



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Gesundheitssystem"
Gesundheitswirtschaft |
Alle Artikel aus:
Gesundheitssystem
Gesundheitswirtschaft
Oft Weiterführung von Kliniken trotz Insolvenz und erhebliche regionale Unterschiede der Versorgungsmerkmale
 Zu den in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Eckzahlen der Krankenhausentwicklung in Deutschland gehört die Anzahl der insolventen oder der Krankenhäuser denen Insolvenz droht durch das "Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsinstitut (RWI)".
Zu den in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Eckzahlen der Krankenhausentwicklung in Deutschland gehört die Anzahl der insolventen oder der Krankenhäuser denen Insolvenz droht durch das "Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsinstitut (RWI)".
In der Pressemitteilung vom 21.6. 2017 zur jüngsten Ausgabe des Krankenhaus-Ratingreports 2017 liest sich dies dann so: "Die wirtschaftliche Lage deutscher Krankenhäuser hat sich im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr nur leicht verschlechtert. Sie war besser als 2012, das in jüngster Vergangenheit das schlechteste Jahr für Krankenhäuser war. 9 Prozent befanden sich 2015 im 'roten Bereich' mit erhöhter Insolvenzgefahr, 12 Prozent im 'gelben' und 79 Prozent im 'grünen Bereich'."
Darüber wie es mit den Kliniken im 'roten Bereich' weiter ging, ob es jedes Jahr andere Kliniken waren oder ein Teil dauerhaft knapp vor der Insolvenz stand oder steht und was mit diesen oder insolventen Kliniken, ihren Beschäftigten und PatientInnen konkret passiert, erfährt man aus den Ratingreports leider nichts.
Dass der dort erzeugte alarmierende Eindruck zum Teil übertrieben sein könnte, zeigt nun eine Antwort der Bundesregierung vom 9. Februar 2018 auf eine Anfrage der FDP-Fraktion zum Insolvenzgeschehen bei Kliniken in den Jahren 2016 und 2017.
Nach einer Umfrage bei den für den Krankenhaussektor zuständigen Bundesländern antwortete die Bundesregierung auf die Frage "Welche Auswirkungen haben und hatten diese Insolvenzen nach Kenntnis der Bundesregierung auf Patienten, Mitarbeiter, Zulieferer und weitere beteiligte Akteure?" wie folgt: "Die von einer Krankenhausinsolvenz bzw. entsprechenden Verfahren betroffenen Länder teilten mit, dass der Klinikbetrieb zum größten Teil unverändert und ununterbrochen weitergeführt wurde. Die meisten von einer Insolvenz betroffenen Krankenhäuser wurden unter neuer Trägerschaft fortgeführt."
Diese für die "Temperatur" der Krankenhausdebatte interessante Feststellung sollte natürlich nicht so verstanden werden, dass Träger von Kliniken, dort Beschäftigte und PatientInnen im Umkreis von wirtschaftlich angeschlagenen Kliniken nicht große Probleme hätten.
Woran einige dieser und anderer Probleme der Krankenhausversorgung aber auch liegen könnten, deuten weitere in der Antwort der Bundesregierung enthaltene Informationen an.
Berichtet wird noch über
• die Anzahl von Planbetten im teil- und vollstationären Bereich insgesamt und pro 1 000 Einwohner nach Bundesländern mit erheblichen Unterschieden zwischen diesen Ländern,
• die zur Verfügung gestellten und ausgezahlten Krankenhausinvestitionsmittel insgesamt und pro Planbett der einzelnen Bundesländer, die ebenfalls erheblich unterschiedlich sind und
• über die Entwicklung von Inflation, Tarifsteigerungen und Landesbasisfallwerten für den Zeitraum 2007 bis 2017.
Die Bundestagsdrucksache 19/702 ist wie alle Bundestagsdrucksachen und -Protokolle kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.4.18
"If Anyone Is Going to Take Away Our Business It Should Be Us" - Warum die Tabakindustrie beim "Aufhören" mit dem Rauchen hilft!
 Eines muss man der Tabakwarenindustrie lassen: Sie ist einfallsreich und nutzt jede Gelegenheit als Anbieterin in allen Situationen um das Rauchen herum präsent zu sein und damit auch zu verdienen. Dies gilt auch für Angebote, die scheinbar nicht zu ihrem traditionellen wirtschaftlichen Interesse zu passen scheinen, wie therapeutischen Produkten (z.B. Kaugummis), die helfen sollen auf das Rauchen bzw. die Aufnahme von Nikotin zu verzichten ("Nicotine replacement therapy (NRT)").
Eines muss man der Tabakwarenindustrie lassen: Sie ist einfallsreich und nutzt jede Gelegenheit als Anbieterin in allen Situationen um das Rauchen herum präsent zu sein und damit auch zu verdienen. Dies gilt auch für Angebote, die scheinbar nicht zu ihrem traditionellen wirtschaftlichen Interesse zu passen scheinen, wie therapeutischen Produkten (z.B. Kaugummis), die helfen sollen auf das Rauchen bzw. die Aufnahme von Nikotin zu verzichten ("Nicotine replacement therapy (NRT)").
Als derartige Stoffe in den 1980er Jahren auf den Markt kamen, gehörte die Tabakwarenindustrie zu den entschiedenen Gegnern. Die Kombination der Nutzung solcher Hilfsmittel mit gezielter Beratung schien auch nachweislich geeignet, mit dem Rauchen aufhören zu können. Trotzdem ändert sich seit 2016 die Position der Tabakwarenindustrie zu diesen Produkten und zwar so, dass sie jetzt selber NRT-Mittel anbietet. Wer jetzt denkt, die Industrie sähe die gesundheitlich schädlichen Wirkungen von Nikotin und Notwendigkeit, das Rauchen aufzuhören endlich ein, irrt sich gewaltig.
In einem am 13. September 2017 online veröffentlichten Aufsatz in der Fachzeitschrift "American Journal of Public Health" kommen die VerfasserInnen auf der Basis von internen Dokumenten der Zigarettenhersteller aus den Jahren 1960 bis 2010 nämlich zu folgenden Erkenntnissen:
— Die Industrie beschäftigte sich bereits seit den 1950er Jahren selber mit der Entwicklung von NRT-Stoffen.
— Nachdem die US Food and Drug Administration (FDA) 1984 diese Stoffe zugelassen hatte, betrachtete die Tabakindustrie dies als Bedrohung und übte auf die Hersteller aus der pharmazeutischen Industrie Druck aus, auf das explizite Marketingziel der völligen Raucherentwöhnung zu verzichten.
— 1996 gelang es den Herstellern der NRT-Mittel ihre Erhältlichkeit zu erleichtern, sie also zu so genannten ohne Verordnung frei erhältlichen Over-the-counter (OTC)-Produkte umzuwidmen.
— In den 1990er Jahren hatte die Tabakindustrie als ein wesentliches Ergebnis mehrerer Bevölkerungsstudien erkannt, dass NRT häufig nicht zur Beendigung des Rauchens führte und dies auch nicht das Ziel der NRT-Nutzer war, sondern eine Art Ergänzung zum Weiterrauchen von eventuell weniger Zigaretten war.
— Als 2009 die FDA damit begann den Tabakmarkt streng zu regulieren, versuchte die Tabakindustrie ihrerseits den tabakbasierten oder -assoziierten Nikotinmarkt möglichst komplett zu besetzen.
— Als gleichzeitig der Tabakindustrie ab dem Jahr 2009 gesetzlich erlaubt wurde, selber nikotinhaltige NRT-Stoffe frei zu verkaufen, begann sie diesen Markt mit Erfolg zu Lasten der pharmazeutischen Industrie zu erobern.
Der Aufsatz Tobacco Industry Research on Nicotine Replacement Therapy: "If Anyone Is Going to Take Away Our Business It Should Be Us von Dorie Apollonio und Stanton A. Glantz ist im "American Journal of Public Health" (107, no. 10: 1636 -1642) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.2.18
Evidenz zu den gesundheitlichen Effekten von E-Zigaretten. Mehr als den Herstellern lieb sein dürfte.
 Über kaum ein anderes gesundheitsbezogenes Konsumprodukt wurde und wird von Herstellern und ihren Kopflangern derartig viel Desinformation verbreitet oder der Eindruck erweckt "man wisse nichts oder nicht genug" über Nachteile und Risiken als bei Tabakprodukten. Dies gilt in gewissem Maß auch für die aktuell angebotenen Ersatzprodukte wie Iqos oder die E-Zigarette.
Über kaum ein anderes gesundheitsbezogenes Konsumprodukt wurde und wird von Herstellern und ihren Kopflangern derartig viel Desinformation verbreitet oder der Eindruck erweckt "man wisse nichts oder nicht genug" über Nachteile und Risiken als bei Tabakprodukten. Dies gilt in gewissem Maß auch für die aktuell angebotenen Ersatzprodukte wie Iqos oder die E-Zigarette.
Insofern sind Informationen darüber, dass es überhaupt einen gesicherten Informationsstand gibt und über dessen wichtigsten Inhalte wichtig.
Zu E-Zigaretten ist dies mit den Ergebnissen eines am 23. Januar 2018 veröffentlichten Berichts einer Expertengruppe der us-amerikanischen "National Academies of Sciences, Engineering and Medicine" möglich. Dessen 680 Seiten umfassender "Consensus Study Report" Public Health Consequences of E-Cigarettes basiert auf der Sichtung und Bewertung von über 800 peer-reviewten wissenschaftlichen Studien zum Thema und ist nach einer kurzen und nach Erfahrung des Verfassers ohne unerwünschte Folgen verlaufenden Anmeldeprozedur über die obige Website komplett kostenlos erhältlich.
Der Bericht kommt insgesamt zu 8 Schlussfolgerungen mit "conclusive evidence, 10 Schlussfolgerungen mit "substantial evidence", 8 Schlussfolgerungen mit "moderate evidence", 12 Schlussfolgerungen mit "limited evidence", 4 Schlussfolgerungen mit "insufficient evidence", 5 Schlussfolgerungen mit "no available evidence". Genaue Definitionen der verschiedenen Evidenzgrade finden sich in dem Report.
Eine Auswahl davon sieht in der Fassung einer Pressemitteilunbg zum Report wie folgt aus:
• There is conclusive evidence that exposure to nicotine from e-cigarettes is highly variable and depends on the characteristics of the device and the e-liquid, as well as on how the device is operated.
• There is substantial evidence that nicotine intake from e-cigarettes among experienced adult e-cigarette users can be comparable to that from conventional cigarettes.
• There is conclusive evidence that in addition to nicotine, most e-cigarettes contain and emit numerous potentially toxic substances.
• There is substantial evidence that except for nicotine, exposure to potentially toxic substances from e-cigarettes (under typical conditions of use) is significantly lower compared with conventional cigarettes.
• There is substantial evidence that e-cigarette use results in symptoms of dependence on e-cigarettes.
• There is moderate evidence that risk and severity of dependence is lower for e-cigarettes than for conventional cigarettes.
• There is moderate evidence that variability in the characteristics of e-cigarette products (nicotine concentration, flavoring, device type, and brand) is an important determinant of the risk and severity of dependence on e-cigarettes.
• There is conclusive evidence that completely substituting e-cigarettes for conventional cigarettes reduces users' exposure to many toxicants and carcinogens present in conventional cigarettes.
• There is substantial evidence that completely switching from regular use of conventional cigarettes to e-cigarettes results in reduced short-term adverse health outcomes in several organ systems.
• There is substantial evidence that e-cigarette use by youth and young adults increases their risk of ever using conventional cigarettes.
• There is conclusive evidence that e-cigarette use increases airborne concentrations of particulate matter and nicotine in indoor environments compared with background levels.
• There is moderate evidence that second-hand exposure to nicotine and particulates is lower from e-cigarettes compared with conventional cigarettes.
• There is no available evidence whether or not e-cigarette use is associated with intermediate cancer endpoints in humans. (An intermediate cancer endpoint is a precursor to the possible development of cancer; for example, polyps are lesions that are intermediate cancer endpoints for colon cancer.)
• There is limited evidence from animal studies using intermediate biomarkers of cancer to support the hypothesis that long-term e-cigarette use could increase the risk of cancer.
• There is no available evidence whether or not e-cigarettes cause respiratory diseases in humans.
• There is moderate evidence for increased cough and wheeze in adolescents who use e-cigarettes, and an increase in asthma exacerbations.
• There is conclusive evidence that e-cigarettes can explode and cause burns and projectile injuries. Such risk is significantly increased when batteries are of poor quality, stored improperly, or are being modified by users.
• There is conclusive evidence that intentional or accidental exposure to e-liquids (from drinking, eye contact, or skin contact) can result in adverse health effects such as seizures, anoxic brain injury, vomiting, and lactic acidosis.
• There is conclusive evidence that intentionally or accidentally drinking or injecting e-liquids can be fatal.
• There is no available evidence whether or not e-cigarettes affect pregnancy outcomes.
• There is insufficient evidence whether or not maternal e-cigarette use affects fetal development."
Bernard Braun, 12.2.18
Von den Grenzen der Lernfähigkeit oder "social responsibility" von Tabakkonzernen. Zulassung von iQOS in den USA und Deutschland
 Die großen Herstellerfirmen von Tabakwaren für den USA-Markt müssen zwischen November 2017 und März 2018 in den USA in 5 ganzseitigen Anzeigen in 50 Zeitungen und über 12 Monate fünfmal pro Woche in zahlreichen Fernsehsendungen aufgrund eines Gerichtsurteils aus dem Jahr 2006 und nach jahrelangen Versuchen dies zu verhindern erklären, dass ihre Produkte massive Gesundheitsrisiken hatten und haben, sie in der Regel davon wussten, auch die so genannten Light-Produkte nicht gesünder waren oder durch Veränderungen der Zusammensetzung von Zigaretten bewusst zusätzlich Sucht erzeugt wurde.
Die großen Herstellerfirmen von Tabakwaren für den USA-Markt müssen zwischen November 2017 und März 2018 in den USA in 5 ganzseitigen Anzeigen in 50 Zeitungen und über 12 Monate fünfmal pro Woche in zahlreichen Fernsehsendungen aufgrund eines Gerichtsurteils aus dem Jahr 2006 und nach jahrelangen Versuchen dies zu verhindern erklären, dass ihre Produkte massive Gesundheitsrisiken hatten und haben, sie in der Regel davon wussten, auch die so genannten Light-Produkte nicht gesünder waren oder durch Veränderungen der Zusammensetzung von Zigaretten bewusst zusätzlich Sucht erzeugt wurde.
Zu den so verbreiteten Wahrheiten gehören z.B. die folgenden: "Smoking is highly addictive. Nicotine is the addictive drug in tobacco.", "Cigarette companies control the impact and delivery of nicotine in many ways, including designing filters and selecting cigarette paper to maximise the ingestion of nicotine, adding ammonia to make the cigarette taste less harsh, and controlling the physical and chemical make-up of the tobacco blend.", "When you smoke, the nicotine actually changes the brain — that's why quitting is so hard." oder "More people die every year from smoking than from murder, AIDS, suicide, drugs, car crashes, and alcohol combined."
Gleichzeitig gibt es von denselben Konzernen neben der ja gesundheitsbezogen auch nicht unstrittigen Markteinführung von E-Zigaretten weltweit neue Produkte, bei denen erneut gesundheitliche Vorzüge hervorgehoben und mögliche Nachteile verschwiegen werden.
Aktuell versucht der Hersteller Philip Morris für den us-amerikanischen Markt die Zulassung von so genannten "Modified Risk Tobacco Product Applications" wie IQOS durch die "U.S. Food and Drug Administration (FDA)" zu erhalten und zwar vorrangig mit dem Hinweis, es handle sich um gesündere Produkte als die normalen Zigaretten. Der Herstellerwunsch beruht darauf, dass in IQOS zwar normaler Tabak enthalten ist, der aber nicht verbrannt, sondern nur erhitzt wird. Die Herstellerfirma kommt daher auch zu dem Schluss, dass "scientific studies have shown that switching completely from cigarettes to the IQOS system can reduce the risks of tobacco-related diseases."
Diese Firma hatte in einem 67 Seiten umfassenden Papier (The Science behind the Tobacco Heating System. A Summary of published scientific articles von Maurice Smith et al. bzw. von Philip Morris International) im altbewährten Stil versucht, mit meist industriefinanzierten Studien u.a. das gesundheitliche Risiko von IQOS kleinzureden und diese Bewertung der FDA schmackhaft zu machen.
Damit hat sich nun ein für die Beratungen des "Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC)" am 24. und 25. Januar 2018 von Wissenschaftlern der FDA erarbeitetes 75 Seiten umfassendes Dokument (FDA Briefing Document. Meeting of the Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC). Modified Risk Tobacco Product Applications (MRTPAs)) ausführlich beschäftigt.
Nach Beratung beider Dokumente am 24./25. Januar 2018 kommt das WissenschaftlerInnen-Komitee u.a. zu folgenden Empfehlungen an die letztlich entscheidende FDA-Administration:
• Mit 8 zu 1 stimmen sie zu, dass Philip Morris mit der Aussage werben darf, IQOS reduziere die Exposition gegenüber schädlichen oder potenziell schädlichen chemischen Stoffen.
• Mit 8 zu 1 lehnen sie es dann aber ab, dass Philip Morris für das neue Produkt IQOS mit dem Hinweis werben darf, es sei weniger gesundheitsschädlich als konventionelle Zigaretten.
• Mit 5 zu 4 lehnen sie auch die Nutzung der Werbungaussage ab, mit IQOS zu rauchen wäre weniger riskant als weiter normale Zigaretten zu rauchen.
Ob die FDA diesen Empfehlungen ihrer wissenschaftlichen Berater folgen wird, ist im Moment offen. Aber selbst, wenn sie ihnen folgt, liegt der FDA bereits ein Antrag B vor, das Produkt ohne die genannten Werbeaussagen zuzulassen. Wie in anderen Fällen auch, wird es damit wahrscheinlich zu einem jahrelangen gerichtlichen und außergerichtlichen Ringen um gesundheitspositive Formulierungen kommen.
Für Deutschland, wo die Firma Philip Morris auch seit einiger Zeit für IQOS wirbt, liegt bisher eine Vorläufige Risikobewertung von Tobacco Heating-Systemen als Tabakprodukte des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) vom 27. Juli 2017 vor. Danach plant das Institut "eigene Untersuchungen zu den Emissionen dieses Gerätes und gegebenenfalls anderer kommerziell erhältlicher THS", die "im Herbst 2017 beginnen werden".
Zu hoffen ist, dass sich das BfR seitdem auch intensiv mit dem in dem FDA-Dokument zusammengestellten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auseinandersetzt und nicht völlig eigene und möglicherweise problematische Quellen nutzt und Wege geht. Wie das Beispiel Glyphosat zeigt, wäre dies dem Institut durchaus zuzutrauen. Wie das BfR etwa "seine Bewertung des Totalherbizids Glyphosat über viele Seiten aus dem Zulassungsantrag von Monsanto abgeschrieben" hat - so eine bisher nicht widerlegte Kritik -, kann jedermann anhand der auf der Glyphosat-kritischen Website des Umweltinstituts München erhältlichen Originaldokumente selber klären.
Der FDA-Bericht wertet auch eine Reihe unabhängiger wissenschaftlicher Studien aus und kommt auf dieser Basis z.B. zu folgenden Aussagen:
• "In a December 8, 2017 amendment to the applications, the applicant (gemeint ist Philip Morris) identified between 53 and 62 compounds that are at higher levels in the aerosol of the HeatSticks compared to the smoke of the reference cigarette 3R4F."
• Und: "As summarized above, all the 54 measured HPHCs (harmful and potentially harmful constituents) produced by the three HeatSticks were substantially reduced compared to the 3R4F cigarette on a per-cigarette basis. However, based on the results, consuming 10 HeatSticks exposes users to levels of acetaldehyde, acetamide, acrylamide, ammonia, butyraldehyde, catechol, formaldehyde, mercury, propylene oxide, and pyridine that are comparable to smoking 1-3 cigarettes. … Using this model, any increased exposure increases cancer risk."
Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass sich diese Erkenntnis auch in der Mitteilung des BfR findet: "Die Biomarker für einige Stoffe waren jedoch weniger stark reduziert als die entsprechenden Gehalte im Dampf der untersuchten Produkte. Verminderte Gehalte im Dampf führen somit nicht zwangsläufig zu einer im gleichen Maße verminderten Exposition des Verbrauchers gegenüber diesen gesundheitsschädlichen Stoffen."
Und außerdem stellt das BfR bereits in seiner Mitteilung im Juli 2017 fest, was die Hersteller durch geschickte Werbefloskeln (z.B. "Die neue Art, Tabak zu genießen.") zu verbergen suchen: "Die in den Dämpfen erreichbaren Nikotingehalte liegen in der gleichen Größenordnung wie bei herkömmlichen Tabakzigaretten. Daher muss von einem vergleichbaren Suchtpotential ausgegangen werden."
Bernard Braun, 1.2.18
Vertrauen und Hoffen auf die dauerhafte Wirkung von Subventionen und Selbstverpflichtung ist gut, permanente Kontrolle aber besser
 In einer Reihe von Verfahren gegen die Tabakindustrie vor us-amerikanischen Gerichten wurde in den letzten Jahrzehnten u.a. durch hunderttausende im Internet zugänglich gemachte Dokumente und auch in Deutschland erstellte Dokumentationen nahezu lückenlos nachgewiesen, dass und wie die Hersteller gesundheitsgefährdende und suchtfördernde Inhaltsstoffe in ihren Produkten vorsätzlich platzierten und u.a. mit Hilfe abhängiger Wissenschaftler zu verbergen suchten. Auch wenn Tabakrauchen niemals uneingeschränkt gesund sein kann, hätte man angesichts der enormen finanziellen Strafen und des Verlustes an Glaubwürdigkeit erwarten können, dass die Tabakindustrie von sich aus alles tut, um möglichst viele bekannte gesundheitlich problematische Wirkungen ihrer Produkte zu vermeiden.
In einer Reihe von Verfahren gegen die Tabakindustrie vor us-amerikanischen Gerichten wurde in den letzten Jahrzehnten u.a. durch hunderttausende im Internet zugänglich gemachte Dokumente und auch in Deutschland erstellte Dokumentationen nahezu lückenlos nachgewiesen, dass und wie die Hersteller gesundheitsgefährdende und suchtfördernde Inhaltsstoffe in ihren Produkten vorsätzlich platzierten und u.a. mit Hilfe abhängiger Wissenschaftler zu verbergen suchten. Auch wenn Tabakrauchen niemals uneingeschränkt gesund sein kann, hätte man angesichts der enormen finanziellen Strafen und des Verlustes an Glaubwürdigkeit erwarten können, dass die Tabakindustrie von sich aus alles tut, um möglichst viele bekannte gesundheitlich problematische Wirkungen ihrer Produkte zu vermeiden.
Dass dies nicht so sein muss, zeigt eine jetzt veröffentlichte Studie kanadischer Wissenschaftler, die untersuchte wie sich der Gehalt von tabakspezifischen Nitrosaminen, einem potenten Karzinogen, in Tabakprodukten zwischen 2005 und 2011/12 verändert hat.
Diese Art von Nitrosaminen entsteht während des Produktionsprozesses von Tabakprodukten. Sie sind daher vermeidbar. In der kanadischen Provinz Ontario erhielten die Hersteller für dafür geeignete technische Anlagen sogar ab dem Beginn der 2000er-Jahre staatliche Unterstützung.
Die Wissenschaftler untersuchten nun die Entwicklung des Nitrosamingehalts der Zigaretten von Herstellern, die rund 90% der in Kanada produzierten Zigaretten produzieren.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
• Der Anteil der karzigonen Nitrosamine nahm nach der Subventionierung von Maßnahmen, die das Entstehen dieser Stoffe während der Herstellung verhinderten, zwischen 2005 und 2007 ab.
• Zwischen 2007 und 2011/12 nahm der Anteil aber wieder kontinuierlich zu.
• Obwohl die Werte 2011/12 unter dem historischen Allzeit-Hoch um das Jahr 2000 lagen, waren sie 2 bis 40 Mal höher als im Jahr 2007.
• Dass diese Entwicklung etwas mit bewussten Entscheidungen der Unternehmen zu tun hat, zeigt sich darin, dass sie nicht bei den Produkten aller Hersteller zu beobachten war.
Auch wenn die Autoren darauf hinweisen, dass sie nicht untersucht haben, ob diese Entwicklung gesundheitliche Risiken oder Krebserkrankungen beeinflusst hat, stellen sie ausdrücklich das bloße Vertrauen in die Selbstverpflichtung der Industrie in Frage, den möglicherweise durch Rauchen verursachten gesundheitlichen Schaden zu minimieren.
Und auch dem angesichts der Vielzahl gesundheitlich bedenklicher Inhaltsstoffe in Tabakprodukten beliebten Argument, die Reduktion eines Stoffes verringere das gesundheitliche Risiko praktisch nicht (salopp ausgedrückt ändere der Sturz aus dem 19. statt dem 20. Stockwerk an den Sturzfolgen nichts), widersprechen die Autoren vehement: "Nevertheless, companies bear a responsibility to reduce the levels of known carcinogens and other toxicants to the full extent possible even if the likelihood of lower harm is modest."
Ob dies bei den deutschen Herstellern von Tabakprodukten besser aussieht, ist im Zeitverlauf nicht untersucht. Darauf zu vertrauen oder den Selbstverpflichtungen der Hersteller zu glauben, könnte nach den Erfahrungen in Kanada falsch sein.
Die am 8. Juni 2017 in der Fachzeitschrift "Nicotine & Tobacco Research" erschienene Studie Trends Over Time in Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNAs) in Whole Tobacco and Smoke Emissions From Cigarettes Sold in Canada von Christine D. Czoli und David Hammond ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.6.17
Weite Teile der Pharmaindustrie in der wunderbaren Gewinnwelt von Ferrari und Porsche - und manche noch weit darüber
 Ein großer Teil der Beiträge von Ärzten, Krankenhäusern und Produzenten von Gesundheitsprodukten zur gesundheitspolitischen Debatte kreist um fehlende oder u.a. für die immer gewaltigen Investitionen zur Entwicklung neuer Produkte zu geringen Erträge. Einen rhetorischen Spitzenplatz nimmt hierbei die Pharmabranche ein.
Ein großer Teil der Beiträge von Ärzten, Krankenhäusern und Produzenten von Gesundheitsprodukten zur gesundheitspolitischen Debatte kreist um fehlende oder u.a. für die immer gewaltigen Investitionen zur Entwicklung neuer Produkte zu geringen Erträge. Einen rhetorischen Spitzenplatz nimmt hierbei die Pharmabranche ein.
Dass dies nicht der einzige Spitzenplatz ist, zeigt nun ein aktuell möglicher Vergleich eines anerkannten Indikators für die Ertragssituation von Wirtschaftsunternehmen. Es geht um die so genannte EBIT-Marge, die den Anteil des gesamten Gewinns vor Steuern und anderen Abzügen (Earnings Before Interest and Taxes) am Gesamtumsatz angibt. Je höher desto besser.
Für das Jahr 2015 schwankt diese Marge nach entsprechenden Bilanzanalysen der Unternehmensberatung Ernest & Young (trotz der aktuellen Zweifeln an der Verlässlichkeit dieser Branche - siehe die Debatte um die Beratungsleistung beim Verkauf des Flughafens Hahn - trauen wir ihrer EBIT-Analyse) zwischen den Branchen erheblich. Und: "Eine zweistellige EBIT-Marge spricht in der Regel für ein gesundes und profitables Unternehmen."
Der Vergleich zwischen Pharmaunternehmen, Herstellern von PKW's und Herstellern von PKW-Zubehör, also volkswirtschaftlich durchaus bedeutenden Unternehmen zeigt für das Jahr 2015 folgendes:
• Die EBIT-Marge der Autozulieferer betrug 7,4%, die als "Rekordwert" bewertet wird.
• In der Automobilindustrie gab es je nach Hersteller leichte Unterschiede: Toyotas Marge betrug 10,3%, Mercedes-Benz landete bei 9% und BMW bei 10,4%. Dass die Spannbreite in dieser Branche durchaus noch größer sein kann, zeigt eine differenziertere Statistik für das Jahr 2013. Damals schwankte die Marge zwischen 18% für Porsche, 12,5% für Ferrari Maserati und 5% bis 7% bei den meisten anderen Herstellern. Einige Unternehmen hatten allerdings auch negative Werte.
• Die EBIT-Marge der TopTen der Pharmabranche betrug 2015 dagegen rund 28%. Auch hier gab es große Unterschiede: Biotech-Unternehmen landeten zum Teil bei Margen von über 40%, einige der großen Pharmaunternehmen mussten sich mit kleineren, aber immer noch zweistelligen Margen begnügen. Die Margen der auf den Plätzen 11 bis 20 stehenden Unternehmen betrugen z.B. immer noch durchschnittlich 19,6%. Die Margen haben durchweg von 2014 auf 2015 um bis zu zweistellige Prozentbeträge zugenommen. Richtig ist aber auch, dass es vor 2014 bei einigen Unternehmen niedrigere Margen gab, was aber im Nachhinein lediglich als "Schwächephase" bewertet wird. Ernest & Young titelt daher im Mai 2016: "Weltweit größte Pharma-Unternehmen wachsen kräftig - Big Biotech legt am stärksten zu."
Auch wenn das Streben von Managern und Anteilseignern nach hohen zweistelligen oder gar dreistelligen EBIT-Margen nachvollziehbar sein mag, rechtfertigen die aktuellen Werte in der Pharmaindustrie in keiner Weise das Krisenlamento, wenn gesundheitspolitisch z.B. über die teilweise exorbitanten Preise einiger Arzneimittel diskutiert wird.
Die Angaben zur Margensituation bei den Autozulieferern stammen aus der Wirtschaftswoche vom 7.7.2016.
Die 2015er-EBIT-Daten zur Pharmabranche finden sich in einem Report von Ernest & Young.
Mehr über die Margensituation ausgewählter Pkw-Hersteller im Jahr 2015 erfährt man mit Zugangsbeschränkungen bei statistik.com und hier uneingeschränkt für 2013.
Bernard Braun, 25.7.16
Keine "schwarze Schafe" sondern Schattenseite der gewinnorientierten Gesundheitswirtschaft?! Die "Fälle" Olympus und Valeant
 Über das Verhalten der Pharmaindustrie oder anderer Produzenten von Gesundheitsgütern gibt es zahlreiche negative Urteile, Behauptungen oder Erwartungen, die von den damit gemeinten Unternehmen und ihren Verbänden fast reflexartig als Vorurteile oder als Herauspicken weniger oder kleiner "schwarzer Schafe" abgetan werden. Konkret werden beispielsweise exorbitant hohe Preise der Produkte mit den milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungskosten begründet und stets das Image des vor allem dem Wohl des Patienten verpflichteten Unternehmens gepflegt.
Über das Verhalten der Pharmaindustrie oder anderer Produzenten von Gesundheitsgütern gibt es zahlreiche negative Urteile, Behauptungen oder Erwartungen, die von den damit gemeinten Unternehmen und ihren Verbänden fast reflexartig als Vorurteile oder als Herauspicken weniger oder kleiner "schwarzer Schafe" abgetan werden. Konkret werden beispielsweise exorbitant hohe Preise der Produkte mit den milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungskosten begründet und stets das Image des vor allem dem Wohl des Patienten verpflichteten Unternehmens gepflegt.
Dafür, ob dies wirklich so oder völlig anders ist, gibt es fast nie oder nur selten griffige Belege bzw. die sprichwörtlichen "rauchenden Colts".
Umso interessanter sind zwei gut mit Originaldokumenten belegte Fälle eines der weltweit größten Anbieter von diagnostischen Geräten (Olympus) und eines großen kanadischen Arzneimittelherstellers (Valeant Pharmaceuticals), die beide erhebliche Zweifel an der positiven Selbstdarstellung zu lassen.
Im Falle der Firma Olympus geht es um endoskopische Geräte der Firma, die durch ihre Konstruktion so schwer oder gar nicht keimfrei gemacht werden können, dass Patienten durch den Einsatz dieser Geräte infiziert werden können. Dies bemerkte u.a. eines der größten Krankenhäuser im US-Bundesstaat Kalifornien und Anwender dieser Geräte, das "Ronald Reagan Medical Center" der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) u.a. durch den Tod von drei Patienten und die schwere Erkrankung von fünf weiteren Patienten an resistenten Bakterien, die im Gerät existieren konnten und durch dessen Gebrauch übertragen wurden. Nachdem das Krankenhaus diesen Konstruktionsfehler und die unerwünschten Folgen dem Hersteller mitteilte und den Ersatz von 35 Geräten verlangte, weigerte sich Olympus mit einer einmaligen Ausnahme. Stattdessen bot die Firma dem Krankenhaus mit dem es im Übrigen jahrelang eng zusammenarbeitete, die Lieferung neuer Geräte zu einem Preis an, der 28% höher lag als der, den sie selber wenige Monate vorher für die dann fehlerhaften Geräte verlangt und erhalten hatte. Auf den Hinweis, die Firma versuche damit von einer Versorgungskrise zu profitieren (die Firma sprach für das betreffende Geschäftsjahr selber von einer "record breaking" Gewinnerhöhung von 13%), die sie durch ihre Gerätemängel selber geschaffen habe, bot Olympus lediglich an, über Rabatte nachzudenken, wenn das Krankenhaus mehr Geräte bestellen würde.
Nach der bundesweiten Warnung vor den Risiken der Geräte durch die "Food and Drug Administration (FDA)" behauptete Olympus sowohl gegenüber den Angehörigen eines verstorbenen Patienten als auch im Rahmen eines ersten Gerichtsverfahrens, die Schuld an den Vorfällen läge bei Beschäftigten der Klinik, die sich nicht an die Instruktionen des Herstellers gehalten hätten. Daran hielt Olympus trotz der Feststellung der FDA fest, die Infektionen würden selbst dann stattfinden, wenn sich die Kliniken an die Herstellerhinweise hielten. Und auch eine Untersuchung des US-Senats, in der für den Zeitraum 2012 bis 2015 19 schwere Infektionsausbrüche ("superbug outbreaks") in den USA und Europa durch Olympusgeräte dokumentiert sind und auch die mangelhafte oder zögerliche Aufklärung von Kliniken durch die Firma kritisiert wurde, änderte am aktuellen Verhalten der Firma bisher nichts. Das UCLA-Krankenhaus kauft die Geräte mittlerweile bei einem anderen Hersteller.
Dass es sich nicht um einen einmaligen "Ausrutscher" der Firma oder einzelner Mitarbeiter handelte, zeigt schließlich die Tatsache, dass Olympus bereits in 2016 einer Strafzahlung von 646 Millionen US-Dollar zustimmte, damit weitere Ermittlungen wegen massiver Verstöße gegen geltendes US-Recht (u.a. Verbot diverser finanzieller Vergünstigungen für Ärzte) eingestellt werden.
Die ganze Geschichte, verfasst von Chad Terhune und Melody Petersen, ist versehen mit Auszügen von Mails der Firma an die Klinik am 25. März 2016 unter der Überschrift Device Maker Olympus Hiked Prices For Scopes As Superbug Infections Spread in der Los Angeles Times und den Kaiser Health News veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Ebenfalls in dem von jedermann abonnierbaren aber fast ausschließlich über US-Ereignisse berichtende Newsletter "Kaiser Health News" erschien am 28. März 2016 der Bericht Pharmaceutical Company Has Hiked Price On Aid-In-Dying Drug von April Dembosky.
Für das weitere Verständnis sei daran erinnert, das im Bundesstaat Kalifornien ähnlich wie z.B. schon länger im Bundesstaat Oregon nach langen öffentlichen Debatten mit einer parlamentarischen Mehrheit ein Gesetz verabschiedet wurde - das so genannte "aid-in-dying law" -, das bestimmten todkranken PatientInnen die Selbsttötung mit legal zugänglichen bzw. verschreibungspflichtigen Medikamenten ermöglicht. Selbstverständlich kann und darf man dazu weiterhin verschiedener Meinung sein und diese Möglichkeit ethisch ablehnen.
Das Verhalten des Herstellers eines dafür gut geeigneten und die PatientInnen relativ gering belastenden Arzneimittels hat aber nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun.
Das Mittel Seconal auch mit der Bezeichnung Secobarbital erhältlich, wurde im Jahr 1930 als Schlafmittel entwickelt und erwies sich bei einer Überdosierung oder in Kombination mit Alkohol als potenziell tödlich. Daher gilt es auch als "Mittel der Wahl" für die Selbsttötung nach dem geltenden Gesetz.
Im Jahr 2009 kostete eine tödliche Dosis von maximal 100 Kapseln (dies wird oft genannt, wird aber ebenso häufig bestritten und für zu hoch erklärt) weniger als 200 US-Dollar. Während der folgenden sechs Jahre stieg der Preis für diese Dosis auf 1.500 US-Dollar, um nach dem Kauf des Herstellers durch die Firma Valeant im Februar 2015 auf 3.000 US-Dollar zu steigen.
Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Dieselbe Firma erhöhte nach weiteren Aufkäufen anderer Pharmaunternehmen deren Preise um bis zu 500%. Sie kann dies vor allem bei dem vor 80 Jahren entwickelten Seconal nicht durch Forschungskosten rechtfertigen, sondern nutzt nur ohne jegliche Zurückhaltung das Fehlen von ähnlich wirksamen Generika oder den bei der 400-Dollar-Alternative eines Cocktails von drei Medikamenten erforderlichen Aufwand.
Auch wenn das Verhalten der kanadischen Firma Valeant in Deutschland nicht 1:1 möglich wäre, unterstreicht es, dass das Vertrauen auf ein "vernünftiges Marktverhalten" oder das Sichverlassen auf freiwillige Selbstverpflichtungen bzw. Verhaltens-Kodes solcher Firmen nicht zwangsläufig gegen "schwarze Schafe" hilft und stattdessen gezielte staatliche Regulation notwendig ist.
Bernard Braun, 30.3.16
Gesundheitswirtschaft: "Health sells" aber wovor öffentliche Verbraucherschützer schützen sollten.
 Es vergeht kein Monat in dem nicht irgendein wissenschaftliches Institut, ein Wirtschaftsverband, ein Bundes- oder Landesministerium, eine Unternehmensberatung, eine Industrie- und Handelskammer oder eine Autorengemeinschaft aus diesen Einrichtungen, das hohe Lied von der goldenen Zukunft und der konjunkturtragenden Bedeutung der Gesundheitswirtschaft anstimmt. Auf einen dieser Reports soll hier wegen einer relativ seltenen aber zunächst inhaltlich vielversprechenden Besonderheit hingewiesen werden.
Es vergeht kein Monat in dem nicht irgendein wissenschaftliches Institut, ein Wirtschaftsverband, ein Bundes- oder Landesministerium, eine Unternehmensberatung, eine Industrie- und Handelskammer oder eine Autorengemeinschaft aus diesen Einrichtungen, das hohe Lied von der goldenen Zukunft und der konjunkturtragenden Bedeutung der Gesundheitswirtschaft anstimmt. Auf einen dieser Reports soll hier wegen einer relativ seltenen aber zunächst inhaltlich vielversprechenden Besonderheit hingewiesen werden.
Zunächst stimmt das Ende Februar 2015 erschienene Gutachten zur ökonomischen Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg inhaltlich das gewohnte Lied an. Etwas anders sehen die "Sänger", d.h. der Auftraggeber "Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH" aus. Dieser ist nämlich eine public-private-Partnership-Tochtergesellschaft der Handelskammer und der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburgs. Interessant ist nun, ob sich dies irgendwie bei der Darstellung und Bewertung der gesundheitswirtschaftlichen Grunddaten bemerkbar macht!?
Der Report listet dazu die folgenden uneingeschränkt positiv bewerteten ökonomischen Eckdaten auf:
• Der Anteil der Gesundheitswirtschaft an der regionalen Gesamtwirtschaft ist von 8,4 Prozent im Jahr 2005 auf 9,4 Prozent im Jahr 2013 gestiegen.
• Die Bruttowertschöpfung (BWS) lag 2013 bei enormen 8,2 Milliarden Euro.
• Die jährliche Steigerung der BWS im Untersuchungszeitraum in der Gesamtwirtschaft betrug 1,6 Prozent, in der Gesundheitswirtschaft dagegen 3,1 Prozent - und dieser Vorsprung war im Krisenjahr 2009 sogar deutlich größer.
• All dies schlug sich last but not least in einer überdurchschnittlichen Wachstumsrate der Beschäftigung von rund 2 Prozent nieder.
• Und auch die Zukunft sieht mit Hilfe geeigneter "Kellen" gut aus: "Der Zweite Gesundheitsmarkt weist somit insbesondere hinsichtlich der Bruttowertschöpfung Wachstumspotentiale auf, die es zukünftig auszuschöpfen gilt."
Auch wenn die Studie sich auf die "ökonomische Bedeutung" der Gesundheitswirtschaft konzentriert, und dies dem vorrangig dem Umsatz- und Gewinninteressen von Wirtschaftsunternehmen verpflichteten Mitherausgeber "Handelskammer Hamburg" vollkommen genügen mag, stellt sich aber doch die Frage, ob dies dem Zweiten im Bunde, nämlich der dem Gemeinwohl verpflichteten "Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz" genügen darf.
Auch einer noch so von Umsatz- und damit auch Gewinnzahlen der Gesundheitswirtschaft eingenommenen Behörde für Gesundheit hätte es eigentlich zu Ohren gekommen sein müssen, dass ein mehr oder weniger großer, aber jedenfalls spürbarer Teil der im ersten (10% bis 20%) aber vor allem zweiten Gesundheitsmarkt angebotenen Güter und Dienstleistungen bestenfalls keinen nachweisbaren gesundheitlichen Nutzen hat und der Verbraucher eigentlich zumindest vor deren Angebot als Gesundheits-Gut bewahrt werden sollte. Anstatt alles zu tun, um die für das Verhalten großer Teile der Bevölkerung hohe Bedeutung der Prädikate Gesundheit oder gesund abzusichern, legitimiert die Hamburger Behörde euroselig das gegenüber Inhalten gleichgültige Primat von Umsätzen, Gewinnen und Arbeitsplätzen.
Das Elend dieser Taubheit ist, dass alle z.B. durch die Einnahme verordnungspflichtiger aber qualitativ problematischer Arzneimittel oder den Konsum von fragwürdigen Vitamin- oder Nahrungsergänzungsmittel-Cocktails ausgelösten behandlungsbedürftigen Nebenwirkungen oder das Verschleppen und damit möglicherweise Teurerwerden der Behandlung von krankhaften Erscheinungen der Gesundheitswirtschaft nicht als eine Art externalisierte Kosten in Rechnung gestellt wird und deren Bilanz dann deutlich weniger strahlt. Das Gegenteil trifft zu, d.h. auch die Bewältigung der ungeplanten oder auch billigend in Kauf genommen Effekte eines Teils der Gesundheitswirtschaftsangebote erhöht ja noch ihren Umsatz. Auf die Idee, dass ein etwas niedrigerer Umsatz der Gesundheitswirtschaft bzw. die rigorose Entfernung von Produkten vom Gesundheitsmarkt, die zwar gesund zu sein behaupten, es aber nicht sind, mehr Gesundheit bedeuten können, kommen leider die Hamburger Behörde und viele andere öffentliche Akteure in diesem Feld nicht.
Nähert sich dann doch einmal einer dieser Gesundheitswirtschafts-Berichte einem Produktbereich wie dem der Arzneimittel, in dem es jahrzehntelange Bemühungen um die Entfernung unwirksamer oder nur schädlicher Mittel oder die Verhinderung neuer, qualitativ ebenfalls problematischer Güter gibt, werden diese Bemühungen um Gesundheit ignoriert und stattdessen das Bürokratielamento angestimmt.
In dem ebenfalls gerade erschienenen und allein von der IHK Lübeck herausgegebenen "Branchenportrait Gesundheitswirtschaft" werden nach dem gewohnten Freudensturm eine Reihe von lästigen Jubelhindernissen aufgezählt:
• "Mit einer überbordenden Bürokratie und steigenden Produktionskosten werden Bundes- und EU -politische Themen als gravierende Hemmnisse benannt."
• Und: "Allerdings werden die anhaltenden Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen nicht spurlos am Handel mit Arzneimitteln vorübergehen. Im Zuge restriktiverer Vorgaben wird es zunehmend bedeutender, die Produktpalette weiter zu diversifizieren und stärker an die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung auszurichten."
• Und schließlich werden "die zunehmenden Restriktionen und der teilweise damit einhergehende Preisverfall bei Arzneimitteln als größte Risiken eingestuft."
Ein 9-seitiges Management Summary der im Auftrag der Gesundheitswirtschaft GmbH Hamburg erstellten Untersuchung der ökonomischen Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg verfasst von Dennis A. Ostwald, Benno Legler und Marion Cornelia Schwärzler, ist komplett kostenlos erhältlich - die Langfassung nicht.
Das Branchenportrait Gesundheitswirtschaft - Struktur und Perspektiven einer Zukunfts-Branche der IHK Lübeck gibt es auch kostenlos.
Bernard Braun, 16.4.15
"Wir verlassen die neidfreie Zone": GKV-Vorstandsmitglieder und Chefärzte mit Zusatzvertrag lieber weglesen
 Auch in den USA wird immer wieder über siebenstellige Dollareinkommen von Chirurgen oder "Chief Executive Officer (CEO)" verschiedenster Leistungsanbietern und -erbringern im Gesundheitswesen diskutiert. Auf einem anderen, nämlich niedrigeren Niveau geschieht dies seit einigen Jahren auch, wenn es um einkommenssteigernde Zusatzverträge mit ärztlichen Leitungskräften in Krankenhäusern oder um die veröffentlichungspflichtigen aber durchweg sechsstelligen Euro-Gehälter von Vorstandsmitgliedern einer gesetzlichen Krankenkasse geht.
Auch in den USA wird immer wieder über siebenstellige Dollareinkommen von Chirurgen oder "Chief Executive Officer (CEO)" verschiedenster Leistungsanbietern und -erbringern im Gesundheitswesen diskutiert. Auf einem anderen, nämlich niedrigeren Niveau geschieht dies seit einigen Jahren auch, wenn es um einkommenssteigernde Zusatzverträge mit ärztlichen Leitungskräften in Krankenhäusern oder um die veröffentlichungspflichtigen aber durchweg sechsstelligen Euro-Gehälter von Vorstandsmitgliedern einer gesetzlichen Krankenkasse geht.
Im Lichte des gerade für 2014 veröffentlichten achtstelligen Dollar-Gesamteinkommens des CEOs des us-amerikanischen Krankenversicherungs- und Gesundheitsdienstleistungsunternehmen UnitedHealth ("A diversified health company that offers products and services through two platforms - UnitedHealthcare provides health care coverage and benefits services, and Optum provides information and technology-enabled health services."), wird klar, warum derartige Unternehmen und ihre Führungskräfte erfolgreich alles dafür getan haben, dass das US-Krankenversicherungs- und Gesundheitsversorgungssystem auch nach dem "Affordable Care Act (ACA)" von B. Obama massiv von gewinnorientierten Privatunternehmen bestimmt wird und einer öffentlichen Struktur gegen diese ökonomischen Interessenten keine Chance eingeräumt wird (siehe zuletzt "Das Letzte was im US-Gesundheitssystem gebraucht wird, sind noch mehr Füchse als Hühnerstallwache" - Obamacare und was nun?). Klar wird aber auch, was u.a. den Reiz für manche GKV-Führungskraft ausmacht, ihre Körperschaft öffentlichen Rechts als "Unternehmen", seine de facto-Eigentümer/Mitglieder/Shareholder als "Kunden" und zu viel eingezogene Beiträge ihrer Mitglieder aktiengesellschaftlich als "Dividende" zu bezeichnen. Vom Unternehmenssprech bis zu solchen Einkommen ist zwar ein weiter Weg, aber anfangen kann man ihn ja schon mal.
Stephen Hemsley kassierte eine Gesamtvergütung von 66.125.208 US-Dollar. Diese Vergütung setzte sich aus dem "mageren" eigentlichen Gehalt von 1.300.000 US-Dollar und einer Vielzahl vom Umsatz, dem Gewinn und dem Erreichen dreier Ziele (z.B. Versichertenzufriedenheit) abhängigen geldwerten Aktienoptionen zusammen. Dass derartige Einkommen bei UnitedHealth keine Ausnahme darstellen, zeigt sich darin, dass derselbe CEO 2013 immerhin noch 23.100.000 US-Dollar an Gesamtvergütung erhielt. Das Unternehmen mit Sitz in Minnesota, und dort zweitgrößtes Unternehmen, setzte 2014 mit rund 18.000 Mitarbeitern 130 Milliarden US-Dollar um und erzielte einen Gewinn von 5,6 Milliarden US-Dollar. Diese ökonomischen Rahmenbedingungen und die Erwartungen für die zukünftige Entwicklung ermöglichten es dem Unternehmen Ende 2015 für 12,8 Milliarden US-Dollar eine Spezialfirma für Arzneimittelmanagement zu kaufen.
Wer noch Genaueres z.B. über die Vielfalt von Aktienoptionen wissen will, findet es u.a. in dem Artikel UnitedHealth CEO Stephen Hemsley made more than $66 million in 2014 von Patrick Kennedy in der Zeitschrift "Star Tribune" vom 7. April 2015.
Bernard Braun, 9.4.15
Das Neueste aus dem Reich der "Gesundheits"wirtschaft: Reine Muttermilch mit einem kräftigen Schuss Kuhmilch.
 Auch wer die lange Liste der vorsätzlich oder fahrlässig bestenfalls unschädlichen (z.B. zahlreiche Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungsmittel) oder auch gesundheitsgefährdenden (z.B. Silikonimplantate für die weibliche Brust) Produkte der Gesundheitswirtschaft zu kennen glaubt, merkt in regelmäßigen Abständen, dass die schlimmsten Befürchtungen im Zeichen hemmungsloser Gewinnsucht noch getopt werden können.
Auch wer die lange Liste der vorsätzlich oder fahrlässig bestenfalls unschädlichen (z.B. zahlreiche Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungsmittel) oder auch gesundheitsgefährdenden (z.B. Silikonimplantate für die weibliche Brust) Produkte der Gesundheitswirtschaft zu kennen glaubt, merkt in regelmäßigen Abständen, dass die schlimmsten Befürchtungen im Zeichen hemmungsloser Gewinnsucht noch getopt werden können.
Für das neueste Beispiel muss man zuerst einmal auf den Gedanken kommen, es gäbe hier überhaupt etwas aufzudecken. Es geht um die Güte von über Internetanbieter erhältlichen Muttermilchkonserven. Eltern, die für ihr Kind Muttermilch kaufen wollen, machen dies, weil die Mutter ihr Kind nicht selber stillen kann oder will, weil sie ihrem Kind alle nachgewiesenen Vorteile der Muttermilch zugutekommen lassen wollen und/oder weil - und hier endet die reine Geldmacherei mit teurer "Muttermilch" - ihr Kind gegen Kuhmilch allergisch ist oder sie nicht verträgt. Trotz einiger Warnungen der US Food and Drug Administration (FDA) vor nicht eindeutig überwachten "SpenderInnen" und Anbietern nahm die Anzahl der auf entsprechenden Websites plazierten Angebote von Muttermilch ständig auf aktuell mindestens 13.000 pro Jahr zu.
Eine Gruppe von us-amerikanischen Kinderernährungsexperten und Biologen beschloss nun, stichprobenartig und anonym zu überprüfen, ob die Qualitätsversprechen der Wirklichkeit entsprechen. Sie bestellten dafür 102 der als Muttermilch angepriesenen Produkte.
Das Ergebnis einer aufwändigen zweistufigen Inhaltsanalyse lautete:
• 11 der Produkte (11%) enthielten eindeutig nicht nur menschliche, sondern auch Kuhmilch.
• Zehn dieser 11 Produkte enthielten mindestens 10% flüssige Kuhmilch, was den häufig im Nahrungsmittelgeschäft benutzten Hinweis unglaubwürdig macht, das Produkt enthielte lediglich "Spuren", die "rein zufällig" in es gekommen sind. Hier wurde also mit voller Absicht gemixt und damit die genannten gesundheitlichen Risiken billigend in Kauf genommen.
Auch hier erweist sich also die Hoffnung auf Skrupel, Selbstkontrolle oder "social responsibility" der Hersteller solcher "Gesundheits"produkte als problematisch und könnten sich wesentlich härtere Kontrollen durch unabhängige öffentliche Einrichtungen und entsprechende Strafen bei so eindeutig schädigendem Verhalten als die einzig wirksame Alternative erweisen.
Dies gilt leider auch für den Appell der WissenschaftlerInnen, Eltern und Kinderärzte sollten sich trotz ihrer relativen Ohnmacht dieser Risiken bewusst sein: "Because buyers have little means to verify the composition of the milk they receive, all should be aware of the possibility that it may be adulterated. Pediatricians who care for infants should be aware that milk advertised as human is available via the internet, and some of it may not be 100% human milk."
Der Aufsatz Cow's Milk Contamination of Human Milk Purchased via the Internet von Sarah A. Keim et al. ist kostenlos online erschienen und wird gedruckt am 5. Mai 2015 in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (Volume 135) erscheinen.
Bernard Braun, 6.4.15
Was bringt Wettbewerb für die Qualität der Gesundheitsversorgung? Gemischte Ergebnisse einer britischen Übersichtsarbeit
 Den einen ist er noch zu schwach entwickelt oder nicht weitreichend genug, für andere ist er die Hauptursache vieler aufwändigen aber letztlich für die Versicherten oder Patienten nutzlosen Marketinganstrengungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): der Wettbewerb. Der seit Jahrzehnten anhaltenden Rhetorik pro oder contra Wettbewerb stehen relativ wenige solide Versuche gegenüber, die Empirie erwünschter oder unerwünschter versichertenbezogenen Wirkungen des Wettbewerbs im Gesundheitsbereich zu untersuchen.
Den einen ist er noch zu schwach entwickelt oder nicht weitreichend genug, für andere ist er die Hauptursache vieler aufwändigen aber letztlich für die Versicherten oder Patienten nutzlosen Marketinganstrengungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): der Wettbewerb. Der seit Jahrzehnten anhaltenden Rhetorik pro oder contra Wettbewerb stehen relativ wenige solide Versuche gegenüber, die Empirie erwünschter oder unerwünschter versichertenbezogenen Wirkungen des Wettbewerbs im Gesundheitsbereich zu untersuchen.
Was dabei auch aktuell herauskommen könnte, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse einer etwas älteren Übersichtsarbeit. Britische ForscherInnen sichteten dafür zunächst einen großen Teil der weltweit dazu durchgeführten Studien und schlossen in ihre Studie insgesamt 53 Studien ein: rund 50% aus den USA, ein Drittel aus Großbritannien und der Rest in zahlreichen weiteren, nicht-angelsächsischen Ländern und Gesundheitssystemen.
Danach unterschieden sie sechs qualitativ verschiedene Bereiche oder Aspekte auf die der Wettbewerb in den Ankündigungen seiner Protagonisten und den Befürchtungen seiner Kritiker erwünschte oder unerwünschte Auswirkung hätte haben können: klinische Ergebnisse, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Kosten und Wirtschaftrlichkeit, Zufriedenheit, Praxis/Professionalität der Berufstätigen im Gesundheitswesen und Systemstruktur.
Auf der Basis der nationalen, d.h. britischen und der internationalen Literatur ergab sich Folgendes:
• Datenanalysen in Großbritannien weisen auf potenzielle Verbesserungen bei der Sterblichkeit hin, eine Menge methodisch unterschiedlichster internationalen Studien weisen dagegen auf reduzierte klinische Ergebnisse hin
• Wettbewerb führt in einigen britischen Studien zu einem verbesserten Zugang während andere britische Studien eher eine Verschlechterung des Zugangs durch Wettbewerb nachweisen. Letzteres ist in allen internationalen Studien der Fall.
• In Großbritannien hat Wettbewerb gemischte Wirkungen auf die Kosten der Gesundheitsversorgung. In anderen Ländern gibt es Evidenz dafür, dass Wettbewerb die Kosten für Patienten und Ärzte senkt.
• Zur Zufriedenheit gibt es in Großbritannien kaum Forschungen. Obwohl in den USA und anderen Ländern ebenfalls wenig darüber geforscht wurde, zeigt dort ein einziger Review eine Verbesserung der Zufriedenheit unter Wettbewerbsbedingungen.
• In Großbritannien sieht die Evidenz über die Wirkung von Wettbewerb auf das professionelle Handeln und die Professionals gemischt aus, wobei die Mehrheit der Studien Hinweise für negative Auswirkungen auf die Sichtweise und das Verhalten der Beschäftigten zeigt und lediglich bei der Managementqualität Verbesserungen finden. In internationalen Studien dominieren in diesem Bereich unerwünschte Effekte des Wettbewerbs.
• Zu den Auswirkungen von Wettbewerb auf die Strukturen des Gesundheitssystems gibt es in Großbritannien erneut nur wenig verfügbare Forschung. Internationale Studien weisen auf einen Zusammenhang von Wettbewerb und struktureller Fragmentierung sowie verstärkter Fusionsprozesse hin.
Die Ergebnisse ihres Reviews fassen die AutorInnen so zusammen: "Empirical research studies are far less common and seem to suggest that there are both advantages and limitations with using competition as a driver to improve quality in healthcare. On one hand, clinical outcomes and costs may improve, whereas on the other fragmentation, professionalism, access and equity may be negatively affected. Competition may be one component of broader initiatives to support change, but is not a simple or sole choice."
Zu wünschen wäre, dass der Erkenntnisstand über die empirischen Effekte von Wettbewerb laufend aktualisiert wird. Angesichts der auch dabei zu erwartenden "gemischten" Ergebnisse, sollte der Gedanke aufgegriffen werden, statt allein über Wettbewerb verstärkt über breitere und möglicherweise erfolgreichere Ansätze zur Verbesserung der Behandlungsqualität nachzudenken.
Der 34 Seiten umfassende und von der britischen "Health Foundation" herausgegebene Review Competition in healthcare - research scan April 2011 ist samt umfänglicher Literaturliste komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.3.15
"Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute wächst so nah": Raps- statt Olivenöl oder Beispiel für die Grenzen von Studien!
 Den Verfassern der Meldung auf der "Medknowledge"-Website ist die Einführung eines völlig neuen Kriteriums zur Bewertung gesundheitsrelevanter Stoffe zu verdanken: "Zudem ist es ein deutsches Regionalprodukt, welches überall und günstig erworben werden kann."
Den Verfassern der Meldung auf der "Medknowledge"-Website ist die Einführung eines völlig neuen Kriteriums zur Bewertung gesundheitsrelevanter Stoffe zu verdanken: "Zudem ist es ein deutsches Regionalprodukt, welches überall und günstig erworben werden kann."
"Es" ist Rapsöl, das nach einer gerade veröffentlichten randomisierten kontrollierten Studie "mindestens genauso gesund wie Olivenöl ist, und kardiovaskuläre Risikofaktoren mindert."
Um zu diesem Ergebnis zu kommen, überprüften Wissenschaftler bei insgesamt 18 leicht bis mittelmäßig übergewichtigen oder adipösen Männern (BMI 27 bis 35) über 4 Wochen lang den Einfluss des Verzehrs von täglich 50 Gramm Olivenöl, also dem als höchst gesundheitsfördernd erachteten Hauptbestandteil der so genannten Mittelmeerdiät, und derselben Menge Rapsöl auf eine Reihe von adipositasassoziierten Körperwerten (z.B. Cholesterinwerte, Entzündungsprozesse).
Die Ergebnisse bestätigen rein arithmetisch die dem Olivenöl ebenbürtige wenn nicht sogar zum Teil überlegene Wirksamkeit von Rapsöl.
Bevor jetzt aber allzu viel Euphorie über die Möglichkeiten einer rein deutschen Rapsanbaugegend-Diät ausbricht, sollte dem selbstkritischen Hinweis der ausschließlich deutschen AutorInnen, das Ergebnis beruhe auf Wirkungen bei 18 bzw. 9 Personen und einer Nutzungszeit von vier Wochen, mehr Beachtung geschenkt werden. Warum auf so schmaler Basis dann aber Studien durchgeführt und veröffentlich werden, hat vermutlich mehr mit der Jagd nach bibliometrisch relevanten Impact-Punkten zu tun als mit einem wirklichem Interesse an der Aufklärung über die gesundheitlichen Wirkungen von Raps- oder Olivenöl. Warum es aber auch zu solchen Ergebnissen kommt, verbirgt sich hinter dem immerhin offengelegten finanziellen Hintergrund bzw. potenziellem Interessenkonflikt dieser Studie: "This project has been funded in part by a grant from the Union zur Förderung von Oel-und Proteinpflanzen e.V.,Germany".
Unabhängig davon, wer oder was hinter den Studienergebnissen stecken mag, hat aber Rapsöl sicherlich seinen Wert, ist bekömmlich und in jedem Fall bisher garantiert billiger als die Spitzenprodukte der mediterranen Olivenproduzenten.
Die Studie Dietary rapeseed/canola-oil supplementation reduces serum lipids and liver enzymes and alters postprandial inflammatory responses in adipose tissue compared to olive-oil supplementation in obese men von M. Kruse et al. ist zuerst online am 18. November 2014 in der Fachzeitschrift "Molecular Nutrition & Food Research" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.2.15
Soll die Flut der diagnostischen Tests staatlich reguliert werden? Eine Einführung in die Pro und Contra-Debatte in den USA
 Zum medizinisch-technischen Fortschritt wird u.a. die in den letzten Jahren rasch zunehmende Anzahl von diagnostischen Labortests gezählt, die von einfachen Bestimmungen von Körperwerten bis zu prädiktiven Tests für hochkomplexe Risikokonstellationen im menschlichen Körper reichen. Diese Tests werden zum Teil - so zumindest in den USA - sogar zum Selbsttest angeboten, dessen Ergebnisse der Nutzer bzw. Patient per Post an ein Labor schickt, das ihm dann auf demselben Weg auch die Ergebnisse über das Vorhandensein von Risiken oder Erkrankungen zusendet. Viele dieser Tests basieren auf Erkenntnissen der Genom-Medizin.
Zum medizinisch-technischen Fortschritt wird u.a. die in den letzten Jahren rasch zunehmende Anzahl von diagnostischen Labortests gezählt, die von einfachen Bestimmungen von Körperwerten bis zu prädiktiven Tests für hochkomplexe Risikokonstellationen im menschlichen Körper reichen. Diese Tests werden zum Teil - so zumindest in den USA - sogar zum Selbsttest angeboten, dessen Ergebnisse der Nutzer bzw. Patient per Post an ein Labor schickt, das ihm dann auf demselben Weg auch die Ergebnisse über das Vorhandensein von Risiken oder Erkrankungen zusendet. Viele dieser Tests basieren auf Erkenntnissen der Genom-Medizin.
Ob die Entwicklung, die Vermarktung und der Einsatz solcher Tests durch die für die Zulassung von Medizinprodukten wie Arzneimittel oder Medizingeräten zuständigen staatlichen Einrichtungen reguliert werden sollte, wird nun in den USA seit einigen Monaten intensiv diskutiert. Dafür spricht, dass eine Reihe dieser diagnostischen Tests falsch-positive aber auch falsch-negative Ergebnisse liefern und Ärzte wie Patienten kritische Entscheidungen im Dunkeln treffen müssen, die u.U. zu Fehlbehandlungen führen - so die Befürworter einer systematischen Kontrolle der Wirksamkeit und des Schadenspotenzials der Tests. Eine zu starke Regulierung verhindert nach Ansicht der Warner vor einem solchen Schritt den gerade möglich erscheinenden Nutzen der Genforschung, die Entwicklung besserer genetischer Tests und das Versprechen der "genomic medicine".
Wer sich einen Überblick über den derzeitigen Stand der Debatte in den USA verschaffen will, kann dies jetzt kostenlos in zwei kurzen pro und contra-"Viewpoint"-Beiträgen beginnen, die am 5. Januar 2015 online in der Fachzeitschrift "JAMA" erschienen sind.
Es handelt sich um den Aufsatz FDA Regulation of Laboratory-Developed Diagnostic Tests Protect the Public, Advance the Science. Should the FDA regulate laboratory-developed diagnostic tests? —Yes. von Joshua Sharfstein, und den Aufsatz Genetic Testing and FDA RegulationOverregulation Threatens the Emergence of Genomic Medicine. Should the FDA regulate laboratory-developed diagnostic tests? —No. von James P. Evans und Michael S. Watson.
Mehr zum Thema Laboratory Developed Tests, darunter zahlreiche Gutachten, findet sich auf einer Website der für die Regulierung potenziell zuständigen "U.S. Food and Drug Administration (FDA".
Bernard Braun, 5.1.15
Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: "Open Payment" oder "Sunshine database" zwischen Licht und Schatten!
 Was in Deutschland entweder einer der vielen Träume von Transparenz im Gesundheitswesen ist oder als Eingriff in die Freiheit eines Berufsstandes bekämpft wird, ist in den USA im Prinzip Wirklichkeit - nur fehlen an der Transparenz über die Zahlungen der Pharma- und Medizinprodukteindustrie im Moment mehrere Milliarden US-Dollar und zigtausende Empfänger.
Was in Deutschland entweder einer der vielen Träume von Transparenz im Gesundheitswesen ist oder als Eingriff in die Freiheit eines Berufsstandes bekämpft wird, ist in den USA im Prinzip Wirklichkeit - nur fehlen an der Transparenz über die Zahlungen der Pharma- und Medizinprodukteindustrie im Moment mehrere Milliarden US-Dollar und zigtausende Empfänger.
Seit kurzem kann jedermann auf der von der Regierungseinrichtung "Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)" betriebenen Website "OpenPaymentsData.CMS.gov" erfahren, wie viel Geld die größten Akteure der Gesundheitswirtschaft unter unterschiedlichsten Etiketten (z.B. Forschungsgelder, Finanzierung von Kongressen oder Angebot von Aktien) an wie viele Ärzte und Kliniken in den USA bezahlt haben. Im Jahre 2013 waren dies 3,5 Milliarden US-Dollar, die von 1.419 Herstellern in 4,4 Millionen einzelnen Aktionen an 546.000 Ärzte und 1.360 Kliniken verteilt wurden. Jeder dieser Ärzte und Kliniken erhielt mindestens eine Zuwendung der Industrie.
Diese für Deutschland fast unvorstellbare Durchleuchtung der Einflussnahme auf Leistungsanbieter im Gesundheitswesen ist aber auch in den USA nicht ohne fatale Schattenseiten. Als erstes wirkt die Website als ob es so etwas wie Web Design nicht gäbe. Wer glaubt, schnell die relevanten Daten zu finden, verklickt sich rasch in einer schier endlosen Kette von Links. Zweitens fehlen noch wichtige Informationen über die Identität der Zahlungsempfänger, die bisher lediglich für das Jahr 2015 zugesagt sind. Und drittens teilt die Regierungsbehörde vor wenigen Tagen mit, dass für den Zeitraum August bis Dezember 2013 noch Angaben über die Zahlung von 1,3 Milliarden US-Dollar an 360.000 Ärzte und 873 Kliniken fehlen.
Zu der "open payment"-Informationsquelle findet sich in dem am 7. Oktober 2014 im Wall Street Journal erschienen Artikel More Than $1B in Payments to Doctors is Excluded From Sunshine Database von Ed Silverman etwas mehr. Das Open Payment Data Fact Sheet ist ebenfalls frei zugänglich.
Spätestens dann, wenn die Transparenz komplett ist und auch leichter erreicht werden kann, stellt sich die Frage, warum so etwas Systematisches nicht auch in Deutschland möglich ist.
Bernard Braun, 8.10.14
Ist der "brain drain" von Ärzten aus Ländern der Dritten Welt durch Einkommensverbesserungen zu stoppen? Das Beispiel Ghana.
 In der aktuellen Debatte über den Mangel an Ärzten und Pflegekräften zur Behandlung der Ebola-PatientInnen in den westafrikanischen Ländern, spielt auch das Argument eine Rolle, hier handle es sich um eine Folge des so genannten "brain drains" der Angehörigen dieser und anderer Berufe in europäische oder nordamerikanische Länder und Gesundheitssysteme. Als ein Grund für diese Mobilität gelten die Einkommensunterschiede zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern. Höhere Einkommen für Ärzte etc. in Ghana, Indonesien oder Honduras, so die Schlussfolgerung, würden die Abwanderung spürbar mindern.
In der aktuellen Debatte über den Mangel an Ärzten und Pflegekräften zur Behandlung der Ebola-PatientInnen in den westafrikanischen Ländern, spielt auch das Argument eine Rolle, hier handle es sich um eine Folge des so genannten "brain drains" der Angehörigen dieser und anderer Berufe in europäische oder nordamerikanische Länder und Gesundheitssysteme. Als ein Grund für diese Mobilität gelten die Einkommensunterschiede zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern. Höhere Einkommen für Ärzte etc. in Ghana, Indonesien oder Honduras, so die Schlussfolgerung, würden die Abwanderung spürbar mindern.
Ob dies stimmt und um welche Summen es dabei geht, untersuchte jetzt ein Wissenschaftler der RAND Corporation für den afrikanischen Staat Ghana genauer.
Dazu untersuchte er den Anteil afrikanischer Ärzte in 16 OECD-Ländern über 14 Jahre (1991 bis 2004). Er berücksichtigte dabei, dass es in Ghana im gesamten Zeitraum das staatliche Programm "Additional duty hours allowance (ADHA)" gab, das letztlich zu einer Erhöhung der dortigen Ärzteeinkommen beitrug. Obwohl für andere Zwecke geplant, stammte 2005 laut einer Studie knapp die Hälfte des Einkommens der ghanaesischen Ärzte aus dem ADHA-Topf.
Im Vergleich des "brain drain" aus Ghana mit dem aus den restlichen afrikanischen Staaten ohne vergleichbare Einkommensanreize zeigte sich bereits kurz nach dem Start und der Einwirkung von ADHA eine Abnahme bei den ghanaesischen Ärzten und nur bei diesen. Insgesamt zeigen die Analysen über den gesamten Zeitraum eine Abnahme der Emigration von Ärzten aus Ghana in die USA, Deutschland und vergleichbare Länder um 10%.
In der sehr intensiven Diskussion dieses Ergebnis, sind zwei Aspekte besonders interessant:
• In eine Weiterentwicklung des Analysemodells müssten u.a. auch die Entwicklung der Immigrationsbedingungen in den Aufnahmeländern und die sonstigen politischen und sozialen Entwicklungen in den Immigrationsländern berücksichtigt werden. Dies ist mit komplexen methodischen Anforderungen verbunden.
• Ein anderer Aspekt fasst der Autor so zusammen: "Even if the wage increase programme reduced physician migration, this does not automatically make it a good policy solution. An important question is whether the programme would pass a cost-benefit test." Dafür schätzt er die ADHA-Kosten im Untersuchungszeitraum für jeden in Ghana zusätzlich verbliebenen Arzt auf 167.000 US-Dollar. Für die Frage nach der "cost-effectiveness" stellt er dem die "cost of producing a new doctor" gegenüber, die auf 30.000 bis 70.000 US-Dollar geschätzt werden.
Auch wenn man weitere vom Autor skizzierte Limitationen hinzunimmt, handelt es sich um einen wichtigen ersten Versuch, mit einem künftig noch wachsenden Problem analytisch und konzeptionell umzugehen. Die professionell und immer aggressiver von allen "westlichen" Ländern weltweit in den so genannten Entwicklungsländern geführten Abwerbekampagnen für Beschäftigte im Gesundheitswesen könnte z.B. dazu führen, dass sich dort verstärkt tatsächlich oder vermeintlich gefährliche Erkrankungsereignisse bzw. Epidemien bilden, die mangels Personal und sonstiger Infrastruktur nicht mehr akut versorgt werden können. Speziell wenn es sich um ansteckende Erkrankungen handelt, stehen die entwickelten Länder vor der Herausforderung, mit Hunderten von Millionen Dollars oder Euros daran vor Ort etwas zu verändern. Ob dies dann nicht u.U. teurer wird als ADHA-Programme und gleichzeit nationale Ausbildungsprogramme für mehr Gesundheitspersonal in Europa oder Nordamerika, sollte in künftigen "brain drain"-Studien ebenfalls mitberücksichtigt werden.
Von dem materialreichen Aufsatz Do higher salaries lower physician migration? von Edward N Okeke, der am 26. Juli 2014 in der Zeitschrift "Health Policy Planning. (2014; 29 (5): 603-614) erschienen ist, gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 7.8.14
Mythos "gesunde Ernährung ist teuer" oder "zu teuer" - Metaanalyse: Wie viel teuerer als ungesündeste ist sie wirklich?
 Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.
Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.
Eine am 5. Dezember 2013 in der Online-Ausgabe des "British Medical Journal Open" von EpidemiologInnen der "Harvard School of Public Health" veröffentlichte Metaanalyse von 27 Studien aus 10 Ländern (USA/Kanada, 6 europäische Länder, Südafrika/Australien etc.) mit im internationalen Vergleich höheren Durchschnittseinkommen schafft hierzu mehr Klarheit.
Auf den einfachsten finanziellen Nenner gebracht kostet die gesündeste Ernährung, also z.B. die mit Früchten, Gemüse, Fisch oder Nüssen insgesamt rund 1,50 US-Dollar pro Tag mehr als die am wenigsten gesunde Ernährung, bestehend aus Fertiggerichten, Fleisch oder raffinierten Samen bzw. Getreide. Dazu wurden sowohl die Kosten pro Essensportion als auch die bestimmter Kalorienmengen untersucht.
Rechnet man die unerwartet niedrigen absoluten Tageskosten einer gesunden Ernährung auf das Jahr hoch, kommt allerdings ein Betrag von rund 550 US-Dollar zusammen. Dies kann für eine Reihe von Familien eine zu hohe Kostenlast bedeuten, deren Gewicht politisch gesenkt werden muss. Dabei ist nach Ansicht der WissenschaftlerInnen hilfreich, dass die dafür erforderlichen Geldmittel im Vergleich zu den Kosten der Behandlung von ernährungsbedingten Krankheiten eher gering sind. Die Behandlungskosten würden außerdem durch gesunde Ernährung präventiv erheblich gesenkt werden.
Die WissenschaftlerInnen widmeten sich auch der Frage warum ungesündere Ernährung billiger ist. Dies liegt ihres Erachtens vor allem an einem komplexen Netzwerk von Produzenten, Vertreibern und Marketingakteure, die alle an dieser Art von Nahrungsmittel interessiert sind und daran auch gut verdienen. Sofern diese Erklärung stimmt, könnte also eine vergleichbare Infrastruktur für gesündere Nahrungsmittel sowohl deren Erreichbarkeit erhöhen als auch die Preise senken.
Auch wenn die in die Analyse eingegangenen Warenkörbe und deren Preisstruktur sich in mehrerlei Hinsicht je nach Land unterscheiden können dürfte sich an den Preisniveaus und -unterschieden in reicheren Ländern nichts Grundsätzliches ändern. Und damit auch nichts an den gesundheitspolitischen und -ökonomischen Schlussfolgerungen.
Der am 5. Dezember 2013 online veröffentlichte Aufsatz Do Healthier Foods and Diet Patterns Cost More Than Less Healthy Options? A Systematic Review and Meta-Analysis von Mayuree Rao, Ashkan Afshin, Gitanjali Singh und Dariush Mozaffarian ist in der Fachzeitschrift "BMJ Open" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.12.13
Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe
 Kurz vor Ende ihrer Amtszeit legte die schwarz-gelbe Koalition im Spätsommer 2013 das Konzeptpapier Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen vor. So begrüßenswert es ist, dass sich die Bundesregierung mit den Herausforderungen globaler Gesundheit auseinandersetzt - das Konzept der scheidenden Regierung lässt etliche Wünsche offen. Zwar benennt es wichtige Fragen globaler Gesundheitspolitik und teils zutreffende Argumente. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das in monatelanger Arbeit entstandene Papier allerdings vielfach als reine Rhetorik oder gar als Verschleierung bedenklicher Zielsetzungen. Die abgeleiteten politischen Konsequenzen und Strategien sind nicht nur unzureichend, sondern geben sogar Anlass zur Sorge.
Kurz vor Ende ihrer Amtszeit legte die schwarz-gelbe Koalition im Spätsommer 2013 das Konzeptpapier Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen vor. So begrüßenswert es ist, dass sich die Bundesregierung mit den Herausforderungen globaler Gesundheit auseinandersetzt - das Konzept der scheidenden Regierung lässt etliche Wünsche offen. Zwar benennt es wichtige Fragen globaler Gesundheitspolitik und teils zutreffende Argumente. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das in monatelanger Arbeit entstandene Papier allerdings vielfach als reine Rhetorik oder gar als Verschleierung bedenklicher Zielsetzungen. Die abgeleiteten politischen Konsequenzen und Strategien sind nicht nur unzureichend, sondern geben sogar Anlass zur Sorge.
Unter Federführung des Bundesgesundheitsministeriums waren das Auswärtige Amt sowie die Bundesministerien für Wirtschaft, für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie für Forschung und Bildung an dem Konzeptpapier zu globaler Gesundheitspolitik beteiligt. Entstanden ist ein Sammelsurium aus außen-, handels-, entwicklungs-, forschungspolitischen Aspekten. Das Papier beruft sich wiederholt auf deutsche Traditionen und Erfahrungen, meint damit aber vor allem die von Paul Ehrlich geprägte Forschung zur Krankheitsbekämpfung. Die maßgeblich auf Rudolf Virchow zurückgehende Erkenntnis, dass Gesundheit in erster Linie von den Lebens- und Arbeitsbedingungen abhängt, kommt in dem Konzeptpapier allenfalls am Rande zur Sprache.
In ihrem Konzeptpapier benennt die Bundesregierung drei Leitgedanken für ihre globale Gesundheitspolitik:
• Schutz und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch globales Handeln
• Wahrnehmung globaler Verantwortung durch die Bereitstellung deutscher Erfahrungen, Expertise und Mittel
• Stärkung internationaler Institutionen der globalen Gesundheit
Dabei konzentriert sie sich auf fünf Schwerpunkte:
• Wirksam vor grenzüberschreitenden Gesundheits- gefahren schützen
• Gesundheitssysteme weltweit stärken - Entwicklung ermöglichen
• Intersektorale Kooperationen ausbauen - Wechselwirkungen mit anderen Politikbereichen
• Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft - Wichtige Impulse für die globale Gesundheit setzen
• Globale Gesundheitsarchitektur stärken.
Erheblich größere Bedeutung als den gesellschaftlichen Bedingungen von Gesundheit misst das Konzept der Bundesregierung nämlich der heilenden Wirkung von Exportprodukten der deutschen Pharma-, Medizingeräte- oder Versicherungsindustrie bei. Diese Einschätzung ist bestenfalls naiv, eher aber gefährlich. Denn deutsche Erzeugnisse unterliegen in erster Linie den Gewinninteressen der Hersteller und nur in geringem Maße dem tatsächlichen Bedarf. Wer es ernst meint mit globaler Gesundheit, der muss das Allgemeinwohl über Herstellerinteressen stellen und gegen Handelsbarrieren vorgehen, die armen Ländern u. a. den Zugang zu wichtigen Arzneimitteln versperren.
So richtig die Forderung der Bundesregierung nach universeller Absicherung im Krankheitsfall ist, so wenig glaubhaft ist ihr Bekenntnis, solange sie mit ihrer Sparpolitik in Folge der Eurokrise die soziale Absicherung beispielsweise der Griechen untergräbt. Universelle Absicherung im Krankheitsfall gilt für alle Menschen, auch für Migranten. Und der Export privater Krankenversicherungen in Entwicklungsländer hemmt den Aufbau umfassender Systeme und erschwert universelle soziale Absicherung.
Von solchen Erkenntnissen ist ebenso wenig die Rede wie von krank machenden oder gar tödlichen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch und anderswo, wo die Opfer einstürzender Gebäude nur die Spitze eines Eisbergs sind. Die alltäglichen Arbeitsbedingungen gefährden die Gesundheit. Auch vermeidet das Papier das Thema der gesundheitsschädlichen Wirkungen vieler Ausfuhrprodukte der deutschen Gesundheitswirtschaft, ganz zu schweigen von anderen Exportgütern made in Germany: Dabei ist Deutschland die drittgrößte, bei Kleinwaffen sogar zweitgrößte Rüstungsschmiede der Welt - eine Umwandlung dieses Industriezweigs wäre ein riesiger Beitrag zur globalen Gesundheit. Gleichzeitig gehört dieses Land zu den größten Umweltverschmutzern und erwirtschaftet seine Exportüberschüsse auch mit umweltschädlichen Produkten: Konsequente Eindämmung des Treibhausgasausstoßes und eine neue Verkehrspolitik können ebenso wie abgas- und lärmarme Autos erheblich mehr zur Verbesserung der Gesundheit hierzulande und weltweit beitragen als Arzneimittel und Medizintechnologie.
Alle diese Widersprüche lässt das Konzeptpapier der Bundesregierung völlig außer Acht. Vielmehr suggeriert es eine rückwärtsgewandte, selbstbezogene und auf den eigenen Vorteil bedachte Haltung, die Reminiszenzen an das Credo "Am deutschen Wesen soll die Welt genesen", sei es durch Medizinprodukte aus deutscher Herstellung oder durch soziale Sicherungssysteme nach deutschem Vorbild. Auch wenn das Papier die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit wie multilateraler Akteure und insbesondere der Weltgesundheitsorganisation WHO betont, liegt der Schwerpunkt des Papiers woanders.
Die angesehene Medizinerzeitschrift Lancet widmete dem Konzeptpapier bereits ihrer Ausgabe vom 21. September 2013 ein Editorial. Namhafte deutsche Gesundheitswissenschaftler kritisierten zwei Monate später in derselben Zeitschrift die Bundesrepublik Deutschland, deren geringer Einsatz für Fragen der globalen Gesundheit der politischen und wirtschaftlichen Rolle des Landes würde nicht gerecht. In ihrem Teilbeitrag mit dem Titel Germany and global health: an unfinished agenda? mit dem Titel benennen die Autoren eine Reihe von Mängeln des Regierungskonzepts:
• Intellektuelle Eigentumsrechts und Zugang zu Arzneimitteln,
• Thematisierung struktureller Determinanten wie Handel, Wirtschaftskrise und weltweite Ungleichheit,
• relevante Beschränkungen des Rechts auf größtmögliche Gesundheit für MigrantInnen, Flüchtlinge und Asylsuchende in der Europäischen Union einschließlich Deutschlands,
• zuverlässige Finanzierungsmechanismen für die WHO,
• Förderung globaler Gesundheitsforschung und -erziehung,
• effektive und transparente interministerielle Institutionalisierung der deutschen globalen Gesundheitspolitik.
Im Lancet findet sich auch eine englischsprachige Zusammenfassung.
Die Große Koalition hat nun die Gelegenheit, das bisher stiefmütterlich behandelte Thema der globalen Gesundheitspolitik von nun ab aktiver und vor allem auch ernsthafter zu verfolgen. Das bisher vorliegende Konzeptpapier eignet sich allerdings schwerlich als Grundlage, dafür ist es zu lückenhaft, einseitig und letztlich irreführend. Gefordert ist ein Konzept für globale Gesundheitspolitik, das nicht deutsche Interessen und die Logik der Krankheitswissenschaften in den Vordergrund stellt, sondern auf Grundlage gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse Vorschläge entwickelt, wie die Bundesrepublik und ihre Regierungen systematisch zur Verbesserung der Gesundheit weltweit beitragen können.
Das Konzeptpapier der Bundesregierung lässt sich hier kostenfrei herunterladen.
Jens Holst, 17.12.13
Werbung zu Arzneimitteln und Medizinprodukten ohne Wirkungsnachweis ist als irreführend verboten. Das Beispiel Kinesio-Tape.
 Gerichte werden immer häufiger zu Wächtern bzw. Sachwaltern der Interessen der Bevölkerung an gesundheitlich nützlichen und wirksamen Gütern und Dienstleistungen. Dies ist einerseits zu begrüßen, andererseits aber wegen des dafür notwendigen aber aufwändigen und von vielen gescheuten Klageverfahrens gegen Hersteller oder z.B. ärztliche Anbieter nicht unproblematisch. Zu wünschen wäre, dass vorhandene staatliche Behörden nach geltendem Recht beim Marktzugang oder -auftritt solcher Produkte aktiv werden und den bisher mit relativ geringen und nicht immer unabhängig erbrachten Nachweispflichten von erwünschten und unerwünschten Wirkungen versehenen Marktzugang erschweren oder wenigstens die werbewirksame Etikettierung als "gesund" untersagen.
Gerichte werden immer häufiger zu Wächtern bzw. Sachwaltern der Interessen der Bevölkerung an gesundheitlich nützlichen und wirksamen Gütern und Dienstleistungen. Dies ist einerseits zu begrüßen, andererseits aber wegen des dafür notwendigen aber aufwändigen und von vielen gescheuten Klageverfahrens gegen Hersteller oder z.B. ärztliche Anbieter nicht unproblematisch. Zu wünschen wäre, dass vorhandene staatliche Behörden nach geltendem Recht beim Marktzugang oder -auftritt solcher Produkte aktiv werden und den bisher mit relativ geringen und nicht immer unabhängig erbrachten Nachweispflichten von erwünschten und unerwünschten Wirkungen versehenen Marktzugang erschweren oder wenigstens die werbewirksame Etikettierung als "gesund" untersagen.
Das jüngste, auf der Basis des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und des Heilmittelwerbegesetzes gefällte Urteil des Landgerichts Ulm zeigt aber, dass es eine Reihe bereits existierender Gesetze gibt, welche es verhindern helfen können, dass gesundheitlich unsinnige oder problematische, aber in jedem Fall umsatzgarantierende Angebote der Gesundheitswirtschaft mit der Wertschätzung für "gesunde" Güter und Leistungen werben bzw. versprechen, die Hoffnungen von kranken Menschen auf Heilung oder Linderung zu erfüllen.
Es geht hier um das so genannte Kinesio-Taping. Die von einem japanischen Chiropraktiker erfundenen bunten Bänder sollen nach Meinung ihrer Hersteller, der sie oft plakativ tragenden Sportler und auch von Ärzten Sportlern wie Nichtsportlern akut gegen Verspannungen und Verletzungen helfen und ferner durch eine bessere Durchblutung und Muskellockerung vorbeugend wirken sollen. Mit diesen Effekten warb eine Ärztin, die ihre PatientInnen auch mit dieser Art von Bandage behandelte, umfänglich auf ihrer Praxis-Website. Dagegen klagte ein "Verband sozialer Wettbewerb" mit dem Argument, es handle sich hierbei um unlauteren Wettbewerb und einen Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz.
In dessen Paragraph 3 ist "irreführende Werbung" für Arzneimittel, Medizinprodukte und einer Reihe weiterer gesundheitsbezogener Produkte und Leistungen verboten. Irreführend ist dabei "insbesondere", wenn Arzneimitteln, Medizinprodukten, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln eine therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die sie nicht haben, wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, daß ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann, bei bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen Wirkungen eintreten" oder "die Werbung nicht zu Zwecken des Wettbewerbs veranstaltet wird."
Das für die Klage zuständige Landgericht Ulm machte es sich nicht einfach und zog für seine Bewertung der von der Beklagten veröffentlichten werbenden Aussagen und sein Urteil die wissenschaftlichen Erkenntnisse heran, die sich eigentlich bereits der Hersteller oder spätestens die hierfür ja ausgebildete Ärztin statt Werbeprospekte und Fußballer-Statements hätten anschauen können und müssen.
Die einzige methodisch hochwertige Studie, eine so genannte Metaanalyse aus dem Jahr 2012 kommt zu dem für solche Analysen selten eindeutigen Schluss, dass "von 97 Beiträgen...gerade einmal 10 die Einschlusskriterien (der Artikel musste Daten über die Wirkung des Kinesio-Tapings zur Verfügung stellen, und zwar im Hinblick auf Resultate, die die Muskeln und das Skelett betreffen; ferner musste die Arbeit eine Kontrollgruppe haben). Von diesen 10 Publikationen prüften nur 2 Studien sportbezogene Verletzungen. Davon involvierte lediglich eine Studie verletzte Athleten. Die eingeschlossenen Studien enthielten aber z.T. Ergebisse zur möglichen Prävention von Sportverletzungen. Die Wirksamkeit des Kinesio-Tapings in Bezug auf Schmerzerleichterung war belanglos: Es gab keine klinisch relevanten Ergebnisse. Fazit der Metaanalyse war, dass lediglich eine qualitative Evidenz von geringer Bedeutung vorlag, die den Nutzen des Kinesio-Tapings gegenüber anderen Arten des Tapings bei Handhabung und Prävention von Sportverletzungen untermauern konnte" - so ein das Urteil kommentierender Fachanwalt.
Das Gericht sah dies genauso, unterstrich die gerade für gesundheitsbezogene Aussagen und Angebote zentrale Bedeutung eines wissenschaftlich erbrachten positiven Nutzen-/Wirkungsnachweises, bewertete die Werbung der Ärztin als "Vorsprung durch Rechtsbruch" und verbot ihr unter Androhung eines Bussgelds bei Zuwiderhandlung im Detail 36 inhaltlich werbende Aussagen als irreführend und damit im Prinzip ihren gesamten Kinesio-Werbeauftritt.
Das gesamte Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Ulm mit dem Aktenzeichen 10 O 35/13 KfH ist leider nicht kostenlos zugänglich. Ob dies bei einem Urteil eines öffentlichen Gerichts zu einem Gegenstand öffentlichen Interesses in Zeiten des Internets gerechtfertigt ist, ist fragwürdig - vor allem wenn an einem "steuerfinanzierten" Urteil dann private Anbieter wie Jurion oder Beck-Online verdienen.
Zumindest an den Tenor und die Liste der als Irreführung untersagten 36 werbenden Aussagen kommt man dann aber trotzdem kostenlos heran. Weiteres Interesse am Urteil kostet dann aber z.B. 39,99 Euro monatlich für ein entsprechendes Urteils-Abo.
Die 2012 veröffentlichte Metaanalyse Kinesio taping in treatment and prevention of sport injuries: a meta-analysis of the evidence for its effectiveness von Sean Williams et al. ist in der Fachzeitschrift "Sports Medicine" (42: 153-164) erschienen. Von diesem Aufsatz ist das Abstract kostenlos zugänglich.
Von dem ausführlichen juristischen Kommentar Gesetzliche Anforderungen an ärztliche Werbung des Wettbewerbsrechtler T. Oehler, erschienen in der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift" (2013. 138(45): 2322-2324), ist ebenfalls das Abstract kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.13
"Roland Berger"-Gutachten oder wie man mit altem säuerlichem Wein in neuen Schläuchen mit dem Fachkräftemangel Geld verdienen kann
 Mindestens um den Umsatz und die Gewinne der zahlreichen Unternehmensberatungen, die sich um die künftige Entwicklung der Personalressourcen und Organisation der Gesundheitsversorgung in regelmäßigen Abständen gutachterlich Gedanken machen, braucht man sich nicht zu sorgen. Unabhängig davon, ob sie etwas Neues finden oder ihre Lösungsvorschläge oftmals der siebte Aufguss bekannter Lösungsversuche unter anderem Namen sind.
Mindestens um den Umsatz und die Gewinne der zahlreichen Unternehmensberatungen, die sich um die künftige Entwicklung der Personalressourcen und Organisation der Gesundheitsversorgung in regelmäßigen Abständen gutachterlich Gedanken machen, braucht man sich nicht zu sorgen. Unabhängig davon, ob sie etwas Neues finden oder ihre Lösungsvorschläge oftmals der siebte Aufguss bekannter Lösungsversuche unter anderem Namen sind.
Dies gilt auch für das am 28. Oktober 2013 veröffentlichte Gutachten der Unternehmensberatung Roland Berger, das sich mit dem Thema "Fachkräftemangel im Gesundheitswesen: Medizinische Berufe verlieren in Deutschland an Attraktivität" beschäftigt.
Die Kerndiagnosen oder -behauptungen lauten:
• fast 80 % der deutschen Krankenhäuser spüren heute schon die Folgen des Fachkräftemangels,
• der demografischer Wandel führt bis 2030 zu einer Verdoppelung der Anzahl der über 80-Jährigen,
• dadurch wird der Fachkräftemangel bis 2015 auf rund 175.000 bzw. rund 15 % steigen,
• Medizin- und Pflegeberufe werden immer unattraktiver: Hoher bürokratischer Aufwand und Überstunden belasten das Image der Branche aber
• dank neuer Technologien (z.B. Telemonitoring oder technische Assistenzsysteme) und mehr Prävention wird der so genannte erste Gesundheitsmarkt, also das GKV-System bis 2030 jährlich um ca. 3% und der zweite Gesundheitsmarkt, also die gesundheitsbezogenen Leistungen, die nicht von der GKV organisiert und bezahlt werden jährlich sogar um 6% pro Jahr wachsen wird.
Und für die mangelnde Attraktivität der Medizin- und Pflegeberufe hat Roland Berger auch gleich die Lösung:
• Patientenkoordinatoren als wichtige Schnittstelle zwischen Medizin und Verwaltung, um Ärzte (obwohl nicht explizit genannt wahrscheinlich auch Pflegekräfte?) zu entlasten.
Woher der Roland Berger-Gutachter dies auch immer wissen will, hätte seines Erachtens die "Einführung von so genannten 'Patientenkoordinatoren' … zwei positive Folgen: das medizinische und Pflegepersonal würde deutlich entlastet und die Patienten wären mit den Leistungen der Ärzte und mit der Organisation in den Kliniken zufriedener." Oder auf den Punkt gebracht: "Nur so lässt sich das Problem des akuten Fachkräftemangels in deutschen Krankenhäusern an den Wurzeln packen."
Unter dem Titel "Verweildauerorientiertes Patientenmanagement" hatte Roland Berger übrigens bereits 2012 wahre Wunderdinge über den Nutzen eines damals "Patientenmanager" genannten neuen Akteurs berichtet (der Bericht kann schriftlich angefordert werden). Der Vollständigkeit halber sei der aktuell gemachte, gleichrangige Vorschlag einer "durchgängigen Prozessoptimierung" erwähnt - was immer das auch heißen mag.
Dabei ist das Nachdenken über die nachteilige Wirkung fehlender Arbeitsteilung im Bereich administrativer Tätigkeiten und möglicher Alternativen zum Status quo vollkommen berechtigt. Problematisch wird es, wenn die Berger-Experten keine Silbe darüber verlieren, dass es etwas ähnliches wie die "Patientenkoordinatoren" etc. unter der Bezeichnung Case- oder Care-Manager bereits seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gibt und woran es liegt, dass diese bisher nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt haben.
Ärgerlich wird es, wenn es darum geht was Roland Berger nicht analysieren will oder kann und als mögliche kurz- und langfristige Lösungsansätze mitpräsentiert: Kein Wort zu der Unattraktivität zumindest der Einkommen von Pflegekräften, kein Wort von der Finanzierung der "Patientenkoordinatoren", kein Wort zu der fast unendlich-zähen, schwierigen und zum Teil auch erforschten Geschichte der Delegation traditioneller Tätigkeiten von Ärzten und Pflegekräften an andere Beschäftigte und der interprofessionellen Zusammenarbeit. Und schließlich auch kein Wort zur eventuell personalsparenden Reduktion der Über- und Fehlversorgung im Krankenhaus und der Möglichkeiten einer stärkeren Ambulantisierung z.B. normaler Geburten oder Sterbefälle.
Sofern dies alles nicht in einer zumindest im Moment nicht bekannten und frei zugänglichen Langfassung des Gutachtens (interessante Fußnote der Veröffentlichung: "Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln. Es dient nur dem internen Gebrauch unseres Klienten und ist ohne die zu Grunde liegenden Detailanalysen sowie den mündlichen Vortrag nicht vollständig") vorkommt, verfehlt das Gutachten das Motto von Roland Berger um Längen. Dieses lautet "it's character that makes impact".
Von dem Gutachten "Fachkräftemangel im Gesundheitswesen" von Zun-Gon Kim ist eine 17-seitige Zusammenfassung frei und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.10.13
Erhöht Vitamin D die Knochendichte und senkt damit das Frakturrisiko? Nur sehr geringe Evidenz und dann nur bei einzelnen Knochen!
 Die Furcht vor der Verringerung ihrer Knochendichte und der möglichen Folge schwerer Knochenbrüche und damit oft assoziierter langer Erkrankungsdauern oder gar anhaltender Pflegebedürftigkeit plagt relativ viel ältere Menschen ab ihrem 50. Lebensjahr. Als präventiv wirksam gilt u.a. die regelmäßige nahrungsergänzende Einnahme von Vitamin D zusammen mit oder ohne Kalzium. Untersuchungen zeigen, dass bis zur Hälfte der über 50-Jährigen ihre Ernährung so ergänzen. Frühere methodisch hochwertige Meta-Analysen kamen bereits zu dem Schluss, dass Vitamin D allein nicht das Risiko von Knochenbrüchen verringert. In Studien, die zu diametral anderen Ergebnissen kamen, erhielten die TeilnehmerInnen neben Vitamin auch noch Kalzium, das erwiesenermaßen de Knochendichte verbessern kann und daher auch eine präventive Wirkung auf das Risiko von Knochenbrüchen hat.
Die Furcht vor der Verringerung ihrer Knochendichte und der möglichen Folge schwerer Knochenbrüche und damit oft assoziierter langer Erkrankungsdauern oder gar anhaltender Pflegebedürftigkeit plagt relativ viel ältere Menschen ab ihrem 50. Lebensjahr. Als präventiv wirksam gilt u.a. die regelmäßige nahrungsergänzende Einnahme von Vitamin D zusammen mit oder ohne Kalzium. Untersuchungen zeigen, dass bis zur Hälfte der über 50-Jährigen ihre Ernährung so ergänzen. Frühere methodisch hochwertige Meta-Analysen kamen bereits zu dem Schluss, dass Vitamin D allein nicht das Risiko von Knochenbrüchen verringert. In Studien, die zu diametral anderen Ergebnissen kamen, erhielten die TeilnehmerInnen neben Vitamin auch noch Kalzium, das erwiesenermaßen de Knochendichte verbessern kann und daher auch eine präventive Wirkung auf das Risiko von Knochenbrüchen hat.
Einige ForscherInnen waren sich aber nicht sicher, ob die Solo-Wirkung von Vitamin D nicht doch noch durch höhere Dosen oder durch einen gezielten Einsatz in besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen eintreten könnte. Deshalb führten sie einen systematischen Review und eine Meta-Analyse über alle randomisierten kontrollierten Studien durch, welche die Einnahme verschiedenster Vitamin D-Dosen und Kombinationen von Vitamin D mit anderen als hilfreich vermuteten Mitteln auf Personen ab dem 20. Lebensjahr untersuchten. Der primäre Endpunkt der Studien war die prozentuale Veränderung, d.h. im positiven Fall Erhöhung der Knochendichte.
In ihre Studie gingen von 3.930 bis 2012 gefundenen Studien 23 mit einer mittleren Beobachtungszeit von fast 2 Jahren und mit 4.082 TeilnehmerInnen ein. 92% von ihnen waren Frauen, das Durchschnittsalter betrug 59 Jahren. Die Knochendichte wurde an bis zu fünf Stellen bzw. Knochen gemessen: Lendenwirbelsäule, Oberschenkelhalsknochen, am Schenkelring, am Unterarm und am gesamten Körper.
Die Ergebnisse:
• Es gab sechs Studien, in denen es bei der Dichte eine signifikante Erhöhung gab, vier Studien zeigten lediglich bei einem einzigen Knochen eine höhere Knochendichte, zwei Funde zeigten eine signifikante Verschlechterung und die restlichen 11 Studien fanden keinerlei signifikanten Nutzen der Vitamineinnahme für die Knochendichte. Nur eine Studie fand Verbesserungen der Knochendichte bei mehr als einem der untersuchten Knochen(orte).
• Bei der Meta-Analyse ergab sich lediglich für die Dichte des Oberschenkelhalsknochens ein kleiner Nutzen der Vitamineinnahme. Die für diese Analyse einbezogenen Studien waren aber sehr heterogen, was zur Vorsicht bei der Verallgemeinerung des Ergebnisses führen sollte. Umso verwunderlicher ist es trotzdem, dass bei den unmittelbar benachbarten Hüftknochen keinerlei Veränderungen ihrer Dichte gefunden werden konnten.
Die ForscherInnen kommen daher zu dem Ergebnis, dass ihr systematischer Review "provides very little evidence of an overall benefit of vitamin D supplementation on bone density". Kleine Verbesserungen bei einzelnen Knochen seien gegen mögliche unerwünschte Effekte abzuwägen. Und außerdem sei die "number of positive results ... little better than what would have been expected by chance." Auf die teure Messung der Knochendichte und der generellen Einnahme von Vitamin D könne verzichtet werden, außer bei der kleinen Gruppe von erkennbar besonders gefährdeten Personen. Bevölkerungsbezogene Messungen des Vitamin-D-Spiegels in den USA hätten schließlich gezeigt, dass "most adults ... do not need supplementation."
Dass dies die Hersteller und Verkäufer von Vitamin D-Präparaten anders sehen, ihnen dies auch nicht untersagt ist und sie damit auch enorme Verkaufserfolge erzielen, ist ein Beispiel dafür, dass bei allen Produkten, die eine Gesundheitswirkung behaupten oder mit ihr werben, die Hersteller dazu gesetzlich verpflichtet werden müssen, diesen Nutzen und/oder die Schädigungsfreiheit durch unabhängige Studien nachzuweisen. Gelingt ihnen dies nicht, sollten sie in keiner Weise mehr mit der hoch angesehenen und verkaufsfördernden Gesundheitswirkung werben dürfen.
Der Aufsatz Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis. von Ian Reid et al. ist am 11. Oktober 2013 in der Zeitschrift "Lancet" "early online" veröffentlicht worden. Sein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.10.13
Beschäftigungsabbau durch Privatisierung von Krankenhäusern! Bei jeder Form der Privatisierung und bei allen Beschäftigten?
 Sowohl der bis 2008 erfolgte Abbau von rund 50.000 Pflegekräftestellen in deutschen Krankenhäusern als auch zuletzt die Privatisierung der Uni-Kliniken in Marburg und Gießen, wurde und wird von einer heftigen Debatte über erwünschte und unerwünschte Wirkungen der Umwandlung von zuvor öffentlichen oder freigemeinnützigen Kliniken in privatwirtschaftlich betriebene Krankenhaus-Wirtschaftsunternehmen begleitet.
Sowohl der bis 2008 erfolgte Abbau von rund 50.000 Pflegekräftestellen in deutschen Krankenhäusern als auch zuletzt die Privatisierung der Uni-Kliniken in Marburg und Gießen, wurde und wird von einer heftigen Debatte über erwünschte und unerwünschte Wirkungen der Umwandlung von zuvor öffentlichen oder freigemeinnützigen Kliniken in privatwirtschaftlich betriebene Krankenhaus-Wirtschaftsunternehmen begleitet.
Die Manager von privaten Krankenhausunternehmen oder Klinikketten nennen als ein erwünschtes Ziel von Privatisierung, die Effizienz der stationären Versorgung zu verbessern, also z.B. nicht mehr durch schlechte Behandlungsprozesse Ressourcen zu verschwenden oder technische Neuerung mit Rationalisierungspotenzial zu "verschlafen". Die Gegner oder Kritiker der Privatisierung von Krankenhäusern sehen im Abbau von Personal das wesentliche Mittel dieser Effizienzsteigerung und fürchten, dass dies zu einer Verschlechterung der Behandlungsqualität führt oder führen könnte.
Eine jetzt veröffentlichte Studie von Ökonomen des Zentrums für Gesundheitsökonomie der Universität Hamburg ist die erste Studie, die auf breiter empirischen Basis tiefschürfend untersucht, welche dieser Erwartungen oder Befürchtungen überwiegen.
Sie untersuchen dazu 493 Krankenhäuser, von denen 132 bereits vor dem Beginn der Studie, d.h. in den Jahren 1996 bis 2008, privatisiert worden waren. 99 von ihnen waren von privaten, gewinnorientierten Eigentümern erworben worden, 33 gehören privaten Eigentümern, die mit dem Kauf und Betrieb keine Gewinnabsichten verbanden. Vor detaillierteren Untersuchungen der Privatisierungseffekte, sehen die Autoren einerseits keinen Zusammenhang zwischen dem Privatisierungsgeschehen und der Einführung von Fallpauschalen, relativieren diese Aussage aber, wenn sie ihr Augenmerk nur auf die gewinnorientierten Privatisierungen richten.
Bei den Effekten der Privatisierung zeigte sich Folgendes:
• Zunächst führt die Privatisierung von Krankenhäusern insgesamt zu dem erwarteten Personalabbau. Dies ist aber fast ausschließlich der Effekt der großen Anzahl von "for-profit"-Privatisierungen.
• Nach einer so genannten "for-profit-privatization" gab es große Reduktionen bei den Beschäftigten, die sich bei "non-profit-privatization" nicht bzw. nicht auf Dauer zeigten.
• Auch bei einer "for-profit-privatization" betraf die Reduktion nicht sämtliche Beschäftigtengruppen, sondern bestand vor allem im Abbau von nichtärztlichem Personal, wie z.B. den Pflegekräften oder sonstige therapeutische oder technische Arbeitskräfte. Bei Ärzten konnten die Forscher im Zusammenhang mit Privatisierung keinerlei dauerhaften Personalabbau entdecken.
• Bei der Frage, ob der Personalabbau bei Pflegekräften und sonstigem nichtärztlichem Personal z.B. über die Erhöhung der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft zu unerwünschten Effekten bei der Versorgungsqualität führen, geben die Hamburger Forscher keine abschließende Antwort: "Reductions in nurses and other clinical staff following for-profit privatization may not necessarily lead to quality reductions, however. Public hospitals are likely to be overstaffed before the privatization event. Furthermore, private hospital chains could have decreased their staff-to-patient ratios as a result of increases in productivity by improvement of IT, workflow and standardization. Moreover, there is evidence for Germany that especially private for-profit hospitals, which often operate in very competitive regions, have improved their quality management and hospital outcomes as a way of attracting patients".
Da es auch empirische Studien insbesondere in den USA gibt, die solche unerwünschten Qualitätsmängel nach "for-profit"-Privatisierungen belegten und auch genügend Studien existieren, die zeigen, dass ab einer bestimmten Anzahl von Patienten pro Pflegekraft das Sterblichkeits- und Folgeerkrankungsrisiko kräftig steigt, ist die Absicht hierüber auch in Deutschland mehr Klarheit zu schaffen begrüßenswert.
Auch wenn manche Zusammenhänge von Krankenhaus-Privatisierung und Stellenabbau schon immer in gewerkschaftlichen Analysen zu einzelnen Übernahmen behauptet und belegt wurden, erhärtet die vorliegende Studie nunmehr eine Reihe bisher unklarer systematischer Zusammenhänge dieser Art und zeigt, dass es sich bei diesen Folgen nicht um das Ergebnis einzelner "schwarzen Schafe" handelt.
Der Aufsatz Employment effects of hospital privatization in Germany von Mareike Heimeshoff, Jonas Schreyögg und Oliver Tiemann ist am 24.Juli 2013 im "The European Journal of Health Economics" erschienen. Leider ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.8.13
Ein Hauch von Sisyphos: Vitamin C verhindert Erkältungen nicht und hat bescheidene Wirkungen auf ihre Dauer und Schwere.
 Wenn es nach den Herstellern von Vitamin C-Kapseln und zahllosen Gesundheitsfibeln wie Ratgeberseiten ginge, würden wir alle "für alle Fälle" im gesamten Winterhalbjahr zur Verhinderung von Erkältungen oder der Abkürzung von Dauer und Schwere ihrer Symptome Ascorbinsäure in allen natürlichen oder industriellen Formen oder Zubereitungen zu uns nehmen. Ob das wirklich hilft ist aber seit über 70 Jahren umstritten.
Wenn es nach den Herstellern von Vitamin C-Kapseln und zahllosen Gesundheitsfibeln wie Ratgeberseiten ginge, würden wir alle "für alle Fälle" im gesamten Winterhalbjahr zur Verhinderung von Erkältungen oder der Abkürzung von Dauer und Schwere ihrer Symptome Ascorbinsäure in allen natürlichen oder industriellen Formen oder Zubereitungen zu uns nehmen. Ob das wirklich hilft ist aber seit über 70 Jahren umstritten.
Um hier mehr Klarheit zu schaffen, durchkämmte eine Cochrane-Reviewergruppe jetzt alle Studien der letzten Jahrzehnte, in denen täglich mehr als 200 Milligramm Vitamin C aufgenommen wurden und in denen eine Kontrollgruppe ein Placebo eingenommen hatte. Die meisten Studien waren auch randomisiert und doppel-blind. In den Review gingen dann 29 Studien mit 11.306 TeilnehmerInnen ein.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Das relative Risiko, eine Erkältung zu bekommen, unterschied sich zwischen denjenigen, die Vitamin C oder ein Placebo zu sich nahmen bei den der Durchschnittsbevölkerung zuzurechnenden 10.708 TeilnehmerInnen nicht (RR=0,97).
• Anders war dies nur bei den 598 TeilnehmerInnen in 5 Studien, die Marathonläufer waren oder Skiläufer und Soldaten, deren Tätigkeit oder sportliche Betätigung kurzfristig unter schwersten klimatischen Bedingungen stattfand. Das relative Risiko eine Erkältung zu bekommen war für diesen Personenkreis deutlich geringer, wenn Vitamin C eingenommen wurde (RR=0,48).
• Die Dauer der Erkältung reduzierte sich bei Erwachsenen unter Vitamin C-Aufnahme um 8%, die von Kindern um 14%. Wenn Kinder zwischen 1 und 2 Gramm pro Tag an Vitamin C aufnahmen, sank die Erkrankungsdauer um 18%.
• Nachweisbare und signifikante Wirkungen von Vitamin C gibt es auch auf die Ernsthaftigkeit der Erkältungssymptome. Die Reviewer schränken dies aber mit dem Hinweis "it is modest in absolute terms" deutlich ein.
• Die therapeutischen Studien, d.h. Studien in denen nach Beginn einer Erkältung versucht wird, mittels hoher und sehr hohen Vitamin C-Dosen die Dauer und Schwere der Erkältung zu beeinflussen, "showed no consistent effect" auf beide Zielgrößen. Hier ist auf jeden Fall vor einer uneingeschränkten Empfehlungen z.B. 8 Gramm Vitamin C pro Tag aufzunehmen weitere Forschung notwendig.
• Etwas Gutes zum Schluss: In keiner Studie wurde über unerwünschte Nebenwirkungen der Vitamin C-Ein- oder Aufnahme berichtet.
Die Bewertung der Einnahme von Vitamin C zur Verhinderung von Erkältung ist eindeutig: "Routine vitamin C supplementation is not justified". Trotz teilweise geringen und auch nicht eindeutig zu replizierenden Wirkungen bewerten die Cochrane-Reviewer die Einnahme von Vitamin C zur Beeinflussung von Dauer und Schwere einer eingetretenen Erkältung etwas weniger ablehnend: "It may be worthwhile for common cold patients to test on an individual basis whether therapeutic vitamin C is beneficial for them."
Auch hier gilt natürlich, dass Orangen, Paprika oder andere Vitamin C-Träger aus vielen anderen und guten Gründen weiter verzehrt werden sollten - nur eben nicht mit der Erwartung Erkältungskrankheiten verhindern oder uneingeschränkt zu beeinflussen können.
Von dem am 31. Januar 2013 veröffentlichten Cochrane-Review Vitamin C for preventing and treating the common cold von Hemilä H. und Chalker E. gibt es kostenlos das gewohnt umfangreiche Abstract.
Wer Materialien für ein Lehrstück zur geringen Geschwindigkeit der Verbreitung und Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis sucht, wird auch beim Vitamin C fündig.
So gab es bereits innerhalb des letzten Jahrzehnts mehrere ähnlich lautende Ergebnisse verschiedener methodisch hochwertiger Reviews und Metaanalysen, die bisher offensichtlich kaum erkennbare Wirkungen auf die Werbung für die präventive und therapeutische Aufnahme von Vitamin C und natürlich auf deren wirkliche Aufnahme erzielten.
Zum Beispiel schrieb einer der Autoren des aktuellen Cochrane-Reviews, Hemilä, zusammen mit einem anderen Autoren bereits 2005 u.a.: "The lack of effect of prophylactic vitamin C supplementation on the incidence of common cold in normal populations throws doubt on the utility of this wide practice. The clinical significance of the minor reduction in duration of common cold episodes experienced during prophylaxis is questionable, although the consistency of these findings points to a genuine biological effect. In special circumstances, where people used prophylaxis prior to extreme physical exertion and/or exposure to significant cold stress, the collective evidence indicates that vitamin C supplementation may have a considerable beneficial effect." Der komplette Text dieses Aufsatzes Vitamin C for preventing and treating the common cold. von Douglas RM und Hemilä H ist 2005 in der Open Access-Zeitschrift PLoS Medicine (2(6): e168) erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.2.13
Wo Gesundheit suggeriert wird, muss welche drin sein: Werbung für "bekömmlichen" Wein endgültig auch in Deutschland unzulässig
 Mit einem am 14. Februar 2013 veröffentlichten Urteil schloss sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einer zuvor vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) nach europäischem Recht gefällten Entscheidung an, und erklärte die Weinwerbung mit dem Prädikat "bekömmlich" auch in Deutschland verbindlich für unzulässig.
Mit einem am 14. Februar 2013 veröffentlichten Urteil schloss sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einer zuvor vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) nach europäischem Recht gefällten Entscheidung an, und erklärte die Weinwerbung mit dem Prädikat "bekömmlich" auch in Deutschland verbindlich für unzulässig.
Damit unterlag endgültig eine Winzergenossenschaft aus Rheinland-Pfalz, die ihre Weine unter der Bezeichnung "Edition Mild bekömmlich" mit dem Zusatz "sanfte Säure" vermarktet hatte. Auf dem Etikett hieß es: "Zum milden Genuss wird er durch Anwendung unseres besonderen (..) Schonverfahrens zur biologischen Säurereduzierung."
Sowohl die zuständige Behörde, zwei bundesrepublikanische gerichtliche Instanzen und schließlich der EuGH waren der Ansicht, der normale Verbraucher verstehe unter dem Prädikat "bekömmlich" einen Hinweis auf die besondere Magenverträglichkeit dieser Weine und damit eine gesundheitsbezogene Angabe. Damit verstoße die Werbung gegen die so genannte Health-Claims-Verordnung über die Verwendung nährwert- und gesundheitsbezogener Angaben bei Lebensmitteln (Nr. 1924/2006), die bei alkoholischen Getränken mit einem höheren Alkoholgehalt als 1,2 Volumenprozent generell unzulässig sei.
In der Mitteilung über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird der weitere Rechtsweg bis zum EuGH so zusammengefasst: "Auf die Revision der Klägerin legte das Bundesverwaltungsgericht dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) im Jahr 2010 mehrere Fragen zur Auslegung des Begriffs der gesundheitsbezogenen Angabe vor (Pressemitteilung Nr. 82/2010 vom 23. September 2010). Mit Urteil vom 6. September 2012 (Rs. C-544/10) hat der EuGH entschieden, dass eine Bezeichnung wie "bekömmlich" verbunden mit dem Hinweis auf einen reduzierten Gehalt eines Stoffes, der von einer Vielzahl von Verbrauchern als nachteilig angesehen wird, eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der Verordnung darstellt. Der EuGH hat ferner festgestellt, dass das ausnahmslose Verbot, eine solche Angabe bei der Vermarktung von Wein zu verwenden, mit den durch die Unionsrechtsordnung geschützten Grundrechten der Berufsfreiheit und der unternehmerischen Freiheit vereinbar ist."
Und: "Auf dieser Grundlage hat das Bundesverwaltungsgericht nunmehr die Revision zurückgewiesen (Aktenzeichen 3 C 23.12) und die Entscheidungen der Vorinstanzen bestätigt."
Die Pressemitteilung 9/2013 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Februar 2013 steht kostenlos zur Verfügung. Und auch das schriftliche Urteil ist komplett kostenlos erhältlich.
Das komplette Urteil des EuGH vom 6. September 2012 kann kostenlos heruntergeladen werden.
Die Health Claims-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (ABl. L 404, S. 9) in der zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 116/2010 der Kommission vom 9. Februar 2010 (ABl. L 37, S. 16) geänderten Fassung hat eigentlich anders als EU-Richtlinien unmittelbare Geltung in allen EU-Mitgliedsländern.
Zur Konkretisierung der Health Claimsverordnung setzte die EU-Kommission am 16. Mai 2012 eine weitere Verordnung, nämlich die Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern in Kraft. Darin finden sich auf 40 Seiten, die aus rund 44.000 eingereichten oder recherchierten durch Experten extrahierten gesundheitsbezogenen Angaben, die in der EU uneingeschränkt oder mit präzisen zusätzlichen Angaben zu Werbezwecken benutzt werden dürfen.
Mit Sicherheit ist zu erwarten, dass auf der Basis dieser Verordnung, unabhängig davon, wie verlässlich und vollständig sie ist, auch künftig Werbeaussagen mit gesundheitsbezogenen Angaben insbesondere von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft untersagt werden können.
Bernard Braun, 16.2.13
OLG-Rechtsprechung zum Zweiten: Wer für ein 'gesundheitsförderndes' Produkt wirbt, muss dies wissenschaftlich beweisen können!
 Nachdem bereits das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main in einem Urteil verlangt hat, dass Produkte für die mit gesundheitlichen Wirkungen geworben wird, diese auch nachweisbar haben müssen (vgl. dazu den ausführlichen Forums-Beitrag) kommt das Oberlandesgericht Koblenz in einem Urteil vom 10. Januar 2013 bezogen auf ein anderes Produkt und seine werbliche Vermarktung praktisch zum selben Ergebnis.
Nachdem bereits das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main in einem Urteil verlangt hat, dass Produkte für die mit gesundheitlichen Wirkungen geworben wird, diese auch nachweisbar haben müssen (vgl. dazu den ausführlichen Forums-Beitrag) kommt das Oberlandesgericht Koblenz in einem Urteil vom 10. Januar 2013 bezogen auf ein anderes Produkt und seine werbliche Vermarktung praktisch zum selben Ergebnis.
Der Entscheidung des OLG Koblenz lag der Prospekt eines Warenhauses zugrunde in dem es für Fitnesssandalen warb. Die Werbung behauptete, die Sandale "kann helfen, Cellulite vorzubeugen", "kann helfen, die Muskulatur zu kräftigen", "unterstützt eine gute Haltung" und die "runde Sohlenform unterstützt die natürliche Rollbewegung des Fußes". Zudem wurde in einer Abbildung eine erhöhte Muskelaktivität der Beine um bis zu 20% im unteren Bereich, bis zu 13% im mittleren Bereich und bis zu 30% im oberen Bereich behauptet.
Dagegen klagte ein Verein zu dessen Aufgabe die Wahrung der Wettbewerbsregeln im Interesse seiner Mitglieder gehört, mit der Feststellung die werbenden Aussagen seien unrichtig und sollten unterlassen werden. Trotz eines Erfolgs dieser Klage beim Landgericht Mainz ging das Warenhaus dann beim OLG in Berufung. Im ersten Prozess hatte ein Sachverständiger gegutachtet, die in der Werbung aufgeführten Effekte seien wissenschaftlich nicht belegt.
In seinem Urteil untersagte der der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz (Urteil vom 10. Januar 2013, Az.: 9 U 922/12) entgültig, die Werbung der Beklagten sei irreführend. Die dazu bisher veröffentlichte Pressemitteilung fasst den Tenor des Urteils so zusammen: "Es sei nicht wissenschaftlich erwiesen, dass das Tragen der Sandalen die behaupteten Effekte zeige. Wer mit gesundheitlichen Wirkungen von Produkten werbe, müsse besonders strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Aussagen erfüllen. Wenn aber eine gesundheitsfördernde Wirkung nicht hinreichend wissenschaftlich belegt werden könne, sei die Werbung zur Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher geeignet und damit irreführend. Aufgrund dieser Irreführung wurde der Beklagten untersagt, mit diesen Aussagen für die Fitnesssandalen zu werben."
Sicherlich ist es nach den beiden Urteilen möglich, den künftigen Verbraucherschutz in Sachen Gesundheit weiteren Land-, Oberlandes- und last not least dem Bundesgerichtshof zu überlassen. Darüber gehen weitere Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt ins Land und in dieser Zeit werden Tausende von Anbieter für Zehntausende weiterer Produkte und Dienstleistungen ohne einen Fetzen von Nutzen- oder Wirksamkeitsnachweis oder sogar trotz nachgewiesener Unwirksamkeit mit "Gesundheits"-Prädikaten werben, damit Milliarden Euro umsetzen und Millionen von Verbrauchern und zum Teil auch PatientInnen täuschen. Die Alternative wären eindeutige gesetzliche Regelungen, deren rechtlich solide Grundlage mit den Urteilsbegründungen der RichterInnen zweier OLGs bereits vorliegt.
Die Pressemitteilung zum Urteil des OLG Koblenz ist kostenlos erhältlich.
Das lesenswerte Urteil ist über die Entscheidungsdatenbank der Justiz Rheinland-Pfalz das o.g. Aktenzeichen und die Suchbegriffe Oberlandesgericht und Sandalen komplett kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 19.1.13
"Gesundheitsmonitoring und -management aus der Hosentasche!" oder wie verlässlich sind Gesundheits-Apps?
 Die Versprechungen und Hoffnungen, die mit der Informationstechnologie und besonders für den Alltag von Gesundenmit den immer zahlreicher werdenden Gesundheits-Applikationen (Apps) für Smartphones verbreitet und gehegt werden, wachsen explosionsartig. Dies gilt unabhängig davon, ob es um die laufende Blutdruck- oder zuckermessung, Erinnerungen an die Einnahme von Arzneimitteln oder die Ermittlung, Dokumentation, Berechnung zahlreicher Körperwerte oder -erscheinungen und deren Online-Weitergabe an medizinisch-technische Zentren geht. Wie leider bei vielen "alten" Gesundheitsleistungen üblich, werden Zweifel an der Verlässlichkeit und dem Nutzen solcher Apps nicht ernst genommen oder als moderne Maschinenstürmerei ins Abseits diskutiert.
Die Versprechungen und Hoffnungen, die mit der Informationstechnologie und besonders für den Alltag von Gesundenmit den immer zahlreicher werdenden Gesundheits-Applikationen (Apps) für Smartphones verbreitet und gehegt werden, wachsen explosionsartig. Dies gilt unabhängig davon, ob es um die laufende Blutdruck- oder zuckermessung, Erinnerungen an die Einnahme von Arzneimitteln oder die Ermittlung, Dokumentation, Berechnung zahlreicher Körperwerte oder -erscheinungen und deren Online-Weitergabe an medizinisch-technische Zentren geht. Wie leider bei vielen "alten" Gesundheitsleistungen üblich, werden Zweifel an der Verlässlichkeit und dem Nutzen solcher Apps nicht ernst genommen oder als moderne Maschinenstürmerei ins Abseits diskutiert.
Dass dies kurzschlüssig ist und möglicherweise gesundheitlich nachteilig, zeigt eine gerade veröffentlichte kleine Studie zur diagnostischen Verlässlichkeit von Apps, die ihren Nutzern versprechen, Hautveränderungen oder -verletzungen und Muttermale visuell untersuchen zu können und dabei Melanome, d.h. eine äußerst aggressive Hautkrebsform erkennen zu können. Dazu wurden von einer Forschergruppe der Universität Pittsburgh 188 Bilder von Melanomen und vorher von Dermatologen als harmlos diagnostizierten Hautflecken zusammengestellt, welche mit den Apps optisch untersucht wurden.
Die Ergebnisse weisen auf ein massives Verlässlichkeitsproblem bei den zum Einsatz gekommenen weit verbreiteten vier Apps hin:
• Die Trefferquote oder Sensitivität der Apps schwankte zwischen 6,8% und 98,1%. Sensitivität gibt an bei wie vielen erkrankten Patienten die jeweilige Krankheit durch die Anwendung des Tests tatsächlich erkannt wird, d.h. ein positives Testresultat auftritt. Die Spezifität, also die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Gesunde, die nicht an der betreffenden Erkrankung leiden, im Test auch als gesund erkannt werden, schwankt zwischen 30,4% und 93,7%
• Drei der vier Programme schätzten mindestens 30% der Melanome als harmlos ein. Sie wiegen ihre Nutzer also in eine falsche Sicherheit, und verhindern damit die bei dieser sehr schnell wachsenden und metastasierenden Krebsart notwendige sofortige Behandlung.
• Dabei erwiesen sich vor allem die Apps als unzuverlässiger oder fehlerhafter, bei denen die Diagnose durch eine spezielle automatische Bildererkennungssoftware mit einem entsprechenden Algorithmus gestellt wurde. Die mehr oder weniger bessere App schickte die Daten zur Beurteilung an ein dermatologisches Diagnose-Zentrum, das dann den Nutzer per Mail oder SMS über das Ergebnis informierte. Dass aber auch bei dieser App Fehldiagnosen auftraten zeigt, dass beim Verdacht auf ein Melanom die letzte Gewissheit einer Bewertung von Hautveränderungen nur durch eine mikroskopische Untersuchung einer Hautprobe durch einen Dermatologen gewonnen werden kann.
Im Lichte dieser Ergebnisse und angesichts der mit Sicherheit von der Gesundheitswirtschaft weiterhin in Hülle und Fülle angebotenen derartigen "do-it-yourself"-Gesundheitshilfen, sollte so frühzeitig wie möglich für zweierlei gesorgt werden:
• Obligatorische Überprüfung der Verlässlichkeit und Qualität aller mit dem Image des "Gesundheits"-Hilfsmittel werbenden Produkte der "neuen" Gesundheitswirtschaft
• Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung entweder das Verbot des Anbietens als "Gesundheits"-Hilfe oder sogar bei entsprechend hohem Risiko von Fehldiagnosen oder falscher Sicherheit ein Verbot des Marktzugangs.
Der am 16. Januar 2013 im Fachjournal "JAMA Dermatology" (2013;():1-4) erschienene Aufsatz "Diagnostic Inaccuracy of Smartphone Applications for Melanoma Detection" von Joel A. Wolf et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.1.13
Vitamin D-Einnahme senkt Risiko der kardiovaskulären Morbidität!? Zunächst einmal Fehlanzeige und Warnung vor zu hohen Erwartungen
 In vielen Beobachtungsstudien waren niedrigere Vitamin D-Werte mit höheren kardiovaskulären Risikofaktoren wie einem hohen Fettsäurespiegel und Bluthochdruck assoziiert. Daraus schlossen zahlreiche Ärzte, zum Teil auch durch einen Report des "Institute of Medicine (IOM)" aus dem Jahr 2010 ermuntert, ihren PatientInnen trotz fehlender randomisierter kontrollierter Studien mit harten Endpunkten zu raten, zusätzlich zu der mit der normalen Nahrung und Lebensweise aufgenommenen Menge des Vitamins noch Ergänzungsmittel zu sich zu nehmen - um das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen zu senken.
In vielen Beobachtungsstudien waren niedrigere Vitamin D-Werte mit höheren kardiovaskulären Risikofaktoren wie einem hohen Fettsäurespiegel und Bluthochdruck assoziiert. Daraus schlossen zahlreiche Ärzte, zum Teil auch durch einen Report des "Institute of Medicine (IOM)" aus dem Jahr 2010 ermuntert, ihren PatientInnen trotz fehlender randomisierter kontrollierter Studien mit harten Endpunkten zu raten, zusätzlich zu der mit der normalen Nahrung und Lebensweise aufgenommenen Menge des Vitamins noch Ergänzungsmittel zu sich zu nehmen - um das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen zu senken.
Ob die Grundannahme zu den Wirkungen des Vitamin D stimmt, untersuchten jetzt britische ForscherInnen in einer randomisierten kontrollierten Studie mit 305 postmenopausalen Frauen im Alter von durchschnittlich 64 Jahren, von denen keine kardiovaskuläre Erkrankung bekannt war. Die TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe bekamen täglich ein Jahr lang entweder 400 oder 1.000 standardisierte Einheiten des Vitamins.
Das Ergebnis der Studie war klar:
• Zu Studienbeginn war der durchschnittliche Level des Vitamins im Körper aller TeilnehmerInnen mit 13,5 ng/mL ähnlich hoch bzw. niedrig.
• Nach einem Jahr hatte sich dieser Level in beiden Interventionsgruppen verdoppelt und war in der Kontrollgruppe unverändert hoch.
• Entgegen den Erwartungen veränderte der deutlich höhere Vitamin D-Wert bei den weiblichen Angehörigen der Vitamin-Gruppen im Vergleich mit den Angehörigen der Placebogruppe nicht signifikant die Werte der kardiovaskulären Risikofaktoren oder -werte.
• Ungeklärt bleibt die Frage, ob Vitamin D nicht auf andere Weise als über die Risikofaktoren auf das Risiko einer kardiovaskulären Erkrankung einwirkt. Aber selbst wenn dies so ist, berechtigt dies nicht, die Einnahme von Vitamin D mit diesem Ziel zu fördern.
Die ForscherInnen empfehlen auf der Basis ihrer Studie, die zusätzliche Auf-/Einnahme von Vitamin D als Mittel zur Veränderung oder Absenkung von kardiovaskuären Risikofaktoren so lange nicht zu empfehlen bzw. zu unterlassen bis weitere entsprechende methodisch geeignete Analysen zeigen, dass diese Vitaminergänzung wirklich die kardiovaskuläre Morbidität absenkt. Ob die Zusammensetzung der Interventionsgruppe aus relativ gesunden Frauen oder andere Faktoren den Mangel an Ein-/Auswirkung auf die spezielle kardiovaskuläre Morbidität erklärt, wird angesprochen, aber nicht abschließend geklärt. Auch solche offenen Fragen rechtfertigen aber nicht die mit festen Erwartungen dieser Effekte verbundene Aufnahme von Vitaminkapseln.
Die in diesem Zusammenhang erwähnte "VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL)"-Studie beendet noch oder erst in diesem Jahr die Aufnahme von TeilnehmerInnen und wird daher erst in mehreren Jahren die Erkenntnisse über den primär-präventiven Nutzen des Vitamin D gewinnen und verbreiten können.
Von dem Aufsatz "Vitamin D3 supplementation has no effect on conventional cardiovascular risk factors: A parallel-group, double-blind, placebo-controlled RCT" von Wood AD et al. - erschienen im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism(2012 Oct; 97: 3557) - ist ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.10.12
Erneut kein signifikanter Nutzen "gekaufter Gesundheit": Magnesium bei Muskelkrämpfen von älteren Personen und Schwangeren.
 Wer nach Beispielen nach Über- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem sucht, wird insbesondere im Bereich von oft frei käuflichen Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Nahrungsergänzungsmitteln fast immer fündig.
Wer nach Beispielen nach Über- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem sucht, wird insbesondere im Bereich von oft frei käuflichen Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Nahrungsergänzungsmitteln fast immer fündig.
Dies gilt nach den gründlichen Analysen eines am 12. September 2012 veröffentlichten Cochrane-Reviews auch für Magnesium, das offensiv und auch häufig von Ärzten als prophylaktisches "natürliches" Mittel gegen Muskelkrämpfen bei Schwangeren, Höheraltrigen und Personen mit Krämpfen nach körperlicher Bewegung gepriesen wird.
Dazu analysierten die Reviewer zunächst alle zwischen Mitte der 1970er Jahren und heute durchgeführten randomisierten kontrollierten Studien, welche die behaupteten und vermuteten Wirkungen auf bzw. gegen Muskelkrämpfe im Vergleich von Personen, die Magnesium einnahmen, mit unbehandelten Personen, Placebobehandelten oder sonstig therapierten Personen untersucht hatten.
Dabei fanden sich sieben aussagefähige Studien mit insgesamt 406 TeilnehmerInnen. Drei Studien kümmerten sich um Muskelkrämpfe in den Beinen von Schwangeren und vier Studien um Personen, die ohne fassbare Ursachen an Krämpfen litten.
Die wesentlichen Ergebnisse des erstmalig durchgeführten systematischen Reviews lauteten:
• Für die vor allem bei älteren Erwachsenen auftretenden idiopathischen Krämpfe gab es in der Magnesiumgruppe gegenüber den TeilnehmerInnen in der Placebogruppe zwar einen kleinen Unterschied, der aber nicht statistisch signifikant war. So nahm die Anzahl der Krämpfe pro Woche gegenüber dem Ausgangswert zu Beginn der Studie bei den MagnesiumnutzerInnen um 3,93% ab. Der Unterschied bei der Anzahl betrug zwischen den beiden Personengruppen nach vier Wochen gerade einmal 0,01 Krämpfe pro Woche.
• Der Anteil der Personen, deren Krampfrate nach Start der Studie um 25% oder mehr abnahm, war in der Magnesiumgruppe (-8%) nicht wesentlich größer als in der Placebogruppe - der Unterschied daher auch nicht signifikant, also möglicherweise rein zufällig.
• Nach vier Wochen gab es ferner keinen signifikanten Unterschied bei der Krampfintensität und -dauer. Einschränkend erwähnen die Reviewer hier aber die geringe Anzahl von Studien, die diese Indikatoren überhaupt erhoben und bewerteten.
• In ihren Schlussfolgerungen halten die Reviewer es insbesondere für ältere Erwachsene für unwahrscheinlich, dass zusätzliche Einnahmen von Magnesium zu einer klinisch spürbaren und bedeutenden Prophylaxe von Krämpfen beitragen. Für die möglichen Wirkungen von Magnesium auf Muskelkrämpfe von Schwangeren ist die Forschungsliteratur widersprüchlich. Und schließlich beschäftigte sich bisher noch keine RCT mit bewegungsassoziierten oder mit bestimmten Erkrankungen assoziierten Muskelkrämpfen.
Über den Cochrane-Review Magnesium for skeletal muscle cramps. von Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK, et al. (Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12; 9: CD009402) gibt auch der gewohnt ausführliche kostenlose Abstract Auskunft.
Bernard Braun, 29.10.12
Was wäre, wenn kommunale Krankenhäuser Weihnachtsmärkte wären? Schluss mit ihrer Privatisierung!?
 Es "steht…nicht im freien Ermessen einer Gemeinde, 'freie Selbstverwaltungsangelegenheiten' zu übernehmen oder sich auch jeder Zeit wieder dieser Aufgaben zu entledigen. Gehören Aufgaben zu den Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises, so darf sich die Gemeinde im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung dieses örtlichen Wirkungskreises, der ausschließlich der Gemeinde, letztlich zum Wohle der Gemeindeangehörigen, anvertraut ist, nicht ihrer gemeinwohlorientierten Handlungsspielräume begeben. Der Gemeinde steht es damit nicht grundsätzlich zu, sich ohne Weiteres der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu entledigen. Anderenfalls hätten es die Gemeinden selbst in der Hand, den Inhalt der kommunalen Selbstverwaltung durch Abstoßen oder Nichtwahrnehmung ihrer ureigenen Aufgaben auszuhöhlen. Um ein Unterlaufen des ihr anvertrauten Aufgabenbereichs zu verhindern, muss sich die Gemeinde grundsätzlich zumindest Einwirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten vorbehalten, wenn sie die Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises anderen übertragen will. Sie kann sich damit nicht ihres genuinen Verantwortungsbereichs für die Wahrnehmung ihrer Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises entziehen. Will sie Dritte bei der Verwaltung bestimmter Bereiche ihres eigenen Aufgabenbereichs einschalten, die gerade das Zusammenleben und das Zusammenwohnen der Menschen in der politischen Gemeinschaft betreffen, so muss sie ihren Einflussbereich über die Entscheidung etwa über die Zulassung im Grundsatz behalten. Der Gemeinde ist es verwehrt, gewissermaßen den Inhalt der Selbstverwaltungsaufgaben selbst zu beschneiden oder an Dritte abzugeben."
Es "steht…nicht im freien Ermessen einer Gemeinde, 'freie Selbstverwaltungsangelegenheiten' zu übernehmen oder sich auch jeder Zeit wieder dieser Aufgaben zu entledigen. Gehören Aufgaben zu den Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises, so darf sich die Gemeinde im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung dieses örtlichen Wirkungskreises, der ausschließlich der Gemeinde, letztlich zum Wohle der Gemeindeangehörigen, anvertraut ist, nicht ihrer gemeinwohlorientierten Handlungsspielräume begeben. Der Gemeinde steht es damit nicht grundsätzlich zu, sich ohne Weiteres der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu entledigen. Anderenfalls hätten es die Gemeinden selbst in der Hand, den Inhalt der kommunalen Selbstverwaltung durch Abstoßen oder Nichtwahrnehmung ihrer ureigenen Aufgaben auszuhöhlen. Um ein Unterlaufen des ihr anvertrauten Aufgabenbereichs zu verhindern, muss sich die Gemeinde grundsätzlich zumindest Einwirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten vorbehalten, wenn sie die Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises anderen übertragen will. Sie kann sich damit nicht ihres genuinen Verantwortungsbereichs für die Wahrnehmung ihrer Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises entziehen. Will sie Dritte bei der Verwaltung bestimmter Bereiche ihres eigenen Aufgabenbereichs einschalten, die gerade das Zusammenleben und das Zusammenwohnen der Menschen in der politischen Gemeinschaft betreffen, so muss sie ihren Einflussbereich über die Entscheidung etwa über die Zulassung im Grundsatz behalten. Der Gemeinde ist es verwehrt, gewissermaßen den Inhalt der Selbstverwaltungsaufgaben selbst zu beschneiden oder an Dritte abzugeben."
Wer glaubt, hier handle es sich um eine Passage aus dem neuesten kommunalpolitischen Grundsatzpapier der Gewerkschaft Ver.di irrt und darf ein zweites Mal raten.
"Aus der bundesverfassungsrechtlichen Garantie der kommunalen Selbstverwaltung folgt, dass sich eine Gemeinde im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft nicht ihrer gemeinwohlorientierten Handlungsspielräume begeben darf. Eine materielle Privatisierung eines kulturell, sozial und traditionsmäßig bedeutsamen" Bereichs, "der bisher in alleiniger kommunaler Verantwortung betrieben wurde, widerspricht dem. Eine Gemeinde kann sich nicht ihrer hierfür bestehenden Aufgabenverantwortung entziehen. Ihr obliegt vielmehr auch die Sicherung und Wahrung ihres Aufgabenbereichs, um eine wirkungsvolle Selbstverwaltung und Wahrnehmung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu gewährleisten."
Wer immer noch an Ver.di oder eine kommunalpolitische Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD denkt, aber das Gefühl hat, das passe "irgendwie" nicht zu den in seiner Gemeinde laufenden Absichten ein bisher kommunales Krankenhaus an einen privaten Krankenhaus-Träger zu verkaufen oder zu verscherbeln, irrt erneut, aber goldrichtig.
Beide Zitate stammen aus einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Mai 2009. Und auch wenn es sich konkret um ein letztinstanzliches Urteil zur Privatisierung des lange Zeit in alleiniger kommunaler Verantwortung betriebenen Offenbacher Weihnachtsmarktes handelt, gehören natürlich Krankenhäuser ohne Zweifel zu den sozial bedeutsamen Bereichen einer Kommune.
Und wem dies zu spekulativ erscheint, kann sich durch den Kommentar der privaten Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) eines besseren belehren lassen: "Diese Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts könnte sich auch auf andere Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung auswirken. Das Urteil beschränkt die Privatisierungsmöglichkeiten einer Gemeinde zumindest auf kulturell, sozial und traditionsmäßig bedeutsame Aufgabenbereiche….Ferner ist nun das rechtliche Risiko deutlich gestiegen, dass private Dritte Privatisierungsentscheidungen einer Gemeinde gerichtlich angreifen und womöglich ganz verhindern."
Und wie viele "gerichtlichen Angriffe" auf Privatisierungen kommunaler Krankenhäuser oder Schwimmbäder gibt es seit 2009? Richtig geraten: keine (bekannt gewordenen).
Die "Entdeckung" dieses Urteils ist dem Geschäftsführer der Frankfurter Nicht-Regierungsorganisation medico international zu verdanken, der im medico Rundschreiben 03/2012 mit seinem Beitrag Bescherung im Gesundheitswesen darauf aufmerksam machte. Zu weiterer Verbreitung dieses Wissens trug nun der
Frankfurter Chirurg Bernd Hontschik bei, der neben seiner Praxis auch noch wöchentlich in der "Frankfurter Rundschau" engagierte und meist kluge Kommentare zur gesundheitspolitischen Situation in Deutschland verfasst und Herausgeber der im Suhrkamp-Verlag erscheinenden Buchreihe "Medizin Human" ist. Die Kommentare kann man entweder in der FR lesen oder sie sich regelmäßig kostenlos zumailen lassen (chirurg@hontschik.de).
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts mit dem Aktenzeichen 8 C 10.08 kann komplett kostenlos heruntergeladen werden und ist auch außerhalb der zitierten Passagen für Nichtjuristen interessant und verständlich.
Und auch der PwC-Kommentar "Privatisierung öffentlicher Einrichtungen durch die Gemeinde" ist in Gänze auf der Website der wahrscheinlich auch gelegentlich mit Krankenhaus-Privatisierungen befassten Beratungsfirma kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.9.12
"Zuerst zahlen dann behandeln": "Bedside-Schuldenmanagement" als neuester Zweig der US-Gesundheitswirtschaft
 Natürlich wird so etwas in deutschen Krankenhäusern oder Arztpraxen nie passieren, doch auch in den USA gehört die offene oder "under cover"-Präsenz von Schuldeneintreiberfirmen in Notaufnahmestationen von Krankenhäusern und das von ihnen betriebene Inkasso von Honoraren vor (!) Beginn der Behandlung auch noch nicht lange zum Instrumentarium der Krankenhaus-Ökonomie.
Natürlich wird so etwas in deutschen Krankenhäusern oder Arztpraxen nie passieren, doch auch in den USA gehört die offene oder "under cover"-Präsenz von Schuldeneintreiberfirmen in Notaufnahmestationen von Krankenhäusern und das von ihnen betriebene Inkasso von Honoraren vor (!) Beginn der Behandlung auch noch nicht lange zum Instrumentarium der Krankenhaus-Ökonomie.
Angestoßen durch Dokumente, die die Generalstaatsanwältin ("attorney general") des Bundesstaates Minnesota anlässlich der Erhebung einer Anklage gegen eine der größten Firmen dieser Branche, zu deren Praktiken veröffentlicht hat, berichtet die "New York Times" am 25. April 2012 ausführlich über die neueste Ausgeburt des anhaltenden Fehlens eines sozialen Versicherungs- und Versorgungssystems. Die Firma "Accretive Health", eines der us-weit größten und am dynamischsten wachsende Inkassounternehmen für nicht bezahlte Rechnungen für medizinisch-ärztliche Leistungen, wird beschuldigt "having placed its employees in emergency rooms and other departments at two hospitals and demanding that patients pay before receiving treatment."
Die erwähnten Dokumente zeigen, dass die Inkassounternehmen fast vor keiner erlaubten und unerlaubten Methode zurück schrecken, das Geld für Behandlungen vor deren Beginn einzutreiben. So treten sie oft nicht als Inkasso-Beschäftigter auf, sondern sind so in das Krankenhausgeschehen "eingebettet", dass sie zunächst als Krankenhausbeschäftigte wahrgenommen werden. In zahlreichen Fällen erhielten sie auch illegal Zugang zu Unterlagen über die Diagnosen und Behandlungen von Patienten. Jedenfalls enthielt ein verlorener und wieder gefundener Laptop eines SChuldeneintreibers der Firma derartige Daten von 23.500 PatientInnen aus Minnesota in unverschlüsselter Form.
Die Namen von PatientInnen, die bereits einmal eine Rechnung nicht bezahlt hatten wurden auf so genannten "stop lists" erfasst, was ihnen selbst den Zugang zu lebensrettenden Maßnahmen ohne vorherige Bezahlung erschwerte. Obwohl die jetzt angeklagte Firma dies lang als "Geschwätz" abtat, belegen die veröffentlichten Dokumente diese Praxis eindeutig. Beschäftigte des Inkassounternehmens ermunterten Beschäftigte in Notfallambulanzen dazu, ankommende Patienten zuerst um eine Kreditkartenzahlung zu bitten oder machten dies selber. Wenn dies nicht klappte, wurde den Pflegekräften etc. zu folgendem Satz geraten: "If you have your checkbook in your car I will be happy to wait for you" - was man auch als Versuch der Verweigerung von Hilfeleistungen oder Nötigung verstehen kann. Als eine Krankenhausgruppe im Bundesstaat Minnesota, die Fairview Health Services, im März ankündigte, ihren Inkasso-Vertrag mit Accretive Health zu kündigen, startete das Schuldeneintreiberunternehmen eine "Informationskampagne" zu dieser Entwicklung bei den Investoren der Krankenhausgruppe. Der Kurswert der Krankenhausgruppe sank daraufhin beträchtlich.
Um nicht missverstanden zu werden: Die unbezahlten Versorgungsleistungen der mehr als 5.000 örtlichen Krankenhäuser sind ein ernstes Problem für sie und beliefen sich 2010 auf 39,2 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung um 16% gegenüber 2007 bedeutete. Zu den Hauptgründen zählen die unbezahlten Behandlungsrechnungen und die kostenlose Behandlung von nicht- oder unterversicherten PatientInnen in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser und damit der politisch verursachte mangelnde Krankenversicherungsschutz von 40 bis 50 Millionen US-BürgerInnen.
Dass dies für einige Unternehmen sogar lukrativ sein kann, zeigt die Gewinnentwicklung der Firma Accretive. 2011 berichtete sie von 29,2 Millionen US-Dollar Gewinn, was eine Steigerung um 130% gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Ob dies so weiter geht und sich diese "Geschäftsidee" weiter verbreitet, entscheidet letztlich die Wahl des US-Präsidenten im November 2012.
Der "New York Times"-Artikel "Debt Collector is faulted for tough tactics in hospitals" vom 24. April 2012 ist kostenlos erhältlich.
Die 36-seitige Klageschrift "State of Minnesota versus Accretive Health Inc." vom 19. Januar 2012, u.a. wegen schwerer Verstöße gegen das "Health Insurance Portability and Accountability Act (Hippaa)" von 1996 ist ebenfalls frei zugänglich. Dieses Gesetz verbietet es z.B. , dass Schuldeneintreiber Einblick in die Krankenakte des Patienten oder potenziellen Schuldners haben.
Eine Zusammenfassung liefert die Presseerklärung "ATTORNEY GENERAL SWANSON SUES ACCRETIVE HEALTH FOR PATIENT PRIVACY VIOLATIONS. Debt Collector Lost Laptop Containing Sensitive Data on 23,500 Minnesota Patients der Generalstaatsanwältin.
Über die Website der Anklägerin erhält man außerdem freien Zugang zu der sechsbändigen Dokumentensammlung "Compliance Review of Fairview Health Services' Management Contracts with Accretive Health, Inc.".
Bernard Braun, 26.4.12
Antioxidative Nahrungsergänzungsmittel von Vitamin A bis Selen: Nicht nur nutzlos, sondern zum Teil sogar lebensverkürzend
 So genannte Antioxidantien gelten seit einiger Zeit als wahre Wundermittel, Körperzellen gegen schädliche äußere Einflusse zu schützen und im Falle des Schutzes vor Krebs auch als lebensverlängernd. Diese Wirkungen wurden auch durch einige Tierexperimente, durch physiologische Modelle und einige Beobachtungsstudien gestützt. Andere Beobachtungsstudien hatten aber auf fehlende positive Wirkungen und sogar unerwünschte schädigende Effekte hingewiesen. Trotzdem boomen das Geschäft und die Einnahme von Beta-Carotin-, Vitamin A-, Vitamin C- und Selenpräparate als so genannte Nahrungsergänzungsmittel.
So genannte Antioxidantien gelten seit einiger Zeit als wahre Wundermittel, Körperzellen gegen schädliche äußere Einflusse zu schützen und im Falle des Schutzes vor Krebs auch als lebensverlängernd. Diese Wirkungen wurden auch durch einige Tierexperimente, durch physiologische Modelle und einige Beobachtungsstudien gestützt. Andere Beobachtungsstudien hatten aber auf fehlende positive Wirkungen und sogar unerwünschte schädigende Effekte hingewiesen. Trotzdem boomen das Geschäft und die Einnahme von Beta-Carotin-, Vitamin A-, Vitamin C- und Selenpräparate als so genannte Nahrungsergänzungsmittel.
Eine 2012 aktualisierte und auf noch breiterer Studienbasis argumentierende Fassung eines so genannten Cochrane-Reviews aus dem Jahr 2008 kommt jetzt aber zum Schluss, dass diese Mittel nicht nur weitgehend nutzlos sind, sondern zum Teil sogar lebensverkürzend wirken.
Dies ist das Ergebnis eines systematischen Reviews von 78 randomisierten kontrollierten klinischen Studien mit 296.707 TeilnehmerInnen, die entweder eines der genannten Nahrungsergänzungsmittel, ein Placebo oder gar nichts einnahmen. Unter den TeilnehmerInnen waren 215.900 gesund und 80.807 litten an verschiedenen Krankheiten wie Magen-Darm-, Herz-Kreislauf oder Hauterkrankungen. Die TeilnehmerInnen waren durchschnittlich 63 Jahre alt und die Dauer der Einnahme der Vitamine und sonstigen Stoffe lag bei durchschnittlich 3 Jahren zwischen 28 Tagen und 12 Jahren.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Insgesamt hatten alle antioxidativen Ergänzungsstoffe in einer Metaanalyse keine statistisch signifikante Wirkung auf die Sterblichkeit. Diese Nichtwirkung war sowohl in primär- als auch in sekundärpräventiv angelegten Studien zu beobachten.
• Wenn auch nur schwach und nicht bei allen Stoffen, war aber die Sterblichkeit unter den NutzerInnen einiger der Mittel oder Stoffe um das 1,03- bis 1,04-Fache höher als bei den jeweiligen NichtnutzerInnen. Die höhere Sterberate trat bei den Personen auf, die Beta-Carotin oder die Vitamine E und A (möglicherweise aber nur bei höheren Dosen) als Ergänzungsmittel einnahmen, nicht aber bei den Konsumenten von Vitamin C und Selen.
Die Reviewer raten daher sowohl gesunden als auch kranken Menschen von einer Nahrungsergänzung mit Antioxidantien wegen deren mangelnder Wirkung und schädlicher Effekte ab. Sie weisen auch darauf hin, dass diese Mittel oft als "natürlich" verharmlost werden und ihr Charakter als medizinische Produkte übersehen wird. Da sie dies aber sind, fordern die WissenschaftlerInnen vor der Marktzulassung solcher Stoffe eine strenge Bewertung. Zu betonen ist noch, dass dies kein Plädoyer gegen die Aufnahme der genannten Vitamine oder Stoffe durch die normale Ernährung ist, sondern sich nur gegen die dann meist auch noch hoch dosierte Aufnahme von Ergänzungsmitteln richtet.
Von dem am 14. März 2012 veröffentlichten aktualisierten Cochrane-Review "Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases" von Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG und Gluud C. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007176) gibt es kostenlos nur das Abstract. Dort findet man aber wie bei Abstract von Cochrane-Reviews gewohnt eine Fülle von quantitativen Daten und auch differenzierte methodische Darstellungen.
Bernard Braun, 25.3.12
WHO-Kompendium zu Gesundheitstechnologien für die 3. Welt: Eine Dauerwerbesendung der Medizintechnikindustrie
 In letzter Zeit wird speziell in Deutschland mehr darüber geredet, auch die Zulassung und den Einsatz von medizintechnischen Apparaten und Verfahren mindestens von einem bei der Zulassung von Arzneimitteln relativ etablierten Nachweis der Wirksamkeit, des Nutzens und der Sicherheit abhängig zu machen. Nicht alles wo "wissenschaftlich-technischer Fortschritt" draufsteht und auf wo ein TÜV-Siegel klebt sollte zum "Menschenversuch" zugelassen werden.
In letzter Zeit wird speziell in Deutschland mehr darüber geredet, auch die Zulassung und den Einsatz von medizintechnischen Apparaten und Verfahren mindestens von einem bei der Zulassung von Arzneimitteln relativ etablierten Nachweis der Wirksamkeit, des Nutzens und der Sicherheit abhängig zu machen. Nicht alles wo "wissenschaftlich-technischer Fortschritt" draufsteht und auf wo ein TÜV-Siegel klebt sollte zum "Menschenversuch" zugelassen werden.
Davon völlig unberührt scheint die weltweite Public Health-Institution Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu sein, wenn es um ein Kompendium zu Gesundheitstechnologien ausgerechnet oder gerade für Entwicklungsländer geht.
Dieses Kompendium ist ein drastisches Beispiel dafür, dass die WHO bei Bedarf nicht mehr die Interessen der Patienten und Krankenversicherten in ihren Mitgliedsländern vertritt, sondern vorrangig die der Anbieter von Gesundheitsleistungen. Die extreme Nähe der WHO bzw. eines Teils ihrer Fachberater zur Herstellerfirma des Schweinegrippe-Medikaments Tamiflu war offensichtlich kein einmaliger Ausrutscher.
Die WHO hebt bei dem Kompendium zunächst dessen Neutralität hervor: "The compendium of new and emerging technologies that address global health concerns has been created as a neutral platform for technologies which are likely to be suitable for use in low-resource settings."
Ihr Kompendium soll zu einem notwendigen Dialog zwischen Gesundheitspolitikern in der Dritten Welt, Produzenten, Ärzten und anderen Akteuren des Gesundheitswesens beitragen und zu einer stärkeren Verbreitung verschiedener Gesundheitstechnologien in den ärmeren Ländern beitragen. So weit, so gut: "The compendium 2011 is a first snapshot of several health technologies which might have the potential to improve health outcomes or to offer a solution to an unmet medical need in low-resource settings. The compendium specifically focuses on innovative technologies that are not yet widely available in developing countries, and product concepts under way."
Die im Kompendium auf jeweils einer Seite vorgestellten und bewerteten in Entwicklung befindlichen oder auch bereits vertriebenen Gesundheitstechnologien wurden von Mitgliedern der internationalen Gesundheitstechnologie-Agentur EuroScan-Gruppe und der WHO "based on data and information provided by the developers of the technologies" ausgewählt.
Die Anbieterabhängigkeit oder -geneigtheit ist aber nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei einigen für die weitere Entscheidungsfindung über den Einsatz der Gesundheitstechnik-Innovationen wichtigen Informationen bestimmend.
In erfreulicher Offenheit heißt es dazu im Kompendium: "However, the evaluation by EuroScan member agencies and WHO has been solely based on a limited assessment of data and information submitted in the developers' applications and, where available, of additional sources of evidence, such as literature search results or other publicly available information. There has been no rigorous review for safety, efficacy, quality, applicability, nor cost acceptability of any of the technologies. Therefore, inclusion in the compendium does not constitute a warranty of the fitness of any technology for a particular purpose. Besides, the responsibility for the quality, safety and efficacy of each technology remains with the developer and/or manufacturer."
Bei der Lektüre der Steckbriefe von insgesamt 44 Gesundheitstechnologien findet man dann auch fast keine unabhängige Bewertung zur Qualität der Innovation, sondern nahezu ausschließlich Herstellerprospekt-Angaben.
Selbst wenn die WHO an einer Stelle beteuert, sie wolle "not be held to endorse nor to recommend any technology included in the compendium", zeigt dies lediglich das eigene Unbehagen über ihren Versuch, in den ärmeren Ländern mit solchen tendenziösen und dürftigen Informationen Aufmerksamkeit für Gesundheitstechnologien zu wecken.
Angesichts der Herstellerorientierung des Kompendiums spielt es schon keine Rolle mehr, was an einzelnen Technologien vorgestellt wird und ob sie wirklich dem Bedarf der BewohnerInnen und Kranken in Ländern der Dritten Welt entsprechen. Bei den in Entwicklung befindlichen Techniken stehen neben durchaus sinnvollen Geräten zur Trinkwasserhygiene telemedizinische und -kommunikative Geräte und Prozeduren im Vordergrund. Wer einmal in den ländlichen Regionen oder den Elendsvierteln der Großstädte eines Entwicklungslandes unterwegs war, wird allerdings Zweifel an der Praxisgerechtigkeit eines "Medical data communication system" oder von "Mobile technology to connect patients to remote doctors" für die meisten der dortigen BewohnerInnen hegen. Tragbare Diagnoseinstrumente und Wasserfilter sind dagegen schon eher von Nutzen.
Das 54-seitige "Compendium of new and emerging health technologies 2011" der WHO gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 17.3.12
Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen 2011 - Licht- und Schattenseiten der offiziellen Arbeitsmarktstatistik
 2010 arbeiteten nach der neuesten Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 2,8 Millionen Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen.
2010 arbeiteten nach der neuesten Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 2,8 Millionen Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen.
Die wichtigsten Charakteristika der Beschäftigungssituation in diesen Berufen fasst die BA so zusammen:
• Die Beschäftigung in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den letzten zehn Jahren um ein Fünftel gewachsen.
• Jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeitet mittlerweile in einem Gesundheits- oder Pflegeberuf.
• Der Frauenanteil unter den Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegesektor ist deutlich größer als bei der Gesamtbeschäftigung.
• Sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitbeschäftigung sind gestiegen.
• 2010 waren ein Drittel der im Gesundheits- und Pflegeberufen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Teilzeit tätig.
• Minijobber sind in Gesundheits- und Pflegeberufen unterdurchschnittlich vertreten.
• Die Arbeitslosigkeit in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.
• 2010 waren in Gesundheits- und Pflegeberufen durchschnittlich 40.700 offene Stellen gemeldet.
• Die Besetzung offener Stellen im Gesundheitssektor, insbesondere bei Ärzten, Kranken- und Gesundheitspflegekräften sowie Altenpflegefachkräften fällt zunehmend schwerer. Fachkräfteengpässe zeigen sich nahezu in allen Bundesländern.
Dass die alleinige Lektüre des "Wichtigsten in Kürze" zu falschen Eindrücken und Schlussfolgerungen führen kann, d.h. die Lektüre des gesamten 24-seitigen Textes notwendig, hilfreich also in jedem Fall empfehlenswert ist, zeigt die gut ausgewogen wirkende Feststellung, sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitbeschäftigung seien gestiegen. Schaut man in den Text, ergibt sich ein wesentlich differenzierteres und nachdenklich stimmendes Bild. Von allen 2,8 Millionen Beschäftigten arbeiteten 2010 910.000 in Teilzeit und 1,8 Millionen waren vollzeitbeschäftigt. Das Wachstum fiel allerdings extrem unterschiedlich aus: Die Vollzeitbeschäftigung wuchs in den letzten Jahren um 6% und die Teilzeitbeschäftigung um 70%. In einigen Sub-Berufsgruppen, wie etwa bei den KrankenpflegerInnen im Krankenhaus ist sowohl der Anteil der Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten deutlich höher (ca. 45%) und die Zunahme der Beschäftigten erfolgt fast ausschließlich durch die Zunahme von Teilzeitbeschäftigten.
Auch die eher beruhigend gemeinte Behauptung, Minijobber seien in den Gesundheits- und Pflegeberufen unterdurchschnittlich vertreten, stimmt zwar. Dennoch beruhigt ein Blick in das entsprechende Kapitel nicht wirklich. So arbeiteten 2010 rund 401.000 Personen in diesem Berufsfeld geringfügig - 59% ausschließlich geringfügig und 41% zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten um 33% bestiegen. Dieser Anstieg war deutlich stärker als in allen Berufen und den Dienstleistungsberufen mit einem Anstieg von 21%.
Über eine Reihe weiterer Schwachstellen der offiziellen Beschäftigtenstatistik im Bereich der Pflegeberufe erfährt man noch mehr bei der Lektüre des aktuellen Gutachtens zum Stand der Beschäftigungsverhältnisse in Pflegeberufen von Michael Simon.
Die im Dezember 2011 erschienene Broschüre Der Arbeitsmarkt in Deutschland 2011 - Gesundheits- und Pflegeberufe der Bundesagentur für Arbeit erhält man kostenlos.
Bernard Braun, 4.3.12
"Wo Gesundheit drauf steht, muss auch nachweisbar Gesundheit drin sein" - Wie ein Gericht "Gesundheits"wirtschaft beim Wort nimmt
 Einem nicht kleinen Teil der allenthalben von ihren Anbietern aber auch von wissenschaftlichen Experten gepriesenen Expansion der Gesundheitswirtschaft könnte die werbewirksame Gesundheitsbezogenheit verloren gehen, wenn die Kernargumente eines bereits im November letzten Jahres gefällten Urteils des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt/Main durch den als Revisionsinstanz zuständigen Bundesgerichtshof bestätigt werden und dann Schule machen werden.
Einem nicht kleinen Teil der allenthalben von ihren Anbietern aber auch von wissenschaftlichen Experten gepriesenen Expansion der Gesundheitswirtschaft könnte die werbewirksame Gesundheitsbezogenheit verloren gehen, wenn die Kernargumente eines bereits im November letzten Jahres gefällten Urteils des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt/Main durch den als Revisionsinstanz zuständigen Bundesgerichtshof bestätigt werden und dann Schule machen werden.
In dem Verfahren ging es darum, unter welchen Voraussetzungen gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel, konkret ging es um einen Pilzextrakt, mit der EU-weiten so genannten "Health-Claims-Verordnung (HCV)" und mit weiteren Verordnungen des Europäischen Parla-ments und des Rates (so genannte "Novel-Food-Verordnung") vereinbar sind, die verlangt, dass das Versprechen gesundheitlicher Wirkungen wissenschaftlich abgesichert sein muss.
Ein Kläger betrachtete entsprechende Aussagen eines Anbieters dieses Pilzextraktes als wettbewerbswidrig und klagte auf Unterlassung.
Das Landgericht hatte dem entsprochen und für eine Reihe der Vitalpilz-Lebensmittel zahlreiche gesundheitsbezogene Werbeaussagen (z.B. "Zur Unterstützung eines gesunden Herz-Kreislaufs verbessert dieser Vitalpilz die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit bei Stress." oder "Vitalpilz zur Unterstützung einer gesunden Verdauung.") untersagt.
Dagegen hatte der Anbieter der Vitalpilzpräparate vor dem Oberlandesgericht weiter geklagt.
Dieses Gericht wies jetzt diese Klage ab und gab dem Kläger u.a.mit folgenden Argumenten recht:
• "Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezeichnet der Begriff "gesundheits-bezogene Angabe" für die Zwecke der HCV jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und der Gesundheit andererseits besteht … . Darüber hinaus erfasst die HCV auch Verweise auf nichtspezifische allgemeine Vorteile des Nährstoffs oder Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden … ."
• "Die streitgegenständlichen Aussagen sind ausnahmslos gesundheitsbezogene Angaben im Sinne dieser Definition. Denn sie stellen einen Zusammenhang zwischen dem Konsum der beworbenen Produkte und der Gesundheit des Anwenders her. Das gilt auch für die Aussagen, bei denen ein ausdrücklicher Gesundheitsbezug nicht gegeben ist, so bei den Aussagen gemäß Ziffer 5 "zur Unterstützung der optimalen Leistungsfähigkeit", "…erhöht die Ausdauer und Leistungsfähigkeit" und Ziffer 10."Zur Vorbeugung gegen natürlichen Haarausfall", "Zur unterstützenden Vorbeugung gegen Wassereinlagerungen" und "Unter anderem unterstützt dieser Vitalpilz die Neubildung von gesundem kräftigem Haar". Angaben, die sich auf das allgemeine Wohlbefinden beziehen, fallen zwar nicht unter den Begriff der gesundheitsbezogenen Angabe. Gleichwohl ist dieser Begriff im Interesse des Schutzzwecks der HCV, die Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Konsum solcher Produkte zu bewahren, denen in der Werbung eine positive gesundheitliche Wirkung zugeschrieben wird, die ihnen tatsächlich nicht zukommt, weit auszulegen. Die Schwelle zur gesundheitsbezogenen Angabe soll daher bereits bei Aussagen wie "reinigt Ihren Organismus", "hält Sie jung" oder "verlangsamt den Alterungsprozess" überschritten sein (…). Auch der Bundesgerichtshof hat die Bewerbung eines Kräuterlikörs als "wohltuend" als gesundheitsbezogene Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCV angesehen. Denn mit einer solchen Aussage werde zwar nicht erklärt, wohl aber suggeriert, zumindest jedoch mittelbar zum Ausdruck gebracht, dass der Genuss des Kräuterlikörs geeignet ist, den Gesundheitszustand des Verbrauchers zu verbessern."
• "Der Senat folgt dem Landgericht auch in seiner Auffassung, dass die beanstandeten Aussagen nach Art. 10 Abs. 1 HCV verboten sind, weil die Beklagte die Richtigkeit der von ihr für ihre Produkte in Anspruch genommenen gesundheitsbezogenen Angaben entgegen Art. 5 Abs. 1 lit. a) HCV nicht anhand allgemein anerkannter wissenschaftlicher Nachweise bewiesen hat."
• "Alle genannten Voraussetzungen müssen sich auf allgemein anerkannte wissenschaftli-che Nachweise stützen lassen und durch diese abgesichert sein (Art. 6 Abs. 1 HCV). Die Anforderungen, die an einen solchen Nachweis zu stellen sind, sind nach Auffassung des Senats grundsätzlich nicht weniger streng als die Anforderungen, die auch an den Nachweis der Wirksamkeit eines Arzneimittels oder einer bilanzierten Diät gelten."
• "Der Nachweis der Richtigkeit einer gesundheitsbezogenen Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCV ist daher - soweit sich die wissenschaftliche Anerkennung nicht anders belegen lässt - durch Vorlage von Studien zu erbringen, die nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden sind. Dem werden grundsätzlich nur randomisierte und placebokontrollierte Doppelblindstudien mit einer adäquaten statistischen Auswertung, die durch Veröffentlichung in den Diskussionsprozess in die Fachwelt einbezogen sind, gerecht."
• "Dabei besteht, soweit für Lebensmittel mit nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben beworben wird,… die Gefahr, dass sich Verbraucher auf die Richtigkeit solcher Angaben verlassen und es deshalb nicht oder nur verspätet zur einer Behandlung der Funktionsstörung oder Krankheit kommt."
• Für die weitere Debatte über die Zulässigkeit und Haltbarkeit gesundheitsbezogener Aussagen für andere Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Dienstleistungsangebote wird aber erst die nächste Instanz, also der Bundesgerichtshof, und möglicherweise der Europäiusche Gerichtshof entscheiden: "Die Revision war zuzulassen, weil die Fragen der Auslegung des Begriffs der "gesundheitsbezogenen Angabe" im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCV - insoweit ist ein Ersuchen des Bundesgerichtshofs um Vorabentscheidung beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anhängig (…) - und der Anforderungen, die an den Nachweis der Richtigkeit einer solchen gesundheitsbezogenen Angabe im Sinne der Art. 5 und 6 HCV zu stellen sind, grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO haben. Die Beurteilung der Frage, ob in diesem Zusammenhang ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erforderlich ist, soll … dem Bundesgerichtshof vorbehalten bleiben."
Wer die weitreichenden Folgen einer Bestätigung der auch gesundheitswissenschaftlich berechtigten Argumentation des OLG Frankfurt ermessen will, braucht sich lediglich eine halbe Stunde der TV-Werbung für diverse Lebensmittel anzuschauen oder die Werbeseiten einschlägiger Illustrierten durchlesen. Wenn zahlreiche massenhaft verkauften Riegel, Cremes, Tropfen, Übungen oder "medical wellness"-Produkte künftig nur noch reine Lebensmittel oder Produkte ohne das Etikett "Gesundheit" sein dürfen, würden viele der vom "Gesundheits"versprechen angelockten Käufer andere Kaufentscheidungen treffen und vollkommen auf "ver- und gekaufte Gesundheit" verzichten.
Wer Näheres zu den Rechtsgründen des OLG-Urteils und den hier ausgelassenen juristischen Details wissen will, kann dies in dem komplett kostenlos zugänglichen Urteil des OLG Frankfurt mit dem Aktenzeichen 6 U 174/10 vom 10.11. 2011 nachlesen.
Wer hofft oder fürchtet, dass der Bundesgerichtshof dem OLG folgt, muss sich mit Geduld wappnen und einen Suchauftrag für die entsprechende Entscheidung des BGH starten.
Bernard Braun, 13.2.12
Unerwartetes zur Beschäftigungs- und Berufstreue sowie Einkommensentwicklung von Krankenschwestern und Co. 1993-2008 in SLH
 Das "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt sich kurzem intensiver mit dem Status quo sowie der bisherigen und künftigen Entwicklung regionaler Arbeitsmärkte und dabei auch der der Gesundheitswirtschaft.
Das "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt sich kurzem intensiver mit dem Status quo sowie der bisherigen und künftigen Entwicklung regionaler Arbeitsmärkte und dabei auch der der Gesundheitswirtschaft.
Welche interessanten und teilweise unerwarteten Ergebnisse hier zu erwarten sind, zeigt der vom IAB-Nord erstellte Bericht "Gesundheitswirtschaft in Schleswig-Holstein. Leit- und Zukunftsbranche für den Arbeitsmarkt". Der Bericht über das "Gesundheitsland" Nummer 1 der BRD enthält die folgenden Rubriken: aktuelle Situation der Beschäftigung, Entwicklung der letzten 10 Jahre, Strukturen der Beschäftigung, Beschäftigung in ausgewählten Berufen der Gesundheitswirtschaft, Verdienst in Berufen der Gesundheitswirtschaft und einem beschäftigungs- und gesundheitspolitisch besonders interessanten Kapitel über die Berufsverläufe in Berufen der Gesundheitswirtschaft - der Geburtsjahrgang 1968.
Die Erkenntnisse der Berufsverlaufsanalyse basieren auf den maximal bis 1975 zurückreichenden Individualdaten der Beschäftigten-Historik (BeH) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die BeH enthält die Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung und umfasst in der aktuellen Version rund 36 Millionen Individuen in Deutschland (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Minijobber). Für die Analyse zu Schleswig Holstein wurde aus der BeH eine spezifische Untersuchungskohorte gebildet. Ausgewählt wurden alle im Jahr 1968 Geborenen (ruznd 10 % der Geburtskohorte), die am 30.06.1993 in einem Gesundheitsberuf beschäftigt waren (Voll- oder Teilzeit). Anschließend wird bis zum Jahr 2008 jeweils am 30.06. der ausgeübte Beruf, die Arbeitszeit und das Einkommen erfasst. Abgebildet wird so der Berufsverlauf zwischen dem 25. und dem 40. Lebensjahr.
Auf dieser Basis können u.a. die Beschäftigungstreue (Verbleib in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung), die Berufsteue (Verbleib im Ausgangsberuf des Jahres 1993 oder einem anderen Gesundheitsberuf) und die Einkommensentwicklung berechnet werden.
Die Ergebnisse lauten im Einzelnen:
• Beschäftigungstreue: Der überwiegende Teil der Ausgangsgruppe geht im "Beobachtungszeitraum einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht (unabhängig vom jeweiligen Beruf). Differenziert nach Berufen haben die Krankenschwestern/-pfleger, Hebammen mit fast 80 % eine sehr hohe Beschäftigungsquote (78,4 Prozent, Stichtag im Folgenden jeweils der 30.06.2008). Im Durchschnitt aller Berufe liegt diese Rate deutlich niedriger (71,9 Prozent, Westdeutschland: 74,8 Prozent). Ebenfalls recht hohe Beschäftigungswerte erreichen die Krankenpflegehelfer (Schleswig-Holstein: 75,0 Prozent, West: 75,6 Prozent) und die Sprechstundenhelfer (Schleswig-Holstein: 74,5 Prozent, Westdeutschland: 75,5 Prozent). Bei den Altenpflegern/-helfern ist die Beschäftigungsquote niedriger (Schleswig-Holstein: 71,2 Prozent, Westdeutschland: 72,8 Prozent). Ein ganz anderes Bild bei den Masseuren und Krankengymnasten. Hier beträgt der Verbleib im Beschäftigungssystem nur 54,5 Prozent in Schleswig-Holstein (55,1 Prozent in Westdeutschland)." Abgesehen von den zuletzt Genannten, bei denen aber ihre hohe Selbständigkeit eine Rolle spielen könnte, weisen Gesundheitsberufe weitgehend konstante Beschäftigungsverläufe auf.
• Berufstreue: Hier kommen zum Stichtag 30. Juni 2008 "die Krankenschwestern/-pfleger und Hebammen auf eine Berufstreue von fast 90 Prozent (Schleswig-Holstein: 89,0 Prozent, Westdeutschland: 89,3 Prozent). Auch die Altenpfleger/-helfer haben eine hohe Berufstreue (Schleswig-Holstein: 84,8 Prozent, Westdeutschland: 79,7 Prozent). Die Krankenpflegehelfer sind nach 15 Jahren zu etwas weniger als 80 Prozent in einem Gesundheitsberuf tätig (Schleswig-Holstein: 79,7 Prozent, Westdeutschland: 78,0 Prozent). Auffallend ist die Situation der Sprechstundenhelfer. Diese Gruppe verbleibt zwar überdurchschnittlich häufig im Beschäftigungssystem, aber zu weniger als 70 Prozent in einem Gesundheitsberuf (Schleswig-Holstein: 69,9 Prozent, Westdeutschland: 70,9 Prozent). Hier hat eine starke Abwanderung in andere Berufsfelder stattgefunden. Umgekehrt die Gruppe der Masseure und Krankengymnasten. Hier war der Verbleib im Beschäftigungssystem am niedrigsten. Von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind aber über 80 Prozent in einem Gesundheitsberuf tätig (Schleswig-Holstein: 81,8 Prozent, Westdeutschland: 81,3 Prozent). Ebenfalls zu einem hohen Grad berufstreu sind die Diätassistenten und Pharmazeutisch-technischen Assistenten (Schleswig-Holstein: 83,6 Prozent, Westdeutschland: 74,6 Prozent). Das auffallendste Verlaufsmuster haben die Apothekenhelfer. Sie erreichen zwar den konstantesten Beschäftigungsverlauf aller Gesundheitsberufe, sind allerdings nur noch gut zur Hälfte in einem Gesundheitsberuf tätig (Schleswig-Holstein: 57,7 Prozent, Westdeutschland: 53,7 Prozent). Hier erfolgt eine starke Abwanderung in andere Berufe und Branchen, jeder zweite Apothekenhelfer verlässt die Gesundheitswirtschaft."
• In der dritten Längsschnittsanalyse geht es um das Niveau und die Entwicklung der Bruttoeinkommen: Die Analyse der Gehälter ist auf Vollzeiteinkommen beschränkt, weil auch "in der BeH die genauen Angaben zu wöchentlichen Arbeitsstunden bei Teilzeitbeschäftigung fehlen. Differenziert man nach Geschlecht ist eine ausgeprägte "Gender-Wage-Gap", zu finden, d. h. Frauen verdienen im selben Beruf bei gleicher Arbeitszeit weniger als Männer. … Das höchste Einkommen erreichen die Krankenschwestern/-pfleger, Hebammen. Mit 3.352 € bei den Männern und 2.950 € liegt das Einkommen deutlich über dem Durchschnittswert aller Berufe in Schleswig-Holstein. Gegenüber dem Berufskollegen in Westdeutschland fällt der Rückstand mit jeweils rund 100 € relativ gering aus. Im Zeitverlauf (1993 bis 2008) hat sich der Verdienst günstig entwickelt. Zwischen 1993 bis 2008 beträgt der Einkommenszuwachs bei den Männern rund 68 Prozent, bei den Frauen sind es rund 45 Prozent (Westdeutschland: Männer 63 Prozent, Frauen 47 Prozent). Der Lohnzuwachs ist höher als in Schleswig-Holstein insgesamt (Männer: 49 Prozent, Frauen: 41 Prozent) und auf ähnlichem Niveau wie der der Berufskollegen in Westdeutschland. … Krankenpflegehelfer erzielen mit 2.890 € bei den Männern und 2.698 € bei den Frauen einen überdurchschnittlichen Lohn für Schleswig-Holstein. Die weiblichen Krankenpflegehelfer verdienen sogar mehr als die Berufskollegen in Westdeutschland. Im Zeitverlauf konnten die Krankenpflegehelfer einen deutlichen Lohnzuwachs erzielen. Zwischen 1993 und 2008 ist das Einkommen bei den Männern um rund 66 Prozent gestiegen, bei den Frauen rund 50 Prozent (Westdeutschland: Männer 66 Prozent, Frauen 46 Prozent). Auf der anderen Seite des Lohnspektrums findet man die Sprechstundenhelfer. Hier können mangels ausreichender Fallzahlen nur die weiblichen Einkommen untersucht werden. Mit 1.843 € liegt das Einkommen um fast 1.000 € unter dem Durchschnitt aller Berufe in Schleswig-Holstein. Verglichen mit dem Verbraucherpreisindex haben die Sprechstundenhelfer sogar Einkommensverluste hinnehmen müssen."
Unter allen untersuchten Gesundheitsberufen "ist die Situation bei den Apothekenhelfern (am ungünstigsten). Auch hier können mangels Fallzahlen nur die weiblichen Beschäftigten ausgewertet werden. Mit 1.722 € liegt das Einkommen rund 650 € unter dem Durchschnitt Schleswig-Holsteins und ist das niedrigste aller untersuchten Gesundheitsberufe. Die Apothekenhelfer in Schleswig-Holstein verdienen fast 300 € weniger als ihre Kollegen in Westdeutschland. Auch in der zeitlichen Perspektive zwischen 1993 und 2008 ist die Einkommensentwicklung ungünstig."
Die Resultate der IAB-Nord-Analysen beinhalten einige gewichtige Anregungen aber auch Irritationen für die weitere Diskussion über die die Situation und zukünftige Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials oder -angebots im Gesundheitswesen (Schlagwort: "Fachkräftemangel/-notstand"). Nachdem auch diese Analyse belegt, dass rund 80% des Beschäftigungszuwachses im Gesundheitswesen zwischen 2000 und 2010 auf dem Zuwachs von Teilzeitstellen beruht, fällt der Mangel an Transparenz über weitere Merkmale dieser Beschäftigtengruppe (Stichwort: Arbeitszeit) besonders ins Gewicht.
Auf weitere derart differenzierte und längsschnittlich fokussierte Berichte über die Verhältnisse in anderen Bundesländern darf man jedenfalls gespannt sein.
Der Bericht "Gesundheitswirtschaft in Schleswig-Holstein. Leit- und Zukunftsbranche für den Arbeitsmarkt" von Volker Kotte (IAB-Regional. IAB Nord Nr. 01/2011) umfasst 49 Seiten und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.1.12
Wie realistisch ist die Prognose von 950.000 im Jahr 2030 fehlenden ärztlichen und nichtärztlichen Fachkräften?
 Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei ambulant und stationär tätigen ÄrztInnen wird von derzeit 17.300 bis 2030 auf 165.400 fehlende Mediziner anwachsen. Im Jahr 2030 droht damit jede dritte Arztstelle in Krankenhäusern unbesetzt zu sein. Im ambulanten Bereich wird dann die Hälfte der für die Versorgung benötigten Ärzte fehlen. Noch dramatischer sieht es im Pflegebereich aus: Die Anzahl von heute in stationären Einrichtungen fehlenden 8.400 Krankenschwestern, Pfleger und Hebammen wird bis 2030 auf mehr als 350.000 anwachsen. Damit wäre jede zweite nicht-ärztliche Stelle bis zum Jahr 2030 in deutschen Krankenhäusern unbesetzt. Insgesamt droht in der Gesundheitsversorgung in zwanzig Jahren eine Personal-lücke von 950.000 ärztlichen und nicht ärztlichen Fachkräften.
Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei ambulant und stationär tätigen ÄrztInnen wird von derzeit 17.300 bis 2030 auf 165.400 fehlende Mediziner anwachsen. Im Jahr 2030 droht damit jede dritte Arztstelle in Krankenhäusern unbesetzt zu sein. Im ambulanten Bereich wird dann die Hälfte der für die Versorgung benötigten Ärzte fehlen. Noch dramatischer sieht es im Pflegebereich aus: Die Anzahl von heute in stationären Einrichtungen fehlenden 8.400 Krankenschwestern, Pfleger und Hebammen wird bis 2030 auf mehr als 350.000 anwachsen. Damit wäre jede zweite nicht-ärztliche Stelle bis zum Jahr 2030 in deutschen Krankenhäusern unbesetzt. Insgesamt droht in der Gesundheitsversorgung in zwanzig Jahren eine Personal-lücke von 950.000 ärztlichen und nicht ärztlichen Fachkräften.
Dies jedenfalls sind die schlagzeilenträchtigen Ergebnisse einer von der Unternehmensberatungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) in Auftrag gegebenen und vor wenigen Tagen veröffentlichten 80-seitigen Studie von Wissenschaftlern des Wirtschaftsforschungsinstituts WiFOR. Sie werteten dazu u.a. mehr als zwanzig Millionen Datensätze zu Arbeitsmarkt, Altersstruktur und Ausbildungsentwicklung der ärztlichen und nicht-ärztlichen Fachkräfte im Gesundheitswesen aus.
Für die weitere Debatte über die Dringlichkeit und das Gewicht des prognostizierten Fachkräftebedarfs spielen vor allem die Annahmen über die Nachfrage, die dieses Angebot erfordert, eine wichtige Rolle. Dies trifft auch auf die vorgestellten Lösungsvorschläge zu.
Die Autoren beginnen ihren insgesamt allerdings sehr knapp gehaltenen Versuch, den Personalbedarf abzuleiten, mit dem Hinweis, dass "in der Literatur … hauptsächlich demografische, ökonomische, soziale und kul-turelle Einflussfaktoren auf die Arbeitsnachfrage im Gesundheitswesen genannt (werden)" und konstatieren, dass "die Prognose der Nachfrage … alle genannten quantitativen und qualitativen Faktoren berücksichtigen (sollte), um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen." Sie folgen diesem Programm aber dann aus praktischen Gründen nicht: "Da dies aber kaum möglich ist, müssen bei der Prognose in einem oder mehreren Bereichen Vereinfachungen vorgenommen werden. Dies sichert die Praktikabilität der Durchführung der Analyse." Stattdessen sehen sie "die Veränderungen der Altersstruktur und der Morbidität der Bevölkerung als zentrale Punkte für die Prognose der Nachfrage nach Fachkräften an" und leiten aus dem Zusammenhang von älter und kränker werdenden Bevölkerung eine "deutlich umfangreicheren Inanspruchnahme von Behandlungen und somit einem erhöhten Ärztebedarf" ab. Zusätzlich zu dieser linear fortgeschriebenen Bedeutung der demografiebedingten Nachfrage für eine rasch größer werdende Nachfrage nach ärztlichen und nichtärztlichen Fachkräften in der ambulanten und stationären Versorgung, spielt auch noch der Ersatzbedarf für die heute Beschäftigten eine große Rolle für die Anzahl fehlender Fachkräfte.
Ein grundlegender Mangel der Studie und damit der Verlässlichkeit ihrer Mangelprognosen ist, dass sie sich bei der Nachfrage nach gesundheitlichen Leistungen und damit nach entsprechendem Personal weitgehend auf die Plausibilität von Ursache-Wirkungs-Ketten wie "älter-kränker-behandlungsbedürftiger" und die lineare Fortsetzung bisheriger Entwicklungen verlässt.
Zumindest hätten die Verfasser die bereits 2008 vom Statistischen Bundesamt in seiner Prognose des künftigen Behandlungsbedarfs gewählte Unterscheidung von zwei möglichen Entwicklungstrends übernehmen können. Die amtlichen Statistiker berücksichtigten in ihrer Prognose zunächst die Existenz zweier Hypothesen über den Zusammenhang von Altern und Morbidität: Die so genannte Expansions- oder Medikalisierungshypothese (plakativ: Längerleben=länger in Krankheit leben) und die Kompressionshypothese (plakativ: Längerleben=länger in Gesundheit leben und Zusammenballung der Morbidität am Lebensende).
Je nachdem welcher theoretischen Annahme gefolgt wird, ergaben sich beträchtliche Unterschiede bei den Szenarios über die künftigen Bedarfe und "Lasten": Folgt man dem Expansions- oder Status-Quo-Szenario nimmt bei sinkender Bevölkerungsanzahl die Anzahl der Krankenhausfälle von 17 Millionen im Jahr 2005 stetig auf 19 Millionen im Jahr 2030 zu. Folgt man dagen dem Kompressions- oder Szenario mit sinkenden Behandlungsquoten, steigt die Anzahl der Krankenhausfälle 2030 lediglich auf 17,9 Millionen Fälle und sinkt sogar zwischen 2020 und 2030 leicht. Der Prognoseunterschied beläuft sich also 2030 auf über eine Million Fälle. Dass diese oder auch eine vom Statistischen Bundesamt für wahrscheinlich gehaltene kleinere Nachfragedifferenz auch ein geringeres Angebot an Fachkräften erfordert ist offensichtlich, fällt aber in der PwC-Studie spurlos unter den Tisch.
Auch ohne dass man dem Szenario der PwC-Studie folgt, sind die in ihr vorgeschlagenen Gegenmittel überlegenswert und nützlich. Dies gilt generell für den Hinweis, Lösungen erforderten das Drehen an vielen Stellschrauben.
Und speziell etwa für die Vorschläge,
• die Beschäftigten in der Gesundheitsversorgung besser zu bezahlen oder ihre Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern (z.B. durch andere Arbeitszeitregelungen),
• die trotz der jahrzehntelangen Debatte und vieler normativer Verbesserungen faktisch weitgehend immer noch bestehende Un- oder Schwerdurchlässigkeit zwischen dem ambulanten und stationären Bereich durchgehend zu überwinden und
• insbesondere in ländlichen Gegenden verstärkt Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen.
Nachdem bereits heute vor allem die Nachfrage nach qualifiziertem Pflegepersonal bei weitem das Angebot übertrifft, ist der Hinweis, das künftige Fachpersonal nur durch die Anwerbung ausländischer Fachkräfte zur Verfügung haben zu können sicherlich richtig. Dies gilt aber ebenso für den Hinweis, dass es künftig einen weltweiten Wettbewerb um diese Be-schäftigten geben wird.
Auch die für den künftigen Versorgungs- und Personalbedarf relevante Frage, ob die von den Prognostikern linear fortgeschriebene Versorgungsangebots-Palette überhaupt oder wenn ja, in Gesundheitseinrichtungen und durch die dort tätigen zum Teil hochqualifizierten Arbeitskräften erbracht werden muss, stellen sich die Gutachter gar nicht. So handelt es sich bei einem erheblichen Teil der ambulant und stationär erbrachten Leistungen um Über- und Fehlversorgung, also nutzlose oder sogar überwiegend schadenstiftende Angebote. Ebenso kann in Zweifel gezogen werden, dass anders als in vielen vergleichbaren Ländern in Deutschland rund 95 % der Kinder im Krankenhaus geboren werden müssen (u.a. weil in Deutschland rund 75 % aller Schwangeren zu "Risikoschwangeren" deklariert werden) oder rund 75 % aller Sterbenden zum Teil gegen ihren erklärten Willen im Krankenhaus sterben (u.a. wegen des fehlenden Angebots ambulanter palliativmedizinischer Versorgung oder der geringen Anzahl von Hospizen) und dort auch noch häufig am Rande des ethisch Vertretbaren aufwändig medizinisch und pflegerisch behandelt werden.
Die Studie "Gesundheitswesen Fachkräftemangel. Stationärer und ambulanter Bereich bis zum Jahr 2030" herausgegeben von der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprufungsgesellschaft und verfasst von Dennis A. Ostwald, Tobias Ehrhard, Friedrich Bruntsch, Harald Schmidt und Corinna Friedl ist komplett kostenlos erhältlich.
Die von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 2008 herausgegebene Untersuchung "Demografischer Wandel in Deutschland Heft 2: Auswirkungen auf Krankenhausbehandlungen und Pflegebedürftige im Bund und in den Ländern" ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.10.10
Gesundheits-Markt-Expertise der Deutschen Bank
 Nach Ansicht der Deutschen Bank wächst die Gesundheitswirtschaft in Deutschland mit dreifacher Schubkraft. Dazu trügen der demografische Wandel, der medizinisch-technische Fortschritt und das zunehmende Gesundheitsbewusstsein gleichermaßen bei. Hauptantrieb sei der Fortschritt in Medizin, Medizintechnik und Pharmazie. Nach Auffassung der "Gesundheitsexperten" Dieter Bräuninger und Oliver Rakau von Deutsche Bank Research profitierten viele Bereiche der Gesundheitswirtschaft vom verstärkten Gesundheitsbewusstsein der Bürger. Die Begründung: "Seit 1992 haben sich die Gesundheitsausgaben der privaten Haushalte mehr als verdoppelt, und deren Anteil an den gesamten Gesundheitsausgaben ist von 10,5 % auf 13,4 % gestiegen." Eine interessante Interpretation: Wieso die wachsende Belastung durch Praxisgebühr, steigende Medikamentenzuzahlungen und wachsende andere Steigerungen der Selbstbeteiligung Ausdruck eines verstärkten Gesundheitsbewusstseins sein soll, beantworten die Deutschbanker nicht.
Nach Ansicht der Deutschen Bank wächst die Gesundheitswirtschaft in Deutschland mit dreifacher Schubkraft. Dazu trügen der demografische Wandel, der medizinisch-technische Fortschritt und das zunehmende Gesundheitsbewusstsein gleichermaßen bei. Hauptantrieb sei der Fortschritt in Medizin, Medizintechnik und Pharmazie. Nach Auffassung der "Gesundheitsexperten" Dieter Bräuninger und Oliver Rakau von Deutsche Bank Research profitierten viele Bereiche der Gesundheitswirtschaft vom verstärkten Gesundheitsbewusstsein der Bürger. Die Begründung: "Seit 1992 haben sich die Gesundheitsausgaben der privaten Haushalte mehr als verdoppelt, und deren Anteil an den gesamten Gesundheitsausgaben ist von 10,5 % auf 13,4 % gestiegen." Eine interessante Interpretation: Wieso die wachsende Belastung durch Praxisgebühr, steigende Medikamentenzuzahlungen und wachsende andere Steigerungen der Selbstbeteiligung Ausdruck eines verstärkten Gesundheitsbewusstseins sein soll, beantworten die Deutschbanker nicht.
Großes Potenzial für wirtschaftliches Wachstum sieht Deutsche Bank Research in der Produktion pharmazeutischer Erzeugnisse, die in den letzten zehn Jahren in Deutschland jährlich mehr als vier Prozent zugenommen habe. Die " Schubkräfte" wie der medizinisch-technische und Fortschritt und neue Strukturen der Gesundheitswirtschaft sprächen dafür, dass diese Rate anhalten werde. Schließlich erbrächte eine Senkung des durchschnittliche Krankenstands in Deutschland Produktionsgewinne in Höhe von rund 10 Milliarden Euro Diesen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsproduktivität nähme die Öffentlichkeit zu wenig wahr. Außerdem eröffneten steigende Einkommen in den aufstrebenden Schwellenländern günstige Exportperspektiven. Belastend wirken jedoch die staatliche Marktregulierung und hohe Entwicklungskosten der Industrie.
In der Bewertung des viel beschworenen demografischen Wandels hebt sich die Analyse der DB Research auffällig von dem gängigen Argumentationsmuster der erdrückenden finanziellen Belastung durch die vergreisende Gesellschaft ab. Vielmehr sehen sie in dem wachsenden Bevölkerungsanteil älterer Menschen ein enormes Wachstumspotenzial für den Gesundheitsmarkt. Ob sich diese ökonomischen Erwartungen angesichts der sich abzeichnenden Kompression der Morbidität tatsächlich realisieren lassen, bleibt so unerwähnt wie abzuwarten.
Bemerkenswert ist die Erkenntnis, dass auch die Forschungsabteilung der Deutschen Bank die Gesundheitsversorgung nicht mehr ausschließlich als wirtschaftlichen Kostenfaktor betrachtet. Im ersten Kapitel mit dem viel sagenden Titel Vom Kostenblock zum Wachstumspol heißt es: "Dabei wird zunehmend wahrgenommen, dass die Gesundheitswirtschaft über die von den obligatorischen Krankenversicherungen finanzierten Güter hinaus reicht." Als Ursache für diese einseitig ausgabenbezogene Betrachtung des Gesundheitswesens sehen die Autoren "einen wesentlichen Webfehler" der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, nämlich die Kopplung der Beiträge an die Arbeitseinkommen. Das gilt natürlich nur für den von staatlicher Kostendämpfung geprägten ersten Gesundheitsmarkt. Glücklicherweise habe sich aber mittlerweile ein zweiter dynamischer Markt etabliert, der die von den Bürgern direkt finanzierten Produkte umfasst, von freiverkäuflichen Arzneimitteln über die individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) bis hin zu allen Angeboten der Wellness-Branche.
Die Gesundheitswirtschaftsexperten der Deutschen Bank beklagen den restriktiven Rahmen der GKV, in dem sich ein Großteil der Gesundheitswirtschaft in Deutschland bewege und was den Ausblick für die Gesundheitswirtschaft im Inland trübe. Die logische Folge: Die deutsche Gesundheitswirtschaft muss ihr Heil verstärkt im Ausland suchen, insbesondere in den Schwellenländern mit ihrer wachsenden Wirtschaftsstärke und vor allem einer mittlerweile nennenswerten Schicht zahlungskräftiger Abnehmer.
Dass die Expansion des zweiten Gesundheitsmarkts auch erhebliche Gefahren für Leib und Leben mit sich bringen, thematisiert das Gutachten der Deutschen Bank nicht. Auf eine mögliche Gefährung durch Überversorgung weist das Editorial der Juni-Ausgabe von BMJ Clinical Evidence} hin. Vor allem in den USA nähmen Angebot und Werbung für "Routine-" und andere Untersuchungen beständig zu, so die Autorin Angela Raffle: "Regular tests for healthy people, and their advertisement directly to consumers, are now unshakably embedded in American culture and commerce".
Solche Überlegungen scheinen aber bisher offenbar weder zur Deutschen Bank noch zu Gesundheitsminister Philip Rösler durchgedrungen zu sein. Die Ergebnisse des DB-Gutachtens liegen ohnehin den Einschätzungen des Ministers Philip Rösler erstaunlich nahe, die er am 22. Februar 2010 in der Financial Times Deutschland unter dem Titel Jobmotor Gesundheit zum Besten gab. Sehr ähnliche Ansichten vertritt auch der Arbeitgeberverband Bund der Deutschen Industrie (BDI) in seinem Positionspapier Für eine starke Gesundheitswirtschaft in Deutschland.
Das Forum Gesundheitswesen ist bereits mit früheren Beiträgen auf Annahmen und Mythen über den Jobmotor Gesundheitswesen eingegangen, das seit Längerem die Debatte über das deutsche Gesundheitswesen beeinflusst. Hier finden Sie den Bericht der Deutschen Bank Research Gesundheitswirtschaft im Aufwind.
Jens Holst, 2.6.10
Sind private gewinnorientierte Krankenhäuser in Deutschland wirtschaftlicher als öffentliche Krankenhäuser? Nein!
 Wer diese Frage unter dem Eindruck von Hochglanzprospekten, Krankenhaus-Hitlisten und öffentlicher "Berichterstattung" mit "Ja" beantwortet und sich als Mitarbeiter oder Befürworter öffentlicher oder frei-gemeinnütziger Krankenhäuser am liebsten vor einer Antwort gedrückt hätte, kann sich hiermit wundern und den Kopf wieder etwas höher tragen.
Wer diese Frage unter dem Eindruck von Hochglanzprospekten, Krankenhaus-Hitlisten und öffentlicher "Berichterstattung" mit "Ja" beantwortet und sich als Mitarbeiter oder Befürworter öffentlicher oder frei-gemeinnütziger Krankenhäuser am liebsten vor einer Antwort gedrückt hätte, kann sich hiermit wundern und den Kopf wieder etwas höher tragen.
Eine Analyse der Ökonomen Tiemann und Schreyögg von der "Munich School of Management" hat sich nämlich diese Frage auch gestellt und für die Antwort die umfangreichen betriebswirtschaftlichen Daten zur Arbeit der unterschiedlichen Eigentums- oder Trägertypen von Krankenhäuser gründlich analysiert. Die Forscher verglichen dabei insbesondere die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern in öffentlichem Eigentum mit der von gewinnorientierten wie nicht gewinnorientierten Kliniken in privatem Besitz.
Anders als einer Reihe früherer Studien ging in ihre Berechnung nicht nur die Anzahl der behandelten Fälle und Finanzdaten bis hin zum Gewinn ein, sondern auch Daten über die Qualität der Versorgung und die Heterogenität der in den unterschiedlichen Krankenhausarten behandelten PatientInnen.
In einem ersten Schritt bewerteten sie für die Jahre 2002 bis 2006 mit einer so genannten "data envelopment analysis (DEA)" die Leistungsfähigkeit von 1.046, d.h. knapp der Hälfte der noch betriebenen Krankenhäuser in öffentlichem und privaten Besitz. Letztere wurden nochmals nach "for-profit" oder "non-profit"-Krankenhäuser unterschieden.
In einem zweiten Analyseschritt verfeinerten sie die Effizienzanalyse durch eine multivariate lineare Regressionsanalyse, in deren Modell auch organisatoriche Merkmale, Umweltcharakteristika und vor allem die Verschiedenheit des "Patientenguts" eingingen.
Die zum Teil unerwarteten Ergebnissen fassten die Forscher so zusammen:
• "Our findings show that public ownership was associated with significantly higher efficiency than other forms of ownership; private for-profit ownership, in particular, was associated with lower efficiency."
• An diesen Schlüsselergebnissen veränderte sich auch nach einer Reihe von Sensitivitätsüberprüfungen nichts.
• Was private Krankenhäuser besser hinbekommen als öffentlich getragene und was diese stattdessen in den Vordergrund ihres Handelns rückten, bringen die Autoren auf folgenden Nenner: "Our results suggest that private for-profit hospitals place greater emphasis on earning profits (i.e. higher revenues per case due to higher prices), whereas public hospitals, because of resource constraints, focus primarily on input efficiency."
• Ein weiteres wichtiges Ergebnis war die positive Assoziation zwischen der Krankenhausgröße und der Leistungsfähigkeit. Private gewinnorientierte Krankenhäuser waren dabei unter den Kliniken mit mehr als 1.000 Betten wirtschaftlicher als alle anderen Krankenhaustypen.
• Private, gewinnorientierte Krankenhäuser, die bekanntermaßen vorrangig kleinere bis mittlere Krankenhäuser kaufen und dort ausgewählte Leistungen anbieten, wären daher "well advised, to change their acquisition strategy in terms of choice of hospital size and location."
• Dort wo ein strammer regionaler Wettbewerb zwischen Krankenhäusern existiert, waren die privaten gewinnorientierten Krankenhäuser allerdings unwirtschaftlicher als ihre Konkurrenten mit anderer Trägerschaft.
• Anders als dies von denjenigen, die Wettbewerb zum ordnungspolitischen Zweck oder Allheilmittel erklären, suggeriert wird, hat der Wettbewerbsdruck nach der Analyse der beiden Ökonomen einen "significant negative impact on hospital efficiency."
• Abschließend stellen sie daher fest: "The ongoing trend towards privatization in Germany may not be an appropriate way to ensure the best use of the scarce resources in the hospital sector, because public hospitals use relatively fewer resources than private for-profit hospitals."
Angesichts der ungehinderten weiteren Privatisierung von Krankenhäusern darf man in jedem Fall auf die Ergebnisse der von den beiden Betriebswirten zusätzlich für notwendig gehaltenen Längsschnittanalyse der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Krankenhaustypen gespannt sein.
Die mit detaillierten Angaben gespickte Studie "Effects of Ownership on Hospital Efficiency in Germany" von Oliver Tiemann, Jonas Schreyögg ist im Sammelband "BuR - Business Research Official Open Access Journal of VHB" des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (Volume 2, Issue 2, December 2009: 115-145) erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.3.10
Systematisches und Empirisches über die direkten und indirekten Krankheitskosten im deutschen Gesundheitssystem.
 Nach den Heften zur Gesundheitsberichterstattung Nr. 45 (Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens) und Nr. 46 (Beschäftigte im Gesundheitswesen) hat jetzt das Robert-Koch-Institut (RKI) das Heft 48 zum Thema "Krankheitskosten" veröffentlicht.
Nach den Heften zur Gesundheitsberichterstattung Nr. 45 (Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens) und Nr. 46 (Beschäftigte im Gesundheitswesen) hat jetzt das Robert-Koch-Institut (RKI) das Heft 48 zum Thema "Krankheitskosten" veröffentlicht.
Auf den rund 30 Seiten des Heftes geht es u.a. um die folgenden Fakten und Themen:
• Im Jahr 2006 entstanden der deutschen Volkswirtschaft durch Krankheiten direkte Kosten in Höhe von insgesamt rund 236 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich vor allem um die Kosten der im Rahmen der ambulanten und (teil-)stationären Versorgung erbrachten diagnostischen, therapeutischen, rehabilitativen oder pflegerischen Leistungen. Hierzu zählen auch der damit in Verbindung stehende Verbrauch von Arznei- und Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Zahnersatzleistungen.
• Einige der im GBE-Heft ausführlich belegten und erörterten Fragen lauten: Welche Krankheit verursacht bei wem und in welcher Einrichtung des Gesundheitswesens welche Kosten? Wieso überschreiten die Krankheitskosten der Frauen die der Männer um fast 36 Milliarden Euro? Auf welche Krankheiten sind bei älteren Menschen die höchsten Kosten zurückzuführen und auf welche bei Kindern und Jugendlichen?
• Ein bedeutender Anteil der Krankheitskosten im Seniorenalter entsteht in ambulanten oder (teil)stationären Pflegeeinrichtungen Die Ergebnisse zeigen bei Frauen in Pflegeeinrichtungen bedeutend höhere Pro-Kopf-Kosten als bei Männern. Diese Unterschiede können als indirekte Folge der Feminisierung des Alters gedeutet werden: Frauen weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, den Ehe- oder Lebenspartner zu überleben und damit im Alter selbst auf (professionelle) Pflege angewiesen zu sein.
• Deutlich unterschiedliche Krankheitskosten-Effekte gab es auch 2006 zwischen den Altersgruppen: "Auf die unter 15- Jährigen - die 14,0 % der Gesamtbevölkerung stellten - entfielen lediglich 6,1 % der Krankheitskosten. Der Bevölkerungsanteil übertraf damit den Krankheitskostenanteil in diesem Alter um das 2,3-fache. Nahezu umgekehrt war es bei den älteren Menschen: Die im Vergleich hohen Krankheitskosten der über 64-Jährigen (47,1 %) konzentrierten sich auf eine verhältnismäßig kleine Bevölkerungsgruppe (19,5 %). Hier überschritt der Kostenanteil den Bevölkerungsanteil um das 2,4-fache. Der Kostenanteil der über 64-Jährigen lag damit knapp über dem vergleichbaren Kostenanteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren (46,8 %). Die Krankheitskosten verteilten sich im erwerbsfähigen Alter allerdings auf deutlich mehr "Kopfe": Der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung betrug 66,5 %.
• Bei allen Kostenunterschieden der Krankenbehandlung nach soziodemographischen Merkmalen ist aber stets die grundsätzliche Ungleichverteilung der Erkrankungshäufigkeit, Behandlungsbedürftigkeit und damit letztlich auch der Krankheitskosten in der Bevölkerung zu beachten. So entstehen rund 80% aller Ausgaben und damit auch der Kosten durch die Behandlung von 20% der Versicherten einer gesetzlichen Krankenkasse. Dies muss man insbesondere bei den ebenfalls im Heft ausgerechneten Pro-Kopf-Krankheitskosten von 2.870 Euro pro Einwohner oder von 1.260 Euro pro Kopf der bis 15-Jährigen, den 2.930 Euro pro Kopf der 45-64-Jährigen oder gar den 14.370 Euro pro Kopf der Hochbetagten mit mehr als 85 Jahren berücksichtigen.
• Die höchsten Kosten entstanden durch Krankheiten des Kreislaufsystems mit insgesamt 35,2 Milliarden Euro. An zweiter Stelle mit 32,7 Milliarden Euro stehen die Kosten für Krankheiten des Verdauungssystems, zu denen als eine der besonders ausgabenintensiven Einzelkrankheiten die Zahnkaries gehört. Den dritten Rang bei den Kosten für Krankheitsgruppen nehmen psychische und Verhaltensstörungen mit 26,7 Milliarden Euro ein. Darunter waren die Kosten für Demenzkranke mit 3,7 % die relativ größten. Fast gleichhoch wie die Kosten der Behandlung psychischer Erkrankungen waren die Ausgaben für Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems.
• Neben den direkten Kosten gehen zusätzliche Verluste für die deutsche Volkswirtschaft einher, die aus Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und vorzeitigem Tod der erwerbstätigen Bevölkerung resultieren. Sie werden in Form von verlorenen Erwerbstätigkeitsjahren berechnet. Dieser Arbeitsausfall summiert sich auf einen zusätzlichen Ressourcenverlust von rund vier Millionen verlorenen Erwerbstätigkeitsjahren. Nähme man die kostenmäßigen Wirkungen der allerdings schlecht quantifizierbaren oder monetarisierbaren Einschränkungen durch Schmerz oder des Verlustes an Lebensqualität hinzu, wären die individuellen und kollektiven Verluste noch wesentlich höher.
Die Ergebnisse der Krankheitskostenrechnung können in Verbindung mit weiteren epidemiologischen Daten zur Überprüfung und Steuerung der Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen verwendet werden. Sie liefern Hinweise auf mögliche Einsparpotenziale für die Entwicklung gesundheitspolitischer Instrumente, dienen als Entscheidungshilfe bei der Vergabe von Forschungsmitteln, unterstützen die Gesundheitsberichterstattung sowie die Evaluation von Gesundheitszielen und können als Ausgangsbasis für die Berechnung künftiger Kostenentwicklungen - insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels - genutzt werden.
Strenggenommen handelt es sich bei Krankheitskosten und damit auch der Krankheitskostenrechnung um nichts, was mit der in der normalen Marktökonomie verglichen werden könnte: "Kosten bezeichnen in der Regel den mit Marktpreisen bewerteten Einsatz von Produktionsfaktoren bei der Herstellung von Waren und Dienstleistungen. Bei den Preisen im Gesundheitswesen handelt es sich jedoch nur selten um wirkliche Marktpreise, sondern überwiegend um Verhandlungs- oder administrativ festgelegte Preise. Ausgangspunkt der Krankheitskostenrechnung im Rahmen der GBE ist deshalb ein ausgabenorientierter Kostenbegriff, bei dem nur der Verbrauch solcher Waren und Dienstleistungen mit Kosten verbunden ist, denen Ausgaben gegenüberstehen. Dadurch können die mit der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen verbundenen "Kosten" unmittelbar der Gesundheitsausgabenrechnung bzw. den dieser Rechnung zu Grunde liegenden Datenquellen entnommen werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Ausgaben für Investitionen wegen der schwierigen Zuordnungsproblematik nicht einzelnen Krankheiten zugeordnet werden. Die insgesamt in der Krankheitskostenrechnung nachgewiesen "Kosten" sind deshalb niedriger als die in der Gesundheitsausgabenrechnung nachgewiesenen Gesamtgesundheitsausgaben. Alle nicht ausgabenwirksamen Leistungen, beispielsweise private Arztfahrten oder die unentgeltliche Pflege von Angehörigen, werden in der Krankheitskostenrechnung nicht berücksichtigt."
Schließlich eignet sich die Krankheitskostenrechnung auch nicht wie zum Beispiel Kosten-Nutzen-Analysen oder Kosten-Effektivitäts-Analysen für Vergleiche unterschiedlicher Maßnahmen.
Das GBE-Heft 48 "Krankheitskosten" von Manuela Nöthen und Karin Böhm kann kostenlos heruntergeladen werden oder schriftlich kostenlos bestellt werden (Robert Koch-Institut, GBE, General-Pape-Straße 62, 12101 Berlin, E-Mail: gbe@rki.de, Fax: 030-18754-3513).
Bernard Braun, 11.1.10
"Jobmotor" Gesundheitswesen? Jein!
 Wer oder was hinter der seit Jahren monstranzartig für alle möglichen Bewertungen und Prognosen zitierten Anzahl von 4,3 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen steckt, die es auch für das aktuellste Berichtsjahr 2006 zu berichten gibt, stellt das Heft Nr. 46 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes mit dem Titel "Beschäftigte im Gesundheitswesen" ausführlich dar. Außerdem bietet es einen Überblick über die Rahmenbedingungen für die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Gesundheitspersonals; es befasst sich mit der Vielfalt der Berufe im Gesundheitswesen und den unterschiedlichen Einrichtungen. Besonderheiten der Beschäftigten hinsichtlich Alter, Geschlecht, Migrationserfahrung, und Arbeitszeiten werden ebenfalls unter die Lupe genommen.
Wer oder was hinter der seit Jahren monstranzartig für alle möglichen Bewertungen und Prognosen zitierten Anzahl von 4,3 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen steckt, die es auch für das aktuellste Berichtsjahr 2006 zu berichten gibt, stellt das Heft Nr. 46 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes mit dem Titel "Beschäftigte im Gesundheitswesen" ausführlich dar. Außerdem bietet es einen Überblick über die Rahmenbedingungen für die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Gesundheitspersonals; es befasst sich mit der Vielfalt der Berufe im Gesundheitswesen und den unterschiedlichen Einrichtungen. Besonderheiten der Beschäftigten hinsichtlich Alter, Geschlecht, Migrationserfahrung, und Arbeitszeiten werden ebenfalls unter die Lupe genommen.
Charakteristisch für das Gesundheitspersonal sind eine hohe Frauenquote (72,3% mit Ausnahme bei den Ärzten und Zahnärzten mit 40% und 38,7%), die Arbeit in Schicht- und Nachtdiensten sowie an Wochenenden und Feiertagen und ein hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten (10% der Männer und 35,9% der Frauen). Differenzierte fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten sowie eine eng an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtete Kooperation der Berufsgruppen bilden die Basis für eine gute Versorgung.
Aus beschäftigungs- oder arbeitsmarktpolitischer Sicht haben die 284.000 praktizierenden Ärzte im Jahr 2006 für die medizinische Versorgung eine besondere Bedeutung. Sie behandeln nicht nur selbst Patienten, sondern einbeziehen auch weitere Beschäftigte im Gesundheitswesen bei Diagnose, Therapie und Prävention mit ein und verordnen Leistungen Dritter, darunter die von Krankenhäusern, Apotheken, Heilmittel-Kaufhäuser oder Pharmaherstellern mit ihren zahlreichen Beschäftigten. Fast die Hälfte der Ärzte ist ambulant tätig. Die Alterung der Ärzte schreitet stark voran. Zwischen 1997 und 2006 nahm dort die Zahl 50-Jähriger und Älterer um 37% zu. Schwer abschätzbar sind darüber hinaus zukünftige Migrationsbewegungen von Ärzten.
Die mit Abstand häufigsten Berufe sind Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger (717.000) und die medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten (522.000) im Jahr 2006. Im Laufe von zehn Jahren hat die Zahl der Altenpflegerinnen und Altenpfleger stark zugenommen auf inzwischen 321.000. Dies kann auf die Alterung der Gesellschaft und zunehmende Professionalisierung der Altenpflege nach Einführung der Pflegeversicherung zurückgeführt werden.
Zu den Vorzügen dieses Heftes zählt, dass das Statistische Bundesamt über seine Gesundheitspersonalrechnung alle verfügbaren Daten zur Ermittlung der Beschäftigten zusammenführt, zum Beispiel aus dem Mikrozensus und der Krankenhausstatistik des Bundesamtes, aus Datenquellen der Bundesanstalt für Arbeit oder der Bundesärztekammer.
Zu den für die weitere Debatte über den "Jobmotor" Gesundheitswesen wichtigen Ausführungen des GBE-Heftes gehören beispielsweise:
• Die einschränkenden Alternativdaten zur reinen "Job"-Zählerei: "Die Zahl der Vollzeitäquivalente im Gesundheitswesen betrug im Jahr 2006 rund 3,3 Millionen. Die Zahl der Vollzeitäquivalente sank von 1997 bis 2006 um 31.000 oder - 0,9 %. Obwohl seit 1997 ein Anstieg des Gesundheitspersonals um rund 198.000 Beschäftigte zu verzeichnen ist (+ 4,8 %), zeigen die Vollzeitäquivalente, dass das Beschäftigungsvolumen insgesamt leicht rückläufig ist."
• "Die Analyse des Gesundheitspersonals nach Berufen bzw. Berufsgruppen hat kontinuierliche Beschäftigungsanstiege vor allem in den Gesundheitsdienstberufen und sozialen Berufen deutlich gemacht. Einrichtungsbezogen galt dies für die Einrichtungen der stationären und teilstationären bzw. ambulanten Pflege. Allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen lassen sich jedoch schwer treffen, da viele Einflussfaktoren in ihrer Wirkung nicht abgeschätzt werden können."
• Die ausführlichen Darstellungen zur Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit vieler Gesundheitsbeschäftigten werden hier als exemplarisch für das spezifische Arbeitsbelastungsspektrum dieser Berufstätigen etwas ausführlicher dargestellt: "In sozialen Berufen leisteten 81,2 % der Beschäftigten im Jahr 2006 ständig, regelmäßig oder gelegentlich Samstagsarbeit. Bei den Gesundheitsdienstberufen waren es über die Hälfte, insbesondere Ärztinnen und Ärzte (75,0 %) und Apothekerinnen und Apotheker (81,3 %). Zudem waren von der Samstagsarbeit über 80 % der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger sowie Hebammen und Entbindungspfleger, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen/-helfer, Altenpflegerinnen und Altenpfleger und Augenoptikerinnen und Augenoptiker betroffen. Vergleichsweise hierzu betrug der Anteil der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft 48,4 %."
• "Ähnlich wie bei der Samstagsarbeit war auch der Anteil derjenigen Beschäftigten, die ständig, regelmäßig oder gelegentlich sonn- bzw. feiertags arbeiteten, bei den Ärztinnen und Ärzten, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pflegern sowie Hebammen und Entbindungspflegern, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen/-helfern, Altenpflegerinnen und Altenpflegern mit 71 % bis 85 % besonders hoch. Zum Vergleich arbeiteten 28,2 % der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft an Sonn- bzw. Feiertagen."
• "Ähnliches gilt für die ständige, regelmäßige oder gelegentliche Arbeit in den Abendstunden, d. h. zwischen 18 und 23 Uhr. Auch hier hoben sich die sozialen (73,2 %) und Gesundheitsdienstberufe (61,9 %) im Jahr 2006 durch einen überdurchschnittlichen Anteil hervor. In der Gesamtwirtschaft erbrachten 45,7 % der Beschäftigten ihre Arbeit auch in den Abendstunden. Von Abendarbeit waren wiederum Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger sowie Hebammen und Entbindungspfleger, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen/-helfer, Altenpflegerinnen und Altenpfleger am häufigsten betroffen (70 % bis 82 %)."
• "Nachtarbeit zwischen 23 und 6 Uhr musste sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Gesamtwirtschaft von deutlich weniger Beschäftigten geleistet werden als Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und Abendarbeit. Dabei leisteten im Jahr 2006 die Gesundheitsdienstberufe am häufigsten ständig, regelmäßig oder gelegentlich Nachtarbeit (31,8 %) und hier speziell die Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger sowie Hebammen und Entbindungspfleger zu über 55 %. In der Gesamtwirtschaft waren es 15,2 % der Beschäftigten."
Was leider etwas zu kurz kommt, ist eine intensivere Darstellung anderer als der klassischen physischen oder organisatorischen Arbeitsbelastungen wie etwa die unter dem Druck der Ökonomisierung und Demographie beklagte Arbeitsverdichtung oder die tendenzielle Dissonanz von professionellen und ethischen Normen der Berufstätigen mit ihren tatsächlichen Arbeitsbedingungen.
Das 2009 erschienene Heft 46 der "Gesundheitsberichterstattung des Bundes - Beschäftigte im Gesundheitswesen"
von Anja Afentakis und Karin Böhm vom Statistischen Bundesamt in Bonn umfasst 46 Seiten erhält und man erhält es kostenlos als PDF-Datei oder in Papierform beim Robert-Koch-Institut (RKI)
Bernard Braun, 9.7.09
Gesundheitswirtschaft: "Bedarfsgerecht, Jobmotor und nur hilfreich"? - Mehr Skepsis, Anbieterferne, Nutzen und Qualität!
 Hunderttausende "Jobs" und neue Märkte mit Umsätzen und Gewinnen im Multi-Milliardenbereich sind die Schlüsselworte, die ganze Bundesländer in Verzücken versetzen und niemand mehr über die wirklichen Beschäftigungseffekte, die Realitätsnähe der Bedarfsprognosen und mögliche unerwünschte Wirkungen für die Gesundheit und den Geldbeutel der mit Angeboten der zweiten Gesundheits- oder "medical wellness"-Wirtschaft konfrontierten Menschen nachdenken lassen.
Hunderttausende "Jobs" und neue Märkte mit Umsätzen und Gewinnen im Multi-Milliardenbereich sind die Schlüsselworte, die ganze Bundesländer in Verzücken versetzen und niemand mehr über die wirklichen Beschäftigungseffekte, die Realitätsnähe der Bedarfsprognosen und mögliche unerwünschte Wirkungen für die Gesundheit und den Geldbeutel der mit Angeboten der zweiten Gesundheits- oder "medical wellness"-Wirtschaft konfrontierten Menschen nachdenken lassen.
Dass nach den kritischen Erfahrungen mit der anbieterinduzierten Nachfrage im traditionellen ersten Gesundheitsmarkt der Gesetzlichen Krankenversicherung, Skepsis, Zurückhaltung und kritische Überprüfung statt Euphorie berechtigt sind, zeigt die im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen am Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen erstellte Studie "Gesundheitswirtschaft und Beschäftigung in Bremen", die im Juni 2009 veröffentlicht wurde.
Die interdisziplinär von dem Ökonomen Joachim Larisch und dem Sozial- und Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun - beide keine Anbieter - erstellte Studie fasst die Ergebnisse einer genaueren empirischen Analyse der aktuellen Gesundheitswirtschaft und die entsprechenden Schlussfolgerungen für die weitere Debatte so zusammen: "Bevor sich die politischen Akteure des Bundeslandes Bremen in die Schar der Bundesländer einreihen, die seit einigen Jahren auf Kongressen und in Gestalt regionalpolitischer und -wirtschaftlicher Initiativen die Gesundheitswirtschaft zum uneingeschränkten Träger des wirtschaftlichen Fortschritts und des Wohlbefindens der Bevölkerung erklären und ausbauen wollen, erscheint uns notwendig zu sein, einige systematische und empirische Aspekte dieses Trägers genauer zu beleuchten und bei künftigen politischen Entscheidungen genau zu beachten."
Dabei sollen u.a. die folgenden Aspekte beachtet und bedacht werden:
• Es gibt bisher, d.h. seit Mitte der 1990er Jahre, kaum einen bundesweit empirisch nachweisbaren Nutzen für das Volumen der Beschäftigung (in Vollzeitstellen) der gesamten bisher zur Gesundheitswirtschaft zusammengefassten Wirtschaftsbereiche und Anbieter von Leistungen: "Am Volumen des "Jobmotors" zu zweifeln bedeutet natürlich nicht, den hohen und auch stabilen Anteil von Arbeitsplätzen beziehungsweise Voll-Arbeitsverhältnissen am gesamten Beschäftigungsvolumen zu ignorieren."
• Die "Ein- und Ausschlusskriterien von wirtschaftlichen Leistungsarten oder -bereichen in die Gesundheitswirtschaft sind genauer und qualitativ zu bedenken. Dies gilt insbesondere, wenn Teile der sogenannten Genussgüterindustrie und darunter auch die Tabakverarbeitung, die Fitnessbranche", ein Teil des Tourismus (so genannter "Gesundheits"-Tourismus oder "Teile der Nahrungsmittelbranche mit dem Hinweis auf irgendeinen Nutzen für das Wohlbefinden eingeschlossen werden. Die hier zu entwickelnden Kriterien sollten natürlich im Rahmen der evidenzbasierten Qualitätssicherungspolitik auch für Anbieter und Angebote im traditionellen, engeren Bereich der Gesundheitswirtschaft gelten, das heißt im Ernstfall auch zum Ausschluss führen."
• "Unabhängig von beiden bisher genannten Aspekten müssen aber in den weiteren Diskussionen und Entscheidungen zur Gesundheitswirtschaft auch die zunächst nichtökonomischen, unbeabsichtigten aber unerwünschten Wirkungen der Klassifizierung, Einordnung oder Etikettierung von Leistungsangeboten als "gesundheits"wirtschaftliche oder "Gesundheits"leistungen beachtet werden. Zu den unerwünschten sozialen Auswirkungen gehören vor allem die Individualisierung, Pathologisierung, Medikalisierung, Therapeutisierung und Verexpertlichung des Umgangs mit sozialen Ereignissen und Zuständen. Außerdem wird suggeriert, soziale Probleme durch individuelles Verhalten bewältigen zu können, was nicht nur die Lösung vieler dieser Probleme auf den Sankt Nimmerleinstag verschiebt, also Leid verlängert oder verstetigt, sondern auch ökonomische Folgelasten mit sich bringen kann. Derartige zusätzlichen Lasten entstehen auch durch eine im Bereich der engeren Gesundheitswirtschaft zu beobachtende spezielle Dynamik der angebotsinduzierten Nachfrage."
Unter Beachtung dieser und weiterer Kriterien empfehlen die Gutachter dann den quantitativen und vor allem qualitativen Beitrag zur Wertschöpfung der tatsächlich und potenziell zur Gesundheitswirtschaft gehörenden Leistungserbringer und Angebote zu untersuchen. Dies sollte auch Überlegungen umfassen, welche Angebotskonstellation notwendig ist, um in Bremen und anderswo real vorhandene und bisher nicht ausreichend befriedigte gesundheitliche Versorgungs- und Unterstützungsbedarfe wirksam und wirtschaftlich befriedigen zu können. Dabei denken die Gutachter zum Beispiel an träger- und sektorenübergreifende Angebotsstrukturen, mit denen differenzierte Steuerungssysteme erprobt und über verbesserte Versorgungsstrukturen Wirtschaftlichkeitsreserven mobilisiert werden könnten.
Die 74 Seiten umfassende Expertise "Gesundheitswirtschaft und Beschäftigung in Bremen" von Bernard Braun und Joachim Larisch ist kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 17.6.09
Kein nachgewiesener Nutzen, unzulänglich qualifizierte Anbieter aber bald 100 Milliarden Euro schwer: Beispiel "Medical Wellness"!
 Wer sich bis zur zwölften Seite eines aktuellen (6/2009) Forschungsberichts aus dem "Institut Arbeit und Technik (IAT)" der Fachhochschule Gelsenkirchen zum Modethema Gesundheitswirtschaft durchgelesen hat, bekommt das zuvor gewohnt üppig und optimistisch gemalte Bild der Erweiterung der alten GKV-Gesundheitswirtschaft um die moderne und bedarfsgerechte Kombination von klassischer Medizin und Wohlfühlangeboten zu "medical wellness" vom Kopf auf die Füße gestellt.
Wer sich bis zur zwölften Seite eines aktuellen (6/2009) Forschungsberichts aus dem "Institut Arbeit und Technik (IAT)" der Fachhochschule Gelsenkirchen zum Modethema Gesundheitswirtschaft durchgelesen hat, bekommt das zuvor gewohnt üppig und optimistisch gemalte Bild der Erweiterung der alten GKV-Gesundheitswirtschaft um die moderne und bedarfsgerechte Kombination von klassischer Medizin und Wohlfühlangeboten zu "medical wellness" vom Kopf auf die Füße gestellt.
Um den "Kopf" ordentlich zum Brummen zu bringen, verzichtet aber auch dieser "Forschungs"-Bericht auf keine der mittlerweile hundertfach durchgekauten Trendmeldungen und -fortschreibungen, Bedarfsvermutungen und natürlich dem Jonglieren mit einem milliardenschweren "Kuchen", der hier zu verteilen ist.
Die wichtigsten Zutaten heißen:
• "In den letzten Jahren hat die steigende privat finanzierte Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen rund um die Themenfelder Gesundheit und Wohlfühlen einen regelrechten Wellnessboom ausgelöst.
• Zunehmend geht die Tendenz in Richtung der gezielten Prävention und Gesundheitsförderung. Daraus hat sich das Segment Medical Wellness gebildet, welches medizinische Leistungen mit Wohlfühlangeboten vereint.
• Medizinische Wellnessleistungen werden sowohl klassisch von Ärzten und Kliniken wie auch von Nicht-Medizinern wie Hotels und Fitnessstudios angeboten; beide Seiten versuchen mit unterschiedlichen Strategien den Medical Wellness Markt zu erschließen."
• Und was da angeblich erschlossen werden kann wird so quantifiziert: "50 bis 70 Milliarden Euro werden jährlich auf dem Wellness-Markt umgesetzt, die 100 Milliarden Euro-Grenze könnte in wenigen Jahren überschritten sein."
Wie vorrangig es den Propagandisten und Protagonisten der Gesundheitswirtschaft um "Markterschließung" und Vermarktungserfolge geht statt klare gesundheitliche Ziele und Belange zu befriedigen, illustrieren etwa die vielen Ausführungen des ebenfalls am IAT tätigen Gesundheitswirtschaftsexperten Josef Hilbert besonders griffig.
Eines von vielen Beispielen sind seine Ausführungen zur Gründung des "Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen e.V.", d.h. eines Vereins dessen wesentliche Träger und Interessenten die Bundesländer sind, am 14. Februar 2008 in Berlin: Dort hieß es: "Die Gesundheitswirtschaft gehört zu den stark expandierenden Branchen. Bis zum Jahre 2020 können in Deutschland rund eine Million neue Jobs entstehen, so Privatdozent Dr. Josef Hilbert, Vorsitzender des neuen Vereins. Ein wesentlicher Faktor ist hier die demografische Entwicklung in Deutschland. Die Altersstruktur der Bevölkerung verändert sich und verlangt verstärkt nach alters- und indikationsspezifischen Produktangeboten. Integrierte Modelle in der Versorgung und kooperierende interdisziplinäre wissenschaftliche Ansätze stärken den Medizin- und Technologiestandort Deutschland und führen schneller zu Patenten und damit zu unternehmerischen Chancen. ... Der Verein ... bringt regionalspezifische Exzellenzen in einen bundesweiten Kontext. ... Ein weiterer Schwerpunkt ist es, im Ausland auf die Leistungsfähigkeit der deutschen Gesundheitswirtschaft aufmerksam zu machen. Dieses fördert den Export von Gesundheitsprodukten und Dienstleistungen."
Was die aktuelle Ausgabe von "Forschung Aktuell" des IAT von früheren Publikationen unterscheidet ist seine Darstellung von inhaltlichen "Hindernissen".
Dazu rechnet die Verfasserin etwa die folgenden strukturellen Mängel:
• Qualifikationsdefizite: "Für die Reifung des Medical Wellness Marktes ist die Branche auf die Verfügbarkeit professioneller Arbeit angewiesen. Eine spezielle Bedeutung kommt somit der Qualifizierung und den Kompetenzen der Beschäftigten zu. Einheitliche Wege der Aus- und Weiterbildung gibt es bislang aber nicht. Vielmehr besteht ein Nebeneinander unterschiedlichster Berufsgruppen mit verschiedenen Qualifikationen; diese Spanne reicht von traditionellen Berufen mit geregelten Ausbildungswegen wie dem Masseur bzw. medizinischen Bademeister bis hin zu Absolventen neuartiger Weiterbildungskurse wie dem IHK-zertifizierten Lehrgang zum Wellnessberater, sowie im Bereich der privaten Weiterbildungsanbieter von Lehrgängen zum Wellnesstrainer oder Wellnesstherapeut. Statt einer zukunftsträchtigen Professionalisierung und Qualitätssicherung finden sich auf dem Weiterbildungsmarkt ungenaue Kurstitel, ungeregelte Berufsbilder und fehlende Standards der Abschlüsse;"
• Soziale und Finanzierungsprobleme: "Relevant sein wird, ob es der Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren gelingt, Medical Wellness weiten Teilen der Bevölkerung zugänglich zu machen und das Modell der Salutogenese in Deutschland zu etablieren. Aufgrund der Tatsache, dass fast alles, was mit (medizinischer) Wellness zu tun hat, von den Konsumenten privat finanziert wird, profitieren besonders die einkommensstarken Teile der Bevölkerung von gesundheitsfördernden Produkten und Dienstleistungen. Im gleichen Atemzug werden die Angebote, die auch den sozial schwächer gestellten der Gesellschaft offen standen (die Kur), systematisch zurückgefahren."
• Und schließlich im Schlusssatz formuliert die fehlende wissenschaftliche Grundlage bzw. der bislang fehlende Wirksamkeitsnachweis: "Das Thema (Medical) Wellness ist in der deutschen wissenschaftlichen Forschung bislang noch nicht weit verbreitet. "Gerade im Wellnessbereich besteht bislang noch ein Defizit an gesicherten Forschungsergebnissen." (vgl. Barth/Werner 2005: 183) Vorliegende Studien, zumeist zu den Umsatzzahlen der Branche, stammen vorwiegend von Unternehmensberatungen, welche die Gesundheitswirtschaft allgemein wie auch den Bereich Medical Wellness speziell als neues Geschäftsfeld erschließen möchten. Diese Dominanz der Studien aus dem wirtschaftlichen Bereich ist jedoch auch kritisch zu betrachten. Es fehlt bislang an wissenschaftlicher Grundlagenarbeit zum Thema Medical Wellness, zu einer einheitlichen Definition, zur Evaluation der Angebote hinsichtlich Qualität, Kosten und Nutzen sowie zur Überprüfbarkeit der Gesamtidee von Medical Wellness als gesundheitsförderlicher Lebensstil. Zwar kann die finale Wirksamkeit der einzelnen Medical Wellness Angebote nicht genau beurteilt werden, dennoch können wissenschaftliche Evaluationen dazu beitragen, die grundlegende Legitimation für Medical Wellness zu schaffen sowie Rückschlüsse auf Qualifikationsanforderungen, Zugangswege etc. liefern (vgl. Klatt 2007)."
Nach diesen selbstkritischen Hinweisen wäre es noch unverständlicher, wenn in einem Land, dessen erster GKV-Gesundheitsmarkt seit Jahrzehnten mit einer Über- und Fehlversorgung von Leistungen ohne nachgewiesenem gesundheitlichem Nutzen zu kämpfen hat und u.a. deswegen zu wenig Geld für eine Reihe notwendiger und nützlicher Leistungen hat, ein zweiter Markt ohne Widerstand mit Leistungen läuft oder sie zu starten versucht, die keinen wissenschaftlich nachgewiesenen Nutzen haben und deren Erbringer erhebliche Qualifikationsmängel aufweisen.
Insbesondere die dem Gemeinwohl und auch dem gesundheitlichen Wohl aller ihrer BürgerInnen besonders verpflichteten Vertreter der Bundesländer oder anderer öffentlicher Einrichtungen sollten sich überlegen, ob sie lediglich auf das vage und zumindest in der Vergangenheit noch nicht mal empirisch eintreffende Versprechen von "mehr Jobs" diesen Markt wirklich intensiv fördern wollen.
Den kleinen Forschungsbericht "Medical Wellness - Zukunftsmarkt mit Hindernissen von Sandra Dörpinghaus (Forschung aktuell des IAT 6/2009) erhält man kostenlos auf der Homepage des IAT.
Die 2-seitige Presseerklärung des "Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen e.V." gibt es ebenfalls frei zugänglich.
Bernard Braun, 7.6.09
Licht am Ende des langen dunklen Tunnels der Debatte über Gesundheit und Alter in Deutschland? Ein Bericht von RKI, StaBu und DZA
 Immer wenn die Zukunft der Gesundheit und der Finanzierung von Gesundheitssystemen so richtig dunkel erscheinen soll, wird seit geraumer Zeit je nach Temperament die demographische "Entwicklung" oder "Katastrophe" bemüht: Alt, älter, kränker, teurer und kollektiv unfinanzierbar aber immer öfter das Eldorado der Gesundheitswirtschaft.
Immer wenn die Zukunft der Gesundheit und der Finanzierung von Gesundheitssystemen so richtig dunkel erscheinen soll, wird seit geraumer Zeit je nach Temperament die demographische "Entwicklung" oder "Katastrophe" bemüht: Alt, älter, kränker, teurer und kollektiv unfinanzierbar aber immer öfter das Eldorado der Gesundheitswirtschaft.
Dass an einigen der Grundannahmen wenig oder nichts stimmt, wird seit einiger Zeit und vorwiegend im internationalen Rahmen intensiver diskutiert als im GKV-System. Dies gilt vor allem für die Stimmigkeit der Annahmen mit der Zunahme der Lebenserwartung sei eine Morbiditätsexpansion verbunden versus der Annahme, dass die Anzahl der gesunden Lebensjahre zunimmt und der Großteil der Morbidität ans Lebensende verschoben oder völlig bewältigt wird. Der internationale Forschungsstand gab einem der letzten "Alter-und-Gesundheit"-Beiträge im Forum-Gesundheitspolitik Anlass von einem "Spielstand" von 4:1 für die "compression of morbidity" zu sprechen.
Mit dem in der Reihe "Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes" 2009 erschienenen, 323 Seiten umfassenden Band zum Thema "Gesundheit und Krankheit im Alter" haben die drei HerausgeberInnen Böhm (Statistisches Bundesamt), Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Altersfragen) und Ziese (Robert Koch-Institut), deren Institute in diesem Bereich enger zu kooperieren beabsichtigen, eine bemerkenswert gründliche, verständliche und für die Bundesrepublik Deutschland aktuell empirisch gestützte Analyse vorgelegt. Ihre Analyse bricht mit einigen der reflexartigen Verständnisse über Alter und Gesundheit und unterstützt damit einen längst überfälligen Paradigmawechsel in diesem Bereich der gesundheitspolitischen Debatte.
Die Darstellung gliedert sich in die Abschnitte: theoretische Positionen zum Alter und Altern, Gesundheitszustand und Gesundheitsentwicklung mit der Frage, ob der demografische Wandel zu einer Kompression oder Expansion der Morbidität führen wird, gesundheitsrelevante Lebenslagen und Lebensstilen mit einer Erörterung der Frage »Wie wichtig ist Prävention?, Angebote gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung
für alte Menschen, Beiträge zu den ökonomischen Chancen und Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und der Frage, ob Gesundheit unter den Bedingungen von Demografie und Fortschritt bezahlbar bleibt.
Die wesentlichen Forschungsergebnisse zum Verhältnis von Gesundheit/Krankheit und Alter sowie der Morbiditätslast älterer Menschen sehen nach der Ansicht und im Originalton der AutorInnen aus dem RKI und seinen Kooperationspartnern so aus:
• "Es ist noch nicht endgültig zu beantworten, ob die Verlängerung der Lebenszeit im Alter auch mit einer Zunahme der Lebensjahre ohne substanzielle funktionale Einschränkungen einhergeht. Es überwiegen allerdings die Studien, die Verbesserungen in der funktionalen Gesundheit Älterer in den letzten Jahren nachweisen."
• "Entscheidend für weitere Erfolge bei der Verbesserung der funktionalen Gesundheit wird daher sein, inwieweit es gelingt, ältere Menschen über gesundheitsförderliches Verhalten zu informieren und sie zu Veränderungen im Gesundheitsverhalten zu motivieren."
• "Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Verschlechterung der subjektiven Gesundheit keiner altersinhärenten Gesetzmäßigkeit folgt. Vielmehr tragen vielfältige individuelle und gesellschaftliche Bedingungen dazu bei, ob und in welchem Ausmaß sich die subjektive Gesundheit mit steigendem Alter verschlechtert."
• Zwar argumentieren die AutorInnen zunächst relativ zögerlich: "Eine empirisch noch ungeklärte Forschungsfrage ist, inwiefern der Zugewinn an Lebensjahren ein längeres Leben bei guter Gesundheit impliziert. In der Tendenz verzeichnen die Länder mit einer sehr hohen Lebenserwartung auch die größeren Anteile an gesunden Lebensjahren." An anderer Stelle lautet die "Kernaussage" dann aber recht deutlich: "Auch wenn in Deutschland nur wenige Datenquellen zur Entwicklung der gesunden Lebenserwartung zur Verfügung stehen, deuten die vorliegenden Ergebnisse auf eine Zunahme der Lebenserwartung in Gesundheit hin."
• Außerdem: "Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorliegenden Ergebnisse auf einen Anstieg der gesunden Lebenserwartung seit Ende der 1980er-Jahre hindeuten. Es kam im Zuge der ansteigenden Lebenserwartung zu einer relativen Kompression chronischer Morbidität. Die Befundlage zur Entwicklung der gesunden Lebenserwartung in Deutschland stimmt mit den internationalen Ergebnissen überein. Ein Anstieg zeigt sich anhand unterschiedlicher Datenquellen und auf Basis verschiedener Gesundheitsindikatoren. Im Kohortenvergleich haben sich der Anteil und das Ausmaß der gesundheitlich beeinträchtigten Lebenszeit bei Männern und Frauen insbesondere für starke gesundheitliche Beeinträchtigungen verringert. Damit deutet sich insgesamt eine Entwicklung in Richtung der Kompressionsthese an."
Liegen damit genügend Hinweise auf die Evidenz der Kompressionshypothese vor, bleibt immer noch der Hinweis auf die Kostenträchtigkeit und auf Dauer Unfinanzierbarkeit der Krankheitskosten älterer Menschen.
Hierzu stellt der Bericht fest:
• "Obwohl ein beträchtlicher Teil der Krankheitskosten bei älteren Menschen entsteht, kann das Alter per se nicht dafür verantwortlich gemacht werden: Weitere, teils altersabhängige, teils altersunabhängige Faktoren müssen bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden."
• "Zusammenfassend gibt es eine Reihe zuverlässiger Belege dafür, dass weniger die Altersstruktur per se, als vielmehr ein Bündel verschiedener Faktoren Einfluss auf die Krankheitskosten ausübt, die teils selbst mit dem Alter in Zusammenhang stehen (z.B. die in der Sterbekostenforschung erkannte Ballung von Krankheitskosten im letzten Zeitabschnitt vor dem Tod - Anmerkung Bernard Braun), teilweise aber auch altersunabhängig sind. Welchem Faktor dabei im Einzelnen welcher Stellenwert zukommt, ist auf der gegenwärtigen Datenbasis und in Anbetracht der Komplexität des Themas nur schwer zu quantifizieren. ...Von einer (statistischen) Altersabhängigkeit der Krankheitskosten prospektiv auf eine "Kostenexplosion" im Gesundheitswesen zu schließen, würde die hier komplex wirkenden Mechanismen und Zusammenhänge deutlich verkennen."
• "Abschließend sei daher nochmals betont: Das Alter an sich muss keine größere gesundheitliche Belastung und Pflegebedürftigkeit bedeuten".
Wohltuend zurückhaltend, realistisch und differenziert geht die Expertise schließlich auch beim Versuch einer Prognose der künftigen Entwicklung der Gesundheitswirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Zunahme der 60/65+-Bevölkerung vor: "Zusammenfassend zeigt sich, dass einzelne Zweige der Gesundheitswirtschaft vom Älterwerden der Gesellschaft profitieren, ohne dass sie zwangsläufig einen Ausgabenfaktor für die GKV darstellen (individuelle Gesundheitsleistungen, Selbstmedikation). ...Ob und inwiefern sich eine florierende Gesundheitswirtschaft auf die künftige Beschäftigungsentwicklung auswirken wird, bleibt offen. ...Umgerechnet in Vollzeitäquivalente ist im Gesundheitswesen eine stagnierende bis leicht abnehmende Beschäftigungsentwicklung zu beobachten. Ausgenommen hiervon sind wenige Berufsgruppen, primär die Beschäftigten in der Altenpflege."
Der 323-seitige Untersuchungsband "Gesundheit und Krankheit im Alter" ist komplett und kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 26.5.09
5,5 Millionen $ von Versicherungs- und Pharmafirmen für US-Gesundheitspolitiker: Wohin fließt das Startpaket von 634 Mrd. $?
 Krankenversicherungen, Pharmaunternehmen und andere wirtschaftlich am US-Gesundheitssystem interessierte Akteure haben seit 2005 allein an die Top 10 der für die absehbare Gesundheitsreform entscheidenden parlamentarischen Entscheidungsträger beider Parteien im 111ten us-amerikanischen Kongress und Senat zusammen 5,5 Millionen US-Dollar (Versicherungen: 2,2 Mio US-$ und Pharmahersteller samt ihren Beschäftigten 3,3 Mio US-$) gespendet.
Krankenversicherungen, Pharmaunternehmen und andere wirtschaftlich am US-Gesundheitssystem interessierte Akteure haben seit 2005 allein an die Top 10 der für die absehbare Gesundheitsreform entscheidenden parlamentarischen Entscheidungsträger beider Parteien im 111ten us-amerikanischen Kongress und Senat zusammen 5,5 Millionen US-Dollar (Versicherungen: 2,2 Mio US-$ und Pharmahersteller samt ihren Beschäftigten 3,3 Mio US-$) gespendet.
Diese jetzt von der in Kalifornien angesiedelten gemeinnützigen Versichertenorganisation "Consumer Watchdog" auf der Basis von öffentlich zugänglichen Wahldaten (Daten der "Federal Election Commission", die vom "Center for Responsive Politics" zusammengestellt wurden) erstellte Statistik bestätigt oder illustriert etwas, was in den USA und auch hierzulande immer wieder lediglich verschwörerisch kolportiert wird, von Betroffenenseite aber meist reflexartig als gegenstandslos oder allerhöchstens als "Ausrutscher" schwarzer Schafe in Firmen und Parlamenten bagatellisiert wird: Die Gesetzgebung wird nicht nur durch argumentative Lobbyistenarbeit, sondern auch durch Bargeld zu beeinflussen versucht.
Dass auch jetzt behauptet werden wird, das Geld wäre nie als Einflussnahme auf die Gesetzgebung gezahlt und eingenommen worden, ist zu erwarten, geht aber recht rabiat mit der Wahrheit um. Mancher Leser mag auch der verblüfften Ansicht sein, es ginge "nur" um 5,5 Mio $.
Zu den Spitzenempfängern gehören mit 546.000$ der vormalige republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain, der Fraktionsführer der Republikaner McConnell mit 425.000$, der demokratische Vorsitzende des für eine Gesundheitsreform zentralen Finanzausschusses Max Baucus mit 413.000$ oder der demokratische Abgeordnete Dingell, der allein von Pharmafirmen 180.000$ annahm.
Zusätzlich informiert die Organisation noch über die rund 1 Milliarde $, die allein in den letzten 2 Jahren nach eigenen Angaben für die gesamte Lobbyarbeit der wirtschaftlich am Gesundheitssektor interessierten Unternehmen oder Verbänden aufgebracht wurden. Da der gewählte Präsident Barack Obama nicht mehr dem Kongress angehört, taucht er in der Übersicht nicht auf, hat aber für seine Wahlkampagne in 2007 und 2008 allein über 2 Millionen Spenden von Einzelpersonen aus Versicherungs- und Pharmaunternehmen (928.316$ von Beschäftigten in Versicherungsaunternehmen und 1.068.200$ von Pharmabeschäftigten -also niemals von politischen Komitees oder Firmen direkt) erhalten. Wäre Hillary Clinton noch Mitglied des Senats würde sie seit 2005 die Spitzenposition bei den Spendenempfängern besetzen; mit 385.159$ von der Pharmaindustrie und 376.661$ von Versicherungsunternehmen.
Betrachtet man die letzten 2 Wahlperioden des Kongresses haben alle jeweiligen Mitglieder insgesamt 24.220.976$ von Versicherungen und Arzneimittelherstellern an Spenden erhalten.
Der frühere republikanische Parlamentarier W.J. Tauzin und jetzige Chef der "Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)" sieht dies als die US-Form von Partizipation an der Politik und meint: "We do what most people do in political systems: We support people with whom we agree and with whom we believe in," und fügt hinzu, dass die Spender "also support other people who don't always agree with us but are honest and fair and open-minded."
Mehr über die Empfänger von Zahlungen dieser beiden Gesundheitswirtschaftsakteure und mögliche inhaltliche Motive und auch mögliche Wirkungen dieser Zuwendungen, findet man auf der Website von "Consumer Watchdog" u.a. in zwei einfachen Exceltabellen aufgelistet.
Bernard Braun, 10.3.09
Hautbräune und "schwarze Schafe": Sonnenstudio jein danke oder ein Lehrstück für die Qualität freiwilliger Zertifizierung.
 Wessen Winterdepression oder Eitelkeit so stark ist, dass er den Besuch eines Sonnenstudios erwägt, der sollte sich dies nach Kenntnisnahme der jüngsten, aus dem November 2008 stammenden 3. Überprüfung einer Stichprobe von 100 zertifizierten Sonnenstudios durch das "Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)" doch lieber ein zweites Mal gründlich überlegen.
Wessen Winterdepression oder Eitelkeit so stark ist, dass er den Besuch eines Sonnenstudios erwägt, der sollte sich dies nach Kenntnisnahme der jüngsten, aus dem November 2008 stammenden 3. Überprüfung einer Stichprobe von 100 zertifizierten Sonnenstudios durch das "Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)" doch lieber ein zweites Mal gründlich überlegen.
Die BfS-Recherche entdeckte nicht nur einige der häufig in solchen Überprüfungen üblichen aber rasch bagatellisierten "schwarze Schafe", sondern eine fast einheitlich "schwarze Studio-Herde". Dies ist umso bemerkenswerter als sich die gesamten 100 Studios werbewirksam mit Zertifikaten einer freiwilligen Überprüfung durch Zertifizierungseinrichtungen schmücken, es sich also im strengen Sinne um eine systematisch positiv verzerrte Stichprobe handelt. Zu erwarten gewesen wäre daher ein besseres Ergebnis als wenn eine wirklich repräsentative Stichprobe aus zertifizierten und nicht zertifizierten Betrieben untersucht worden wäre. Angesichts der fast rein "schwarzen" Ergebnisse ist dies aber schon arithemetisch gar nicht möglich.
Als einen Indikator dafür wie manipulationsanfällig freiwillige Zertifikate sein können, weist das BfS darauf hin, dass bereits im Vorfeld einer letzten EU-weit am 31.7.2008 endenden Frist zur Zertifizierbarkeit von Altgeräten in Sonnenstudios eine völlig ungewöhnliche Welle von über 600 Neu-Zertifizierungen zu beobachten war. Dies allein könnte natürlich auch nur bedeuten, dass gut arbeitende Studios in einer Art lang Versäumtes lediglich unter dem äußeren Druck nachgeholt haben.
Ob dies so ist oder auch nicht zeigen die Ergebnisse der Überprüfung der 100 ausgewählten Studios, die unangemeldet und durch anonyme Besucher erfolgte, die sich als erstmalige Besucher eines Sonnenstudios ausgaben und angaben, es einfach mal ausprobieren zu wollen.
Die von diesen Prüfern zur Prüfung genutzten Kriterien waren zwischen Studioanbietern und BfS vereinbart worden und waren öffentlich bekannt. Die Prüfung offenbarte folgende Qualitäts- und Sicherheitszustände:
• Sowohl die Dokumentation der Kundenberatung, der Dosierungspläne sowie die der unterschriebenen Einverständniserklärungen waren nur in etwa einem Drittel der geprüften Sonnenstudios vorhanden.
• "Bei 82 der 100 geprüften Studios wurde keine bzw. eine sehr mangelhafte Erstberatung, die nicht den Kriterien des BfS entsprach, durchgeführt. Es kamen grob falsche Aussagen wie z. B. "Hauttyp I darf sonnen" vor. Sehr oft wurde kein Dosierungsplan erstellt. Obwohl in zertifizierten Sonnenstudios grundsätzlich untersagt, konnten in etlichen Studios mit Einverständnis der Eltern auch Jugendliche unter 18 sonnen."
• Konnten die Sonnenbänke durch den Kunden durch einfachen Geldmünzeneinwurf gesteuert werden, ist dies eine Nichtbeachtung der Kriterien des BfS. Es wurden zwei Sonnenstudios gefunden, bei denen es sich um reine Selbstbedienungs- Sonnenstudios handelte. Eine Zertifizierung eines solchen Sonnenstudios ist nach den Kriterien des BfS ausgeschlossen. Des Weiteren wurden bei den 100 überprüften Sonnenstudios solche gefunden, die über einen Münzapparat an jeder Kabine oder über eine zentrale Einheit den Kunden die eigenverantwortliche Steuerung der Bänke und der Bestrahlungszeit erlauben. Die war bei 22 der 100 geprüften Sonnenstudios der Fall. Auch dies ist nach den Kriterien des BfS nicht zulässig.
• "Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Sonnenstudios wurde gebeten, die schwächste und die stärkste Sonnenbank zu benennen. ... Es stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter oftmals nicht die schwächste oder stärkste Bank kannten. Damit ist eine richtige Dosierung unmöglich."
• Weiterhin wurde überprüft, ob im Wartebereich der Solarien die nach den Zertifizierungskriterien geforderten Informationen den Nutzerinnen und Nutzern frei und in vollem Umfang zugänglich waren. Ohne Beanstandungen blieben hier etwa ein Drittel der überprüften Studios.
Immerhin gab es auch noch ein paar positive Verhältnisse, zu denen u.a. gehörte:
• "Die Zwangsabschaltung nach einer maximalen erythemwirksamen Dosis von 875 J/m2 (3,5 MED) wurde, soweit an den Steuereinheiten nachvollziehbar, eingehalten. Die Notabschaltung an den Geräten war vorhanden. Augenschutzbrillen wurden in jedem geprüften Sonnenstudio angeboten. Hinweistafeln in den Kabinen mit Erst- und Schwellenbestrahlungszeiten sowie allgemeine Hinweise waren bis auf wenige Ausnahmen vorhanden. Zu den genutzten Geräten lagen in den meisten Fällen die Herstellerinformationen vor."
• "Zur Überprüfung des Betriebsablaufs wurde auf Sauberkeit und Hygiene geschaut und ob Desinfektionsmittel entsprechend der DGHM-Liste (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.) verwendet werden. Hier wurde bis auf wenige Ausnahmen, bei denen das Desinfektionsmittels nicht eindeutig als in der DGHMListe verzeichnet gefunden wurde, keine gravierenden Mängel festgestellt."
Die Zusammenfassung des BfS ist nach diesen weitverbreiteten Mängeln auch entsprechend "tiefschwarz": "Bis auf 4 Studios (eines in Rheinland-Pfalz, 3 in Hessen), die vollständig die Kriterien des Bundesamtes für Strahlenschutz umsetzen, entsprach keines der als zertifiziert gemeldeten und nun überprüften 100 Sonnenstudios den Kriterien".
Neben den konkreten Mängeln sind die Ergebnisse aber auch geeignet, erhebliche Zweifel an der Validität, Glaubwürdigkeit und damit dem Orientierungswert von freiwillig durchgeführten Zertifizierungen zu nähren und die Forderung nach staatlich vorgeschriebenen Prüfroutinen vor der Ausgabe von Zertifikaten zu stützen.
Der 8 Seiten umfassende "Bericht 3. Solarienüberprüfung durch das BfS im Oktober und November 2008" ist kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für eine Presseerklärung der Anbieterorganisation "IGS! Initiative geprüfte Sonnenstudios", in der die Anbieter mit starken Worten versuchen, die "wirklichen Absichten" des BfS zu enthüllen:"Ihnen passt, ein altes Politiker-Zitat, die ganze Richtung nicht. Ihre Aktion zielt nicht auf Steigerung und Besserung durch kritische Prüfung sondern auf Verhinderung und Entmutigung durch gezielte Diffamierung. Damit dokumentieren Sie zweifelsfrei, dass Ihnen nicht - wie uns "Geprüften Sonnenstudios" - an Qualitätsverbesserung und Sicherheit für den Nutzer gelegen ist, sondern dass Sie mit Ihrer regel- und sittenwidrigen Aktion (gemeint ist wohl die unangemeldete und anonyme Überprüfung) die Solarienbranche als Ganzes treffen und die Glaubwürdigkeit der Qualitätsoffensive untergraben wollten."
Und schließlich gibt es natürlich auch die "Stellungnahme des BfS zu den Vorwürfen der Initiative geprüftes Sonnenstudio (igs!) bezüglich der 3. Solarienüberprüfung durch das BfS Ende 2008" im Internet.
Bernard Braun, 10.2.09
Diabetes als "Goldgrube". Tagestipp: Wie viele, viele Millionen ChinesInnen aus einem Euro ganz viele Euros machen können!
 Womit konnte man zwischen 2003 und 2008 am meisten Geld verdienen? Wer 2003 100 € in DAX-Aktien investierte, hat heute 235 €, wer dies in Aktien tat, die im Dow Jones-Index gelistet sind, muss sich mit 142 € zufrieden geben und auch die Anlage im MSCI, dem Welt-Aktienindex erbrachte nicht mehr. Wer aber im so genannten Strategie-Musterdepot des Newsletter "Diabetes&Geld" investierte, das nur Firmen listet, die etwas mit Diabetes und DiabetikerInnen zu tun haben, konnte dieses Jahr 376 € verbuchen.
Womit konnte man zwischen 2003 und 2008 am meisten Geld verdienen? Wer 2003 100 € in DAX-Aktien investierte, hat heute 235 €, wer dies in Aktien tat, die im Dow Jones-Index gelistet sind, muss sich mit 142 € zufrieden geben und auch die Anlage im MSCI, dem Welt-Aktienindex erbrachte nicht mehr. Wer aber im so genannten Strategie-Musterdepot des Newsletter "Diabetes&Geld" investierte, das nur Firmen listet, die etwas mit Diabetes und DiabetikerInnen zu tun haben, konnte dieses Jahr 376 € verbuchen.
Das ist die werbeträchtige Botschaft der neuesten Ausgabe des von der Firma "Diabetes&Geld" produzierten Newsletters vom 4. 9. 2008 über dessen Anliegen wir unter der Überschrift "Diabetes - der große Rendite-Reibach" das erste Mal im Jahr 2006 informierten. Anlass war die selten so offen und klar (z. B. wird nicht noch viel und tendenziell fälschlich über das "Jobwunder" in der Gesundheitswirtschaft geredet) zur Schau getragene Gier, an einer Krankheit zu verdienen und damit auch möglicherweise daran, an der Stilisierung einer "Diabetes-Epidemie" mitzuwirken und die dadurch drohenden Krankheitslasten zu dramatisieren.
Daran hat sich nichts geändert: im Gegenteil. Und welche Argumentationen nun dazu gekommen sind und wie die aktuelle "Goldgräberstimmung" der Gesundheitswirtschaft "Abteilung Diabetes" aktuell aussieht, zeigt erneut der einschlägige Newsletter.
Ergänzend, wiewohl mit leichten monetären Abweichungen aber immer noch mit recht üppigen Gewinnmargen startet die Lobpreisung des Diabetes: "Als wir im Frühjahr 2003 unsere Strategie vorstellten, wie aus 100.000 Euro in 10 Jahren 1 Million Euro werden, wurden wir von einigen belächelt. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass unsere Strategie nicht nur für jeden nachvollziehbar, sondern auch einfach ist. Viele, die uns belächelt haben, sind heute begeisterte Leser von Diabetes & Geld. Jährliche Durchschnittsrendite: 29%. Das Diabetes-Strategie-Musterdepot startete am 3. Februar 2003 mit einem Startkapital von 100.000 Euro. Inzwischen verbuchen wir einen Gewinn von 265% und führen aktuell einen Bestand von 376.000 Euro! Damit liegen wir voll im Plan: Denn jährlich knapp 30% Gewinn ergibt nach 10 Jahren 1 Million Euro."
Wenn man aber dann das "Pech" hat, nicht nur AnlegerIn, sondern auch selber DiabetikerIn zu sein, sollte man nicht vergessen, davon zu profitieren: "Immer mehr Diabetiker nutzen die Chance, sich mit einem Diabetes-Depot oder einzelnen Diabetes-Aktien etwas von dem, was die Krankheit kostet, wieder zurückzuholen. Welche Unternehmen dies sind und wie auch Sie von der Entwicklung profitieren, lesen sie in Diabetes & Geld."
Und wo DiabetikerInnen und gesunde AnlegerInnen erst recht zulangen werden können, sagen die Tippgeber zum Dank für die Probebestellung des "Informationsdienstes" auch noch: "Sofort nach Absendung Ihrer Anforderung erhalten Sie als Dankeschön für Ihr Interesse den Sonderreport "China: Goldgrube für Diabetes-Unternehmen" (2., aktualisierte Ausgabe) im Wert von 69,50 Euro kostenlos. Dieses Geschenk können Sie auch behalten, wenn Sie innerhalb von 21 Tagen von Ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen."
Und wenn es erst gelingt weit über 10 % der Bevölkerung zu DiabetikerInnen umzuwandeln (Hilfsmittel: das metabolische Syndrom) und diese dann auch noch oft ohne Notwendigkeit und Nutzen mehrmals am Tage ihren Blutzucker messen oder mit teurer "Diabetiker"-Spezialernährung, oralen Antidiabetika und in speziellen "Diabetiker-Hotels" ihre Erkrankung behandeln und zum Teil unerreichbare oder nutzlose Blutzuckerwerte anzustreben versuchen, dann müsste doch 1 Million schon in 8 Jahren zu schaffen sein!????
Das alles, so ist zu befürchten, können wir dann alle in weiteren Ausgaben des Newsletters nachlesen können.
Zu bestellen ist die Informationsquelle Newsletter zum Thema Diabetes und Geld natürlich kostenlos. Wer aber den Informationsdienst mit den heißen Anlagetipps abonnieren will, der muss schon komplett 19,50 € pro Woche bezahlen. Zumindest die Firma DIABETES & GELD, Rosario Beteiligungen GmbH hat damit schon mal einen ordentlichen Gewinn gemacht. Honnit soît qui mal y pense!
Bernard Braun, 7.9.2008
Beschäftigungsboom in der Gesundheitswirtschaft? Ja, aber, aber …!
 Dass sich ein skeptischer Blick hinter die Euphorie vom "Jobmotor" Gesundheitswirtschaft lohnt, zeigten in der Vergangenheit bereits mehrere differenzierte Forum-Analysen der Daten des Statistischen Bundesamtes.
Dass sich ein skeptischer Blick hinter die Euphorie vom "Jobmotor" Gesundheitswirtschaft lohnt, zeigten in der Vergangenheit bereits mehrere differenzierte Forum-Analysen der Daten des Statistischen Bundesamtes.
Ein gerade erschienener Forschungsbericht (Forschung Aktuell 6/2008) aus dem Institut für Arbeit und Technik (IAT) unterstreicht und erweitert eine realistische Betrachtung und liefert zugleich interessante Daten zur regionalen Verteilung der Beschäftigungstrends in den verschiedenen Bereichen der Gesundheitswirtschaft.
Zum Anteil der Gesundheitswirtschaft an den Gesamtarbeitsplätzen und deren innere Struktur liefert der Bericht folgende Informationen:
• Insgesamt arbeiteten 2006 in Deutschland 4,6 Millionen Menschen in der Gesundheitsbranche. Von ihnen waren 82% sozialversicherungspflichtig und 12% ausschließlich geringfügig beschäftigt. 6% waren Selbständige.
• Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse nahm zwischen 2003 und 2007 um 2,1% zu, was im Vergleich zur geringen Abnahme derselben Art von Beschäftigung um 0,4% in der Gesamtwirtschaft den Ruf vom "Jobmotor" begründet hat.
• Diese Euphorie wird aber gewaltig dadurch eingeschränkt, dass der Großteil der Beschäftigungseffekte "durch die Substitution von Vollzeit- in Teilzeitstellen zu erklären" ist: "Während die Vollzeitstellen im Gesundheitssektor um 7,7 Prozent absanken, stieg die Teilzeitbeschäftigung um fast 19 Prozent. Auch wenn die Gesundheitswirtschaft seit jeher aufgrund des überdurchschnittlichen Frauenanteils im klassischen Gesundheitswesen sowie der Altenhilfe durch Teilzeitbeschäftigung dominiert ist, nimmt seit 2003 der Anteil der Teilzeitbeschäftigten weiter rasant zu. So wuchs der Anteil der in der Gesundheitswirtschaft tätigen Teilzeitbeschäftigten an allen dort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den letzten fünf Jahren um 4 Prozentpunkte von 25,9 Prozent auf 30,2 Prozent. Die entsprechenden Anteile in der Gesamtwirtschaft sind lediglich um knapp 2 Prozentpunkte von 15,9 Prozent im Jahr 2003 auf 17,8 Prozent im Jahr 2007 gewachsen. Der Trend einer zunehmenden Teilzeitbeschäftigung weitet sich auch auf den bisher durch Vollzeitstellen dominierten Vorleistungs- und Zulieferbereich aus. Während dort die Vollzeitbeschäftigung um etwa 30 Prozent absank, stieg die Teilzeitbeschäftigung um 23,3 Prozent an."
• Dies wird qualitativ noch dadurch verschärft, dass in der Gesundheitswirtschaft auch die Anzahl der geringfügigen Beschäftigung zunimmt. Zwischen 2003 und 2007 stieg dort die Anzahl der "Mini-Jobber" um 7,3% auf 584.300 Personen an, lag damit aber immerhin noch unter dem gesamtwirtschaftlichen Zuwachs dieser Beschäftigungsverhältnisse von 11,6%.
Beim regionalen Vergleich der Gesundheitswirtschafts-Arbeitsplätze fällt eine gravierende Ungleichverteilung auf:
• Bei einem Bundesdurchschnitt von 5,4% ragen Spitzen-Arbeitsagenturbezirke wie Marburg (12,6%), Münster (10,8%) und Heidelberg (8,4%) weit heraus. Im Zeitraum 2003-2007 gibt es aber auch Verlierer wie beispielsweise die Region Korbach, die 2,6% der Gesundheitsarbeitsplätze vor allem durch den Abbau im stationären Rehabilitationsbereich verlor.
• Im Medizintechnikbereich gibt es noch stärkere Ungleichverteilung und damit verbundene Abhängigkeiten: Der bundesweite Spitzenreiter bei diesen Arbeitsplätzen, der Arbeitsagenturbezirk Rottweil hat 9% seiner gesamten Arbeitsplätze in diesem Bereich.
• Ebenfalls ein großes Gewicht an allen Arbeitsplätzen haben Krankenhausbeschäftigte in Münster (4,4%) oder Marburg (3,3%).
Wie schon das mehrmalige Auftauchen einiger Städte auf den Spitzenplätzen andeutet, sind bestimmte Kombinationen von Teilbereichen der Gesundheitsbranche, wie etwa die Existenz von Unikliniken und innovativen Technikherstellern, förderlich für einen hohen Anteil von Arbeitsplätzen an allen Arbeitsplätzen.
Die 9 Seiten umfassende Studie "Beschäftigungstrends in der Gesundheitswirtschaft im regionalen Vergleich" von Elke Dahlbeck und Josef Hilbert ist als PDF-Datei kostenlos erhältlich. Über die IAT-Homepage ist auch der Zugriff auf weitere Arbeiten des Institutsschwerpunkts "Gesundheitswirtschaft und Lebensqualität über die quantitative und qualitative Bedeutung der Gesundheitswirtschaft möglich.
Bernard Braun, 5.6.2008
Das Geschäft mit Genomanalysen für Privatpersonen blüht: Krankheitsrisiken, Ernährungsratschläge, Empfehlungen zur Partnerwahl
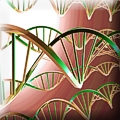 Nach eher zaghaftem Beginn scheint das Geschäft mit Genom-Analysen für Privatpersonen nun richtig ins Rollen zu kommen. Nach dem Vorreiter "23andMe" bieten inzwischen, wie die Tageszeitung "Washington Post" berichtet, etwa 20 Firmen im Internet für Preise unter 1.000 Dollar (ca. 650 Euro) Genom-Analysen auch für Privatpersonen an und übermitteln die Ergebnisse teilweise schon unter Umgehung des Arztes direkt an den Kunden. Die neue Strategie spricht nicht mehr so stark die Ängste vor Krankheit und Behinderung an, sondert appelliert jetzt an das Gesundheitsbewusstsein und verkauft Prävention. Das Standard-Angebot ist zwar immer noch, wie wir schon berichtet haben (vgl. "23andMe" - Eine Google-Firma verkauft an Privatpersonen jetzt Analysen ihrer Erbanlagen), das Vaterschaftsgutachten und die Ermittlung individueller Risiken für bestimmte Erbkrankheiten. Neu im Verkaufsprogramm sind jetzt jedoch "aus Genanalysen abgeleitete" Ernährungs- und Lebensstil-Ratschläge, "Abstammungsanalysen" und nicht zuletzt auch Programme zur Partnervermittlung, die neben Hobbys und Persönlichkeitsmerkmalen auch eine Analyse der 23 menschlichen Chromosomenpaare einbeziehen.
Nach eher zaghaftem Beginn scheint das Geschäft mit Genom-Analysen für Privatpersonen nun richtig ins Rollen zu kommen. Nach dem Vorreiter "23andMe" bieten inzwischen, wie die Tageszeitung "Washington Post" berichtet, etwa 20 Firmen im Internet für Preise unter 1.000 Dollar (ca. 650 Euro) Genom-Analysen auch für Privatpersonen an und übermitteln die Ergebnisse teilweise schon unter Umgehung des Arztes direkt an den Kunden. Die neue Strategie spricht nicht mehr so stark die Ängste vor Krankheit und Behinderung an, sondert appelliert jetzt an das Gesundheitsbewusstsein und verkauft Prävention. Das Standard-Angebot ist zwar immer noch, wie wir schon berichtet haben (vgl. "23andMe" - Eine Google-Firma verkauft an Privatpersonen jetzt Analysen ihrer Erbanlagen), das Vaterschaftsgutachten und die Ermittlung individueller Risiken für bestimmte Erbkrankheiten. Neu im Verkaufsprogramm sind jetzt jedoch "aus Genanalysen abgeleitete" Ernährungs- und Lebensstil-Ratschläge, "Abstammungsanalysen" und nicht zuletzt auch Programme zur Partnervermittlung, die neben Hobbys und Persönlichkeitsmerkmalen auch eine Analyse der 23 menschlichen Chromosomenpaare einbeziehen.
In einem Aufsatz in der "Washington Post" hat der Journalist Rick Weiss jetzt über die neuesten Tendenzen auf dem Markt der direkt an Privatkunden verkauften Genom-Analysen berichtet: Genetic Testing Gets Personal - Firms Sell Answers On Health, Even Love (Washington Post, Tuesday, March 25, 2008; Page A01). Nicht mal ein halbes Jahr nach dem Startup der von Google gekauften Firma "23andMe" (Motto: "Genetik ist persönlich geworden"), tummeln sich jetzt fast zwei Dutzend Firmen im Feld der Dechiffrierung des menschlichen Erbguts, die größten darunter: Genelex, Genovations, Genosolutions, Integrative genomics, Interleukin genetics, Navigenics, Nutrilite, Salugen, Sciona und Suracell.
Beobachtet hat Rick Weiss dabei auch, dass die Verkaufsstrategien sich geändert haben. Zwar ist das Standardangebot immer noch die von den Firmen behauptete, von seriösen Wissenschaftlern jedoch in Frage gestellte Ermittlung von Risiken für eine Vielzahl von Erbkrankheiten. So liefert "23andMe" den "persönlichen Risiko-Kalkulator", mit dem man vorgeblich die exakte Wahrscheinlichkeit für ein späteres Erkranken an Morbus Crohn, Brustkrebs oder Diabetes errechnen kann oder auch, zu welchem Ohrenschmalz-Typus (trocken, feucht, klebrig) man rein genetisch gehört.
Viele Firmen haben jedoch erkannt, dass nur der Appell an Ängste vor zukünftigen Erkrankungen und Behinderungen als Verkaufsargument nicht ausreicht und bieten daher auch Rat und Hilfe zur Prävention an. Markige Werbesprüche gehören dazu wie "Tragen Sie in Ihren Erbanlagen hohe Risiken? Verbessern Sie Ihre Chancen, gesund zu bleiben!" oder auch hohle Phrasen mit wissenschaftlichem Duktus: "Wir bieten Lösungen zur Beseitigung Ihrer strukturellen, funktionalen und systemischen Defizite".
Ein kleiner Auszug aus den Verkaufsargumenten:
• "Das Mycellf DNA Fitness Programm bietet auf Ihre Gene exakt abgestimmte Lösungen für Ihre Ernährung, Bewegung und Ihren Lebensstil" (Sciona)
• Genelex offerieret neben Vaterschafts-Tests auch Genanalysen zur Medikamentenverträglichkeit: "Aktuell bieten wir eine Analyse der Gene CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2 und CYP1A2 an, die Ihnen und ihrem Arzt helfen, Ihre Reaktion auf eine Vielzahl von Medikamenten vorherzusagen, Medikamente zur Behandlung von Depression und Ängsten, Manien und Psychosen, Blutdruck und -gerinnung, Herzerkrankungen und Diabetes".
• Von Suracell erwerben kann man das "Suracell Personal Genetic Health Program", das "auf ihre individuellen, genetisch bestimmten Ernährungsnotwendigkeiten abgestimmt ist und das mit Ihren körpereigenen Reparaturmechanismen abgestimmt ist, um so die DNA-Defekte zu beheben, die durch den alltäglichen Stress im 21.Jahrhundert entstehen."
Noch einen Schritt weiter in der Alltags- und Lebensberatung geht die Firma "Scientific Match" (Motto: "Die Wissenschaft der Liebe"), ein Institut zur Partnervermittlung. Anwendung finden dort Fragebögen zur Persönlichkeitsanalyse und zur Feststellung von Hobbys und persönlichen Vorlieben. Der neue, dritte Arm der Partnervermittlung ist jetzt jedoch die Genanalyse. Alle Kunden müssen nicht nur Fragebögen ausfüllen, sondern auch ein Röhrchen mit einer Probe Ihres Speichels einsenden. Das Versprechen der Firma: "Sie werden den Körpergeruch Ihres zukünftigen Partners lieben. Ihre Chancen auf ein besseres Sexleben steigen. Frauen haben meist mehr Orgasmen mit dem Partner. Die Chancen für gesunde Kinder mit einem robusten Immunsystem steigen."
Eine Vielzahl seriöser Genforscher wird von Rick Weiss in der Washington Post zitiert, die die neuen Angebote zur privaten Entschlüsselung der Erbanlagen kritisieren oder sogar als Scharlatanerie bezeichnen. Unter diesen Kritikern ist auch Craig Venter, jener Wissenschaftler, der im letzten Jahr für Aufsehen sorgte, als er in der Zeitschrift "PloS Biology" sein komplettes Erbgut analysieren ließ und im Internet (auch mit einer interaktiven Grafik) veröffentlichte. (vgl.: Samuel Levy u.a: The Diploid Genome Sequence of an Individual Human). Durchgängig heißt die Kritik der Wissenschaftler: Schon die Bestimmung der Risiken für eine spätere Erkrankung ist beim jetzigen Wissensstand problematisch, da hier eine Vielzahl von Faktoren wirksam ist und darunter nicht nur genetische. Noch fragwürdiger sind jedoch Empfehlungen zum Lebensstil.
In diese Kerbe schlägt jetzt auch eine neuere Studie, die in der Zeitschrift "American Journal of Human Genetics" veröffentlicht wurde. Ein Forschungsteam aus Rotterdam und Atlanta hat dort Ergebnisse einer Literatursichtung zu der Frage veröffentlicht, welche eindeutig belegten Zusammenhänge es bislang zwischen bestimmten Gen-Ausprägungen und dem Auftreten einzelner Erkrankungen gibt. Berücksichtigt wurden dabei 260 Meta-Analysen, die ihrerseits wiederum jeweils eine Vielzahl einzelner Studien bewertet hatten. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere Studien zu jenen Gen-Ausprägungen, die von den kommerziellen Unternehmen zur privaten Genom-Analyse angeboten werden. Das Fazit der Forscher fällt überaus kritisch aus.
Die Wissenschaftler stellen zunächst fest, dass von den Firmen insgesamt 69 Gen-Varianten in 56 Genen getestet werden. Für ein Großteil dieser 56 Gene, nämlich 24 (43%), so ihr erster Befund, gibt es bislang jedoch keine Meta-Analyse, also eine über einzelne Studien hinausgehende wissenschaftlich fundierte Bilanz. Für die verbleibenden 32 Gene fanden sie 260 Meta-Analysen, von denen jedoch wiederum nur 60 (38%) überhaupt statistisch signifikante Zusammenhänge zum Auftreten bestimmter Erkrankungen fanden. Und selbst diese statistisch signifikanten Zusammenhänge waren überwiegend sehr bescheiden.
Ihr Fazit lautet: "Die wissenschaftliche Beweislage, dass Genom-Analysen dazu nützlich sind, um ein genetisch bedingtes Risiko für das Auftreten häufiger Erkrankungen zu ermitteln oder um persönliche, krankheitsvorbeugende Empfehlungen zum Lebensstil und zur Ernährung zu entwickeln, ist unzureichend. (…) Obwohl Genom-Analysen durchaus das Potential haben, die Effektivität und Effizienz präventiver Maßnahmen zu erhöhen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die wissenschaftliche Evidenz unzureichend. Trotz der Fortschritte in der Ernährungs- und Pharmako-Genetik, dürfte es noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bevor solche Empfehlungen auf der Basis individueller genetischer Profile in verantwortlicher Weise ausgesprochen werden können."
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: A. Cecile J.W. Janssens u.a.: A Critical Appraisal of the Scientific Basis of Commercial Genomic Profiles Used to Assess Health Risks and Personalize Health Interventions (The American Journal of Human Genetics, Volume 82, Issue 3, 593-599, 3 March 2008)
Gerd Marstedt, 25.3.2008
Alle Jahre wieder: "Jobmotor Gesundheitswesen" im neunten Jahr im "Leerlauf".
 Wie jedes Jahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt kurz vor Weihnachten eine differenzierte Statistik der "Beschäftigung im Gesundheitswesen". Angesichts der von fast allen gesellschaftlichen Gruppen auch im letzten Kalenderjahr wieder verbreiteten Gewissheit, das Gesundheitswesen stelle einen der wenigen "Jobmotoren" in Deutschland dar, lohnt sich mehr als ein Blick auf die Zahlen.
Wie jedes Jahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt kurz vor Weihnachten eine differenzierte Statistik der "Beschäftigung im Gesundheitswesen". Angesichts der von fast allen gesellschaftlichen Gruppen auch im letzten Kalenderjahr wieder verbreiteten Gewissheit, das Gesundheitswesen stelle einen der wenigen "Jobmotoren" in Deutschland dar, lohnt sich mehr als ein Blick auf die Zahlen.
Das Statistische Bundesamt überschreibt zunächst seine Pressemitteilung vom 13. Dezember 2007 mit der frohen Botschaft: "Beschäftigung im Gesundheitswesen 2006 um 0,8% gestiegen". So waren zum 31. Dezember 2006 rund 4,3 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwa jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Zwischen 2005 und 2006 stieg die Zahl der Arbeitsplätze im Gesundheitswesen um 34.000. Das entspricht einem Beschäftigungswachstum von 0,8%. Welche Teilbereiche des tiefgegliederten Gesundheitswesens zu diesem Gesamtwachstum der Anzahl von Beschäftigten wie beigetragen haben stellen die Wiesbadener Statistiker auch dar: "Während die Beschäftigung im Gesundheitswesen im Jahr 2004 lediglich um 14 000 Personen (+ 0,3%) zunahm, waren 2005 mit einem Plus von 28.000 (+ 0,6%) und 2006 mit einem erneuten Anstieg von 34.000 Beschäftigten (+ 0,8%) wieder deutlichere Zuwächse zu verzeichnen. Diese sind vor allem auf 22.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den Gesundheitsdienstberufen (beispielsweise Ärzte und Gesundheits- und Krankenpfleger) und in den sozialen Berufen (+ 11.000), wie Altenpfleger, zurückzuführen. Die Beschäftigung in sonstigen Gesundheitsfachberufen (zum Beispiel Pharmakanten) und in anderen Berufen des Gesundheitswesens (zum Beispiel Reinigungskräfte) blieb 2006 mit einem leichten Anstieg von jeweils 1.000 Personen nahezu konstant. Nur im Gesundheitshandwerk (zum Beispiel Augenoptiker) gab es 2006 rund 1.000 Beschäftigte weniger als im Vorjahr." Der Anteil der Beschäftigten im Gesundheitswesen betrug 1997 4,107 Millionen, d. h. die Zunahme der Köpfe betrug 4,9%.
Der relativ größte Teil der Personen, nämlich 84%, arbeitete im Jahr 2006 in Einrichtungen der ambulanten sowie stationären und teilstationären Gesundheitsversorgung. In der ambulanten Gesundheitsversorgung gab es 2006 mit einem Plus von 7.000 Personen einen schwächeren Zuwachs als im Vorjahr (+ 16 000). Einen Beschäftigungsanstieg gab es 2006 vor allem in stationären und teilstationären Einrichtungen (+ 16.000 Personen) und zwar dort fast ausschließlich im Pflegebereich. Nachdem das Krankenhauspersonal in den drei Jahren von 2003 bis 2005 um insgesamt 50.000 Beschäftigte abnahm, gab es 2006 erstmals wieder einen leichten Anstieg (+ 1.000 Personen).
Weitere Einzelheiten, darunter die jährliche Entwicklung seit 1997 findet der Interessent in den Tabellen Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Art der Beschäftigung und Berufen oder nach Art der Beschäftigung und der Einrichtung oder der Art der Einrichtung und Berufen.
Er kann dabei eine gröbere (z. B. "Vorleistungsindustrie") oder feinere (z. B. pharmazeutische Industrie, medizinische Laboratorien und Großhandel) Betrachtungsweise wählen.
Eine vierte Tabelle enthält dann auch für 2006 die Daten, die zumindest einen wichtigen Aspekt der gesamten Beschäftigungsdiskussion, wenn nicht sogar den gravierendsten enthalten. Es geht um den Stand und die Entwicklung der Vollzeitkräfte oder der vollzeitäquivalenten Beschäftigungsverhältnisse in Kontrast zu der bisher betrachteten Entwicklung der Anzahl von beschäftigten Personen, ob mit 40 oder 10 Stunden die Woche.
Von den 4,3 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen besaßen 2006 60% eine Vollzeitstelle, der Rest der Beschäftigten verteilte sich auf eine breite Palette von Teilzeit- und Minijobs.
Rechnet man alle Teilzeitbeschäftigungen zu Vollzeitstellen zusammen, berechnet also so genannte Vollzeitäquivalente oder Vollkräfte mit voller tariflicher Arbeitszeit, kommt man 2006 auf 3,315 Millionen.
Nach Lesart des Statistischen Bundesamt "stagnierten" die Vollkräfte 2006 mit einem leichten Zuwachs von 1.000 (tatsächlich handelt es sich um rund 2.000) nahezu, "denn der Anstieg der Teilzeitbeschäftigten um 3,0% und der geringfügig Beschäftigten um 5,0% wurde durch den Rückgang der Vollzeitbeschäftigung um 0,9% fast relativiert." Zu Recht weist das Bundesamt auf das Jahr 2005 hin, in dem das Vollzeitäquivalent mit einem Minus von 23.000 (- 0,7%) noch rückläufig war.
So erfreulich aus beschäftigungspolitischer Sicht diese Veränderung gegenüber dem Trend des Vorjahres sein mag, findet man in den Tabellen des Amtes aber auch den nunmehr fast 10 Jahre prägenden Trend der Entwicklung von Vollzeitkräften. Deren Anzahl sinkt seit 1997 mit 3,346 Millionen Vollkräften auf die 3,315 Millionen Vollkräfte in 2006 und damit um 0,9%, wobei diese Entwicklung auch zwischen anderen Jahren das eine mal nach oben aber dann auch gleich wieder nach unten verlief.
Von einem quantitativ ausgeprägten und stabilen Wachstum des gesamten Arbeits(zeit)volumens kann daher im Gesundheitswesen nicht gesprochen werden. Die Hoffnungen und Verheißungen eines "Jobmotors" Gesundheitswesen können sich fast ausschließlich auf die Zunahmen jedweder Form von Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, eben "Jobs", stützen. Dies kann für die so arbeitenden Menschen genau das Richtige also nichts Nachteiliges sein, rechtfertigt aber nicht Hoffnungen, im Gesundheitswesen gäbe es eine zunehmende Anzahl von Vollarbeitsverhältnissen.
Hier findet man die Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes und die Links auf die vier differenzierten Beschäftigungstabellen.
Bernard Braun, 13.12.2007
"23andMe" - Eine Google-Firma verkauft an Privatpersonen jetzt Analysen ihrer Erbanlagen
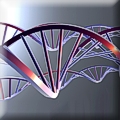 Jeder Mensch hat 23 Chromosomenpaare. Wer sie als US-BürgerIn bisher nicht näher kennt, kann dies seit Mitte November 2007 durch den Einsatz von rund 1.000 US-Dollar und einer Speichelprobe bei "23and Me" nachholen.
Jeder Mensch hat 23 Chromosomenpaare. Wer sie als US-BürgerIn bisher nicht näher kennt, kann dies seit Mitte November 2007 durch den Einsatz von rund 1.000 US-Dollar und einer Speichelprobe bei "23and Me" nachholen.
Und die im Mai 2007 vom Suchmaschinenanbieter Google für 2,9 Millionen Euro erworbene Biotech-Firma "23andMe" ist oder wird nicht lange allein sein, denn mit der isländischen Firma "deCode" existiert für die Gebühr von 985 US-Dollar bereits ein zweiter Anbieter, der bereits 1998 mit dem Erwerb der Erbdatenbank der isländischen Bevölkerung begonnen hatte, ins Innerste der Menschen zu schauen. Zwei weitere Firmen bereiten in den USA ihren Markteintritt vor. Anders als die beiden Erstanbieter verlangt der dritte bekannte künftige Anbieter, die Firma Navigenics, für ihre DNA-Analyse 2.500 US-Dollar, bietet dafür aber auch eine zusätzliche telefonische Genetik-Beratung an.
Alles zusammen deutet an, dass es bald zur gesundheitlichen Pflicht oder Eigenverantwortung gehören könnte, seine DNA zu kennen. Und wer könnte schon etwas gegen das "empowering [von] Individuals to Access and Understand Their Own Genetic Information" (Überschrift der Presseerklärung von 23andMe vom 19. November 2007 zu ihrem Marktauftritt) haben?
Welche Probleme mit der Produktion und Verbreitung derartiger Informationen sicher oder möglicherweise entstehen und ob sie vermieden werden können, sollte angesichts der Brisanz einiger der Informationen möglichst schnell und offen diskutiert werden.
In gut verständlicher Weise hat damit unter der Überschrift "The DNA Age: My Genome, Myself: Seeking Clues in DNA" die Journalistin Amy Harmon in der "New York Times" vom 17. November 2007 begonnen, die zu den journalistischen Vortestern des Angebots gehörte. Diesen und andere Artikel sowie das umfangreiche Archiv der NYT kann man nach einer kostenlosen Registrierung auf der Homepage der Zeitung lesen.
Zuvor soll aber kurz dargestellt werden, worin die Leistungen derartiger Firmen bereits jetzt bestehen. Dies lässt sich am besten in den Worten der Presseankündigung der Firma 23andMe nachvollziehen:
• "23andMe sends individuals a saliva kit containing a barcoded tube for saliva collection. Customers then use the enclosed mailing materials to send their samples to 23andMe's contracted laboratory. The DNA is then extracted and exposed to a microchip-like device made by Illumina, a leading developer of genetic analysis tools (Nasdaq: ILMN), that reads more than half a million points in the individual's genome, including a proprietary set chosen by 23andMe scientists, to produce a detailed genetic profile.
• Once the analysis has been completed, individuals will be able to use their own private login to access their data via 23andMe's secure website. Using 23andMe's web-based tools, individuals can explore their ancestry, see what genetics research means for them and compare themselves to friends and family members.
• Ultimately, they will become part of a community that works together to advance the overall understanding of the human genome."
Die Skepsis, mit der die vorhandenen und künftigen Angebote zu beurteilen sind, orientiert sich an folgenden Aspekten:
• Die Haftungsansprüche der Kunden sind unklar oder zumindest nicht in der in der EU gewohnten Weise gesichert. Die Firma deCODE bringt dies so zum Ausdruck: "Obwohl deCODE modernste Methoden zum Genotyping anwendet und nach höchsten Qualitätsstandards arbeitet", heißt es im Service-Agreement, "gibt deCODE keinerlei Garantie darauf, dass der Scan des genetischen Materials erfolgreich sein oder korrekte Resultate liefern wird." Da Island nicht der Europäischen Union angehört, greifen hier übrigens auch EU-Bestimmungen zu Kunden- und Datenschutz nicht.
• Auch wenn die Genanalysen nach Meinung von Experten auf labortechnisch hohem Niveau stattfinden, bleibt die Frage, wie die so genetisch analysierten Personen mit den sie betreffenden Ergebnissen umgehen. Dies betrifft zum einen den Umgang mit der Fülle von Risiko-Informationen bei Abwesenheit konkreter Erkrankungen. Auch wenn es Firmen gibt, die eine telefonische Beratung anbieten und nicht nur einen elektronischen "Genome Explorer" oder ein "Gen Journal", zeigt der Bericht über die Werte der NYT-Journalistin eine Reihe der hier auf die Nutzer solcher Angebote zukommenden Herausforderungen:" I found a perverse sense of accomplishment. My risk of breast cancer was no higher than average, as was my chance of developing Alzheimer’s. I was 23% less likely to get Type 2 diabetes than most people. And my chance of being paralyzed by multiple sclerosis, almost nil. I was three times more likely than the average person to get Crohn’s disease, but my odds were still less than one in a hundred. I was in remarkably good genetic health ... and then I opened my 'Gene Journal’ for heart disease to find that I was 23% more likely than average to have a heart attack." Fünf der SNPs oder "snips" aus den rund 10 Millionen "single nucleotide polymorphisms" oder Variationen der 23 Chromosomenpaare (die Firmen analysieren aber im Moment "nur" 1 Million solcher genetischer zusammenhänge), zeigen der Berichterstatterin ferner, dass sie eine hundertfach höhere Wahrscheinlichkeit hat, einen Zusammenbruch der Makula zu erleiden, also massive Sehverluste zu bekommen. Andere Snips beruhigen sie aber darin, dass sie im höheren Alter wohl keine bösartige Form der Arthritis in den Fingern haben dürfte, mithin weiter ohne Probleme Artikel tippen kann. Die einzige Hilfe beim Umgang mit ihrem Herzattackenrisiko, die das "Gene Journal" im übrigen lieferte, war der völlig banale Hinweis auf - wer hätte das gedacht - "healthy lifestyle choices".
• Der Gebrauchswert zahlreicher Leistungen, wie etwa die genetische Identifikation der Herkunftsgegend von Vorfahren der Personen oder ein "celebrity feature", das anzeigt mit welcher berühmten Person man genetisch etwas gemein hat, ist eher gering. Ob es im Genbestand dieser Formen womöglich Hinweise auf einen bisher unbekannten Bruder gibt, könnte dagegen präventiv für Erbstreitigkeiten interessant sein.
• Auch wenn alle Unternehmen ihren Kunden versichern, die persönlichen Daten niemand direkt zugänglich zu machen, gibt es Angebote, die zumindest nicht alle Möglichkeiten einer missbräuchlichen Verwendung dieser Daten verhindern: Dazu gehört z. B. das Angebot, "Genetische Familienportaits" erstellen zu lassen, in denen die Daten mehrerer Familienangehörigen zusammengeführt werden können. Technisch möglich sind auch "Genplauschs" mit Freunden. Ob dies irgendwann einmal "freundliche" Nachfragen von Arbeitgebern oder Versicherungsunternehmen provoziert, man habe doch nichts zu verbergen und solle mal einen Blick auf die Risikoprofile erlauben, ist natürlich im Moment nur eine Spekulation - aber praktisch möglich. Unabhängig davon stellt sich aber auch die Frage, ob das Internet wirklich technisch sicher für die Übertragung derartig sensible Daten ist.
• Das Angebot im Internet offenbart zugleich die wachsende Schwäche der in vielen Ländern bestehenden gesetzlichen Verbote einer solchen Genetikberatung von Anbietern in diesem Land.
• Auch wenn genanalytische Qualitätsstandards eingehalten werden, die Datensicherheit gewährleistet ist und selbst wenn es bessere Methoden der Erläuterung gibt, bleibt völlig offen bzw. ist wissenschaftlich nicht abschließend erforscht, in welchem Maße Menschen und ihre Gesundheit wirklich durch Genomsequenzen ohne jegliche Freiheitsgrade determiniert sind. Dies liegt allein schon daran, dass eine ganze Reihe von genetischen Steuerungsmechanismen nicht in der DNA-Sequenz kodiert ist. Es droht also die Gefahr, dass eine Reihe der Nutzer dieser Angebote zwischen Hypochondrie und Fatalismus hin- und hertreiben. Bei diesen Verunsicherungsfolgen hilft dann eventuell auch der Rat nicht, sich über derartige Profile mit seinen Arzt zu unterhalten. Aktuell dürften Hausärzte nämlich nicht arg viel sachkundiger sein als ihre Gen-Googler.
Bernard Braun, 26.11.2007
Nachhilfestunden bei Inkompetenz in Gesundheitsfragen: Ein gigantischer neuer Markt für Beratungsfirmen
 In der ersten Welle schwappten Alarmmeldungen darüber hoch, dass Millionen von US-Amerikanern über eine unzureichende Gesundheitskompetenz verfügen, also nicht in der Lage sind, Medikamenten-Beipackzettel oder Verhaltensanweisungen ihres Arztes zu verstehen. Die zweite Welle der Schlagzeilen war dann den Gesundheitsökonomen vorbehalten: Mangelhafte Gesundheitskompetenz ("Health Literacy"), so hieß es, würde nach einer wissenschaftlichen Studie unnötige Kosten im Gesundheitswesen von weit über 100 Milliarden Dollar verursachen. Jetzt brandet die dritte Schlagzeilen-Welle heran, die in Pressemitteilungen Abhilfe verheißt. "UCLA Anderson", eine große Bildungseinrichtung im Bereich Management, gab eine Pressemitteilung heraus und berichtete, dass im Rahmen eines großen "Health Literacy Programms" bei sozial benachteiligten Familien durch gesundheitsbezogene Beratung und Information die Gesundheitsausgaben pro Familie um 554 Dollar jährlich gesenkt werden konnten.
In der ersten Welle schwappten Alarmmeldungen darüber hoch, dass Millionen von US-Amerikanern über eine unzureichende Gesundheitskompetenz verfügen, also nicht in der Lage sind, Medikamenten-Beipackzettel oder Verhaltensanweisungen ihres Arztes zu verstehen. Die zweite Welle der Schlagzeilen war dann den Gesundheitsökonomen vorbehalten: Mangelhafte Gesundheitskompetenz ("Health Literacy"), so hieß es, würde nach einer wissenschaftlichen Studie unnötige Kosten im Gesundheitswesen von weit über 100 Milliarden Dollar verursachen. Jetzt brandet die dritte Schlagzeilen-Welle heran, die in Pressemitteilungen Abhilfe verheißt. "UCLA Anderson", eine große Bildungseinrichtung im Bereich Management, gab eine Pressemitteilung heraus und berichtete, dass im Rahmen eines großen "Health Literacy Programms" bei sozial benachteiligten Familien durch gesundheitsbezogene Beratung und Information die Gesundheitsausgaben pro Familie um 554 Dollar jährlich gesenkt werden konnten.
Teilnehmer an den Maßnahmen, die unter anderem vom großen amerikanischen Pharma-Unternehmen Johnson & Johnson gesponsert wurden, waren etwa 20.000 Kinder aus 35 Bundesstaaten, die auch schon am sogenannten "Head Start" Programm teilnahmen, einer kompensatorischen Erziehung für Kinder und Familien aus sozial benachteiligten Schichten. Zusätzlich zu den schulischen Nachhilfestunden erhielten diese Familien eine persönliche und telefonische Beratung sowie ein Gesundheits-Handbuch mit Verhaltensratschlägen, was sie bei bestimmten Erkrankungen ihrer Kinder selbst tun können, statt sofort einen Arzt oder eine Notaufnahme aufzusuchen.
Beobachtet hatte man nämlich zuvor, dass viele Eltern aus diesem Milieu auch schon bei Bagatell-Erkrankungen ihres Kindes (wie leichtes Fieber, Erkältungen oder Ohrenschmerzen) sofort eine Arztpraxis oder die Notaufnahme einer Klinik in Anspruch nahmen. Die Evaluation der Intervention zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz ergab dann, wie in einigen Grafiken von UCLA beeindruckend dargestellt wird, dass die Arztbesuche der beteiligten Familien um 42% gesunken waren und die Inanspruchnahme von Notaufnahmestationen um 58%. Die Kosteneinsparungen für die staatliche Krankenversicherung Medicaid waren dadurch beträchtlich. Kosten von 60 Dollar für die gesundheitliche Beratung standen Einsparungen von 554 Dollar pro Familie gegenüber. Insgesamt wurden für bei etwa 9.000 beteiligten Familien Kosten in Höhe von 5 Millionen Dollar eingespart. Es ist daher nicht verwunderlich, dass einige US-Bundesstaaten bereits beschlossen haben, das Programm zu übernehmen.
Hier ist die Pressemitteilung zu finden: UCLA Research Shows Dramatic Savings for Medicaid When Head Start Parents Learn to Care for Kids’ Illnesses
Hier ist ein Hintergrundpapier zu den Maßnahmen (Word-Datei): What to Do at 99.5ºF - Helping Head Start Parents Care for Kids’ Common Ailments
Mehr als jeder dritte erwachsene US-Amerikaner (36%), so war festgestellt worden, verfügt über eine unterdurchschnittliche "Health Literacy". Das entspricht einer potentiellen Beratungs-Klientel von 80 Millionen Bürgern. Man darf gespannt sein, wann die erste deutsche Studie durchgeführt wird. Die Schweiz ist schon so weit, es gibt sogar schon eine eigene Website "Gesundheitskompetenz". "Wir wollten herausfinden, ob in den drei großen Sprachregionen der Schweiz Unterschiede bezüglich der Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger bestehen und ob solche regionalen Unterschiede mit bestehenden Erkenntnissen übereinstimmen", heißt es in einer Pressemitteilung. Befragt wurden von April bis Mitte Mai 2006 insgesamt 1250 Einwohner im Alter von über 15 Jahren. Die mitgeteilten Ergebnisse verraten leider nicht, ob nun die Schweizer gesundheitskompetenter oder inkompetenter sind als Amerikaner. Berichtet wird lediglich über Einstellungen der Schweizer gegenüber ihren Ärzten und Erfahrungen in der Arztpraxis.
Hier ist die Pressemitteilung: Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPMZ) präsentiert Ergebnisse über die regionalen Unterschiede bezüglich der Gesundheitskompetenz in der Schweiz
Gerd Marstedt, 9.11.2007
Preis, gesundheitsbezogene Qualität und Komfort von Laufschuhen: Keine Spur von Zusammenhang.
 Egal, ob drei Streifen, gar keine Streifen, wasser- oder edelgasgepuffert oder mit und ohne Super-Torsion: "Richten Sie sich ja nicht nach dem Preis, wenn es um die Wahl von möglichst gesunden Sportschuhen geht!", so könnte salopp die Schlussfolgerung aus einer kleinen Studie in Großbritannien lauten.
Egal, ob drei Streifen, gar keine Streifen, wasser- oder edelgasgepuffert oder mit und ohne Super-Torsion: "Richten Sie sich ja nicht nach dem Preis, wenn es um die Wahl von möglichst gesunden Sportschuhen geht!", so könnte salopp die Schlussfolgerung aus einer kleinen Studie in Großbritannien lauten.
Unter der Überschrift "Do you get value for money when you buy an expensive pair of running shoes?" berichten Richard Thomas Clinghan, Graham P Arnold, Tim S Drew, Lynda Cochrane und Rami J Abboud vom Institute of Motion Analysis & Research der University of Dundee in der im Verbund mit dem BMJ erscheinenden Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicines" (Online first 11. Oktober 2007) von einer Untersuchung des Zusammenhangs von messbarer Qualität sowie subjektiv empfundenem Komfort von Sportschuhen mit den extrem unterschiedlichen Preisen.
In ihr wurden von 43 Testpersonen drei Paar Laufschuhe von drei verschiedenen Herstellern aus drei Preiskategorien, nämlich 40-45, 60-65 und 70-75 britischen Pfund gekauft und getestet. Die Tests bestanden in einer Messung der für die Sport- und Gesundheitsfunktion wichtigen Druckverteilung und damit Abfederung von Stößen gegenüber dem Gelenk- und Skelettsystem des Läufers auf der gesamten Fußsohle mit Hilfe des so genannten PEDAR-Systems. Der Komfort der Schuhe konnte auf einer validierten Skala bewertet werden. Diese Messungen erfolgten sowohl während Übungen auf einem Lauf-Heimtrainer und beim Outdoor-Walking, wobei sich keine großen Unterschiede bei der Leistungsfähigkeit der Schuhe zeigten.
Die weiteren Ergebnisse lauteten:
• Niedrig- und mittelpreisige Laufschuhe derselben Marke lieferten dieselbe, wenn nicht sogar eine bessere Federungswirkung wie die hochpreisigen Produkte. Insgesamt gab es aber weder zwischen den unterschiedlich teuren Exemplaren derselben Marke noch zwischen Marken nennenswerte Unterschiede.
• Die Bewertung des Komforts hängt offensichtlich stark von individuellen Präferenzen ab und hing weder mit der gemessenen Druckverteilung noch dem Preis der Schuhe zusammen. Hier muss angemerkt werden, dass den Testpersonen der Preis und die Marke der Schuhe unbekannt war, d.h. auch eindeutige Erkennungsmerkmale verdeckt wurden.
• Der Preis war kein Indikator oder Prädiktor für Federungsleistung oder Komfort.
Von dem Aufsatz "Do you get value for money when you buy an expensive pair of running shoes?" gibt es kostenfrei lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 15.10.2007
Entwicklung und Stand der Privatisierungsprozesse im deutschen Krankenhauswesen - Länderbericht Deutschland 2006!
 Seit der Wiedervereinigung ist bis 2004 der Anteil privater Träger im Krankenhausbereich von 14,1 % auf 25,3 % gestiegen. Diese für die vorherige deutsche Krankenhauslandschaft ungewöhnliche Entwicklung trug mit dazu bei, dass die drei größten privaten Krankenhausbetreiber Europas mit den Rhönkliniken, Helios und Asklepios ihren Sitz und ihr Hauptaktionsfeld in Deutschland haben.
Seit der Wiedervereinigung ist bis 2004 der Anteil privater Träger im Krankenhausbereich von 14,1 % auf 25,3 % gestiegen. Diese für die vorherige deutsche Krankenhauslandschaft ungewöhnliche Entwicklung trug mit dazu bei, dass die drei größten privaten Krankenhausbetreiber Europas mit den Rhönkliniken, Helios und Asklepios ihren Sitz und ihr Hauptaktionsfeld in Deutschland haben.
Diesen und vergleichbaren Prozessen in drei weiteren Branchen geht in weiteren fünf europäischen Ländern seit einigen Jahren und noch bis 2009 ein internationales Forschungsprojekt auf den Grund. Das von der EU-Kommission geförderte Forschungsprojekt "Privatisation of Public Services and the Impact
on Quality, Employment and Productivity (PIQUE)" (CIT5-2006-028478) beschäftigt sich mit den "Zusammenhängen zwischen Beschäftigung, Produktivität und der Qualität öffentlicher Dienstleistungen im Rahmen von Liberalisierungs- und Privatisierungsprozessen".
Eine Kernhypothese des Projekts ist die eines engen Zusammenhangs von guten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und ihren positiven Auswirkungen auf die Produktivität wie die Qualität der Dienstleistungen. Dieser Hypothese geht das Projekt in mehreren Ländern (z. B. Belgien, Österreich, Schweden und auch Deutschland) und verschiedenen Branchen (z. B. Elektrizität, Post, ÖPNV und Gesundheitsdienste / Krankenhäuser) empirisch nach. Das Projekt veröffentlicht innerhalb seiner Laufzeit mehrere Branchenberichte und Fallstudien und wird in Deutschland vom WSI-Institut in der Hans-Böckler-Stiftung bearbeitet.
Einer der Branchenberichte untersucht auf 27 Seiten die "Liberalisation, privatisation and regulation
in the German healthcare sector/hospitals", ist von Thorsten Schulte verfasst und Ende 2006 veröffentlicht worden.
Der Bericht beschäftigt sich vorrangig damit, einen kompakten und materialreichen Überblick über die Entwicklung und den Zustand der Krankenhausmarktsstruktur, das spezielle deutsche System zur gesetzlichen und finanziellen Regulierung dieses Marktes sowie die Rolle des Staates und anderer Stakeholders zu geben.
Ohne dass es im Krankenhausbereich eine vergleichbar explizite Privatisierungs- und Kommerzialisierungsansage gegeben hat, startete eine solche Strategie zunächst nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland und ab 2000 auch mit einer Privatisierungswelle in Westdeutschland. Letztere mit der vorläufigen Krönung der ersten Privatisierung zweier Universitätskliniken in Hessen. Dabei waren die verschiedenen Finanzierungs- und Finanzengpässe nahezu aller Bundesländer und vieler städtischer Haushalte die mitentscheidenden Triebkräfte.
Auch wenn der Verfasser des Berichts zu Recht beklagt, dass es erst wenige und dann kaum abgeschlossene Forschung über den Impact dieser Entwicklung auf die Arbeitsbedingungen, die wirtschaftlichen Beziehungen und die Qualität der Krankenhausleistungen gibt, verficht er entschieden die These, "privatisation will lead sooner or later to a deterioration of both working conditions and service quality".
Damit steht für ihn fest, dass der deutsche Krankenhaussektor auch künftig "an area of political struggles" bleiben wird.
Da die PIQUE-ForscherInnen auch den Krankenhausmarkt als das Resultat von politischen Entscheidungen betrachten, bleibt zu hoffen, dass es ihnen selber oder in Kooperation mit anderen empirischen Forschungsprojekten zur Arbeits- und Versorgungsqualität im Krankenhaus (z. B. das seit 2003 und noch bis Ende 2008 vom WZB und Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen bearbeitete Projekt "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System (WAMP)") gelingt, ihre Thesen zu verifizieren.
Den Bericht "Liberalisation, privatisation and regulation in the German healthcare sector/hospitals" kann man als kostenfreie PDF-Datei hier herunterladen.
Bernard Braun, 30.9.2007
Pflegeheime private Anlagespäre: "More profit and less nursing at many homes" - Nicht nur ein Problem der USA!?
 In der durch den aktuellen Prüfbericht des "Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK)" über die Qualität der ambulanten und stationären Altenpflege zum wiederholten Maße provozierten Debatte über immer noch beachtliche Defizite in Pflegeheimen, wird gar nicht oder nur am Rande über das mögliche Konfliktverhältnis zwischen den Gewinninteressen privater Träger von Pflegeeinrichtungen und den Interessen der Pflegebedürftigen und ihrer Pflegekassen gesprochen. Die Hinweise darauf, dass es offensichtlich Träger gibt, die eine weit bessere Qualität mit mehr qualifizierten MitarbeiterInnen anbieten als andere und dabei auch noch Gewinn machen, sollten aber Anlass sein darüber gründlicher zu recherchieren und zu diskutieren.
In der durch den aktuellen Prüfbericht des "Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK)" über die Qualität der ambulanten und stationären Altenpflege zum wiederholten Maße provozierten Debatte über immer noch beachtliche Defizite in Pflegeheimen, wird gar nicht oder nur am Rande über das mögliche Konfliktverhältnis zwischen den Gewinninteressen privater Träger von Pflegeeinrichtungen und den Interessen der Pflegebedürftigen und ihrer Pflegekassen gesprochen. Die Hinweise darauf, dass es offensichtlich Träger gibt, die eine weit bessere Qualität mit mehr qualifizierten MitarbeiterInnen anbieten als andere und dabei auch noch Gewinn machen, sollten aber Anlass sein darüber gründlicher zu recherchieren und zu diskutieren.
Zu welchen interessanten Ergebnissen man dabei kommt, zeigt eine gerade veröffentlichte vergleichende Recherche über die Besonderheiten privater Pflegeheimunternehmen - in den USA und in der "New York Times (NYT)" vom 23. September 2007.
Wer meint, amerikanische Zustände wären nicht vergleichbar und private Unternehmen seien in Deutschland sowieso oder a priori anders als in den USA und wer eine repräsentative Studie sucht, braucht nicht weiter zu lesen.
Für den, der sich doch dafür interessiert, folgen die wesentlichen Ergebnisse der von Charles Duhigg durchgeführten Analyse von Trends des Engagements privater Investmentgruppen in diesem Sektor und die Ergebnisse einer Analyse von Versorgungsdaten der "Centers for Medicare and Medicaid Services" des "Department of Health and Human Services".
Die NYT analysierte Daten von 1.200 privaten Pflegeheimen, die zwischen 2000 und 2006 von entsprechenden Unternehmen gekauft und betrieben werden und verglich sie mit mehr als 14.000 anderen bundesweiten Heimen in nichtprivater Trägerschaft. Die Bewertungskriterien waren u.a. die Häufigkeit von Beschwerden, die bei der Aufsichtsbehörde ("regulators") eingingen, Gesundheits- und Sicherheitsprobleme, die den Aufsichtsbeamten auffielen, Strafen, die gegen Heime durch staatliche und bundesstaatliche Behörden verhängt wurden und weitere Performance-Indikatoren aus mehreren Surveys und Datenbasen.
Dabei zeigten sich innerhalb des Untersuchungszeitraums eine Reihe deutlicher und systematischer Unterschiede zwischen privaten und anders getragenen Heimen:
• In privatwirtschaftlichen Heimen teilen sich 20 Bewohner eine registrierte Fach-Pflegekraft, in anderen Heimen waren es bundesweit durchschnittlich 13 BewohnerInnen.
• In jeder privaten Einrichtung traten durchschnittlich 7,7 ernste, von Aufsichtsbeamten entdeckten Gesundheitsprobleme auf, im nationalen Durchschnitt waren es lediglich - aber immerhin immer noch - 6,5.
• Der Anteil von langfristiger Pflege bedürftiger Personen, die Hilfe bei ihren täglichen Aktivitäten brauchten, wuchs zwischen 2000 und 2006 in privaten Heimen um 23 %, in den anderen Heimen um 16 %.
• Der Anteil der so genannten "long-stay residents", deren Fähigkeit sich selbst innerhalb und außerhalb ihres Wohnraumes zu bewegen verschlechterte sich in privaten Heimen um 17 % und in nicht-privaten um 13 %.
• Außerdem nahm der Anteil von BewohnerInnen, die depressiv und ängstlich waren, in privaten Heimen um 16 % und in anders getragenen Heimen um 14 % zu.
• Die in den USA dominanten großen privaten "Pflegeketten" (im Artikel gibt es dazu eine anschauliche interaktive Grafik) verdienten 2005 im Durchschnitt 41 % mehr an der Pflege als die durchschnittliche Einrichtung.
• In 60 % der von privaten Unternehmen frisch übernommenen Heimen wurde die Anzahl der "clinical registered nurses" abgesenkt und manchmal auch bis knapp unter die gesetzlich erlaubte Mindestanzahl. Bei 21 % der privaten Heime stieg ihre Anzahl aber auch, weil sie teilweise zuvor ungesetzlich niedrig lag.
• Obwohl das US-Gesundheitsministerium 2002 betonte, die meisten Pflegebedürftige bräuchten mindestens 1,3 Pflegestunden pro Tag durch eine Pflegefachkraft, lieferten die privaten Heime nur eine Stunde.
• In der Veröffentlichung fehlen allerdings Daten mit denen geprüft werden könnte, ob nicht private Heime möglicherweise von vornherein die schwierigeren Pflegebedürftigen aufgenommen hatten. Sehr unwahrscheinlich, aber möglich.
Der NYT-Artikel deutet bereits in der Überschrift "More profit and less nursing at many homes" die von der Zeitung vermuteten Hintergründe und Zusammenhänge der zitierten Verhältnisse an und illustriert auch anschaulich die Strategien mehrerer großer Investment-Gruppen, die in diesem Bereich aktiv waren und sind. Um die Dimensionen des Pflegemarktes zu verdeutlichen, weist die NYT auf die 75 Milliarden US-$ hin, die allein die staatlichen Versicherungssysteme Medicare und Medicaid 2006 für Heimpflege ausgegeben haben.
Wie profitabel das "Geschäft mit Pflegeheimen" sein kann, zeigt der Artikel am Weiterverkauf einer großen Heimkette mit 186 Heimen, an den Industrie- und Dienstleistungskonzern General Electric (GE). Der hierzulande mit humanem Touch werbenden Konzern waren diese Heime 1,4 Mrd. US-$ wert und die privaten Verkäufer hatten ihr eingesetztes Kapital innerhalb von vier Jahren mit diesen Heimen um mehr als 500 Millionen US-$ vermehrt. Dazu passt der lakonische Schlusssatz des Artikels: "Formation (so der Namen des Verkäufers) declined to comment on that figure."
Nach Lektüre des Artikels sollte man aber nochmals gründlich über die leuchtenden Augen einer Reihe von deutschen Akteure der Gesundheitswirtschaft nachdenken, wenn sie über die Demographie reden.
Kostenfrei heruntergeladen werden kann der im Ausdruck 10 Seiten umfassende Artikel - nach einer Registrierung - von Charles Duhigg "More profit and less nursing at many homes" hier.
Wer auch sonst an den zum Teil exzellent recherchierten und geschriebenen Artikeln der New York Times oder deren Gastkommentaren (darunter traditionell und für die an die Mehrheit der deutschen Ökonomen gewöhnten LeserInnen ausgesprochen lebendig und ideenreich der Ökonom Paul Krugman) interessiert ist, kann kostenlos eine tägliche Auswahl an Artikeln abonnieren und seit neuem auch die Archive der NYT kostenlos benutzen. Die einzige Voraussetzung ist, sich einmal kostenfrei online registrieren zu lassen und sich gelegentlich über die scheinbar unausrottbaren Werbungs-Pop ups zu ärgern.
Bernard Braun, 24.9.2007
Eine immer populärere Denkformel: Fast Food + Nahrungsergänzungsmittel = gesunde Ernährung
 Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpillen werden immer beliebter. Eine jetzt von TNS Healthcare, einem Institut für Gesundheitsforschung und Meinungsbefragung, durchgeführte Studie hat gezeigt, dass Besucher von Fitness-Studios überdurchschnittlich oft Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Befragt wurden rund 16.000 Personen im Alter von 14 bis 90 Jahren nach ihren sportlichen Aktivitäten und der Einnahme von Vitaminen und ähnlichen Produkten. Dabei gaben 15% der Frauen und 14% der Männer an, in den vergangenen drei Monaten ein Fitness-Studio besucht zu haben. In dieser Gruppe nehmen etwa 50% Vitamine ein, 38% Mineralstoffe und Spurenelemente. Dieser Anteil ist rund zehn Prozentpunkte höher als bei den Nicht-Besuchern (28%). Besonders auffällige Unterschiede gibt es bei den Präparaten, die zur Leistungssteigerung und zum Muskelaufbau genutzt werden. Während diese Produkte in der Bevölkerung von ein bis drei Prozent in den letzten drei Monaten konsumiert wurden, ist der Anteil unter den Fitness-Studio Besuchern deutlich höher. vgl. die Pressemitteilung von TNS Healthcare: "Besucher von Fitness-Studios nehmen ein 10- bis 15-faches an Nahrungsergänzungsmitteln ein"
Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpillen werden immer beliebter. Eine jetzt von TNS Healthcare, einem Institut für Gesundheitsforschung und Meinungsbefragung, durchgeführte Studie hat gezeigt, dass Besucher von Fitness-Studios überdurchschnittlich oft Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Befragt wurden rund 16.000 Personen im Alter von 14 bis 90 Jahren nach ihren sportlichen Aktivitäten und der Einnahme von Vitaminen und ähnlichen Produkten. Dabei gaben 15% der Frauen und 14% der Männer an, in den vergangenen drei Monaten ein Fitness-Studio besucht zu haben. In dieser Gruppe nehmen etwa 50% Vitamine ein, 38% Mineralstoffe und Spurenelemente. Dieser Anteil ist rund zehn Prozentpunkte höher als bei den Nicht-Besuchern (28%). Besonders auffällige Unterschiede gibt es bei den Präparaten, die zur Leistungssteigerung und zum Muskelaufbau genutzt werden. Während diese Produkte in der Bevölkerung von ein bis drei Prozent in den letzten drei Monaten konsumiert wurden, ist der Anteil unter den Fitness-Studio Besuchern deutlich höher. vgl. die Pressemitteilung von TNS Healthcare: "Besucher von Fitness-Studios nehmen ein 10- bis 15-faches an Nahrungsergänzungsmitteln ein"
Bereits 2006 hatte eine andere Umfrage gezeigt: "Jeder dritte Deutsche greift zu Nahrungsergänzungen in Form von Pillen, Kapseln oder Pulvern - so das Ergebnis einer Forsa-Studie. Besonders bei jungen, sportlichen und gestressten Menschen mit ausgeprägtem Gesundheitsbewusstsein und höherem Bildungsstand liegen die Erzeugnisse im Trend. Für die Industrie hat sich damit ein großer Markt eröffnet, der auf mindestens 1 Mrd. Euro Jahresumsatz allein mit Vitamin- und Mineralstoffpräparaten in Deutschland geschätzt wird." vgl. Das Geschäft mit den gesunden Kapseln - Der Markt der Nahrungsergänzungsmittel
Das Geschäft mit den in Drogerien, Apotheken und Supermärkten verkauften Pillen und Pülverchen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Rund 1,4 Milliarden Euro gaben deutsche Verbraucher von Oktober 2005 bis September 2006 für Nahrungsergänzungsmittel und verwandte Produkte aus. Dies berichtete Ralf Voigt, Marketing Manager beim Marktforschungsinstitut IMS-Health GmbH auf der 7. Euroforum Jahrestagung Nahrungsergänzungsmittel in Frankfurt. Am häufigsten gefragt waren Mittel zur Hustenlinderung, ergänzende Mineralstoffe, Multivitaminpräparate und Vitamin-C-Pillen. vgl. Nahrungsergänzungsmittel: Tops und Flops
Der gesundheitliche Nutzen der Nahrungsergänzungsmittel und Vitamintabletten ist überaus fraglich. So stellte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung fest, dass bei Nahrungsergänzungsmitteln auf der Basis von Gemüse- und Obstextrakten in der Regel der wissenschaftliche Nachweis der behaupteten gesundheitlichen Wirkungen fehlt. Häufig werden Befunde über gesundheitliche Positiveffekte durch den Verzehr von Obst und Gemüse schlicht übertragen auf synthetische Produkte. Der Nachweis einer gesundheitlich relevanten Wirkung muss jedoch für das einzelne Nahrungsergänzungspräparat erbracht werden, weil ansonsten der Verbraucher irregeführt und getäuscht wird. (DGE-Stellungnahme zu "Gemüse- und Obstprodukten" als Nahrungsergänzungsmittel)
Gerd Marstedt, 8.7.2007
"Teuer, meist überflüssig - und trotzdem gekauft" - Angst von Kerngesunden vor Cholesterin versus mündiger Verbraucher
 Auch wenn ab dem 1. Juli 2007 die so genannte EU-Health-Claims-Verordnung den Herstellern von Lebensmitteln vorschreibt, nur mit wissenschaftlich belegten Ergebnissen zu werben, ist ein anderes finanzielles und vielleicht sogar gesundheitliches Problem des freien aber intransparenten Angebots "gesunder Lebensmittel" und ihres "Für-alle-Fälle-Konsums" durch Menschen, die kerngesund sind, noch nicht vom Tisch.
Auch wenn ab dem 1. Juli 2007 die so genannte EU-Health-Claims-Verordnung den Herstellern von Lebensmitteln vorschreibt, nur mit wissenschaftlich belegten Ergebnissen zu werben, ist ein anderes finanzielles und vielleicht sogar gesundheitliches Problem des freien aber intransparenten Angebots "gesunder Lebensmittel" und ihres "Für-alle-Fälle-Konsums" durch Menschen, die kerngesund sind, noch nicht vom Tisch.
Dass es derartigen Fehlkonsum gar nicht selten gibt, zeigt eine jetzt veröffentlichte Studie des "Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV)" und des "Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR)" über das Angebot und den Verzehr von Lebensmitteln, die mit Pflanzensterinen angereichert sind. Diese Lebensmittel sollen dazu beitragen, erhöhte Cholesterinspiegel zu senken. Das derzeitige Angebot im Handel umfasst Margarine, aber auch Milchprodukte, Käse und Brot. In Deutschland startete diese Art "gesunder" Lebensmittel im Jahre 2000 mit der Margarine "becel pro-activ". Die Europäische Kommission hat den Zusatz von Pflanzensterinen nun auch für Fruchtgetränke auf Milchbasis, Sojagetränke, Gewürze und Salatsoßen zugelassen. Der Zusatz der Pflanzensterine muss auf der Packung gekennzeichnet sein. Der Gehalt an Sterinen ist begrenzt, damit die tägliche Aufnahme aus solchen Produkten drei Gramm nicht überschreitet und mögliche unerwünschte gesundheitliche Wirkungen ausgeschlossen sind. Weil Pflanzensterine die Aufnahme von Vitaminen einschränken können, wird auf den Packungen empfohlen, entsprechend mehr Obst und Gemüse zu essen. Kinder unter fünf Jahren, Schwangere und Stillende sollten die angereicherten Lebensmittel trotzdem nicht essen. Wer schon Cholesterin senkende Medikamente einnimmt, sollte den Verzehr mit dem Arzt abstimmen.
Ob die Hinweise auf den Packungen von den Verbrauchern wahrgenommen und befolgt werden und ob die mit Pflanzensterinen angereicherten Lebensmittel ihre eigentliche Zielgruppe - Personen mit erhöhten Cholesterinwerten - erreichen, haben BfR und vzbv gemeinsam mit den Verbraucherzentralen der Länder durch eine vermutlich nicht repräsentative aber dennoch aussagekräftige schriftliche Befragung von 1.002 Verbrauchern in 33 Lebensmittelgeschäften, die alle zu den Käufern von mit Pflanzensterinen angereicherten Lebensmitteln gehören, untersuchen lassen. Die Befragung wurde vom Institut für Markt und Gesellschaft (imug) Ende 2006 durchgeführt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Fast die Hälfte der Käufer (46 %) von Lebensmitteln mit Pflanzensterinen hat sich ohne spezielle Kaufempfehlung und 9 % haben sich durch Hinweise von Verwandten bzw. Bekannten für den Kauf der Produkte entschieden. Auf ärztliches Anraten haben 13 % der Käufer zu den Produkten gegriffen und 2 % folgten dem Rat von Apothekern oder Ernährungsberatern. Auf die Produktwerbung in den Medien haben 24 % und auf aktive Präsentation in Geschäften hat 1 % der Käufer reagiert.
• Die Befragten haben sich zu 80 % für den Verzehr der Produkte entschieden und zu 20 % verzehren sie die Produkte innerhalb familiärer und partnerschaftlicher Verhältnisse einfach mit. Ihr Verzehrsgrund ist zu 55 % ein erhöhter Cholesterinspiegel, dessen sie sich zu 48 % sicher sind. RUnd die Hälfte der befragten Käufer verzehrt damit ohne Grund regelmäßig Lebensmittel, die ihre Blutwerte beeinflussen. Zu 25 % hat er andere Verzehrsgründe, die überwiegend gesundheitlicher Art, jedoch nicht objektiviert sind.
• Die Befragten, die sich bewusst für den Verzehr entschieden haben, haben dies zu 21 % mit dem Arzt besprochen, obwohl das auf den Packungen ausdrücklich jedem angeraten wird. Sie riskieren damit unerwünschte gesundheitliche Wirkungen.
• Sie können zu 0,5 % alle zusätzlichen Gebrauchshinweise korrekt wiedergeben und zu 1 % die drei wichtigsten. Zu 27 % ist ihnen bekannt, dass diese Lebensmittel nicht von allen Menschen gegessen werden sollten und zu 21 %, dass bei den Produkten auf die Verzehrmengen zu achten ist. Außerdem wissen sie zu 8 %, dass die Pflanzensterine den Lebensmitteln zugesetzt wurden, kennen zu 4 % den empfohlenen Maximalverzehr von Pflanzensterinen und wissen zu 4 %, dass auch die Aufnahme von Carotinoiden und fettlöslichen Vitaminen durch den Verzehr der Produkte reduziert wird.
• Sie sind zu 83 % regelmäßige Verzehrer, die mindestens ein Produkt täglich verwendet und neigen zu 11 % zum täglichen Verzehr mehrerer Produkte. Ihr Potenzial zur Überschreitung der empfohlenen Höchstmenge an Pflanzensterinen durch Mehrfachverzehr liegt zurzeit um 2,3 %.
Die von den Auftraggebern der Studie geforderte bessere und eindeutige Kennzeichnung solcher Lebensmittel (klare und eindeutige Pflichtkennzeichnung von Lebensmitteln mit Pflanzensterinzusatz als für die Zielgruppe "für Menschen mit nachweislich erhöhtem Cholesterinspiegel" geeignet), erscheint im Lichte anderer im Bericht zitierten Forschungsergebnisse nicht unbedingt erfolgversprechend:
• Zwar geben 52 % bis 54 % der Verbraucher an, fast immer oder häufig das Zutatenverzeichnis, die Nährwertangaben oder die Angaben über Zusatzstoffe auf Lebensmitteln zu beachten.
• In der Dissertationsschrift "Qualitätswahrnehmung bei Lebensmitteln - Das Verbraucherbild in Rechtssprechung und Wissenschaft" von A. Engelage aus dem Jahr 2002 wird auch berichtet, dass 65 % der Verbraucher nach eigenen Angaben die gesetzlichen Kennzeichnungselemente von Lebensmitteln häufig nutzen.
• Sie arbeitete aber heraus, dass einzelne Kennzeichnungselemente unterschiedlich gewichtet und am häufigsten Informationen zur Haltbarkeit abgefragt werden. Zutatenverzeichnisse sowie Nährwertangaben werden zwar von zwei Dritteln der Verbraucher für nützlich gehalten, ihr bewusstes Lesen wird aber vor allem gesundheitsbewussten Verbrauchern zugeschrieben.
• Diese Informationen werden jedoch von den Verbrauchern nur zum Teil richtig verstanden und nur zu 20-30 % als besonders wichtige Informationen eingestuft.
Dabei bleibt die noch grundlegendere Frage unangesprochen, ob wirklich jeder Cholesterinspiegel so hoch ist, dass er etwa zur Verhinderung von Herz-Kreislauferkrankungen durch Medikamente und/oder "gesunde" und meist auch etwas teurere Lebensmittel gesenkt werden muss. Gegen die Behandlungsnotwendigkeit eines nicht geringen Teil des erhöhten Cholesterinspiegels gibt es nämlich seit längerem eine Reihe epidemiologischer Einwände.
Eine "Gemeinsame Presseerklärung des VZBV und des BfR" erhalten Sie hier.
Hier können Sie den 63-seitigen Projektbericht "Lebensmittel mit Pflanzensterinzusatz in der Wahrnehmung der Verbraucher. Projektbericht über ein Gemeinschaftsprojekt der Verbraucherzentralen und des BfR", herausgegeben von Birgit Niemann, Christine Sommerfeld, Angelika Hembeck und Christa Bergmann erhalten.
Bernard Braun, 28.6.2007
Selbstzahlermarkt Gesundheitswesen: Konsumenten-Nirvana oder Käufer-Nepp? Was lehren die "self-pay markets" in den USA?
 Immer dann, wenn staatliche, intermediäre oder gemeinsame Einrichtungen oder die Selbstverwaltung von Krankenversicherern und Leistungserbringer daran scheitern, Verträge über möglichst preisgünstige aber qualitativ hochwertige Leistungen abzuschließen und die Patienten dazu zu bringen, diese Leistungen nachzufragen und zu akzeptieren, einigen sich die Gescheiterten darauf, diese schwierige Aufgabe, dem Patienten zu übertragen. Mit genügend Informationen über Preise und Qualitäten ausgestattet und mit kräftigen Sparanreizen bis hin zur völligen Vorfinanzierung in Kostenerstattungssystemen, erscheint der Patient geeignet, die Rolle eines einkaufenden Konsumenten ausfüllen zu können. Befreit von der bevormundenden und anonymen Preis- und Qualitätsregulierung durch dritte Parteien, werden diese Modelle als funktionierende Alternativen propagiert.
Immer dann, wenn staatliche, intermediäre oder gemeinsame Einrichtungen oder die Selbstverwaltung von Krankenversicherern und Leistungserbringer daran scheitern, Verträge über möglichst preisgünstige aber qualitativ hochwertige Leistungen abzuschließen und die Patienten dazu zu bringen, diese Leistungen nachzufragen und zu akzeptieren, einigen sich die Gescheiterten darauf, diese schwierige Aufgabe, dem Patienten zu übertragen. Mit genügend Informationen über Preise und Qualitäten ausgestattet und mit kräftigen Sparanreizen bis hin zur völligen Vorfinanzierung in Kostenerstattungssystemen, erscheint der Patient geeignet, die Rolle eines einkaufenden Konsumenten ausfüllen zu können. Befreit von der bevormundenden und anonymen Preis- und Qualitätsregulierung durch dritte Parteien, werden diese Modelle als funktionierende Alternativen propagiert.
Eine von der "California HealthCare Foundation" in Auftrag gegebene Studie, die von Forschern des Non-Profit-"Center for Studying Health System Change (HSC)" durchgeführt wurde, ist jetzt beendet und in der renommierten Zeitschrift "Health Affairs" in deren Web exklusive-Bereich zusammen mit einem langen Kommentar veröffentlicht worden. Beide Aufsätze fassen Erfahrungen aus den USA zusammen, also einem Land, in dem es die breitesten und längsten Erfahrungen mit derartigen Methoden und Anreizsystemen gibt.
Die auf vielen Interviews mit Gesundheitsmarkt-Experten, Leistungsanbietern, Berufsorganisationen und staatlichen Regulatoren basierende Studie "Self-Pay Markets in Health Care: Consumer Nirvana or Caveat Emptor (=Käufer sei auf der Hut)?" von Ha T. Tu and Jessica H. May (in: "Health Affairs 26, no. 2 (2007), w217-w226: published online 6 February 2007), kommt zu folgenden Erkenntnissen:
• Selbst wenn Patienten die gesamten Kosten einer medizinischen Behandlung aus eigener Tasche vorfinanzieren oder teilweise auch ganz allein zahlen müssen, suchen sie lediglich begrenzt durch systematische Vergleiche nach dem Angebot mit dem niedrigsten Preis und der höchsten Versorgungsqualität. Selbst dann, wenn die medizinischen Leistungen relativ übersichtlich sind und geradlinig zu erreichen sind, gibt es vor dem erwarteten Verhalten des "consumer Shopping" viele Barrieren.
• Auf dem näher betrachteten Markt für LASIK ( damit ist die Beseitigung von Kurz- und Weitsichtigkeit durch eine Laserbehandlung des Auges gemeint), der in den USA als ein idealer Selbstzahlermarkt gilt, sahen sich die Patienten zahlreichen Hürden, undurchsichtigen Rechnungen, fehlleitender Werbung und offenen Qualitätsfragen gegenüber. Ähnliches zeigte sich auf den Märkten für in vitro-Befruchtung, kosmetischer Nasenveränderung und Zahnkronen.
• Während diese Märkte und die genannten Anreize als ideal geeignete Modelle für kostensenkendes und qualitätsverbesserndes Konsumentenengagement gelten, verlassen sich nach den durchgeführten Untersuchungen Patienten bei der Wahl ihres Leistungserbringers oft nur auf mündliche Empfehlungen.
Der HSC-Präsident Paul Ginsburg verweist in seinem Co-Aufsatz "Shopping For Price In Medical Care. Insurers are best positioned to provide consumers with the information they need, but will they deliver?" (in: Health Affairs 26, no. 2 (2007): w208-w216. published online 6 February 2007) darauf, dass die laufenden Bemühungen, die Preistransparenz zu Gesundheitsleistungen für die genannten Ziele zu verbessern, oft die komplexen Entscheidungen über medizinische Behandlungen, die Abhängigkeit der Patienten von ärztlichen Ratschlägen und die Notwendigkeit von Qualitätsinformationen herunterspielten. Dem Patienten einfach eine Preisliste von "à la carte"-Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, hilft ihm bei den komplexen Wahlentscheidungen über preisgünstige und qualitativ gute Leistungen und Leistungserbringer wenig.
Für die USA kommen die Forscher und der HSC-Präsident zu der politischen Empfehlung, nicht die Rolle von "health plans", also der kollektiven Organisation, bei der Aushandlung besserer Preise und der verständlichen Übersetzung komplexer Preis- und Qualitätsdaten in nützliche handlungssteuernde Informationen für das Patientenverhalten im Gesundheitsmarkt aus dem Auge zu verlieren.
Da nicht zu erwarten ist, dass deutsche Versicherte und Patienten von Natur aus bessere Konsumenten sind oder deutsche Informationssysteme den us-amerikanischen Marktsystemen überlegen sind, verdienen die kritischen Bewertungen der empirischen Steuerungsfähigkeit durch einzelne Konsumenten gerade in der aufkommenden Begeisterung für deren Rolle im deutschen Gesundheitswesen einer gewissen Aufmerksamkeit.
Die kalifornischen Auftraggeber ziehen für sich folgenden Schluss: "Unlike shopping for a car or going to a restaurant, there is no easily-obtained 'list price' or menu of medical services. We commissioned this research to highlight the disconnect between consumers' growing financial responsibility for medical care and the lack of easily-accessible cost and quality information to guide decision-making."
Hier finden Sie den komplett kostenfreien Text des 10 Seiten umfassenden Aufsatzes "Self-Pay Markets In Health Care: Consumer. Nirvana Or Caveat Emptor? Experience with LASIK, dental crowns, and other self-pay procedures reveals key barriers to robust consumer price shopping" von Ha T. Tu and Jessica H. May in der Web exklusive-Ausgabe von "Health Affairs".
Außerdem können Sie hier auch den 9 Seiten umfassenden Aufsatz
"Shopping For Price In Medical Care. Insurers are best positioned to provide consumers with the information they need, but will they deliver?" von Paul Ginsburg kostenfrei komplett herunterladen
Bernard Braun, 6.2.2007
Beschäftigte im Gesundheitswesen 2005: Zwischen "Jobmotor" und "Personalmangel"
 "Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren zum 31. Dezember 2005 knapp 4,3 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwa jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Während die Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft zwischen 2004 und 2005 nahezu stagnierte, ist sie im Gesundheitswesen um 27 000 Beschäftigte oder 0,6% gestiegen."
"Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren zum 31. Dezember 2005 knapp 4,3 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwa jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Während die Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft zwischen 2004 und 2005 nahezu stagnierte, ist sie im Gesundheitswesen um 27 000 Beschäftigte oder 0,6% gestiegen."
Wer sich nach diesem rundum positiven Einstiegsabsatz einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 18.1. 2007 zufrieden zurücklehnt und Meldungen über Personalmangel im Gesundheitswesen in das Reich des "üblichen Gejammers" verweist, verpasst die ganze Wahrheit um 10 Zeilen oder findet sie in seiner Tageszeitung gar nicht.
Denn ebenso wie die absolute Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen in dem zitierten Umfang gestiegen ist, setzte sich ein anderer Trend, nämlich die Abnahme der so genannten vollzeitäquivalenten Stellen fort.
In den Worten des Statistischen Bundesamtes sah dies so aus: "Nicht alle der 4,3 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen besaßen eine Vollzeitstelle: Die Zahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten im Gesundheitswesen, die so genannten Vollzeitäquivalente, lag bei 3,3 Millionen. Sie ging zwischen 2004 und 2005 wie schon im Vorjahreszeitraum weiter zurück (- 26 000 beziehungsweise - 0,8%). Grund hierfür war der Rückgang der Vollzeitbeschäftigung um 2,2%. Dies konnte auch durch den Anstieg der Teilzeit- beziehungsweise geringfügig Beschäftigten um 4,2% beziehungsweise 9,4% nicht ausgeglichen werden."
Die Beschäftigungssituation im Gesundheitswesen ist also weder mit dem Schlagwort "Jobmaschine" noch mit dem des "Personalmangels" allein angemessen zu beschreiben und zu bewerten, sondern erfordert differenziertere und ergebnisoffene Analysen z. B. über die Auswirkungen der Zunahme von Teilzeittätigkeit auf die Versorgungsqualität und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Wer über die quantitative Entwicklung noch Genaueres wissen will und zwar seit 1997 und nach Geschlecht sowie Berufen und Teilbereichen des Gesundheitswesens differenziert, kann dies interaktiv mit so genannten Ad hoc-Tabelellen des Statistischen Bundesamt machen.
Bernard Braun, 18.1.2007
Das Geschäft mit der Krankheit
 Das Gesundheitswesen in Deutschland ist ein zukunftsträchtiger und ökonomisch überaus relevanter Markt. Weltweit gilt der "Gesundheitsmarkt" als 3,5 Billionen Dollar schwer, allein in Deutschland betragen die Ausgaben der GKV jährlich über 140 Milliarden Euro und die Umsätze für Arzneimittel betrugen 2005 knapp 35 Millionen Euro. Nach einer neuen Länderanalyse der Unternehmensberatung Frost & Sullivan soll sich der Gesamtumsatz im europäischen Gesundheitswesen, zu dem Arzneimittel, Medizintechnik und medizinische Leistungen beitragen, bis 2008 um jährlich 6,4% erhöhen.
Das Gesundheitswesen in Deutschland ist ein zukunftsträchtiger und ökonomisch überaus relevanter Markt. Weltweit gilt der "Gesundheitsmarkt" als 3,5 Billionen Dollar schwer, allein in Deutschland betragen die Ausgaben der GKV jährlich über 140 Milliarden Euro und die Umsätze für Arzneimittel betrugen 2005 knapp 35 Millionen Euro. Nach einer neuen Länderanalyse der Unternehmensberatung Frost & Sullivan soll sich der Gesamtumsatz im europäischen Gesundheitswesen, zu dem Arzneimittel, Medizintechnik und medizinische Leistungen beitragen, bis 2008 um jährlich 6,4% erhöhen.
Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht Wunder, dass Pharma-Unternehmen und Hersteller von Medizintechnik ihre Marktanteile auch mit Strategien zu erhöhen trachten, die bei Licht betrachtet dem Leitbild eines mündigen und informierten Patienten erheblich widersprechen. Die Zeitschrift "Public Library of Science" hat jetzt ein Schwerpunktheft herausgegeben, das sich in mehreren Beiträgen (auf Englisch) dem "Geschäft mit der Krankheit" widmet. Es werden vielfältige Hintergrund-Informationen präsentiert zu Marketingstrategien der Pharmaindustrie, zur Rolle der Medien sowie zur Frage, ob Regierungen eine regulierende Funktion ausüben können.
Einige Aufsätze aus dem Sonderheft:
• "Bigger and Better: How Pfizer Redefined Erectile Dysfunction" - Über die Strategien des Pfizer-Konzerns zur Vermarktung und Umsatzssteigerung von Viagra
• "Medicine Goes to School: Teachers as Sickness Brokers for ADHD" - Wie versucht wird, schon Lehrer in Schulen in eine Strategie der Medikalisierung beim "Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)", dem sog. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom einzubinden
• "Female Sexual Dysfunction: A Case Study of Disease Mongering and Activist Resistance" - Wie weibliche Sexualprobleme medikalisiert werden und sofortige Hilfe versprochen wird
• "The Latest Mania: Selling Bipolar Disorder" - Wie Psychopharmaka als alltägliche Stimmungsaufheller verkauft werden
PDF-Datei (4.4 MB, 47 Seiten) The Fight against Disease Mongering (Das Geschäft mit der Krankheit)
Gerd Marstedt, 28.11.2006
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL): Dringend regulierungsbedürftig
 Seit 1998 gibt es so genannte "Individuelle Gesundheitsleistungen" mit der einprägsamen Abkürzung IGeL. Der Begriff beschreibt ärztliche Leistungen, die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen getragen werden und die daher von Interessierten selbst bezahlt werden müssen. Eine weitere medizinische Definition gibt es nicht. Am häufigsten werden Diagnosemethoden als IGeL verkauft, insbesondere in Form so genannter "Vorsorge". Die vorrangige Motivation für das Konzept war und ist, die finanzielle Situation der Anbieter zu verbessern.
Seit 1998 gibt es so genannte "Individuelle Gesundheitsleistungen" mit der einprägsamen Abkürzung IGeL. Der Begriff beschreibt ärztliche Leistungen, die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen getragen werden und die daher von Interessierten selbst bezahlt werden müssen. Eine weitere medizinische Definition gibt es nicht. Am häufigsten werden Diagnosemethoden als IGeL verkauft, insbesondere in Form so genannter "Vorsorge". Die vorrangige Motivation für das Konzept war und ist, die finanzielle Situation der Anbieter zu verbessern.
IGeL werden oft als Teil eines zweiten Gesundheitsmarkts beschrieben und weisen auch viele marktwirtschaftliche Charakteristika auf, zum Beispiel: Stimulierung von Bedarf, Werbung, Dominanz von Verkaufs- gegenüber Informationsbemühungen. Dies ist bei medizinischen Themen allerdings nicht unproblematisch. An vielen Beispielen kann gezeigt werden, dass Informationen falsch, unvollständig, halbwahr und tendenziös, nach Kriterien der Kassenärztlichen Vereinigungen sogar unseriös sind. Eine angemessene Aufklärung von Interessierten ist nicht gewährleistet. Damit entfällt vielfach die Grundlage und wesentliche Voraussetzung für ein informiertes Einverständnis der an IGeL Interessierten. Zum Schutz der Versicherten besteht bezüglich des IGeL-Marktes insbesondere wegen seiner vielfältigen Auswüchse dringender Regulierungsbedarf.
Prof. Dr. med. Jürgen Windeler, Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen, setzt sich in diesem Artikel mit der Problematik der IgeL-Angebote auseinander.
PDF-Datei Individuelle Gesundheitsleistungen - Spagat zwischen Markt und Medizin
Gerd Marstedt, 31.10.2006
"Der Markt der Gesundheit" - Neue Focus-Broschüre zur Gesundheitswirtschaft
 "Die Bedeutung des Gesundheitsmarktes steigt kontinuierlich. Schon heute wird in diesem Markt mehr umgesetzt als in der gesamten Automobilbranche. Rund 4,2 Millionen Menschen waren 2003 in der Gesundheitsbranche tätig. Das entspricht einem Anteil von elf Prozent an allen Beschäftigten in Deutschland. Gesundheit ist ein Wirtschaftsmotor, gleichzeitig ein Faktor, den sich die deutsche Volkswirtschaft in bisheriger Form nicht mehr leisten kann. Jedem Bürger ist klar, dass es Einschnitte geben muss, aber kaum jemand möchte davon betroffen sein. Nach Inkrafttreten der letzten Gesundheitsreform nahm der Anteil derjenigen, die bereit sind, persönliche Opfer für die Gesundheit zu bringen, von 30 Prozent im Jahr 2004 auf 27 Prozent in diesem Jahr ab. Dies ergab eine aktuelle Analyse der FOCUS-Studie Communication Networks 9.0.
"Die Bedeutung des Gesundheitsmarktes steigt kontinuierlich. Schon heute wird in diesem Markt mehr umgesetzt als in der gesamten Automobilbranche. Rund 4,2 Millionen Menschen waren 2003 in der Gesundheitsbranche tätig. Das entspricht einem Anteil von elf Prozent an allen Beschäftigten in Deutschland. Gesundheit ist ein Wirtschaftsmotor, gleichzeitig ein Faktor, den sich die deutsche Volkswirtschaft in bisheriger Form nicht mehr leisten kann. Jedem Bürger ist klar, dass es Einschnitte geben muss, aber kaum jemand möchte davon betroffen sein. Nach Inkrafttreten der letzten Gesundheitsreform nahm der Anteil derjenigen, die bereit sind, persönliche Opfer für die Gesundheit zu bringen, von 30 Prozent im Jahr 2004 auf 27 Prozent in diesem Jahr ab. Dies ergab eine aktuelle Analyse der FOCUS-Studie Communication Networks 9.0.
Gleichzeitig steigt das Preisbewusstsein der Bevölkerung beim Kauf rezeptfreier Arzneimittel. Jeder Dritte greift eher zu günstigen Präparaten und jeder zweite Bürger versucht zusätzlich bei anderen Gesundheitsprodukten zu sparen. Das höchste Vertrauen bei Informationen zu Gesundheitsfragen genießt nach wie vor der Arzt. 61 Prozent der Bevölkerung ziehen ihn zu Rate, 60 Prozent informieren sich aus Printmedien und 38 Prozent verlassen sich auf die Empfehlung des Apothekers. Künftig wird das Internet als Informationsquelle an Bedeutung gewinnen. Bereits heute beziehen sich rund 40 Prozent der Suchabfragen im Internet auf das Thema Gesundheit."
Dies sind einige Ergebnisse, die in der neuen Broschüre der Zeitschrift "Focus" vorgestellt werden. Auf 52 Seiten werden zu vielen Themen (u.a.: Prävention, medizinische Versorgung, Selbstmedikation, sanfte Medizin, Pharmaindustrie, Informationsverhalten zur Gesundheit, Werbemarkt) Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien und Umfragen kurz zusammengefasst und mit Grafiken und Tabellen anschaulich dargestellt. Der Download der Broschüre ist kostenlos, man muss sich jedoch vorher bei www.medialine.de registrieren.
Hier geht es zum Download der Focus-Medialine Broschüre "Der Markt der Gesundheit"
Gerd Marstedt, 22.12.2005
"Individuelle Gesundheitsleistungen" (IGeL) - eine neue Goldgrube für Ärzte?
 Immer öfter bieten Ärzte in ihrer Praxis Zusatzleistungen an, die der Patient selbst bezahlen soll. Rund 16 Millionen Versicherte (23,1 Prozent) haben in den vergangenen zwölf Monaten eine solche "Individuelle Gesundheitsleistung" (IGeL) angeboten bekommen. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) und die Verbraucherzentrale NRW am 10. Oktober 2005 in Bonn vorgelegt haben. Die auch so genannten "Wohlfühlleistungen" werden vor allem einkommensstarken Patienten angeboten. So bekamen nur 17,6 Prozent der Versicherten in der Einkommensgruppe bis 2.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen IGeL-Angebote, während es in der Einkommensgruppe oberhalb von 4.000 Euro doppelt so viele (35,5 Prozent) waren. "Dadurch wird deutlich, dass bei Individuellen Gesundheitsleistungen das medizinisch Notwendige nicht im Vordergrund steht", betonte Klaus Zok, Projektleiter beim WIdO und Autor der Studie.
Immer öfter bieten Ärzte in ihrer Praxis Zusatzleistungen an, die der Patient selbst bezahlen soll. Rund 16 Millionen Versicherte (23,1 Prozent) haben in den vergangenen zwölf Monaten eine solche "Individuelle Gesundheitsleistung" (IGeL) angeboten bekommen. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) und die Verbraucherzentrale NRW am 10. Oktober 2005 in Bonn vorgelegt haben. Die auch so genannten "Wohlfühlleistungen" werden vor allem einkommensstarken Patienten angeboten. So bekamen nur 17,6 Prozent der Versicherten in der Einkommensgruppe bis 2.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen IGeL-Angebote, während es in der Einkommensgruppe oberhalb von 4.000 Euro doppelt so viele (35,5 Prozent) waren. "Dadurch wird deutlich, dass bei Individuellen Gesundheitsleistungen das medizinisch Notwendige nicht im Vordergrund steht", betonte Klaus Zok, Projektleiter beim WIdO und Autor der Studie.
Rund 16 Millionen gesetzlich krankenversicherten Patienten wird im Laufe eines Jahres eine Selbstzahler-Leistung unterbreitet oder sie haben eine solche Leistung in Anspruch genommen. Im aktuell beobachteten Einjahreszeitraum stieg der Umfang der privat angebotenen Zusatzleistungen um 44%. Das Verkaufsvolumen erreicht gegenwärtig rund eine Milliarde Euro. Dabei ist der zahnärztliche Bereich in dieser Summe noch nicht einmal enthalten. Dabei liegen mit einem Anteil von 22% Prozent die Ultraschalluntersuchungen auf Platz eins, gefolgt von Augeninnendruckmessungen (16%) und ergänzenden Krebs-Früherkennungsuntersuchungen bei Frauen (11%). Mehr als 40 Prozent der Versicherten meinten, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis durch IGeL beeinflusst wird, wobei sie mehrheitlich eine Verschlechterung (79%) befürchten. Die von den Versicherten hierzu formulierten Aussagen bringen durchgehend die Verunsicherung zum Ausdruck, die mit der Wahrnehmung des ärztlichen Verkaufsinteresses einhergeht.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ist als PDF-Datei kostenlos herunterzuladen; Goldgrube Privatabrechnung. Die gesamte Studie kann gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro beim Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) bezogen werden. Die Befragungsergebnisse von 2005 decken sich sehr stark mit den schon ein Jahr zuvor vom WidO ermittelten Befunden. Hierzu gibt es eine PDF-Datei mit ausführlicher Darstellung der Umfrageresultate auf 8 Seiten: Klaus Zok: Private Zusatzangebote in der Arztpraxis (WIdO Monitor 1, 2004).
In einer unlängst vom Marktforschungsunternehmens GfK und der Stiftung Gesundheit durchgeführten Studie, bei der Ende 2004 eine Stichprobe von 8000 niedergelassenen Ärzten aller Fachrichtungen, befragt wurden, zeigte sich:
• 74% der befragten Ärzte gaben an, sie würden in ihrer Praxis IGeL-Leistungen anbieten, weitere 8% planten dies für die Zukunft
• 79% stimmten (völlig oder eher) der Aussage zu "Ohne Individuelle Gesundheitsleistungen ist meine Praxis auf Dauer nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben." Die Studie kann hier kostenlos heruntergeladen werden: Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit
Eine detaillierte Liste der individuellen Gesundheitsleistungen, die derzeit in Arztpraxen angeboten werden, von Vorsorgeuntersuchungen über reisemedizinische Beratungsleistungen bis hin zu sonstigen Leistungen (wie Beschneidung oder Refertilisation nach vorangegangener Sterilisation) einschl. der Gebühren findet man hier:
• IGEL - Individuelle Gesundheitsleistungen
Gerd Marstedt, 31.10.2005
Gesundheit als Lifestyle: Marktanalysen und Hintergrunddaten des FOCUS
 Nach dem theoretischen Modell des russischen Professors für Wirtschaft, Nikolai Kondratieff, kommt es alle 30 bis 50 Jahre zu einer Basisinnovation, die dann einen neuen sog. Kondratieff-Zyklus einleitet. Nach Dampfmaschine und Baumwolle und zuletzt Informationstechnik und Computer wird als nächster Zyklus der Schwerpunkt "individuelle und kollektive Gesundheit" prognostiziert. Schon jetzt verzeichnet die Gesundheitswirtschaft mächtige Wachstumsraten. Damit ist weniger der große Markt der Selbstmedikation angesprochen, als vielmehr jene Produkt-Palette, die im Gefolge der Präventions-Bemühungen unserer Gesellschaft für den Bürger Hilfe sein sollen für eine gesundsheitsbewußte Lebensweise: Fitness-Studios und Heimtrainer, Wellness-Hotels und Saunas, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, cholesterinfreie Nahrungsmittel und Energie-Drinks.
Nach dem theoretischen Modell des russischen Professors für Wirtschaft, Nikolai Kondratieff, kommt es alle 30 bis 50 Jahre zu einer Basisinnovation, die dann einen neuen sog. Kondratieff-Zyklus einleitet. Nach Dampfmaschine und Baumwolle und zuletzt Informationstechnik und Computer wird als nächster Zyklus der Schwerpunkt "individuelle und kollektive Gesundheit" prognostiziert. Schon jetzt verzeichnet die Gesundheitswirtschaft mächtige Wachstumsraten. Damit ist weniger der große Markt der Selbstmedikation angesprochen, als vielmehr jene Produkt-Palette, die im Gefolge der Präventions-Bemühungen unserer Gesellschaft für den Bürger Hilfe sein sollen für eine gesundsheitsbewußte Lebensweise: Fitness-Studios und Heimtrainer, Wellness-Hotels und Saunas, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, cholesterinfreie Nahrungsmittel und Energie-Drinks.
Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht Wunder, wenn der "Gesundheitsmarkt" ausführlichen Analysen unterzogen wird. Das Magazin FOCUS bietet zwei relativ ausführliche Studien, die nicht nur für Produzenten im Gesundheitsmarkt von Interesse sind, sondern anhand vieler statistischer Daten und Umfrage-Ergebnisse verdeutlichen, in welchem Maße in unserer Gesellschaft Gesundheit, Fitness und Wellness boomen. Beide Studien: "Der Markt für Fitness und Wellness" (56 Seiten) und "Der Markt der Gesundheit" (43 Seiten) sind bei FOCUS online als PDF-Dateien kostenlos herunterzuladen, vorher muss man sich lediglich registrieren.
PDF-Dateien von FOCUS Media Line: Der Markt für Fitness und Wellness, Der Markt der Gesundheit
Gerd Marstedt, 12.8.2005
Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit
 EDV und Informationstechnologien verbreiten sich immer schneller und dringen auch ein in die medizinische Versorgung. Die Patienten-Chipkarte, Internet-Homepages von Ärzten und Kliniken, EDV-Systeme zum Qualitätsmanagement sind einige Zeugen dieses Wandels. Vor diesem Hintergrund geht eine gemeinsame Studie des Marktforschungsunternehmens GfK und der Stiftung Gesundheit der Frage nach, wie Ärzte diese Herausforderungen wahrnehmen und wie sie ihnen in der Praxis begegnen. Befragt wurde dazu Ende 2004 eine Stichprobe von 8000 niedergelassenen Ärzten aller Fachrichtungen. Die zentralen Fragenblöcke waren: Nutzung von EDV im Praxisalltag, Nutzung und Einsatz von Online-Medien, Einstellung zu Qualitätsmanagement-Systemen, Stand der rechtlichen Sicherheit im Praxisalltag.
EDV und Informationstechnologien verbreiten sich immer schneller und dringen auch ein in die medizinische Versorgung. Die Patienten-Chipkarte, Internet-Homepages von Ärzten und Kliniken, EDV-Systeme zum Qualitätsmanagement sind einige Zeugen dieses Wandels. Vor diesem Hintergrund geht eine gemeinsame Studie des Marktforschungsunternehmens GfK und der Stiftung Gesundheit der Frage nach, wie Ärzte diese Herausforderungen wahrnehmen und wie sie ihnen in der Praxis begegnen. Befragt wurde dazu Ende 2004 eine Stichprobe von 8000 niedergelassenen Ärzten aller Fachrichtungen. Die zentralen Fragenblöcke waren: Nutzung von EDV im Praxisalltag, Nutzung und Einsatz von Online-Medien, Einstellung zu Qualitätsmanagement-Systemen, Stand der rechtlichen Sicherheit im Praxisalltag.
Die Studie berichtet unter anderem über folgende Ergebnisse:
• Niedergelassene Ärzte sind untereinander und mit Kliniken bereits in hohem Maße vernetzt, die Vernetzung wird aber bislang nicht regelmäßig genutzt.
• Bereits 63 % der befragten Ärzte verfügen über eine eigene Homepage im Internet, ähnliche viele sind in einem Online-Verzeichnis für Ärzte eingetragen.
• Etwa zwei Drittel der Ärzte halten Werbemaßnahmen für die eigene Praxis für "sehr wichtig" oder "eher wichtig" und stimmen auch der Aussage zu: "Werbung wird im ärztlichen Bereich als eine Form des
Praxismarketings in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen."
• 74% der befragten Ärzte gaben an, sie würden in ihrer Praxis IGeL-Leistungen anbieten, weitere 8% planten dies für die Zukunft
• 79% stimmten (völlig oder eher) der Aussage zu "Ohne Individuelle Gesundheitsleistungen ist meine Praxis auf Dauer nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben."
Die 28seitige Studie mit vielen Diagrammen ist auch als PDF-Datei verfügbar.
PDF-Datei zur Studie Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit
Gerd Marstedt, 2.8.2005