



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Gesundheitssystem"
Andere Themen |
Alle Artikel aus:
Gesundheitssystem
Andere Themen
Global Health - Mehr als Medizin und Technologie
 Global Health - Globale Gesundheit - steht heute weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Vor allem die deutsche Bundesregierung und insbesondere das Kanzleramt haben dem Thema Global Health in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet und dazu beigetragen, dass es auf vielen internationalen Konferenzen einen prominenten Raum einnimmt. Das ist eine unmittelbare Folge der weitgehenden Globalisierung aller Lebensbereiche, also der zunehmenden internationalen Verflechtung vor allem der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten. Sie bringt für einen wachsenden Teil der Weltbevölkerung erhebliche Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich, führt zu wachsenden Belastungen von Umwelt und Klima, schürt bewaffnete Konflikte um natürliche Ressourcen wie Wasser und Bodenschätze, befördert den Tourismus für die einen und den Migrationsdruck für die anderen und vertieft die sozioökonomischen Gräben in und zwischen Ländern.
Global Health - Globale Gesundheit - steht heute weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Vor allem die deutsche Bundesregierung und insbesondere das Kanzleramt haben dem Thema Global Health in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet und dazu beigetragen, dass es auf vielen internationalen Konferenzen einen prominenten Raum einnimmt. Das ist eine unmittelbare Folge der weitgehenden Globalisierung aller Lebensbereiche, also der zunehmenden internationalen Verflechtung vor allem der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten. Sie bringt für einen wachsenden Teil der Weltbevölkerung erhebliche Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich, führt zu wachsenden Belastungen von Umwelt und Klima, schürt bewaffnete Konflikte um natürliche Ressourcen wie Wasser und Bodenschätze, befördert den Tourismus für die einen und den Migrationsdruck für die anderen und vertieft die sozioökonomischen Gräben in und zwischen Ländern.
Mit der Bedeutung nimmt auch die Wahrnehmung der weilweiten Verbindungen und der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gesundheit der Menschen zu. Das vergleichsweise neue Konzept Globale Gesundheit bezieht sich auf die Gesundheit von Menschen jenseits von Ländergrenzen, verfolgt eine explizit transnationale und universelle Perspektive und unterscheidet sich von "Internationaler Gesundheit" insbesondere durch die Berücksichtigung der globalen gesundheitsbezogenen Herausforderungen
Global Health ist ein komplexer Sammelbegriff, der zwar erheblich an Bedeutung gewonnen hat, aber bis heute keine eindeutige Verwendung erfährt. Bereits 2006 definierte eine us-amerikanisch-peruanische Forschergruppe um Theodore Brown globale Gesundheit in ihrem Artikel The World Health Organization and the transition from "international" to "global" public health" als Global health is the health of populations in the global context. Die britischen Wissenschaftler David Stuckler und Martin McKee beschrieben 2008 in Five metaphors about global health policy das breite Spektrum von globaler Gesundheit, das von Gesundheit als Instrument der inneren Sicherheit und der Außenpolitik über karitative, philantropische Ansätze und öffentlich-private Partnerschaften bis hin zum allgemeinen Menschenrecht und solidarischem Handeln reicht. Eine internationale Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern um Jeffrey Koplan leitete in ihrem Artikel Towards a common definition of global health einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf globale Gesundheit ein. Im Anschluss an den aussagekräftigen einleitenden Satz Global health is fashionable forderte die Autoren eine wegweisende Definition von Global Health, die alle gesundheitlichen Herausforderungen und länderübergreifenden Determinanten von der weltweiten Ausrottung von Krankheiten (z. B. Kinderlähmung) über Antibiotikaresistenzen, Ernährungssicherheit, Urbanisierung und Migration bis zum Klimawandel umfassen müsse. Für den deutschsprachigen Raum bietet die Bundeszentrale für politische Bildung eine vergleichbare Begriffserklärung in dem Beitrag Globale Gesundheit / Global Health von Silke Gräser.
Das gängige, im politischen Raum vorherrschende Verständnis von Global Health wird allerdings allzu häufig der gebotenen Komplexität nicht gerecht und weist konzeptionelle Beschränkungen auf. Der herrschende Global-Health-Diskurs erfüllt vielfach weder den implizit mit dem Begriff "global" verknüpften Anspruch auf Universalismus noch die Erfordernisse einer umfassenden transdisziplinären und ressortübergreifenden Gesundheitspolitik. Darauf machen zwei Beiträge in Publikationen des AOK-Bundesverbands aufmerksam. In der Januar-Ausgabe 2019 des Monatsmagazins Gesundheit und Gesellschaft (G+G) zeigt Jens Holst, der an der Hochschule Fulda die neu eingerichtete Professur für Medizin mit Schwerpunkt Global Health innehat, an Hand der besorgniserregenden Antibiotika-Resistenzentwicklung die Bedeutung von globaler Gesundheit bzw. globaler gesundheitsbezogener Zusammenhänge auf. Eine erfolgversprechende Strategie zur Eindämmung der zunehmenden Multiresistenzen von Krankheitserregern darf sich nicht auf die Human- und Tiermedizin beschränken, sondern muss auch grundlegende Fragen der landwirtschaftlichen Produktion, der Arbeitsbedingungen und der Handelspolitik einbeziehen, sich mit der Steuerung transnationaler Konzerne und einem politischen Ausgleich globaler Machtasymmetrien Machtasymmetrien befassen und grundlegende Governancefragen beantworten. Gerade auf die unverzichtbare Bedingung einer konsequenten Politik der Gesundheit-in-allen-Politikbereichen zur Lösung der drängenden Resistenz-Problematik verweist der Beitrag, der auch ein Glossar mit Begriffsbestimmungen relevanter Termini wie primärer, globaler, internationaler und öffentlicher Gesundheit und von "one health" bzw. "health in all" umfasst. Der Artikel Resistenzen ohne Grenzen ist direkt online zu lesen und auch als PDF herunterzuladen.
Eine explizite Begriffsbestimmung von Global Health enthält der zweite Betrag von Jens Holst, der in der April-Ausgabe 2019 der G+G Wissenschaft, der Wissenschaftsbeilage von Gesundheit und Gesellschaft, erschien. Er beschreibt und analysiert die Entstehung und historische Entwicklung des Begriffs Global Health und setzt sich kritisch mit unterschiedlichen Auslegungen, Strömungen und insbesondere mit der selektiven, verengten Sicht auf globale Gesundheit auseinander und nimmt Bezug auf die Forderung nach der Dekolonalisieung von Global Health. Gerade die in Medizin, Politik und Wirtschaft vielfach anzutreffende Verkürzung globaler Gesundheitsfragen auf biomedizinische und technologische Lösungsansätze und der Fokus auf einkommensschwächere Länder im Sinne von international health wird dem Thema Globale Gesundheit nicht hinreichend gerecht. Vielmehr ist Global Health die konsequente Weiterentwicklung von Public Health als inter- bzw. transdisziplinäre Wissenschaft mit systemischer Sichtweise auf die globalen gesundheitlichen Herausforderungen. Auch der Artikel Global Health - Hope oder Hype? steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 10.8.19
Verantwortungsvolle Gesundheitsfinanzierung: Verfahren und Gestaltung gleichermaßen wichtig
 Die Forderung nach good governance bestimmt seit vielen Jahren die entwicklungspolitische Landschaft: Gute Regierungspolitik, besser die verantwortungsvolle Führung der Staatsgeschäfte, bezieht sich auf alle Lenkungsaktivitäten der öffentlichen Hand und setzt einen leistungsfähigen und zuverlässigen Staat voraus. Vielerorts verhindern aber fehlende Rechtsstaatlichkeit, Verletzung der Menschenrechte und weit verbreitete Korruption jegliches Vertrauen in den Staat und die wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung der Länder. Fehlende politische Verantwortlichkeit konterkariert auch die globalen Bemühungen um universellen Zugang zu Gesundheit und sozialer Sicherung. Verantwortungsvolle Organisation und Abwicklung der Gesundheitsfinanzierung schließt auch die Durchsetzung rechtsbasierter Versorgungsansprüche ein und ist unerlässlich für die Stärkung der Gesundheitssysteme und die Ausweitung der sozialen Absicherung im Krankheitsfall.
Die Forderung nach good governance bestimmt seit vielen Jahren die entwicklungspolitische Landschaft: Gute Regierungspolitik, besser die verantwortungsvolle Führung der Staatsgeschäfte, bezieht sich auf alle Lenkungsaktivitäten der öffentlichen Hand und setzt einen leistungsfähigen und zuverlässigen Staat voraus. Vielerorts verhindern aber fehlende Rechtsstaatlichkeit, Verletzung der Menschenrechte und weit verbreitete Korruption jegliches Vertrauen in den Staat und die wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung der Länder. Fehlende politische Verantwortlichkeit konterkariert auch die globalen Bemühungen um universellen Zugang zu Gesundheit und sozialer Sicherung. Verantwortungsvolle Organisation und Abwicklung der Gesundheitsfinanzierung schließt auch die Durchsetzung rechtsbasierter Versorgungsansprüche ein und ist unerlässlich für die Stärkung der Gesundheitssysteme und die Ausweitung der sozialen Absicherung im Krankheitsfall.
Dass sich good financial governance in der Gesundheitsfinanzierung nicht auf das Funktionieren des Finanzierungssystems beschränken darf, sondern in entscheidendem Maße auch von den Finanzquellen, der Lastenverteilung bzw. dem Umverteilungspotenzial abhängt, zeigt ein soeben erschienenes Arbeitspapier des Fachbereichs Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda. Unter dem Titel Good Governance and Redistribution in Health Financing: Pro-poor effects and general challenges analysiert der Autor Jens Holst zunächst ausführlich die Verteilungswirkungen der verschiedenen Gesundheitsfinanzierungsformen im Hinblick auf wesentliche Kriterien wie Universalität, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Das Arbeitspapier aus der Fuldaer Serie pg papers zeigt verschiedene Zusammenhänge auf:
Im Gesundheitswesen umfasst Governance alle regulierenden und steuernden Maßnahmen von Regierungen oder anderen öffentlichen Entscheidungsträgern und schließt den transparenten, korrekten Umgang des Staats mit seinen Einnahmen sowie die nachvollziehbare Verwendung der Mittel zum Wohle der Bevölkerung ein. Daher verfolgt zum Beispiel die deutsche Entwicklungspolitik auch die Förderung von Good Financial Governance, also den Aufbau eines funktionierenden Systems öffentlicher Finanzen. Verantwortungsvoller Umgang mit Finanzmitteln ist nicht zuletzt auch bei der Gesundheitsfinanzierung unerlässlich. Neben Ansätzen, Strategien und Programmen zur Einrichtung, Verwaltung und Kontrolle von Finanzströmen nach gesetzlichen Vorgaben oder ergebnisorientierten Indikatoren muss Governance in der Gesundheitsfinanzierung unweigerlich die Frage einschließen, inwieweit die Ressourcengenerierung, -mischung und -allokation in sozial gerechter, fairer und nachhaltiger Weise organisiert sind.
Individuelle und kollektive finanzielle Nachhaltigkeit, Lastenaufteilung und soziale Kohärenz oder Solidarität sind wesentliche Bestandteile von Governance in der Gesundheitsfinanzierung und hängen stark von gesellschaftlichen Prioritäten und Werten ab. Soziale Gerechtigkeit bei der Finanzierung, transparente Risikomischung und Rechenschaftspflicht beim Einkauf von Gesundheitsleistungen sind intrinsische Elemente von Governance in der Gesundheitsfinanzierung und entscheidend für die Erreichung des Ziels einer universellen Absicherung im Krankheitsfall. Dabei liegt die Verantwortung für ein transparentes, rechenschaftspflichtiges und verlässliches Gesundheitsfinanzierungssystem bei den Regierungen, die Transparenz und gute finanzielle Steuerung gewährleisten müssen.
Im Hinblick auf nachhaltige, sozial gerechte und somit verantwortungsvolle Gesundheitsfinanzierung zeigt das Papier einige grundlegende Lehren auf:
• Universelle Absicherung im Krankheitsfall ist allein durch öffentliche Gesundheitsfinanzierung, also über Steuern oder Sozialversicherungen für (nahezu) die gesamte Bevölkerung eines Landes möglich;
• Steuerfinanzierung bietet zwar erhebliche Vorteile gegenüber sozialen Krankenversicherungssystemen im Hinblick auf die universelle Bevölkerungsabsicherung, ihre Verteilungswirkungen und die Fairness der Steuerfinanzierung hängen aber vom jeweiligen Steuersystem ab, nämlich der Effektivität der Steuererhebung, der Ausgestaltung des Besteuerungssystems und nicht zuletzt der Verteilung der Einnahmen aus direkten und indirekten Steuern;
• Soziale Krankenversicherungssysteme können relevante Umverteilungseffekte entfalten, aber nur, wenn sie die gesamte Bevölkerung einschließen und kein Ausscheren in private Alternativsysteme erlauben;
• Globale öffentlich-private Partnerschaften und vertikale Gesundheitsprogramme haben bisher keinen erkennbaren Beitrag zur Gesundheitssystemstärkung und -finanzierung geleistet;
• Innovative Geldquellen wie Finanztransaktionssteuern sind für die Aufstockung der Mittel zum Aufbau wirksamer Krankenversorgungssysteme unerlässlich.
Good financial governance im Gesundheitswesen hängt immer von der Fähigkeit des Systems ab, Ressourcen für den Aufbau und die finanzielle Ausstattung sozialer Sicherungs- und Umverteilungssysteme zu mobilisieren und bereitzustellen und dabei die finanzielle Belastung durch medizinische Versorgungsleistungen sozial gerecht zu verteilen. Insgesamt erweist sich die Finanzierung über öffentliche Mittel, also durch Steuermittel und/oder Sozialversicherungsbeiträge, als nachhaltiger und sozial gerechter als über private Quellen, nämlich private Krankenversicherungen oder Selbstzahlung. Allerdings hängen die gesamtgesellschaftlichen Verteilungswirkungen unmittelbar von der Gestaltung des Steuersystems und Effektivität der Steuererhebung bzw. von der bevölkerungsbezogenen Breite und der Organisation bestehender sozialer Krankenversicherungen ab.
Das Arbeitspapier zum Thema Gesundheitsfinanzierung good governance steht kostenlos zum Download zur Verfügung: pg paper 2/2017.
Bernard Braun, 25.5.17
Universelle Absicherung im Krankheitsfall - eine weltweite Herausforderung
 Eine wirksame und tatsächlich hilfreiche Absicherung gegen die finanziellen und ökonomischen Risiken von Krankheit gehört keineswegs zu den Selbstverständlichkeiten auf der globalisierten Welt. Neben vielen anderen Entbehrungen und Notlagen wie Armut, fehlenden Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten und mangelnden Chancen auf ein besseres Leben treiben auch inexistente oder unterentwickelte soziale Sicherungssysteme immer mehr Menschen in die Flucht, die wohlstandsgewöhnte EuropäerInnen allzu leichtfertig als "Wirtschaftsflüchtlinge" abqualifizieren, so als wäre unausweichliches Elend nicht Grund genug, zu neuen Ufern aufzubrechen. Angesichts der privilegierten Reisemöglichkeiten gerade von MitteleuropäerInnen und des massenhaften Vertriebs von Produkten aus den Weltmarktfabriken in den armen Ländern des Südens besteht ein in der globalisierten Informationsgesellschaft ein oftmals erstaunliches Unwissen über die realen Lebensbedingungen in der Welt. Den Teilaspekt der sozialen Absicherung im Krankheitsfall beleuchtete Ende 2014 und Anfang 2015 eine dreiteilige Serie in der AOK-Zeitschrift Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands. Der kompart-Verlag hat nun die Beiträge der beiden Entwicklungs- und Gesundheitsexperten Jens Holst und Jean-Olivier Schmidt in aktualisierter Fassung in einem Sonderdruck erneut aufgelegt.
Eine wirksame und tatsächlich hilfreiche Absicherung gegen die finanziellen und ökonomischen Risiken von Krankheit gehört keineswegs zu den Selbstverständlichkeiten auf der globalisierten Welt. Neben vielen anderen Entbehrungen und Notlagen wie Armut, fehlenden Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten und mangelnden Chancen auf ein besseres Leben treiben auch inexistente oder unterentwickelte soziale Sicherungssysteme immer mehr Menschen in die Flucht, die wohlstandsgewöhnte EuropäerInnen allzu leichtfertig als "Wirtschaftsflüchtlinge" abqualifizieren, so als wäre unausweichliches Elend nicht Grund genug, zu neuen Ufern aufzubrechen. Angesichts der privilegierten Reisemöglichkeiten gerade von MitteleuropäerInnen und des massenhaften Vertriebs von Produkten aus den Weltmarktfabriken in den armen Ländern des Südens besteht ein in der globalisierten Informationsgesellschaft ein oftmals erstaunliches Unwissen über die realen Lebensbedingungen in der Welt. Den Teilaspekt der sozialen Absicherung im Krankheitsfall beleuchtete Ende 2014 und Anfang 2015 eine dreiteilige Serie in der AOK-Zeitschrift Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands. Der kompart-Verlag hat nun die Beiträge der beiden Entwicklungs- und Gesundheitsexperten Jens Holst und Jean-Olivier Schmidt in aktualisierter Fassung in einem Sonderdruck erneut aufgelegt.
Spätestens seit Erscheinen des Weltgesundheitsberichts 2010: Health systems financing: the path to universal coverage steht zumindest in der entwicklungsbezogenen gesundheitspolitischen Szene das Thema der universellen Absicherung im Krankheitsfall weit oben auf der Agenda. Auch das Forum Gesundheitspolitik hat diese Thematik mehrfach aufgegriffen, so in den Beiträgen zum Weltgesundheitsbericht 2010 und zum Weltgesundheitsbericht 2013, der Kritik WHO-Einsatz für universelle Sicherung abgeschwächt sowie in dem Artikel Globale Soziale Sicherung: So utopisch wie unverzichtbar.
Nun haben der Leiter des Kompetenzcenters Gesundheit und Soziale Sicherung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Jean-Olivier Schmidt, und der gesundheits- und entwicklungspolitische Berater sowie Vertretungsprofessor an der Hochschule Fulda, Jens Holst, eine schlaglichtartige Übersicht über weltweite Bestrebungen nach Auf- und Ausbau sozialer Sicherungssysteme vorgelegt. Die journalistisch geschriebene, kenntnisreiche Abhandlung beschreibt aktuelle Entwicklungen in ausgewählten Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Mehrere Interviews mit Gesundheits- und EntwicklungspolitikerInnen ergänzen die Berichte. Die Länderbeispiele stehen stellvertretend und exemplarisch für die gängigen sozial- bzw. gesundheitspolitischen Ansätze in Entwicklungs- und Schwellenländern. Riesenländer wie Indien und China, aber auch viele andere Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika wollen mit dem Ausbau der Sozialsysteme die Gesundheit ihrer Bevölkerung verbessern und zugleich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben.
Das erste Kapitel mit dem Titel Medizin gegen Armut widmet sich den gesundheits- und sozialpolitischen Ansätzen in verschiedenen asiatischen Ländern und beleuchtet dabei nicht nur die höchst unterschiedlichen Ansätze der beiden Riesenländer China und Indien, sondern auch verschiedene Strategien mittelgroßer Länder wie Philippinen und Vietnam. Dabei wird klar, dass soziale Absicherung im Krankheitsfall grundlegende Bedeutung für die Überwindung der geringen Lebenserwartung und letztlich auch der Armut ist und die Länder diese Ziele mit unterschiedlicher Konsequenz verfolgen. Das Fazit der Autoren spricht für sich: "Solidarische Finanzierung ist unverzichtbar. So verschieden die Länder in Asien sind, so zeigen die Erfahrungen der vergangenen fünfzehn Jahre doch in eindrucksvoller Weise, wie sie den wirtschaftlichen Aufschwung nutzen, um wachsenden Ungleichheiten mit sozialpolitischen Maßnahmen zu begegnen. Mit Gesundheit können sich Politiker im Wahlkampf gut profilieren. Bei allen Unterschieden in Kultur und Gesellschaft scheint Einigkeit darin zu bestehen, dass solidarische Finanzierung und Risikoverteilung für Gesundheitssysteme unverzichtbar sind. Die größten Herausforderungen bilden im Moment die Einbeziehung des riesigen informellen Sektors und die Regulierung privater Anbieter. Gerade beim letzten Punkt könnten die Länder auch von deutschen Erfahrungen profitieren."
Das zweite Kapitel des Dreiteilers widmet sich dem afrikanischen Kontinent, beschränkt sich aber de facto auf das Afrika südliche der Sahara. Obwohl vor allem Tunesien, aber auch Marokko und andere nordafrikanische Länder sozialpolitische Erfolge vorzuweisen haben, richten die beiden Autoren das Augenmerk auf die Länder Südafrika, Ruanda, Ghana und Kenia. Das reichste Land im südlichen Afrika ist auch im Gesundheitswesen bis heute durch schroffe soziale Unterschiede gekennzeichnet, die allen Bemühungen um universelle Sicherungssysteme erhebliche Hürden in den Weg stellen. Ghana und Ruanda haben beide die Einführung von Kleinstversicherungen zum Ausgangspunkt für umfangreichere soziale Sicherungsstrukturen gemacht, wobei das ruandische System deutliche autoritärer funktioniert als das ghanaische, dafür aber mittlerweile einen größeren Bevölkerungsanteil einbezieht. In Kenia hingegen, dem Land mit der ältesten sozialen Krankenversicherung im südlichen Afrika, mahlen die Mühlen langsam, möglicherweise zu langsam, um mit der wirtschaftlichen Dynamik Schritt zu halten.
Entgegen aller gängigen eurozentristischen Skepsis beschließen die Autoren den Afrika-Teil mit einem eher zuversichtlichen Fazit: "Der enormen Krankheitslast zum Trotz, die auf dem afrikanischen Kontinent liegt, lässt die jüngere Entwicklung afrikanischer Gesundheitssysteme Hoffnung aufkeimen. Auch wenn manche Länder wie Kenia oder auch Tansania eher im Status quo verharren, sind andernorts deutliche Fortschritte erkennbar. Immer mehr Staaten südlich der Sahara leiten grundlegende Reformen ihrer Systeme ein und steigern ihre Gesundheitsausgaben. ... Entscheidend sind politischer Wille und gute Regierungsführung. Die Lage verbessert sich nur, wenn die Menschen Zugang zu und Anspruch auf gute Versorgung haben. Immer mehr Regierungen in Afrika nehmen diese Aufgabe ernst und investieren in die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung."
Innerhalb des Trikont spielt Lateinamerika zweifelsohne eine besondere Rolle, wenngleich die asiatischen Tiger inzwischen erheblich aufgeholt haben. Aber die Ländern in Mittel- und Südamerika hatten anderthalb Jahrhunderte mehr Zeit, sich als selbständige Nationen von den Folgen der Kolonialherrschaft zu befreien als die in Afrika oder Südostasien. Viele Nationen der einstigen spanischen und portugiesischen Weltreiche blicken mittlerweile auf eine lange Geschichte sozialer Sicherung zurück, allen voran Chile, das erste lateinamerikanische Land mit einem umfassenden sozialen Sicherungssystem, das später als Pionier neoliberaler Reformen von sich reden machte. Mexiko war stark vom deutschen System beeinflusst und steht heute für ein Land, das universelle Sicherung über parallele Versicherungssysteme anstrebt. Kolumbien folgte zunächst Chile, wendet sich nun aber wieder von marktorientierten Ansätzen in der Sozialpolitik ab. Und Brasilien wählte inmitten der Blütezeit des Neoliberalismus den Weg der staatlichen Absicherung und des verfassungsmäßigen Rechts auf Gesundheit. Die sozialpolitische Landschaft in Lateinamerika veranlasste die Autoren zu einer interessanten Schlussfolgerung: "Zweifelsohne können lateinamerikanische Sozialsysteme bis heute einiges von der langen Erfahrung europäischer Institutionen lernen. Mittlerweile haben die einstigen europäischen Kolonien aber selber bemerkenswerte gesundheitspolitische Erfahrungen und Erfolge vorzuweisen. Die Zunahme unsteter und prekärer Arbeitsverhältnisse in Europa erfordert auch hierzulande neue sozialpolitische Strategien. Lateinamerika hat auf diesem Gebiet viel zu bieten - internationale Zusammenarbeit muss keine Einbahnstraße sein."
Der lesenswerte Dreiteiler von Jens Holst und Jean-Olivier Schmidt steht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache kostenfrei zum Download zur Verfügung:
Deutsche Fassung: Was macht die Welt gesund-Gesundheit global
English version: What makes the world healthy - global health.
Bernard Braun, 24.3.16
Gesundheit durch Impfen - Der unbeirrbare Glaube an biomedizinische Lösungen
 Effizienzdruck und Marktmechanismen bestimmen in zunehmendem Maße auch die entwicklungspolitische Agenda. Selbstverständlich ist es gerechtfertigt, die Ressourcen möglichst wirksam und zielgenau dahin zu lenken, wo sie am besten zur Entwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. In Anbetracht der Komplexität der Gegebenheiten und Herausforderungen ist das allerdings leichter gesagt als getan. Nicht alles, was gut gemeint ist, entwickelt auch die gewünschte Wirkung. Hinzu kommt das relativ neue Phänomen des Wohltätigkeitskapitalismus von Unternehmen bzw. UnternehmerInnen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre unermesslichen Renditen investieren sollen und sich massiv in der Entwicklungsagenda mitmischen. Ein anschauliches Beispiel für die neuen Herrschaftsverhältnisse und die wachsende Einmischung privater GeberInnen in die Entwicklungspolitik ist die 1999 entstandene Globale Allianz für Impfungen und Immunisierungen GAVI. In der Oktoberausgabe 2015 (Seiten 32-36) widmete das Magazin Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands der internationalen Impfallianz eine ausführliche Betrachtung.
Effizienzdruck und Marktmechanismen bestimmen in zunehmendem Maße auch die entwicklungspolitische Agenda. Selbstverständlich ist es gerechtfertigt, die Ressourcen möglichst wirksam und zielgenau dahin zu lenken, wo sie am besten zur Entwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. In Anbetracht der Komplexität der Gegebenheiten und Herausforderungen ist das allerdings leichter gesagt als getan. Nicht alles, was gut gemeint ist, entwickelt auch die gewünschte Wirkung. Hinzu kommt das relativ neue Phänomen des Wohltätigkeitskapitalismus von Unternehmen bzw. UnternehmerInnen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre unermesslichen Renditen investieren sollen und sich massiv in der Entwicklungsagenda mitmischen. Ein anschauliches Beispiel für die neuen Herrschaftsverhältnisse und die wachsende Einmischung privater GeberInnen in die Entwicklungspolitik ist die 1999 entstandene Globale Allianz für Impfungen und Immunisierungen GAVI. In der Oktoberausgabe 2015 (Seiten 32-36) widmete das Magazin Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands der internationalen Impfallianz eine ausführliche Betrachtung.
Mit Impfungen lassen sich viele Leben retten, sie schützen nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Allgemeinheit, und können dazu beitragen, die Ausbreitung von Krankheitserregern einzudämmen und Seuchen auszurotten. 1999 entstand GAVI als öffentlich-private Partnerschaft, um die weltweiten Anstrengungen zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten zu bündeln. Heute ist die Impfallianz der wichtigste Financier von Impfstoffen in armen Ländern. Für den Schutz vor Infektionskrankheiten zeichnet eigentlich die Weltgesundheitsorganisation verantwortlich, da aber ihre Finanzkraft sinkt, springen private Geldgeber in die Bresche.
Impfungen eignen sich besonders gut für das Konzept des zunehmenden Wohltätigkeitskapitalismus, der sich streng an unternehmerischen Grundsätzen orientiert. Entwicklungsprogramme und -projekte müssen definierte Zielvorgaben sowie klare Kosten-Nutzen-Analysen erfüllen und messbare Resultate liefern. Doch zugleich entsteht ein Sammelsurium von Einzelprojekten nach Gutdünken der Sponsoren, das sich jeder demokratischen Legitimierung entzieht und Governance-Bestrebungen sowohl in der nationalen als auch globalen Gesundheitspolitik zuwiderläuft. Das erklärte Ziel von GAVI, die Impfstoffpreise für arme Länder erschwinglich zu halten, führt nur zu relativen Preissenkungen: die Kosten für einige neuere Substanzen überfordern viele Länder und garantieren den Herstellern in jedem Fall hinreichende Gewinne.
Vor allem fließen durch vertikale Programme wie GAVI erhebliche finanzielle Mittel in die Entwicklungsländer, die nationale Prioritäten und politische Vorgaben beeinflussen können. Die enge Ausrichtung auf die Vermeidung von Infektionskrankheiten drängt andere Gesundheitsprobleme in den Hintergrund und schwächt die Bemühungen der Länder um die allseits geforderte Stärkung ihrer Gesundheitssysteme. Und sie setzt ausschließlich auf biomedizinische Ansätze zur Lösung grundlegender Gesundheitsprobleme. Dabei hängt die Gesundheit weit stärker von anderen Einflussfaktoren als von Mikroben und dem medizinischen Versorgungssystem ab. Das Fazit des Artikels über GAVI ist deutlich: "Am wirksamsten wären "Impfungen" gegen Armut, Unterernährung, geringe Bildung und gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen. Ein solches Wundermittel wird aber nicht aus medizinischen oder mikrobiologischen Labors kommen. Dafür bedarf es einer Änderung der herrschenden Verhältnisse und einer Teilhabe aller Menschen am weltweit wachsenden Wohlstand.
Solche Aspekte kommen auch in der soeben erschienenen Februar-2016-Ausgabe von Health Affairs nicht zur Sprache. Vielmehr belegen verschiedene Artikel in der Medizinerzeitschrift die Erfolge von Impfprogrammen und deren bisher sogar unterschätzte Kosteneffektivität. Das ware nicht die erste von klaren Interessen geleitete oder gar gesponsorte Ausgabe von Health Affairs.
Der Artikel Große Spender für den kleinen Pieks steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 29.2.16
Zur Empirie von Gesundheitssystem-Mythen am Beispiel Medicare und Medicaid
 Vorurteile oder Mythen über die Leistungen fremder ausländischer Krankenversicherungs- und Gesundheitsversorgungssysteme bestimmen zahlreiche gesundheitspolitische Diskurse. Während konservative Politiker in den USA das deutsche Gesundheitswesen für den Hort von "socialized medicine" halten, wird das britische Gesundheitswesen bzw. der "National Health Service" in Deutschland häufig mit dem Stichwort "englische Verhältnisse" klassifiziert und ihm jede Menge unerwünschter Outcomes zugesprochen.
Vorurteile oder Mythen über die Leistungen fremder ausländischer Krankenversicherungs- und Gesundheitsversorgungssysteme bestimmen zahlreiche gesundheitspolitische Diskurse. Während konservative Politiker in den USA das deutsche Gesundheitswesen für den Hort von "socialized medicine" halten, wird das britische Gesundheitswesen bzw. der "National Health Service" in Deutschland häufig mit dem Stichwort "englische Verhältnisse" klassifiziert und ihm jede Menge unerwünschter Outcomes zugesprochen.
Sowohl im Ausland als auch in den USA selber werden die beiden staatlichen und steuerfinanzierten Krankenversicherungssysteme Medicaid und Medicare im Vergleich mit den privaten Krankenversicherungen oft als dysfunktional und qualitativ schlecht hingestellt - Notbehelfe für RentnerInnen und Arme eben.
Dass diese Bewertungen einer empirischen Überprüfung nicht standhalten und hinter der Kritik nicht die Sorge um die Gesundheit der beiden Versichertengruppen steht, sondern die argumentative Aufbereitung für die Expansionsgelüste der privaten Versicherungen, zeigen jetzt zwei Studien.
Das Ziel der Studien waren empirisch gestützte Antworten auf zwei Kritikpunkte bzw. Urteile:
• Illegale bzw. EinwanderInnen ohne aktuell gültige US-Ausweispapiere ("undocumented immigrants" ) nach Schätzungen des "Department of Homeland Security (DHS)" waren dies 2011 rund 11,5 Millionen Personen), die sich über Medicare für den Fall einer stationären Behandlung krankenversichern können (Medicare Hospital Insurance Trust Fund), würden diesen Schutz missbräuchlich ausnutzen, also mehr versuchen "herauszuholen" als sie einbezahlt haben.
• Wer über Medicaid krankenversichert ist, erhielte eine schlechte Versorgungsqualität.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Harvard Medical School beschäftigte sich mit der ersten Behauptung und stellte fest, dass die Wirklichkeit zwischen den Jahren 2000 und 2011 diametral anders aussah: Insgesamt zahlte diese Versichertengruppe jährlich zwischen 2.2 und 3.8 US-Dollar Milliarden mehr als ihre Versorgung kostete. Der "Überschuss" betrug pro Kopf und Jahr 316 US-Dollar ein Betrag, der in der restlichen US-Bevölkerung "nur" 106 US-Dollar groß war.
Ob die zweite Behauptung zutreffend ist, wurde in einem Report des "Commonwealth Fund" mit Daten des bevölkerungsrepräsentativen "Commonwealth Fund Biennial Health Insurance Survey" aus dem Jahr 2014 untersucht.
Die vier wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• 95% der 19- bis 64-jährigen ganzjährig versicherten Medicaid-Patienten wurden durchweg versorgt, 53% erhielten im Bedarfsfall am selben Tag oder spätestens am Folgetag einen Arzt- oder Pflegetermin und 55% sagten, die Qualität ihrer Behandlung sei exzellent oder sehr gut gewesen.
• Bei sämtlichen dieser Versorgungsindikatoren gab es kaum Unterschiede zu den privat Krankenversicherten. Die Anteile betrugen 94%, 58% und 58%.
• Nur gegenüber den nicht Krankenversicherten gab es gravierende und auch statistisch signifikante Unterschiede. Von denen hatten 77% eine durchgehende Versorgungen, sagten 40%, ihre Versorgung wäre exzellent oder sehr gut und erhielten 43% rasch einen Behandlungstermin.
• Wenn es um Probleme beim Zahlen von Arztrechnungen etc. ging, hatten schließlich die Medicaid-Versicherten sogar sowohl deutlich weniger Probleme als die privat und nicht Krankenversicherten: Die Anteile der jeweiligen Personen betrugen 10%, 21% und 35%.
Auch bei einer Reihe weiterer Indikatoren für die Behandlungsqualität ergab sich kein grundlegend anderes Bild.
Zum Hintergrund der Mythen ist wichtig zu wissen, dass sie bei der Weigerung von bis zu 20 Bundesstaaten eine Rolle spielen, Medicare und Medicaid im Verbund mit dem Affordable Care Act/Obamacare auszubauen.
Die Studie Unauthorized Immigrants Prolong the Life of Medicare's Trust Fund von Leah Zallman et al. erschien am 18. Juni 20915 in der Zeitschrift "Journal of General Internal Medicine". Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Die Studie Does Medicaid make a difference? Findings from The Commonwealth Fund Biennial Health Insurance Survey 2014 von Blumenthal D, et al. erschien als Publikation des Commonwealth Fund im Juni 2015 und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.7.15
Was bringt Wettbewerb für die Qualität der Gesundheitsversorgung? Gemischte Ergebnisse einer britischen Übersichtsarbeit
 Den einen ist er noch zu schwach entwickelt oder nicht weitreichend genug, für andere ist er die Hauptursache vieler aufwändigen aber letztlich für die Versicherten oder Patienten nutzlosen Marketinganstrengungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): der Wettbewerb. Der seit Jahrzehnten anhaltenden Rhetorik pro oder contra Wettbewerb stehen relativ wenige solide Versuche gegenüber, die Empirie erwünschter oder unerwünschter versichertenbezogenen Wirkungen des Wettbewerbs im Gesundheitsbereich zu untersuchen.
Den einen ist er noch zu schwach entwickelt oder nicht weitreichend genug, für andere ist er die Hauptursache vieler aufwändigen aber letztlich für die Versicherten oder Patienten nutzlosen Marketinganstrengungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): der Wettbewerb. Der seit Jahrzehnten anhaltenden Rhetorik pro oder contra Wettbewerb stehen relativ wenige solide Versuche gegenüber, die Empirie erwünschter oder unerwünschter versichertenbezogenen Wirkungen des Wettbewerbs im Gesundheitsbereich zu untersuchen.
Was dabei auch aktuell herauskommen könnte, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse einer etwas älteren Übersichtsarbeit. Britische ForscherInnen sichteten dafür zunächst einen großen Teil der weltweit dazu durchgeführten Studien und schlossen in ihre Studie insgesamt 53 Studien ein: rund 50% aus den USA, ein Drittel aus Großbritannien und der Rest in zahlreichen weiteren, nicht-angelsächsischen Ländern und Gesundheitssystemen.
Danach unterschieden sie sechs qualitativ verschiedene Bereiche oder Aspekte auf die der Wettbewerb in den Ankündigungen seiner Protagonisten und den Befürchtungen seiner Kritiker erwünschte oder unerwünschte Auswirkung hätte haben können: klinische Ergebnisse, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Kosten und Wirtschaftrlichkeit, Zufriedenheit, Praxis/Professionalität der Berufstätigen im Gesundheitswesen und Systemstruktur.
Auf der Basis der nationalen, d.h. britischen und der internationalen Literatur ergab sich Folgendes:
• Datenanalysen in Großbritannien weisen auf potenzielle Verbesserungen bei der Sterblichkeit hin, eine Menge methodisch unterschiedlichster internationalen Studien weisen dagegen auf reduzierte klinische Ergebnisse hin
• Wettbewerb führt in einigen britischen Studien zu einem verbesserten Zugang während andere britische Studien eher eine Verschlechterung des Zugangs durch Wettbewerb nachweisen. Letzteres ist in allen internationalen Studien der Fall.
• In Großbritannien hat Wettbewerb gemischte Wirkungen auf die Kosten der Gesundheitsversorgung. In anderen Ländern gibt es Evidenz dafür, dass Wettbewerb die Kosten für Patienten und Ärzte senkt.
• Zur Zufriedenheit gibt es in Großbritannien kaum Forschungen. Obwohl in den USA und anderen Ländern ebenfalls wenig darüber geforscht wurde, zeigt dort ein einziger Review eine Verbesserung der Zufriedenheit unter Wettbewerbsbedingungen.
• In Großbritannien sieht die Evidenz über die Wirkung von Wettbewerb auf das professionelle Handeln und die Professionals gemischt aus, wobei die Mehrheit der Studien Hinweise für negative Auswirkungen auf die Sichtweise und das Verhalten der Beschäftigten zeigt und lediglich bei der Managementqualität Verbesserungen finden. In internationalen Studien dominieren in diesem Bereich unerwünschte Effekte des Wettbewerbs.
• Zu den Auswirkungen von Wettbewerb auf die Strukturen des Gesundheitssystems gibt es in Großbritannien erneut nur wenig verfügbare Forschung. Internationale Studien weisen auf einen Zusammenhang von Wettbewerb und struktureller Fragmentierung sowie verstärkter Fusionsprozesse hin.
Die Ergebnisse ihres Reviews fassen die AutorInnen so zusammen: "Empirical research studies are far less common and seem to suggest that there are both advantages and limitations with using competition as a driver to improve quality in healthcare. On one hand, clinical outcomes and costs may improve, whereas on the other fragmentation, professionalism, access and equity may be negatively affected. Competition may be one component of broader initiatives to support change, but is not a simple or sole choice."
Zu wünschen wäre, dass der Erkenntnisstand über die empirischen Effekte von Wettbewerb laufend aktualisiert wird. Angesichts der auch dabei zu erwartenden "gemischten" Ergebnisse, sollte der Gedanke aufgegriffen werden, statt allein über Wettbewerb verstärkt über breitere und möglicherweise erfolgreichere Ansätze zur Verbesserung der Behandlungsqualität nachzudenken.
Der 34 Seiten umfassende und von der britischen "Health Foundation" herausgegebene Review Competition in healthcare - research scan April 2011 ist samt umfänglicher Literaturliste komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.3.15
Erster Evaluierungsbericht des DEval erschienen
 Obwohl Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungs-zusammenarbeit seit je her in Deutschland und anderswo eine untergeordnete Rolle spielt, gerät auch sie unter zunehmenden Rechtfertigungszwang. Die wachsende Unterordnung des Politischen unter das Ökonomische macht auch vor komplexen sozialen, politischen und sozialpolitischen Wirklichkeit nicht Halt. Ganz im Sinne des weltweit um sich greifenden Neo-Neo-Positivismus hat das deutsche Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im November 2012 das Deutsche Institut für Entwicklungsevaluierung ins Leben gerufen, auf dessen Homepage es heißt: "Übergeordnetes Ziel des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) ist die unabhängige Beurteilung des Erfolges von Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit." Der Nachweiszwang für ihre Wirksamkeit hat nun auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit erfasst: "Durch seine unabhängige und externe Gesamtsicht hilft das Institut, Methoden und Standards von Evaluierungen aufzuarbeiten und damit die Qualität von Erfolgsbewertungen zu erhöhen."
Obwohl Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungs-zusammenarbeit seit je her in Deutschland und anderswo eine untergeordnete Rolle spielt, gerät auch sie unter zunehmenden Rechtfertigungszwang. Die wachsende Unterordnung des Politischen unter das Ökonomische macht auch vor komplexen sozialen, politischen und sozialpolitischen Wirklichkeit nicht Halt. Ganz im Sinne des weltweit um sich greifenden Neo-Neo-Positivismus hat das deutsche Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im November 2012 das Deutsche Institut für Entwicklungsevaluierung ins Leben gerufen, auf dessen Homepage es heißt: "Übergeordnetes Ziel des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) ist die unabhängige Beurteilung des Erfolges von Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit." Der Nachweiszwang für ihre Wirksamkeit hat nun auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit erfasst: "Durch seine unabhängige und externe Gesamtsicht hilft das Institut, Methoden und Standards von Evaluierungen aufzuarbeiten und damit die Qualität von Erfolgsbewertungen zu erhöhen."
Die Evaluierung der eigenen Politik im Auftrag der Bundesregierung hebt sich allerdings in interessanter Weise von gängigen Bewertungsansätzen anderer Länder ab, die einfache Gleichungen aus dem eigenen finanziellen Input und veränderten Zielgesundheitsparametern als Beleg für Erfolg anführen. Oder weiterhin vorrangig ökonometrische Wirkungsforschung betreiben. Befördert durch die Fokussierung der internationalen Staatengemeinschaft auf die Millenium Development Goals und teils massive Kapitalspritzen wurde dies zu einem neuen Schwerpunkt in der internationalen Entwicklungsforschung. Die interessante Literaturrecherche The aid effectiveness literature: The sad results of 40 years of research des australisch-dänischen Forscherteams Hristos Douzouliagos und Martin Paldam analysierte bereits im Jahr 2005 rund 100 empirische Studien über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit und ihre Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen der Entwicklung. Das Ergebnis dieser Meta‐Analyse war ernüchternd und zeigte, dass die empirische Evidenz für positive Wirkung der EZ noch höchst brüchig ist. So schlussfolgern Hristos Douzouliagos und Martin Paldam (2005) aus ihrer Metaanalyse zur Frage der Aid Effectiveness Literature (AEL): "We have demonstrated that the AEL has not managed to show that there is a significantly positive effect of aid. Consequently, if there is an effect, it must be small. Development aid is consequently an activity that has proved difficult to do right. When something is difficult, it is of paramount importance that it is transparent, i.e., that it is done by simple, clear and easily controllable rules" (S. 27).
Nun hat das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit den Bericht zu seinem ersten Evaluierungsunterfangen vorgelegt. Zwei Jahre dauerte das anspruchsvolle Unterfangen, bei dem sich das DEval der Bewertung von nicht weniger als 30 Jahren ruandisch-deutscher Zusammenarbeit widmet. Dabei verfolgte es einen komplexen, vornehmlich qualitativen Ansatz, der die jeweiligen politischen und sozialen Bedingungen berücksichtigt. Die Analyse bzw. die Studie ist in drei Zeiträume unterteilt, um damit sowohl der phasenweise dramatischen historischen Entwicklung in Ruanda als auch veränderten Schwerpunkten der deutschen Entwicklungshilfe bzw. -zusammenarbeit Rechnung zu zollen. Die erste Phase von 1980 bis 1994 war durch den Einsatz von ÄrztInnen und Pflegekräften als EntwicklungshelferInnen gekennzeichnet und lässt keine nachhaltige Wirkung erkennen, die den Genozid am Ende dieser Periode überlebt hätte. Die zweite Phase 1995-2003 begann eher mit Nothilfe zum Wiederaufbau der weitgehend zerstörten Infrastruktur des Gesundheitswesens, ging aber ab 2000 in die Unterstützung einer grundlegenderen Entwicklungsstrategie des ostafrikanischen Landes über; hier kommt die Evaluierung zu dem Ergebnis, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung grundlegender Gesundheitsdienste auf lokaler Ebene und zur Qualifikation des Personals leistete. In der letzten Phase 2004-2012, mit der die deutsch-ruandische Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich auf Wunsch der ruandischen Regierung zu Ende ging, stand ganz im Zeichen deren wachsenden Engagements im Sozialbereich, einer verbesserten Koordinierung der EntwicklungspartnerInnen sowie der Millenium-Entwicklungsziele. Dabei erwiesen sich die verschiedenen Ansätze der deutschen Entwicklungszusammenarbeit als unterschiedlich wirksam und nachhaltig:
• Die auch von Deutschland unterstützte Budgetfinanzierung, die auf Eigenverantwortung der ruandischen PartnerInnen setzt, durchlebte mehrere Engpässe und ist durch die zunehmende Kooperation der vornehmlich in ganz eigenen Interesse aktiven USA mit Ruanda in seiner Nachhaltigkeit bedroht
• im Bereich der Gesundheitsfinanzierung spielte die technische Unterstützung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle beim erfolgreichen Aufbau anfänglich gemeindebasierter und mittlerweile durch die öffentliche Hand organisierter Krankenversicherung, die mittlerweile die Bevölkerungsmehrheit erfasst haben
• die Ansätze zur Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit reichte von der Unterstützung der Familienplanungsstrategie über die Bereitstellung erforderlicher Gesundheitsleistungen bis zu peer education, was nach Einschätzung der EvaluiererInnen zur Verbesserung der Zielindikatoren beigetragen hat.
Neben diesen konkreten Befunden bewertet der DEval-Bericht auch gängige indirekte Parameter der Entwicklungszusammenarbeit, die das Direktorat für Entwicklungszusammenarbeit der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter den Begriffen Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impact und Nachhaltigkeit vereinheitlicht hat. Die Evaluierung der ruandisch-deutschen Kooperation im Gesundheitssektor kommt bei den verschiedenen Kriterien naturgemäß zu unterschiedlichen Einschätzungen der diversen Ansätze.
Der Auftraggeber der Ruanda-Evaluierung, das BMZ, scheint laut seiner Stellungnahme zum ersten DEval-Bericht mit der Bewertung seiner Aktivitäten und Ansätze zufrieden zu sein. "Die Ergebnisse der Evaluierung sind insgesamt positiv und im Einzelnen sehr differenziert dargestellt. Sie zeigen, dass die deutschen Beiträge vielfach an den richtigen Stellen ansetzten, aber auch aus Erfahrungen gelernt bzw. auf sich verändernde Rahmenbedingungen eingegangen wurde."
Der in zwei Bänden erschienene Evaluierungsbericht steht kostenfrei in voller Länge auf der Website des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit zum Download zur Verfügung: Band 1 und Band 2 bzw. Annexes.
Dort findet sich auch eine kurze Darstellung des DEval.
Jens Holst, 6.10.14
Globale Gesundheitspolitik - mehr als deutsche Pillen und Technik für den Weltmarkt
 Die 2011 von verschiedenen zivilgesellschaftlichen und akademischen AkteurInnen gegründete Deutsche Plattform für Globale Gesundheit hat ein grundlegendes Papier zu Fragen globaler Gesundheitspolitik vorgelegt. Unter dem Titel Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort zeigt die Plattform entscheidende Aspekte von dem auf, was globale Gesundheitspolitik ausmachen muss.
Die 2011 von verschiedenen zivilgesellschaftlichen und akademischen AkteurInnen gegründete Deutsche Plattform für Globale Gesundheit hat ein grundlegendes Papier zu Fragen globaler Gesundheitspolitik vorgelegt. Unter dem Titel Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort zeigt die Plattform entscheidende Aspekte von dem auf, was globale Gesundheitspolitik ausmachen muss.
Auslöser für dieses Papier war die Verabschiedung des Konzeptpapiers Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen im September 2013 durch die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung. Ende 2013 stellte das Forum Gesundheitspolitik dieses Papier in dem Beitrag Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe vor und verwies auf weitere Stellungnahmen und Analysen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Konzeptpapier der Bundesregierung zu globaler Gesundheitspolitik dem formulierten Anspruch schwerlich gerecht wird.
Die Plattform für globale Gesundheit hat sich intensiv mit dem Konzeptpapier der Bundesregierung auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Bundesregierung in ihrem Konzeptpapier von einem verkürzten Gesundheitsbegriff ausgeht.
Die Plattform, in der Gewerkschaften, Sozial- bzw. Wohlfahrtsverbände, entwicklungs- wie migrationspolitische Organisationen, Wissenschaft, soziale Projekte und Bewegungen zusammenarbeiten, hat sich mit dem Ziel gegründet, unter den Bedingungen der fortschreitenden Internationalisierung der Lebensbedingungen den engen Zusammenhang zwischen globalen und lokalen Einflussfaktoren von Gesundheit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, vorhandene Kräfte zu bündeln und in Deutschland politisch Einfluss zu nehmen. Sie will keine weitere gesundheits- oder entwicklungspolitische Lobby-Gruppe sein, sondern eine übergreifende Initiative mit dem Ziel, die sozialen Bedingungen für Gesundheit stärker in den Mittelpunkt der nationalen und internationalen Gesundheitsdebatte zu rücken. Dafür will sie die Zusammenarbeit zwischen nationaler und internationaler Gesundheitspolitik intensivieren und damit einen Beitrag zur Überwindung der bestehenden Trennung zwischen innenpolitischer und globaler Gesundheitspolitik leisten.
Wenn man diesen Anspruch Ernst nimmt, muss man, wie die Plattform, zu dem Schluss kommen, dass im Konzeptpapier der Bundesregierung zentrale gesundheitspolitische Probleme entweder gar nicht, nicht hinreichend oder gar fehlleitend zur Sprache kommen. Wichtige Aspekte globaler Gesundheitspolitik fehlen. Denn globale Gesundheitspolitik muss nicht nur alle Menschen weltweit in den Blick nehmen, sondern auch die sozialen Determinanten von Gesundheit und alle anderen Faktoren indirekter Gesundheitspolitik.
Als Grundlagen für eine künftige ressortübergreifende Strategie für globale Gesundheit fordert die Deutsche Plattform für globale Gesundheitspolitik daher
• eine stärkere Ausrichtung auf Gesundheitsförderung als auf Biomedizin
• eine hinreichende Beachtung sozialer Ungleichheiten
• gesunderhaltende Arbeits- und Lebensbedingungen
• universelle soziale Absicherung im Krankheitsfall
• ausreichende und sichere Ernährung
• angemessene handels- und steuerpolitische Regulierungen
• Kontrolle und Zurückdrängen von Profitinteressen in der Gesundheitswirtschaft
• Steuerung der Migration von Fachkräften
• Verminderung der gesundheitlichen Risiken des Klimawandels
• Gesundheitsförderliche Energiepolitik
• Eindämmung von Rüstungsexporten und Krieg
• Zugang zur Krankenversorgung auch für Illegale
• Demokratisierung der WHO als relevante Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
Im Fazit des Plattform-Papiers heißt es: "In der globalisierten Welt ist globale Gesundheitspolitik eine bedeutende wie auch vielschichtige Querschnittsaufgabe. Es ist ermutigend, dass die weltweiten Zusammenhänge von Gesundheit in den vergangenen Jahren verstärkt in den Blick gerückt sind. Und es ist gut, dass sich auch die Bundesregierung mit der Vorlage eines Konzeptpapiers dieser Herausforderung gestellt hat. Das vorgelegte Papier macht allerdings auch deutlich, wie weit der Weg zu einem umfassenden Verständnis von globaler Gesundheitspolitik und geeigneten politischen Strategien zur Verbesserung der weltweiten Gesundheit noch ist."
Zusammenfassend kommt die Plattform in ihrem Gegenkonzept zu der Einschätzung: "Auch wenn mit Blick auf den laufenden Post-2015-Prozess nun eine Chance vertan sein könnte, besteht für die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit kein Zweifel, dass der eingeschlagene Weg in die richtige Richtung führt. Dafür ist allerdings ein klares Bekenntnis zu einem menschenrechtlichen Verständnis erforderlich, das Gesundheit nicht als profitables "Geschäftsmodell" begreift, sondern als Anspruch jedes Menschen. Die Krise der gegenwärtigen Gesundheitspolitik ist nicht zuletzt Folge des Gefangenseins in Einstellungen und Überzeugungen, die bestehende Probleme verlängern, nicht aber überwinden. "Probleme", darauf hat schon Albert Einstein verwiesen, "kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Allen Interessierten steht das Grundsatzpapier der Deutschen Plattform für globale Gesundheit zum Thema Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 27.8.14
"Nichts ist unmöglich" oder SchülerInnenzahl in Pflegefachberufen nimmt zwischen 2007/08 und 2011/12 kräftig zu
 Zu den häufig als unvermeidbar oder unumkehrbar dargestellten und linear problematischer werdenden Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen gehört der Mangel an Fachkräften in den wichtigsten 17 gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufen. Die Brisanz solcher Prognosen ergibt sich hauptsächlich aus der ebenfalls als naturgegeben prognostizierten Zunahme kranker und pflegebedürftiger älteren Personen und die für den beruflichen Nachwuchs besonders unattraktiv charakterisierten und kommunizierten Arbeitsbedingungen in pflegerischen Berufen.
Zu den häufig als unvermeidbar oder unumkehrbar dargestellten und linear problematischer werdenden Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen gehört der Mangel an Fachkräften in den wichtigsten 17 gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufen. Die Brisanz solcher Prognosen ergibt sich hauptsächlich aus der ebenfalls als naturgegeben prognostizierten Zunahme kranker und pflegebedürftiger älteren Personen und die für den beruflichen Nachwuchs besonders unattraktiv charakterisierten und kommunizierten Arbeitsbedingungen in pflegerischen Berufen.
Eine Reihe von nationalen und international vergleichenden Studien zeigen allerdings, dass beide Trends nicht zwangsläufig oder zumindest nicht in dem dramatisierten Umfang eintreten müssen.
Eine am 17. Juli 2014 veröffentlichte Auswertung der Entwicklung der SchülerInnenzahl in Gesundheitsfachberufen zwischen 2007/08 und 2011/12 durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) liefert eine bemerkenswerte und zum Teil unerwartete Momentaufnahme für die Personalentwicklung.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten so:
• mit rund 187.000 Schülerinnen und Schülern im Jahr 2011/2012 im Vergleich zum Schuljahr 2007/2008 ist ein Anstieg um 5,9 % in allen nicht-akademischen Erstausbildungen der Gesundheitsfachberufe zu verzeichnen.
• Der Anteil der SchülerInnen in den drei Pflegeberufen "Altenpflege", "Gesundheits- und Krankenpflege" sowie "Gesundheits- und Kinderkrankenpflege" an allen SchülerInnen beträgt beinahe 66%.
• Zunahme der SchülerInnen für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege um 4,7 %, für Gesundheits- und Krankenpflege um 7,6 %, für RettungsassistentInnen um 21,6 %), für Podologen/zur Podologin um 29,7 % und für AltenpflegerInnen um 36,2%.
• Insbesondere bei den SchülerInnen für Altenpflege verstärkt sich die Zunahme sogar gegen Ende des Untersuchungszeitraums mit jährlich +5,3% sogar kräftig.
• Eine Abnahme der SchülerInnenzahlen gibt es dagegen bei den PhysiotherapeutInnen (-10,1 %), ErgotherapeutInnen (-23,7 %), MasseurInnen und medizinischen BademeisterInnen (-28,1 %) DiätassistentInnen (-42,2 %).
Die Entwicklung kommentiert der BIBB-Präsident so: "Wenn der momentane Trend sich verstetigt, besteht die Chance, dass wir den gerade in dieser Branche erwarteten Fachkräftemangel abmildern können". Ob dieser Kommentar nicht zu weit geht, werden die nächsten Jahre und vergleichbare Untersuchungen belegen müssen. Wenigstens an der Unvermeidbarkeit des Umfangs des Personalnotstands im Pflegebereich lässt sich aber mit diesen aktuellen Trends schon zweifeln.
Die als Heft 153 der "Wissenschaftlichen Diskussionspapiere" des BIBB erschienene Studie Gesundheitsfachberufe im Überblick von Maria Zöller et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
"Das wissenschaftliche Diskussionspapier fasst die Ergebnisse der statistischen Analysen der bundesrechtlich geregelten nicht-akademischen Ausbildungen in Gesundheitsfachberufen zusammen. Darüber hinaus werden Ansatzpunkte zur Modernisierung der Ausbildungen aufgezeigt. Ergänzend werden Forschungsprojekte und Publikationen des Bundesinstituts für Berufsbildung sowie Hinweise zu Portalen mit weiterführenden Informationen übersichtlich dargestellt. Abgerundet wird der Bericht durch eine aktuelle BIBB-Auswahlbibliografie zu Gesundheitsfachberufen."
Bernard Braun, 20.7.14
Pay for Performance bleibt Glaubensfrage - Empirie überaus schwach
 Seit langem gibt es unter Gesundheitswissenschaftlern und teilweise unter Gesundheitsökonomen eine lebhafte Diskussion über Sinn und Unsinn einer leistungs- oder erfolgsabhängigen Honorierung der Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Während BefürworterInnen dieser Form der finanziellen Steuerung einen Erfolg versprechenden Ansatz zur Unterstützung erwünschter Verhaltensweisen der Anbieter, zur Verbesserung der Versorgungsqualität und letztlich auch zur Kostendämpfung sehen, verweisen SkeptikerInnen auf die zusätzlich anfallenden Kosten, fragliche Qualitätsverbesserungen sowie die Gefahr unerwünschter Effekte durch rein pekuniäre Motivation und mögliche Fehlsteuerung durch Verlagerung auf einkommensrelevante Leistungen.
Seit langem gibt es unter Gesundheitswissenschaftlern und teilweise unter Gesundheitsökonomen eine lebhafte Diskussion über Sinn und Unsinn einer leistungs- oder erfolgsabhängigen Honorierung der Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Während BefürworterInnen dieser Form der finanziellen Steuerung einen Erfolg versprechenden Ansatz zur Unterstützung erwünschter Verhaltensweisen der Anbieter, zur Verbesserung der Versorgungsqualität und letztlich auch zur Kostendämpfung sehen, verweisen SkeptikerInnen auf die zusätzlich anfallenden Kosten, fragliche Qualitätsverbesserungen sowie die Gefahr unerwünschter Effekte durch rein pekuniäre Motivation und mögliche Fehlsteuerung durch Verlagerung auf einkommensrelevante Leistungen.
Etwas Licht in die laufende Debatte zu bringen verspricht ein kürzlich in der Fachzeitschrift Health Policy veröffentlichter Überblicksartikel mit dem Titel Effects of pay for performance in health care: A systematic review of
systematic reviews. Darin bestätigt die deutsch-niederländische Forschergruppe nicht nur die große Bandbreite von Erfahrungen und Erkenntnissen, sondern vor allem, dass die zustimmende oder ablehnende Haltung von einer Reihe zusätzlicher Faktoren und damit letztlich von der eigenen Einstellung abhängt.
Pay-for-performance (P4P) oder performance-based payment (PBP) bezeichnet eine solche erfolgsabhängige Vergütung, die sich an Hand festgelegter Qualitäts- oder Ergebnisindikatoren bemisst und zur Steigerung der Behandlungsqualität und verbesserter Versorgung beitragen soll. P4P ist als ein externes Anreizsystem im Rahmen der Bezahlung für Gesundheitsleistungen beispielsweise von niedergelassenen Ärzten oder Krankenhäusern, das Leistungserbringer motivieren soll, vordefinierte Ziele möglichst weitgehend zu erfüllen. Diese erfolgsorientierte Vergütung soll zum einen direkten Einfluss auf das Einkommen eines Leistungserbringers haben und zum Anderen über ein öffentlich zugängliches Berichtssystem indirekte Auswirkungen auf das Verhalten von Leistungserbringern haben.
Im Unterschied zu Deutschland haben andere Länder teils langjährige Erfahrungen mit leistungs- und qualitätsorientierten variablen Vergütungsanteilen bzw. P4P. In den USA finden seit über 20 Jahren erfolgsorientierte Prämien auf der Basis bestimmter Qualitätsindikatoren Anwendung. Großbritannien ist bemüht, die hausärztliche Qualität mithilfe finanzieller Anreize in Form leistungsbezogener Vergütungsanteile zu verbessern. Praktisch alle britischen Praxen beteiligen sich am dortigen P4P Programm, das niedergelassenen Hausärzten auf Grundlage von 150 festgelegten Qualitätsindikatoren eine durchschnittlich 25-prozentige Einkommenssteigerung beschert. Auch viele andere Länder wie Kanada, Israel, Neuseeland, Taiwan oder Ruanda wenden zunehmend P4P-Ansätze an.
Wie alle marktorientierten Neuerungen - vor allem wenn sie aus den USA kommen - stieß der P4P-Ansatz seit Anbeginn auf große Resonanz vor allem unter Gesundheitsökonomen, aber auch bei Gesundheitswissenschaftlern. Mittlerweile liegt eine Vielzahl von Studien und wissenschaftlichen Publikationen zu den Wirkungen von erfolgsabhängiger Honorierung im Gesundheitswesen vor. Überwogen anfangs eher positive Auswertungen und Einschätzungen, die vielfach aus der Feder der Initiatoren stammten und zumeist nur kurzfristige Auswirkungen erfassten, hat sich mittlerweile die verfügbare empirische Evidenz unübersehbar zu kritischeren Bewertungen verschoben. Auf weniger optimistische Ergebnisse wies das Forum Gesundheitspolitik beispielsweise im letzten Jahr mit dem Artikel "Pay for performance" auch nach 6 Jahren ohne positive Wirkung hin. Die Heterogenität der Befunde konnten auch verschiedene systematische Meta-Analysen nicht reduzieren, da sie jeweils unterschiedliche Schwerpunkte verfolgten.
Die nun vorgelegte Meta-Meta-Analyse versucht, auf diesem widersprüchlichen Gebiet einen strukturierten umfassenden Überblick über vorliegende Evidenzen zu P4P-Wirkungen und deren Begleitumständen zu liefern. In diese Meta-Meta-Analyse schlossen die Autoren aus Rotterdam und Nürnberg insgesamt 22 Studien ein, die einen sehr breiten Kanon von P4P-Effekten aufzeigten. Zwar deuten einige Analysen auf eine mögliche (Kosten-)Effektivität einer erfolgsabhängigen Honorierung von Leistungserbringern hin; allerdings sind die Hinweise insgesamt nicht überzeugend, denn viele Studien fanden überhaupt keine oder allenfalls sehr schwache Auswirkungen auf die Effektivität und nur wenige Untersuchungen konnten P4P-Effekte überzeugend von denen anderer Veränderungen abgrenzen. Während P4P zur Abschwächung von Ungleichheiten zwischen verschiedenen sozioökonomischen Gruppen beitragen konnte, war bei anderen Ungleichheiten kein positiver Effekt zu beobachten. Allerdings fand das deutsch-niederländische Forscherteam Hinweise auf unerwünschte Wirkungen insbesondere bei solchen Behandlungen, für die keine erfolgsabhängige Vergütung erfolgte.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Allenfalls geringe Effektivitätssteigerung bei Prävention: Begutachtungen der Effektivität des P4P-Ansatzes bezogen sich im Wesentlichen auf präventive Maßnahmen wie Impfungen und Früherkennung zeigten ein sehr gemischtes Bild, das keine Rückschlüsse zulässt, zumal die in einigen Studien erfasste positive Auswirkung von P4P ausgesprochen gering war.
• Unterschiedliche Effekte bei verschiedenen Krankheiten: P4P hatte geringen Einfluss auf die Behandlungsqualität bei Asthma und Diabetes, aber nicht bei Herzerkrankungen.
• Nachhaltigkeitslücke: Die zumeist ohnehin eher schwachen Wirkungen von P4P sind im ersten Jahr nach Einführung erfolgsabhängiger Honorierung am stärksten ausgeprägt und geht danach zurück.
• Kosteneffektivität: Es fehlt bisher der Nachweis, dass P4P-Ansätze die mit ihrer Einführung und Umsetzung einhergehenden Mehrausgaben für das Gesundheitssystem rechtfertigen, indem potenzielle bzw. erwünschte Kostendämpfungen die dafür erforderlichen Ausgaben zumindest kompensieren. Zudem lassen die Studien auch regelmäßig die Frage offen, ob gemessene Verbesserungen nicht allein durch die aufgrund des P4P-Ansatzes vermehrt verfügbaren Ressourcen erklärbar sind.
• Auswirkungen auf Behandlungen außerhalb der erfolgsabhängigen Honorierung: Auch hier zeigt die Zusammenschau diverser Meta-Analysen ein sehr uneinheitliches Bild, das den Verdacht auf negative Effekte auf nicht für die leistungsabhängige Vergütung relevante Procedere und die intrinsische Motivation nahe-, aber nicht belegen.
• Gesundheitliche Ungleichheit: P4P kann zumindest kurzfristig zu einer Verringerung sozialer Ungleichheit bei der Nutzung von Präventionsangeboten beitragen, indem Anbieter proaktiver Personen für diese Maßnahmen rekrutieren; ansonsten bleiben aber vertikale und vor allem horizontale Ungleichheiten weitgehend unberührt.
• Öffentliches Berichtswesen: Die mit der leistungsabhängigen Vergütung medizinischer Anbieter verbundene Offenlegung von Daten zur Qualität ihrer Versorgung scheint zu einer Verstärkung der erwünschten P4P-Effekte beizutragen bzw. diese zu einem nicht unerheblichen Teil mit zu verursachen.
• Abhängig von einer Vielzahl anderer Faktoren: Letztlich hängen die Wirkungen des performance-based payment von einer ganzen Reihe Umsetzungs- und Umgebungsfaktoren ab, nämlich von der Art der Erfolgs- und Zielvorgaben, Größe der Einrichtung, Häufigkeit der erfolgsabhängigen Honorierung etc.
Von dem Artikel Effects of pay for performance in health care: A systematic review of systematic reviews von Frank Eijkenaara, Martin Emmert, Manfred Scheppach und Oliver Schöffski, in der Health-Policy Ausgabe 110 (2-3) steht für Nicht-Abonnenten nur das Abstract kostenfrei zur Verfügung.
Jens Holst, 3.8.13
Jahrbuch für kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften online verfügbar
 Für alle gesundheitspolitisch oder gesundheitswissenschaftlich und am Medizinbetrieb Interessierten steht seit kurzem eine weitere relevante Informationsquelle zur Verfügung: Das Jahrbuch für kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften geht online. Damit steht nun Internet-NutzerInnen eine Vielzahl hochinteressanter kritischer Analysen gesundheitspolitischer und -relevanter Texte zur Verfügung, die sich nicht allein mit aktuellen Herausforderungen und Fragestellungen befassen, sondern auch Schlaglichter auf die Auseinandersetzungen vergangener Jahrzehnte werfen und vergleichende Rückblicke erlauben.
Für alle gesundheitspolitisch oder gesundheitswissenschaftlich und am Medizinbetrieb Interessierten steht seit kurzem eine weitere relevante Informationsquelle zur Verfügung: Das Jahrbuch für kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften geht online. Damit steht nun Internet-NutzerInnen eine Vielzahl hochinteressanter kritischer Analysen gesundheitspolitischer und -relevanter Texte zur Verfügung, die sich nicht allein mit aktuellen Herausforderungen und Fragestellungen befassen, sondern auch Schlaglichter auf die Auseinandersetzungen vergangener Jahrzehnte werfen und vergleichende Rückblicke erlauben.
Denn mit der Vorgängerreihe Jahrbuch für Kritische Medizin erscheint das Jahrbuch für kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften (JKMG) im Prinzip seit 1970 regelmäßig im Hamburger Argument Verlag. Die Veröffentlichungsreihe begann zunächst unter dem Namen Kritik bürgerlicher Medizin und entwickelte sich ab 1972 unter dem stärker programmatisch formulierten Titel Argumente für eine soziale Medizin weiter. Weitere vier Jahre später entstand zudem das Jahrbuch für kritische Medizin als ein Forum der Diskussion über den gesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Die zugrunde liegende Orientierung auf eine sozial und human ausgerichtete Medizin führte quasi zwangsläufig zu einer Kritik der zunehmenden Einengung des Gesundheitsverständnisses auf biomedizinische Aspekte. Das Jahrbuch für kritische Medizin setzte dieser Tendenz nicht nur ein breiteres Gesundheitskonzept und eine kritische wissenschaftliche Aufarbeitung von Gesundheitspolitik und Praxis im Gesundheitswesen entgegen, sondern verschrieb sich auch der Entwicklung von Konzepten der Gesundheitsförderung und Prävention. Das Jahrbuch für kritische Medizin verstand sich dabei als ein breites Diskussionsforum für konstruktive Kritik am hiesigen Gesundheitswesen. Es verfolgte dabei den Anspruch, die festgefahrene und teilweise provinzielle übliche Auseinandersetzung über Medizin und Gesundheit zu überwinden.
Ab 1983 erschienen sämtliche Bände unter dem einheitlichen Reihentitel Kritische Medizin im Argument-Verlag. Diese Reihe umfasste seither einen Themen-Band sowie ein eigentliches Jahrbuch für kritische Medizin pro Jahr. Auch darin gab es jeweils einen Schwerpunkt, die Redaktion wollte aber immer auch den Charakter eines Diskussionsforums erhalten, so dass auch Aufsätze außerhalb des Schwerpunktes enthalten waren. Als Antwort auf die allmähliche Erweiterung des thematischen Spektrums der veröffentlichten Beiträge kam es 2009 zur konzeptionellen Erweiterung und entsprechenden Umbenennung der Reihe in Jahrbuch für Kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften. Weiterhin ist jeder Band einem Schwerpunktthema gewidmet, zu dessen Vorbereitung die Redaktion üblicherweise einen Call for Papers versendet. Allerdings sind auch Beiträge außerhalb der Schwerpunktthemen jederzeit willkommen.
Das Jahrbuch für Kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften bleibt der Tradition der vorangegangenen Reihen treu und bietet heute ein aktuelles Forum für die kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bedingungen von Gesundheit und Krankheit sowie mit Fragen der gesundheitsbezogenen Versorgung und der Gesundheitspolitik. Die Redaktion besteht aus ehrenamtlich tätigen HochschullehrerInnen und AkademikerInnen, die das JKMG als willkommenes Medium pflegen, außerhalb des wissenschaftlichen Mainstreams gesundheitsrelevante Themen analysieren und darlegen zu können, um einen nicht von Partialinteressen geleiteten und von Drittmitteln wie von selbstreferenzieller Selektion des herrschenden Wissenschaftsapparates unabhängigen wissenschaftlichen Diskurs zu ermöglichen.
Um seine Sichtbarkeit zu erhöhen und die Nutzung der vielen wertvollen Beiträge zu erleichtern, hat sich die aktuelle Redaktion des JKMG entschieden, die Jahrbuch-Artikel auf seiner Website zur Verfügung zu stellen.
Damit stehen auch die historischen Bände auf der Homepage der Reihe Jahrbuch für kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften kostenfrei als Volltexte zum Download zur Verfügung. Die Vielzahl der inhaltlich hochinteressanten, kenntnisreich geschriebenen Artikel, die sich um eine kritisch-wissenschaftliche Analyse jeweils aktueller oder als gesundheitspolitisch wichtig erachteten Themen bemühen, dürfte allerdings keineswegs nur für HistorikerInnen interessant sein. Bereits eine oberflächliche Betrachtung der verschiedenen Ausgaben und Artikel im Jahrbuch für kritische Medizin ebenso wie in der Nachfolgereihe Jahrbuch für kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften zeigt sehr schnell, dass etliche der dort analysierten und diskutierten Themen heute aktuell sind wie eh und je. Nachlesen verspricht in vielen Fällen nicht nur rückblickend, sondern auch für aktuelle Debatten einen nicht zu unterschätzenden Erkenntnisgewinn.
Einzig den jeweils aktuellen Band stellt die Redaktion nicht sofort zum kostenfreien Download zur Verfügung. Interessierte können wie gehabt beim Argument-Verlag den jeweils letzten Band vom Jahrbuch für Kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften bestellen. Aktuelle Bände stehen aber jeweils nach Erscheinen der folgenden Ausgabe online zur Verfügung.
Jens Holst, 25.3.13
Selbstbeteiligungen in Entwicklungsländern machen ärmer und kränker
 Nicht nur in Deutschland und anderen Industriestaaten gehören nachfrageseitige finanzielle Steuerungsmechanismen wie Patientenselbstbeteiligungen zum Standardrepertoire von Gesundheitsreformen. Auch die meisten Entwicklungs- und Schwellenländer greifen immer wieder auf das ebenso alte wie fragwürdige Instrument von Zuzahlungen zur Krankenbehandlung zurück. Ein soeben veröffentlichtes Discussion Paper der mittlerweile beendeten Forschungsgruppe Public Health am Wissenschaftzentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) geht detailliert den Fragen der Anwendung, Bedeutung und vor allem Wirkung von so genannten user fees (Nutzergebühren) und anderen Formen von Selbstbeteiligungen in den armen Ländern des Südens nach. Der Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Entwicklungsberater Jens Holst beleuchtet zunächst den theoretischen Begründungszusammenhang von Patientenzuzahlungen im Gesundheitswesen, verweist dabei aber explizit auf ausführlichere Betrachtungen in seinem vorangegangenen WZB Discussion Paper zu Auswirkungen von Zuzahlungen in Industrieländern, worauf wir seinerzeit in dem Forumsbericht Was Sie schon immer über Zuzahlungen wissen wollten ... hinwiesen. Der Hauptteil des aktuellen Discussion Papers widmet sich messbaren Zuzahlungswirkungen in Entwicklungs- und Schwellenländern im Hinblick auf makro- und mikroökonomische Aspekte, die Problematik von Opportunitätskosten und feststellbare Strategien des Umgangs mit Selbstbeteiligungen sowie Möglichkeiten und Herausforderungen von Zuzahlungsbefeiungen. Ein weiteres Kapitel analysiert spezifischer die Effekte von Zuzahlungen bei der Steuerung des Nachfrageverhaltens im Gesundheitswesen, gefolgt von einem Überblick über relevante Metaanalysen zu dieser Thematik.
Nicht nur in Deutschland und anderen Industriestaaten gehören nachfrageseitige finanzielle Steuerungsmechanismen wie Patientenselbstbeteiligungen zum Standardrepertoire von Gesundheitsreformen. Auch die meisten Entwicklungs- und Schwellenländer greifen immer wieder auf das ebenso alte wie fragwürdige Instrument von Zuzahlungen zur Krankenbehandlung zurück. Ein soeben veröffentlichtes Discussion Paper der mittlerweile beendeten Forschungsgruppe Public Health am Wissenschaftzentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) geht detailliert den Fragen der Anwendung, Bedeutung und vor allem Wirkung von so genannten user fees (Nutzergebühren) und anderen Formen von Selbstbeteiligungen in den armen Ländern des Südens nach. Der Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Entwicklungsberater Jens Holst beleuchtet zunächst den theoretischen Begründungszusammenhang von Patientenzuzahlungen im Gesundheitswesen, verweist dabei aber explizit auf ausführlichere Betrachtungen in seinem vorangegangenen WZB Discussion Paper zu Auswirkungen von Zuzahlungen in Industrieländern, worauf wir seinerzeit in dem Forumsbericht Was Sie schon immer über Zuzahlungen wissen wollten ... hinwiesen. Der Hauptteil des aktuellen Discussion Papers widmet sich messbaren Zuzahlungswirkungen in Entwicklungs- und Schwellenländern im Hinblick auf makro- und mikroökonomische Aspekte, die Problematik von Opportunitätskosten und feststellbare Strategien des Umgangs mit Selbstbeteiligungen sowie Möglichkeiten und Herausforderungen von Zuzahlungsbefeiungen. Ein weiteres Kapitel analysiert spezifischer die Effekte von Zuzahlungen bei der Steuerung des Nachfrageverhaltens im Gesundheitswesen, gefolgt von einem Überblick über relevante Metaanalysen zu dieser Thematik.
Die Finanzierung der medizinischen Versorgung ihrer Bevölkerung stellt die meisten Entwicklungs- und viele Schwellenländer vor das Dilemma knapper öffentlicher Ressourcen und konkurrierender Prioritäten. Vielerorts ist die öffentliche Krankenversorgung zwar kostenfrei, aber chronisch unterfinanziert und weder quantitativ noch qualitativ in der Lage, die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen zu befriedigen. Auf der Suche nach zusätzlichen Finanzierungsquellen zur Verbesserung der Krankenversorgung entstand die Idee, deren NutzerInnen, also die PatientInnen stärker an den Kosten ihrer Behandlungen zu beteiligen. Insbesondere in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre drängten nicht nur die üblichen Verdächtigen unter den internationalen Organisationen wie Weltbank und IWF die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zur Einführung von Nutzergebühren bei Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen; andere UN-Sonderorganisationen wie WHO und UNICEF schlugen in dieselbe Kerbe. Im Zuge der so genannten Bamako-Initiative führten viele afrikanische Länder generelle Behandlungsgebühren in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen ein. Auch in den allermeisten anderen Entwicklungs- und Schwellenländern mussten bzw. müssen Patienten in zunehmendem Maße selber für ihre Krankenversorgung aufkommen.
In ihrer viel beachtenden Strategiestudie Financing Health Services in developing countries: an agenda for reform forderte die Weltbank unter anderem eine deutliche Erhöhung der Nutzergebühren in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Sechs Jahre später unterstrich der Weltbank-Jahresbericht Investing in Health die Notwendigkeit von Nutzergebühren sowie einer Zweiklassenmedizin, da umfassende Leistungspakete aus öffentlichen Mitteln nicht für alle bezahlbar seien.
Dabei verfolgte die systematische Einführung von Nutzergebühren im Gesundheitswesen nach Auffassung ihrer BefürworterInnen im Wesentlichen drei Ziele: Generierung zusätzlicher Mittel zur Verbesserung der Krankenversorgung, Überwindung bestehender Ungerechtigkeiten beim Zugang zu Versorgungsleistungen und Kostendämpfung durch Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen. Diese Annahmen standen ganz im Zeichen der neoklassischen Wirtschaftstheorie, die vornehmlich mikroökonomische Ansätze in der Logik individueller Nutzenmaximierung propagierte und in Entwicklungsländern in Form der Strukturanpassungsprogramme Einzug hielt. In der Gesundheitspolitik verdrängten zunehmend ökonomische Vorstellungen sozialpolitische Zielsetzungen, und es setzte sich das Denken in finanziellen Anreizsystemen zur Steuerung von Anbieter- und Nachfragerverhalten durch. Perfiderweise bezogen sich die Verfechter von user fees gleichzeitig explizit auf die Basisgesundheitsbewegung von Alma Ata und deren Forderung nach Dezentralisierung, Transparenz, Empowerment und Governance.
Das aktuelle WZB Discussion Paper versucht in erster Linie, die Studienlage an Hand der mittlerweile riesigen Zahl empirischer Untersuchungen über die Auswirkungen von Nutzergebühren im Gesundheitswesen von Entwicklungs- und Schwellenländern darzulegen. Dabei zeigen sich zum einen grundlegende Schwächen der theoretischen Begründungszusammenhänge, denn in die meisten ökonomischen Modellrechnungen so viele Annahmen und Einschränkungen ein, dass ihre Relevanz für die Versorgungsrealität fragwürdig ist.
Auf praktischer Ebene hat sich gezeigt, dass die erwünschten Effekte nur teilweise und in geringem Ausmaß eingetreten sind. Bei aller Heterogenität der vorliegenden Untersuchungen bleibt die Bilanz von Patientenzuzahlungen in Entwicklungsländern in Bezug auf die Systemstärkung und Nachhaltigkeit der Gesundheitsfinanzierung insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Dieser Gesamteindruck verstärkt sich, wenn man die Studien jenseits formalwissenschaftlicher Kriterien oder ihres wirtschaftstheoretischen Ansatzes analysiert. So führten primär mikroökonomische Entwicklungsansätze in Form der Cost-Sharing-Politik zu grundlegenden, nachhaltigen Änderungen wie beispielsweise der Kürzung der Regelfinanzierung öffentlicher Leistungserbringer und weitergehenden sozialpolitischen bzw. wohlfahrtsstaatlichen Konsequenzen. Ohnehin stimmen etliche Analysen und Befunde unübersehbare mit weltbanknahen positiven Einschätzungen der meist kurzfristig verbesserten Versorgungsqualität überein oder reproduzieren die unbelegte Annahme, Nutzergebühren wirkten als Vorläufer von Krankenversicherungssystemen.
Aller anfänglichen Euphorie und rezidivierenden Befeuerung nachfrageseitiger Steuerungsideen im Gesundheitswesen zum Trotz hat die wachsende Erkenntnis eher bedenklicher als positiver Effekte von Behandlungsgebühren allerdings sowohl in Entwicklungs- und Schwellenländern als auch bei internationalen Organisationen mittlerweile kritische Positionen gegenüber Patientenzuzahlungen gestärkt. Insbesondere die unerwünschten Auswirkungen auf Arme sowie offenkundige Nachhaltigkeitsprobleme haben die Hürden für die Umsetzung einer Politik der Nutzergebühren erhöht. Die zunehmende Bedeutung von universeller Absicherung im Krankheitsfall als entwicklungspolitisches Ziel machten die Forderung nach Abschaffung von Patientenzuzahlungen zuletzt zu einem wichtigen Thema in der Entwicklungszusammenarbeit.
Im Zuge der dominierenden Debatte über Universal Health Coverage haben die KritikerInnen von Zuzahlungen in Entwicklungs- und Schwellenländern momentan Oberwasser in der entwicklungspolitischen Diskussion über die Gesundheitssystementwicklung und -stärkung in den armen Ländern dieser Welt. Soziale Sicherung und vor allem die Absicherung im Krankheitsfall stehen weit oben auf der internationalen Agenda. Doch zum einen ist die Vorstellung einer wirksamen und unschädlichen patientenseitigen Steuerung der Nachfrage nach Krankenversorgungsleistungen noch immer tief in vielen Köpfen verankert. Und zum anderen dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann das Pendel wieder umschlägt und die unkaputtbare Forderung nach Eigenbeteiligungen Oberhand gewinnt. Wer für diesen Fall und für immer wiederkehrende Diskussionen über Sinn und Unsinn von Nutzergebühren gewappnet sein will, der findet im Discussion Paper Direktzahlungen in der Krankenversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern: Ein Reforminstrument mit überwiegend negativen Wirkungen überaus reichhaltiges empirisches Material, hilfreiche Einordnungen, wichtige Denkanstöße und nicht zuletzt die vermutlich umfangreichste Literaturzusammenstellung zu dieser Thematik.
Jens Holst, 14.2.13
Warum sind Mythen so allgegenwärtig, zäh und bleiben haften und was man daran ändern kann? Antworten eines "Entlarvungs-Handbuchs"
 Egal, ob es um grundsätzliche Zweifel am Klimawandel, um die eherne Gewissheit geht, dass die Masern-Mumps-Röteln-Impfung Autismus auslöst oder um die "Kostenexplosion" im Gesundheitswesen sowie den demografischen "Silver-Tsunami" (so die neueste Bezeichnung der Zunahme des Anteils der älteren Bevölkerung): Die Versuche, die Vertreter solcher Positionen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft mit immer wieder bestätigten oder erweiterten Fakten und Evidenz davon zu überzeugen, dass es sich dabei um eindeutig widerlegte und unsinnige Mythen handelt, scheitern oft über Jahre und Jahrzehnte.
Egal, ob es um grundsätzliche Zweifel am Klimawandel, um die eherne Gewissheit geht, dass die Masern-Mumps-Röteln-Impfung Autismus auslöst oder um die "Kostenexplosion" im Gesundheitswesen sowie den demografischen "Silver-Tsunami" (so die neueste Bezeichnung der Zunahme des Anteils der älteren Bevölkerung): Die Versuche, die Vertreter solcher Positionen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft mit immer wieder bestätigten oder erweiterten Fakten und Evidenz davon zu überzeugen, dass es sich dabei um eindeutig widerlegte und unsinnige Mythen handelt, scheitern oft über Jahre und Jahrzehnte.
Ihre Eigenart eines Stehaufmännchen liegt zum einen daran, dass Mythen kognitiv betrachtet nicht hundertprozentiger Unsinn oder gleichbedeutend mit einer falschen Geschichte (Kolakowski) sind. In Anlehnung an Roland Barthes kann man Mythen als Umwandlungen komplexer sozialer oder geschichtlicher Sachverhalte in einfachere scheinbar naturhafte Zustände charakterisieren, bei denen immer "einiges unter den Tisch" fällt (Obendiek).
Zum anderen gibt es aber eine Reihe menschlicher psychologischer und kommunikationeller Eigenschaften oder Eigenarten, die zusätzlich zu der enormen Persistenz der genannten und vieler anderer Mythen beitragen.
Das zuerst im November 2011 veröffentlichte so genannte "Debunking Handbook" (Entlarvungshandbuch) der australischen Psychologen Cook und Lewandowsky enthält eine kompakte Darstellung der Mechanismen, die dabei eine zentrale Rolle spielen und die eine ihrer zentralen Schlussfolgerungen stützen, "die Evidenz" lasse "vermuten, dass populäre Mythen Einfluss behalten werden - egal wie oft und energisch man diese Irrtümer korrigiert." (zitiert nach dem ausgezeichneten Artikel von Sebastian Herrmann (2012): Wie man Starrköpfe überzeugt. In: Süddeutscher Zeitung vom 1.2.2012 - ein Beitrag, der leider für Nichtabonnenten nicht frei zugänglich ist) Trotz dieser Evidenz halten die beiden Autoren es aber für möglich, Mythen und ihre Propagandisten zu irritieren und ihre Behauotungen zu erschüttern.
Zu den wichtigsten Gründen warum Mythen so erfolgreich und zäh sind, zählen Cook und Lewandowsky folgende:
• Psychologische Studien zeigen, dass einmal erhaltene Informationen auch durch noch so gut belegte andersartige Informationen automatisch aus dem Gedächtnis gelöscht werden. Nicht zuletzt ihre Wiederholung durch andere als die Erstinformanten erzeugt den Eindruck, an der ersten Information müsse "doch etwas dran sein".
• Die Annahme, Menschen hielten an einer falschen Meinung oder Vorstellung fest, weil sie noch nicht über genügend Informationen verfügten, ist daher falsch. Das Gegenteil ist sogar richtig. Je mehr man offen gegen einen Mythos als Mythos ankommuniziert, desto wahrscheinlicher kommt es zu einem so genannten "Familiarity Backfire Effect". Die Vertrautheit mit einem Mythos ergibt sich nach Meinung der von den Autoren zitierten Studien dadurch, dass in einer Mischung von Mythen und Pro- oder Contra-Fakten oft nach kurzer Zeit nur noch der Mythos präsent oder vertraut ist und die Fakten verblassen. Die Vertrautheit mit dem Mythos führt dazu, dass frontale Kritik an ihm Abwehr provoziert. Als Alternative schlagen die Handbuchverfasser daher vor, ohne Nennung des Mythos alternative Fakten zu präsentieren und auch davon nicht allzu viele.
• Der Hinweis auf die Risiken von zu viel Gegenargumenten beim Aufklären von Mythen spricht das Problem des so genannten "overkill backfire effect" an. Versucht man die meist einfach gestrickten Mythen komplex zu widerlegen, fühlen sich viele Menschen, die ja auch noch sehr viele weitere Dinge zu verarbeiten haben, überfordert und "schießen" mit dem Festhalten an der unaufwändigeren Version "zurück". Statt dem bereits erwähnten Informationsdefizitansatz zu folgen, schlagen die Handbuchverfasser das so genannte KISS-Prinzip vor: "Keep it simple, stupid!": "Eine simpel gestrickte Legende ist kognitiv attraktiver als deren komplexe Widerlegung."
• Auch zu viel Verständnis oder das mehr oder minder rhetorische Hineindenken oder -versetzen in die als Mythos bezeichnete Position, provoziert meist nicht eine Art Gegenverständnis oder die Bereitschaft "offen und ohne Voreinstellung miteinander zu reden", sondern das Gegenteil. Schon die unkritisierte Erwähnung des Mythos, so entsprechende empirische Experimente, bestärkt diejenigen, die seiner Existenz überzeugt sind, in ihrer Position. Die daraus abgeleitete Empfehlung, den Mythos nicht zu erwähnen, den man gerade zu widerlegen sucht, erscheint aber selbst Cook und Lewandowsky als kommunikationshemmend. Auch aus diesem Dilemma ergibt sich aber, dass die Kommunikation von verstehbaren und prägnant dargestellten Fakten von hoher Bedeutung ist. Als gelungenes Beispiel für ein Faktum, das evtl. den "Klimawandel-Mythos" erschüttert, nennen die Autoren das Argument, dass 99,9% der "Wissenschaftler", die als Unterzeichner einer Resolution den vom durch Menschen verursachten Klimawandel verneinen, keine Klimawissenschaftler, sondern Personen mit irgendeinem Bachelor- oder Masterabschluss, Lehrer oder Computerexperten sind.
• Ein letzter Fehler in der Kommunikation von Mythen und mit Mythenanhängern ist der so genannte Bestätigungsfehler. Je mehr Menschen eine Position beziehen und verinnerlichen, desto mehr glauben sie nur noch Argumenten, die ihre Ausgangsmeinung stützen und werden durch Gegenargumente oft nur noch darin bestärkt. Es kommt dann zum dritten "backfire effect", dem "worldview backfire effect". Als Mittel, auch hier noch aufklärerisch tätig sein zu können, empfehlen die Psychologen u.a., ein anderes "framing", d.h. das Vermeiden von Reizworten und Nutzen unverfänglicherer Begriffe. US-Republikaner dürfe man nicht mit den Begriffen "Klimawandel oder -steuer" überzeugen wollen, sondern müsse z.B. von Kohlendioxidausgleich reden. Ein wichtiger Hinweis ist der, dass das faktengestützte Entlarven eines Mythos Lücken im Geist derjenigen hinterlässt, die sich überzeugen lassen. Man dürfe es daher nicht beim Entlarven belassen, sondern müsse alternative Erklärungen für die sozialen oder natürlichen Phänomene anbieten.
Die Beschäftigung mit Mythen und ihrer Widerlegung oder Entlarvung ist nach Kenntnis der hier vorgestellten Erkenntnisse zwar noch einmal wesentlich anspruchsvoller, aufwändiger und langwieriger geworden, keinesfalls aber hoffnungsloser was mögliche Erfolge betrifft. Da Mythen erheblich durch das ständige Wiederholen im Alltag durch unterschiedlichste Personen und Institutionen am Leben erhalten bleiben, darf auch die Gegenaufklärung nicht aus noch so starken Einmalaktionen bestehen, sondern sollte das Gebetsmühlenhafte im Prinzip übernehmen. Ob man im Einzelfall allen Empfehlungen des Handbuchs folgt, kann jeder für sich entscheiden. Sie sollten aber als Anregungen verstanden werden, mehr als bisher über die dort geschilderten Barrieren und Blockademechanismen für eine rationale Gegenaufklärung zu verbreiteten Mythen und Irrtümern nachzudenken. Wichtig ist dabei, dass man den sozialen Nutznießern von Mythen wenigstens das Argument wegnimmt, es gäbe keine Fakten, die gegen diese Mythen sprächen. Dies ist deshalb wichtig, weil damit die Protagonisten von Mythen ihre Positionen verstärkt durch ihre Interessen begründen müssen und sich nicht mehr hinter naturhaften Abläufen oder angeblich politikfreien Sachzwängen verstecken können.
Wer mehr dazu lesen will, kann das neun Seiten umfassende und zum Teil anschaulich illustrierte "The Debunking Handbook. von Cook, J. und Lewandowsky, S. in der aktuellsten zweiten Version vom 23. Januar 2012 kostenlos herunterladen. Wer auf die Website "Sceptical Science" geht, findet dort für die "Backfire-Thesen" zahlreiche Kommentare und weitere Links von Lesern des Handbuches.
Bernard Braun, 6.2.12
Wenn Deutschland die Ärzte ausgehen, dann bestimmt nicht durch Abwanderung! Daten zum In- und Outflow im Gesundheitswesen
 In zahlreichen Diskussionen über den Fachkräftemangel, Pflegenotstand oder Ärztemangel in Deutschland spielt die Mobilität von Angehörigen dieser Berufsgruppen aus anderen Ländern und in andere Länder eine quantitativ und qualitativ entscheidende Rolle. So wie der heutige und erst recht der prognostizierte Mangel an Krankenschwestern und -pfleger nur durch einen "brain drain" aus Osteuropa, Thailand oder China verhinderbar erscheint, gilt die Flucht deutscher Ärzte in andere Länder als eine wesentliche und explodierende Determinante aller Varianten des Ärztemangels in Deutschland.
In zahlreichen Diskussionen über den Fachkräftemangel, Pflegenotstand oder Ärztemangel in Deutschland spielt die Mobilität von Angehörigen dieser Berufsgruppen aus anderen Ländern und in andere Länder eine quantitativ und qualitativ entscheidende Rolle. So wie der heutige und erst recht der prognostizierte Mangel an Krankenschwestern und -pfleger nur durch einen "brain drain" aus Osteuropa, Thailand oder China verhinderbar erscheint, gilt die Flucht deutscher Ärzte in andere Länder als eine wesentliche und explodierende Determinante aller Varianten des Ärztemangels in Deutschland.
Wie die Mobilität oder der "in"- und "outflow" von Gesundheitspersonal in und zwischen 17 EU-Ländern wirklich aussieht, spielt in diesen Debatten häufig keine Rolle. Dies liegt aber auch oft am Mangel von verlässlichen und leicht zugänglichen Zahlen.
Dies hat sich nun durch eine Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation bzw. des von ihr geförderten "European Observatory on Health Systems and Policies" erheblich geändert.
Auf Basis einer Vielzahl veröffentlichter aber auch unveröffentlichter Daten kommen die Autoren zu einer Reihe interessanter Einblicke in die wirkliche Quantität und Qualität des "brain drains" von Gesundheitsberufsangehörigen:
• Generell stellen die HerausgeberInnen/AutorInnen den verbreiteten Mangel an Daten und die geringe Tiefe der vorhandenen Daten fest, selbst dort wo heftigste Debatten geführt werden. Zum Beispiel gibt es keine Daten, wie viele der ins Ausland gegangenen Ärzte wieder nach einiger Zeit nach Deutschland zurückkommen, also ähnliche Arbeitsbiografien haben wie viele der in Deutschland tätigen ausländischen ÄrztInnen.
• Entgegen vielen in den Massenmedien breit getretenen Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen führten die EU-Erweiterungen weder zu einem "Überfluten" der Alt-EU-Länder mit Ärzten oder Pflegekräfte aus den osteuropäischen Beitrittsländern noch dort zu einem massiven Beschäftigtenverlust.
• Der Anteil von Gesundheitsbeschäftigten deutscher und ausländischer Herkunft, die im Ausland ausgebildet wurden und von dort nach Deutschland kamen, an allen Gesundheitsbeschäftigten wuchs von rund 3,7% im Jahr 2003 auf 5,5% im Jahr 2008.
• 2008 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 13% aller Gesundheitsbeschäftigten, die in Deutschland arbeiteten, außerhalb Deutschlands geboren worden. Für 2007 gab das Robert Koch Institut auf der Basis von Mikrozensusdaten an, dass 11,5% aller Berufstätigen im Bereich der öffentlichen Gesundheit persönliche Erfahrungen mit Immigration hatten.
• Die Anzahl der deutschen und ausländischen Ärzte, die das deutsche Gesundheitswesen in Richtung Ausland verließen, stieg seit 2000 an. Im Jahr 2008 machten dies absolut 3.065 Ärzte, die rund 1% der aktiven Ärzte repräsentierten. 67% von diesen Ärzten oder 2.054 besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit und kehrten also nicht lediglich in ihre Heimatländer zurück.
• Verglichen mit dem Jahr 2007 wuchs die Anzahl aller (!) ins Ausland gehenden Ärzte um 26%. Diese häufig als Beleg für eine "Explosion" der Ärzte-Emigration kommunizierte Zahl verliert aber schon deutlich an Schrecken, wenn man noch genauer hinsieht: Die Anzahl der deutschen Ärzte, die 2007 in einem anderen Land ihren Dienst antraten, wuchs mit 10% nämlich deutlich geringer.
• Dass die absolut und relativ nicht unbedingt dramatisch hohe Abwanderung im Jahr 2008 keine Eintagsfliege war, sondern seit Jahren auf dem anfangs festgestellten Niveau mal zu- aber auch wieder abnimnmt, belegen die neuesten Daten der Bundesärztekammer für das Jahr 2010: In diesem Jahr wanderten insgesamt 3.241 ursprünglich in Deutschland tätige Ärztinnen und Ärzte ins Ausland ab. Der Anteil der deutschen Ärzte betrug 68,7 % oder 2.227 Personen. Ob diese Zahlen die folgende Quintessenz der 2010 von der Bundesärztekammer und Kassenärztlichen Bundesvereinigung herausgegebenen programmatischen Analyse "Dem deutschen Gesundheitswesen gehen die Ärzte aus! Studie zur Altersstruktur-und Arztzahlentwicklung von Thomas Kopetsch rechtfertigt, bleibt den LeserInnen überlassen: "Zusammenfassend lässt sich feststellen: Es liegen mittlerweile ausreichende und belastbare Daten dafür vor, dass die Abwanderung von in Deutschland tätigen Ärzten ins Ausland in den letzten Jahren auf einem recht hohen Niveau liegt."
• Bei allerdings wesentlich schlechterer Datengrundlage, stellen die Observatory-AutorInnen für die Anzahl der in Deutschland sozialversicherungspflichtig tätigen ausländischen Pflegekräfte und Hebammen eine seit 2003 sinkende Tendenz fest. Ihr Anteil an allen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Pflegekräfte und Hebammen sank zwischen 2003 und 2008 von 3,7% auf 3,4%. Und selbst der Anteil ausländischer PflegehelferInnen sank im selben Zeitraum auf höherem Niveau von 7,6% auf 7%. Insgesamt folgt damit die Beschäftigung ausländischer Pflegekräfte dem bis 2008 generellen Trend zum Abbau von Pflegekräfte-Stellen im Krankenhaus um bis zu 50.000 Personen.
• Die wichtigsten Gründe für die Abwanderung deutscher Ärzte ins Ausland sind nach mehreren dazu vorliegenden Studien nicht monetärer Art. Vor allem spielen die bessere postgraduierte Ausbildung, bessere Arbeitsbedingungen, die Gelegenheiten zur beruflichen Weiterentwicklung und das entspannte Arbeitsklima die entscheidenen Rollen.
Zusätzlich zu den Fallstudien über "Health Professional Mobility and Health Systems. Evidence from 17 European countries" in 17 Alt- und Neu-EU-Ländern (darunter auch ein Report zu Deutschland) enthält der von Matthias Wismar, Claudia B. Maier, Irene A. Glinos, Gilles Dussault und Josep Figueras herausgegebene 632 Seiten-Band noch konzeptionelle Aufsätze zur Methodik und zu den Hauptergebnissen der vergleichenden Analysen.
Bernard Braun, 21.10.11
Möglichkeiten und Grenzen von BürgerInnenbeteiligung in der Gesundheitspolitik und Gesundheitsforschung - Ein Cochrane-Review
 Viele empirische Versuche, die Gesundheitspolitik oder verschiedenste inhaltlich relevante Methoden und Instrumente der gesundheitlichen Versorgung u.a. durch Beteiligung von BürgerInnen bürgerorientierter und vor allem wirksamer zu gestalten, mussten ihren Erfolg niemals im Rahmen systematischer Evaluation nachweisen noch waren veröffentlichte Ergebnisse vor Verzerrungen jedweder Art gefeit.
Viele empirische Versuche, die Gesundheitspolitik oder verschiedenste inhaltlich relevante Methoden und Instrumente der gesundheitlichen Versorgung u.a. durch Beteiligung von BürgerInnen bürgerorientierter und vor allem wirksamer zu gestalten, mussten ihren Erfolg niemals im Rahmen systematischer Evaluation nachweisen noch waren veröffentlichte Ergebnisse vor Verzerrungen jedweder Art gefeit.
Das rechtfertigende Argument, das in den Leistungsbereichen der medizinischen Versorgung angewandte Untersuchungsdesign randomisierter kontrollierter Studien, sei bei sozialen Interventionen oder Beteiligungen nicht einsetzbar, wirkte schon immer vorgeschoben. Selbst wenn also in den Beobachtungsstudien Bemühungen unternommen wurden, den Nutzen der jeweiligen Intervention nachzuweisen, konnte nie ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse durch die Selektivität der untersuchten Akteure oder andere Faktoren verzerrt waren.
Mit dem erstmals 2006 und aktuell im Jahr 2010 geupdateten Cochrane-Intervention Review "Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material" (Nilsen et al. 2010) liegt ein methodisch wie inhaltlich wichtiger Beitrag vor, an dem sich die weitere Erforschung der Praxis von Maßnahmen zur Bürgerorientierung im Gesundheitsbereich messen lassen muss.
Die diesem Review zugrundeliegenden Studien waren randomisierte kontrollierte Untersuchungen, welche die Wirkungen der Einbeziehung von Konsumenten oder Nutzer und verschiedene Methoden der Beteiligung bei der Entwicklung von Gesundheitspolitik und bei deren Erforschung, von Leitlinien für die Behandlungspraxis und von Informationsmaterial für Patienten untersuchten.
Die Ergebnisindikatoren der jeweiligen Intervention war die Beteiligungs- oder Antwortrate der Konsumenten, die entdeckten Nutzersichtweisen, der Nutzereinfluss auf Entscheidungen, das gesundheitliche Ergebnis oder der Verbrauch von Ressourcen, die Zufriedenheit der Konsumenten oder professionellen Akteure mit dem Beteiligungsprozess oder den Produkten dieses Prozesses, die Wirkung auf die beteiligten Nutzer und schließlich auch die Kosten.
Die wesentlichen Ergebnisse der sechs reviewten RCTs mit 2.123 TeilnehmerInnen lauten:
• Es gibt mäßige qualitative Evidenz, dass die Beteiligung von NutzerInnen an der Entwicklung von Informationsmaterialien für Patienten zu Produkten führt, die für sie relevanter, lesbarer und verständlicher sind als die sonstigen Materialien, ohne ihnen Angst zu machen.
• Das auf Nutzer-Input beruhende Informationsmaterial kann außerdem das Wissen der Patienten verbessern.
• Außerdem gibt es eine geringe qualitative Evidenz, dass der Einsatz von Interviewern aus den Reihen der Nutzer statt hauptamtlicher Interviewer in Zufriedenheitssurveys einen geringen Einfluss auf die Resultate des Surveys hat. Die Zufriedenheit ist allerdings beim Einsatz von Nutzer-Interviewern etwas geringer. Da es sich dabei um Befragungen von psychisch Kranken handelte, muss die Verallgemeinerbarkeit der Vorteile noch genauer untersucht werden.
• Ebenfalls nur eine geringe qualitative Evidenz gibt es dafür, dass eine von Nutzern mitentwickeltes Dokument für das erklärte Einverständnis mit gesundheitlichen Maßnahmen innerhalb einer wissenschaftlichen Studie im Vergleich mit einem von professionellen ForscherInnen entwickeltem Dokument einen kleinen Vorteil bei der Verständlichkeit der Studienbeschreibung bietet, wenn es überhaupt eine nachweisbare Wirkung eines solchen Dokuments gibt.
• Dafür, dass mündliche Verfahren wie Telefondiskussionen oder face-to-face-Gruppendiskussionen Konsumenten besser in die Prioritätensetzung für kommunale Gesundheitsziele einbeziehen als schriftlich zugesandte Befragungen, lieferten RCTs nur eine sehr geringe qualitative Evidenz. Die unterschiedlichen Beteiligungsmethoden lieferten allerdings unterschiedliche Prioritätenkataloge und hatten insofern eine potenziell manipulative Bedeutung.
Zusammenfassend lässt sich also dreierlei sagen:
• Bisher sind aus den verschiedensten ernst gemeinten oder auch nur vorgeschobenen Gründen wenige Untersuchungen durchgeführt worden, die qualitativ hochwertig untersuchten, welches die besten Wege und Methoden sind, Nutzer und Konsumenten von gesundheitlichen Leistungen auf Bevölkerungsniveau in Entscheidungen über Versorgungsangebote einzubeziehen bzw. sie daran mitwirken zu lassen.
• RCTs sind machbar, um gesichertes Wissen über den Nutzen von Konsumenten- oder Nutzerbeteiligung im Bereich verschiedener Entscheidungen über Elemente der gesundheitlichen Versorgung zu gewinnen.
• Auf dem Niveau der gesamten Bevölkerung liefern die hier reviewten RCTs nur eine sehr kleine Evidenz für die Wirkung von Nutzermitwirkung an Entscheidungen über die Gesundheitsversorgung.
Der Review "Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material" von Nilsen ES, Myrhaug HT, Johansen M, Oliver S, Oxman AD ist in der "Cochrane Database of Systematic Reviews" zuerst 2006 und erneut 2010 erschienen. Kostenlos ist nur ein ausführliches Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 28.7.10
Wie frei dürfen Privatkrankenversicherungen mit ihren Kunden umgehen? Bundesverwaltungsgericht zieht Grenze zugunsten Altkunden
 Vor einigen Wochen wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft ein Gutachten des Berliner IGES-Instituts und des Ökonomen Rürup vorgelegt, das die Private Krankenversicherung u.a. dafür kritisiert, dass sie sich mehr um Neumitglieder kümmert als um Bestandskunden: Indem PKV-Unternehmen die "Spielräume, mit ihrer Tarifangebotspolitik Versichertengruppen mit … systematisch unterschiedlicher Risikostruktur wirksam voneinander zu trennen" nutzen, gelingt es ihnen "den Wettbewerb um Versicherte ganz auf Neukunden zu konzentrieren". Dies führt dazu, dass sie "die Ineffizienzen im Versicherungsangebot noch verstärken."
Vor einigen Wochen wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft ein Gutachten des Berliner IGES-Instituts und des Ökonomen Rürup vorgelegt, das die Private Krankenversicherung u.a. dafür kritisiert, dass sie sich mehr um Neumitglieder kümmert als um Bestandskunden: Indem PKV-Unternehmen die "Spielräume, mit ihrer Tarifangebotspolitik Versichertengruppen mit … systematisch unterschiedlicher Risikostruktur wirksam voneinander zu trennen" nutzen, gelingt es ihnen "den Wettbewerb um Versicherte ganz auf Neukunden zu konzentrieren". Dies führt dazu, dass sie "die Ineffizienzen im Versicherungsangebot noch verstärken."
Das im Zeichen der Kassenwahlfreiheit oftmals für die GKV beklagte vorrangige Kümmern um die "guten Risiken" oder die so genannte "Rosinenpickerei" und entsprechende Wohlfühlangebote für relativ gesunde Versicherte gibt es also auch in der PKV nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch dann, wenn man bereits Versicherter ist. Anders als in der GKV kann sich in der PKV nicht der Staat damit beschäftigen, diese Konzentration auf "gute Risiken" und die damit mehr oder weniger stark verbundene Vernachlässigung der "schlechten Risiken" (meist ältere, sozial schwächere und schwerer Kranke) zu unterbinden. Gesundheitsfonds und morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich, d.h. die - unabhängig ob sie wirklich wie erwünscht wirken - entsprechenden Anreizsysteme für die GKV gibt es für die PKV nicht.
Trotzdem kann auch die PKV nicht so uneingeschränkt zum Nachteil einiger ihrer Kunden operieren wie es sich vielleicht ihre Versicherungs-Betriebswirte wünschen würden. Dies zeigt ein am 23.6.2010 gefälltes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in dem die Rechtsprechung der Praxis eines PKV-Unternehmens einen deutlichen und spürbaren Riegel vorschiebt.
In dem Verfahren ging es darum, dass die private "Allianz"-Krankenversicherung seit März 2007 den neuen Krankenversicherungstarif "Aktimed ("für Kunden, die gerade am Beginn ihrer beruflichen Karriere stehen oder sich selbständig gemacht haben") anbot. Er sieht im Gegensatz zu den bisher bestehenden Tarifen vor, eine niedrigere Grundprämie für sogenannte "beste Risiken" mit einem korrespondierend ausgeweiteten Bereich von individuellen Risikozuschlägen vor. Die Versicherung gewährte diesen Tarif aber lediglich Neukunden.
Die für die Aufsicht von privaten Versicherungsunternehmen auch zuständige BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) verpflichtete darauf die Klägerin, Anträge ihrer Alt-Versicherungsnehmer auf Wechsel aus Tarifen mit gleichartigem Versicherungsschutz in die neuen Tarife ohne Erhebung eines Tarifstrukturzuschlages anzunehmen. Dies dann, soweit bei Vertragsbeginn des alten Vertrags keinerlei Vorerkrankungen, Beschwerden oder sonstige gefahrerhöhende Umstände dokumentiert wurden, die nach den Annahmegrundsätzen für die neuen Tarife zu einem Risikozuschlag führen. Gegen diese Auflage erhob die "Allianz" vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main Klage, die auch erfolgreich ausging.
In dem Revisionsverfahren der BaFin hat das Bundesverwaltungsgericht nun das Urteil des Verwaltungsgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Das entscheidende Argument lautete: "Die Erhebung eines Tarifstrukturzuschlags für Versicherungsnehmer der privaten Krankenversicherung bei Tarifwechsel verstößt gegen zwingendes Versicherungsvertragsrecht. Danach erwirbt der Versicherungsnehmer mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages das Recht, dass der vom Versicherer bei Vertragsbeginn festgestellte Gesundheitszustand im Fall eines Tarifwechsels für die Risikoeinstufung im neuen Tarif maßgeblich bleibt. Die Erhebung eines pauschalen Risikozuschlags aus Anlass des Tarifwechsels ist unzulässig."
Unabhängig davon, ob man gesundheitspolitisch die PKV wirklich kundenfreundlicher haben oder machen will, werden die "Allianz" und eventuelle Nachahmer ihrer bisherigen Praxis jetzt wohl ihre Versicherungskonditionen ändern müssen.
Zu dem Urteil (Aktenzeichen: BVerwG 8 C 42.09) liegt noch keine schriftliche Begründung vor sodass im Moment lediglich die offizielle Gerichts-Pressemitteilung Nr. 50/2010 zum Urteil kostenlos zugänglich ist. Wer an der Begründung interessiert ist, muss nur ab und zu auf die Entscheidungs-Seite des Bundesverwaltungsgerichts schauen.
Bernard Braun, 28.6.10
"Todesursache" Nr. 1: Herzstillstand! Wie groß und inhaltlich folgenschwer ist das Elend der Todesursachenstatistik?
 Zu den Klassikern unter den in der weltweiten Gesundheitsberichterstattung verwandten Indikatoren der gesundheitlichen Lage gehören die Häufigkeit und die Ursachen der Sterbefälle. Damit handelt es sich auch um die meistverwendeten Indikatoren in Gesundheitssystemvergleichen.
Zu den Klassikern unter den in der weltweiten Gesundheitsberichterstattung verwandten Indikatoren der gesundheitlichen Lage gehören die Häufigkeit und die Ursachen der Sterbefälle. Damit handelt es sich auch um die meistverwendeten Indikatoren in Gesundheitssystemvergleichen.
Ebenso klassisch ist aber die Bemerkung, man könne zumindest die Verlässlichkeit oder Validität der Hauptinformationsquelle zu den qualitativen Details der Sterbefälle, nämlich die Todesursachenbescheinigungen "vergessen" - vor allem auch, wenn diese von niedergelassenen Ärzten ausgestellt wurden. Dies bestätigte sich auch in Studien, die die attestierten Todesursachen im Rahmen von Obduktionen überprüften. Zusätzlich zu den daraus ableitbaren Unsicherheitsquoten bei den normalen Todesursachenbescheinigungen, gab es aber Hinweise darauf, dass sowohl intertemporale als auch internationale oder -regionale Todesursachenstatistiken wegen einer Vielzahl von Schwächen mit Vorsicht zu nutzen und zu genießen sind. Wie groß die Vorsicht dabei sein sollte, konnte man bisher aber nicht ausreichend quantifizieren.
Eine gerade erschienene Studie von sechs us-amerikanischen Gesundheitsstatistikern der University of Washington in Seattle schafft hier erheblich Abhilfe. Sie benennen nicht nur die Fehlerquellen, sondern quantifizieren auch die durch sie produzierten Fehleinschätzungen.
Wesentliche Ursachen für die fehlerhafte und qualitativ mängelbehaftete Berichterstattung über Todesursachen selbst in den Ländern mit ausgezeichneten Gesundheitsberichterstattungssystemen gibt es nach den AutorInnen mehrere.
Dazu gehören
• die regelmäßigen Veränderungen der "International Statistical Classification of Disease and Related Health problems (ICD)". Wer die Entwicklung der Sterblichkeit im gesamten 20 Jahrhundert untersuchen will, muss Daten verwenden, die auf der Basis von fünf Versionen der "International List of Causes of Death (ILCD)" und danach von weiteren fünf Versionen der ICD (aktuelle Version ICD 10) bestimmt worden sind. Der Übergang von der reinen Todesursachenklassifikation ILCD zu den Mortalitäts- und Morbiditäts-Klassifikationen ICD 6-10 weitete die Anzahl der Ursachen von 179 auf rund 20.000 aus. Die zunehmende Komplexität und Unübersichtlichkeit trug dazu bei, dass weder im selben Land noch international immer die aktuellste Version benutzt wurde oder die differenzierteren Möglichkeiten gar nicht oder nur zeitverzögert ausgenutzt wurden.
• Um das Problem mit der Fülle von Todesursachen praktisch bewältigen zu können, gab es ab der ICD 6 Kurzformen oder "Kitteltaschenversionen" der ICD-Todesursachen. Deren unterschiedliche Zusammensetzungen und die gleichzeitige Anwendung des gesamten ICD-Katalogs machen die Gewinnung von Zeitreihen von Todesursachen nicht einfacher und inaltlich valide.
• Eine dritte Ursache für die inhaltlichen Mängel von Todesursachenstatistiken folgt aus dem Nebeneinander von Mortalitäts- und Morbiditätsursachen in den ICD-Versionen. Dies meint, dass Ärzte Diagnosen als Todesursachen benennen, die weder aus klassisch medizinischer noch aus Public Health-Sicht wirklich zum Tode führen können. Die WHO-VerfasserInnen der ICD-Klassifikationen haben dem sogar selber Rechnung getragen indem sie im Anhang der ICD-Codes eine "List of conditions unlikely to cause death" einfügten. Trotzdem war damit nach Expertenmeinung das Problem der so genannten "garbage codes" oder des "garbage coding" nicht verschwunden.
Wozu diese Fehler-Ursachen quantitativ führten haben die MedizinstatistikerInnen aus Seattle nun auf der Basis von 4.434 Länderjahren mit Todesursachendaten aus 145 Ländern im Zeitraum von 1901 bis 2008 genauer untersucht. Die Datenbasis umfasste 743 Millionen Todesfälle während des Geltungs- und Nutzungszeitraums der ICD-Versionen 1 bis 10. Die Wissenschaftler erstellten damit länderspezifische Todesursachenlisten und eine Public health-orientierte Todesursachenliste mit 56 Ursachen. Für jede Klassifikationsversion identifizierten sie außerdem die Arten und die Anzahl von "Mülldiagnosen oder -ursachen" und versuchten mit aufwändigen Methoden an ihrer Stelle die wirklichen Ursachen zu eruieren. Dabei unterschieden sie vier Arten von "Müll-Todesursachen" zu denen u.a. eindeutig unzutreffende oder die wahren Ursachen verhüllende Sachverhalte wie der Risikofaktor essentieller Bluthochdruck oder das Herzversagen als letztes Ereignis des Wirkens einer Reihe von Ursachen gehören.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Bemühungen sind:
• Der Anteil von Todesfällen, die mit "Müllursachen" fehlklassifiziert wurden, verändert sich über alle Länder hinweg und auch zwischen den einzelnen ICD-Versionen erheblich.
• Untersucht man die Daten sämtlicher Länderjahre ging der Anteil von "Müllursachen" von 43 % während des Geltungszeitraums der ICD 7 auf 24 % innerhalb der noch laufenden ICD 10-Zeit zurück.
• Im Jahr 2005 variierte der Anteil von falschen bzw. unbrauchbaren Todesursachen zwischen 11 % im austral-asiatischen Bereich und mehr als 50 % in Ländern wie Thailand.
• Die Arten der "Müllursachen" variierten zusätzlich noch erheblich nach dem Alter der Gestorbenen.
• Wenn man versucht, die "Müll-Todesursachen" durch wahrscheinlich tatsächliche Todesursachen zu ersetzen und dann z.B. altersstandardisierte Todesraten neu berechnet, verändern sich beispielsweise internationale Rangreihen nicht unwesentlich: In der Rangreihe der ischämischen Herzerkrankungen verändert sich die Rangfolge von 83 Ländern im Jahr 2005 so: Der Rang von 19 Ländern verändert sich um 2-4 Positionen und der von 49 Ländern um 5 oder mehr Rangpositionen nach oben oder unten. Bei den tödlichen Verkehrsunfällen ist der Effekt noch wesentlich stärker. Noch bedeutender wird die Kontrolle und Korrektur falscher Todesursachen aber im Bereich der nichtübertragbaren Erkrankungen wie z.B. Diabetes wo sich durch die genannten Korrekturen etwa Trendrichtungen in der Zeit umkehren. Ähnlich folgenreich erweisen diese Todesursachenkorrekturen sich beim genauen Timing der sozial- und gesundheitspolitisch relevanten epidemiologischen Transition.
Im Aufsatz und in 5 Anhängen legen die WissenschaftlerInnen umfassende Daten zu den Arten und dem Umfang der "Müll-Todesursachen" und den Folgen ihrer inhaltlichen Korrekturen für die Statistik von 56 Public health-relevanten Diagnosebereichen vor.
Nach Kenntnis der Anzahl falschklassifizierter Todesursachen und nach Kenntnis der inhaltlichen Auswirkungen für die Gesundheitsberichterstattung sollte noch mehr und intensiver als in der Vergangenheit versucht werden, die Diagnosequalität der Todesursachenbescheinigungen durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen für Ärzte und andere damit betraute Personen deutlich zu verbessern.
Der Aufsatz "Algorithms for enhancing public health utility of national causes-of-death data" von Mohsen Naghavi, Susanna Makela, Kyle Foreman, Janaki O'Brien, Farshad Pourmalek und Rafael Lozano ist als "Open access"-Beitrag und damit komplett kostenlos in der Fachzeitschrift "Population Health Metrics" (2010, 8:9) erschienen. Die Anhänge sind durch Links im Text zugänglich.
Bernard Braun, 13.6.10
Zur Kritik der "Versloterhüschelung" der Sozialstaatsdebatte oder wozu eine Feier zum 65. Geburtstag auch dienen kann.
 Wer sich schon mal in Kenntnis der simplen Zahlen des Sozialbudgets über die
Wer sich schon mal in Kenntnis der simplen Zahlen des Sozialbudgets über die
• "ebenso faktenarme wie meinungsstarke Kritik von bekannten Publizisten am Sozialstaat als einem die bürgerliche Elite aussaugenden Vampyr" geärgert hat oder sich fragte woher dies kommt,
• wen die These von Manfred E. Streit, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Ökonomik, soziale Gerechtigkeit sei ein "ordnungspolitisches Ärgernis", das "eine Art von Gesellschaft schaffen (würde), die in allen wesentlichen Belangen das Gegenteil einer freien Gesellschaft wäre" (FAZ 28.5.2008) fassungslos macht und
• wen die seltsame Einigkeit des stets auf talkshowfähige Formulierungen und Begriffe abonnierten bunten Philosophen Sloterdijk mit eher anthrazitfarbenen Wirtschaftswissenschaftlern wie Friedrich Breyer, Bernd Raffelhüschen oder Axel Börsch-Supan über die prinzipielle Untauglichkeit oder Überflüssigkeit des Sozialstaates nachdenklich stimmt,
bekommt in einem am 3. Mai 2010 anlässlich der Feier des 65ten Geburtstags des WZB-Gesundheitswissenschaftlers Rolf Rosenbrock gehaltenen kurzen Vortrag zum Thema "Sozialpolitik und die Ignoranz der gebildeten Stände" des diskursfreudigen Berliner Ökonomen Hartmut Reiners eine Menge Impulse für die notwendige geistige und politische Auseinandersetzung mit diesen Positionen.
Abgerundet wird dies mit der schlüssig belegten These, Sozialpolitik sei eben gerade nicht - wie von den genannten Protagonisten und einer leider nicht kleinen Schar von Kopflangern in deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen, Parteizentralen, Verbänden und Ministerien gebetsmühlenartig verbreitet - eine "Wohltätigkeitsveranstaltung für Bedürftige" (Sloterdijk thematisiert dies im FAZ-Feuilleton [10.6.2009] unter der Überschrift "Revolution der gebenden Hand") oder ein Lohnnebenkostenproblem.
Verlässt man die deutsche Provinz in Freiburg/Breisgau, Karlsruhe und anderswo, stellt man fest, dass eine Fülle international renommierter Ökonomen, Soziologen und Sozialpolitikforscher (Sen, Bourdieux, Esping-Andersen u.v.a.) Sozialpolitik in den reichen Gesellschaften völlig anders, nämlich als "Infrastrukturpolitik mit unverzichtbaren Investitionen in die allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung" verstehen.
Der Vortrag "Sozialpolitik und die Ignoranz der gebildeten Stände" von Hartmut Reiners ist hier komplett erhältlich.
Bernard Braun, 5.5.10
Handwörterbuch und Lehrbuch "Sozialmedizin - Public Health"
 Trotz des im internationalen Vergleich beträchtlichen "Spätstarts" in den 1990er Jahren gibt es mittlerweile an deutschen Hochschulen eine Fülle von Bachelor- und Masterstudiengängen für Public Health, Öffentliche Gesundheitswissenschaften und verwandte Fachgebiete (z. B. Gerontologie). Die nachholende Entwicklung und die tatsächliche oder auch nur vermutete Nachfragesituation für AbsolventInnen dieser Studiengänge tragen dazu bei, dass die Bemühungen um ein eigenständiges Profil dieser wissenschaftlichen Disziplin gegenüber so hegemonialen und wirkmächtigen Disziplinen wie der Medizin oder der Ökonomie zugunsten einer Ausdifferenzierung in erfolgreicher erscheinenden Sub- oder Teildisziplinen vernachlässigt werden. Die Frage, "was alles zu Public Health gehört" und wie man verhindert, dass rein additive Konzepte lediglich zu einer untauglichen Ansammlung von Halb- oder Drittelwissen in drei bis sieben akademischen Fachgebieten führen, wird entweder nicht, nicht mehr oder nicht gründlich genug gestellt.
Trotz des im internationalen Vergleich beträchtlichen "Spätstarts" in den 1990er Jahren gibt es mittlerweile an deutschen Hochschulen eine Fülle von Bachelor- und Masterstudiengängen für Public Health, Öffentliche Gesundheitswissenschaften und verwandte Fachgebiete (z. B. Gerontologie). Die nachholende Entwicklung und die tatsächliche oder auch nur vermutete Nachfragesituation für AbsolventInnen dieser Studiengänge tragen dazu bei, dass die Bemühungen um ein eigenständiges Profil dieser wissenschaftlichen Disziplin gegenüber so hegemonialen und wirkmächtigen Disziplinen wie der Medizin oder der Ökonomie zugunsten einer Ausdifferenzierung in erfolgreicher erscheinenden Sub- oder Teildisziplinen vernachlässigt werden. Die Frage, "was alles zu Public Health gehört" und wie man verhindert, dass rein additive Konzepte lediglich zu einer untauglichen Ansammlung von Halb- oder Drittelwissen in drei bis sieben akademischen Fachgebieten führen, wird entweder nicht, nicht mehr oder nicht gründlich genug gestellt.
Ein Ausdruck dieser Situation sind die geringe Anzahl und die relativ geringe inhaltliche Variation der Überblicks- und Einführungswerke zu Public Health. Für ein Verständnis von Public Health, das sozialmedizinische, epidemiologische, sozialökonomische, sozialrechtliche und medizin- wie organisationssoziologische Sicht- und Handlungsweisen integriert, liegen fast gleichzeitig ein erstmals veröffentlichtes Lehr- und Lernbuch sowie ein im Mai 2010 bereits in zweiter Auflage erscheinendes Handwörterbuch vor, die diesen Anspruch jeweils unter dem Titel "Sozialmedizin und Public Health" erheben.
Das hauptsächlich von dem Sozialmediziner Jens Uwe Niehoff (Berlin), dem Sozialrechtler Felix Welti (Neubrandenburg) und dem Sozial- und Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun (Bremen) verfasste "Handwörterbuch Sozialmedizin und Public Health" beschäftigt sich aus nationaler wie zum Teil internationaler Sicht mit den "Grundlagen der Gesundheitssicherung, der Gesundheitsversorgung, des Gesundheitsmanagements, der Steuerung und der Regulation im Gesundheitswesen". In über 500 mehr oder weniger ausführlichen, theoretisch wie empirisch argumentierenden Stichwörtern wollen die Autoren ein "möglichst gutes Instrument für den Gebrauch des eigenen Verstandes" liefern und wollen dazu u.a. durch explizite Kommentierungen zentraler Sachverhalte beitragen. Dem Verständnis von Wissenschaft als Kritik entspricht auch das Selbstverständnis, dass "Übereinstimmung oder die Vermeidung konfligierender Auffassungen … ausdrücklich kein gewählter Maßstab" ist.
Wer sich einen Überblick zu den bearbeiteten Stichwörtern verschaffen will, findet hier das Stichwortregister des Handwörterbuches.
Das samt Stichwortregister 325 Seiten umfassende "Handwörterbuch Sozialmedizin und Public Health" erscheint zu einem Ladenpreis von 29 Euro im Mai 2010 im Nomos-Verlag Baden-Baden.
Obwohl es sich bei dem von dem Sozialmediziner David Klemperer (Regensburg) unter Mitarbeit des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlers Bernard Braun (Bremen) verfassten "Lehrbuch für Gesundheits- und Sozialberufe - Sozialmedizin - Public Health" um ein aus sieben großen Kapiteln bestehendes Werk handelt, geht es auch ihm darum "Lust auf mehr zu machen und zu Vertiefung und Eigenstudium anzuregen". Dies ist verbunden mit einem bewussten Verzicht auf Vollständigkeit und einem kritischen verstehenstheoretischen Votum gegen das so genannte "Bulimie-Lernen" in verschulten Massenstudiengängen. Dort erfolgt die Aneignung von Wissen fast ausschließlich mit dem Ziel, "Stoff in großen Mengen ins Kurzzeitgedächtnis zu pressen, ihn in der Prüfung (meist Klausuren mit Multiple Choice-Charakter) von sich zu geben und danach schnell wieder zu vergessen". Dies sei "ineffektiv", einer wissenschaftlichen Hochschule "unwürdig" und eine "Verschwendung von Lebenszeit".
Was stattdessen "Wissenschaftlichkeit" im Bereich von Gesundheit und Krankheit meint und welche Bedeutung dabei Alltagserfahrungen, Zweifel und Skepsis, Fehlschlüsse und unsystematische Beobachtung und nicht zuletzt Interessenkonflikte oder die Kluft von Wissen und Handeln haben, wird bereits im ersten Kapitel dargestellt. Dem schließen sich Kapitel über die Epidemiologie, evidenzbasierte Medizin und Praxis, das Gesundheits- und Krankheitsverständnis, Prävention, soziale Ungleichheit und das Gesundheitssystem wie die Gesundheitspolitik an.
Durch die, wenn möglich durchgängige Verlinkung von Thesen und Argumenten mit Originalquellen, versucht das Buch bequeme Zugänge für ungezügelte Neugier zu schaffen. Daran Interessierte können sich in einer Art Schneeballmethode tiefer in Themen einarbeiten.
Wer sich anschauen will, mit welcher Methodik diese Prinzipien umgesetzt werden, kann sich unter anderem das mit zahlreichen aktiven Links versehene Literaturverzeichnis des Buches und das komplette Kapitel "Soziale Ungleichheit der Gesundheit" auf der Website www.sozmad.de anschauen.
Das 335 Seiten umfassende Buch "Sozialmedizin - Public Health. Lehrbuch für Gesundheits- und Sozialberufe" ist im Februar 2010 mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention zum Ladenpreis von 24,95 Euro im Hans Huber Verlag Bern erschienen und wird vom Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin empfohlen.
Gerd Marstedt, 27.4.10
US-Studie zum legalisierten Verkauf von Organen: Ärmere wären sehr viel eher bereit, eine Niere zu spenden
 Während hierzulande der Vorstoß des Ordinarius für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth, Peter Oberender, zur Legalisierung bezahlter Organspenden nur kritische Debatten und zumeist ablehnende Stellungnahmen nicht nur kirchlicher Würdenträger auslöste (vgl. Legalisierter Organverkauf als neuer Weg der Armutsbekämpfung?), ist eine US-amerikanische Forschungsgruppe aus Philadelphia schon deutlich weiter. Sie überprüfte in einer Befragung, welche Faktoren die Bereitschaft zu einer Organspende (Niere) beeinflussen können.
Während hierzulande der Vorstoß des Ordinarius für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth, Peter Oberender, zur Legalisierung bezahlter Organspenden nur kritische Debatten und zumeist ablehnende Stellungnahmen nicht nur kirchlicher Würdenträger auslöste (vgl. Legalisierter Organverkauf als neuer Weg der Armutsbekämpfung?), ist eine US-amerikanische Forschungsgruppe aus Philadelphia schon deutlich weiter. Sie überprüfte in einer Befragung, welche Faktoren die Bereitschaft zu einer Organspende (Niere) beeinflussen können.
Drei Informationen wurden in der Studie systematisch variiert und unterschiedlich ausgestaltet: Die in Aussicht gestellte finanzielle Belohnung, die Mitteilung über die mit der Organspende verbundenen Risiken und der Hinweis, ob Empfänger der Niere ein Verwandter oder ein unbekannter Empfänger auf einer Warteliste ist. Überprüft wurde außerdem, ob die Einkommenssituation der Befragungsteilnehmer eine Rolle spielt. In der Auswertung zeigte sich, dass alle drei Faktoren eine große Rolle spielen für die Bereitschaft, eine Niere zu spenden. Darüber hinaus wurde aber auch deutlich, dass Befragte mit sehr niedrigem Einkommen unter allen Bedingungen die größte Bereitschaft zur Organspende artikulieren.
Basis der Befragung waren Interviews mit zufällig in Bussen und Bahnen angetroffenen Berufspendlern im Großraum Philadelphia. Von 550 angesprochenen Pendlern erklärten sich 415 zum Interview bereit. Da nicht alle in gesundheitlicher Hinsicht für eine Organspende in Frage kamen - wie die Befragung später zeigte - wurden schließlich Daten von 342 Männern und Frauen im Alter von durchschnittlich 33 Jahren ausgewertet. In den Befragungen wurden eine Reihe sozio-ökonomischer und gesundheitlicher Aspekte erfragt und darüber hinaus sehr unterschiedliche Informationen vorgegeben, um zu klären, welche dieser Informationen die Bereitschaft zu einer Nierenspende wie stark beeinflusst. Variiert wurde:
• die in Aussicht gestellte Höhe der finanziellen Prämie: keine Prämie, 10.000 Dollar, 100.000 Dollar
• die Information über die Höhe gesundheitlicher Risiken (späteres Nierenversagen mit der Folge dauerhafter Dialysen oder einer Transplantation): 0,1%, 1%, 10%
• der Hinweis, ob die gespendete Niere einem Familienmitglied zugute kommt oder einem Unbekannten auf einer Warteliste.
In einer multivariaten Analyse, in der diese drei Variablen, aber auch noch eine Reihe weiterer Faktoren überprüft wurden, zeigten sich dann folgende Ergebnisse.
• Die Nähe zum Empfänger hatte den allerstärksten Einfluss, die Wahrscheinlichkeit einer Spende war neun Mal so hoch, wenn der Empfänger ein Familienmitglied war.
• Sehr bedeutsam war auch der Effekt des Gesundheitsrisikos.
• Nicht ganz so stark, aber immer noch statistisch signifikant waren Einflüsse der Prämienhöhe.
• Das Alter der Befragten spielte keine Rolle, wohl aber das Geschlecht: Bei Frauen lag die Wahrscheinlichkeit zu einer Spendenbereitschaft 1,5mal so hoch wie bei Männern.
• Eine überaus große Rolle spielte schließlich auch die finanzielle Situation der Befragten (vgl. Grafik). Bei niedrigem Einkommen lag diese Bereitschaft unter allen Bedingungen deutlich höher als bei Wohlhabenden. 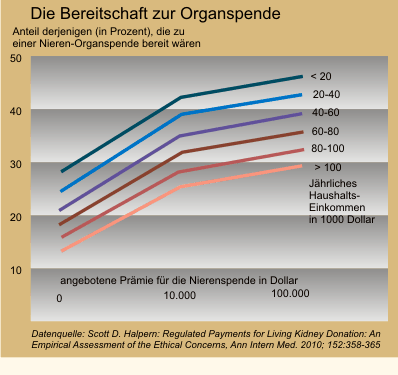
Speziell dieses Ergebnis wird nun jedoch von den Forschern heruntergespielt, wenn sie in der Diskussion ihrer Befunde hervorheben, dass ärmere Befragungsteilnehmer durch eine Steigerung finanzieller Anreize nicht stärker motiviert werden als dies bei wohlhabenderen Teilnehmern der Fall ist. ("Providing payments did not preferentially motivate poorer persons to sell a kidney, suggesting that payment does not represent an unjust inducement—one that would put substantially more pressure on poorer persons than on wealthier persons." S. 363)
Tatsächlich sind weniger gut verdienende Befragungsteilnehmer (siehe Grafik) unter allen Bedingungen eher bereit zur Organspende, was jedoch auch heißt: Bei einer sehr hohen Prämie sind knapp die Hälfte der Befragten aus dieser Gruppe mit niedrigem Einkommen potentielle Spender, aber weniger als ein Drittel der Gruppe mit hohem Einkommen. Und was wäre wohl das Ergebnis gewesen, wenn die Stichprobe nicht aus einer Stichprobe pendelnder Berufstätiger mit relativ gesichertem Einkommen bestanden hätte, sondern auch noch die Ärmsten in der US-Bevölkerung, Arbeits- und Obdachlose, einbezogen hätte?
Prof. Eckhard Nagel (Mitglied des Deutschen Ethikrates und Leiter des Transplantationszentrums des Klinikums Augsburg) hat in einem Interview mit Deutschlandradio Kultur festgestellt: "Also ich finde den Weg von Peter Oberender, so wie er ihn vorschlägt, mit dem regulierten Markt völlig absurd, und glaube auch, dass es ein Zeichen für eine Verödung unseres Geistes ist, wenn man glaubt, man müsse alles mit der Ökonomie regeln." Und dem ist wenig hinzuzufügen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Scott D. Halpern et al: Regulated Payments for Living Kidney Donation: An Empirical Assessment of the Ethical Concerns (Ann Intern Med. 2010;152:358-365)
In einem Essay im SPIEGEL Online "Wenn Menschen sich selbst ausschlachten" argumentieren auch der Bio-Ethiker Christian Illies und der Medizinprofessor Franz Weber entschieden gegen einen freien Organhandel.
Gerd Marstedt, 9.4.10
Ansätze der Regionalisierung von sozialer Sicherung
 Im Zuge der anhaltenden Globalisierung und mit beständigem Anstieg der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und der Migration entstehen nicht nur neue Herausforderungen für die Gesundheit, sondern zunehmend auch für die soziale Absicherung der Menschen. Soziale Sicherungssysteme sind traditionell auf nationalstaatlicher Ebene angelegt und werden den sich verändernden Anforderungen in der globalisierten Welt immer weniger gerecht. Um den neuen internationalen Herausforderungen besser begegnen zu können, schließen sich die Länder weltweit in regionalen Wirtschaftblöcken zusammen, die in erster Linie verbesserten Handelsbeziehungen und forcierter Wirtschaftsentwicklung dienen. Über die ökonomischen Ziele hinaus bieten regionale Wirtschaftsblöcke aber auch die Erfordernis und die Chance, die soziale Absicherung der BürgerInnen zu verbessern und insbesondere auf die gesamte Region auszuweiten. Dies hängt allerdings von den jeweils vorhandenen Gesellschaftsvorstellungen, Werten und Prioritätensetzungen ab. Ein soeben erschienener Artikel aus The Open Health Services and Policy Journal untersucht die sozialpolitischen Strategien und Erfahrungen der Europäischen Union (EU), des südamerikanischen MERCOSUR und der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA. Gerade aus der recht unterschiedlichen Entwicklung dieser drei Wirtschaftsblöcke lassen sich grundlegende Lehren und Empfehlungen ableiten, deren Bedeutung in Zukunft zweifellos steigen wird.
Im Zuge der anhaltenden Globalisierung und mit beständigem Anstieg der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und der Migration entstehen nicht nur neue Herausforderungen für die Gesundheit, sondern zunehmend auch für die soziale Absicherung der Menschen. Soziale Sicherungssysteme sind traditionell auf nationalstaatlicher Ebene angelegt und werden den sich verändernden Anforderungen in der globalisierten Welt immer weniger gerecht. Um den neuen internationalen Herausforderungen besser begegnen zu können, schließen sich die Länder weltweit in regionalen Wirtschaftblöcken zusammen, die in erster Linie verbesserten Handelsbeziehungen und forcierter Wirtschaftsentwicklung dienen. Über die ökonomischen Ziele hinaus bieten regionale Wirtschaftsblöcke aber auch die Erfordernis und die Chance, die soziale Absicherung der BürgerInnen zu verbessern und insbesondere auf die gesamte Region auszuweiten. Dies hängt allerdings von den jeweils vorhandenen Gesellschaftsvorstellungen, Werten und Prioritätensetzungen ab. Ein soeben erschienener Artikel aus The Open Health Services and Policy Journal untersucht die sozialpolitischen Strategien und Erfahrungen der Europäischen Union (EU), des südamerikanischen MERCOSUR und der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA. Gerade aus der recht unterschiedlichen Entwicklung dieser drei Wirtschaftsblöcke lassen sich grundlegende Lehren und Empfehlungen ableiten, deren Bedeutung in Zukunft zweifellos steigen wird.
So kann man die EU im Bereich Gesundheits- und Sozialpolitik trotz der Kontroversen und zum Teil berechtigten Kritik an der Ausrichtung des Lissabon-Vertrags zweifelsohne als sozialpolitischen Pionier der Freihandelszonen bezeichnen. Auch wenn Gesundheits- und Sozialpolitik bis heute eine Angelegenheit der Mitgliedsstaaten ist, sind vielerorts grenzüberschreitende Versorgungs- und Sicherungsstrukturen gewachsen. Vor allem aber sind mittlerweile viele soziale Ansprüche, die EU-Bürger in einem Land erworben haben, in allen Staaten der Gemeinschaft einlösbar, beispielsweise Rentenansprüche und medizinische Versorgung. Der MERCÒSUR (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay sowie Venezuela als formales und Bolivien, Chile und Peru als assoziierte Mitglieder) ist zwar von dieser Portabilität von sozialen Ansprüchen und regionaler sozialer Absicherung noch meilenweit entfernt, hat aber einige Regelungen eingeführt, die der zunehmenden Migration insbesondere aus den ärmeren in die wohlhabenderen Mitgliedsstaaten Rechnung trägt. Die MERCOSUR-Länder beobachten sehr aufmerksam die Geschehnisse in Europa und verfügen bei aller Unterschiedlichkeit der sozialen und ökonomischen Entwicklung über vergleichbare sozialstaatliche Vorstellungen. Dies kann man von der NAFTA nicht behaupten, die in starkem Maße von den USA geprägt ist und deren Freizügigkeiten sich bis heute Güter und Dienstleistungen, aber nicht auf Menschen bezieht. Wo die reichen Länder die Migration aus dem ärmsten Mitgliedsstaat unterdrücken bzw. ausschließlich nach eigenem Bedarf zulassen, besteht kein spürbarer Bedarf an grenzüberschreitender sozialer Sicherung. Die Tatsache, dass die USA bis heute ein sozialpolitisches Entwicklungsland sind, das im Unterschied sowohl zu Kanada als auch zu Mexiko keinen Anspruch auf universelle Krankenversicherung durchsetzen konnte, wirkt sich hemmend auf die Regionalisierung der sozialen Sicherung in der NAFTA aus.
Der Artikel The Potential of Regional Trade Agreements for Extending Social Protection in Health: Lessons Learned and Emerging Challenges ist kostenfrei in der Open-Access zeitschrift The Open Health Services and Policy Journal 2, pp. 84-93 herunterzuladen.
Den Download ohne weitere Suche in der Online-Zeitschrift können Sie hier starten.
Jens Holst, 17.12.09
Was kostet die Interaktion mit privaten Krankenversicherern Ärzte und weiteres Praxispersonal in den USA an Zeit und Geld?
 Eine der vielen Ursachen für die mittlerweile fast 16 % des Bruttoinlandprodukts, die in den USA auf Gesundheitsausgaben entfallen, ist der gegenüber öffentlichen und kollektiven Versicherungssystemen höhere Verwaltungsaufwand der überwiegend (aber bei weitem nicht komplett) privaten einzelvertraglichen Absicherung gegen Erkrankungsrisiken. Hier dachte man meist an die Aufwändungen für Vertreter, Vertragsabschlüsse und andere Aquisitions- und Haltekosten und die enormen Kosten für Anwälte und Haftpflichtversicherungen im amerikanischen Gesundheits- und Rechtssystem.
Eine der vielen Ursachen für die mittlerweile fast 16 % des Bruttoinlandprodukts, die in den USA auf Gesundheitsausgaben entfallen, ist der gegenüber öffentlichen und kollektiven Versicherungssystemen höhere Verwaltungsaufwand der überwiegend (aber bei weitem nicht komplett) privaten einzelvertraglichen Absicherung gegen Erkrankungsrisiken. Hier dachte man meist an die Aufwändungen für Vertreter, Vertragsabschlüsse und andere Aquisitions- und Haltekosten und die enormen Kosten für Anwälte und Haftpflichtversicherungen im amerikanischen Gesundheits- und Rechtssystem.
Weniger dachte und wusste man bis jetzt an und von den Folgekosten, die den Leistungserbringern durch die komplexe Interaktion mit den verschiedenen überwiegend privaten (überwiegend deshalb, weil sich die staatlichen Versicherungssysteme Medicare und Medicaid zum Teil auch privater "health plans" bedienen) Krankenversicherungsanbietern und deren zahlreichen Einzel- oder selektiven Verträgen mit Ärzten und Krankenhäusern entstanden.
Dies hat sich jetzt durch zwei von der "Robert Wood Johnson Foundation's Changes in Health Care Financing and Organization (HCFO)-Initiative" und dem "Commonwealth Fund" unterstützten Untersuchungen über den Zeitaufwand und dessen Geldäquivalent von Verwaltungskräften und Ärzten in Gesundheitseinrichtungen grundlegend und präzise geändert, deren Ergebnisse im neuesten Heft der renommierten Public Health-Zeitschrift "Health Affairs" bzw. der neuesten "Web Exclusive"-Ausgabe dieser Zeitschrift enthalten sind.
In der einen Studie untersuchten Lawrence P. Casalino zusammen mit Kollegen vom Weill Cornell Medical College mittels einer 2006 durchgeführten Befragung von 895 (von als repräsentativ für die Zielgruppe geltenden 1.939 angeschriebenen Personen antworteten also 49,8% [roh] bzw. 57,5% [adjustiert]) Ärzten (1.310) und Verwaltungskräften medizinischer Gruppenpraxen (629), den Zeitaufwand, der für das Einholen von Behandlungserlaubnissen, das Ausfüllen von Arzneimittelformularen, Anforderungen, Ermächtigungen, Vereinbarungen und die Dokumentation von Qualitätsdaten von und für Versicherungsunternehmen aufgebracht werden musste:
• Die Ärzte mussten dafür insgesamt 142 Stunden oder rund drei Wochen pro Jahr und Kopf aufwenden. Durchschnittlich waren dies wöchentlich 3 Stunden. Der Aufwand bei primary care-Ärzten betrug 3,5 Stunden, bei Fachärzten 2,6 Stunden und bei Chirurgen 2,1 Stunden.
• Das Pflegepersonal verwendete pro Jahr und Arzt mehr als 23 Wochen für derartige Verwaltungsaufgaben und
• das Büropersonal war sogar 44 Wochen pro Arzt und Jahr mit diesen Aufgaben beschäftigt.
• Wenn man diese durch private Versicherungsverhältnisse anfallenden Arbeitsaufwände monetarisiert, kosten sie jährlich rund 31 Milliarden US-$ oder 68.274 US-$ pro Arzt und Jahr. Der genannte Betrag stellt 6,9% aller Ausgaben für Ärzte und klinische Dienstleistungen in den USA dar. Dieser Anteil ist immerhin sechsmal so hoch wie die gesamten jährlichen Ausgaben der US-Bundesregierung für das "Children's Health Insurance Program (CHIP)".
• Fast drei Viertel der Befragten gaben an, dass sich ihr Aufwand für Interaktionen mit "health plans" in den vergangenen zwei Jahren zugenommen hatte.
Da in der Studie ein Teil der niedergelassenen Ärzte und sämtliche stationär tätigen Ärzte und Verwaltungskräfte ausgeschlossen waren, also 163.000 Ärzte und ihr Pflege- und Verwaltungspersonal, dürfte der absolute Betrag für die Verwaltungsgeschäfte mit Krankenversicherungen in jedem Fall noch deutlich höher sein. Würde man auch noch die für diese Interaktionen notwendigen technischen Geräte (Telefon, EDV etc.) hinzurechnen, wäre der Betrag noch höher.
Zum Schluss ihrer Studie geben Casalino et al. aber auch noch zu bedenken, dass man administrative Kosten nicht nur als negativ und Arbeitszeitverschwendung betrachten sollte, sondern auch die damit verbundenen Möglichkeiten der Kostenersparnis und der Qualitätsverbesserung in Betracht ziehen sollte. Obwohl es für Ärzte sehr lästig und teuer ist mit verschiedenen Versicherungen und ihren Verwaltungsroutinen zurecht zu kommen könnten gerade der dahinter stehende Wettbewerb Nutzen im Bereich von Innovation oder der erweiterten Wahlmöglichkeiten von Patienten produziert werden. Ob dies tatsächlich der Fall ist oder reine Theorie oder Wettbewerbs-Apologetik ist bedarf allerdings nach Ansicht der AutorInnen erst der empirischen Überprüfung.
In einer separaten zweiten Fall-Studie eines von Julie Sakowski am Sutter Health Institute for Research and Education geleiteten Forschungsteams, fand sich, dass die mehr als 500 Ärzte in einer großen medizinischen Versorgergruppe (medical group) in Kalifornien mehr als 35 Minuten pro Tag aufbringen mussten, um Rechnungsfragen und Versicherungsaufgaben zu erledigen. Diese Aktivitäten erforderten zusätzlich noch rund zwei Drittel der Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Verwaltungskraft pro vollbeschäftigtem Arzt.
83% des nichtklinischen Personals widmeten ihre Arbeitszeit ausschließlich der Abrechnung von Leistungen und Versicherungsaktivitäten.
2006 beliefen sich die Kosten für die Abrechnung und Versicherungskontakte auf 85.276 US-$ pro Vollzeit-Arzt oder auf 10% des gesamten Versorgungsaufwands der Praxis.
Als mögliche Lösung der Kompliziertheit und damit auch Fehleranfälligkeit sowie der Kosten des bisherigen Systems schlagen die WissenschaftlerInnen vor: "Within a multipayer system, adopting fully standardized plan features and procedures offers the best hope of major efficiencies in billing/insurance administration."
Auch wenn viele der Abläufe und Probleme in den USA wegen der deutlich anderen Strukturen nicht oder nicht 1:1 auf das bundesrepublikanische System übertragbar sind, verdienen die Problemsicht und die angedachten Lösungen im Zeichen der politisch gewollten Ausdehnung oder Vervielfachung selektiver und damit Einzelverträge mehr Beachtung als viele andere internationale Erfahrungen. Wenn deutsche Ärzte schon bei den Disease Management-Programmen (DMP) über einen zu hohen Verwaltungsaufwand klagten, wird es bei Ärzten, die demnächst mit 10 oder auch 27 verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen unterschiedliche Hausarzt- und andere Versorgungsverträge mit individuellen Inhalten und Verwaltungsabläufen haben werden, nicht anders, sondern eher noch aufwändiger werden.
Der Aufsatz "Peering into the Black Box: Billing and Insurance Activities in a Medical Group" von Julie A. Sakowski, James G. Kahn, Richard G. Kronick, Jeffrey M. Newman, und Harold S. Luft ist am 14. Mai 2009 in der Web Exclusive-Ausgabe der Zeitschrift "Health Affairs" (w544-w554) erschienen. Zu ihm gibt es kostenlos ein Abstract, eine zweiseitige Zusammenfassung "In the Literature" beim Commonwealth Fund oder auch die Komplett-Version als PDF-Datei.
Der Aufsatz "What Does It Cost Physician Practices to Interact with Health Insurance Plans?" von Lawrence P. Casalino, Sean Nicholson, David N. Gans, Terry Hammons, Dante Morra, Theodore Karrison, und Wendy Levinson, M.D. ist ebenfalls am 14. Mai 2009 in der Zeitschrift "Health Affairs" (28, Nummer 4: w533-w543) erschienen. Von ihm gibt es auch eine zweiseitige Zusammenfassung beim Commonwealth Fund, ein Abstract und die kostenlose Komplettversion.
Bernard Braun, 17.5.09
"Priority Setting" in acht Gesundheitssystemen: Größte Schwachstelle ist die mangelhafte Beteiligung der Öffentlichkeit
 In den Gesundheitssystemen zahlreicher Länder fanden und finden mehr oder weniger offene oder intensive Diskussionen über die explizite oder implizite Rationierung gesundheitlich notwendiger Versorgungsleistungen (und nur dies ist strenggenommen Rationierung und nicht die Verweigerung jeder beliebigen Leistung) oder die Prioritätensetzung bei diesen Leistungen sowie die damit verbundenen Fragen der Gerechtigkeit und Effizienz solcher Maßnahmen statt.
In den Gesundheitssystemen zahlreicher Länder fanden und finden mehr oder weniger offene oder intensive Diskussionen über die explizite oder implizite Rationierung gesundheitlich notwendiger Versorgungsleistungen (und nur dies ist strenggenommen Rationierung und nicht die Verweigerung jeder beliebigen Leistung) oder die Prioritätensetzung bei diesen Leistungen sowie die damit verbundenen Fragen der Gerechtigkeit und Effizienz solcher Maßnahmen statt.
Egal, welche Absichten man bezüglich der Rationierung verfolgt, ob was man von ihr lernen will der Argumente gegen sie sucht, kann erst eine gründliche Analyse der unterschiedlichen nationalen Diskurse Hinweise auf ihre jeweiligen Erfolge und Misserfolge oder die Bedingungen ihres Scheiterns liefern.
Diese Untersuchung führten nun zwei Philosophen aus Norwegen und den USA für acht Länder, nämlich Norwegen, Schweden, Israel, die Niederlande, Dänemark, Neuseeland, Großbritannien und den US-Bundesstaat Oregon, für deren expliziten Bemühungen um eine Priorisierung der Allokation von Ressourcen im Gesundheitswesen durch.
Die dort entwickelten Herangehensweisen lassen sich in eine Variante unterscheiden, die sich darauf konzentriert, Prinzipien herauszuarbeiten und eine andere Variante, bei der es darum geht praktische Übungen und den Wissenserwerb zu definieren.
Um überhaupt Lehren aus den Erfahrungen mit Rationierung in diesen Ländern gewinnen zu können, sahen sich die Forscher vier Aspekte genauer an: Wie sah der Prozess des "priority settings" aus? Was waren die Kriterien aus mit denen der Erfolg dieser Bemühungen bewertet wurden? Welche Herangehensweise wurde mit diesen Kriterien am besten getroffen? Wie kommt man unter Nutzung der Erfolge und des Scheiterns am besten im Prozess einer Rationierung voran?
Zu den zentralen Kriterien mit den die Rationierungsdiskurse und -politiken untersucht und eingeordnet wurden gehörte die ausdrückliche Bitte für einen öffentlichen Input und die Förderung einer öffentlichen Diskussion und Bildung, die Einrichtung der Prinzipien und ihres Einfluss auf Politik und Versorgungspraxis.
Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Prioritätensetzungsgeschehen in diesen Ländern lauten:
• Es zeigte sich, dass es nur eine geringe Evidenz dafür gibt, dass die Etablierung eines Wertekatalogs für "priority setting" irgendeinen Effekt auf die Gesundheitspolitik gehabt hat.
• Ebenso wenig Evidenz hatten Priorisierungsübungen aber auf das damit ins Auge gefasste Ideal einer offenen, partizipativ-öffentlichen Einmischung in die Entscheidungsfindung.
- Die Einrichtungen, die sich in den verschiedenen Ländern etabliert haben, um bei der Steuerung des Rationierungsprozesses und seiner Implementation mitzuwirken, waren relativ erfolgreich.
• Am wenigstens Wirkung auf Politik und Praxiswelt zeigten die ersonnenen und platzierten "priority setting"-Prinzipien bzw. ein Priorisierungsrahmen.
• Die dritte Schlussfolgerung aus den acht Fallstudien kommt relativ nüchtern zum Schluss, dass trotz aller Attraktivität und der u.a. in der Priorisierungsliteratur zu beobachtenden Begeisterung für eine öffentliche Beteiligung von BürgerInnen an diesen Prozessen diese kein fester und wirksamer Bestandteil der Priorisierungsorganisation ist.
• In den meisten Ländern wurden daher regelbasierte und -legitimierte Bewertungsprozeduren durch outcomelegitimierte Bewertungen ersetzt, die Beteiligung der Öffentlichkeit zurückgefahren und stattdessen Experten-Zirkel gestärkt und die Einmischungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit auf den Fall offensichtlicher Fehler in der Entwicklung von Rationierungsvorschlägen begrenzt.
• Eine wichtige Quintessenz: "The examination of the prioritization efforts discussed in this paper, however, leads us to conclude that implementation of public discussion and open and transparent deliberative processes has not been achieved" und der Versuch einer Lösung unter Berücksichtigung der öffentlichen Beteiligung: "In light of this, one of the main challenges for the priority setting field would be propose appropriate levels of public involvement and appeal that is much less extensive than the usual rhetoric suggests, but that still ensures that decisions reached are legitimate. One key element for appropriate public involvement would probably be transparency in providing reasons for decisions."
Die Untersuchung enthält knappe Darstellungen und Bewertungen der acht nationalen Priorisierungs-Szenarien, fragt aber praktisch nirgendwo nach, ob und in welcher Intensität der Zwang über Rationierung diskutieren zu müssen und praktische Vorschläge zur Rationierung liefern zu müssen eigentlich gerechtfertigt ist. So berechtigt die kritische Darstellung und Auseinandersetzung mit der mangelnden öffentlichen Beteiligung also auch ist, so problematisch ist die dargestellte Konzentration auf eine zum guten Teil technische Optimierung der Beteiligung der Öffentlichkeit.
Die dreizehnseitige Darstellung der Analysen erschien als Aufsatz unter dem Titel "Priority setting in health care: Lessons from the experiences of eight countries" von Lindsay M Sabik und Reidar K Lie bereits am 21. Januar 2008 im Onlinebereich der Zeitschrift International Journal of Equity Health" und ist komplett und kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 3.12.08
Wie weit ist die Theorie von "choice and price competition" auf Gesundheitsmärkten von der Wirklichkeit entfernt? Die Schweiz!
 Wahlmöglichkeiten oder -freiheiten in Märkten, auf denen Krankenversicherungen agieren, sind eine zweiseitige oder gar zweischneidige Angelegenheit: Auf der einen Seite suggeriert die ökonomische Theorie, dass dann, wenn es mehrere konkurrierende Versicherer oder Versicherungsangebote gibt, die Versicherungsprämien niedriger sind und der Markt effizienter funktioniert. Außerdem hätten Konsumenten dann eine bessere Chance Angebote zu finden, die ihren Präferenzen entsprechen, wenn Versicherungen in der Lage sind unterschiedliche Leistungspakete anzubieten. Andererseits drohten Konsumenten dann, wenn die Wahlmöglichkeiten zunehmen von ihnen überwältigt zu werden und nicht mehr in der Lage zu sein, das preisgünstigste und bedarfsgerechteste Angebot zu finden. Insgesamt drohen Fehlentscheidungen bei der Wahl einer Krankenversicherung, die weitreichende negative Folgen für den einzelnen Versicherten und den Anbieter haben.
Wahlmöglichkeiten oder -freiheiten in Märkten, auf denen Krankenversicherungen agieren, sind eine zweiseitige oder gar zweischneidige Angelegenheit: Auf der einen Seite suggeriert die ökonomische Theorie, dass dann, wenn es mehrere konkurrierende Versicherer oder Versicherungsangebote gibt, die Versicherungsprämien niedriger sind und der Markt effizienter funktioniert. Außerdem hätten Konsumenten dann eine bessere Chance Angebote zu finden, die ihren Präferenzen entsprechen, wenn Versicherungen in der Lage sind unterschiedliche Leistungspakete anzubieten. Andererseits drohten Konsumenten dann, wenn die Wahlmöglichkeiten zunehmen von ihnen überwältigt zu werden und nicht mehr in der Lage zu sein, das preisgünstigste und bedarfsgerechteste Angebot zu finden. Insgesamt drohen Fehlentscheidungen bei der Wahl einer Krankenversicherung, die weitreichende negative Folgen für den einzelnen Versicherten und den Anbieter haben.
Wenn sich also Versicherungsanbieter und Versicherungsleistungen im Krankenversicherungsbereich differenzieren, steht nicht unbedingt oder automatisch fest, ob es sich dabei um eine positive oder negative Entwicklung handelt.
Umso wichtiger sind empirische Untersuchungen von realen Versicherungs-Märkten und den dort erkennbaren Entwicklungen. Wenn es solche Analysen überhaupt gibt, sind es zumeist Fallstudien aus einzelnen Ländern oder sogar nur Teilen ihres Krankenversicherungsgeschehens. Auch wenn die damit gewonnenen Erkenntnisse nicht repräsentativ sind, sind diese aussagefähiger oder wirklichkeitsnäher als die platonischen und apodiktischen Aussagen vieler ökonomischer Modelle.
Da auch im deutschen Krankenversicherungsmarkt seit 1993 Wahlfreiheiten bestehen, die durch die seit kurzem bestehenden Möglichkeiten selektiver Verträge und Wahltarife nochmals wesentlich in Richtung eines "Tarifdschungels" - so die eher skeptische Bewertung der Entwicklung - erweitert werden, besteht auch hierzulande ein gesteigertes Interesse, mehr über den Nutzen oder die unerwünschten Effekte von Wahlfreiheiten zu erfahren.
Dies wird durch die Ergebnisse einer Studie befriedigt, welche die US-Ökonomen Richard Frank und Karine Lamiraud unter dem Titel "Choice, Price Competition and Complexity in Markets for Health Insurance" als Working Paper 13817 des US-"National Bureau of Economic Research (NBER)" im Februar 2008 veröffentlicht haben. Sie untersuchen darin die Empirie und den Wert der Wahlmöglichkeiten in Krankenversicherungsmärkten am Beispiel der Schweiz.
Kurz dargestellt sieht der Krankenversicherungsmarkt in der Schweiz zum Zeitpunkt der NBER-Untersuchung so aus. Er ist auf der Ebene von Kantonen organisiert. Versicherer bieten dort ein weitgehend standardisiertes, umfassendes Leistungspaket an, das ambulante, stationäre und Pflegeleistungen umfasst. Jeder Versicherer setzt seinen eigenen Beitragssatz fest, der für alle Individuen derselben Altersgruppe im betreffenden Kanton gleich sein muss und auch für künftige Versicherte gelten muss. Alle BürgerInnen sind versicherungspflichtig und hatten in der Untersuchungszeit die Wahl zwischen rund 30 Versicherungsplänen oder -paketen. Die Versicherten können ihre Versicherung unaufwändig in der jährlichen Wahl- oder Wechselperiode wechseln. Preisinformation sind umfassend und verständlich erhältlich und ein Versicherungswechsel beeinträchtigt normalerweise in keiner Weise den Zugang des Wechslers zu einzelnen Ärzten.
Dies alles vorausgesetzt, wäre für den Schweizer Krankenversicherungsmarkt eigentlich ein aktiver Preiswettbewerb zu erwarten. Das Gegenteil trifft aber zu: Der Markt ist durch große und sich hartnäckig erhaltenden Preisunterschiede zwischen den Angeboten/Anbietern geprägt. Im Jahre 2004 hätte ein Wechsel zwischen dem billigsten und teuersten Krankenversicherer eine Beitragsdifferenz von nahezu 20 % erbracht. In einem Kanton betrug dieser Unterschied sogar 80% des durchschnittlichen Beitrages. Noch unerwarteter: Die Wechselrate war sehr gering, nämlich rund 3 % pro Jahr.
Was erklärt nun diese großen Beitragsunterschiede und die gleichzeitig geringe Wechselrate?
• Eine der möglichen Standarderklärungen der ökonomischen Theorie, hohe Such- und Wechselkosten, spielen nach Meinung der Autoren in der Schweiz keine wesentliche Rolle.
• Eine wesentliche plausiblere Erklärung liegt dagegen mit Erkenntnissen der neueren Forschung zum menschlichen Verhalten in ökonomischen Kontexten vor. Diese Forschung hat nachgewiesen, dass dann, wenn komplexe ökonomische Entscheidungen von weitreichender Bedeutung gefällt werden müssen, ein Zustand der Wissensüberfülle bzw. -überforderung ("cognitive overload") eintreten kann und Ängste vor falschen Entscheidungen auftreten. Beide Faktoren zusammen können zu einer Zurückhaltung vor Entscheidungen führen und damit zur "Wahl" des Status quo. Dieses Entscheidungs- bzw. Nichtentscheidungsverhalten geht u.a. mit einer Unterschätzung der Gewinne und einer Überschätzung der Verluste einher, die mit einem Versicherungswechsel verbunden gesehen werden.
Ob diese Erklärung auch für das tatsächliche Geschehen in der Schweiz zutrifft, untersuchen die Autoren auf der Basis einer Haushaltsbefragung zum Wechselgeschehen in den Jahren 1997-2000 und Informationen der Versicherer über ihre Angebote.
Die Wissenschaftler entdeckten dabei, dass Wechselraten vor allem und ausgerechnet dann konsistent niedriger sind, wenn die Versicherten mehr Wahlmöglichkeiten besitzen. Dies gilt selbst dann, wenn die Versicherten mit ihrem aktuellen Versicherungsunternehmen unzufrieden waren. Diese Ergebnisse unterstreichen nachdrücklich die praktische Relevanz der "decision overload theory". Die daneben ebenfalls bestehende Bedeutung von Preisunterschieden für das Wechselverhalten zeigt sich darin, dass im beschriebenen Rahmen mehr gewechselt wurde, wenn die Preisunterschiede zunahmen.
Die Autoren zeigen, dass Wechsler ihre Beiträge im Vergleich zu den Kassenverbleibern um durchschnittlich 16 % verringerten. Dies heißt aber, dass viele Versicherte durch ihren Nichtwechsel "leave money on the table" - und zwar nicht zu wenig.
Wenn der Preis aber offensichtlich für viele Schweizer BürgerInnen nicht der wichtigste entscheidungssteuernde Faktor ist, stellt sich die Frage was dann schwerer wiegt?
• Die Möglichkeit von Qualitätsunterschieden verwerfen die Autoren unter Hinweis auf die gewollt minimalen Qualitätsunterschieden im schweizerischen Versicherungsmarkt.
• Eine ähnlich geringe Rolle spielt danach die Erwartung, dass ein Versicherungsunternehmen dauerhaft im Markt präsent ist (angesichts der Insolvenz einiger Unternehmen in der Vergangenheit ein denkbarer Faktor).
• Ein weiterer entscheidungssteuernder Faktor könnte der Wunsch sein, sich ähnlich wie eine bekannte Personengruppe zu verhalten. Dafür spricht die Tatsache, dass 40 % der Haushalte sagten, sie träfen ihre Entscheidung auf der Basis der Entscheidungen und Empfehlungen von Angehörigen oder Freunden oder aus Tradition.
• Schließlich könnte auch die Größe des bisherigen Versicherers eine Rolle spielen: Nichtwechsler finden sich eher in großen nationalen Versicherungsunternehmen.
Die US-Ökonomen ziehen aus diesen empirischen Resultaten zwei Schlussfolgerungen. Erstens und etwas allgemeiner: "One implication of these results is that expanding choice to very large numbers is likely to reduce the effectiveness of consumer decision-making which may in turn result in larger markups by health insurers." Zweitens auf den Zuwachs der Wahlmöglichkeiten im US-Versicherungsmarkt bezogen: "At a moment in history when elderly Americans are facing large numbers of choices in private health plans and prescription drug plans our findings may offer some cautions regarding the need for decision support and mechanisms that simplify such health insurance choices."
Obwohl die Autoren also empirisch eine Fülle von strukturell wirkenden Hindernisse für eine Steuerung durch Wahlfreiheiten auf komplexen Versicherungsmärkten liefern, halten auch sie nach dem Motto "die Hoffnung stirbt zuletzt" verwunderlicherweise an der scheinbar uneingeschränkten Machbarkeit oder Funktionsfähigkeit der Wahlfreiheit und des Preiswettbewerbs fest oder glauben, durch technische und organisatorische Detailkorrekturen die offensichtlich hemmenden Bedingungen korrigieren zu können.
Gerade auf der Basis der Erkenntnisse ihrer Fallstudie müssen sich Frank und Lamiraud die Frage gefallen lassen: Wie oft muss sich eigentlich ein ökonomisches Modell empirisch als nicht funktionierend oder gescheitert erweisen bevor es selbst für gescheitert gilt?
Von der Studie "Choice, Price Competition and Complexity in Markets for Health Insurance" gibt es kostenlos nur ein Abstract im "NBER Bulletin on Aging and Health", Heft 2 2008.
Wer die komplette Studie lesen will, der kann sie als PDF-Datei durch die Onlinezahlung von 5 US-$ über das "Social Science Research Network" elektronisch beziehen.
Wer außerdem wissen will, wie das GKV-System der Kassenwahlfreiheit funktioniert bzw. welche massiven Wechselbarrieren es hierzulande gibt, findet einige interessante Erkenntnisse in der bereits im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellten Studie von Wissenschaftlern des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen und der Universität Duisburg-Essen (Braun, Greß, Rothgang, Wasem).
Bernard Braun, 12.11.08
Sozialversicherungsschutz als "bürokratisches Hemmnis": "Unternehmerfreundliche" Abschaffung der Künstlersozialkasse vorgeschlagen
 Seit 25 Jahren gibt es im deutschen Sozialversicherungsssystem die Künstlersozialkasse (KSK). Wegen der besonderen sozialen Situation freiberuflicher Künstler und Publizisten, die u.a. durch ein nichtstetiges und aktuell bei durchschnittlich 12.616 Euro liegendes Jahreseinkommen charakterisiert ist, wurde dieser spezielle und weltweit einmalige Träger für die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung dieser Berufsgruppen 1983 geschaffen.
Seit 25 Jahren gibt es im deutschen Sozialversicherungsssystem die Künstlersozialkasse (KSK). Wegen der besonderen sozialen Situation freiberuflicher Künstler und Publizisten, die u.a. durch ein nichtstetiges und aktuell bei durchschnittlich 12.616 Euro liegendes Jahreseinkommen charakterisiert ist, wurde dieser spezielle und weltweit einmalige Träger für die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung dieser Berufsgruppen 1983 geschaffen.
Die derzeit rund 160.000 Mitglieder zahlen nur die Hälfte ihrer Beiträge, während die KSK als Arbeitgeber agiert und die andere Hälfte bezahlt. Sie bekommt wiederum 20 % dieser Summe aus dem Bundeshaushalt und die restlichen 80 %, also insgesamt 40 % der gesamten Beiträge, stammen von den Unternehmen, die mit Erzeugnissen und Dienstleistungen von Künstlern etc. ihre Geschäfte machen, also von Galerien, Verlagen, Plattenfirmen, Theater, Orchester oder Museen. Diese so genannten Verwerter, und dies ist im aktuellen Zusammenhang wichtig, sind also eine Mischung aus Klein-, Mittel- und Großunternehmen.
Die KSK geriet spätestens dann ins Gerede und wurde in Frage gestellt als im Jahr 2007 zum einen auch Firmen zur Kasse gebeten wurden, die auf Honorarbasis z. B. Grafiker für ihre Werbeplakate engagierte und wegen der erkennbaren Zahlungsverzüge von zahlungspflichtigen Unternehmen stärkere Kontrollen der Zahlungspflichten und Zahlungserfüllung durch die Deutsche Rentenversicherung erfolgte. Der Anfangserfolg der Nachzahlung von 13 Millionen Euro und die dahinter steckenden Informationsdefizite oder auch Verweigerungshaltungen lassen ahnen, dass noch weitere Millionen nachträgliche Zahlungen zu erwarten sind.
Der ohne Zweifel damit und mit der zukünftig korrekten Zahlung verbundene Verwaltungsaufwand war der Auslöser für einen in der Geschichte der deutschen Sozialversicherungssysteme erst- und einmaligen Versuch der Auflösung eines Sicherungsystems. Einmalig aber keineswegs nur auf die KSK gemünzt ist die dafür bemühte Begründung.
Anlass ist der "Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft (Drittes Mittelstandsentlastungsgesetz)", über den mit Unterstützung von sieben Bundesländern und mehrerer Bundesratsausschüsse am 19. September in der 847. Sitzung des Bundesrates abgestimmt werden soll.
In einer "Empfehlung" (Bundesratsdrucksache 558/1/08) von 7 Bundesländern und mehreren Bundesratsausschüssen für die Verabschiedung (Bundesratsdrucksache 558/1/08)" wird die Auflösung der KSK als eine konkrete Entlastungsmaßnahme empfohlen.
Die entscheidende Passage lautet:
"Der Bundesrat fordert, dass die Künstlersozialversicherung abgeschafft oder zumindest unternehmerfreundlich reformiert wird. Der Aufwand bei der Feststellung der Abgabenpflicht und bei der Durchführung des Verfahrens, die verstärkten Kontrollen durch die Deutsche Rentenversicherung bei der Ermittlung der abgabepflichtigen Unternehmen sowie die Verpflichtung zur Beantwortung eines mehrseitigen Fragebogens führen zu einer großen Bürokratie. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind durch die nun flächendeckend erfolgende Erfassung diesem bürokratischen Aufwand ausgesetzt. Der Aufwand überschreitet die erzielten Mehreinnahmen der Künstlersozialkasse erheblich und ist damit unangemessen hoch. Außerdem besteht infolge der komplizierten gesetzlichen Regelungen keine Klarheit über den Umfang der Abgabepflicht. Die Höhe der Kosten bei der Auftragsvergabe von Leistungen, die eventuell unter die Abgabepflicht fallen können, ist für Auftraggeber nicht genau kalkulierbar. Nicht nachvollziehbar ist, dass die Abgabepflicht in mehreren Fällen auch dann besteht, wenn der betroffene Künstler, Grafiker oder Publizist gar nicht bei der Künstlersozialversicherung versichert ist. Hinzu kommt die große Verunsicherung der Unternehmen im Hinblick auf die rückwirkende Abgabepflicht für fünf Jahre. Die Nachforderungssummen haben inzwischen eine Höhe von über 13 Mio. Euro erreicht. Der lange Rückwirkungszeitraum wird der Tatsache nicht gerecht, dass bisher über den Umfang der Abgabeverpflichtung in der Künstlersozialversicherung nicht ausreichend aufgeklärt wurde."
Ohne ein Wort über die soziale Notwendigkeit des KSK-Versicherungsschutzes zu verlieren oder wenigstens theoretisch über Alternativen nachzudenken, stilisiert der Bundesrat die Unternehmerfreundlichkeit der Prozedur zu einem, wenn nicht gar zum entscheidenden Kriterium einer Sozialversicherung. Mit diesem Argument könnte man nach Abschaffung der KSK im Prinzip auch die Versicherungsträger für Nichtkünstler wie etwa die gesetzlichen Krankenkassen abschaffen.
Bernard Braun, 11.9.2008
DIW-Studie 2007: Soziale Aufstiegschancen nicht größer als vor 20 Jahren, gefühlte soziale Sicherheit deutlich gesunken.
 Zur den objektiven (Finanzierung) wie subjektiven (Systemzufriedenheit) Existenz- und Funktionsbedingungen eines Sozialversicherungssystems à la Deutschland gehören u.a.: Eine mit Einkommenszuwächsen aber auch ausgeprägten Gerechtigkeitsempfindungen und -erfahrungen verknüpfte Aufwärtsmobilität sowie die konkrete Erfahrung wie das Gefühl, auch künftig sozial abgesichert zu sein.
Zur den objektiven (Finanzierung) wie subjektiven (Systemzufriedenheit) Existenz- und Funktionsbedingungen eines Sozialversicherungssystems à la Deutschland gehören u.a.: Eine mit Einkommenszuwächsen aber auch ausgeprägten Gerechtigkeitsempfindungen und -erfahrungen verknüpfte Aufwärtsmobilität sowie die konkrete Erfahrung wie das Gefühl, auch künftig sozial abgesichert zu sein.
In Anbetracht dieser Erfordernisse sind die Ergebnisse einer Studie bedenklich, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin im Auftrag des Wirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 10/2008, EVT 19. Juni) durchführte. Die Studie basiert auf Daten des Sozioökonomischen Panels des DIW (SOEP), der mit rund 20.000 Befragten größten regelmäßigen Umfrage zur Lebenslage und Zufriedenheit der Deutschen.
Danach haben sich zum einen zwischen 1987 und 2007 die je nach sozialer Herkunft stark unterschiedlichen Chancen auf eine anspruchsvolle berufliche Position nicht nennenswert verändert. Die Durchlässigkeit der Gesellschaft ist also in Deutschland heute nicht größer als vor 20 Jahren.
Im Einzelnen sieht dies so aus: Zwar sind laut Studie die Aufstiegs-Chancen für Frauen aus der Ober- und Mittelschicht leicht gestiegen. Doch für Frauen aus gering gebildeten Familien sind die Aufstiegschancen etwas gesunken und bei Männern durch alle sozialen Schichten in etwa gleich geblieben. Damit sind sowohl die guten Aussichten von Söhnen aus der Oberschicht zementiert, die es zu zwei Dritteln in interessante Jobs schaffen, als auch die schlechten Chancen von denen aus der Unterschicht, die dies nur zu einem Drittel schaffen. An grundlegenden sozial ungleich verteilten Lebenschancen hat sich also kaum etwas verändert oder sogar einiges zum Negativen hin verändert.
Zum anderen hat das DIW mit den SOEP-Daten untersucht, wie gut die Deutschen sich sozial abgesichert fühlen. Dazu wurde untersucht wie die Bürger den Schutz gegen die Lebensrisiken Krankheit, Gebrechlichkeit, Arbeitslosigkeit und Altersarmut wahrnehmen. Danach ist die gefühlte soziale Sicherheit im Westen wie im Osten in den vergangenen fünf Jahren in allen vier Bereichen gesunken. Auch im Vergleich zu 1987 ist sie im Westen - für den Osten liegen hier keine Daten vor - in drei von vier Bereichen zurückgegangen. Ausnahme ist die Absicherung gegen Gebrechlichkeit, da es 1987 noch keine Pflegeversicherung gab.
Speziell für den Krankheitsschutz zeigte sich dabei: "Die Einschätzung der Absicherung gegen Krankheitsrisiken ist im Zeitverlauf im Westen deutlich rückläufig. Seit etwa Mitte der 1990er Jahre schätzt nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung ihre Absicherung gegen Krankheitsrisiken als gut oder sehr gut ein. Auch im Osten ist - bei insgesamt niedrigerem Niveau - eine leicht negative Entwicklung erkennbar."
Zum Zusammenhang der faktischen und gefühlten sozialen Sicherheit mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit und damit auch der sozialen Handlungsbereitschaft und -fähigkeit hält die DIW-Studie fest: "Eine einfache Analyse der Korrelationen zwischen der (generellen und bereichsspezifischen) Einschätzung der sozialen Sicherheit und der allgemeinen Lebenszufriedenheit zeigt einen extrem starken Zusammenhang auf. Dieser Zusammenhang dürfte … zum Teil in der Persönlichkeit der Befragten liegen: Eine Person, die eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit angibt, dürfte auch eine hohe allgemeine Zufriedenheit mit dem sozialen Sicherungssystem berichten, weil sie ein "zufriedener" Mensch ist. Allerdings behalten in einer multivariaten Analyse auch die bereichsspezifischen Angaben zur eigenen sozialen Absicherung, die auf die tatsächliche Situation der eigenen sozialen Absicherung gegen Lebensrisiken zielt und damit auch weniger stark von Persönlichkeitseigenschaften der Befragten abhängen sollte, ebenfalls deutliche positive Effekte auf die Lebenszufriedenheit. Das erlaubt die Schlussfolgerung, dass die Einschätzungen zur sozialen Sicherung - der eigenen wie der generellen - einen wichtigen Bestandteil der allgemeinen Lebenszufriedenheit bilden."
Die DIW-Studie "Macht die soziale Marktwirtschaft glücklich? Analysen mit dem Sozio-oekonomischen Panel" von Olaf Groh-Samberg umfasst 34 Seiten und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.6.2008
"Medicare macht’s möglich": Welchen gesundheitlichen Nutzen hat ein Krankenversicherungsschutz für vorher unversicherte Personen?
 Jeder glaubt es zwar irgendwie oder ist sich hochplausibel sicher, dass eine obligatorische und verpflichtende Krankenversicherung positive individuelle und letztlich gesellschaftliche Wirkungen hat - nur wissen und vor allem den Nachteil mangelhaften oder fehlenden Versicherungsschutzes kennen tut niemand so richtig. Dies liegt vor allem in Deutschland daran, dass rund 90% in der Gesetzlichen und mindestens 8% in einer Privaten Krankenversicherung vollversichert sind und über die Effekte der Nichtversicherung bei den armen Nichtversicherten wenig oder nichts bekannt ist.
Jeder glaubt es zwar irgendwie oder ist sich hochplausibel sicher, dass eine obligatorische und verpflichtende Krankenversicherung positive individuelle und letztlich gesellschaftliche Wirkungen hat - nur wissen und vor allem den Nachteil mangelhaften oder fehlenden Versicherungsschutzes kennen tut niemand so richtig. Dies liegt vor allem in Deutschland daran, dass rund 90% in der Gesetzlichen und mindestens 8% in einer Privaten Krankenversicherung vollversichert sind und über die Effekte der Nichtversicherung bei den armen Nichtversicherten wenig oder nichts bekannt ist.
Angesichts der gerade mal wieder leicht ansteigenden Anzahl von 47 Millionen dauerhaft oder temporär nicht- oder unterversicherter US-AmerikanerInnen eignet sich im Moment noch die USA makaberer weise besonders dafür, empirisch vergleichende Analysen über die gesundheitlichen Effekte von fehlendem und vorhandenen obligatorischen Krankenversicherungsschutz durchzuführen.
Dabei ist gerade aus den USA bereits bekannt, dass unversicherte BürgerInnen, die beispielsweise an Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes leiden, schlechtere gesundheitliche Ergebnisse haben als vergleichbar erkrankte Krankenversicherte. Ob sich bei den bisher Unversicherten etwas durch einen Versicherungsschutz ändert, wurde aber bisher auch in den USA nicht nachgewiesen.
Eine Gruppe von vorwiegend an Bostoner Hochschulen forschenden Wissenschaftlern um Michael McWilliams führte dazu mit den Daten des national repräsentativen Health and Retirement Surveys für den Zeitraum von 1992 bis 2004 eine quasiexperimentelle Längsschnittanalyse durch. Es handelt sich um Angaben für 5.006 ständig versicherter und 2.227 hartnäckig oder mit kurzen Unterbrechungen unversicherter Personen im Alter von 55 bis 64 Jahren.
Da mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres die meisten vorher nicht versicherten US-BürgerInnen Mitglied der staatlichen Versicherung für RentnerInnen werden, also von Medicare, kann man in den USA den gesundheitlichen Effekt dieses Schutzes messen.
Dazu erfragten McWilliams et al. für alle über 65 Jahre alten StudienteilnehmerInnen eine Reihe von gesundheitlichen Indikatoren: Generelle Gesundheitslage, Veränderungen im Gesundheitszustand, Schmerzen, Beweglichkeit, depressive Zustände und Behendigkeit sowie einen jahresbezogenen Summenwert aller 6 Faktoren. Außerdem erhoben sie das Auftreten unerwünschter kardiovaskulärer Outcomes.
Die Ergebnisse waren eindeutig und signifikant:
• Bisher unversicherte Personen berichteten im Vergleich mit den immer schon Krankenversicherten statistisch hochsignifikant von einer stärkeren Verbesserung ihrer summarisch dargestellten gesundheitlichen Entwicklung und mehrerer Einzelindikatoren mit jedem Jahr nach dem Beginn der Mitgliedschaft bei Medicare (differential change in annual trend, +0,20; P=0,002).
• Auch Herz-Kreislauferkrankte oder DiabetikerInnen unter den bisher Nichtversicherten berichteten im Vergleich von wesentlich stärkeren gesundheitlichen Verbesserung bei ihrer Gesamtgesundheit (differential change in annual trend, +0,26; p=0,006), bei ihrer Beweglichkeit (+0,04; p=0,05) oder bei unerwünschten Kreislaufereignissen (-0,015; p=0,03) aber nicht bei depressiven Symptomen (+0,04; p=0,32).
• Bei den vorher unversicherten jetzigen RentnerInnen ohne eine dieser Vorerkrankungen gab es signifikante ausgeprägtere Verbesserungen bei depressiven Zuständen aber meist nur schwächere Verbesserungen bei allen anderen Indikatoren, die dann auch nicht mehr statistisch signifikant waren.
• Im Alter von 70 Jahren war die mit Eintritt ins Rentenalter ohne Medicare erwartbare Differenz der allgemeinen Gesundheit zwischen versicherten und unversicherten BürgerInnen mit kardiovaskulären Erkrankungen und Diabetes um 50% reduziert.
Der Aufsatz "Health of Previously Uninsured Adults After Acquiring Medicare Coverage" von J. Michael McWilliams; Ellen Meara; Alan M. Zaslavsky und John Z. Ayanian ist gerade im "Journal of American Medical Association (JAMA)" (2007; 298(24): 2886-2894) erschienen. Ein Abstract kann kostenfrei heruntergeladen werden.
Auf der WEbsite des "Commonwealth Fund" ist außerdem eine zweiseitige Zusammenfassung mit weiteren DAten und einer Grafik kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.12.2007
USA: Mit zunehmender Entfernung zum Hautarzt und Armutsrate sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit von Melanompatienten
 Die regionale Präsenz, Dichte und Erreichbarkeit von Ärzten kann positiven oder negativen Einfluss auf die möglichst frühe Entdeckung bestimmter schwerer und "schneller" Erkrankungen haben und die Überlebensprognose verschlechtern:
Die regionale Präsenz, Dichte und Erreichbarkeit von Ärzten kann positiven oder negativen Einfluss auf die möglichst frühe Entdeckung bestimmter schwerer und "schneller" Erkrankungen haben und die Überlebensprognose verschlechtern:
Dies zeigt eine gerade veröffentlichte Studie von Karyn Stitzenberg et al. von der School of Public Health der Universität von North Carolina in Chapel Hill. Mit jedem weiteren Kilometer Entfernung zu einem Hautarzt nimmt auch die für die Prognose einer malignen Melanomerkrankung (der so genannte bösartige "schwarze Hautkrebs") wichtige Dicke bzw. Tiefe der Krebsgeschwulst (die so genannte "Breslow thickness") um 0,6 % zu. In den ländlichen und städtischen Gegenden North Carolinas wo die Gesundheitswissenschaftler den Zugang und den Gesundheitszustand von 615 Melanompatienten untersuchten, betrug die durchschnittliche Entfernung zum Dermatologen und seinen der Erkrankung angemessenen diagnostischen Möglichkeiten (u.a. mit gezielten Biopsien und Zelluntersuchungen) und therapeutischen Fähigkeiten 8 Meilen.
Bei Patienten, die mehr als 15 Meilen fahren mussten, war der Tumor 20 % dicker, was ihre Überlebenswahrscheinlichkeit verringerte. Dies hängt damit zusammen, dass mit wachsendem Durchmesser das Risiko der Metastasenbildung rasch anwächst, und zwar mit jedem Millimeter erheblich.
In der Untersuchung wurde auch nach Assoziationen der Tumordicke mit dem Alter, dem Geschlecht, der sozialen Situation (poverty rate) und der Anzahl der Ärzte in den Regionen der untersuchten Patienten gesucht.
Dabei erwies sich auch die Armutsposition der Patienten als ein spürbarer Einflussfaktor: Mit jedem Prozent, das ein Erkrankter auf der Armutsskala ärmer ist, steigt auch die Dicke des Melanoms um 1 % an. Die Dicke und damit die Gefährlichkeit des Melanoms war nicht mit dem Geschlecht, der Ländlichkeit des Wohnorts an sich oder der allgemeinen Versorgung mit Dermatologen assoziiert.
Zu den Details, die den Zugang erschweren und möglichen weiteren Determinanten muss sicherlich weiter geforscht werden. Der Entfernung zu Leistungserbringern, vor allem wenn es nicht darum geht, ob ein Allgemein- oder Facharzt an jeder oder nur an jeder zweiten "Ecke" erreichbar ist, muss allerdings je nach Krankheit und den möglichen ernsten Folgen in der Angebotsplanung eine höhere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Hier finden Sie das Abstract des Aufsatzes "Distance to Diagnosing Provider as a Measure of Access for Patients With Melanoma" von Stitzenberg et al. in den "Archives of Dermatology" (2007;143:991-998).
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse gibt es in englischer Sprache im Wissenschafts-Informationsdienst "Science daily" und in Deutsch mit weiteren Links im "Deutschen Ärzteblatt".
Bernard Braun, 26.8.2007
Steuerzahlen macht Spaß - und Spenden noch mehr
 Mit einem bemerkenswerten Artikel stellt die renommierte Wissenschaftszeitung Science in ihrer Ausgabe vom 15. Juni 2007 eine der gängigsten ökonomischen Annahmen in Frage. Ein interdisziplinäres Wissenschaftler-Team der Universität Oregon untersuchte die Hirnaktivität während Bildschirm-simulierter Geldtransaktionen. Während jeweils einstündiger funktioneller Magnetresonanztomographie stellten die Forscher vermehrte Aktivität in zwei entwicklungsgeschichtlich älteren Hirnarealen fest, dem Nucleus caudatus und dem Nucleus accumbens. Diese Beobachtung aus dem relativ neuen Verfahren der Neurobildgebung liefert wichtige Erkenntnisse über hirnbiologische Prozesse und wertvolle Hinweise für Ansätze der kognitiven Psychologie.
Mit einem bemerkenswerten Artikel stellt die renommierte Wissenschaftszeitung Science in ihrer Ausgabe vom 15. Juni 2007 eine der gängigsten ökonomischen Annahmen in Frage. Ein interdisziplinäres Wissenschaftler-Team der Universität Oregon untersuchte die Hirnaktivität während Bildschirm-simulierter Geldtransaktionen. Während jeweils einstündiger funktioneller Magnetresonanztomographie stellten die Forscher vermehrte Aktivität in zwei entwicklungsgeschichtlich älteren Hirnarealen fest, dem Nucleus caudatus und dem Nucleus accumbens. Diese Beobachtung aus dem relativ neuen Verfahren der Neurobildgebung liefert wichtige Erkenntnisse über hirnbiologische Prozesse und wertvolle Hinweise für Ansätze der kognitiven Psychologie.
Der Nucleus caudatus gehört zu den so genannten Basalganglien des Gehirns und galt lange Zeit als Teil des Kontrollsystems von Willkürbewegungen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass er auch eine wichtige Funktion im Lern- und Gedächtnissystem spielt; zudem gilt der N. caudatus als Sitz des Vertrauens im Gehirn. Der Nucleus accumbens gehört zum so genannten mesolimbischen System, das an emotionalen Lernprozessen beteiligt ist, wo Glücksgefühle durch Verstärken bestimmter Verhaltensmuster entstehen und eine zentrale Rolle im Lust-, Belohnungs- und Glückssystem des menschlichen Gehirns spielen.
Die beschriebenen neurobiologischen Aktivierungsmuster zeigen etwas Überraschendes: Nicht nur freiwilliges Spenden, sondern selbst Pflichtabgaben lösen Reize im Vertrauens- und Belohnungssystem aus. Dies zieht die grundlegende "Weisheit" der Ökonomie, dass angeblich niemand gerne Geld abgibt und schon gar nicht Steuern bezahlt, erheblich in Zweifel. Und es zeigt, wie beschränkt und "unnatürlich" die Theorie der individualistischen Nutzenmaximierung ist, die ja auch im Sozial- und Gesundheitswesen in den letzten Jahrzehnten überaus erfolgreich Einzug gehalten hat. Allerdings bleibt abzuwarten, ob empirische und quantifizierbare Ergebnisse des brain mapping größere Chancen haben als hinlänglich bekannte Beobachtungen aus der kognitiven Psychologie, wenn es darum geht, den uneingeschränkten Glauben an die pseudowissenschaftliche neoklassische Ideologie einzudämmen.
Einer der Autoren, Ulrich Mayr, meint, das Ergebnis spiegelt den Balanceakt wider, dem jede Gesellschaft ausgesetzt ist: "What this shows to someone who designs tax policy is that taxes aren't all bad. Paying taxes can make citizens happy. People are, to varying degrees, pure altruists. On top of that they like that warm glow they get from charitable giving. Until now we couldn't trace that in the brain."
Leider ist der vollständige Studienbericht mit dem Titel Neural Responses to Taxation and Voluntary Giving Reveal Motives for Charitable Donations nur für Abonennten frei zugänglich; hier finden Sie das Abstract aus Science.
Eine englischsprachige kommentierte Zusammenfassung der Studie findet sich bei Newswise
Jens Holst, 18.6.2007
Ein bißchen konspirativ: Die Arbeit der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft"
 Ausgangspunkt einer bis heute nicht beendeten Debatte über die Zustimmung der Bundesländer zur Gesundheitsreform und insbesondere zum Finanzausgleich zwischen den Ländern war die vom Kieler Ökonomen Thomas Drabinski veröffentlichten Studie über Ökonomische Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die Bundesländer. Vorgestellt wurde die Studie auf einer Pressekonferenz der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft". Dass diese Initiative mit fast schon konspirativ zu nennenden Praktiken versucht, ihre gesellschaftlichen Werte und Zielvorstellungen zu verbreiten, wurde jetzt anhand zahlreicher Beispiele in einem in der Frankfurter Rundschau veröffentlichten Artikel von Sebastian Kutz und Sabine Nehls bekannt: Angriff der Schleichwerber - Die "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" beweist immer wieder ihre perfide Kampagnenfähigkeit. Wichtigster Partner der INSM ist das von den Arbeitgeberverbänden finanzierte "Institut der Deutschen Wirtschaft" in Köln. Zugestanden wird zwar die Finanzierung durch den Arbeitgeberverband Gesamtmetall, immer wieder jedoch auch betont, man vertrete nicht deren Interessen, sondern das gesellschaftliche Gesamtwohl. Pro Jahr stehen der Initiative knapp 9 Millionen Euro zur Verfügung.
Ausgangspunkt einer bis heute nicht beendeten Debatte über die Zustimmung der Bundesländer zur Gesundheitsreform und insbesondere zum Finanzausgleich zwischen den Ländern war die vom Kieler Ökonomen Thomas Drabinski veröffentlichten Studie über Ökonomische Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die Bundesländer. Vorgestellt wurde die Studie auf einer Pressekonferenz der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft". Dass diese Initiative mit fast schon konspirativ zu nennenden Praktiken versucht, ihre gesellschaftlichen Werte und Zielvorstellungen zu verbreiten, wurde jetzt anhand zahlreicher Beispiele in einem in der Frankfurter Rundschau veröffentlichten Artikel von Sebastian Kutz und Sabine Nehls bekannt: Angriff der Schleichwerber - Die "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" beweist immer wieder ihre perfide Kampagnenfähigkeit. Wichtigster Partner der INSM ist das von den Arbeitgeberverbänden finanzierte "Institut der Deutschen Wirtschaft" in Köln. Zugestanden wird zwar die Finanzierung durch den Arbeitgeberverband Gesamtmetall, immer wieder jedoch auch betont, man vertrete nicht deren Interessen, sondern das gesellschaftliche Gesamtwohl. Pro Jahr stehen der Initiative knapp 9 Millionen Euro zur Verfügung.
"Nicht die Parlamentarier sind die Adressaten der Arbeit, sondern vielmehr Meinungsführer in der Gesellschaft", so schreibt die FR. "Die INSM arbeitet fast ausschließlich über die Platzierung ihrer Themen und Botschaften in den Medien. Dazu gehören auch so genannte Medienpartnerschaften, also Kooperationen, bei denen beispielsweise die INSM und eine Zeitung gemeinsam eine Diskussion zu einem aktuellen Thema veranstalten, so genannte Rankings erstellen oder Studien in Auftrag geben und vermarkten (zu nennen sind hier beispielsweise die FAZ und Capital, aber auch die Fuldaer Zeitung und die Zeitschrift Eltern). Gleichzeitig berichtet dann die Zeitung im Vorfeld und im Nachhinein über die Veranstaltung. Sie führt Interviews mit den Diskutanten, die gleichzeitig auch Botschafter der Initiative sind. Einige Gesprächspartner, die gegenteilige Meinungen vertreten, genügen als Feigenblatt. So gibt sich eine von Arbeitgebern finanzierte und bestimmte Öffentlichkeitsarbeit neutral - mit breiter Unterstützung der beteiligten Medien."
Ein wichtiges Instrument der INSM sind die so genannten Botschafter und Kuratoren, die Interviews geben, Gastbeiträge schreiben oder in Talkshows auftreten und so die mit der Initiative verabredeten Argumente unters Volk bringen. Zu diesem Kreis gehören etwa der frühere Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer, der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Martin Kannegiesser, der Finanzexperte von Bündnis 90/Die Grünen Oswald Metzger, der ehemalige Ministerpräsident Lothar Späth oder der Präsident des Hamburgischen Welt-Wirtschaftsinstituts Thomas Straubhaar. Früher einmal beteiligt waren der ehemalige Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, Ex-Minister Wolfgang Clement und der "Professor aus Heidelberg" Paul Kirchhoff.
Als einige Beispiele für die Vorgehensweise der "Schleichwerber" werden in der FR genannt:
• Bei einem in den Medien veröffentlichten Interview mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Freien Universität Berlin unter dem Titel "Beamtentum der Lehrer abschaffen", das vom Journalisten Carsten Seim durchgeführt wurde, blieb vollständig unerwähnt, dass Lenzen Mitglied im Botschafter- und Kuratorenkreis, später dann "Berater" und Mitglied im Förderkreis der INSM war und dass Seim Carsten Seim bereits seit vier Jahren im Dienst der INSM stand.
• 2003 finanzierte die INSM teilweise einen Fernsehdreiteiler des Hessischen Rundfunk über "Märchen" der Sozialpolitik und die Notwendigkeit von Reformen in diesem Bereich, der in der ARD zu sehen war
• Für rund 60.000 Euro wurden in der Vorabend-Soap "Marienhof" Dialoge platziert, die etwa "Eigeninitiative und Flexibilität von Arbeitslosen" oder die "Zeitarbeit" ansprachen. Der "Deutsche Rat für Public Relations" sprach dazu gegenüber der INSM eine öffentliche Rüge aus, die von ihr auch später akzeptiert wurde.
• Die INSM hat auch eine Website Wirtschaft und Schule eingerichtet, auf der sie Unterrichtsmaterial für Lehrer bereitstellt. Das hervorragend aufbereitete Material ermöglicht die Unterrichtsvorbereitung in Rekordzeit, en passant finden so auch die Wertvorstellungen der Initiative Eingang in die Köpfe der Lehrer und Schüler.
Hier finden Sie den kompletten Bericht: Angriff der Schleichwerber - Die "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" beweist immer wieder ihre perfide Kampagnenfähigkeit
Gerd Marstedt, 9.1.2007
Legalisierter Organverkauf als neuer Weg der Armutsbekämpfung?
 Der Ordinarius für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth und Leiter der Unternehmensberatung Oberender & Partner, Peter Oberender, hat sich jetzt in einem Interview mit dem Radiosender Deutschlandradio Kultur dafür ausgesprochen, den Verkauf von menschlichen Organen in geregelter Form zu erlauben. Dies sei nötig, um den Menschen zu helfen, die ein Spenderorgan zum Überleben brauchten. Bereits jetzt gäbe es in Ländern wie Indien einen "grauen Markt", bei dem allerdings 80 Prozent der Spender aufgrund mangelhafter Nachsorge stürben. Überdies würde dies auch dazu beitragen, Armut durch eine Organspende zu verringern: "Wenn jemand existenziell bedroht ist, weil er nicht genug Geld hat, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren, muss er meiner Meinung nach die Möglichkeit zu einem geregelten Verkauf von Organen haben." Es müsse ein geregelter Markt geschaffen werden, bei dem "ähnlich der Börse" festgelegt werde, wer zum Handel zugelassen sei und wer Organe entnehmen dürfe. Außerdem müssten die Organspender selbst abgesichert werden.
Der Ordinarius für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth und Leiter der Unternehmensberatung Oberender & Partner, Peter Oberender, hat sich jetzt in einem Interview mit dem Radiosender Deutschlandradio Kultur dafür ausgesprochen, den Verkauf von menschlichen Organen in geregelter Form zu erlauben. Dies sei nötig, um den Menschen zu helfen, die ein Spenderorgan zum Überleben brauchten. Bereits jetzt gäbe es in Ländern wie Indien einen "grauen Markt", bei dem allerdings 80 Prozent der Spender aufgrund mangelhafter Nachsorge stürben. Überdies würde dies auch dazu beitragen, Armut durch eine Organspende zu verringern: "Wenn jemand existenziell bedroht ist, weil er nicht genug Geld hat, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren, muss er meiner Meinung nach die Möglichkeit zu einem geregelten Verkauf von Organen haben." Es müsse ein geregelter Markt geschaffen werden, bei dem "ähnlich der Börse" festgelegt werde, wer zum Handel zugelassen sei und wer Organe entnehmen dürfe. Außerdem müssten die Organspender selbst abgesichert werden.
Seine Position zur Legalisierung der bezahlten Organspende hat Oberender bereits 2003 in einem Aufsatz "Das belohnte Geschenk - Monetäre Anreize auf dem Markt für Organtransplantate" ausführlicher dargelegt. Dort kommt er sogar zu der Feststellung, dass damit die Schere zwischen Arm und Reich reduziert werden könne: "Erhält der Organgeber Geld für seine Bereitschaft zur Organabgabe, so kann das materielle Gefälle zwischen Arm und Reich sogar vermindert werden. Bedürftigen Familien wird damit die Chance auf ein neues oder zumindest besseres Leben gegeben." (Oberender/Rudolf, S.27) Soziale und gesellschaftsethische Risiken durch den legalen Organhandel werden nicht erkannt, im Gegenteil, die derzeitigen gesetzlichen Regelungen werden sogar als Beschneidung von Freiheitsrechten wahrgenommen: "Innerhalb einer industrialisierten Gesellschaft ist nicht zu befürchten, daß eine Familie so stark unter dem Existenzminimum lebt, daß man sich veranlaßt fühlt, deshalb Körperorgane zu verkaufen. Zu eng ist das Netz der sozialen Sicherungssysteme geknüpft. Einzig der Wunsch über diesem Existenzminimum zu leben, könnte hierfür ausschlaggebend sein. In einem solchen Fall aber handelt es sich um die freie Entscheidung eines Individuums, die es zu akzeptieren gilt. Wird der Handel mit Körperorganen beschränkt, so wird die Freiheit der Individuen eingeschränkt und ihnen die Entscheidungsmacht über ihren eigenen Körper genommen." (ebd. S.27f)
Den Vorschlag Oberenders hat jetzt Eckart Nagel, Leiter des Transplantationszentrums Augsburg und Vize-Vorsitzender des Nationalen Ethikrates, in einem Interview ebenfalls im Deutschlandradio Kultur scharf kritisiert. Er bezeichnete die Idee als "völlig absurd" und fügte hinzu: "Ich glaube auch, dass es ein Zeichen für eine Verödung unseres Geistes ist, wenn man glaubt, man müsse alles mit der Ökonomie regeln." Die Mitschrift des Interviews ist hier zu finden: Organhandel ist eine Perversion
Die Zahl der Transplantationen in Deutschland ist nach Informationen der Deutschen Stiftung Organtransplantation in den vergangenen Jahren gestiegen und lag 2005 bei über 4.000. Derzeit warten allerdings in Deutschland etwa 11.500 Patientinnen und Patienten auf ein Spenderorgan, circa 10.000 auf eine Niere. Die Warteliste für die Nierentransplantation steigt seit Jahren kontinuierlich an, da immer mehr Patienten dialysepflichtig werden.
Oberender hatte bereits im Jahr 2005 auf sich aufmerksam gemacht, als er in einem Gutachten das sog. "Bayreuther Modell" propagierte. Konkret empfohlen wird dort für die Zukunft eine völlige Umgestaltung der GKV-Finanzierung, in der die Gesundheitsausgaben nicht mehr wie derzeit über Generationen hinweg nach dem Solidarprinzip bestritten werden, sondern nach dem in der PKV geltenden Prinzip individueller Risiken. vgl. ausführlicher hierzu den Artikel "Gutachten zur GKV empfiehlt Abwendung vom Solidarprinzip".
• Hier finden Sie den Audio-Mitschnitt des Interviews mit P.O. Oberender im Deutschlandradio Kultur zur Legalisierung der bezahlten Organspende
• Ein Interview mit Oberender hierzu veröffentlichte auch FOCUS-MONEY Nr. 21 (2004): "Eine ethische Lösung"
• Der Aufsatz von Oberender/Rudolf (Diskussionspapier 12-03 Oktober 2003 ISSN 1611-3837) ist hier als PDF-Datei verfügbar: Peter O. Oberender und Thomas Rudolf: Das belohnte Geschenk - Monetäre Anreize auf dem Markt für Organtransplantate
• Ein Nachfolger-Aufsatz ist hier: Peter O. Oberender und Thomas Rudolf, Diskussionspapier 15-05, Oktober 2005, ISSN 1611-3837, Monetäre Anreize für die postmortale Körperorganspende - Eine ökonomische Analyse
Gerd Marstedt, 28.12.2006
Profit statt Prävention! Diabetes - der große Rendite-Reibach.
 Weil nur sehr selten so offen und nicht noch vielfach verklausuliert (z.B. mit der Floskel von der "Jobmaschine Gesundheitswesen") über das große Geschäft mit einer Krankheit geredet wird, sei ausnahmsweise ein Verweis auf derartiges Material gegeben.
Weil nur sehr selten so offen und nicht noch vielfach verklausuliert (z.B. mit der Floskel von der "Jobmaschine Gesundheitswesen") über das große Geschäft mit einer Krankheit geredet wird, sei ausnahmsweise ein Verweis auf derartiges Material gegeben.
"Diabetes & Geld", nach eigenem Bekunden "Deutschlands führender Informationsdienst zum Thema Diabetes, Geld und Börse" begleitet sein Angebot einer "kostenlosen Sonderstudie zum Milliardenmarkt Diabetes" mit dem Titel "Wie Sie mit Diabetes-Aktien ein Vermögen verdienen" mit bemerkenswerten Werbeargumenten.
So zieht der Informationsdienst eine verlockende Verbindung zwischen der Feststellung, es gäbe "jeden Tag 980 neue Diabetiker in Deutschland" oder auch "jeden Tag 31.000 neue Diabetiker weltweit" und der Werbebotschaft, der Kurswert des eigenen "Diabetes-Strategie-Musterdepot (wachse) seit Start 2003 mit durchschnittlich 40% Plus pro Jahr". Bei so viel Zuwachs stört es nicht weiter, dass an anderer Stelle von 30 % jährlichem Zuwachs oder insgesamt seit 2003 von einem Kursplus von 280 % geredet wird.
Hauptsache ist: "Diabetes ist der Megamarkt des 21. Jahrhunderts....Der Insulinmarkt bringt derzeit einen Weltumsatz von 3 Mrd US-Dollar und wächst jährlich um 14%. Im Jahr 2007 wird der Insulinmarkt einen Weltumsatz von über 5 Mrd US-Dollar erreichen. Der Markt für orale Diabetes-Medikamente bringt derzeit jährlich 5,9 Mrd US-Dollar Umsatz und wird sich bis zum Jahr 2007 auf 12 Mrd US-Dollar mehr als verdoppeln. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 19%. Im Vergleich dazu sind die Wachstumsraten in der Automobilindustrie mit 2% geradezu lächerlich."
Und für den, der es noch immer nicht kapiert hat: "Die Konzerne, die mit dieser Krankheit den großen Reibach machen, sind zumeist börsennotiert. Mit einer Beteiligung an solchen Unternehmen können Sie ein Vermögen verdienen."
Wer noch mehr über die Kalküle dieses Typs von Gesundheitswirtschaft erfahren will, kann sich hier die kostenlose Version der Sonderstudie "Wie Sie mit Diabetes-Aktien ein Vermögen verdienen" herunterladen.
Bernard Braun, 12.12.2006
Bielefelder Memorandum Gesundheitswissenschaftler fordern Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten
 Anders als die Protagonisten der meisten letzten Gesundheitsreformen und des "Wettbewerbsstärkungsgesetzes", treten die Erstunterzeichner des so genannten Bielefelder Memorandums zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten dafür ein, "die Verhinderung zunehmender sozialer Spaltung zum obersten Ziel auf der Agenda einer kommenden Gesundheitsreform zu machen." Auch wenn Gesundheitspolitik nur einen Teil dazu beitragen kann, soll die Schaffung "gesundheitlicher Chancengleichheit ... als Messlatte" von Reformen dienen.
Anders als die Protagonisten der meisten letzten Gesundheitsreformen und des "Wettbewerbsstärkungsgesetzes", treten die Erstunterzeichner des so genannten Bielefelder Memorandums zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten dafür ein, "die Verhinderung zunehmender sozialer Spaltung zum obersten Ziel auf der Agenda einer kommenden Gesundheitsreform zu machen." Auch wenn Gesundheitspolitik nur einen Teil dazu beitragen kann, soll die Schaffung "gesundheitlicher Chancengleichheit ... als Messlatte" von Reformen dienen.
Das Memorandum ist entstanden im Zusammenhang der Fachtagung "Health Inequalities" an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld im Mai 2006. In einem Plenum fasste Andreas Mielck seine über 15 Jahre verdichteten Forschungsergebnisse zusammen und leitete zusammen mit dem anschließenden Referat von Klaus Hurrelmann über zu Frage nach den politischen Konsequenzen der gesundheitswissenschaftlichen Einsichten. Drei unterschiedliche Arbeitsgruppen befassten sich außerdem mit den Themen Soziale Ungleichheit und Prävention / Präventionspolitik, Kinder- und Jugendgesundheit sowie Ungleichheiten in der Pflegerischen Versorgung.
Das Graduiertenkolleg der Hans-Böckler-Stiftung organisierte ein paralleles Forum Soziale Ungleichheit: Der blinde Fleck in der Gesundheitsversorgung.
Viele Referate stehen zum Download (meist als Foliendateien) zur Verfügung, darunter u.a.:
• Anton Kunst (Rotterdam): Socioeconomic inequalities in health in Europe: identifying priority areas
• Eero Lahelma (Helsinki): Towards a better understanding of socioeconomic inequalities in health: The importance of multiple dimensions of social position
• Siegfried Geyer (Hannover): Explaining health inequalities
• Marina Steindor (Stuttgart): Gerechte Gesundheitschancen - ein halbherziges Thema über 200 Jahre deutscher Gesundheitspolitik
• Hartmut Remmers (Osnabrück): Ethische Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit gesundheitlicher Versorgungsleistungen
- Susanne Hartung (Bielefeld): Förderung von Sozialkapital als "Präventionsmaßnahme"
• Thomas Lampert (Berlin): Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen: Eine Herausforderung für die Gesundheitspolitik
Hier sind die Referate der Tagung "Health Inequalities"
Hier ist das Bielefelder Memorandum zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten
Bernard Braun, 20.11.2006
Medizin und Ethik
 Die Diskussion ethischer Fragen hat in der Medizin seit einiger Zeit Konjunktur. Publikationen und Kongressberichte weisen auf eine Vielfalt von Themen: Sterben und Tod, Hirntod, Gentherapie und Gentests, Reproduktionsmedizin, unkonventionelle Heilverfahren (Alternativmedizin), Stammzellenforschung, Sterbehilfe (Euthanasie), Klonen beim Menschen, Methoden der Organverteilung in der Transplantationsmedizin, Patientenautonomie und -verfügung, Umgang mit einzelnen Krankheiten wie Aids und Alzheimer-Demenz usw. Zeitgleich zu dieser Entwicklung hat sich in der Medizin ein professioneller Ethikbetrieb etabliert, der in den 90er Jahren boomartig expandierte.
Die Diskussion ethischer Fragen hat in der Medizin seit einiger Zeit Konjunktur. Publikationen und Kongressberichte weisen auf eine Vielfalt von Themen: Sterben und Tod, Hirntod, Gentherapie und Gentests, Reproduktionsmedizin, unkonventionelle Heilverfahren (Alternativmedizin), Stammzellenforschung, Sterbehilfe (Euthanasie), Klonen beim Menschen, Methoden der Organverteilung in der Transplantationsmedizin, Patientenautonomie und -verfügung, Umgang mit einzelnen Krankheiten wie Aids und Alzheimer-Demenz usw. Zeitgleich zu dieser Entwicklung hat sich in der Medizin ein professioneller Ethikbetrieb etabliert, der in den 90er Jahren boomartig expandierte.
Andererseits haben sich etwa seit den 80er Jahren im Gesundheitswesen Versuche durchgesetzt, das Arztverhalten mit Geldanreizen zu steuern. Die finanziellen Steuerungsinstrumente bauen implizit darauf, dass die Ärzte sich bei ihren Entscheidungen, Empfehlungen, Verschreibungen, Über- und Einweisungen primär von den damit verbundenen einzelwirtschaftlichen Gewinnchancen und -risiken leiten lassen. Damit wurde ein Ökonomisierungsprozess in Gang gesetzt, in dem tendenziell die medizinischen und pflegerischen Entscheidungen, Therapien, Empfehlungen usw. durch das ökonomische Vorteilskalkül überformt werden.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich Hagen Kühn vom Wissenschaftszentrum Berlin mit der Frage, inwieweit ein Ethikbetrieb (zum Beispiel in Krankenhäusern und medizinischen Forschungseinrichtungen) überhaupt moralische Normen und Werthaltungen im Gesundheitswesen konstituieren kann, und wenn ja, in welcher Weise? Er kommt zu dem despektierlichen Fazit "Der Kern des Ethikbetriebs besteht in Begründungen und Legitimationen von Entscheidungen, die vordem ohne den Ethikbetrieb getroffen wurden. Ihre wachsende Präsenz in der Klinik ist Zeichen einer Tendenz zu Abspaltung des Moralischen aus dem klinischen Alltagshandeln und der Verwandlung der Ärzte in (subjektive) 'ethische Laien'."
Download der PDF-Datei Hagen Kühn: Der Ethikbetrieb in der Medizin - Korrektur oder Schmiermittel der Kommerzialisierung?
Gerd Marstedt, 30.10.2006