



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Arzt-Patient-Kommunikation |
Alle Artikel aus:
Patienten
Arzt-Patient-Kommunikation
Beeinflusst in den USA die Behandlung durch nicht-weiße Ärzte die Gesundheit nicht-weißer Männer? Ja, und was ist in Deutschland!?
 Afroamerikanische männliche (auch weibliche) US-Bürger leben fast 5 Jahre kürzer als nichthispanische weiße Männer. Rund 60% dieser kürzeren Lebenserwartung beruht auf der höheren Prävalenz chronischer Erkrankungen unter den Afroamerikanern. Ein wiederum großer Anteil dieser Erkrankungen könnte durch präventive Interventionen z.B. durch Veränderungen des Lebensstiles, durch Impfungen oder durch die Nutzung von Früherkennungsuntersuchungen vermieden oder der Zeitpunkt der Erkrankung zeitlich hinausgeschoben werden. Die meisten dieser Maßnahmen setzen aber einen Arztbesuch bzw. eine ärztliche Behandlung voraus. Und damit kommt eine weitere Ungleichheit im us-amerikanischen Gesundheitssystem zur Geltung. Während der Anteil der Afroamerikaner an der Gesamtbevölkerung rund 13% beträgt, gehören nur 4% der Ärzt*innen und 7% der Medizinstudierenden dieser ethnischen (im englischen Originaltext werden hier immer Begriffe wie "race" oder "same-race" benutzt, die im Deutschen negativ belastet sind und deshalb nicht direkt übersetzt werden) Gruppe an.
Afroamerikanische männliche (auch weibliche) US-Bürger leben fast 5 Jahre kürzer als nichthispanische weiße Männer. Rund 60% dieser kürzeren Lebenserwartung beruht auf der höheren Prävalenz chronischer Erkrankungen unter den Afroamerikanern. Ein wiederum großer Anteil dieser Erkrankungen könnte durch präventive Interventionen z.B. durch Veränderungen des Lebensstiles, durch Impfungen oder durch die Nutzung von Früherkennungsuntersuchungen vermieden oder der Zeitpunkt der Erkrankung zeitlich hinausgeschoben werden. Die meisten dieser Maßnahmen setzen aber einen Arztbesuch bzw. eine ärztliche Behandlung voraus. Und damit kommt eine weitere Ungleichheit im us-amerikanischen Gesundheitssystem zur Geltung. Während der Anteil der Afroamerikaner an der Gesamtbevölkerung rund 13% beträgt, gehören nur 4% der Ärzt*innen und 7% der Medizinstudierenden dieser ethnischen (im englischen Originaltext werden hier immer Begriffe wie "race" oder "same-race" benutzt, die im Deutschen negativ belastet sind und deshalb nicht direkt übersetzt werden) Gruppe an.
Zu dieser quantitativen Lücke kommt noch ein qualitatives Misstrauen der Afroamerikaner gegen das mehrheitlich weiße Ärzte-Establishment, das an einer Reihe rassistischer oder die Afroamerikaner systematisch benachteiligenden Aktivitäten beteiligt war. Auch wenn sie bereits vor einiger Zeit beendet wurde, gehört dazu die zwischen 1932 und 1972 durch staatliche Public Health-Institutionen durchgeführte so genannte Tuskegee-Syphilis-Studie. Und ganz aktuell zeigte eine Studie, dass durch Fehlannahmen bzw. Geringschätzung über die Gesundheitsrisiken von Afroamerikanern ein in der Behandlungssteuerung im Krankenhaus verwandter Algorithmus schwarze Patient*innen gegenüber weißen erheblich benachteiligte. Zu den weiteren Einzelheiten siehe den Artikel Algorithmus im US-Gesundheitswesen benachteiligt Afroamerikaner im Deutschen Ärzteblatt vom 25. Oktober 2019 und den Aufsatz Hospital 'risk scores' prioritize white patients in der Zeitschrift "Science" vom 24. Oktober 2019.
Auf diesem Hintergrund entstand die Vermutung, die eingangs beschriebene Ungleichheit beim Sterberisiko könne dadurch verringert werden, wenn afroamerikanische Patienten bei Ärzt*innen ihrer Ethnie in Behandlung wären und wegen des wesentlich höheren Vertrauen auch gesundheitsfördernden Verhaltensempfehlungen dieser Ärzt*innen eher und mit größerem gesundheitlichen Effekt folgen.
Ob dies nur gut gemeint ist oder wirklich zutrifft untersuchte jetzt eine Gruppe von US-Wissenschaftler*innen mit einer randomisierten kontrollierten Studie von über 1.3000 afroamerikanischen Männern aus Kalifornien.
Für die Untersuchung wählten die Wissenschaftler*innen ein anspruchsvolles mehrdimensionales methodisches Konzept aus: Die Teilnehmer füllten zuerst einen umfangreichen Fragebogen zu ihrem gesundheitlichen Zustand aus. Sie erhielten zugleich einen Gutschein für eine Gesundheitsuntersuchung in einer kooperierenden Klinik. Die Studienteilnehmer, die sich für eine Screeninguntersuchung entschieden wurden per Zufall einem schwarzen oder nichtschwarzen (weiß oder asiatisch) Arzt zugewiesen. Sie erhielten dann ein Bild ihres Arztes und konnten angeben welche invasiven oder nicht-invasiven Untersuchungen sie aus einer umfangreichen Liste in Anspruch nehmen wollten. In dem sich anschließenden Gespräch mit dem ihnen zugewiesenen Arzt konnten sie ihre Auswahl an Untersuchungen revidieren. Bis zu Beginn dieses Gesprächs gab es keine signifikanten Unterschiede des Auswahlverhaltens nach der Ethnie der Ärzt*innen.
Dies änderte sich nach dem persönlichen Kontakt mit dem Arzt aber grundlegend. Der Anteil der Patienten, die sich mit einem afroamerikanischen Arzt unterhalten hatten und bei denen anschließend z.B. präventive Untersuchungen des Blutdrucks, Blutzuckers und des Cholesterins durchgeführt wurden oder der Body Mass-Index bestimmt wurde, war 20 bis 25 Prozentpunkte höher als bei den Patienten, die mit einem weißen oder asiaamerikanischen Arzt zu tun hatten.
Entscheidend für dieses Ergebnis war die wesentlich bessere Kommunikation zwischen afroamerikanischen Patienten und Ärzten, die u.a. invasive Untersuchungen, die ein bestimmtes Vertrauen zum Arzt voraussetzen.
Abschließend versuchten die Forscher*innen unter Berücksichtigung anderer Studien noch den potenziellen Gesundheitsgewinn zu bestimmen, der durch ein afroamerikanisches Patient-Arzt-Team entsteht. Sie schätzen, dass die Lücke bei der kardiovaskulären Sterblichkeit zwischen weißen und schwarzen Patienten durch mehr solcher Teams oder Paarungen zu Gunsten der afroamerikanischen Patienten um 19% geschlossen werden könnte und die bei der generellen Lebenserwartung um 8%.
Auch wenn jetzt deutsche Leser*innen denken, die Ergebnisse dieser Studie aus der wesentlich diverseren us-amerikanischen Gesellschaft, gingen an der deutschen Wirklichkeit vorbei, weisen sie auf Dynamiken und Effekte von Patient-Arzt-Interaktionen hin, die nur mit anderen Hautfarben oder Phänotypen auch hierzulande Behandlungsergebnisse verbessern oder verschlechtern könnten.
Von dem Aufsatz Does Diversity Matter for Health? Experimental Evidence from Oakland von Marcella Alsan, Owen Garrick und Grant Graziani (erschienen als "NBER Working Paper No. 24787), gibt es kostenlos eine kurze Zusammenfassung. Prüfen sollte jeder, der duiese aber auch noch weitere NBER-Studien komplett lesen will, ob er eine der Zugangsvoraussetzungen (z.B. Universitätsangehöriger, Journalist) erfüllt. Das NBER (National Bureau of Economic Research) ist keine regierungszahme Einrichtung und auch nicht dem neoliberalen Ökonomie-Mainstream verfallen.
Eine umfangreiche Sammlung von Daten und Literatur zum Aufsatz 'Does Diversity Matter for Health? Experimental Evidence from Oakland'. Appendix — For Online Publication gibt es kostenlos zum Herunterladen.
Bernard Braun, 14.12.19
Übergewichtsprävention für jugendliche Risikogruppen erreicht diese nicht, sondern überwiegend deutschsprachige Eltern
 Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.
Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.
In welcher Weise dies für besondere und auch nicht einfach erreichbare Risikogruppen, d.h. für Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund und niedrigem Sozialstatus geschieht, versucht jetzt eine in Deutschland durchgeführte Studie genauer in Erfahrung zu bringen.
Dazu recherchierten die Wissenschaftler*innen mittels eines evidenzbasierten Kriterienkatalogs im Spätsommer 2017 mit einer der großen Suchmaschinen nach frei verfügbaren print- und webbasierten Materialien zur Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Übergewichtsprävention. Zusätzlich suchten sie in einem App-Store nach kostenfreien und ebenfalls ernährungs- und übergewichtsbezogenen Gesundheits-Apps.
Sie fanden 89 Printmedien, 58 Websites und 25 Apps.
Die qualitativ wichtigsten Ergebnisse lauten so:
• "Die meisten Websites richten sich an Eltern respektive Erwachsene (65,6%) und Fachkreise (62,5%). Von den untersuchten Websites waren nur 9,4% speziell für Kinder konzipiert."
• "Webbasierte Materialien sind zu 37,5% kultursensibel gestaltet. Bei 40,6% der Websites lassen sich entweder unterschiedliche Sprachen auswählen oder es stehen Dokumente in unterschiedlichen Sprachen zum Download zur Verfügung."
• "Bei 9,4% der Websites kann eine Version in leichter Sprache aufgerufen werden. Knapp ein Fünftel der Websites bietet eine Version in Gebärdensprache und 3,1% eine Hörfassung."
• "In der Gesamtschau erfüllen Printmedien zu 92,8% die formalen und zu 87,8% die inhaltlichen Kriterien. Risikogruppen für Übergewicht werden zu 53% berücksichtigt."
• "Websites erfüllen formale Kriterien zu 88,8% und inhaltliche Kriterien zu 91,7%. Risikogruppen wurden bei etwa der Hälfte der Websites berücksichtigt (48,8%)."
• "Von den getesteten Apps richten sich die wenigen qualitativ hochwertigen an Eltern und Schwangere, sind häufig textbasiert und ausschließlich in deutscher Sprache verfasst."
Alles in Allem ist es nicht verwunderlich, wenn die Resonanz all dieser inhaltlich überwiegend korrekten Aufklärungsmaterialien bei den genannten Risikogruppen gering ist bzw. diese Gruppen damit gar nicht erreicht werden.
Die Forderungen der Autor*innen für die (Weiter-)Entwicklung solcher Materialien lauten daher auch so: "Bei ihrer Entwicklung sollten Web- und App-Entwicklerinnen und Entwickler sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die diversen Ausprägungen der Gesundheitskompetenz von Nutzerinnen und Nutzern berücksichtigen. Die Informationen sollten alltagsnah sein und praktische Anregungen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten im Alltag geben. Risikogruppen der Gesundheitsförderung profitieren von kurzen Texten in leichter Sprache respektive in ihrer Herkunftssprache."
Selbst wenn aber mehr textbasierte Informationsmaterial für die jungen Zielgruppen existieren, löst dies nicht das Problem, dass ein nicht geringer Teil von ihnen selbst dann, wenn sie an Informationen interessiert sind, diese nicht lesen und verstehen können. Laut der jüngsten PISA-Befragung 2018 - Ländernotiz Deutschland haben 21% aller 15-Jährigen eine Lesekompetenz auf dem Grundschulniveau und dürften damit selbst mit Texten in einfacher Sprache nichts anfangen können. Dass dies noch keineswegs der höchste Anteil von Jugendlichen mit objektivem Informations- und Handlungsbedarf sein dürfte, die eine geringe Lesekompetenz haben, zeigt folgende Überlegung: Übergewicht, schlechte Ernährung und auch Leseschwäche sind überdurchschnittlich bei Angehörigen unterer sozialer Schichten zu finden Ausgerechnet Jugendliche, die also besonders Aufklärung nötig hätten, sind daher auch zu mehr als 20% leseschwach. Konkret waren es laut der 18 Seiten umfassenden Zusammenfassung der Grundbildung im internationalen Vergleich der PISA-Studie 2018 von Kristina Reiss et al. bei 29,2% der in Deutschland in nichtgymnasialen Schularten lernenden Schüler*innen der Fall. Unter den Schüler*innen in Gymnasien betrug dieser Anteil 1,8%. Fügt man diesen 21%, 29,2% oder 1,8% noch den wahrscheinlich auch nicht geringen Anteil der an solchen Informationen aus verschiedenen Gründen nicht interessierten Jugendlichen hinzu, wird die sehr begrenzte Reichweite selbst der besten Aufklärungsmaterialien offenbar.
Der Aufsatz Gesundheitsförderung und Übergewichtsprävention - systematische Bewertung verfügbarer Informationsmaterialien mit Fokus auf Risikogruppen von Jana Brauchmann, Laura Hruschka, Nadja-Raphaela Baer, Birgit Jödicke, Marc Urlen, Susanna Wiegand und Liane Schenk ist in der Ausgabe 12/2019 der Zeitschrift "Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.12.19
Erhalt einer leitliniengerechten Behandlung von Knie-Arthrose hängt vom Zeitpunkt und vom Facharzt ab - nur in den USA?!
 Wie die nicht seltene und daher auch bereits in Leitlinien bearbeitete Kniearthrose behandelt wird, hängt erheblich davon ab bei welchem Arzt und wann die Behandlung erfolgt. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer im Oktober 2019 in der Fachzeitschrift "Arthritis Care & Research" Studie über die Art der Behandlung von 2.297 PatientInnen mit dieser Erkrankung in den Jahren 2007 bis 2015. Die Datenquelle war der regelmäßig durchgeführte "National Ambulatory Medical Care Survey". Dabei sollten sowohl mögliche arztspezifische Therapieunterschiede identifiziert werden als beobachtet werden, ob sich Behandlungskonzepte in Dreijahreszeiträumen - also unter dem möglichen Einfluss von Behandlungs-Leitlinien - verändert haben. An Behandlungsmaßnahmen wurde zwischen der Überweisung zu einer physikalischen Therapie, Lebensstilberatung (z.B. sportliche Übungen und Gewichtsmanagement), NSAIDs bzw. nichtsteroidale Schmerzmittel mit entzündungshemmender Wirkung und Narkotika bis hin zu Opioiden unterschieden.
Wie die nicht seltene und daher auch bereits in Leitlinien bearbeitete Kniearthrose behandelt wird, hängt erheblich davon ab bei welchem Arzt und wann die Behandlung erfolgt. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer im Oktober 2019 in der Fachzeitschrift "Arthritis Care & Research" Studie über die Art der Behandlung von 2.297 PatientInnen mit dieser Erkrankung in den Jahren 2007 bis 2015. Die Datenquelle war der regelmäßig durchgeführte "National Ambulatory Medical Care Survey". Dabei sollten sowohl mögliche arztspezifische Therapieunterschiede identifiziert werden als beobachtet werden, ob sich Behandlungskonzepte in Dreijahreszeiträumen - also unter dem möglichen Einfluss von Behandlungs-Leitlinien - verändert haben. An Behandlungsmaßnahmen wurde zwischen der Überweisung zu einer physikalischen Therapie, Lebensstilberatung (z.B. sportliche Übungen und Gewichtsmanagement), NSAIDs bzw. nichtsteroidale Schmerzmittel mit entzündungshemmender Wirkung und Narkotika bis hin zu Opioiden unterschieden.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Wenn PatientInnen sich bei einem Orthopäden behandeln ließen erhielten am Anfang der Beobachtungszeit noch 158 von 1.000 eine physikalische Therapie und am Ende waren es nur noch 88 von 1.000. Und auch die Anzahl der PatientInnen, die Lebensstilempfehlungen erhielten sank von 184 pro 1.000 auf 86/1.000 PatientInnen.
• Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der PatientInnen, die von Orthopäden in Übereinstimmung mit der Leitlinie NSAIDs erhielten von 132/1.000 auf 278/1.000 PatientInnen. Die Anzahl, welche nicht mit der Leitlinie übereinstimmende Narkotika oder Opioide verordnet erhielten, stieg von 77 auf 236/1.000 PatientInnen.
• Die Therapien der AllgemeinärztInnen (primary care) veränderten sich zwar auch im Beobachtungszeitraum, aber statistisch nicht signifikant. Der Anteil der PatientInnen, die physikalische Therapien verordnet bekamen stieg von 26 auf 46 pro 1.000 und der Anteil mit Lebensstilempfehlungen sank von 243 auf 221 pro 1.000 PatientInnen. Signifikant stieg dagegen die Verordnung von NSAIDs an und zwar von 221 auf 498 von 1.000 PatientInnen.
• Die Behandlungsempfehlungen waren nicht nur mit der Art des Arztes, sondern auch mit einer Reihe von nichtmedizinischen Faktoren wie z.B. der Praxistyp assoziiert.
- Insgesamt wurden PatientInnen mit einer Arthrose des Knie mit physikalischen Therapien und therapeutischen Empfehlungen für den Lebensstil zunehmend unterversorgt und mit Schmerzmittel überversorgt.
Der Hauptautor der Studie, S. Khoja, fasste das Ergebnis so zusammen: "Our major takeaway from this research is that patients might not be receiving optimum care for knee osteoarthritis. Physicians seem more focused on helping their patients manage their pain with medications, but it is also important to consider the long-term benefits of exercise for mitigating declines in physical health,…Despite being part of clinical practice guidelines, exercise-based interventions are still being prescribed at a very low rate."
Die Studie Recommendation Rates for Physical Therapy, Lifestyle Counseling and Pain Medications for Managing Knee Osteoarthritis in Ambulatory Care Settings. Cross‐sectional Analysis of the National Ambulatory Care Survey (2007‐2015) von Samannaaz S. Khoja, Gustavo J. Almeida, Janet K. Freburger wird in der Zeitschrift "Arthritis Care & Research" erscheinen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich. Eine wahrscheinlich nicht lange erhältliche "accepted article"-Version ist auch noch kostenlos und lediglich online zu lesen.
Bernard Braun, 12.10.19
Über die Folgen unterschiedlicher Arzt-Patient-Kommunikation über die Unsicherheit medizinischer Diagnosen
 Ein erheblicher Teil der medizinischen Diagnosen ist mehr oder weniger unsicher oder mangels ausreichender Untersuchungen auch ungesichert. Viele Behandlungsleitlinien empfehlen den Ärzten darüber auch mit dem Patient zu reden. Dass die Art und Weise wie Ärzte darüber mit ihren PatientInnen kommunizieren aber einer Gratwanderung gleicht, zeigt eine am 10. Januar 2018 veröffentlichte Studie aus den USA nachdrücklich.
Ein erheblicher Teil der medizinischen Diagnosen ist mehr oder weniger unsicher oder mangels ausreichender Untersuchungen auch ungesichert. Viele Behandlungsleitlinien empfehlen den Ärzten darüber auch mit dem Patient zu reden. Dass die Art und Weise wie Ärzte darüber mit ihren PatientInnen kommunizieren aber einer Gratwanderung gleicht, zeigt eine am 10. Januar 2018 veröffentlichte Studie aus den USA nachdrücklich.
Sofern Ärzte im Gespräch mit PatientInnen nicht prinzipiell den Eindruck erwecken, ihre Diagnose wäre sicher und die darauf basierende Therapie auch, hängt sowohl die Zufriedenheit der PatientInnen mit dem Arztbesuch, das Vertrauen in den Arzt und ihre Therapietreue erheblich von der Kommunikation der diagnostischen Unsicherheit ab.
Dazu wurden 71 Eltern pädiatrisch behandelter Kinder in einer so genannten Vignettenstudie in drei Gruppen eingeteilt, denen drei verschiedene Varianten der Unsicherheitskommunikation mit der Bitte vorgelegt wurden ihr Vertrauen in den Arzt etc. anzugeben. Die Aussagen reichten von der expliziten Kommunikation von Unsicherheit ("I'm not sure which disease this is") über eine implizite Kommunikation von Unsicherheit durch mehrere mögliche diagnostische Ergebnisse ("It could be this disease or this other disease.") bis hin zu einer anderen impliziten Kommunikation von Unsicherheit durch Fastsicherheit ("It is most likely this disease.").
Die technische Kompetenz der Ärzte, die explizit Unsicherheit kommunizieren wurde durchweg schlechter bewertet, das Vertrauen in sie und die Bereitschaft ihren therapeutischen Ratschlägen zu folgen waren deutlich geringer als bei Ärzten, die eine der impliziten Kommunikationsvarianten wählten. Ob dies auch für die Diagnosekommunikation mit anderen PatientInnengruppen gilt oder auch bei einer größeren Anzahl von StudienteilnehmerInnen sollte überprüft werden.
Der Aufsatz Patient perspectives on how physicians communicate diagnostic uncertainty: An experimental vignette study von Viraj Bhise et al. ist in der Zeitschrift "International Journal for Quality in Health Care" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.1.18
Mehr Transparenz über verordnete und gekaufte Medikamente für PatientInnen und ÄrztInnen durch Medikationsplan!? Ja, aber….
 Seit vielen Jahren weisen ExpertInnen auf die möglichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln durch verschiedene, über die Parallelverordnungen uninformierten Ärzte und die nicht geringe Anzahl von nicht rezeptpflichtigen von den PatientInnen in der Apotheke gekauften so genannten "Over-the-counter (OTC)"-Arzneimittel hin. Die für Ärzte aber auch PatientInnen herrschende Intransparenz erklärt einen Teil der Wechselwirkungen, der Wirkungsblockaden oder auch der Noncompliance mit deren oft auch ebenfalls erheblichen Folgen für PatientInnen und Ärzte. So dürfte hinter der in Deutschland immer noch überdurchschnittlich großen Anzahl von Patient-Arzt-Kontakten zum Teil gesundheitliche Beschwerden stecken, die durch diese Verordnungswirklichkeit verursacht wurden. Über diese die gebotene Transparenz herzustellen gehörte daher viele Jahre in jeden gesundheits- oder versorgungspolitischen Themenkatalog.
Seit vielen Jahren weisen ExpertInnen auf die möglichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln durch verschiedene, über die Parallelverordnungen uninformierten Ärzte und die nicht geringe Anzahl von nicht rezeptpflichtigen von den PatientInnen in der Apotheke gekauften so genannten "Over-the-counter (OTC)"-Arzneimittel hin. Die für Ärzte aber auch PatientInnen herrschende Intransparenz erklärt einen Teil der Wechselwirkungen, der Wirkungsblockaden oder auch der Noncompliance mit deren oft auch ebenfalls erheblichen Folgen für PatientInnen und Ärzte. So dürfte hinter der in Deutschland immer noch überdurchschnittlich großen Anzahl von Patient-Arzt-Kontakten zum Teil gesundheitliche Beschwerden stecken, die durch diese Verordnungswirklichkeit verursacht wurden. Über diese die gebotene Transparenz herzustellen gehörte daher viele Jahre in jeden gesundheits- oder versorgungspolitischen Themenkatalog.
Seit dem 1. Oktober 2016 gibt es nun für GKV-Versicherte, wenn sie mindestens 3 oder mehr unterschiedliche ärztlich verordnete, Arzneimittel einnehmen oder anwenden nach § 31a SGB V den gesetzlichen Anspruch auf einen bundeseinheitlichen schriftlichen und evtl. künftig auch elektronischen Medikationsplan. Die Ausstellung und Pflege des Medikationsplans erhalten die ausstellenden Ärzte auch extrabudgetär vergütet.
Ob und wie der Medikationsplan im ersten Jahr seiner Existenz funktioniert, wollte die Handeskrankenkasse (hkk) in Bremen genauer wissen und befragte schriftlich 1.000 ihrer Versicherten, die zumindestens in einem Quartal, dem letzten Quartal 2016, nach den Routinedaten über die Arzneimittelverordnungen die Kriterien für die Ausstellung eines Plans erfüllt hatten. 324 Versicherte, ein angesichts der qualitativen Zusammensetzung der ArzneimittelkonsumentInnen guter Anteil, antworteten.
Die Ergebnisse waren überwiegend ernüchternd und zeigen ein weiteres Mal, dass selbst gut gemeinte und von allen Akteuren seit Jahren geforderte Instrumente und Interventionen ohne zusätzliche Unterstützung bei der Implementation nicht oder nur sehr schleppend funktionieren.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten
• Nur 37,7 % der Versicherten, die den Anspruch und Bedarf für einen Medikationsplan gehabt hätten, haben ihn auch erhalten.
• Ein Viertel der Befragten mit Medikationsplan hat eine ausreichende Erklärung zum Sinn des Planes entweder gar nicht oder nur mit Einschränkungen erhalten.
• Mit knapp 21 % der Befragten sprachen die den Medikationsplan ausstellenden Ärzte nicht über den Nutzen und die Einnahme der verordneten Medikamente.
• 51,6 % aller Befragten mit Medikationsplan wurden nicht gefragt, ob sie sich zusätzlich rezeptfreie Arzneimittel in der Apotheke gekauft haben.
• 43 % aller Befragten mit Medikationsplan wurden nicht darauf hingewiesen, den Plan auch beim Besuch anderer Ärzte mitzunehmen und ggfls. ergänzen zu lassen.
• 32,5 % der Befragten, die auch von anderen Ärzten als dem Ersteller des Medikationsplans Medikamente verordnet bekamen, wurden von diesen nicht nach dem Medikationsplan gefragt.
• Sofern der Medikationsplan bei diesen Arztkontakten überhaupt eine Rolle spielte, wurde er ohne genauere Erklärung bei 14,3 % dieser Befragten nicht ergänzt.
Der Verfasser der Studie, der Bremer Gesundheitswissenschaftler Dr. Bernard Braun (Bremer Institut für Arbeitsschutz und Gesundheitsforschung - BIAG und SOCIUM der Universität Bremen) stellt zu den konzeptionellen Mängeln und Umsetzungsschwächen schließlich noch folgendes fest:
• Angesichts einer Reihe von Unterschieden zwischen den offiziell im SGB V und in der dreiseitigen Vereinbarung zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung der Bundesärztekammer Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Ärztekammern und dem Deutschen Apothekerverband festgelegten Kriterien für die Erstellung eines Medikationsplans und den in Darstellungen z.B. der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) genannten Kriterien, sollte untersucht werden welche Kriterien bei den Ärzten "angekommen" sind und für Entscheidungen über die Erstellung eines Medikationsplans genutzt werden und möglicherweise die Erstellung von Medikationsplänen verhindern. In einem Pretest des Fragebogens erwähnten dort Befragte Ärzte, die offensichtlich weder ihren Nutzen noch den des Patienten kannten oder kommunizierten. Einige Ärzte hattren aber auch bereits vor der gesetzlichen Regelund handgestrickte Übersichten erstellt und ausgehändigt.
• Obwohl z.B. in der dreiseitigen Vereinbarung zum Teil bis auf den Millimeter genau die Höhe und Breite von Zeilen oder die Größe von Zeichen geregelt wird, existieren dort wo es um Inhalte des Medikationsplan geht häufig nur vage und Willkür fördernde Bemerkungen wie "in der Regel" oder "sofern möglich", die einen breiten Gestaltungsspielraum ermöglichen, der sich mehr oder weniger negativ auf den für Patienten erfahrbaren Nutzen einer möglichst vollständigen Übersicht über ihre rezeptpflichtige und rezeptfreie medikamentöse Behandlung auswirken kann. Unklar oder zu schwammig bleibt außerdem ob und wie sich Ärzte durch Nachfragen bei Patienten denen sie selber ein oder mehrere Arzneimittel verordnen, darüber informieren müssen, ob derselbe Patient nicht bereits von anderen Ärzten Arzneimittel unter der 3-Arzneimittelgrenze erhalten hat und damit zusammen diese Grenze überschritten wird. Eine Reihe dieser Bestimmungen sollte daher präzisiert und verpflichtend gemacht werden.
• Abgesehen davon, ob wirklich ab dem 1. Januar 2019 die technischen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen geschaffen oder gesichert sind, um zusätzlich zum schriftlichen einen elektronischen Medikationsplan auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) zu dokumentieren, sollte generell geklärt werden, ob damit nicht für große Teile der PatientInnen die schon mit der schriftlichen Form nicht einfach zu gewinnende Übersicht über ihren Arzneimittelkonsum massiv be- oder gar mangels einfacher Lesbarkeit der eGK sogar verhindert wird.
• Aber selbst für den schriftlichen Medikationsplan gilt nach Kenntnis der akribisch auf 97 Seiten einer Anlage zur bereits erwähnten Vereinbarung festgehaltenen Vorschriften zu den zu dokumentierenden Daten und zur Formatierung der Plandaten sowie des Aussehens des Plans, dass lesbare und wirksame Dokumente für "normale" NutzerInnen anders aussehen sollten. Die oft geäußerte Kritik am Layout der Qualitätsberichte von Krankenhäusern und die dort gemachten Verbesserungsvorschläge, sind bei der Konzipierung des Medikationsplans völlig ignoriert worden.
In jedem Fall sollten sich alle Beteiligten überlegen was sie tun können die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Regelmäßige Kontrollen sind dabei sicherlich hilfreich.
Der hkk-Report Medikationsplan 2017 umfasst 18 Seiten und ist komplett kostenlos abrufbar.
Bernard Braun, 26.10.17
Was haben die 75% der deutschen Ärzte von der Transparenz über Industriezahlungen an sie zu befürchten, die sie 2016 verhinderten?
 In den USA gibt es seit 2013 und in Deutschland seit 2015 Veröffentlichungen über die Höhe und Art der Zuwendungen von Pharmaunternehmen an Ärzte. Und damit hören die Gemeinsamkeiten auch bereits auf: In den USA handelt es sich um eine gesetzliche Vorschrift mit dem griffigen Namen "Physician Payments Sunshine Act", die für alle Pharmaunternehmen und alle Ärzte verpflichtend ist. In Deutschland handelt es sich um eine Selbstverpflichtung an der nur die Mitglieder des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller (VfA) und diejenigen Ärzte mitmachen, die das wollen. In die deutschen Übersichten gehen außerdem Zuwendungen der Generikahersteller, der Hersteller homöopathischer Mittel und der Mitglieder des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie (BPI) nicht ein. Der Anteil der Ärzte, die ihre Zuwendungen transparent machen sank von 31% im Jahr 2015 auf 25% im Jahr 2016. In Deutschland können also PatientInnen weder für 75% ihrer Ärzte etwas über Zuwendungen der Pharmaindustrie erfahren noch selbst bei den 25% nicht, ob und wie viel sie noch Zahlungen von Generikaherstellern u.a. erhalten haben.
In den USA gibt es seit 2013 und in Deutschland seit 2015 Veröffentlichungen über die Höhe und Art der Zuwendungen von Pharmaunternehmen an Ärzte. Und damit hören die Gemeinsamkeiten auch bereits auf: In den USA handelt es sich um eine gesetzliche Vorschrift mit dem griffigen Namen "Physician Payments Sunshine Act", die für alle Pharmaunternehmen und alle Ärzte verpflichtend ist. In Deutschland handelt es sich um eine Selbstverpflichtung an der nur die Mitglieder des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller (VfA) und diejenigen Ärzte mitmachen, die das wollen. In die deutschen Übersichten gehen außerdem Zuwendungen der Generikahersteller, der Hersteller homöopathischer Mittel und der Mitglieder des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie (BPI) nicht ein. Der Anteil der Ärzte, die ihre Zuwendungen transparent machen sank von 31% im Jahr 2015 auf 25% im Jahr 2016. In Deutschland können also PatientInnen weder für 75% ihrer Ärzte etwas über Zuwendungen der Pharmaindustrie erfahren noch selbst bei den 25% nicht, ob und wie viel sie noch Zahlungen von Generikaherstellern u.a. erhalten haben.
Dabei geht es bei den Zahlungen der 54 größten Pharmaunternehmen an Ärzte und medizinische Fachkreisangehörige 2016 um insgesamt 562 Millionen Euro. 356 Millionen Euro wurden als Honorar für die Durchführung von klinischen Studien und Anwendungsbeobachtungen (AWBs) bezahlt, wobei letztere nach Meinung von Fachleuten meist nutzlos sind. 105 Millionen Euro bekamen Ärzte als Vortragshonorar und für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. Mit weiteren 101 Millionen Euro sponserte die Industrie Veranstaltungen und Institutionen.
Darüber was drei Viertel der deutschen Ärzte von der freiwilligen Transparenz abhält gibt es immer schon Vermutungen, die vor allem auf mögliche Ängste über Vertrauens- und mögliche Patientenverluste für den einzelnen Arzt aber auch Imageschäden für die gesamte Ärzteschaft hinweisen. Dabei blieb bisher unüberprüft, ob diese Ängste berechtigt sind oder auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Umso leichter begeht die Mehrheit der deutschen Ärzte aus Angst vor dem Tod Selbstmord, sprich erschüttert erst recht Vertrauen durch die absichtliche Intransparenz und fördert möglicherweise Stereotype und Heuristiken über "geldgierige, heimlichtuende" Ärzte, die sich viel mehr und länger auswirken als die reine Wahrheit.
Über die von dieser Transparenz zu erwartenden Wirkungen gibt aber jetzt eine kleine Studie detailliert Auskunft.
Dafür wurden 278 englischsprachige EinwohnerInnen des US-Bundesstaats Massachusetts über 18 Jahre und mit mindestens einem Gesundheits-Leistungsanbieterkontakt in den letzten 12 Monaten per Zufall in vier Gruppen aufgeteilt und zwar in eine Gruppe, die Ärzte beurteilen sollte von denen sie auf einer entsprechenden Website sehen konnten ob sie von Pharmaunternehmen oder Herstellern von anderen Medizinprodukten keine Zahlung, wenig Zahlungen oder hohe Zahlungen erhalten hatten. Die der Kontrollgruppe zugeordneten Personen konnten die entsprechende Website nicht einsehen.
Die TeilnehmerInnen sollten auf entsprechenden Skalen ihr Vertrauen zu dem Arzt bzw. zur medizinischen Profession und zur Industrie angeben. Dabei konnten sie nach den Aspekten Ehrlichkeit, Treue zu den Patienteninteressen, Kompetenz und Vertraulichkeit beim Schutz von privaten Informationen unterscheiden.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Verglichen mit den Ärzten, die keine Zahlungen erhalten hatten wurden insbesondere die Ehrlichkeit und die Treue der Ärzte, die hohe Zuzahlungen (über 13.000 US-$) erhielten, geringer bewertet.
• Unter den 7,9%, die ihren eigenen Arzt auf der Website fanden, verschlechterte sich die Bewertung der Ehrlichkeit und Treue mit der Höhe der Zahlungen.
• An der Bewertung der Kompetenz der individuellen Ärzte änderte sich aber durch den Erhalt und die Höhe der Zahlungen nichts.
• Die Kenntnis und die Lektüre der Zahlungs-Website änderte ferner an der Bewertung der medizinischen Profession insgesamt und der Pharma- wie Medizinprodukte-Industrie nichts.
Was hier deutlich wird, ist, dass PatientInnen mit der möglichen Transparenz sehr differenziert umgehen, sie also weder ihrem individuellen Arzt im Lichte der Kenntnisse über Zahlungen durchweg nicht mehr vertrauen noch der gesamten Profession oder den Zahlern solcher Zahlungen das Vertrauen entziehen. Da der Umfang und auch die Qualität (z.B. getrennte Darstellung der Zahlungen für klinische Studien oder AWBs) der Intransparenz auch Vertrauen erschüttern können und vielleicht sogar wesentlich subtiler und nachhaltiger, ist den 75% NichtteilnehmerInnen zu raten freiwillig ihr Verhalten zu ändern oder es darauf ankommen lassen, dass dieser Bereich zukünftig eindeutig per Transparenzgesetz und Pflichttransparenz geregelt wird.
Eine Datenbank, die Zahlungen je Arzt aus der Gruppe der 25% ausweist, ist kostenlos für jeden zugänglich.
Der Aufsatz The Effects of Public Disclosure of Industry Payments to Physicians on Patient Trust: A Randomized Experiment. von Hwong AR, Sah S und Lehmann LS ist in der Fachzeitschrift "J Gen Intern Med." am 17. Juli 2017 als Vorab-Onlinepublikation erschienen. Ein Abstract ist kostenlos.
Bernard Braun, 21.9.17
Unheilbarer Krebs: die meisten Patienten wünschen vollständige Informationen
 Welche Informationen wünschen Patienten mit Krebs und welche wünschen sie nicht - diese Frage untersuchten holländische Wissenschaftler an 77 Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Zweitlinien-Chemotherapie standen. Bei diesen Patienten lag ein fortgeschrittener, nicht heilbarer Brustkrebs oder Darmkrebs vor, der sich unter der ersten Chemotherapie (Erstlinientherapie) weiter ausgebreitet hatte. Die Erfolgsaussichten einer Zweitlinientherapie sind zumeist eher gering oder auch unklar.
Welche Informationen wünschen Patienten mit Krebs und welche wünschen sie nicht - diese Frage untersuchten holländische Wissenschaftler an 77 Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Zweitlinien-Chemotherapie standen. Bei diesen Patienten lag ein fortgeschrittener, nicht heilbarer Brustkrebs oder Darmkrebs vor, der sich unter der ersten Chemotherapie (Erstlinientherapie) weiter ausgebreitet hatte. Die Erfolgsaussichten einer Zweitlinientherapie sind zumeist eher gering oder auch unklar.
Im Gegensatz zu anderen Studien, in denen Patienten mit einer hypothetischen Situation konfrontiert wurden, ging es in dieser Studie um eine "echte" Behandlungsentscheidung.
Die Patienten erhielten von ihrem Onkologen die üblichen Informationen über die Behandlung. Eine Pflegekraft bot ihnen zusätzlich Informationen auf Grundlage einer Entscheidungshilfe zu den Bereichen unerwünschte Wirkungen (Schaden), Tumorwachstum und Überleben an.
Die Information erfolgte schrittweise, indem die Pflegekraft erst erklärte, was für Informationen der Patient zu erwarten hatten damit dieser entscheiden konnten, ob er die Informationen erhalten wollte. Zum Thema Überleben erklärte die Pflegekraft beispielsweise das Konzept der mittleren Überlebenszeit mit dem Hinweis darauf, dass sich die Überlebenszeit für den einzelnen Patienten nicht genau vorhersagen lässt.
Die Patienten wurden befragt, zu welchen Bereichen sie sich informieren wollten. Die Ärzte wurden befragt, zu welchen Bereichen die Patienten nach ihrer Einschätzung informiert werden wollten.
95% der Patienten wollten zu unerwünschten Wirkungen informiert werden, 91% über das Ansprechen des Tumors auf die Therapie und 75% über die Überlebenszeit.
Die Ärzte schätzten den Informationswunsch auf 100%, 97% und 81%.
Informationswunsch des Patienten und Einschätzung des Arztes stimmten in 62% der Fälle überein.
Diese Studie zeigt, dass die meisten aber nicht alle Patienten voll über den Nutzen und den Schaden einer Chemotherapie informiert werden möchten. Selbst über die sehr sensible Frage der verbleibenden Lebenszeit wünschen 75% der Patienten informiert zu werden. Von Seiten der Ärzte werden die Informationsbedürfnisse der Patienten zwar zutreffend als hoch eingeschätzt, bezogen auf den einzelnen Patienten liegen sie aber nur zu 62% richtig. Dies unterstreicht einmal mehr die Aufgabe des Arztes, auf jeden Patienten einzugehen und ihn darin zu unterstützen, seine Bedürfnisse bezüglich Information und Behandlung zu erkennen und mitzuteilen.
Oostendorp LJM, Ottevanger PB, van de Wouw AJ, et al. Patients' Preferences for Information About the Benefits and Risks of Second-Line Palliative Chemotherapy and Their Oncologist's Awareness of These Preferences. Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education 2015. Volltext
David Klemperer, 11.7.16
"Well, palliative is, oh God, where people go to hospital to die." Die Rolle von Begriffen und Einbettungen im Gesundheitswesen
 Die Kommunikation über Krankheiten oder die für gesundheitsbezogene Versorgung benutzten Begriffe können die Nutzung von Angeboten beeinflussen und den damit verbundenen Nutzen mindern oder verhindern. Dies zeigt eine am 18. April 2016 in der kanadischen Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichte Studie über die Inanspruchnahme von Palliativversorgung.
Die Kommunikation über Krankheiten oder die für gesundheitsbezogene Versorgung benutzten Begriffe können die Nutzung von Angeboten beeinflussen und den damit verbundenen Nutzen mindern oder verhindern. Dies zeigt eine am 18. April 2016 in der kanadischen Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichte Studie über die Inanspruchnahme von Palliativversorgung.
Palliativbehandlung ist eine speziell für PatientInnen mit ernsten und leidensvollen Erkrankungen und ihre Familien entwickelte stationäre und ambulante Versorgungsform, die möglichst früh genutzt werden sollte, dabei helfen soll, die Lebensqualität sowie die körperliche und mentale Gesundheit zu verbessern und sogar lebensverlängernde Effekte haben kann.
Eine randomisierte kontrollierte Studie mit 71 an fünf Krebsarten erkrankten TeilnehmerInnen (48 Patienten und 23 helfende Angehörige) wies 40 von ihnen einer Gruppe zu, die zusätzlich zu der Standard-Krebsbehandlung eine frühe Überweisung in eine Palliativbehandlung erhielten. Die anderen 31 TeilnehmerInnen erhielten ausschließlich die Standardbehandlung. Die von den behandelnden Onkologen geschätzte weitere Lebenserwartung aller PatientInnen betrug 6 bis 24 Monate.
48 PatientInnen und 23 pflegende Angehörige nahmen zum Abschluss der Studie an halbstrukturierten mündlichen Interviews über ihre Einstellungen zur und Wahrnehmungen von palliativmedizinischen Versorgung teil.
Das wesentliche Ergebnis war, dass Angehörige der Interventions- wie Kontrollgruppe diese Art von Behandlung als mit einem negativen Stigma von Tod, finaler Behandlung und "end of life care" behaftet beschrieben. Der Gedanke an bzw. das Angebot von Palliativversorgung provoziere Furcht und löse Vermeidungsverhalten aus. Diese Wahrnehmungen entsprangen oft der Interaktion mit Ärzten oder Angehörigen anderer Gesundheitsberufe.
Auch wenn viele Angehörigen der Interventionsgruppe während der Behandlung ein breiteres Verständnis von Palliativversorgung entwickelten, also z.B. erkannten, dass es sich um eine Art "ongoing care" handelt, die ihre Lebensqualität verbesserte, assoziierten auch viele von ihnen mit der Behandlungsform weiterhin das beschriebene Stigma.
Um eine möglichst frühzeitige Inanspruchnahme von palliativmedizinischer Versorgung zu fördern schlugen Angehörige beider Gruppen vor, eine andere Bezeichnung (z.B. "supportive care") zu benutzen, das Angebot in einen anderen Gesamtrahmen einzufügen und die Erklärung durch professionelle Helfer deutlich zu verbessern.
Was bei einer anderen Rahmung der palliativen Behandlung zu beachten wäre, benennt ein Kommentator der Studie so: "Although changing the name to supportive care may help promote a more positive view of palliative care, the stigma will persist if this type of care is recommended only as default treatment when curative or life-prolonging treatments are deemed ineffective or undesired."
Die schlüssige Darstellung der negativen Assoziationen mit dem Begriff Palliativversorgung und der Notwendigkeit sie durch eine andere Begrifflichkeit und Einbettung zu vermeiden, sollte Anlass sein, bei der Nicht- oder zu geringen Inanspruchnahme anderer Gesundheitsangebote (z.B. Impfen, Früherkennungsuntersuchungen oder Nutzung von "watchful waiting"-Angeboten) auch an ein falsches oder stigmatisierendes "wording" zu denken und über mögliche Alternativen nachzudenken.
Der Aufsatz Perceptions of palliative care among patients with advanced cancer and their caregivers von Camilla Zimmermann et al. ist komplett kostenlos erhältlich und enthält eine Fülle von interessanten Originalzitaten aus den geführten Interviews.
Bernard Braun, 25.4.16
Chemotherapie bei fortgeschrittenem Krebs: Ärzte lassen Patienten keine Wahl, aber Patienten merken es nicht
 Spielt Shared Decision Making eine Rolle bei Entscheidungen über eine Zweit- und Drittlinienchemotherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs, ist die Frage, der eine holländische Studie nachging.
Spielt Shared Decision Making eine Rolle bei Entscheidungen über eine Zweit- und Drittlinienchemotherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs, ist die Frage, der eine holländische Studie nachging.
Teilnehmer waren 14 Patienten mit metastasiertem Darmkrebs (mittlere Überlebenszeit 24 bis 28 Monate) bzw. mit einem nicht heilbaren Hirntumor (Glioblastom, mittlere Überlebenszeit 14 Monate) und ihre insgesamt 18 Ärzte. Eine Forscherin begleitete die Patienten bei ihren Arztbesuchen. Stand wegen Fortschreitens der Erkrankung unter Chemotherapie eine Entscheidung darüber an, ob oder ob nicht eine andersartige Chemotherapie durchgeführt werden sollte, wurden die Gespräche aufgezeichnet. Nach der Entscheidung wurden Patienten und Ärzte interviewt, um ihre Sicht des Entscheidungsprozesses offen zu legen.
Die Gespräche wurden daraufhin analysiert, inwieweit Elemente von SDM erkennbar waren.
Keiner der 14 Patienten erhielt Informationen über alle Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich der Option, keine Anti-Tumor-Behandlung durchzuführen. Eher wurde Zweit- oder Drittlinien-Chemotherapie als einzige Möglichkeit angeboten. Einige Ärzte gaben an, die Chemotherapie bei Fortschreiten des Tumorwachstums für das einzig Richtige zu halten und den Verzicht auf eine Chemotherapie gar nicht erwogen zu haben.
Den Nutzen und Schaden der Chemotherapie besprachen die Ärzte zumeist mit ihren Patienten, wenn auch nicht ausführlich. Da sie die Option der Nicht-Fortführung nicht anboten, entfielen auch die entsprechenden Informationen über Nutzen und Schaden, so dass die Patienten zwischen Durchführung und Nicht-Durchführung nicht abwägen konnten. Einige Patienten stimmen der Therapie schon deshalb zu, weil sie befürchteten, die Entscheidung gegen eine Therapie zu bedauern, wenn die Erkrankung fortschreite.
Bei drei Patienten wurde die Therapie nicht fortgeführt. Diese Patienten gaben an, dass die geringe Wahrscheinlichkeit, das Tumorwachstum zu bremsen, die Beeinträchtigung der Lebensqualität nicht aufwiege. Ihre Entscheidung gründete allein auf Informationen darüber, die Therapie durchzuführen und nicht auch auf Informationen über die Nicht-Durchführung.
Auf die Erwartungen, Sorgen und Erfahrungen der Patienten im Rahmen des Entscheidungsprozesses gingen die Ärzte wenig oder überhaupt nicht ein und wenn, dann eher auf den körperlichen Zustand als auf die emotionale Befindlichkeit. Manche Patienten wünschten sich ein Gespräch, das mehr um ihre Person als allein um den Tumor ging. Der Gewinn an Lebenszeit wurde nicht explizit besprochen, so dass einige Patienten unrealistisch hohe Erwartungen in die Therapie setzten.
Insgesamt neigten die Ärzte stark dazu, die Fortführung der Therapie zu nahezulegen oder explizit empfehlen. Manche versuchten, die Patienten in die Entscheidung einzubeziehen, allerdings erst, nachdem sie ihre Empfehlung ausgesprochen hatten. Wenn Ärzte über Optionen sprachen, ging es stets um zwei gegen den Tumor gerichtete Therapie, wie Chemotherapie bzw. Chirurgie. Manche Ärzte waren gewillt, und hielten es für richtig, den Patienten die Entscheidung zu überlassen, hatten aber das Gefühl, dass diese sich überfordert fühlten.
Die meisten Patienten fühlten sich beteiligt, waren zufrieden mit dem Entscheidungsprozess und gaben an, dass der Rat des Arztes mir ihren Wünschen übereinstimmte und sie das letzte Wort gehabt hätten. Einige Patienten hätten sich jedoch präzisere Information und mehr Abwägung von Nutzen und Schaden gewünscht. Patienten, bei denen die Krankheit trotz Chemotherapie fortschritt, bedauerten die Entscheidung nicht, diejenigen bei denen die Krankheit stabil war, natürlich auch nicht.
Zusammenfassend waren Shared Decision Making-Elemente in Gesprächen über Therapieentscheidungen kaum zu beobachten. Trotzdem waren die Patienten weit überwiegend zufrieden mit dem Prozess und der Entscheidung und ihrer Beteiligung an der Entscheidung. Dies weist darauf hin, dass die Patienten nicht vermissen, was sie nicht kennen, nämlich die nicht-direktive präzise Darlegung der Optionen auf Grundlage der Evidenz zu patientenrelevanten Behandlungsergebnissen. Andere Studien zeigen, dass Patienten, die sich über den zu erwartenden Lebenszeitgewinn durch eine Therapie im Klaren sind, dies sehr wohl mit den Schäden, wie Beeinträchtigung der Lebensqualität abzuwägen wissen. Bei gegebener Aussicht auf Nutzen und Schaden entscheiden Patienten individuell sehr unterschiedlich (wir berichteten). Eine gute Entscheidung ist daher nur durch Shared Decision Making erreichbar.
Brom L, De Snoo-Trimp JC, Onwuteaka-Philipsen BD, et al. Challenges in shared decision making in advanced cancer care: a qualitative longitudinal observational and interview study. Health Expect 2015. (Abstract)
David Klemperer, 16.3.16
Ungleichheit in der palliativen Behandlung am Beispiel von Schlaganfall- und Krebspatienten in Schweden
 Bei einer Reihe von schweren Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Teil der Erkrankten innerhalb kurzer Zeit sterben wird. Sowohl professionelle Helfer aber auch Laien sind daher auf palliative Unterstützung vorbereitet und wissen womit diesen Patienten in der Zeit vor ihrem Tod geholfen werden kann. Zu erwarten wäre, dass dies für sämtliche schwer Erkrankten der Fall ist.
Bei einer Reihe von schweren Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Teil der Erkrankten innerhalb kurzer Zeit sterben wird. Sowohl professionelle Helfer aber auch Laien sind daher auf palliative Unterstützung vorbereitet und wissen womit diesen Patienten in der Zeit vor ihrem Tod geholfen werden kann. Zu erwarten wäre, dass dies für sämtliche schwer Erkrankten der Fall ist.
Eine in Schweden durchgeführte Studie mit Daten des "Palliative Care Registers" (hier werden eine Fülle von Details der palliativen Behandlung aller Patienten dokumentiert) zeigt aber, dass dies nicht immer der Fall ist bzw. sein muss. Beim Vergleich der "End of Life"-Behandlung von je 1.626 Krebs- und Schlaganfallpatienten zeigten sich erhebliche Wissens- und Behandlungsunterschiede zu Ungunsten der letzteren.
Dass der Bedarf für Personen, die einen Schlaganfall erleiden vorhanden ist, zeigt die Tatsache, dass rund 20 Prozent von ihnen innerhalb einer Woche sterben und 40 Prozent innerhalb eines Jahres.
Bei Schlaganfallpatienten hatten die Helfer laut der Studie u.a. Schwierigkeiten zu berücksichtigen, ob die Patienten jemand hatten, den sie in den letzten Tagen bei sich haben wollten, sie wussten wesentlich seltener als bei Krebspatienten ob die Patienten Wünsche zum Ort ihres Sterbens hatten oder ob sie Schmerzen hatten. Letzteres ist auf dem Hintergrund problematisch, weil andere Studien zeigten, dass 43 oder sogar mehr Prozent der Patienten mit Schlaganfall Schmerzen haben, in dem analysierten Register war dies aber nur für 5 Prozent eingetragen und damit wahrscheinlich auch behandlungsrelevant. Schließlich wurde mit diesen Patienten und ihren Angehörigen auch wesentlich seltener als mit Krebskranken so genannte "turning point"-Gespräche zu dem Zeitpunkt geführt, wo an Stelle einer kurativen die palliative Behandlung tritt. Diese Gespräche wurden bei 69 Prozent der Schlaganfallpatienten und bei 24 Prozent der Krebspatienten nicht geführt.
Die bei ausländischen Studien obligatorische Frage, ob deren Ergebnisse auch für Deutschland gelten, ist mangels vergleichbarer Registerdaten seriös nicht zu beantworten. Trotzdem sollten sie Anlass sein, derartige Ungleichheiten auch in der palliativen Versorgung in Deutschland nicht auszuschließen oder mit geeigneten Methoden sie zu identifizieren oder auszuschließen.
Die Studie End of Life Care for Patients Dying of Stroke: A Comparative Registry Study of Stroke and von Heléne Eriksson, Anna Milberg, Katarina Hjelm, Maria Friedrichsen ist im März 2016 in der Fachzeitschrift "PLOS ONE" (11 (2)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.3.16
Neue Krebsmedikamente 5: Fortgeschrittener Krebs - keine Chemotherapie ist auch eine Option
 Patienten mit nicht heilbarem Krebs und Erfahrung mit Chemotherapie bewerten bei geringer verbleibender Lebenserwartung den Zugewinn an Lebenszeit durch Chemotherapie sehr unterschiedlich, lautet das Fazit einer Befragung von 81 Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Stadium III- IV). Diese Patienten sollten sich vorstellen, sie hätten ohne Chemotherapie noch 4 Monate zu leben und dann angeben, ab welchem Lebenszeitgewinn aus ihrer Sicht der Nutzen die Belastung übersteigt ("minimum survival benefit"), sie also eine Chemotherapie befürworten würden. Diese Entscheidung sollten sie für eine Chemotherapie mit milder und mit schwerer Toxizität treffen. Als Lebenszeitgewinn wurden ihnen 7 Zeiträume zwischen 1 Woche und 24 Monaten angeboten.
Patienten mit nicht heilbarem Krebs und Erfahrung mit Chemotherapie bewerten bei geringer verbleibender Lebenserwartung den Zugewinn an Lebenszeit durch Chemotherapie sehr unterschiedlich, lautet das Fazit einer Befragung von 81 Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Stadium III- IV). Diese Patienten sollten sich vorstellen, sie hätten ohne Chemotherapie noch 4 Monate zu leben und dann angeben, ab welchem Lebenszeitgewinn aus ihrer Sicht der Nutzen die Belastung übersteigt ("minimum survival benefit"), sie also eine Chemotherapie befürworten würden. Diese Entscheidung sollten sie für eine Chemotherapie mit milder und mit schwerer Toxizität treffen. Als Lebenszeitgewinn wurden ihnen 7 Zeiträume zwischen 1 Woche und 24 Monaten angeboten.
Die Antworten zeigten große Unterschiede auf. 5 Patienten würden eine Chemotherapie schon für eine Woche Lebenszeitgewinn akzeptieren, 9 Patienten würden auch bei 24 Monaten noch ablehnen. Weniger als die Hälfte der Befragten würde sich bei einem Lebenszeitgewinn von 3 Monaten für eine Chemotherapie entscheiden. Die mittlere Schwelle lag bei 4,5 Monaten für die gering toxische und bei 9 Monaten für die stark toxische Chemotherapie. Ältere Patienten setzten die Schwelle höher an, ebenso wie Patienten, die bei der bisherigen Chemotherapie ihre Lebensqualität als niedrig einstuften. Bei der Entscheidung zwischen einer unterstützenden, palliativen Behandlung und einer Chemotherapie mit 4 Monaten Lebenszeitgewinn entschieden sich nur 18 der 81 Patienten für die Chemotherapie. Die meisten Patienten gaben an, bis dahin kein Angebot einer unterstützenden Therapie als Option erhalten zu haben.
Die Vorstellungen einiger Patienten zur Chemotherapie waren recht ausgeprägt. Ein Patient, der eine Chemotherapie für 1 Woche Lebenszeitgewinn auf sich nehmen würde, meinte, dass in dieser Woche vielleicht die Heilung von Lungenkrebs entdeckt würde. Eine Patientin würde auch für 24 Monate Lebenszeitgewinn keine Chemotherapie akzeptieren mit der Begründung, sie habe ein volles, produktives Leben geführt hat und wünsche für die verbleibende Zeit keine Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Chemotherapie.
Die Autoren stellen fest, dass die Ergebnisse teils im Gegensatz zur bis dahin erhaltenen Behandlung stehen.
Diese Studie aus dem Jahr 1998 zeigt auf, dass Chemotherapie-erfahrene Patienten mit nicht heilbarem Krebs sehr wohl abzuwägen wissen zwischen Lebenszeit und Lebensqualität. Sie erhalten aber zumeist nicht die Gelegenheit dazu. Die Möglichkeiten der palliativen Behandlung werden nicht ausgeschöpft (Zu viel Medizin, zu wenig Palliativ-Versorgung am Ende des Lebens)und die Vorstellungen über das Therapieziel sind häufig falsch (Lungenkrebs und Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium: Illusionen über Heilung bei der Mehrzahl der Patienten).
Letztlich verdeutlichen diese Studien, dass eine "Personalisierung" der Krebstherapie durch eine klare Kommunikation von Nutzen und Schaden und eine Klärung der Patientenpräferenz gekennzeichnet sein sollte, also durch Shared Decision Making.
Silvestri G, Pritchard R, Welch HG. Preferences for chemotherapy in patients with advanced non-small cell lung cancer: descriptive study based on scripted interviews. BMJ 1998;317:771-75. Volltext
David Klemperer, 24.2.16
"Wie empathisch ist Ihr Arzt?": "fragen Sie dazu Ihre Spracherkennungssoftware"
 Während auf der einen Seite Telemedizin, Telemonitoring, m- und a-Health-Anwendungen einen großen Teil der face-to-face-Kontakte von Patient und Arzt durch die automatische Übertragung von Körperwerten etc. überflüssig machen, könnten Patienten in Kürze gar nicht mehr ihrem Arzt zuhören müssen, um eine Vorstellung von dessen kommunikativen und therapeutischen Fähigkeiten oder dessen Patientenorientierung zu gewinnen.
Während auf der einen Seite Telemedizin, Telemonitoring, m- und a-Health-Anwendungen einen großen Teil der face-to-face-Kontakte von Patient und Arzt durch die automatische Übertragung von Körperwerten etc. überflüssig machen, könnten Patienten in Kürze gar nicht mehr ihrem Arzt zuhören müssen, um eine Vorstellung von dessen kommunikativen und therapeutischen Fähigkeiten oder dessen Patientenorientierung zu gewinnen.
Es reicht, ein aufnahmefähiges elektronisches Gerät mit einer entsprechenden Spracherkennungssoftware auf den Tisch zu legen, irgendwann einen OK-Button zu drücken und dann zu erfahren, ob der Arzt empathisch bzw. dem Patienten zugewandt war oder nicht.
In einem am 2. Dezember veröffentlichten Aufsatz stellte ein us-amerikanisches Autorenteam eine Software vor, die sie nach mehr als 1.000 Arztgesprächen mit Patienten, die von Drogen abhängig oder alkoholkrank waren, für die Behandlung dieser aber auch anderer Patienten entwickelt haben. Der Algorithmus des Programms bewertet u.a. Wortsequenzen wie "es hört sich an wie", "was denken Sie" oder "was ich gerade bei Ihnen heraushöre" als Indikatoren für hohe Empathie und Wortsequenzen wie "nächste Frage", "sie müssen" und "in der Vergangenheit war das so und so" als Hinweise auf geringe Empathie.
In absehbarer Zeit glauben die Entwickler dieses Sprachtools, dass sie auch die Lautstärke, die Sprechgeschwindigkeiten, die Redehäufigkeit und Zeitanteile des Patienten und Therapeuten für die Bewertung der Gesprächsqualität berücksichtigen können, und dies alles in "real-time feedback"-Geschwindigkeit.
Richtig ist, dass alle Patienten die beste, d.h. ihnen optimal zugeneigte Behandlung bekommen sollten und die traditionelle Evaluation dieser Art von Behandlungsqualität durch Dritte zeitaufwändig ist und die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Therapeut und Patient tangiert. Auch wenn es eine offensichtlich technisch machbare Alternative gibt, ist aber fraglich, ob das Ergebnis wirklich zu einem Mehr an Patientenorientierung führt. Schon der Hinweis der Entwickler, sie würden in naher Zeit "use this tool to train aspiring therapists", lässt die Befürchtung zu, dass sich nach solchen Trainings nur das Wording ändert, ohne dass damit ein Mehr an tatsächlicher Empathie verbunden ist.
Der Aufsatz "Rate My Therapist": Automated Detection of Empathy in Drug and Alcohol Counseling via Speech and Language Processing von Xiao B, Imel ZE, Georgiou PG, Atkins DC und Narayanan ist komplett frei zugänglich am 2. Dezember 2015 in der Fachzeitschrift PLoS ONE erschienen.
Bernard Braun, 6.12.15
Der "fordernde Patient" - ein Mythos
 Werden Ärzte nach den Ursachen für die in vielen Bereichen festgestellte Überversorgung befragt, nennen sie häufig die Anspruchshaltung der Patienten (siehe z.B. "Mündige Patienten" aus Ärztesicht, Forum Gesundheitspolitik) als Ursache.
Werden Ärzte nach den Ursachen für die in vielen Bereichen festgestellte Überversorgung befragt, nennen sie häufig die Anspruchshaltung der Patienten (siehe z.B. "Mündige Patienten" aus Ärztesicht, Forum Gesundheitspolitik) als Ursache.
Eine amerikanische Studie ist dieser Hypothese nachgegangen und kommt zu anderen Ergebnissen.
Beteiligt waren 3624 Patienten und auf Seite der Professionellen 34 Onkologen, 11 onkologische Assistenzärzte sowie 15 Pflegekräfte und ArzthelferInnen in den onkologischen Behandlungszentren von 3 Krankenhäusern im Raume Philadelphia.
Die häufigsten Diagnosen waren Leukämien, Darmkrebs, Brustkrebs und Lungenkrebs. Knapp 2/3 der Patienten hatte Krebs im Frühstadium und etwa 1/3 metastasierten Krebs. Die Ärzte bewerteten die Beziehung zu über 80% der Patienten als hervorragend oder sehr gut.
Es wurden 5050 Arzt-Patienten-Gespräche ausgewertet. Die Ärzte bzw. Pflegekräfte wurden von geschulten wissenschaftlichen Mitarbeitern befragt, ob der Patient den Wunsch oder die Forderung nach einem bestimmten Test oder einer bestimmten Therapie vorgebracht hat. Wenn ja, sollte die Angemessenheit auf einer Skala von "extrem angemessen" bis "überhaupt nicht angemessen" bewertet werden.
In 3530 Gesprächen ging es um Chemotherapie oder Strahlentherapie, in 1520 Gesprächen ging es nicht um eine gegen die Krebserkrankung gerichtete Therapie.
In 440 Gesprächen (8,7%) äußerten Patienten einen Wunsch z.B. nach einer Computertomographie, nach einer Blutuntersuchung oder nach Palliativmaßnahmen.
316 (71,8%) dieser Wünsche beurteilten die Professionellen den Wunsch als angemessen und in 310 Fällen folgten sie ihnen. 50 Wünsche (11,4%) beurteilten sie als unangemessen, 7 befolgten sie. 74 Wünsche (16,8%) konnten sie nicht eindeutig zuordnen, 48 befolgten sie.
Ob Patienten einen Wunsch äußerten, hing nicht zusammen mit dem Geschlecht, dem Alter, der Ethnie, dem Versicherungsstatus, dem Krankheitsstadium oder dem Behandlungsziel. Erhöht war hingegen die Wahrscheinlichkeit für einen Wunsch bei Patienten mit einem Tumor im Kopf-Halsbereich und bei Patienten die aktuell eine Tumortherapie erhielten. Knapp 20% der Patienten, die ihrer Beziehung zum Arzt als nicht gut bewerteten, äußerten einen Wunsch, dagegen nur 8,2% der Patienten, die diese Beziehung als gut oder sehr gut empfanden.
Das Fazit dieser Studie lautet: Patienten äußern nicht häufig einen Wunsch oder eine Forderung. Wenn sie aber etwas wünschen oder fordern, bewerten das die Ärzte in den meisten Fällen als angemessen und setzen es auch um. Die wenigen als nicht angemessen bewerteten Wünsche und Forderungen setzten sie in den meisten Fällen nicht um.
In einem begleitenden Editorial bezeichnet der Onkologe Anthony Back den "fordernden Patienten", der die Gesundheitsausgaben in die Höhe treibt, als Mythos, der auf paternalistischen Sichtweisen beruhe. Vielmehr wandele sich die Arzt-Patient-Beziehung und die Ärzte seien gefordert auf die Kommunikationsbedürfnisse der heutzutage besser informierten und vorbereiteten Patienten einzugehen.
Gogineni K, Shuman KL, Chinn D, Gabler NB, Emanuel EJ: Patient demands and requests for cancer tests and treatments. JAMA Oncology 2015, 1(1):33-39.
Volltext
David Klemperer, 13.8.15
Beteiligung von Krebspatienten bei Behandlungsentscheidungen verbessert die Versorgungsqualität

Eine amerikanische Studie befasste sich mit dem Zusammenhang von Shared Decision Making und der Versorgungsqualität aus Patientensicht.
Patienten mit Darmkrebs oder Lungenkrebs, die angeben, dass der Arzt die Behandlungsentscheidungen kontrolliert, bewerten die Qualität der Versorgung und die ärztliche Kommunikation als weniger gut im Vergleich zu den Patienten, die an den Entscheidungen beteiligt sind.
Dies ist das Ergebnis Befragung von über 5000 Patienten, die zwischen 2003 und 2005 eine Darmkrebs- oder Lungenkrebsdiagnose erhalten haben.
3 bis 6 Monate nach der Diagnosestellung waren die Patienten befragt worden nach
• ihrer Bewertung der Behandlungsqualität
• der bevorzugten und der tatsächlichen Rolle bei Entscheidungen
• ihrer Bewertung der ärztlichen Kommunikation.
Die Rolle bei Entscheidungen wurde in die Kategorien "patientenkontrolliert", "Shared Decision Making" und "arztkontrolliert" unterteilt.
Die Mehrheit (58%) der 5315 Patienten gab den Wunsch nach Shared Decision Making an, 36% bevorzugten die patientenkontrollierte Rolle und 6% die arztkontrollierte Rolle. 42% der 10.817 Behandlungsentscheidungen betrafen Operationen, 36% Chemotherapie und 22% Strahlentherapie.
Auch Patienten, die sich nicht beteiligen möchten, bewerten die Qualität der Versorgung der Kommunikation tendenziell höher, wenn der Arzt sie beteiligte.
Kehl KL, Landrum M, Arora NK, et al. Association of actual and preferred decision roles with patient-reported quality of care: Shared decision making in cancer care. JAMA Oncology 2015. Abstract
David Klemperer, 6.8.15
Je nach Thema bewirken auch Arzt-Ratschläge nichts: Das Beispiel Impfen.
 Entscheidungen für oder gegen eine gesundheitsbezogene Maßnahme (z.B. Auswahl eines Krankenhauses, Durchführung einer Früherkennungsuntersuchung) hängen oft von der Kommunikation mit Ärzten bzw. deren Empfehlungen ab. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, wo also gute Aufklärung durch Ärzte wirkungslos ist, zeigt eine gerade veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie über die Häufigkeit mit der Eltern zögern, ihre Kinder impfen zu lassen und die Selbstwirksamkeit von Ärzten.
Entscheidungen für oder gegen eine gesundheitsbezogene Maßnahme (z.B. Auswahl eines Krankenhauses, Durchführung einer Früherkennungsuntersuchung) hängen oft von der Kommunikation mit Ärzten bzw. deren Empfehlungen ab. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, wo also gute Aufklärung durch Ärzte wirkungslos ist, zeigt eine gerade veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie über die Häufigkeit mit der Eltern zögern, ihre Kinder impfen zu lassen und die Selbstwirksamkeit von Ärzten.
An der Studie im US-Bundesstaat Washington beteiligten sich 56 Kliniken und 347 jungen Mütter. Bevor die Mütter in der Interventionsgruppe unmittelbar nach der Geburt eines gesunden Kindes umfassend und mittels eines 45-minütigen persönlichen Gesprächs über den Nutzen und die Risiken von Impfungen informiert wurden bewegte sich der Anteil impfzögerlicher Mütter nach eigenen Angaben zwischen 9,8% und 7,5%. In der Kontrollgruppe bewegte sich dieser Anteil zwischen 12,6% und 8%. In einer zweiten Befragung nach rund 6 Monaten unterschieden sich die Anteile der Mütter, die zögerten ihre Kinder impfen zu lassen bzw. der Grad der Selbstwirksamkeit der Ärzte, nicht und bewegten sich in beiden Gruppen um die 8%.
Offensichtlich sind Vorbehalte und Befürchtungen vor dem Impfen so stark untermauert, dass selbst kognitive und motivationale Aufklärung durch Ärzte wirkungslos sind.
Von dem am 1. Juni 2015 online in der us-amerikanischen Fachzeitschrift "Pediatrics" veröffentlichten Aufsatz Physician Communication Training and Parental Vaccine Hesitancy: A Randomized Trial von Nora B. Henrikson et al. gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 1.6.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 4 - Mit Sicherheit nutzlos, trotzdem verbreitet: Krebsfrüherkennung bei Alten und Kranken
 Krebsfrüherkennung hat dann einen Nutzen, wenn die Vorverlegung der Diagnose eine Therapie ermöglicht, die zu einer niedrigeren Sterblichkeit und längeren Lebenserwartung führt, als wenn die Krebserkrankung erst nach Auftreten von Symptomen behandelt wird. Als nützlich in diesem Sinne gilt derzeit die Früherkennung von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs, wobei der Nutzen der Brustkrebsfrüherkennung durch neuere Studienergebnisse in Frage gestellt ist (siehe Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering).
Krebsfrüherkennung hat dann einen Nutzen, wenn die Vorverlegung der Diagnose eine Therapie ermöglicht, die zu einer niedrigeren Sterblichkeit und längeren Lebenserwartung führt, als wenn die Krebserkrankung erst nach Auftreten von Symptomen behandelt wird. Als nützlich in diesem Sinne gilt derzeit die Früherkennung von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs, wobei der Nutzen der Brustkrebsfrüherkennung durch neuere Studienergebnisse in Frage gestellt ist (siehe Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering).
In jedem Fall ist der Nutzen der Krebsfrüherkennung naturgemäß in einer nicht nahen Zukunft zu erwarten. Daher werden in Leitlinien zur Krebsfrüherkennung zumeist Obergrenzen für das Alter bzw. für die zu erwartende verbleibende Lebenszeit angegeben.
Eine amerikanische Untersuchung ging der Frage nach, ob auch Personen, die aufgrund von Alter und/oder Krankheit eine niedrige verbleibende Lebenserwartung haben, Krebsfrüherkennungsuntersuchungen erhalten.
Datenbasis ist die jährliche bevölkerungsweite Befragung National Health Interview Survey (NHIS) des amerikanischen National Center for Health Statistics.
In den Jahren 2000 bis 2010 wurden mehrfach Fragen nach der Teilnahme an der Früherkennung von Brustkrebs, Prostatakrebs, Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs gestellt. 27.404 Teilnehmer waren 65 Jahre alt oder älter und wurden in 5 Altersklassen (65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 Jahre oder älter) sowie mit Hilfe eines validierten Mortalitätsindex in 4 Mortalitätsklassen eingeteilt - solche mit niedrigem (<25%), mittlerem (25%-49%), hohem (50-74%) und sehr hohem (75% oder höher) Risiko, in den nächsten 9 Jahren zu sterben.
Das Ergebnis lautet: Mit steigendem 9-Jahres-Mortalitätsrisiko nehmen die Screeningraten zwar ab, liegen aber immer noch hoch.
Trotz einem Risiko von 75% und mehr, innerhalb der nächsten 9 Jahre zu sterben,
erhielten eine Früherkennungsuntersuchung
• 54,6% der Männer in letzten 2 Jahren für Prostatakrebs
• 37,5% der Frauen in letzten 2 Jahren für Brustkrebs
• 30.6% der Frauen in den letzten 3 Jahren für Gebärmutterhalskrebs
• 40,8% der Männer und Frauen in den letzten 5 Jahren für Darmkrebs.
Und selbst bei einem Risiko von 75% oder mehr in den kommenden 5 Jahren zu sterben, ist der Anteil derjenigen, die eine Früherkennungsuntersuchung erhalten haben noch hoch: Prostatakrebs 51,6%, Brustkrebs 34,2%, Gebärmutterhalskrebs 25,7%, Darmkrebs 40,8%.
Für die genannten Krebsarten erhält selbst in der höchsten Altersgruppe (84 Jahre und älter) ein nennenswerter Anteil Früherkennungsuntersuchungen.
Höhere Bildung, Krankenversicherungsschutz und Ehe gingen mit einher, Früherkennungsuntersuchungen zu erhalten.
Die Autoren nennen mehrere mögliche Gründe für die Ergebnisse. So gibt es bislang keine einfache Methode, das 10-Jahres-Mortalitätsrisiko für den individuellen Patienten zu berechnen. Aber selbst wenn die verbleibende Lebenserwartung erkennbar niedrig ist, könnte es dem Arzt schwer fallen, dies dem Patienten durch Einstellen der Früherkennungsuntersuchungen mitzuteilen bzw. dem Patienten könnte es schwer fallen dies zu akzeptieren.
Anzumerken bleibt, dass Ärzte und folglich auch Patienten den Nutzen von Krebsfrüherkennung allgemein überschätzen und die möglichen Schäden unterschätzen, wie hier schon vielfach berichtet (siehe Forum Gesundheitspolitik, Kategorie Früherkennung, Screening). Das Screenen auf Krebserkrankungen von sehr alten und sehr kranken Personen unterstreicht diesen Sachverhalt eindrucksvoll und weist auf einen Bereich hin, in dem weniger mehr wäre: weniger medizinische Aktivität würde hier das Wohlbefinden der Patienten fördern und die Verschwendung von Ressourcen mindern.
Royce TJ, Hendrix LH, Stokes WA, et al. Cancer screening rates in individuals with different life expectancies. JAMA Internal Medicine 2014. Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 3 - "Falscher Alarm" bei Brustkrebsfrüherkennung bewirkt psychische Langzeitschäden
 Als positiver Befund wird bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie eine Gewebsverdichtung bezeichnet. "Richtig positiv" ist der Röntgenbefund, wenn die Abklärung ergibt, das die Verdichtung Tumorzellen enthält, "falsch positiv" hingegen, wenn die Veränderungen gutartig sind. Letzteres wird auch als "falscher Alarm" bezeichnet.
Als positiver Befund wird bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie eine Gewebsverdichtung bezeichnet. "Richtig positiv" ist der Röntgenbefund, wenn die Abklärung ergibt, das die Verdichtung Tumorzellen enthält, "falsch positiv" hingegen, wenn die Veränderungen gutartig sind. Letzteres wird auch als "falscher Alarm" bezeichnet.
Falsch positive Befunde sind häufig - in Deutschland geht man davon aus, dass im Screening-Programm für 50- bis 69-jährige Frauen 200 von 1000 Frauen einmal einen falsch positiven Befund erhalten (siehe Kennzahlen Mammographie, Vs. 1.2, 2010, S. 4).
Eine dänische Studie untersuchte die psychischen Folgen eines falsch-positiven Befundes.
In die Studie wurden 454 Frauen mit positivem Befund (Gewebsverdichtung) in der Früherkennungs-Mammographie in den Jahren 2004 bzw. 2005 im Rahmen des dänischen Brustkrebs-Screening-Programms aufgenommen. Bei 174 ergab die Abklärung der Gewebsverdichtung die Diagnose Brustkrebs ("richtig positiv"), bei 272 konnte ein Brustkrebs ausgeschlossen werden ("falsch positiv"). Zum Vergleich wurden 864 Frauen mit Normalbefund hinzugezogen.
Der psychosoziale Status wurde mit dem "Consequences of Screening in Breast Cancer (COS-BC) questionnaire" (Link) gemessen.
Dieses Befragungsinstrument wurde spezifisch für die Brustkrebsfrüherkennung entwickelt und erfasst Outcomes wie Angst, Verhalten, Gefühl der Niedergeschlagenheit, Schlafprobleme, Ausgeglichenheit, soziale Kontakte und Sexualität.
Die Messung erfolgte zu 5 Zeitpunkten (1, 16, 18 und 36 Monate) und erlaubt somit Aussagen über den Verlauf der psychischen Folgen Unklar war bisher, ob die Ängste und Verunsicherungen, die bei der Eröffnung eines positiven Befundes entstehen, bei der Information, dass es sich nicht um Krebs handelt, wieder verschwinden - ob also bei der Entwarnung nach falschen Alarm alles wieder gut ist.
Frauen mit falsch positivem Screening-Ergebnis berichteten in der kritischen Phase vor der endgültigen entlastenden Diagnose aber auch 4 Wochen danach stärker negative psychosoziale Konsequenzen für alle gemessenen Outcomes im Vergleich zu Frauen mit Normalbefund.
Im Vergleich zu Frauen mit richtig positivem Befund (Brustkrebs-Diagnose) waren in den 6 Monaten nach der endgültigen entlastenden Diagnose die negativen Folgen für die Outcomes existentielle Werte und innere Ruhe genauso stark ausgeprägt, in den übrigen Outcomes deutlich weniger negativ. Die Werte der Frauen besserten sich für beide Gruppen bis zum 18. Monat, danach aber nur noch geringfügig.
3 Jahre nach der Information, keinen Brustkrebs zu haben, bestanden weiterhin deutliche negative psychosoziale Folgen, die etwa in der Mitte zwischen den Frauen mit negativem Mammographie-Ergebnis und den Frauen mit Brustkrebs liegen.
Entwarnung nach einem positiven Screening-Befund führte in dieser Studie also nicht zu einem Verschwinden der psychischen Beeinträchtigung, vielmehr scheint auch ein falsch positiver Screning-Befund ein anhaltendes Trauma auszulösen.
Die schädlichen psychischen Effekte wiegen angesichts des in Frage gestellten Nutzens des Brustkrebs-Screenings (wir berichteten) umso schwerer.
Brodersen J, Siersma VD. Long-Term Psychosocial Consequences of False-Positive Screening Mammography. The Annals of Family Medicine 2013;11:106-15 Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 2 - Quantität und Qualität der Studien zu psychischen Folgen von Krebsfrüherkennung unzulänglich
 Ziel der systematischen Übersichtsarbeit war die Untersuchung der methodischen Qualität von Studien, die sich mit psychischen Folgen von Früherkennung befassen.
Ziel der systematischen Übersichtsarbeit war die Untersuchung der methodischen Qualität von Studien, die sich mit psychischen Folgen von Früherkennung befassen.
Ausgewertet wurden 68 Studien, die sich mit psychologischen Schäden bei der Früherkennung von 2 Krebserkrankungen und 4 Nicht-Krebs-Erkrankungen befassten
• PSA-Screening für Prostatakrebs
• Niedrigdosis- Computertomographie für Lungenkrebs
• Knochendichtemessung für Osteoporose
• Ultraschalluntersuchung Bauchaortenaneurysma
• Doppler-Sonographie der Halsgefäße zur Erfassung einer asymptomatischen Stenose (Verengung)
42 der 68 Studien bezogen sich auf das Prostatakrebs-Screening, 11 auf das Lungenkrebs-Screening und die übrigen 15 Studien auf die 3 Nicht-Krebs-Erkrankungen.
Als "psychologische Last" (psychologic burden) von Früherkennungsuntersuchungen bezeichnen die Autoren die Häufigkeit des Auftretens sowie der Schwere der psychologischen Reaktion, die Dauer und die Auswirkungen auf den Alltag der Patientin bzw. des Patienten und seiner bzw. ihrer Familie.
Schäden können während der gesamten "Screening-Kaskade" auftreten:
• vor dem Screening (Antizipation eines positiven Ergebnisses)
• in der Wartezeit unmittelbar nach dem Screening (Angst vor einem positiven Ergebnis)
• in der Abklärungsphase bei einem positiven Screening-Ergebnis
• nach der Bestätigung eines positiven Ergebnisses
• im Zusammenhang mit der Behandlung.
Als methodischen Standard fordern die Autoren Längsschnittstudien mit krankheitsspezifischen Messinstrumenten. Weniger geeignet seien hingegen Querschnittstudien mit allgemeinen Maßen der Lebensqualität (wie z.B. SF-36).
Von den 68 Studien sind 36 als Längsschnitt und 11 als Querschnitt durchgeführt worden, 19 sind qualitativer Natur und 2 nutzen unterschiedliche Methoden. 16 der 49 nicht-qualitativen Studien erfüllten die Kriterien Längsschnitt und krankheitsspezifische Maße für die psychologische Last. Dies traf für 9 der 30 Studien zum Prostatakrebs-Screening und für 7 der 9 Studien zum Lungenkrebs-Screening zu.
Die Autoren kommen zum Schluss, dass die Zahl, das Design und die Maße der Studien zu den psychologischen Schäden der 5 Früherkennungsuntersuchungen insgesamt inadäquat sind. Es bestünden erhebliche Evidenzlücken.
Die Studie stellt einen weiteren Hinweis dafür dar, dass die in Deutschland durch das Patientenrechtegesetz und das Krebsfrüherkennungsgesetz geforderte informierte Entscheidung allein an fehlenden Informationen infolge unzulänglicher Wissenschaft scheitert. Angesichts der vorgesehenen Ausweitung von Gesundheitsuntersuchungen im Rahmen des Präventionsgesetzes sollte die Evidenzlücken dringend und zügig gefüllt werden.
DeFrank J, Barclay C, Sheridan S, et al. The Psychological Harms of Screening: the Evidence We Have Versus the Evidence We Need. Journal of General Internal Medicine 2014:1-7 Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 1 - Schäden werden nicht ausreichend erforscht
 In dieser Studie ging es um die Frage, inwieweit in randomisierten kontrollierten Studien zum Krebsscreening neben dem Nutzen auch die Schäden untersucht wurden.
In dieser Studie ging es um die Frage, inwieweit in randomisierten kontrollierten Studien zum Krebsscreening neben dem Nutzen auch die Schäden untersucht wurden.
Ausgewertet wurden 198 Veröffentlichungen, die sich auf 57 Studien mit insgesamt 3.419.036 Teilnehmern bezogen.
Als Nutzen von Krebsscreening gelten die Senkung
• der Inzidenz (Neuauftreten) der jeweiligen Krebsart
• der krebsspezifischen Mortalität und
• der Gesamtmortalität.
Die Studien befassten sich mit dem Screening von
• Brustkrebs (Selbstuntersuchung der Brust, Mammographie)
• Dickdarmkrebs (Stuhlbluttest, Sigmoidoskopie/"kleine Darmspiegelung
• Leberkrebs (Ultraschall, CA-125)
• Lungenkrebs (Röntgen bzw. Computertomographie des Brustkorbs)
• Mundhöhlenkrebs (visuelle Inspektion)
• Eierstockkrebs (Ultraschall, CA-125) und
• Prostatakrebs (PSA, Tastuntersuchung).
Bezogen auf die 57 Studien wurden in folgender Häufigkeit auch Schäden untersucht:
• in 4 Studien die Überdiagnose (Tumoren, die nie symptomatisch geworden wären)
• in 2 Studien falsch-positive Ergebnisse ("falscher Alarm", z.B. Gewebsverdichtung in der Mammographie, die sich bei weiterer Abklärung als gutartig erweist)
• in 5 Studien negative psychosoziale Folgen
• in 11 Studien körperliche Schäden und
• in 27 Studien die Notwendigkeit invasiver Folgeuntersuchungen mit den jeweils eigenen Risiken.
Der wichtigste Parameter für den Nutzen, die Senkung der Gesamtsterblichkeit, wurde in 34 der 57 Studien berechnet, der Surrogatparameter Senkung der krebsspezifischen Inzidenz in 51 der 57 Studien.
Dieser Studie zufolge werden die Schäden von Krebsscreening selten untersucht.
Krebsfrüherkennung richtet sich an gesunde Menschen. Die Nutzenwahrscheinlichkeit für den Einzelnen ist eher niedrig und geht mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit für gravierende Schäden einher. Eine Entscheidung über die Teilnahme muss sich auf die realistische Abwägung von Informationen über Nutzen und Schaden gründen. Dass Forscher darauf verzichten, Informationen über Schäden zu generieren ist außerordentlich bedenklich und weist auch auf ein Versagen der Ethikkomitees hin, die solche Studien nicht genehmigen dürften.
Heleno B, Thomsen MF, Rodrigues DS, et al. Quantification of harms in cancer screening trials: literature review. BMJ 2013;347 Open Access
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung - 4 neuere Studien
 Für Krebsfrüherkennung gilt, was für alle anderen medizinischen Interventionen ebenfalls zutrifft: der erhoffte Nutzen geht stets mit möglichen Schäden einher. Eine informierte Entscheidung sollte auf der Abwägung von Nutzenwahrscheinlichkeiten und Schadensrisiken durch den Patienten mit Unterstützung des Arztes im Sinne des Shared Decision Making erfolgen.
Für Krebsfrüherkennung gilt, was für alle anderen medizinischen Interventionen ebenfalls zutrifft: der erhoffte Nutzen geht stets mit möglichen Schäden einher. Eine informierte Entscheidung sollte auf der Abwägung von Nutzenwahrscheinlichkeiten und Schadensrisiken durch den Patienten mit Unterstützung des Arztes im Sinne des Shared Decision Making erfolgen.
Von diesem Ideal ist der medizinische Alltag weit entfernt. Diesbezügliche Studien haben wir im Forum fortlaufend aufgegriffen (Rubrik Früherkennung, Screening).
Diese Studien belegen eine ungute Situation, die sich kurzgefasst folgendermaßen darstellt:
• Viele Ärzte sind über die Wahrscheinlichkeiten von Nutzen und Schaden der Früherkennung schlecht informiert. Sie kennen die Zahlen nicht bzw. verstehen sie nicht.
• Daraus folgend kommunizieren Ärzte den Nutzen und den Schaden von Früherkennung unzulänglich.
• Patienten haben daher teils falsche Vorstellungen davon, was Früherkennung überhaupt ist und unrealistische Vorstellungen von Nutzen und Schaden.
• In Studien werden die Schäden unzureichend untersucht, wenn dann noch eher körperliche als psychische Schäden, obwohl auch letztere gravierend sein können.
Fortschritte sind erkennbar. So hat der Gesetzgeber kürzlich für organisierte Früherkennungsprogramme die "mit der Einladung erfolgende umfassende und verständliche Information der Versicherten über Nutzen und Risiken der jeweiligen Untersuchung" im §25a SGB V festgeschrieben.
Zur Schärfung des Problembewusstseins werden im Folgenden werden 4 neuere Studien vorgestellt.
Die Studien belegen folgende Probleme bzw. Verbesserungsbereiche:
1. In randomisierten kontrollierten Studie zur Krebsfrüherkennung werden die Schäden unzulänglich untersucht. Forum-Beitrag: Schäden werden nicht ausreichend erforscht.
Studie: Heleno B, Thomsen MF, Rodrigues DS, et al. Quantification of harms in cancer screening trials: literature review. BMJ 2013;347.
2. Wenn psychische Schäden untersucht werden, dann ist die Methodik häufig unzulänglich.
Forum-Beitrag: Quantität und Qualität der Studien zu psychischen Folgen von Krebsfrüherkennung unzulänglich
Studie: DeFrank J, Barclay C, Sheridan S, et al. The Psychological Harms of Screening: the Evidence We Have Versus the Evidence We Need. Journal of General Internal Medicine 2014:1-7.
3. Ein methodisch hochwertige Studie zu den psychischen Langzeitfolgen von falsch-positiven Screeningbefunden zeigt deutliche negative Folgen noch nach 2 Jahren
Forum-Beitrag: "Falscher Alarm" bei Brustkrebsfrüherkennung bewirkt psychische Langzeitschäden.
Studie: Brodersen J, Siersma VD. Long-Term Psychosocial Consequences of False-Positive Screening Mammography. The Annals of Family Medicine 2013;11(2):106-15.
4. Krebsfrüherkennung wird auch an Personen durchgeführt, die sicher keinen Nutzen davon haben können.
Forum-Beitrag: Mit Sicherheit nutzlos, trotzdem verbreitet: Krebsfrüherkennung bei Alten und Kranken.
Studie: Royce TJ, Hendrix LH, Stokes WA, et al. Cancer screening rates in individuals with different life expectancies. JAMA Internal Medicine 2014.
David Klemperer, 19.2.15
Beratung über sexuelle Aktivitäten nach Herzinfarkt Mangelware und trotz Leitlinienevidenz restriktiv und frauen-/altenfeindlich
 Für viele PatientInnen, die einen Herzinfarkt hatten, gehören sexuelle Aktivitäten zu den wichtigen Merkmalen einer Rückkehr ins normale und gute Leben und tragen dazu positiv bei. Deshalb empfehlen die aktuellen US-Leitlinien zur Akutbehandlung und Rehabilitation von Herzinfarktpatienten auch ausdrücklich, dass Patienten mit einem komplikationsfreien Herzinfarkt (HI) und sofern sie keine unerwünschten Herz-/Kreislaufsymptome bei leichter oder mittelmäßiger körperlichen Aktivität haben, eine Woche nach ihrem Infarkt oder kurz später wieder sexuell aktiv sein können.
Für viele PatientInnen, die einen Herzinfarkt hatten, gehören sexuelle Aktivitäten zu den wichtigen Merkmalen einer Rückkehr ins normale und gute Leben und tragen dazu positiv bei. Deshalb empfehlen die aktuellen US-Leitlinien zur Akutbehandlung und Rehabilitation von Herzinfarktpatienten auch ausdrücklich, dass Patienten mit einem komplikationsfreien Herzinfarkt (HI) und sofern sie keine unerwünschten Herz-/Kreislaufsymptome bei leichter oder mittelmäßiger körperlichen Aktivität haben, eine Woche nach ihrem Infarkt oder kurz später wieder sexuell aktiv sein können.
Die Wirklichkeit sieht nach den Ergebnissen einer Studie (Baseliner und Follow up nach einem Monat) mit 2.349 weiblichen und 1.152 männlichen, achtzehn- bis fünfundfünfzigjährigen erwachsenen (Durchschnittsalter 48 Jahre) HI-Patienten in den USA und Spanien in jeder Hinsicht anders aus:
• Während des ersten Monats nach ihrem Infarkt sprachen gerade mal 12% der weiblichen und 19% der männlichen HI-Patienten mit ihren Ärzten über ihre Sexualpraxis.
• Von diesen Patienten wurde gerade mal einem Drittel gesagt, sie könnten ohne Einschränkungen Geschlechtsverkehr haben. Zwei Drittel erhielten den ärztlichen Rat so passiv wie möglich zu bleiben und auf einen niedrigen Puls zu achten - wahrhaft schlechte Bedingungen für guten Sex.
• Frauen, Ältere und Personen mit sexueller Inaktivität zu Beginn oder kurz vor der Behandlung warenm besonders vom Nichterhalt von Beratung betroffen.
• Unter den Patienten, die überhaupt beraten wurden, wurden den Spanierinnen signifikant häufiger restriktive Ratschläge gegeben als den Amerikanerinnen.
Die AutorInnen der Studie empfehlen dringend, die Beratung über die bedenkenlose Möglichkeit sexueller Aktivitäten zum festen Bestandteil der Beratung über die Rückkehr zu sonstigen Aktivitäten und zur Arbeit zu machen.
Der Aufsatz Sexual Activity and Counseling in the First Month After Acute Myocardial Infarction (AMI) Among Younger Adults in the United States and Spain: A Prospective, Observational Study von Stacy Tessler Lindau et al. ist am 15. Dezember 2014 online vor dem Druck in der Zeitschrift "Circulation" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.12.14
Präferenzfehldiagnose bei Stentimplantation und beim Prostatakrebs
 Eine präferenzsensitive Entscheidungssituation liegt vor, wenn es für ein medizinisches Problem mehr als eine Möglichkeit gibt, angemessen damit umzugehen. Dann sollten Patienten umfassend über die unterschiedlichen Vorgehensweisen informiert werden, damit sie jeweils Nutzen und Schaden abwägen können. Einseitige Informationen sind mit dem Recht auf Selbstbestimmung und mit der Autonomie des Patienten nicht vereinbar. Stimmen Patienten einem Eingriff nur zu, weil ihnen relevante Informationen vorenthalten wurden, liegt der Entscheidung eine Präferenzfehldiagnose zugrunde (wir berichteten)..
Eine präferenzsensitive Entscheidungssituation liegt vor, wenn es für ein medizinisches Problem mehr als eine Möglichkeit gibt, angemessen damit umzugehen. Dann sollten Patienten umfassend über die unterschiedlichen Vorgehensweisen informiert werden, damit sie jeweils Nutzen und Schaden abwägen können. Einseitige Informationen sind mit dem Recht auf Selbstbestimmung und mit der Autonomie des Patienten nicht vereinbar. Stimmen Patienten einem Eingriff nur zu, weil ihnen relevante Informationen vorenthalten wurden, liegt der Entscheidung eine Präferenzfehldiagnose zugrunde (wir berichteten)..
Zwei klassische Beispiele für präferenzsensitive Entscheidungen sind die Implantation eines Stents (Gefäßprothese) in eine Herzkranzarterie bei der stabilen, also nicht akuten koronaren Herzkrankheit (Verengung von einem oder von mehreren Herzkranzgefäßen) (wir berichteten) sowie die Behandlung des Prostatakarzinoms (wir berichteten).
Der Stent als zusätzliche Maßnahme zur medikamentösen Behandlung dient bei der stabilen koronaren Herzkrankheit allein zur Linderung der Symptome. Ein Stent hat nach heutigem Wissen keinen Einfluss auf das Risiko eines Herzinfarktes oder auf die Lebenserwartung.
Beim Prostatakarzinom stehen verschiedene Behandlungsmethoden zu Verfügung, neben der Operation die Brachytherapie (interne Bestrahlung), die externe Strahlentherapie und das beobachtende Abwarten. Nach bisherigem Wissen tragen Operation und Bestrahlung, wenn überhaupt, dann nur wenig zur Verbesserung des Überlebens bei - dem bestenfalls geringen Nutzen stehen jedoch gravierend Schäden gegenüber, wie Impotenz und Inkontinenz.
Patienten, die auf einen Stent verzichten bzw. ihr Prostatakarzinom nicht mit Operation oder Bestrahlung behandeln lassen, verschlechtern ihre Prognose also nicht.
Fowler und Kolleginnen befragten 114 Patienten, die einen Stent und 342 Patienten, die eine Prostataoperation erhalten hatten, danach, ob die Ärzte sie in gleichem Maße über den durchgeführten Eingriff wie über andere Vorgehensweisen informiert hatten. Der Eingriff hatte im Durchschnitt 14 Monate vorher stattgefunden.
54% der Stent-Patienten gaben an, im Monat vor dem Eingriff keinen Schmerz im Brustkorb oder im Arm gehabt zu haben, also bezüglich der Verengung eines Herzkranzgefäßverengung beschwerdefrei gewesen zu sein. Bei ihnen gab es somit medizinisch keinen Grund, einen Stent einzusetzen. 10% gaben an, vom Arzt über andere Behandlungsmöglichkeiten - Bypass-Operation oder medikamentöse Behandlung - informiert worden zu sein. Nur 6% sind über die alleinige medikamentöse Behandlung als ernsthaft zu erwägende Option informiert worden.
77% gaben an, vom Arzt ausführlich ("a lot") über den Stent informiert woden zu sein während 19% angaben, der Arzt habe sie ausführlich ("a lot") oder etwas ("some") darüber informiert, was gegen den Eingriff spricht. Nur 16% gaben an, nach ihrer Behandlungspräferenz gefragt worden zu sein.
Beim Prostatakarzinom 64% der Patienten gaben an, dass der Arzt mindestens eine andere Behandlungsform ernsthaft mit ihnen besprochen habe, bei einem Drittel das beobachtende Abwarten. Bei 95% besprach der Arzt die Operation, bei 63% sprach er über Argumente gegen Operation. 76% der Patienten gaben an, dass der Arzt sie nach ihrer Präferenz gefragt habe.
Die ethisch unabdingbare Präferenzklärung bei der Entscheidungsfindung zur Frage der Stent-Implantation bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit war in dieser Studie eher die Ausnahme als die Regel.
Auch beim Prostatakarzinom brachten die Ärzte die Gründe für die Operation häufiger zur Sprache als die Gründe dagegen. Häufiger als beim Stent informierten Ärzte die Patienten über andere Behandlungsformen, trotzdem erhielten nur ein Drittel Informationen über das beobachten und nur drei Viertel wurden nach Präferenz befragt.
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Ärzte in dieser Studie kommunikative und ethische Standards nicht einhalten. Ethisch besonders gravierend erscheint es, dass ein Teil der Patienten dem jeweiligen Eingriff nur zugestimmt hat, weil ihm relevante Informationen vorenthalten wurden.
Es dürfte nahe liegen, das von den Autoren entwickelte Befragungsinstrument (siehe Anhang) zur Qualitätssicherung des Entscheidungsprozesses einzusetzen.
Fowler F, Jr., Gallagher P, Bynum JW, Barry MJ, Lucas FL, Skinner JS. Decision-Making Process Reported by Medicare Patients Who Had Coronary Artery Stenting or Surgery for Prostate Cancer. Journal of General Internal Medicine 2012;27(8):911-16.
Volltext Open Access
Mulley AG, Trimble C, Elwyn G. Stop the silent misdiagnosis: patients' preferences matter. BMJ 2012;345. Link
Forum Gesundheitspolitik. Bessere Behandlungsergebnisse durch Information und Beteiligung Link
Anhang
Four survey questions are the focus of this analysis:
1. Before this (INTERVENTION), did a doctor talk with you about (EACH ALTERNATIVE)?
1a. IF YES, Did the doctor talk about (EACH ALTERNATIVE) as a choice to seriously consider?
Alternatives to prostate surgery were external beam radiation, radioactive seed implants, and not having active treatment right away. The alternatives to stents were CABG and using medicine only.
2. Before the (INTERVENTION) how much did a doctor talk with you about the reasons to have (INTERVENTION) — a lot, some, a little, or not at all?
3. Before the (INTERVENTION), how much did a doctor talk with you about why you might not want to have (INTERVENTION) — a lot, some, a little, not at all?
4. Before this (INTERVENTION) did a doctor ask you if you wanted to have (INTERVENTION) instead of doing something else to manage your (CONDITION)?
David Klemperer, 28.7.14
Unterschiedliche Prioritätensetzung erschwert gemeinsame Entscheidungsfindung: Das Beispiel Empfängnisverhütung.
 Zu den teilweise folgenreichen Fehlschlüssen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung gehört, dass PatientInnen und Leistungsanbieter wie Ärzte oder Apotheker bei gemeinsamen Gesprächen und Entscheidungen an denselben Aspekten der Leistung interessiert sind bzw. identische Interessenhierarchien oder Prioritäten haben. Dies kann dazu führen, völlig aneinander vorbei zu reden und angeblich gemeinsame Entscheidungen zu treffen, deren Inhalte manche PatientInnen bereits beim Verlassen der Praxis oder Apotheke als persönlich irrelevant vergessen haben bzw. die sie nicht befolgen.
Zu den teilweise folgenreichen Fehlschlüssen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung gehört, dass PatientInnen und Leistungsanbieter wie Ärzte oder Apotheker bei gemeinsamen Gesprächen und Entscheidungen an denselben Aspekten der Leistung interessiert sind bzw. identische Interessenhierarchien oder Prioritäten haben. Dies kann dazu führen, völlig aneinander vorbei zu reden und angeblich gemeinsame Entscheidungen zu treffen, deren Inhalte manche PatientInnen bereits beim Verlassen der Praxis oder Apotheke als persönlich irrelevant vergessen haben bzw. die sie nicht befolgen.
Die Tatsache dieses Problems hat eine aktuelle Befragungsstudie mit 417 Frauen zwischen 14 und 45 Jahren und 188 verschiedenen Anbietern von kontrazeptiven Leistungen in den USA erneut gut belegt. Beiden Gruppen sollten insgesamt 34 Fragen zu wichtigen, bei der Verordnung und Einnahme solcher Mittel zu beachtenden Aspekten bewerten.
Die Ergebnisse im Detail:
• Bei 18 Fragen waren sich die beiden Befragtengruppen einig. Bei den restlichen Gruppen traten deutliche Unterschiede auf.
• Die Hauptanliegen für die befragten Nutzerinnen von Empfängnisverhütung waren, wie wirksam und sicher die jeweilige Methode wie empfängnisverhütend wirkt. Die Hauptanliegen der Anbieter waren dagegen die Kosten-Nutzenrelation und wie oft die Patientin leitliniengerecht daran erinnert werden müssen, die Methode zu nutzen.
• Für 41,7% der Nutzerinnen gehörte die Sicherheit der Methode zu den drei Spitzenanliegen, ein Interesse, das aber umgekehrt nur 20,1% der Ärzte für besonders wichtig hielten.
• Zu den drei Hauptfragen der Nutzerinnen gehörte schließlich noch die nach den potenziellen Nebenwirkungen (26,3%), was wiederum nur für 16,3% der Anbieter zu den Hauptfragen gehörte.
Da es ein solches Auseinanderklaffen der Interessen zwischen Patienten und Ärzten etc. auch bei anderen Leistungen gibt oder geben könnte, sollte z.B. bei gravierender Häufung von fehlender Therapietreue oder Unzufriedenheit von Patienten zunächst an solche möglicherweise dafür ursächlichen Unterschiede gedacht werden.
Der Aufsatz What matters most? The content and concordance of patients' and providers' information priorities for contraceptive decision making von Kyla Z. Donnelly et al. ist am 1, Mai 2014 als "article in press" der internationalen Fachzeitschrift für reproduktive Gesundheit "Contraception" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.6.14
"Noncompliance kann tödlich enden" oder warum es beim Entlassungsmanagement in Kliniken manchmal um mehr als warme Worte geht
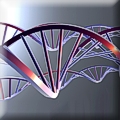 Die Mehrheit der im Krankenhaus behandelten Menschen wird nicht als vollkommen geheilt sondern als mehr oder minder stark behandlungsbedürftig entlassen. Ein Indikator ist, dass diese Personen umden stationären Heilungserfolg erhalten oder verbessern zu können oft kontinuierlich auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sind.
Die Mehrheit der im Krankenhaus behandelten Menschen wird nicht als vollkommen geheilt sondern als mehr oder minder stark behandlungsbedürftig entlassen. Ein Indikator ist, dass diese Personen umden stationären Heilungserfolg erhalten oder verbessern zu können oft kontinuierlich auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sind.
Dass es an der Schnittstelle zur nachstationären Behandlung zu potenziell folgenreichen und unerwünschten Ereignissen kommen kann, zeigt jetzt eine Untersuchung der Einnahme des die Blutgerinnung hemmenden oder "blutverdünnenden" Arzneimittels Clopidogrel nach der Implantation eines Stents. Stents, eine Art gefäßerweiterndes Drahtgeflecht in den Herzkranzgefäßen (mit oder ohne Arzneimittelbeschichtung), werden zur Prävention von schweren oder gar tödlichen Folgen einer Gefäßdurchblutungsstörung eingepflanzt und sind relativ teuer. Damit dieser Schutz wirklich funktioniert, müssen so behandelte Patienten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ohne Unterbrechung das genannte Medikament einnehmen. Wenn die Einnahme um drei oder mehr Tage unterbrochen ist, verdoppelt sein Risiko zu sterben oder innerhalb der zwei Jahre nach der Entlassung mit einem Herzinfarkt erneut in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden - unabhängig von der Art des eingepflanzten Stents. Das höchste Risiko (um das 5,5Fache) für diese Ereignisse besteht in den ersten 30 Tagen nach der Entlassung.
Dass diese dringend notwendige lückenlose medikamentöse Behandlung nicht funktionieren muss, zeigt jetzt eine Untersuchung des gesamten Behandlungsgeschehens von 15.629 Stent-Implantatempfänger im kanadischen British Columbia. Die Patienten, die ihren Stent in den Jahren 2004 bis 2006 erhielten, wurden noch bis zu zwei Jahre nach Entlassung beobachtet. 4.822 von ihnen oder rund 31% hatten das Rezept für das Medikament nicht innerhalb der ersten drei Tage nach Entlassung eingelöst und starteten daher frühestens am vierten Tag mit der notwendigen Behandlung. Die Daten zeigen aber, dass ein Teil der Patienten auch nach fünf und mehr Tagen kein Arzneimittel eingelöst und dann wahrscheinlich auch eingenommen hatte.
Auch wenn nicht geklärt wurde, warum die Patienten ihr Rezept nicht sofort einlösten und unabhängig von einigen methodischen Limitationen der Studie (z.B. keine Randomisierung) sprechen die AutorInnen mit dem folgenden Statement wichtige Leistungen in der Entlassungs- oder Überleitungsphase stationär behandelter Patienten an, die offensichtlich selbst bei derart aufwändigen und riskanten Behandlungen noch nicht überall im Alltag angekommen sind und wichtige Voraussetzungen für die nötige Therapietreue sind: "Interventions to enhance discharge planning, educate patients, simplify regulatory hurdles, and ensure early community pharmacy involvement all have the potential to improve early compliance with medications after hospital discharge and, ultimately, clinical outcomes."
Ob so etwas in Deutschland auch passiert, kann zwar mangels entsprechender Untersuchungen nicht gesichert gesagt oder verneint werden, ist aber angesichts des häufig als verbesserungsbedürftig bewerteten Entlassungsmanagements nicht unwahrscheinlich.
Die am 28. Mai 2014 online in der Fachzeitschrift "Journal of the American Heart Association" veröffentlichte Studie Delay in Filling First Clopidogrel Prescription After Coronary Stenting Is Associated With an Increased Risk of Death and Myocardial Infarction von Nicholas L. Cruden et al. (2014; 3: e000669) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.5.14
Bessere Behandlungsergebnisse durch Information und Beteiligung
 Information und Beteiligung zählen zu den Grundbedürfnissen der meisten Patienten in der medizinischen Behandlung. Studien zu dieser Fragestellung finden sich in der Rubrik Shared Decision Making/Partizipative Entscheidungsfindung.
Information und Beteiligung zählen zu den Grundbedürfnissen der meisten Patienten in der medizinischen Behandlung. Studien zu dieser Fragestellung finden sich in der Rubrik Shared Decision Making/Partizipative Entscheidungsfindung.
Umfassendste Quelle zum Wissen über die Effekte von SDM dürfte die Cochrane Review "Decision aids for people facing health treatment or screening decisions", die 1999 erstmals erschien und zuletzt 2014 aktualisiert wurde. Für die aktuelle Fassung wurden 115 randomisierte kontrollierte Studien zu 46 Entscheidungssituationen mit 34.444 Patienten ausgewertet.
Die 115 Studien untersuchten, welchen Unterschied Decision aids im Vergleich zu herkömmlicher Arzt-Patient-Kommunikation machen. Decision aids bezeichnet Interventionen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung. Dazu zählt, dass den Patienten vermittelt wird, dass eine Entscheidung zu treffen ist und er oder sie Informationen über den Nutzen und die Risiken von Behandlungsoptionen bzw. Screening-Optionen sowie die zu erwartenden Outcomes erhält, um den Nutzen die Risiken vergleichen zu können. Decision aids unterstützen eine Kommunikation im Sinne des Shared Decision Making.
Bezüglich der Dauer des Arzt-Patient-Gesprächs können Decision aids zu einer Verlängerung oder Verkürzung führen oder aber die Dauer bleibt gleich. Im Median erhöht sich die Dauer um 2,55 Minuten, die Verkürzung betrug je nach Studie bis zu 8 Minuten, die Verlängerung bis zu 23 Minuten.
Die Ergebnisse der 118 Studien sind allein wegen Unterschieden in den Fragestellungen, den Methoden und Messinstrumenten nicht einheitlich.
Übergreifend lässt sich jedoch schlussfolgern:
Decision aids
• verbessern das Wissen
• verbessern die Beteiligung
• fördern die Präferenzklärung
• vermitteln eine realistische Wahrnehmung der Outcomes
• verbessern die Arzt-Patient-Kommunikation
• verbessern die Zufriedenheit mit dem Entscheidungsprozess
• vermindern die Inanspruchnahme einiger chirurgischer Eingriffe
• vermindern die Inanspruchnahme einiger Früherkennungsuntersuchungen
• wirken sich nicht negativ auf die Gesundheitsergebnisse aus.
Die Studienergebnisse für den allgemeinen Gesundheitszustand (general health outcomes), für krankheitsspezifische Behandlungsergebnisse wie auch für Therapietreue (Adhärenz) sind eher uneinheitlich.
Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit des Einsatzes von Decision aids zur Verbesserung der Arzt-Patient-Kommunikation. Dabei geht es um die Überwindung eines unhaltbaren, aber noch wenig skandalisierten Sachverhalts: Patienten erhalten Untersuchungen und Behandlungen, die sie ablehnen würden, wenn sie mehr über den Nutzen und die Risiken erfahren hätten - die "stumme Fehldiagnose" (Forum Gesundheitspolitik: "Stumme Fehldiagnose" - vermeidbar durch Shared Decision Making). Ein jüngeres Beispiel für solche einen unhaltbaren Zustand ist das geringe Wissen und die falschen Vorstellungen zum Mammografie-Screening auf Seiten von Gynäkologen (Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken) und auf Seiten der betroffenen Frauen (Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken).
Stacey D, Légaré F, Col Nananda F, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014. Abstract
David Klemperer, 16.5.14
Nutzung von elektronischen Patienteninformationen und Entscheidungshilfen kann Arzt-Patient-Kommunikation negativ beeinflussen
 Im Lichte einer bis zum Jahre 2018 prognostizierten Wachstumsrate des internationalen Telemedizinmarkts von 18,5% (so der jüngste Marktforschungsreport von "Research and Markets") vernachlässigen manche Akteuren allzu gerne und schnell den aus gesundheitlicher Sicht allein entscheidenden Nachweis des uneingeschränkten gesundheitlichen Nutzen der entsprechenden Produkte und Dienstleistungen. Hauptsache der "Job-/Renditemotor Gesundheitswirtschaft" läuft und läuft und läuft.
Im Lichte einer bis zum Jahre 2018 prognostizierten Wachstumsrate des internationalen Telemedizinmarkts von 18,5% (so der jüngste Marktforschungsreport von "Research and Markets") vernachlässigen manche Akteuren allzu gerne und schnell den aus gesundheitlicher Sicht allein entscheidenden Nachweis des uneingeschränkten gesundheitlichen Nutzen der entsprechenden Produkte und Dienstleistungen. Hauptsache der "Job-/Renditemotor Gesundheitswirtschaft" läuft und läuft und läuft.
Besondere Aufmerksamkeit sollte aber dem Bereich des direkten Behandlungskontakts von Ärzten und Patienten, und damit des Kernprozess der gesundheitlichen Versorgung gewidmet werden. Hier gibt es immer wieder Belege für unerwünschte Wirkungen, die bei der Einführung bestimmter telemedizinischer Prozeduren bedacht und mit geeigneten Maßnahmen vermieden werden müssen. Keinesfalls sollte also trotz allen "Fortschritts" auf eine grundsätzliche Skepsis gegenüber diesen und weiteren technisch-organiatorischen Neuerungen bis zum positiven Nachweises ihres Nutzens bzw. ihrer Schädigungsfreiheit verzichtet werden.
In einer Ende Dezember 2013 in der Fachzeitschrift "International Journal of Medical Informatics" erschienenen Studie, geht es um die Auswirkungen elektronischer Patienteninformationen bzw. -akten ("electronic health records") auf die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Zahlreiche andere Studien haben gezeigt, dass diese Kommunikation zu den wichtigsten Determinanten der Zufriedenheit von Patienten mit ihrem Arzt und ihrer Behandlung, ihrer eigenen Therapietreue und damit letztlich auch des Behandlungsergebnisses oder der Gesundheit der Patienten gehört.
In der Studie wurden 100 Arzt-Patientengespräche per Videokamera aufgenommen und auf sämtliche kommunikativen Prozesse, Interaktionen etc. untersucht.
Die wesentlichen Beobachtungen sahen wie folgt aus:
• Ärzte, welche im Untersuchungsraum Zugang zur elektronischen Patientenakte hatten, verbrachten mehr als ein Drittel der Kontaktzeit mit diesen Patienten damit, den Bildschirm anzuschauen.
• Unabhängig davon, ob sie den Text auf dem Monitor lesen oder verstehen konnten, verbringen auch Patienten einen Teil der Konsultationszeit damit, auf den Monitor zu schauen.
• Als unerwünschte Effekte nennen die Studienautoren, dass das Verhalten der Ärzte es für Patienten schwer machen könnte, die notwendige Aufmerksamkeit zu erwecken und zu erhalten. Außerdem bleiben die oft für die Behandlung relevanten nonverbalen kommunikativen Signale unbeachtet und wahrscheinlich ist auch die Fähigkeit der Ärzte, zuzuhören, zu denken und Problemlösungen zu erwägen erheblich eingeschränkt.
Dies bestätigt auch die Ergebnisse einer im Januar 2013 in der Zeitschrift "Medical Decision making" veröffentlichten experimentellen Studie über Wirkungen des Einsatzes von elektronischen Programmen zur Entscheidungsfindung des Arztes ("computerized clinical decision support systems (CDSS)"). Zum einen bewerteten Patienten, welche die Nutzung solcher Programme erlebten die Fähigkeiten des Arztes schlechter als die von Ärzten, die diese Hilfsmittel nicht (erkennbar) in Anspruch nehmen oder einen Kollegen konsultieren. Diese Patienten sind unzufriedener mit der Behandlung und verhalten sich weniger therapietreu. Zum anderen machten allerdings Patienten von Ärzten, die elektronische Hilfsprogramme nutzten, weniger für negative Behandlungsergebnisse verantwortlich.
Sämtliche AutorInnen weisen auf die dringende Notwendigkeit hin, über technische Lösungen, andere Formen der Kommunikation am und mit Monitoren sowie eine Beeinflussung der Einstellungen von Patienten zu Ärzten, die sich elektronischer Hilfsmittel bedienen nachzudenken.
Die Studie Dynamic modeling of patient and physician eye gaze to understand the effects of electronic health records on doctor-patient communication and attention von Enid Montague und Onur Asan ist am 30.12. 2013 online veröffentlicht worden und wird in der Zeitschrift "International Journal of Medical Informatics" (Volume 83, Issue 3 , Pages 225-234) abgedruckt. Das Abstract ist kostenlos verfügbar.
Die Studie Why Do Patients Derogate Physicians Who Use a Computer-Based Diagnostic Support System? von Victoria Shaffer et al. ist in der Zeitschrift "Medical Decision Making" im Januar 2013 (33: 108-118) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos verfügbar.
Bernard Braun, 29.1.14
Ärztinnen sind bei der Behandlung von Diabetikern besser als Ärzte, aber weniger "produktiv" - doch stimmt letzteres wirklich?
 Die Frage, ob das Geschlecht von Ärzten Auswirkungen auf die Art und Weise bzw. die Qualität ihrer Leistungen hat oder ob bei bestimmten Fachdisziplinen Frauen nicht besser bei Ärztinnen (z.B. Gynäkologie) oder Männer bei Ärzten (z.B. Urologie/Andrologie) behandelt werden wollen, wird seit einiger Zeit in verschiedenen Studien kontrovers diskutiert.
Die Frage, ob das Geschlecht von Ärzten Auswirkungen auf die Art und Weise bzw. die Qualität ihrer Leistungen hat oder ob bei bestimmten Fachdisziplinen Frauen nicht besser bei Ärztinnen (z.B. Gynäkologie) oder Männer bei Ärzten (z.B. Urologie/Andrologie) behandelt werden wollen, wird seit einiger Zeit in verschiedenen Studien kontrovers diskutiert.
Eine jetzt in Kanada und genauer in der dortigen französischsprachigen Region Québec abgeschlossene Studie verglich mit Unterstützung durch die Krankenversicherung anhand ausgewählter Qualitätsparametern und mit Behandlungs-Leistungsdaten, wie die Qualität und die "Produktivität" von 431 Ärztinnen und 475 Ärzten aus der Arztgruppe der Familienärzte bei der Behandlung von DiabetikerInnen aussah. Die Kriterien für eine gute Behandlung stammen aus den krankheitsspezifischen Leitlinien in Kanada. Als Kriterien für "Produktivität" wurden die Anzahl regelmäßiger Arztbesuche und die Anzahl von Leistungen wie z.B. die Verordnung von Arzneimitteln gezählt.
Generell folgten die von Ärztinnen behandelten Patienten mehr deren Ratschlägen als die Patienten von Ärzten. 73% der Ärztinnenund 70% der Ärzte forderten ihre Patienten wegen der möglichen unerwünschten Wirkungen des Diabetes auf, ihre Augen leitlinienkonform bei einem Augenarzt untersuchen zu lassen. Zur Inanspruchnahme einer Beratung über die Gefahren des Rauchens motivierten 1,8% der ÄrztInnen und 1,4% der Ärzte ihre Patienten. Und die Anteile der Patienten mit einer ebenfalls leitlinienangemessenen Statin-Verordnung betrug 68,2% bei Ärztinnen und 64% bei Ärzten. Schließlich boten 39% der Ärztinnen und 33% der Ärzte ihren Patienten eine vollständige Untersuchung an. Auch wenn die AutorInnen der Studie einräumen, sie wüssten nicht, ob die PatientInnen z.B. die verordneten Medikamente eingenommen hätten, spricht manches dafür, dass die Behandlungsqualität der Ärztinnen eher den Leitlinienempfehlungen entspricht und damit wahrscheinlich der Gesundheit ihrer Patienten gut tut als die von Ärzten.
Waren die Unterschiede zwar bisher relativ klein aber durchweg signifikant, gibt es bei der "Produktivität" gewaltige und signifikante Unterschiede. So rechneten die Ärzte für die Behandlung ihrer Diabetespatienten im Untersuchungszeitraum 4.920, die Ärztinnen dagegen nur 3.100 Leistungen und damit rund 37% weniger Leistungen ab. Die AutorInnen weisen an dieser Stelle zutreffend darauf hin, dass die bloße Anzahl von Leistungen kein Indiz für eine qualitativ höhere Produktivität im Sinne von produktiv für die Behandlung und Gesundheit von Patient sein könne. So erbringen Ärzte zwar mehr einzelne Leistungen und arbeiten damit mehr, Ärztinnen dagegen brächten deutlich mehr Zeit für den einzelnen Patienten auf. In weiteren ähnlichen Untersuchungen wollen die Montréaler WissenschaftlerInnen sich noch mit der Behandlung von Bluthochdruck, Asthma und COPD durch Ärztinnen und Ärzte beschäftigen.
Ob diese Ergebnisse nach Deutschland übertragbar sind, kann nicht verlässlich beantwortet werden. Am besten sollten aber die Zweifler die dafür notwendige Zeit in die Vorbereitung und Durchführung einer vergleichbaren Studie in Deutschland investieren.
Diese Ergebnisse wurden gerade auf dem vom 17. bis 19. Oktober dauernden internationalen Gesundheitskongress "Santé publique et Prévention" in Bordeaux vorgestellt, erscheinen aber auch noch in dem von R. Borgès Da Silva et al. von der Universität Montréal (Québec, Kanada) verfassten Aufsatz Qualité et productivité dans les groupes de médecine de famille : qui sont les meilleurs ? Les hommes ou les femmes ? in der Zeitschrift "Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique" (Volume 61, Supplement 4, October 2013, Pages S210-S211). Eine frei und kostenlos zugängliche Version oder Abstract gibt es leider nicht.
Bernard Braun, 26.10.13
Wie kommt es zu mangelnder Therapietreue? Ergebnisse einer qualitativen Studie mit an rheumatoider Arthritis erkrankten Menschen
 Zu einer der langlebigsten Erklärungen oder Schuldzuweisungen durch Ärzte aber auch Krankenkassenvertreter, warum eine Krankenbehandlung nicht das gewünschte Ergebnis hat oder wodurch unnötig Kosten verursacht werden, gehört die Non-Compliance oder -Adherence bzw. die Therapieuntreue der Patienten. Wer nachdenkt statt Schuld zuzuweisen, stellt fest, dass zumindest ein Teil der "untreuen" oder "ungehorsamen" Patienten nicht aus Jux und Tollerei z.B. verordnete Medikamente gar nicht oder in einer anderen Dosierung einnimmt als es ihnen der Arzt oder Apotheker oder der Beipacktext möglicherweise gesagt hat und dabei u.a. gesundheitlich unerwünschte Folgen riskiert. Und auch die sporadisch transparent werdenden Medikamentenlager in den Badezimmerschränkchen mancher Menschen, entstehen nicht (allein) wegen der Sammelwut von Patienten.
Zu einer der langlebigsten Erklärungen oder Schuldzuweisungen durch Ärzte aber auch Krankenkassenvertreter, warum eine Krankenbehandlung nicht das gewünschte Ergebnis hat oder wodurch unnötig Kosten verursacht werden, gehört die Non-Compliance oder -Adherence bzw. die Therapieuntreue der Patienten. Wer nachdenkt statt Schuld zuzuweisen, stellt fest, dass zumindest ein Teil der "untreuen" oder "ungehorsamen" Patienten nicht aus Jux und Tollerei z.B. verordnete Medikamente gar nicht oder in einer anderen Dosierung einnimmt als es ihnen der Arzt oder Apotheker oder der Beipacktext möglicherweise gesagt hat und dabei u.a. gesundheitlich unerwünschte Folgen riskiert. Und auch die sporadisch transparent werdenden Medikamentenlager in den Badezimmerschränkchen mancher Menschen, entstehen nicht (allein) wegen der Sammelwut von Patienten.
Eine gerade veröffentlichte Studie von GesundheitswissenschaftlerInnen aus Bremen, Hannover und Kiel untersuchte jetzt diese Gründe für und mit PatientInnen, die langjährig unter behandlungsbedürftiger rheumatoider Arthritis litten. Die AutorInnen zeigen auf dem Boden leitfadengestützter Interviews mit 29 aus 900 bzw. 103 ausgewählten und interviewbereiten PatientInnen, dass es nicht weiterführt, von fehlender Compliance zu sprechen, wenn die Betroffenen verordnete Medikamente überhaupt oder vorübergehend nicht einnehmen. Diese chronisch Kranken sind trotz gelegentlicher "Noncompliance" außerordentlich an guter Medizin interessiert. Der häufige krankheitsbedingte Wechsel der Medikamente, das Verurteiltsein zu dauerhafter Medikation samt teils deutlicher Nebenwirkungen und häufig unzureichende Kommunikation ihrer ÄrztInnen sind wichtige Ursachen für die so genannte Noncompliance. Während die sozialwissenschaftliche Literatur dies seit gut 25 Jahren ergiebig thematisiert hat, wird im medizinischen Diskurs allen Bemühungen um "Modernisierung" des Compliance-Diskurses am Konzept der Folgsamkeit festgehalten. Eine Idee, die ohnehin nur dann gut wäre, wenn die verordneten Medikamente tatsächlich immer evidenzbasiert wären. Die Studie plädiert dafür, die Unterstützung für chronisch Kranke bei der Bewältigung ihrer langstreckigen Krankheitskarrieren zu verbessern statt ihnen de facto immer wieder mit Vorwürfen zu begegnen.
Was in einem modernen, d.h. nicht schuldzuweiserischen Compliance-Dialog zwischen Arzt und Patient zu beachten und zu erreichen ist, wird in der 26 Seiten umfassenden Studie durch ausführliche Zitate aus den Interviews anschaulich verdeutlicht.
Im Anhang findet sich der Frageleitfaden für die qualitativen Interviews, einige Hinweise zur Kodierung der transkribierten Interviews, eine Auflistung der Vielzahl erkrankungsspezifischer Medikamente und ein umfangreiches Literaturverzeichnis.
Die Studie Noncompliance: A Never-Ending Story. Understanding the Perspective of Patients with Rheumatoid Arthritis von Maren Stamer, Norbert Schmacke und Petra Richter erscheint im September 2013 im "Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research" (14 [3], Art. 7) und kann komplett kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 11.8.13
Teilnahme an medizinischer Forschung: grobe Qualitätsmängel der Patienteninformationen
 Die informierte Einwilligung (informed consent) des Patienten bzw. Probanden ist eine notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme an einer medizinischen Studie .
Die informierte Einwilligung (informed consent) des Patienten bzw. Probanden ist eine notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme an einer medizinischen Studie .
Einen Standard für die Qualität von Patienteninformationen hat eine internationale Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern geschaffen, die International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration (Website).
Dieser Standard beschreibt in 10 Dimensionen und 47 Items die Bereiche und Inhalte, die eine Patienteninformation abdecken muss, um dem Patienten eine informierte Entscheidung zu ermöglichen. Daraus wurde eine Checkliste als Prüfinstrument für Entscheidungshilfen (Decision aids) entwickelt.
Entscheidungshilfen (engl.: decision aids) sind Instrumente zur Unterstützung der Kommunikation, die zu einer Entscheidung führt. Sie enthalten spezifische, auf eine konkrete Entscheidungssituation bezogene Informationen über Nutzen und Risiken. Sie zielen darauf ab, Ergebnisse, Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten auf klare, verständliche, wissenschaftlich valide und unverzerrte Weise zu präsentieren, damit Patienten treffen können, die ihren Präferenzen entsprechen.
Mit einer modifizierten Fassung der Checkliste untersuchten die Forscher 139 Dokumente zur Information von Personen, die über die Teilnahme an einer Studie entscheiden sollten.
Anhand von 32 Items wurde wurde u.a. geprüft, ob
• die Behandlung bzw. Intervention sowie die Vor- und Nachteile der Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme beschrieben werden
• die Wahrscheinlichkeiten für Nutzen und Schaden überhaupt und wenn ja in verständlicher Form und mit den bestehenden Unsicherheiten angegeben werden
• die Behandlungsergebnisse detailliert genug beschrieben sind, so dass sich der Proband die Auswirkungen auf sein Leben vorstellen kann
• der Proband Schritt für Schritt an die Entscheidung herangeführt wird, z.B. mit einer Decision aid
• die wissenschaftlichen Quellen für die Informationen und Qualität der Evidenz genannt sind,
• Informationen zu Transparenz genannt sind, z.B. zur Finanzierung der Studie
Die Überprüfung ergab:
• Mehr als 80% der Dokumente beschreiben die Vor- und Nachteile der Teilnahme, etwa 50% die Intervention und keines die Vor- bzw. Nachteile der Nicht-Teilnahme.
• Alle 8 Items zur Darstellung von Wahrscheinlichkeiten werden von weniger als 20% erfüllt.
• Die Klärung der Präferenz, also der vom Probanden bevorzugten Vorgehensweise, unterstützen die Dokumente praktisch überhaupt nicht.
• Bis auf das Datum der Erstellung enthalten die Dokumente keinerlei Hinweise auf die Quellen und die Qualität und Verlässlichkeit der Evidenz.
• Fast alle Dokumente nennen die Namen des Studienleiters und eine Person für Nachfragen. Die zuständige Ethikkomission und die Finanzierungsquelle werden in jeweils 2/3 der Dokumente offen gelegt.
Die Studie macht überdeutlich, dass die Informationsdokumente, die zur Entscheidungen von Patienten dienen, an einer Studie teilzunehmen oder nicht teilzunehmen, völlig unzulänglich sind, wenn man sie an international vereinbarten Qualitätskriterien misst.
Untersucht wurden ausschließlich englischsprachige Dokumente. Als Hilfe für die Erstellung von Patienteninformationen und Einwilligungserklärungen liegt für Deutschland eine Checkliste mit 60 Kriterien und ein Leitfaden aus dem Jahr 2006 vor (Infoblatt). Die Qualität der damit erstellten Dokumente ist - zumindest nach Kenntnis des Autors - nicht systematisch überprüft. Nachdenklich macht, dass Begriffe wie Shared Decision Making, partizipative Entscheidungsfindung und Evidenz in dem 176-seitigen Werk nicht vorkommen.
Brehaut JC et al. Informed consent documents do not encourage good-quality decision making. Journal of Clinical Epidemiology 2012;65(7):708-24 Abstrct
Arbeitsgruppe Qualitätsbewertung von Decision aids IPDAS.
Website Qualitätsbewertung IPDASi-Assessment
Checkliste IPDASi
Checkliste und Leitfaden zur Patienteneinwilligung - Grundlagen und Anleitung für die klinische Forschung Infoblatt
darauf beruhend:
Website Assistent zur Erstellung von Patienteninformationen und Einwilligungserklärungen Link
David Klemperer, 1.12.12
Choosing Wisely - Klug entscheiden: Fachgesellschaften und Verbraucher Hand in Hand für eine gute Versorgung
 Choosing Wisely ist eine Initiative des American Board for Internal Medicine.
Choosing Wisely ist eine Initiative des American Board for Internal Medicine.
Ausgangspunkt ist eine im Jahr 2002 veröffentlichte Charta für ärztliche Berufsethik "Medical Professionalism in the New Millennium".
In der Charta sind 3 Grundprinzipien ärztlicher Tätigkeit festgehalten:
• Das Primat des Patientenwohls
• Das Primat des Selbstbestimmungsrechts des Patienten
• Das Primat der sozialen Gerechtigkeit
Zu den ethischen Pflichten der Ärzte zählt die Charta
• fachliche Kompetenz
• Wahrhaftigkeit im Umgang mit Patienten
• ständigen Qualitätsverbesserung
• gerechte Verteilung begrenzter Mittel im Gesundheitswesen
• Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse
• angemessenes Verhalten bei Interessenskonflikten
"Less is more"- eine der Aktivitäten, die auf dieser Physician Charter beruhen (wir berichteten) - ist mittlerweile zu einer umfassenden Initiative von 9 Fachgesellschaften und 14 Verbraucherschutzorganisation geworden.
Geführt wird die Inititaitve von der ABIM Foundation und Consumer Reports, der weltgrößten Warentestorganisation.
Neun Fachgesellschaften haben jeweils ihre Top 5 der überflüssigen Maßnahmen ihres Fachgebietes aufgelistet und wissenschaftlich begründet: Link.
Weitere 21 Fachgesellschaften werden ihr Top 5 Anfang bis Mitte 2013 veröffentlichen.
Consumer Reports hat in Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachgesellschaften Informationen für die Bürger bzw. Patienten erstellt und auf der Website Consumer Health Choices veröffentlicht.
Website Choosing Wisely Link
Website ConsumerHealthChoices Link
Medical Professionalism in the New Millennium Link
Charta zur ärztlichen Berufsethik (dt. Version) Link
David Klemperer, 30.11.12
Lungenkrebs und Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium: Illusionen über Heilung bei der Mehrzahl der Patienten
 Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung überschätzen häufig ihre Lebenserwartung. Eine jetzt im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ging der Frage nach, wie groß der Anteil derjenigen Patienten mit metastasierter Krebserkrankung ist, die sich von der Chemotherapie eine Heilung erhoffen - ein Ziel das leider weitgehend unrealistisch ist.
Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung überschätzen häufig ihre Lebenserwartung. Eine jetzt im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ging der Frage nach, wie groß der Anteil derjenigen Patienten mit metastasierter Krebserkrankung ist, die sich von der Chemotherapie eine Heilung erhoffen - ein Ziel das leider weitgehend unrealistisch ist.
Dafür wurden 1.193 Teilnehmer einer Kohortenstudie befragt, bei denen vor mindestens 4 Monaten die Diagnose eines fortgeschrittenen (Stadium 4) Karzinoms der Lunge (710 Patienten) oder des Dickdarms (483 Patienten) gestellt worden war.
Befragt wurden nur diejenigen, die sich für eine Chemotherapie entschieden hatten. Die Befragung wurde telefonisch von professionellen Interviewern durchgeführt.
Die entsprechende Frage lautete:
"Nachdem Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Chemotherapie ihnen hilft länger zu leben, ihren Krebs zu heilen oder ihnen hilft bei den Problemen, die der Krebs verursacht?" Die Antwortmöglichkeiten lauteten sehr / etwas / wenig / überhaupt nicht wahrscheinlich bzw. "ich weiß nicht".
Das Ergebnis lautet: 69% der Befragten mit Lungenkrebs und 81% der Patienten mit Darmkrebs erkennen nicht, dass eine Heilung durch Chemotherapie sehr unwahrscheinlich ist. Diese falsche Auffassung war überdurchschnittlich weit verbreitet unter Patienten mit hispanischem und asiatischem Hintergrund sowie unter Schwarzen. Einkommen und Bildung spielten keine Rolle. 20 bis 30% gaben zutreffen an, dass eine Heilung sehr unwahrscheinlich sei.
Patienten mit unrealistischer Erwartung schätzten die Kommunikation des Arztes besser ein als Patienten mit realistischen Erwartungen. Hier wird möglicherweise der realistisch informierende Arzt als Überbringer der schlechten Botschaft abgestraft.
Die Autoren äußern sich besorgt darüber, dass die Kriterien für die informierte Einwilligung nicht erfüllt sind, wenn Patienten falsche Vorstellungen vom Therapieziel haben. Aus früheren Studien sei bekannt, dass Patienten für eine Heilungschance von nur 1% eine stark belastende Therapie auf sich nehmen, nicht aber für einen alleinigen Gewinn an Lebenszeit.
Diese Studie verdeutlicht ein mal mehr, dass jeder Patient die Möglichkeit erhalten muss, eine Entscheidung auf Grundlage von Evidenz zu Behandlungseffekten zu treffen, die ihm wichtig sind.
Weeks JC, Catalano PJ, Cronin A, Finkelman MD, Mack JW, Keating NL, et al. Patients' Expectations about Effects of Chemotherapy for Advanced Cancer. New England Journal of Medicine 2012;367(17):1616-25. Abstract
s.a. Rubrik Shared Decision Making
David Klemperer, 25.10.12
Schlechte Information der und Kommunikation mit Eltern zum Risiko unerwünschter Wirkungen von Arzneimitteln ihrer Kinder
 Die Behandlung erkrankter Kinder stellt in mancherlei Hinsicht eine besondere Herausforderung für Ärzte und andere Akteure im Gesaundheitswesen dar. Dabei spielen insbesondere bei ganz jungen Kindern Eltern oder andere erwachsene Begleitpersonen sowohl bei der Information über die gesundheitlichen Beschwerden der Kinder als auch bei der Therapietreue der Kinder eine wichtige Rolle. Dazu müssen sie aber umfassend informiert werden.
Die Behandlung erkrankter Kinder stellt in mancherlei Hinsicht eine besondere Herausforderung für Ärzte und andere Akteure im Gesaundheitswesen dar. Dabei spielen insbesondere bei ganz jungen Kindern Eltern oder andere erwachsene Begleitpersonen sowohl bei der Information über die gesundheitlichen Beschwerden der Kinder als auch bei der Therapietreue der Kinder eine wichtige Rolle. Dazu müssen sie aber umfassend informiert werden.
Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse einer qualitativen Studie mit Eltern von 44 britischen ambulant und stationär behandelten Kindern, die unerwünschte Wirkungen von verordneten Arzneimitteln ("adverse drug reactions") erlitten hatten, zeigen aber, dass die Information der Eltern behandelter Kinder über die Ursachen und/oder Vermeidungsmöglichkeiten dieser Wirkungen "generally disappointed" waren. Bei den Arzneimitteln handelt es sich z.B. um Antibiotika, schwere Schmerzmittel, Epileptika und Zellgifte.
Insgesamt berichteten die Eltern von einer mageren Kommunikation über die potenziellen Risiken für unerwünschte, schwere Reaktionen nach der Einnahme der Arzneimittel und über die Art der Reaktionen selber. Entweder wurden solche Informationen überhaupt nicht geliefert oder zu völlig unpassenden Gelegenheiten, wie etwa auf dem Weg des Kindes in den Operationssaal.
Die einzige positive Ausnahme stellten nach dieser Studie Informationen zur Wirkweise und den unerwünschten Effekten von Krebsmitteln dar, welche die Eltern als klar und umfassend bewerteten.
Die AutorInnen weisen darauf hin, dass schlechte Information von Eltern deren künftigen Umgang mit Arzneimitteln negativ beeinflusst und u.U. auch Auswirkungen auf das Vertrauen in die Wirkung von Arzneimitteln bei den älter gewordenen Kindern haben kann.
Die möglichen Einwände gegen die geringe Anzahl von Eltern-Kinder-Einheiten und die gewählte qualitative Methode und die zusätzlich möglichen Zweifel an der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Wirklichkeit der Kommunikation über unerwünschte Arzneimittelwirkungen im deutschen Gesundheitswesen, ließen sich mit relativ geringem Aufwand bestätigen oder widerlegen. Bis dahin spricht manches für ein ähnliches Kommunikations-Verhalten deutscher Ärzte.
Weitere Ergebnisse und eine Reihe von Zitaten aus den Gesprächen mit Eltern können in dem komplett kostenlos erhältlichen Aufsatz "Enhancing Communication about Paediatric Medicines: Lessons from a Qualitative Study of Parents' Experiences of Their Child's Suspected Adverse Drug Reaction." von Arnott J, Hesselgreaves H, Nunn AJ, Peak M, Pirmohamed M, et al. (2012) in der Open Access-Zeitschrift "PLoS ONE" (7(10): e46022) nachgelesen werden.
Bernard Braun, 15.10.12
Mehr Wirtschaft als Gesundheit - Staatliche Förderung für IgeL
 Unübersehbaren Optimismus offenbarte zunächst die Berliner Zeitung Ende Juli 2012 mit ihrem Artikel Bundesregierung überprüft Verkaufstrainings für Ärzte. Wie im Forum Gesundheitspolitik bereits Mitte Juni in dem Beitrag Öffentliche Förderung des Verkaufstrainings für IGeL-Angebote nachzulesen war, hat das Haus des ehemaligen Gesundheits- und jetzigen Wirtschaftministers Philipp Rösler das ständige Gerede des Ressortchefs von der Gesundheits-Wirtschaft überaus wörtlich genommen und tatkräftig in die Praxis umgesetzt.
Unübersehbaren Optimismus offenbarte zunächst die Berliner Zeitung Ende Juli 2012 mit ihrem Artikel Bundesregierung überprüft Verkaufstrainings für Ärzte. Wie im Forum Gesundheitspolitik bereits Mitte Juni in dem Beitrag Öffentliche Förderung des Verkaufstrainings für IGeL-Angebote nachzulesen war, hat das Haus des ehemaligen Gesundheits- und jetzigen Wirtschaftministers Philipp Rösler das ständige Gerede des Ressortchefs von der Gesundheits-Wirtschaft überaus wörtlich genommen und tatkräftig in die Praxis umgesetzt.
Laut Medienberichten überprüfte die Bundesregierung zunächst die staatliche Förderung der Marketingseminare, in denen sich ÄrztInnen im Verkauf von IGeLeistungen und anderer Selbstzahler-Angebote schulen lassen können. Im Klartext: Ärzte sollen "Verkaufsstrategien" erlernen, um ihre Patienten besser vom Nutzen solcher Leistungen überzeugen zu können. Mittlerweile hat das Wirtschaftsministerium dem großen öffentlichen Fragezeichen nachgegeben und die Verkaufsförderungsprogramme für niedergelassene ÄrztInnen eingestellt.
Brisant war die bisherige Förderung vor allem deshalb, weil das Wirtschaftsministerium damit die Erbringung von zumeist diagnostischen Verfahren befördert hatte, die nicht nur medizinisch überflüssig und stark umstritten, sondern auch explizit nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten sind. Damit unterlief das Wirtschaftsressort gezielt das subsidiär-korporatistische Entscheidungsgefüge des deutschen Gesundheitswesens. Aber was der liberale Koalitionspartner vom Staat und von öffentlichen Entscheidungsstrukturen hält, zeigt nicht nur das Ressort von Philipp Rösler, sondern auch andere FDP-Minister wie insbesondere BMZ-Leiter Dirk Niebel ja seit der Übernahme der Regierungsverantwortlichkeit mit wachsender Begeisterung.
Allen öffentlichen Regulierungsversuchen trotzt auch beharrlich eine bestimmte Gruppe von MedizinerInnen, die gerne im Namen der "Therapiefreiheit" und ihrer eigenen Freiberuflichkeit handeln mit ihrer subjektiven Wahrnehmung gerne empirische Evidenz aushebeln. Tatsächlich sind es in erster Linie die Leistungserbringer, also die niedergelassenen ÄrztInnen, die ihren PatientInnen einseitig Leistungen ohne erkennbaren medizinischen Nutzen aufdrängen. Allzu oft erbringen sie IGeLeistungen ohne vorausgehende Information und Aufklärung sowie ohne schriftliche Vereinbarung. Nicht selten verkaufen sie den ahnungslosen "KundInnen" auch Leistungen aus dem GKV-Katalog als IGeLeistungen. Bisher haben weder die PatientInnen noch die Kassen in solchen Fällen Anspruch auf Schadensersatz.
Die vollständig aus der eigenen Tasche der Versicherten zu zahlenden Behandlungen stellen mittlerweile eine zusätzliche Einkommensquelle für die Kassenärzte dar. Rund zwei von drei KassenärztInnen bieten IGeLeistungen an, vor allem GynäkologInnen. AugenärztInnen und OrthopädInnen und erzielen damit zusätzliche Einnahmen von etwa 1,5 Mrd. €, was nicht weniger als fünf Prozent der kassenärztlichen Leistungsausgaben entspricht. Für viele Niedergelassene sind die IGeLeistungen heute eine willkommene Zusatzeinnahmequelle, mit der sie zunehmend hemmungslos die subjektiv als beständig schrumpfend empfundenen GKV-Honorare aufbessern und ihre gefühlten Verluste an "Therapiefreiheit" kompensieren können. Unter der konservativen Annahme, dass ÄrztInnen bei der Qualität ihrer Arbeit eine Normalverteilung aufweisen, kann das nichts Gutes für die PatientInnen bedeuten.
Um die geht es allerdings auch einer Reihe von MedizinerInnen allenfalls sekundär. Der Beitrag eines niedergelassenen Gynäkologen im streng GKV-feindlichen Ärztenetzwerk Hippokranet lässt an sozialpolitischem Desinteresse und Verachtung von Menschen mit geringem Einkommen nichts zu wünschen übrig: "Niemand wird gezwungen, sich rein kassenmedizinisch behandeln zu lassen.
Jeder in der Bunzrepublik hat die Wahl. ...ob jeder auch das nötige Geld hat, weiss ich nicht....interessiert mich auch nicht."
Solche und vermutlich auch andere MedizinerInnen interessiert sicherlich viel mehr das wachsende Angebot an verfügbarer Information zu IGeLeistungen, die man beispielsweise auf der Internet-Seite Der Igelarzt vorfindet. Zwar missbilligte der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Frank Ulrich Montgomery, laut Berliner Zeitung vom 30.7.2012 das Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums mit den Worten: "Ärzte sind keine Kaufleute und deshalb brauchen wir auch keine Verkaufsseminare für Individuelle Gesundheitsleistungen." Dies entbehrt allerdings nicht einer gewissen Naivität, haben sich zahlreiche VertreterInnen der Ärzteschaft doch mittlerweile unübersehbar von der Ethik auf die Seite der Monetik geschlagen. Denn irgendwelche Ansprechpartner müssen einschlägige Angebote wie Verkaufen - eine neue Dimension der Praxisarbeit, IGeL seriös anbieten, IGeL anbieten - Wie sag ich`s dem Patienten? oder IGEL und Wahlleistungen sicher anbieten und verkaufen ja finden, sonst würden sie sich wohl kaum in der digitalen Welt des Internets halten.
Auch wenn die schwarz-gelbe Bundesregierung nun die Förderung der Patientenabzocke durch niedergelassene ÄrztInnen "überprüfen" will, die tägliche Praxis der "Halbgötter in Weiß", ihren PatientInnen überflüssige und nicht selten gefährliche und schädliche Leistungen aufzuschwatzen wird diese Koalition nicht in Frage stellen. Die größte Oppositionspartei will nicht nur die Marketing-Förderung des Wirtschaftsministeriums für IGeL-ÄrztInnen beenden, sondern die Ärztezeitung meldete am 31. Juli 2012 auch SPD plant "IGeL-Eindämmungsgesetz".
Immerhin nimmt sich nun der Bundesrat direkt dieses Themas an und dabei die Forderung des GKV-Spitzenverbands auf, als Mindestmaßnahme zum Schutz der PatientInnen eine eintägige Bedenkzeit für IGeLeistungen einzuführen. Abgesehen von einzelnen, eher bürokratischen Leistungen wie Attesten - so berichtet die Ärztezeitung in dem Artikel IGeL-Bedenkzeit-Atteste ausgenommen - gäbe eine derartige Bedenkzeit den informationsbezogen benachteiligten und tendenziell schwächeren NutzerInnen von ambulanten Gesundheitsleistungen eine gewisse Chance, die Notwendigkeit von IGeLeistungen zu überprüfen. Vor allem würde dies die Möglichkeiten der AnbieterInnen verringern, ihre PatientInnen mit dem Zusatzangebot zu überrumpeln.
Die Ablehnung aus der Ärzteschaft ließ nicht lange auf sich warten. Energisch kritisierte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Dr. Johannes Fechner, den Vorschlag des GKV-Spitzenverbands, wie in einem Beitrag im Ärztenetzwerk Facharzt.de nachzulesen ist: "Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum der GKV Spitzenverband IGeL ablehnt und Schranken fordert. Die meisten IGeL erfolgen zum einen auf Patientenwunsch und sind zum anderen medizinisch sinnvoll." Als "abwegig" bezeichnete Fechner die Forderung, IGeLeistungen erst nach 24-stündiger Denkpause zu erbrbringen dürfen. "Der GKV-Spitzenverband zeigt hier mal wieder," so Fechner, "dass er wenig Kenntnis vom Alltag in einer Praxis und der Behandlung von Patienten hat. Warum soll der Arzt einen Patienten, der eine IgeL nachfragt, wieder nach Hause schicken? Die Patienten müssen einen neuen Termin vereinbaren und noch einmal den Aufwand für den Besuch auf sich nehmen, obwohl sie bereits vor dem Arzt stehen. Viele Leistungen ergeben sich zudem erst im Laufe einer Behandlung. Und soll der Arzt die Patienten, deren Kasse die IGeL wie beispielsweise Osteopathie in ihren Leistungskatalog aufgenommen hat, auch erst nach Hause schicken? Das ist Absurdistan und führt zu völligem Unverständnis bei den Patienten."
Allerdings sind in demselben Forum auch andere Stimmen zu lesen: So heißt es in einer Replik: "Nun werden in der Regel die so genannten "IGeL" ja nicht nachgefragt sondern dem Patienten mehr oder weniger nachdrücklich "empfohlen", "nahegelegt" oder schlicht aufgenötigt. Die echte Nachfrage nach derartigen "Wunschleistungen" darf man getrost ziemlich nahe bei Null einordnen."
Die Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten steht kostenfrei online zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 9.8.12
Nicht nur "offensichtlich" sondern empirisch sicher: Wirkungen nonverbalen Verhaltens von Ärzten und Pflegekräften auf Patienten
 Wirkt sich das nonverbale Verhalten von Ärzten und Pflegekräften gegenüber Patienten messbar auf deren mentalen und körperlichen Gesundheitszustand und ihre Zufriedenheit mit der Behandlung aus? Eine verbreitete Antwort lautet "jaaah - irgendwie wahrscheinlich schon"!
Wirkt sich das nonverbale Verhalten von Ärzten und Pflegekräften gegenüber Patienten messbar auf deren mentalen und körperlichen Gesundheitszustand und ihre Zufriedenheit mit der Behandlung aus? Eine verbreitete Antwort lautet "jaaah - irgendwie wahrscheinlich schon"!
Eine präzisere Antwort liefert nun ein systematischer Review mit Metaanalysen von 26 Beobachtungsstudien, die eine Forschergruppe der us-amerikanischen staatlichen Krankenversicherung für ehemalige SoldatInnen (Veteran Affairs) aus 6.536 bis 2010 veröffentlichten in englischer Sprache verfassten Studienaufsätzen kriteriengestützt ausgewählt haben und deren Ergebnisse sie jetzt veröffentlicht hat.
In diesen Studien wurden als Merkmale nonverbaler Kommunikation die körpersprachliche Zuwendung oder Herzlichkeit (warmth) und das erkennbare Zuhören (listening) von Ärzten und eine negative Grundhaltung (negativity) von Ärzten und Pflegekräften mit verschiedensten Methoden gemessen. Untersucht wurde wie sich Interaktionen in denen die genannten Verhaltensweisen auftraten auf die mentale und körperliche Gesundheit und die Zufriedenheit von PatientInnen ausgewirkt haben.
Die wesentlichen Ergebnisse:
• Die Wirkung auf die Patientenzufriedenheit wurde in 65%, die Wirkung auf den mentalen oder physischen Gesundheitszustand dagegen nur in 23% oder 19% der Studien erhoben.
• Wenn Ärzte sich herzlich verhielten und den PatientInnen zuhörten waren diese hochsignifikant (p<0,001) zufriedener.
• Verhielten sich Ärzte negativ gab es keine signifikanten Assoziationen mit der Patientenzufriedenheit. Anders war es, wenn sich Pflegekräfte negativ gestimmt verhielten. In diesem Fall war die Patientenzufriedenheit signifikant (p<0,001) geringer.
• Die Forschergruppe sah sich nicht in der Lage, eine Metaanalyse der Wirkungen nonverbalen Verhaltens auf den gesundheitlichen Zustand durchzuführen. Dazu gab es einerseits zu wenig Studien und diese wiesen auch noch eine zu große methodische Heterogenität für eine solche Analyse auf.
• Die AutorInnen setzen sich auch mit dem naheliegenden Argument auseinander, die Funde "may seem intuitive or obvious". Sie betonen dazu, dass selbst bei offensichtlichen Assoziationen geprüft werden müsse, ob diese durch empirische Daten unterstützt werden. Und am Beispiel des Blick- und Augenkontakts zeigen sie, dass dessen "offensichtliche" Wirkung auf die Patientenzufriedenheit nicht empirisch bestätigt werden kann.
• Die reviewten Studien enthalten schließlich eine Reihe sehr praktische Hinweise welche nonverbalen Bestandteile der Patient-Arzt-Pflegekräfte-Interaktion welche Wirkung haben und in künftigen Trainingsprogrammen für Ärzte und Pflegekräfte besonders beachtet werden müssen.
Da es sich bei den reviewten Studien durchweg um Kohorten- und Fall-Kontrollstudien handelt, warnen die AutorInnen zum einen vor kausalen Schlussfolgerungen, geben aber gleichzeitig eine Reihe von inhaltlichen und methodischen Hinweisen für die künftige Erforschung der Interaktionswirkungen.
Von dem Aufsatz "Association between nonverbal communication during clinical interactions and outcomes: a systematic review and meta-analysis." von Henry SG, Fuhrel-Forbis A, Rogers MA und Eggly S., erschienen in der Zitschrift "Patient Education and Counseling" (Volume 86, Issue 3, March 2012, Pages 297-315) gibt es kostenlos nur das Abstract.
, 20.7.12
Vom Gesundheitsnutzen des Engagements und der Beteiligung von Patienten, und wie ungleich dies im 11-Ländervergleich aussieht.
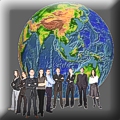 Wenn Patienten an Behandlungsentscheidungen beteiligt sind und auch sonst ausgewählte Elemente und Phasen ihrer Behandlung selbst in die Hand nehmen, berichten sie weniger häufig von Behandlungs- Medikations- oder Labortestfehlern, die sie in den letzten zwei Jahren erfahren mussten, bewerten sie ihre Behandlung und auch ihr Gesundheitssystem insgesamt besser als passive oder paternalistisch behandelte Patienten. So bewerteten z.B. 78% der PatientInnen in den USA, die die Patient-Arzt-Kommunikation und ihr Engegement bei ihrer Behandlung positiv wahrnahmen, die Behandlungsqualität als sehr hoch. Von denen, die weniger beteiligt waren, sagten nur noch 43% die Qualität ihrer Behandlung sei sehr gut.
Wenn Patienten an Behandlungsentscheidungen beteiligt sind und auch sonst ausgewählte Elemente und Phasen ihrer Behandlung selbst in die Hand nehmen, berichten sie weniger häufig von Behandlungs- Medikations- oder Labortestfehlern, die sie in den letzten zwei Jahren erfahren mussten, bewerten sie ihre Behandlung und auch ihr Gesundheitssystem insgesamt besser als passive oder paternalistisch behandelte Patienten. So bewerteten z.B. 78% der PatientInnen in den USA, die die Patient-Arzt-Kommunikation und ihr Engegement bei ihrer Behandlung positiv wahrnahmen, die Behandlungsqualität als sehr hoch. Von denen, die weniger beteiligt waren, sagten nur noch 43% die Qualität ihrer Behandlung sei sehr gut.
Dies ist eines der Ergebnisse einer 2011 vom liberalen, in den USA beheimateten Commonwealth Fund durchgeführten Befragung (Commonwealth Fund International Health Policy Survey) von mehr als 18.000 Erwachsenen in 11 Ländern (Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien und USA), die in der Zeit vor der Befragung stationär behandelt wurden, eine große Operation hinter sich gebracht haben oder im vergangenen Jahr ernsthaft erkrankt oder verletzt waren.
Ein anderes Ergebnis waren die enormen Unterschiede nach Art und Intensität der Beteiligung und des Engagements von Patienten. Hier zeigt sich u.a.:
• Um etwas über das Patientenengagement in Erfahrung zu bringen, fragten die ForscherInnen danach, ob die Ärzte genug Zeit für und mit ihren Patienten aufbringen, sie Sachverhalte verständlich erklären und die Patienten ermuntern, Fragen zu stellen. Bei PatientInnen in Norwegen und Schweden sah das Engagement am geringsten aus, d.h. höchstens ein Drittel der Befragten berichteten zu ihrem Engagement etwas Positives. Ganz anders sah es in Australien, Neuseeland, der Schweiz, Großbritannien und den USA aus, wo rund zwei Drittel der befragten PatientInnen über positive Interaktionen mit ihrem Arzt berichteten.
• In 7 der 11 Länder (Australien, Kanada, Niederlande, Norwegen, Schweden, Großbritannien und den USA) wurden Patienten mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen von ihrem regulären Arzt signifikant weniger zur Beteiligung ermuntert - am ausgeprägtesten in den USA.
• Die Survey-TeilnehmerInnen wurden zusätzlich befragt, ob die von ihnen in Anspruch genommenen Fachärzte sie auch bei der Entscheidungsfindung für eine Behandlung und an der Behandlungsentscheidung beteiligten. Rund 80% der Patienten in der Schweiz und in Großbritannien sagten, dies geschehe durchweg immer oder oft. Zwei Drittel oder mehr der holländischen, neuseeländischen und us-amerikanischen Befragten nahmen dies auch so wahr. Am wenigsten berichteten Befragte in Frankreich, Deutschland, Norwegen und Schweden von "shared decision making"-Erfahrungen bei Fachärzten.
Von der Studie " International Perspectives on Patient Engagement: Results from the 2011 Commonwealth Fund Survey" von R. Osborn und D. Squires, erschienen im "Journal of Ambulatory Care Management" (April/June 2012 35(2):118-28), gibt es kostenlos eine ausführlichere Zusammenfassung.
Bernard Braun, 19.7.12
Autoritäres Verhalten von Ärzten verhindert Shared Decision Making
 Über das Konzept Shared Decision Making haben wir vielfach berichtet (siehe Kategorie SDM). Bekannt ist, dass dieses von allen Seiten zumindest rhetorisch begrüßte Konzept im klinischen Alltag kaum verankert ist. Barrieren wurden bislang zumeist auf Seiten der Patienten und in strukturellen Aspekten wie Zeitmangel auf Seiten der Ärzte gesucht. Eine neue Studie hat jetzt gezeigt, dass Ärzte mit autoritärem Verhalten bei den Patienten Angst erzeugen und schon im Vorfeld die Äußerung von Beteiligungswünschen auf Seiten der Patienten unterdrücken.
Über das Konzept Shared Decision Making haben wir vielfach berichtet (siehe Kategorie SDM). Bekannt ist, dass dieses von allen Seiten zumindest rhetorisch begrüßte Konzept im klinischen Alltag kaum verankert ist. Barrieren wurden bislang zumeist auf Seiten der Patienten und in strukturellen Aspekten wie Zeitmangel auf Seiten der Ärzte gesucht. Eine neue Studie hat jetzt gezeigt, dass Ärzte mit autoritärem Verhalten bei den Patienten Angst erzeugen und schon im Vorfeld die Äußerung von Beteiligungswünschen auf Seiten der Patienten unterdrücken.
Obwohl die aktive Beteiligung der Patienten an Behandlungsentscheidungen im Sinne des Shared Decision Making (SDM) ein weithin propagiertes und als zeitgemäß aufgefasstes Konzept der Arzt-Patient-Kommunikation ist, sind die Versuche, SDM in den medizinischen Versorgungsalltag zu bringen, eher mäßig erfolgreich. Als Barriere wurde u.a. die kommunikative Kompetenz der Ärzte identifiziert. Kaum Aufmerksamkeit hat bislang die kommunikative Kompetenz der Patienten gefunden. Während es im Alltag den meisten Menschen nicht schwerfällt, Fragen zu stellen, Präferenzen zu klären und Empfehlungen abzulehnen, scheint dies in der Kommunikation mit dem Arzt nicht zu funktionieren. Nicht einmal das Coaching von Patienten in Shared Decision Making hat dies deutlich verbessern können.
Der Frage, warum das so ist, ist der amerikanische Gesundheitswissenschaftler Dominick Frosch mit Kollegen jetzt in einer Studie nachgegangen. Dafür führte er 6 Fokusgruppen mit insgesamt 48 Teilnehmern durch. Die Probanden wurden in Allgemeinmedizinpraxen in Palo Alto rekrutiert, einem wohlhabenden Ort in Kalifornien.
Kurzgefasst lautet das Ergebnis: Die Patienten wünschen Beteiligung, sehen aber bei der häufig fehlenden Bereitschaft der Ärzte keine Möglichkeit, ihren Wunsch durchzusetzen. Sie befürchten, den Arzt mit Fragen zu verärgern, dauerhaft als "schwieriger Patient" abgestempelt zu werden und weniger gut behandelt zu werden.
4 übergreifende Themenbereiche ergab die Auswertung der Fokusguppeninterviews.
Patienten befürchten, den Arzt durch Fragen zu verärgern und dadurch Nachteile zu erleiden.
In allen Gruppen äußerten die Patienten den Wunsch nach aktiver Beteiligung an klinischen Entscheidungen. Sie stellten aber auch fest, dass diese Möglichkeit weitgehend vom Arzt abhängt. Sie sahen die Notwendigkeit, die Rolle des "guten Patienten" einzunehmen, weil sie andernfalls Nachteile befürchteten. Sie befürchteten, dass sich der Arzt in seiner Fachlichkeit oder in seiner ärztlichen Autorität durch Nachfragen in Frage gestellt sehe und verärgert würde. Die Teilnehmer befürchten dann wiederum kurzfristige und langfristige Nachteile, Strafe, eine schlechtere Behandlung und eine gestörte Beziehung. Sie empfanden ein hohes Maß an Abhängigkeit, insbesondere vom Wohlwollen des Arztes. Ein selbstbewusstes und fragendes Auftreten würde dazu führen, dauerhaft als "schwieriger Patient" abgestempelt zu werden.
Sie erkennen das Machtgefälle zwischen Ärzten und Patienten und nehmen häufig Rücksicht auf die wahrgenommene Empfindlichkeit des Arztes, um ihn nicht zu verärgern oder zu enttäuschen. Die Teilnehmer sahen sich selbst eher in der Rolle eines Bittstellers unter der Prämisse "doctor knows best" denn als Empfänger einer Dienstleistung. So sehen sie keine andere Möglichkeit, als sich der Rolle des "guten Patienten" anzupassen.
Ärzte können autoritär sein.
Viele Teilnehmer berichten, dass sie sich nicht respektiert und verstanden fühlen, weil der Arzt sich häufig autoritär verhalte. Gegen dieses Verhalten sei man machtlos, weswegen einige Patienten resignativ den Status quo hinnehmen. Die Expertise des Arztes erkennen die Teilnehmer grundsätzlich an, kritisieren aber die daraus abgeleitete dominante Position.
Patienten bemühen sich, Informationslücken zu schließen.
Viele Teilnehmer verschaffen sich außerhalb der Konsultation Informationen über Behandlungsmöglichkeiten. Einige von ihnen verheimlichen dies vor dem Arzt. Motivation für die Informationssuche ist auch die leichte Verfügbarkeit medizinischer Informationen aber auch Misstrauen gegenüber den Empfehlungen des Arztes.
Im Gespräch mit dem Arzt empfinden Teilnehmer häufig Zeitdruck, was sie daran hindere, Fragen zu stellen.
Soziale Unterstützung
Einige Teilnehmer holen sich Unterstützung für den Arztbesuch, z.B. durch Einbezug einer nahestehenden Person. Dies helfe, die Informationen festzuhalten, die sie ansonsten kaum aufnehmen bzw. schnell vergessen würden.
Das Fazit der Autoren: Die Fokusgruppen-Teilnehmer haben durchgehend den Wunsch, Behandlungsoptionen zu kennen und darüber (mit-) zu entscheiden. Sie befürchten aber, den Arzt mit entsprechenden Fragen zu verärgern und die Beziehung zu stören - einige Teilnehmer haben die Erfahrung gemacht, dass der Arzt Fragen als Kritik und Infragestellen seiner Autorität empfindet. Sie sehen das Machtgefälle in der Beziehung zum Arzt und befürchten als Strafe eine schlechtere Behandlung. Da sie dies als zu hohen Preis für die Teilnahme an der Entscheidung bewerten, verzichten sie auf die Durchsetzung ihres Wunsches. Diese Ergebnisse sind umso bemerkenswerter, als es sich um Teilnehmer mit einem hohen sozialen Status handelt, von denen man annehmen kann, dass sie eher als andere selbstbewusst gegenüber den Ärzten auftreten können.
Die Teilnehmer fühlten sich von den Ärzten nicht ausreichend informiert und nicht ausreichend unterstützt, insbesondere wenn es um das Verstehen unterschiedlicher Behandlungsmöglichkeiten geht. Daher behelfen sie sich mit eigener Recherche und Befragung von Mitgliedern ihrer sozialen Netzwerke.
Die Autoren stellen fest, dass zwar eine generell starke Tendenz zur Patientenbeteiligung bestehe. Die Haltung der Ärzte oder zumindest das, was die Patienten als Haltung der Ärzte wahrnehmen sei eine wesentliche Barriere für die Umsetzung im Alltag. Diese Haltung der Ärzte in Frage zu stellen, erscheine den Patienten riskant.
Die Autoren unterbreiten folgende Vorschläge:
• Adäquate Vergütung für Ärzte, die sich in Shared Decision Making engagieren.
• Gute Entscheidungsunterstützungs-Tools (decision aids) und ausreichende Bedenkzeit. Die Entscheidung sollte erst bei einem Folgekontakt getroffen werden.
• Neuausrichtung der Versorgung mit organisatorischen und strukturellen Veränderungen unter Nutzung von Informationstechnologien und besserer Verteilung der Aufgaben im Team. Dadurch könne Zeit für das Arzt-Patient-Gespräch gewonnen werden.
Wesentlicher dürfte aber eine Veränderung der medizinischen Kultur sein. Ärzte sollten ein Interesse entwickeln und auch zeigen für das, was den Patienten wichtig ist. Sie sollten die Ängste ihrer Patienten kennen und ihnen explizit verdeutlichen, dass Fragen und Äußerungen zur Präferenz erwünscht sind. Ausbildung in patientenzentrierter Kommunikation spiele eine Rolle. Letzten Endes gehe es aber um Respekt und die Wertschätzung der Patienten.
Zur Durchsetzung einer patientenzentrierten Versorgung fordern die Autoren rigorose Qualitätsmaße für die Beteiligung der Patienten und die Übereinstimmung ihrer Präferenz mit der durchgeführten Behandlung.
Die Patienten alleine können die kulturellen Barrieren nicht überwinden. Politiker und Meinungsführer im Gesundheitsbereich (health system leaders) müssen proaktive Schritte ergreifen.
Diese Studie verdeutlicht, dass die Entscheidungsfindung in der Medizin auch eine Machtfrage ist. Bislang sitzen die Ärzte am längeren Hebel und setzten ihre Präferenzen durch, indem sie die Beteiligungswünsche der Patienten bewusst oder unbewusst unterdrücken. Wie weit dieses Verhalten auf Seiten der Ärzte verbreitet ist, kann diese qualitative Studie nicht beantworten. Bemerkenswert ist allerdings, dass dieser Mechanismus bei sozial hoch stehenden Patienten gut funktioniert.
Frosch DL, May SG, Rendle KAS, Tietbohl C, Elwyn G. Authoritarian Physicians And Patients' Fear Of Being Labeled 'Difficult' Among Key Obstacles To Shared Decision Making. Health Affairs 2012;31(5):1030-38. Abstract
David Klemperer, 16.6.12
Dramatische Wissenslücken: Ärzte und Früherkennung
 Wenn in einer Gruppe von Patienten eine Krebserkrankung im Alter von 67 Jahren diagnostiziert wird und die Betroffenen mit 70 Jahren sterben, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 0%. Angenommen die Krebserkrankung wird durch eine Früherkennungsuntersuchung bereits im Alter von 60 Jahren diagnostiziert und die Patienten sterben mit 70 Jahren, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 100%. Das Dumme: die dramatische Erhöhung von 0 auf 100% rettet kein einziges Leben. Der Krebs wird zwar früher erkannt, die Lebenserwartung jedoch nicht verbessert.
Wenn in einer Gruppe von Patienten eine Krebserkrankung im Alter von 67 Jahren diagnostiziert wird und die Betroffenen mit 70 Jahren sterben, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 0%. Angenommen die Krebserkrankung wird durch eine Früherkennungsuntersuchung bereits im Alter von 60 Jahren diagnostiziert und die Patienten sterben mit 70 Jahren, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 100%. Das Dumme: die dramatische Erhöhung von 0 auf 100% rettet kein einziges Leben. Der Krebs wird zwar früher erkannt, die Lebenserwartung jedoch nicht verbessert.
Die Minderung der Sterblichkeit an einer Krebserkrankung ist daher das entscheidende Maß für den Erfolg einer Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Die 5-Jahresüberlebensrate ist dagegen bedeutungslos. Ebenfalls untauglich ist die Zahl der früh erkannten Krebserkrankungen, denn durch Früherkennung werden auch solche Tumore entdeckt, die ansonsten nie aufgefallen wären, weil sie entweder nicht weitgewachsen wären oder sich sogar zurückgebildet hätten - ein Phänomen, das als Überdiagnose bezeichnet wird.
Inwieweit amerikanische Allgemeinärzte, die in ihrem Berufsalltag Früherkennungsuntersuchungen veranlassen, diese Sachverhalte kennen und verstehen, haben jetzt Wissenschaftler des Harding Center for Health Literacy untersucht.
Dafür führten sie eine Online-Befragung durch, an der 412 Ärzte teilnahmen.
Grundlage waren 2 Szenarien. In einem Szenario wurde der Nutzen der Krebsfrüherkennungsuntersuchung mit Zahlen zur 5-Jahresüberlebensrate beschrieben, im anderen mit Zahlen zur Senkung der Krebssterblichkeit.
Das Ergebnis lautet: 69% der Ärzte gründeten ihre Empfehlung zur Teilnahme an der Früherkennung auf die 5-Jahresüberlebensrate, also eine für den Nutzen bedeutungslose Information. Nur 23% erkannten die Sterblichkeitssenkung als relevante Information über den Nutzen.
Die meisten Ärzte vermochten nicht zwischen richtigen und falschen Aussagen zur Verbesserung des Überlebens zu unterscheiden.
76% meinten meinten fälschlicherweise, es würden Leben gerettet, wenn durch Krankheitsfrüherkennung die 5-Jahresüberlebensrate gesteigert wird. 22% erkannten, dass diese Aussage falsch ist.
Bei weiterem Nachfragen offenbarten sich weitere Wissenslücken. Die Information, dass die Früherkennungsuntersuchung die Inzidenz von 27 auf 46 pro Tausend Personen steigert (die Zahlen entsprechen den Effekten der Prostatakrebsfrüherkennung), erhöhte bei 62% der Ärzte die Bereitschaft, die Untersuchung zu empfehlen, 50% meinten, dies bedeute eine weitere Erhöhung der Zahl der geretteten Leben - obwohl, wie oben ausgeführt, die Erhöhung der Inzidenz eine diesbezüglich irrelevante Information ist.
Diese und weitere hier nicht dargestellte Antworten belegen einen Mangel an grundlegendem Wissen im Verständnis von Krankheitsfrüherkennung bei der Mehrheit der befragten amerikanischen Ärzte.
Wer nun hofft, dass in Deutschland alles besser sei, wird enttäuscht. In einer Vorläuferstudie mit 65 deutschen Ärzten meinten 76%, dass die 5-Jahresüberlebensrate den Nutzen der Früherkennung beweise. Nur einer der 65 Ärzte konnte den lead-time-bias zutreffend erklären, also die irrtümliche Annahme verbesserten Überlebens durch Vorverlegung des Diagnosezeitpunkts.
Diese Studien sind ein weitere Beleg dafür, dass viele Ärzte aufgrund ihres unzureichend geschulten Zahlenverständnisses nicht dazu in der Lage sind, ihre Patienten angemessen über den Nutzen und Schaden von Früherkennungsuntersuchungen zu informieren. Die Ärztekammern sollten angesichts dieses dramatischen Ergebnisses die Fortbildungspflicht dazu nutzen, die Ärzte auf den Stand des Wissens zu bringen.
Wegwarth O, Schwartz LM, Woloshin S, Gaissmaier W, Gigerenzer G. Do Physicians Understand Cancer Screening Statistics? A National Survey of Primary Care Physicians in the United States. Annals of Internal Medicine 2012;156:340-49. Abstract
Pressemitteilung des Harding-Center Link
Studie mit deutschen Ärzten
Wegwarth O, Gaissmaier W, Gigerenzer G. Deceiving Numbers. Medical Decision Making 2011;31:386-94. Abstract
David Klemperer, 13.3.12
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) mit Krankenhausaufenthalt beruhen zu 67% auf Effekten von vier Arzneimitttelgruppen
 In den USA nehmen 40% der 65 Jahre alten und älteren BürgerInnen regelmäßig und gleichzeitig 5 bis 9 unterschiedliche Arzneimittel und 18% sogar10 und mehr. Die Einnahme von 5 und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln wird in Fachkreisen als Polypharmazie bezeichnet, die mit mehreren gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dazu gehört, dass mit der Anzahl unterschiedlicher Mittel die Therapietreue, d.h. die Einnahme der korrekten Menge zum richtigen Zeitpunkt, abnimmt und unerwünschte Wechselwirkungen auftreten können. Bei älteren Menschen modifizieren außerdem physiologische Veränderungen die Pharmakokinetik und -dynamik in unkalkulierbarem Umfang.
In den USA nehmen 40% der 65 Jahre alten und älteren BürgerInnen regelmäßig und gleichzeitig 5 bis 9 unterschiedliche Arzneimittel und 18% sogar10 und mehr. Die Einnahme von 5 und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln wird in Fachkreisen als Polypharmazie bezeichnet, die mit mehreren gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dazu gehört, dass mit der Anzahl unterschiedlicher Mittel die Therapietreue, d.h. die Einnahme der korrekten Menge zum richtigen Zeitpunkt, abnimmt und unerwünschte Wechselwirkungen auftreten können. Bei älteren Menschen modifizieren außerdem physiologische Veränderungen die Pharmakokinetik und -dynamik in unkalkulierbarem Umfang.
Eine ForscherInnengruppe untersuchte nun mit den USA-repräsentativen Daten des "National Electronic Injury Surveillance System-Cooperative Adverse Drug Event Surveillance Project" für die Jahre 2007 bis 2009, wie viele unerwünschte Polypharmaziefolgen in Gestalt von Notfällen in Krankenhäuser es bei 65+-Personen gab und was die wichtigsten Ursachen waren.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• In jedem der drei Jahre gab es schätzungsweise und im Durchschnitt 99.628 Notfalleinweisungen und -aufenthalte in Krankenhäusern wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Damit gab es mehr oder vergleichbar viele Krankenhaus-Fälle wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen als für Delirium, Demenz sowie Hautinfektionen.
• 48,1% dieser Notfälle passierten bei 80+-Personen. Die arzneimittelassoziierte Einweisungsrate in Krankenhäuser war bei 85+-Personen 3,5 mal so hoch wie bei den 65- bis 69-Jährigen. Die Rate bei den hochbetagten Personen blieb auch unabhängig von der Anzahl der Einnahme unterschiedlicher Arzneimittel gegenüber der Rate bei jüngeren Personen signifikant erhöht.
• Wenn aus einem notwendigen Besuch einer Notfallstation eine Einweisung in das Krankenhaus wurde, lag dies vor allem an der unbeabsichtigten Einnahme einer Überdosis (65,7% versus 45,7%) und war dann notwendig, wenn der Patient 5 oder mehr unterschiedliche Arzneimittel eingenommen hatte (54,8% versus 39,9%).
• 65,7% aller Krankenhauseinweisungen waren wegen der unbeabsichtigten Überdosierung eines Arzneimittels notwendig gewesen.
• 67% aller Einweisungen beruhten auf unerwünschten Wirkungen der Einnahme eines oder mehrerer Arzneimittel aus einer Gruppe von weit verbreiteten und von jedem Arzt häufig verordneten Standardarzneimitteln: Warfarin, ein blutverflüssigendes Arzneimittel, das in Deutschland als Marcumar im Einsatz ist (33,3% aller medikamentenbedingten Notfälle). Insulin (13,9%), orale Thrombozytenaggregationshemmer wie z.B. ASS, Clodioprogrel (13,3%) und orale hypoglykämische Medikamente bei Diabetes mellitus Typ 2 wie z.B. Sulfonylharnstoffe (10,7%). Risikoreiche und auch oft nicht so häufig verordnete Arzneimittel waren dagegen wider Erwartungen nur bei 1,2% der Krankenhauseinweisungen wegen einer unerwünschten Arzneimittelwirkung beteiligt.
Wer die Arzneimittelsicherheit für ältere Menschen spür- und messbar verbessern will, braucht sich nach den Ergebnissen dieser Studie nicht mit Vorrang, allein oder zunächst mit der möglicherweise sehr komplexen und komplizierten Wirk- und Nebenwirkweise zahlreicher riskanter Arzneimittel beschäftigen. Er oder sie kann und sollte sich auf eine Verbesserung des Managements und des Umgangs mit antithrombotischen und antidiabetischen Arzneimitteln konzentrieren, die in den USA 67% der insgesamt rund 66.000 unerwünschten stationär behandelten Notfälle bedingen. Dies ist umso wichtiger, weil die genannten Arzneimittelgruppen meist gegen chronische Erkrankungen und damit über lange Zeiten eingesetzt werden, d.h. das Risiko langsam aber sicher steigt.
Dazu sollte sicherlich noch genauer untersucht werden, welche Wirkungen im Zusammenhang mit diesen Arzneimittelgruppen auftreten und ob sie auf fehlende oder gar fehlerhafte Erklärungen des Arztes oder auch des Apothekers zum Medikament beruhen oder ob die PatientInnen etwas durcheinander bringen bzw. mangels besseren Wissens etwas falsch machen.
Der Aufsatz "Emergency Hospitalizations for Adverse Drug Events in Older Americans" von Daniel S. Budnitz et al. ist im November 2011 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" erschienen. Er ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.2.12
Offenlegung von Interessenkonflikten - unerwünschte Wirkungen möglich
 Interessenkonflikte finanzieller und nicht-finanzieller Art sind in der Medizin weit verbreitet. Als problematisch gelten sie, weil die Wahrnehmung und Bewertung von Sachverhalten beeinflussen und verzerren können. Beispiele zeigen, dass Wissenschaftler je nach Vorhandensein von Interessenkonflikte identische Daten gegensätzlich beurteilen (wir berichteten über das Beispiel Avandia Link).
Interessenkonflikte finanzieller und nicht-finanzieller Art sind in der Medizin weit verbreitet. Als problematisch gelten sie, weil die Wahrnehmung und Bewertung von Sachverhalten beeinflussen und verzerren können. Beispiele zeigen, dass Wissenschaftler je nach Vorhandensein von Interessenkonflikte identische Daten gegensätzlich beurteilen (wir berichteten über das Beispiel Avandia Link).
Als probates Gegenmittel wird die Offenlegung von Interessenkonflikten angesehen. In den USA wird gerade an der Umsetzung von weitreichenden Meldepflichten gearbeitet (wir berichteten: "Es werde Licht - Transparenzregelungen in den USA werden konkretisiert" Link).
Die amerikanischen Sozialwissenschaftler Loewenstein, Sah und Cain haben eine Reihe von Experimenten durchgeführt, die gezeigt haben, dass die Offenlegung von Interessenkonflikten unbeabsichtigte und unerwünschte Folgen haben kann (Quellen 1-4). Eine Zusammenfassung erschien kürzlich im Journal of the American Medical Association.
Die Offenlegung kann Ärzte dazu veranlassen, Informationen stärker zu verzerren, als es ohne Offenlegung der Fall wäre.
Zwei Mechanismen sind dafür ursächlich:
• Die strategische Übertreibung (strategic exaggeration): der Arzt stellt Sachverhalte z.B. stärker positiv verzerrt da, um der Korrektur entgegenzuwirken, die der Rezipient aufgrund seines Wissens um den Interessenkonflikt des Arztes durchführt.
• Die moralische Genehmigung (moral licensing): der Arzt hat das Gefühl, verzerrte Informationen geben zu dürfen, weil der zu Beratende ja gewarnt war.
Diese Ergebnisse wurden in Versuchsanordnungen erzielt, in der die Arzt-Patient-Beziehung nachgeahmt wurde. In den Versuchen musste eine Person (estimator) Mengen schätzen (z.B. Münzen in einem Glas), allerdings auf Grundlage unvollständiger Informationen. Die andere Person (advisor) hatte die Aufgabe, dem Schätzenden als Experte ergänzende Informationen zu geben. Der Berater hatte stets einen Informationsvorteil, indem er z.B. das Glas mit Münzen länger und aus kürzerer Distanz anschauen durfte. Der Schätzende erhielt eine Bezahlung bei möglichst genauer Schätzung. Für den Berater wurden unterschiedliche Anreize gesetzt.
Geprüft wurde nun das Verhalten des Beraters in Abhängigkeit eines Interessenkonflikts sowie das Verhalten des Schätzenden in Abhängigkeit seines Wissens bzw. Nicht-Wissens um den Interessenkonflikt des Beraters.
Kein Interessenkonflikt lag vor, wenn die Bezahlung des Beraters sich nach der Genauigkeit der Schätzung richtete.
Ein Interessenkonflikt wurde dadurch gesetzt, dass der Berater eine höhere Bezahlung erhielt, wenn die Schätzung möglichst hoch lag.
Das wenig überraschende Ergebnis lautet, dass der Berater dem Schätzenden höhere Werte angab, wenn er durch Überschätzung mehr Geld verdiente.
Bei Offenlegung des Interessenkonflikts gaben die Berater noch höhere Werte an als bei Nicht-Offenlegung - im Sinne der strategischen Übertreibung und der moralischen Lizensierung.
Die Schätzer konnten jedoch die verstärkte Verzerrung bei Offenlegung des Interessenkonflikts nicht entsprechend verrechnen. Sie nahmen zwar stärkere Verzerrung an, unterschätzten diese jedoch.
In beiden Studien verdienten die Schätzer bei Offenlegung als bei Nicht-Offenlegung weniger - die Berater genau umgekehrt. Die Verzerrung wurde auf Seiten des Schätzers (Patient) erhöht. Mit der Offenlegung wurde also genau das Gegenteil von dem erreicht, was Offenlegung bewirken soll.
In der Medizin dürfte das Problem nach Einschätzung der Autoren noch größer sein als in den künstlichen Experimenten (stylized eperiments). Patienten gehen zwar davon aus, dass die Informationen von Ärzten durch Interessenkonflikte verzerrt werden, sie vertrauen aber zumeist ihrem Arzt und meinen, dass er davon ausgenommen ist. Dies kann mit der Fehlannahme zusammenhängen, dass Bias das Ergebnis einer einer absichtlichen Täuschung ist.
Ein weiteres unerwünschtes Ergebnis von Offenlegung kann sein, dass Patienten dem Arzt weniger vertrauen und trotzdem unter erhöhtem Druck stehen, das zu machen, was dieser empfiehlt - ein Phänomen, das die Autoren als "insinuation anxiety" bezeichnen: weiß der Patient, dass eine bestimmte Entscheidung dem Arzt einen finanziellen Vorteil bringt, könnte die Ablehnung durch den Patienten eine neue Dimension in die Beziehung bringen, sie könnte dem Arzt signalisieren, dass der Patient ihn für korrupt hält. In diesem Fall mindert die Offenlegung das Vertrauen des Patienten und erhöht den Druck, dem Ratschlag des Arztes zu folgen.
Angesichts der hier dargelegten Erkenntnisse betonen die Autoren, dass sie auf unerwünschte Folgen der Offenlegung von Interessenkonflikten hinweisen und nicht etwa die Offenlegung in Frage stellen wollen. Es gehe darum sicherzustellen, die erwünschten Effekte der Offenlegung zu erzielen. Auch dafür haben die Autoren Experimente durchgeführt (3).
Zielführend könne z.B. eine unverzerrte, also nicht durch Interessenkonflikt beeinflusste Zweitmeinung sein. Hilfreich sei es auch, wenn der Interessenkonflikt durch eine dritte Person offengelegt wird, der Patient genügend Zeit für eine Entscheidung erhält und die Entscheidung in Abwesenheit des Arztes erfolgt.
Die stärkste Wirkung erziele die Pflicht zur Offenlegung von Interessenkonflikten vermutlich auf die Ärzte selbst. Analoge Beispiele aus anderen Bereichen zeigen, dass Personen das Eingehen von Interessenkonflikten vermeiden, wenn diese schwer vor Anderen zu rechtfertigen sind. Dies dürfte für die Annahme von Geschenken und die Finanzierung von ärztlicher Fortbildung durch die pharmazeutische Industrie durchaus zutreffen.
Loewenstein G, Sah S, Cain DM. The Unintended Consequences of Conflict of Interest Disclosure. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2012;307:669-70 Link (Volltext kostenpflichtig)
Weitere Studien der Arbeitsgruppe
(1) Loewenstein G, Sah S, Cain DM. The Burden of Disclosure: Increased Compliance with Distrusted Advice, 2012 Download Volltext (noch nicht in einer Fachzeitschrift mit peer review erschienen)
(2) Sah S, Loewenstein G, Cain DM. How Doctors' Disclosures Increase Patient Anxiety. Download Volltext (noch nicht in einer Fachzeitschrift mit peer review erschienen)
(3) Cain DM, Loewenstein G, Moore DA. The Dirt on Coming Clean: Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest. J Legal Studies 2005;34:1-25. Download Volltext
(4) Cain DM, Loewenstein G, Don AM. When Sunlight Fails to Disinfect: Understanding the Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest. Journal of Consumer Research 2011;37:836-57 Download Volltext
David Klemperer, 24.2.12
"Liar, Liar, Pants on Fire!" (Journal Watch vom 10.2. 2012) oder: Wie gehen ÄrztInnen gegenüber PatientInnen mit der Wahrheit um?
 Wenn man manche Debatten zwischen ÄrztInnen über ihre Stellung in der Gesellschaft verfolgt, würde der an ihrer Unfehlbarkeit und ihrer in jeder Hinsicht "weißen Weste" zweifelnde Hinweis, sie würden nicht selten ihre PatientInnen belügen oder ihnen wichtige Informationen vorenthalten, mit einem rhetorischen und evtl. auch handfesteren Gegenfeuer beantwortet. Zum "deutschen Stil der Debatte" gehörte dann noch das Konzedieren, es gäbe mal das eine oder andere "schwarze Schaf" oder extrem seltene Zwangssituationen wo eine Lüge das Mittel der letzten Wahl darstelle. Das sei aber alles so selten, dass eine empirisch repräsentative Untersuchung der Häufigkeit von Lügen bei deutschen ÄrztInnen reine Zeit- und Geldverschwendung wäre.
Wenn man manche Debatten zwischen ÄrztInnen über ihre Stellung in der Gesellschaft verfolgt, würde der an ihrer Unfehlbarkeit und ihrer in jeder Hinsicht "weißen Weste" zweifelnde Hinweis, sie würden nicht selten ihre PatientInnen belügen oder ihnen wichtige Informationen vorenthalten, mit einem rhetorischen und evtl. auch handfesteren Gegenfeuer beantwortet. Zum "deutschen Stil der Debatte" gehörte dann noch das Konzedieren, es gäbe mal das eine oder andere "schwarze Schaf" oder extrem seltene Zwangssituationen wo eine Lüge das Mittel der letzten Wahl darstelle. Das sei aber alles so selten, dass eine empirisch repräsentative Untersuchung der Häufigkeit von Lügen bei deutschen ÄrztInnen reine Zeit- und Geldverschwendung wäre.
Dass diese "Schluss-der-Debatte"-Kultur problematisch ist, zeigen jetzt die Ergebnisse einer unter us-amerikanischen ÄrztInnen durchgeführten Untersuchung.
Im Jahr 2008 wurde aus der Mitgliedschaft der "American Medical Association" aus jeder von 7 Arztgruppen (z.B. Hausärzte, Chirurgen, Psychiater) zufällig 500 ÄrztInnen ausgewählt, die einen achtseitigen Fragebogen zugeschickt erhielten, der sich u.a. an den professionellen, ethischen oder moralischen Zielvorgaben und Handlungsempfehlungen der praktisch von allen Ärzteorganisationen anerkannten "Charter on Medical Professionalism" orientierte. Von den 3.500 EmpfängerInnen des Fragebogens konnten schließlich nur 2.938 antworten und 1.891, d.h. für Ärztebefragungen sehr gute 64,4%, taten dies dann auch wirklich.
Die wesentlichen Ergebnisse:
• Die große Mehrheit der ÄrztInnen in den USA stimmt generell dem Prinzip zu, ihre PatientInnen vollständig über Behandlungsrisiken und -nutzen zu informieren. Dies gilt auch für das Prinzip, vertrauliche Informationen über PatientInnen unter keinen Umständen oder nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Patienten an Außenstehende weiterzugeben.
• 34,1% der ÄrztInnen stimmten dem Prinzip nur eingeschränkt oder gar nicht zu, davon betroffenen PatientInnen alle wichtigen ärztlichen oder Behandlungsfehler mitzuteilen - auch dann, wenn es zu keinen dramatischen Folgen kam.
• 17,2% der ÄrztInnen stimmten auch dem Prinzip nur eingeschränkt oder gar nicht zu, einem Patienten niemals etwas zu sagen, was nicht wahr ist.
• 35,4% der ÄrztInnen stimmten ferner dem ebenfalls eindeutig kodifizierten Prinzip nicht oder nur mit Einschränkungen zu, ihren PatientInnen eigene finanzielle Beziehungen mit Arzneimittel- oder Geräteherstellern bekannt zu geben.
• 8,6% stimmten schließlich dem Prinzip, Patientendaten unter allen Umständen vertraulich zu behandeln, nur mit Einschränkungen oder gar nicht zu.
• 11% sagten, sie hätten innerhalb des letzten Jahres einem Patienten oder dem Erziehungsberechtigten eines Kindes wenigstens selten oder auch manchmal oder oft etwas Unwahres gesagt.
• Bei der sicherlich heikelsten Situation in einer Arzt-Patient-Beziehung, der Kommunikation einer Erkrankungsprognose, sagten 55,2% der ÄrztInnen, sie hätten dabei selten, manchmal oder oft eine Darstellung gewählt, welche die Prognose positiver darstellt als es sachlich gerechtfertigt gewesen war.
• Aus Angst verklagt zu werden, teilten 19,9% der Befragten den entsprechend betroffenen Patienten nur selten, manchmal oder oft nicht mit, dass ein Fehler gemacht wurde.
• Im Zeitalter der besonderen Bedeutung von Datenschutz besonders diskutierenswert: 28,4% der ÄrztInnen räumten ein, selten, manchmal oder auch oft einer dazu nicht berechtigten Person absichtlich oder unabsichtlich Gesundheitsinformationen über einen ihrer Patienten preisgegeben zu haben.
Trotz einiger Begrenzungen der Studie (z.B. durch die immer noch nicht sehr hohe Beteiligungsrate oder die Wahrscheinlichkeit von positiv verzerrten Antworten), zeigen ihre Ergebnisse, dass es bei unwahrhaftigem Verhalten von Ärzten nicht nur um eine Handvoll "schwarzer Schafe" unter ihnen und auch nicht nur um ein paar "misstrauische" oder unter Verfolgungswahn leidende PatientInnen geht, die nicht nach den allgemein anerkannten professionellen Regeln handeln oder behandelt werden.
Es geht den AutorInnen nicht darum, bei dieser Transparenz oder beim An- und Wehklagen stehen zu bleiben. Eine solche Transparenz, und auch nur sie schiebt vielmehr den notwendigen Prozess an, die Arzt-Patientbeziehung so vertrauensvoll zu gestalten, dass beide nicht weiter glauben, sich entweder unwahrhaft oder misstrauisch und angstvoll verhalten zu müssen.
Nur wer glaubt, deutsche ÄrztInnen wären radikal anders als ihre us-amerikanischen KollegInnen, kann sich angesichts dieser Zahlen ruhig und selbstzufrieden zurücklehnen und eine vergleichbare Transparenz wie die in den USA in Deutschland für unnötig halten.
Die Studie "Survey Shows That At Least Some Physicians Are Not Always Open Or Honest With Patients" von Lisa I. Iezzoni, Sowmya R. Rao, Catherine M. DesRoches, Christine Vogeli und Eric Campbell ist in der renommierten gesundheitswissenschaftlichen Zeitschrift "Health Affairs" (31, Nr. 2 2012: 383-391) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
In der Literaturliste finden sich eine Menge Hinweise auf eine Reihe klassischer angelsächsischer Texte und Studien (mit Links) zur Patientenzentrierung im Gesundheitswesen und speziell des ärztlichen Handelns. Wer glaubt, die oben genannten Prinzipien seien radikal kann sich durch die Lektüre eines wahrhaften "extremistischen" Textes eines Besseren belehren lassen. Gemeint ist der 2009 in derselben Zeitschrift erschienene Aufsatz (28, no.4 (2009): w555-w565) von DM Berwick "What 'Patient-Centered' Should Mean: Confessions Of An Extremist", der komplett kostenlos erhältlich und sehr lesenswert ist.
Seine drei Kernmaximen für Patientenzentrierung lauten: (1) "The needs of the patient come first."(2) "Nothing about me without me."(3) "Every patient is the only patient."
Bernard Braun, 11.2.12
Welchen Nutzen hat die Behandlung von kranken Menschen statt von Krankheiten?
 Als patientenzentriert gilt eine Behandlung, in der die Ärzte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Behandlungsplan entwickeln und sich dabei bemühen, sämtliche Ressourcen der Krankheitsgeschichte des Patienten zu nutzen aber auch mögliche persönliche Hindernisse für die Behandlung zu berücksichtigen. Ob es sich dabei vor allem um einen Beitrag zum Wohlfühlen beider Seiten handelt oder um mehr, sollte eine von 2008 bis 2010 in Schweden durchgeführte kontrollierte Vorher-Nachher-Studie über die Ergebnisse der stationären Behandlung von 248 PatientInnen mit chronischer Herzschwäche herausbekommen.
Als patientenzentriert gilt eine Behandlung, in der die Ärzte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Behandlungsplan entwickeln und sich dabei bemühen, sämtliche Ressourcen der Krankheitsgeschichte des Patienten zu nutzen aber auch mögliche persönliche Hindernisse für die Behandlung zu berücksichtigen. Ob es sich dabei vor allem um einen Beitrag zum Wohlfühlen beider Seiten handelt oder um mehr, sollte eine von 2008 bis 2010 in Schweden durchgeführte kontrollierte Vorher-Nachher-Studie über die Ergebnisse der stationären Behandlung von 248 PatientInnen mit chronischer Herzschwäche herausbekommen.
Die Ergebnisse bei den für die Studie ausgewählten Merkmalen der Behandlung sahen so aus:
• Die Herzpatienten mit der vollständig implementierten personenzentrierten Behandlung lagen 2,5 Tage kürzer im Krankenhaus als die "normal" behandelten Patienten in der Kontrollgruppe. Diese Differenz ist statistisch signifikant.
• Bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) sah es bei den personenzentriert Behandelten ebenfalls signifikant besser aus.
• Bei der gesundheitsbedingten Lebensqualität und der Zeit bis zu einem erneuten Krankenhausaufenthalt unterschieden sich die beiden Patientengruppen nach 3 bzw. 6 Monaten nicht bzw. nicht signifikant. Die raschere Entlassung aus dem Krankenhaus wirkt sich also mit Sicherheit nicht negativ auf die gesundheitsbedingte Lebensqualität und die Notwendigkeit eines erneuten Krankenhausaufenthalts aus.
• Die AutorInnen weisen darauf hin, dass die Effekte der personenzentrierten Behandlung je nach Krankheit unterschiedlich sein können. Diese Art der Behandlung reduzierte beispielsweise die Krankenhausliegedauer von älteren Patienten mit einer Hüftfraktur sogar um 50%.
Trotz einiger Probleme bei der Durchführung der Studie wie zum Beispiel der relativ hohen Abbrecherquote während ihrer Laufzeit, hat eine personenzentrierte Behandlung offensichtlich einen mehrfachen Nutzen für die PatientInnen, der allerdings auch einen gewissen Aufwand auf Arzt- und Patientenseite erfordert. Dies führt immerhin dazu, dass nur 60% der Angehörigen der Interventionsgruppe während ihres gesamten Aufenthalts in der Klinik eine konsistent personenbezogene Behandlung erhielten. Dies zeige, so der Studienleiter Ekman, dass "the difficulty of rearranging the healthcare culture since it is based on a person with an illness and not on the person's illness alone. The biggest challenge will be to break the traditional and rigid structure of healthcare."
Von dem am 15. September 2011 im "European Heart Journal" veröffentlichten Aufsatz "Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure - the PCC-HF study" von Inger Ekman at al. ist neben dem Abstract auch die achtseitige komplette Fassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.11
Wie lang und oft sollen der gesundheitliche Nutzen und die aufwandsenkende Wirkung von Patientenzentrierung noch bewiesen werden?
 Die immer wieder in Studien erkannten Mängel in der Dauer und der Art der Kommunikation und der patientenzentrierten Behandlung insgesamt, stellen auch aus Sicht von vielen Ärzten ein Hemmnis für ihre Wirksamkeit, die Therapietreue und die Zufriedenheit von PatientInnen dar. Dass sich insbesondere in Deutschland nichts an der 6-8-Minutenmedizin und der einseitigen Beendigung des Erzählflusses von PatientInnen durch den Arzt nach kurzer Zeit verändert, begründen ÄrztInnen häufig mit Zweifeln an der tatsächlichen gesundheitlichen Wirksamkeit eines anderen Kommunikations- und Behandlungsstils und auch damit, dass das ja noch mehr zeitlichen Aufwand bei sowieso schon durch die immer wieder berichteten 18 Patient-Arzt-Kontakte pro Jahr überstrapazierten zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Dass eine qualitativ patientenzentriertere und zunächst zeitintensivere Behandlung unter dem Strich zu weniger Aufwand und einer besseren Behandlung könnte, erschien und erscheint vielen ÄrztInnen, Krankenkassenmanagern und Gesundheitspolitikern immer noch zu unsicher, um so zu arbeiten und Anreize zu setzen.
Die immer wieder in Studien erkannten Mängel in der Dauer und der Art der Kommunikation und der patientenzentrierten Behandlung insgesamt, stellen auch aus Sicht von vielen Ärzten ein Hemmnis für ihre Wirksamkeit, die Therapietreue und die Zufriedenheit von PatientInnen dar. Dass sich insbesondere in Deutschland nichts an der 6-8-Minutenmedizin und der einseitigen Beendigung des Erzählflusses von PatientInnen durch den Arzt nach kurzer Zeit verändert, begründen ÄrztInnen häufig mit Zweifeln an der tatsächlichen gesundheitlichen Wirksamkeit eines anderen Kommunikations- und Behandlungsstils und auch damit, dass das ja noch mehr zeitlichen Aufwand bei sowieso schon durch die immer wieder berichteten 18 Patient-Arzt-Kontakte pro Jahr überstrapazierten zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Dass eine qualitativ patientenzentriertere und zunächst zeitintensivere Behandlung unter dem Strich zu weniger Aufwand und einer besseren Behandlung könnte, erschien und erscheint vielen ÄrztInnen, Krankenkassenmanagern und Gesundheitspolitikern immer noch zu unsicher, um so zu arbeiten und Anreize zu setzen.
Dabei gibt es seit mittlerweile über einem Jahrzehnt und bis in die Gegenwart hinein immer wieder genügend Evidenz für den allseitigen Nutzen patientenzentrierterer Behandlung:
• In einem 1995 im "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichten Review von 21 randomisierten kontrollierten Studien über die Wirkungen einer qualitativ anspruchsvollen patientenzentrierten Arzt-Patientkommunikation von der gründlichen und auch narrativen (!) Anamnese bis zur Besprechung (!) eines Behandlungsplans auf die Gesundheit der Patienten, berichteten 16 signifikant positive Resultate, vier negative, die aber nicht signifikant waren und eine Studie ließ den Leser im Unklaren. Die in dem Aufsatz genannten Elemente einer anspruchsvollen Kommunikation empfahlen die AutorInnen als Inputs für die Arztausbildung und Gesundheitsbildungsangebote für PatientInnen. Neben dem Abstract des Aufsatzes "Effective physician-patient communication and health outcomes: a review" von M. A. Stewart im CMAJ (vol. 152 no. 9: 1423-1433) gibt es auch noch eine kostenlose Komplettversion.
• 2000 untersuchte eine andere Gruppe kanadischer VersorgungsforscherInnen in einer Beobachtungsstudie die Kommunikation in 39 Familienärzte-Praxen aus denen insgesamt 315 PatientInnen an der Studie teilnahmen. Das Untersuchungsziel war, heraus zu bekommen, ob sich patientenzentriertes Verhalten von ÄrztInnen auf eine Reihe von Ergebnisindikatoren der Behandlung auswirkte. Sie nahmen zum einen sämtliche Unterhaltungen zwischen diesen PatientInnen und ihren ÄrztInnen auf Tonband auf und klassifizierten die Gespräche anschließend nach dem Grad ihrer Patientenzentrierung. Zusätzlich fragten sie die PatientInnen nach ihren Wahrnehmungen über die Patientenzentrierung des Arztbesuchs. Bei den Ergebnisindikatoren handelte es sich um die Unannehmlichkeit von Symptomen, den selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand nach dem SF-36-Instrument und die Häufigkeit der Nutzung verschiedener diagnostischer Tests, von Überweisungen und von Arztbesuchen. In der Analyse wurden mögliche Confoundervariablen kontrolliert und eine Standardisierung der unterschiedlichen Praxis-PatientInnen vorgenommen.
Zu den Ergebnissen: Die auf der Basis der Tonbandmitschnitte vorgenommene Klassifizierung der Patientenzentrierung korrelierte gut mit der Wahrnehmung von Patientenzentrierung der Kommunikation mit ihrem Arzt. Die Patienten nahmen eine gemeinsame Basis der Arzt-Patientbeziehung wahr. Positive Wahrnehmungen der Patientenzentrierung und eines gemeinsamen Grundes waren deutlich mit einer besseren Erholung von den Unannehmlichkeiten verschiedener Symptome, einer 2 Monate nach der patrienzentrierten Behandlung besseren emotionalen Gesundheit und weniger diagnostischer Tests und Überweisungen assoziiert: Von den Patienten, die in der patientenzentrierten Gruppe behandelt wurden, erhielten 14,6% einen oder mehrere diagnostische Tests, von den PatientInnen, die ihre Behandlung nicht patientenzentriert wahrnahmen, erhielten solche Tests 24,3%. Ähnliche Unterschiede, teils statistisch signifikant, teils nicht, gab es auch noch bei weiteren Aspekten des Behandlungsgeschehens. Die Erfahrung des Patienten, ein anerkannter und gewünschter Teilnehmer an der Problemdiskussion und am Behandlungsprozess zu sein, ist nach Meinung der AutorInnen vielleicht von höchster Bedeutung für sein geringeres Bedürfnis, eine weitere Untersuchung durch Tests und Überweisungen durchzuführen. Dieser Prozess scheint auch beim Arzt abzulaufen. Interessant und nur teilweise erklärt ist, dass es keine statistische Beziehung zwischen der per Tonband klassifizierten Patientenzentrierung ihres Arztkontakts und den positiven Outcomes gab.
Der Aufsatz endet mit einer ausführlichen Reflexion der schwierigen und zum Teil ambivalenten methodischen und inhaltlichen Aspekte der Studie.
Der Aufsatz "The Impact of Patient-Centered Care on Outcomes" von Moira Stewart et al. ist im September 2000 in der Zeitschrift "The Journal of Familiy Practice" (Vol. 49, No. 9) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
• Und schließlich stellte eine us-amerikanische Forschergruppe in der Mai/Juni-Nummer des 2011er-Jahrgangs der Zeitschrift "Journal of the American Board of Family Medicine" die Ergebnisse einer einjährigen randomisierten Studie mit 509 erwachsenen Patienten vor, die von Familienärzten und allgemeinmedizinisch tätigen Internisten behandelt wurden. Die Untersuchung wurde mit Hilfe eines interaktiven Analyseinstruments durchgeführt, das sowohl anzeigt, ob und wie die primärärztliche Behandlung patientenzentriert stattfand und in welchem Verhältnis Patientenzentrierung zu der Nutzung von Gesundheitsversorgung stand.
Nach der Kontrolle des Einflusses einer Vielzahl von sioziodemografischen, Gesundheitsverhaltens- und Gesundheitsindikatoren und dem rechnerischen Ausschluss ihrer möglichen Einwirkung, gab es ein klares Ergebnis zum Zusammenhang von patientenzentreierten Behandlung und zahlreichen der Behandlungsindikatoren. So sank bei den PatientInnen mit wahrgenommener Patientenzentrierung die Anzahl der Inanspruchnahme spezieller Behandlung pro Jahr schwach signifikant, es gab signifikant weniger Krankenhauseinweisungen und weniger Labor- und Diagnosetests. Die Gesamtausgaben für medizinische Dienstleistungen wurden schließlich innerhalb des Untersuchungsjahres ebenfalls signifikant reduziert. Auch hier lohnen sich gründliche Blicke auf die kritische Diskussion der beobachteten Effekte, die zahlreiche Impulse geben, solche Studien für die dennoch ungläubig bleibenden Gesundheitsakteure zu replizieren.
Der Aufsatz "Patient-Centered Care is Associated with Decreased Health Care Utilization" von Klea D. Bertakis und Rahman Azari, erschienen im "The Journal of the American Board of Family Medicine" (24 [3]: 229-239), ist komplett kostenlos erhältlich.
Nach dem hier geschlagenen 16-jährigen Bogen von unterschiedlichsten Studien zum möglichen Zusammenhang von Patientenzentrierung, der Nutzungshäufigkeit gesundheitlicher Leistungen und ihres gesundheitlichen Nutzens, sollten zumindest die Ärzte und andere Erbringer gesundheitlicher Leistungen, die "eigentlich" gern mehr mit ihren PatientInnen kommuniziert und sie in die Behandlung einbezogen hätten, aber nicht so richtig an den Erfolg glauben und vor allem eine aus ihrer Sicht drohende Zunahme von finanzierter und unfinanzierter Arbeit befürchten, auch im deutschen Gesundheitssystem mehr Patientenzentrierung wagen bzw. unterstützen.
Bernard Braun, 24.10.11
Welche Eltern wollen hören, ihr Kind sei "voll fett"? Zur Bedeutung des "wording" von Ärzten für nicht normal gewichtige Kinder
 Eine Ursache für die Schwierigkeiten, objektiv übergewichtige oder adipöse Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern zu Gegenmaßnahmen zu bewegen, ist wahrscheinlich auch das "wording" der Ärzte und vermutlich auch anderer Experten über den Zustand der PatientInnen.
Eine Ursache für die Schwierigkeiten, objektiv übergewichtige oder adipöse Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern zu Gegenmaßnahmen zu bewegen, ist wahrscheinlich auch das "wording" der Ärzte und vermutlich auch anderer Experten über den Zustand der PatientInnen.
Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Online-Befragung von 445 für die USA repräsentativen Gruppe von Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 18 Jahren zu 10 weit verbreiteten expertlichen und öffentlichen Bezeichnungen für übergewichtige Kinder und Jugendlichen. Die Wortliste reichte von gewichtig, ungesundes Gewicht, hoher BMI, Gewichtsproblem, übergewichtig, schwergewichtig, pummelig (chubby), fettleibig (obese), extrem fettleibig bis richtig/voll fett (fat).
Nach einer multivariaten Analyse der Antworten auf einer fünfstufigen Skala von erstrebenswert bis nicht erstrebenswert ergab sich Folgendes:
• Die Bezeichnungen gewichtig und ungesundes Gewicht waren für die Eltern am erstrebenswertesten.
• Ungesundes Gewicht und Gewichtsproblem wurden als die Bezeichnungen bewertet, die am meisten dazu motivieren, Gewicht zu verlieren.
• Die Bezeichnungen fettleibig, extrem fettleibig und richtig fett wurden als die am wenigsten erstrebenswerten Bezeichnungen eingestuft. Sie wurden außerdem als die am meisten stigmatisierenden, beschuldigenden und am geringsten motivierenden Bezeichnungen wahrgenommen.
• Die Einschätzungen der Eltern waren über eine Reihe von soziodemografischen Merkmale (z.B. Geschlecht, Alter, Einkommen, Rasse oder Bildung), ihr eigenes Gewicht und das ihrer Kinder hinweg konsistent.
• Die AutorInnen schließen auch nicht aus, dass stigmatisierendes "wording" zu unerwünschten Auswirkungen auf die gesundheitliche Versorgung führen kann: 35% der befragten Eltern gaben an, in einem solchen Fall einen neuen Arzt zu suchen und 24% würden zwar bei dem Arzt bleiben, aber künftig Gespräche vermeiden in denen ihr Kind erneut so bezeichnet werden könnte.
Auch wenn die Studie einige Grenzen aufweist (z.B. ihre hypothetische Fragestellung), die Liste der Bezeichnungen auch für us-amerikanische Verhältnisse bei weitem nicht vollständig ist und viele der Bezeich-nungen in Deutschland anders lauten müssten, sollten Kinder- oder Hausärzte und andere ExpertInnen bei ihrer Wortwahl für nicht normalgewichtige Kinder nach einer vergleichbaren Untersuchung auch in Deutschland sorgfältiger auf nichtstigmatisierende und motivierende Worte achten. Dies gilt im Übrigen auch für untergewichtige Kinder und Jugendliche.
Der Aufsatz "Parental Perceptions of weight terminology that providers use with youth" von Rebecca Puhl et al. ist online am 26. September 2011 in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (Volume 128, Number 4: e786-e793) erschienen und komplett kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 5.10.11
Fehlversorgung: 70% bis 80% der erkälteten Kinder und Jugendlichen in Bremen, Oldenburg und umzu werden mit Antibiotika therapiert
 Die jüngsten alarmierenden Meldungen über das Auftauchen eines gegen sämtliche Antibiotika resistenten Tripper-Keims in Japan zeigen, dass derartige Gefahren nicht nur bei exotischen, sondern auch bei weit verbreiteten übertragbaren Krankheiten wie der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe (z.B. jährlich 700.000 Neuerkrankte allein in den USA) real werden können. Unter der zunächst sinnvollen und wirksamen Dauerbehandlung mit Antibiotika seit den 1940er Jahren habe das "Bakterium eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, sich gegen sämtliche Wirkstoffe zu wehren, die es kontrollieren sollen" - so die Entdecker des resistenten Bakteriums.
Die jüngsten alarmierenden Meldungen über das Auftauchen eines gegen sämtliche Antibiotika resistenten Tripper-Keims in Japan zeigen, dass derartige Gefahren nicht nur bei exotischen, sondern auch bei weit verbreiteten übertragbaren Krankheiten wie der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe (z.B. jährlich 700.000 Neuerkrankte allein in den USA) real werden können. Unter der zunächst sinnvollen und wirksamen Dauerbehandlung mit Antibiotika seit den 1940er Jahren habe das "Bakterium eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, sich gegen sämtliche Wirkstoffe zu wehren, die es kontrollieren sollen" - so die Entdecker des resistenten Bakteriums.
Auch wenn es keine weiteren inhaltlichen Gemeinsamkeiten gibt, sollte mit Antibiotika dort umso zurückhaltender umgegangen werden, wo weder die Schwere der Erkrankheit noch die Art des Erregers einen präventiven noch einen kurative Wirksamkeit versprechenden Einsatz versprechen. Gemeint ist die Verordnung für und die Einnahme von Antibiotika durch Kinder und Jugendliche vor allem gegen die überwiegend durch Viren ausgelösten Erkältungserkrankungen der oberen Atemwege.
Im Auftrag der Handelskrankenkasse (hkk) Bremen untersuchten die Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun und Gerd Marstedt vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen die Diagnosen aus der ambulanten Behandlung und die verordneten Arzneimittel für die jungen hkk-Versicherten aus Bremen, Oldenburg und dem ländlichen Umfeld der beiden Städte aus den Jahren 2007, 2008 und 2009. Insgesamt bestätigt diese Studie die wenigen ebenfalls regionalen Erkenntnisse z.B. aus Hessen. Sie zeigt ferner, dass die Verordnungswirklichkeit über mehrere Jahre hinweg relativ unbeeindruckt von der fachlichen und politischen Debatte geblieben ist.
Nachdem die Wissenschaftler zunächst den Forschungs-Erkenntnisstand über die Notwendigkeit der Verordnung von Antibiotika und die Gefahren einer gesundheitlich überflüssigen Verordnung von Antibiotika für das Entstehen resistenter Bakterien zusammengefasst haben, kommen sie zu folgenden Grundzügen des Verordnungsverhaltens der Ärzte für die hkk-Kinder und -Jugendlichen:
• Der Anteil der Bremer Kinder und Jugendlichen zwischen 0 und 18 Jahren, die zwischen 2007 und 2009 mindestens einmal im Jahr ein Antibiotika verordnet bekamm pendelte zwischen 34 und 35%.
• In der wenige Kilometer entfernten Stadt Oldenburg bewegte sich derselbe Wert zwischen 44 und 46%.
• Betrachtet man nur die Kinder und Jugendlichen, die mit einer Erkältungserkrankung zu ihrem Haus- oder Kinderarzt kamen bzw. von ihren Eltern gebracht wurden, erhielten in Bremen rund 70% diese PatientInnen und in Oldenburg zwischen 75 und 80% von ihnen Antibiotika verordnet. Ihre Altersgenossinnen im ländlichen Bereich lagen in etwa zwischen diesen Werten. Diese Häufigkeit ist dann, wenn man beachtet, dass rund 90% aller Atemwegserkrankungen durch Viren und nicht durch Bakterien verursacht werden und Antibiotika daher hier definitiv keinen gesundheitlichen Nutzen haben, sehr hoch. Experten schätzen, dass mindestens die Hälfte der Verordnungen ohne jeglichen Nachteil für die PatientInnen ersatzlos und ohne negativen gesundheitlichen Effekt wegfallen könnte.
Zusätzlich stellen die Wissenschaftler die recht kurze Reihe von Studien vor, die zu erklären versuchen, warum Ärzte "wieder besseres Wissen" und letztlich nur auf Druck der Eltern (so eine häufig gehörte entschuldigende Floskel, die offen gegen professionelle Basisnormen verstößt) Antibiotika verordnen. Sie versuchen auch das Eltern zu erklären, von denen nur weniger als 10% sachkundig sagen, sie nähmen gerne ein Antibiotika ein und trotzdem mehrheitlich Antibiotika widerspruchslos verordnen lassen und ihre Kinder einnahmen lassen.
Eine Veränderung der Arzt-Patient-Kommunikation, gezieltere Patientenaufklärung, ein besseres Schmerzmanagement durch die Ärzte (Schmerz ist häufig das kritische Symptom einer Infektion der oberen Atemwege oder des Mittelohrs), ein expliziter Behandlungsplan und öffentliche Aufklärungskampagnen könnten alle zusammen - so die noch geringere Anzahl von Studien, die sich darum kümmerten - zu einer Abnahme der Verordnungshäufigkeit führen.
Die Analyse "Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen" von Bernard Braun und Gerd Marstedt ist in der hkk-Berichtsreihe "Aspekte der Versorgungsforschung" als Teil I der 2011er Ausgabe erschienen und kostenlos erhältlich.
Wer sich auch noch für den Auslöser-Text der aktuellen Debatte über das Auftreten eines komplett Antibiotika-resistenten Trippererreger interessiert, kann sich den wissenschaftlichen Aufsatz "Is Neisseria gonorrhoeae Initiating a Future Era of Untreatable Gonorrhea?: Detailed Characterization of the First Strain with High-Level Resistance to Ceftriaxone" von Ohnishi et al., erschienen im Juli 2011 in der Fachzeitschrift "Antimicrobial Agents and Chemotherapy" (Vol. 55, No. 7: 3538-3545) komplett kostenlos downloaden. Angeblich soll es 10 bis 20 Jahre dauern, bis dieser Erreger in Europa angekommen sein dürfte, eine Vermutung, die unter den Bedingungen globaler Mobilität eher unwahrscheinlich klingt.
Bernard Braun, 14.7.11
Spornen besser informierte Patienten ihre Ärzte dazu an, mehr oder weniger Leistungen anzubieten? In den USA eher weniger!
 Patienten wollen und sollen sich mehr über gesundheitliche Fragen sowie den Nutzen wie die Kosten von Behandlungen informieren, und sind dazu auch zumindest in bestimmten sozialen und Altersgruppen dank des Internets in der Lage. Die Erwartungen an diese sehr normativen neuen Erwartungen an PatientInnen sind hoch und umfassen den Wegfall vieler unnötiger Leistungen und entsprechender Kosten.
Patienten wollen und sollen sich mehr über gesundheitliche Fragen sowie den Nutzen wie die Kosten von Behandlungen informieren, und sind dazu auch zumindest in bestimmten sozialen und Altersgruppen dank des Internets in der Lage. Die Erwartungen an diese sehr normativen neuen Erwartungen an PatientInnen sind hoch und umfassen den Wegfall vieler unnötiger Leistungen und entsprechender Kosten.
Wie so häufig in der deutschen Gesundheitspolitik bleibt es aber meist bei den genannten und ähnlichen Appellen und kümmert sich kaum jemand ernsthaft darum, ob die Ärzte der so informierten und auch entsprechend kommunizierender PatientInnen wirklich weniger oder sogar mehr Leistungen anbieten. So könnten etwa Ärzte, die mit ihren informierten PatientInnen gut über ihre Erkrankungen und deren Behandlungsoptionen reden und sich gut verstehen können, weniger Zeit für Erklärungen und Überzeugungsarbeit bei ihnen benötigen, eher Anreize haben mehr Behandlungsangebote zu machen. Umgekehrt könnte es sein, dass dann, wenn informierte PatientInnen Behandlungen anfragen oder verlangen, die sich deutlich von denen unterscheiden, die der Arzt empfehlen will, eine kontroversenreiche Arzt-Patientbeziehung entsteht, in der es generell schwierig wird, sich überhaupt auf eine Behandlung zu einigen. Ergebnis wären geringer werdende Anreize Leistungen anzubieten und möglicherweise eine qualitativ schlechte Versorgung.
Wie es in den USA wirklich aussieht, untersuchten jetzt Gesundheitswissenschaftler und -ökonomen mit Daten des für die USA repräsentativen "Community Tracking Study (CTS) physician survey".
Mit unterschiedlich komplexen Berechnungsmethoden liegen seit kurzem die folgenden Ergebnisse vor:
• Zunächst bestätigen die Wissenschaftler die zum Teil negative Bewertung von Internet-Informationen durch einen Teil der Ärzte. Die damit verbundene neue interpretative Rolle von Ärzten ist vielen von ihnen oft unwillkommen.
• Generell gaben 8% der befragten Ärzte an, durch informierte PatientInnen bestimmte Anreize zu erhalten, ihre Behandlungsangebote zu reduzieren, 70% empfanden weder leistungsexpansive noch -reduzierende Anreize und 22% sagten, sie hätten Anreize, ihre Dienstleistungen für den Patienten zu erweitern. 16,8% der PatientInnen brachten in die Kontakte mit ihren Ärzten Informationen aus externen Quellen ein.
• Wenn sich Ärzte in einem Umfeld mit überdurchschnittlichem Wettbewerb bewegen, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie Anreize erhalten ihre Leistungen auszudehnen. Umgekehrt sieght es aus, wenn Ärzte stärker unter "managed care"-Bedingungen arbeiten.
• Besser informierte PatientInnen reduzieren die Anreize für Ärzte möglichst viele und auch unnötige oder nutzlose Leistungen anzubieten. Wenn keiner ihrer PatientInnen andere externe medizinische Informationsquellen benutzt, gaben rund 46% der Ärzte an, sie hätten Anreize, die Leistungen für diese Patienten eher auszudehnen. Nur 3% sagen unter diesen Umständen, sie würden Leistungen reduzieren. Wenn aber Ärzte unter ihren PatientInnen die durchschnittliche Anzahl von Personen haben, die sich extern informieren, also 16,8%, geben nur noch 25% von ihnen an, sie empfänden Anreize, die Leistungen auszudehnen. 11,2% sagen dagegen, sie würden in der Praxis mit diesen PatientInnen eher den Anreiz empfinden, die Leistungen zu reduzieren.
Trotz des Mangels an einer generellen Theorie dazu, wie sich PatiententInnen externe medizinische Informationen beschaffen und wie sie diese dann in Arztkontakten nutzen, unterstreicht die Kontrolle einiger anderer vermutlicher Einflussfaktoren und -bedingungen, welche das Arztverhalten beeinflussen könnten, die relativ große Bedeutung des Informationsstandes der PatientInnen für ein Mehr oder Weniger an angebotenen und erbrachten Leistungen. Weitere mehrdimensionale Forscxhung ist aber in jedem Fall notwendig und wahrscheinlich auch ertragreich.
Den kompletten Text des 2011 im "Forum for Health Economics & Policy" (Vol. 14: Iss. 2 Health Economics) erschienenen Aufsatzes "Does Patient Use of Medical Information Affect Physician Practice Incentives to Provide Care?" von Hai Fang and John Rizzo erhält man über die "Berkeley Electronic Press" auch kostenlos. Dazu muss man sich allerdings auf der Website erst persönlich mit wenigen Angaben zur Person anmelden. Nach den Erfahrungen des Autors führt dies zu keinen unerwünschten Angeboten.
Bernard Braun, 1.6.11
Darmkrebs-Screening: Entscheidungshilfen sind auch bei Personen mit geringem Bildungsstand nützlich, senken aber die Teilnahme.
 Die Beteiligung von Patienten an Entscheidungen über ihre Behandlung und die dafür notwendigen Informationen über den Nutzen verschiedener diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen durch den Arzt oder aus anderen Informationsquellen gehören sowohl zu einem modernen und oft mit höherer Wirksamkeit verbundenen Behandlungsverständnis (Stichwort: Patient als "Koproduzent") als auch zu den Erwartungen eines größer werdenden Teils der Patienten.
Die Beteiligung von Patienten an Entscheidungen über ihre Behandlung und die dafür notwendigen Informationen über den Nutzen verschiedener diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen durch den Arzt oder aus anderen Informationsquellen gehören sowohl zu einem modernen und oft mit höherer Wirksamkeit verbundenen Behandlungsverständnis (Stichwort: Patient als "Koproduzent") als auch zu den Erwartungen eines größer werdenden Teils der Patienten.
Zu den immer wieder identifizierten Barrieren des "shared decision making" gehören die Fähigkeit und Bereitschaft der Ärzte, ihre Patienten umfassend und nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu informieren aber auch die Fähigkeit und Bereitschaft vieler Patienten, diese Informationen zu verstehen und auf ihrer Basis eine Behandlungsentscheidung (mit) zu treffen.
Um diese Barrieren auf beiden Seiten abzubauen, wurden in den letzten Jahren für immer mehr Erkrankungssituationen so genannte "decision aids" entwickelt, mit denen im Idealfall alle Informationen vorliegen und stufenweise bis zu einer Entscheidung durchdacht werden können. Auch bei diesen Entscheidungsenthilfen war aber immer die Frage offen, ob formal gering gebildete Personen oder Patienten mit entsprechend geringem Grundwissen über Gesundheits- und Gesundheitssystemfragen wirklich in der Lage sind, alles zu verstehen und eine für sie gute Entscheidung zu treffen.
In einer randomisierten kontrollisierten Studie mit 572 Erwachsenen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren mit niedrigem Bildungsstand wurde nun untersucht, welche Wirkung eine speziell für das kognitive und sprachliche Niveau der Personen zugeschnittene "decision aid" auf das Wahlverhalten und die Inanspruchnahme eines Screeningprogramms für Dick- und Mastdarmkrebs hat. Die sämtlich zur Inanspruchnahme am Screening berechtigten Personen stammen aus mehreren Regionen des australischen Bundesstaates New South Wales, in dem eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht und es einen hohen Anteil ungelernter Tätigkeiten gibt.
Die Interventionsgruppe erhielt eine schriftliche interaktive (Frage-Antwort-Systematik) Broschüre und eine themenbezogene DVD, die beide Angaben zum quantitativen Risiko, an Darmkrebs zu erkranken und zu den Vorteilen aber auch möglichen Schäden durch das Screening enthielten. Hinzu wurde der mögliche Outcome des Tests auf okkultes Blut im Vergleich zu Personen dargestellt, die keinen Test durchgeführt haben. Die Kontrollgruppe erhielt das übliche, d.h. nicht weiter an den vermutlichen geringeren Kenntnissen der Personenm mit niedriger Bildung orientierte Informationsmaterial des nationalen Darmkrebsprogramms. Alle Materialien einschließlich der Teststreifen auf okkultes Blut wurden den TeilnehmerInnen direkt nach Hause geschickt.
Die Ergebnisse zeigten zum einen, dass es möglich ist, mit geeignetem Material und Methodiken auch Personen mit geringem Bildungs- und Wissensstand anzusprechen und ihnen zu einer informierten Wahlmöglichkeit zu verhelfen.
Dies zeigt sich in folgenden Punkten:
• Auf einer Wissenskala mit maximal 12 Punkten, erreichten die EmpfängerInnen der Entscheidungshilfe durchschnittlich 6,5 Punkte, die der Kontrollgruppe lediglich signifikant geringere 4,1 Punkte.
• Untersucht man, wie viele Angehörige der beiden Gruppen eine informierte Wahl getroffen haben, waren es in der "decision aid"-Gruppe 34 % und in der Standardgruppe 12 %.
• Schließlich gaben mehr, nämlich 51 % der Angehörigen der Entscheidungshilfe-Gruppe an, keine Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung Pro oder Contra ihrer Teilnahme am Screening gehabt zu haben als Angehörige der Standardgruppe, von denen dies nur 38 % angaben.
• Die Häufigkeit von genereller Angst vor Darmkrebs war in beiden Gruppen gleich.
Diesen Ergebnissen stehen aber auch ein paar deutlich andersgeartete Effekte der Entscheidungshilfe gegenüber:
• Die Einstellung gegenüber dem Screening auf okkultes Blut war bei 51 % der EmpfängerInnen der Entscheidungshilfe positiv. Bei den Angehörigen der Kontrollgruppe sagten dagegen 65 %, sie stünden diesem Test und seinem Sinn positiv gegenüber.
• Ähnlich sah es dann bei der tatsächlichen Beteiligungsrate aus: Während 59 % der Entscheidungshilfe-Gruppe den Screeningtest durchführte, waren es in der Kontrollgruppe signifikant mehr Personen, nämlich 65 %.
Angesichts der unerwartet niedrigeren Inanspruchnahmehäufigkeit des Darmkrebsscreenings in der Gruppe der Nutzer der Entscheidungshilfe und der offenen Frage, ob es sich dabei um einen "unerwünschten" Effekt handelt oder dies sogar positiv zu bewerten ist, schlagen die australischen ForscherInnen eine gründlichere Debatte über den Sinn und die Umstände von Screenings vor. Sie liefern dafür am Ende ihres Aufsatzes auch eine Reihe von inhaltlichen Hinweisen.
Der 13 Seiten umfassende Aufsatz "A decision aid to support informed choices about bowel cancer screening among adults with low education: randomised controlled trial" von Sian K Smith und anderen ist aktuell online im "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ 2010; 341:c5370) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Über die Anzahl (Ende Oktober 2010=306) und die Art der erhältlichen "decision aids" erfährt man alles in der speziellen "Cochrane decision aid registry".
Bernard Braun, 20.11.10
Warum verordnen Ärzte erkälteten Patienten "gegen besseres Wissen" immer noch viel zu viele Antibiotika?
 Mit der kühleren Jahreszeit steigt die Anzahl erkälteter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener schlagartig an. Damit steigt auch die Anzahl der Verordnungen von Antibiotika an und damit eine ursächlich meist nutzlose aber mittel- bis langfristig zu unerwünschten oder gar gefährlichen Effekten führende Fehlversorgung.
Mit der kühleren Jahreszeit steigt die Anzahl erkälteter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener schlagartig an. Damit steigt auch die Anzahl der Verordnungen von Antibiotika an und damit eine ursächlich meist nutzlose aber mittel- bis langfristig zu unerwünschten oder gar gefährlichen Effekten führende Fehlversorgung.
Nutzlos, weil es sich bei Erkältungskrankheiten und verwandten Erkrankungen meist um Virusinfektionen handelt, Antibiotika aber nur bei bakteriellen Infektionen wirksam und nützlich sind.
Gefährlich, weil auch nutzlose Antibiotika zur Entwicklung resistenter Erreger führen und damit das Risiko künftig nicht mehr behandelbarer Erreger mit erhöhen.
Dass dieses Problem nicht nur in Deutschland besteht, sondern auch in europäischen Nachbarländern, zeigt ein soeben im Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics (Volume 35, Issue 6 Page 617-736) veröffentlichter Artikel aus Polen. Unter dem Titel Antibiotics in the treatment of upper respiratory tract infections in Poland. Is there any improvement?, von dem das Abstract kostenfrei erhältlich ist, hinterfragen Wissenschaftler verschiedener polnischer Universitäten den ungerechtfertigten und potenziell schädlichen Einsatz von Antibiotika bei Infektionen der oberen Luftwege.
Warum viele Ärzte trotz dieses hinlänglich wissenschaftlich belegten und auch verbreiteten Wissens Antibiotika bereits ab dem Kleinkindalter zu häufig verordnen, liegt nach ihrer hartnäckig vertretenen Ansicht und Erfahrung an den Patienten oder ihren Eltern selber. Diese drängten Ärzte derart massiv, Antibiotika zu verordnen und drohten dabei auch, den Arzt zu wechseln, dass ihnen gar nichts übrig bliebe auch "wider besseres Wissen" doch Antibiotika zu verordnen.
An dieser "Schlachtordnung" weckt oder fördert die Lektüre einer bereits im September 2010 veröffentlichten Befragungsstudie in der deutschen Bevölkerung erhebliche Zweifel. Bereits 2008 versuchten nämlich Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) genauer zu ermitteln, inwieweit die deutsche Bevölkerung von ihren Ärzten erwartet, bei einer normalen Erkältung Antibiotika verschrieben zu bekommen. Dazu wurden 1.778 zufällig aus rund 30.000 Internetnutzern ausgewählte Personen online befragt.
Die wichtigsten Befragungsergebnisse lauten:
• Nur 7,7 Prozent der Befragten sagten, sie würden gerne ein Antibiotikum erhalten und brächten diese Erwartung auch zu einem Arztbesuch mit.
• 47,3 Prozent wollen zuerst einmal untersucht werden und dann einen Rat für den weiteren Umgang mit der Erkrankung sowie bei Bedarf eine Krankschreibung erhalten.
• 44,4 Prozent möchten Mittel zur Beseitigung der Erkältungssymptome, beispielsweise schmerzstillende Mittel oder Hustenbonbons. 18,2 Prozent erwarten pflanzliche oder alternative Therapeutika. Ebenso viele meinen, ihr Arzt solle entscheiden, was zu tun sei.
• Unter den wenigen, die erklärtermaßen eine Antibiotika-Verordnung erwarten, würde sich der Großteil (70,8%) passiv verhalten und dem Arzt vertrauen, wenn dieser eine solche Verordnung von sich aus aktiv für unnötig halten würde. 7,1 Prozent wären zwar unzufrieden, würden aber die Entscheidung ihres Arztes akzeptieren. 12,4 Prozent würden an ihrem Wunsch festhalten aber nur 2,7 Prozent einen anderen Arzt konsultieren. Da sich dieser Anteil nur auf die 7,7 Prozent derjenigen bezieht, die überhaupt ein Antibiotikum erwarten, sind es also gerade einmal 0,21 Prozent aller erkälteten Patienten, die ein Arzt nach der Ablehnung einer Antibiotika-Verschreibung vermutlich verlieren würde. Nur bei 0,95 Prozent träfe ein Arzt, der kein Antibiotikum verordnen will, auf hartnäckigen Widerstand, der ihn u.U. viel Zeit kosten würde.
• Die Befragungsergebnisse zeigen außerdem, dass viele Patienten fast durchweg ein fachlich korrektes Wissen um den Sinn und die Risiken von Antibiotika haben. Trotzdem stimmt immer noch eine starke Minderheit der Behauptung zu, Antibiotika seien gegen Viren wirksam und daher geeignet, Erkältungserkrankungen zu behandeln. Die somit offensichtliche Bereitschaft, im Krankheitsfall "für alle Fälle" nach jedem "Strohhalm" zu greifen, zeigt den Aufklärungsbedarf durch Krankenkassen und Ärzte. Dies gilt auch für die Befragten, die auf bestimmte Fragen keine Antworten geben können.
• Eine weitere wichtige Frage war, ob die Einstellungen und Verhaltensweisen von erkälteten Personen möglicherweise von ihrem Wissensstand abweichen. So stimmen rund 94 Prozent der Be-fragten "voll" oder "eher" der Aussage zu, Antibiotika nur einzunehmen, wenn sie absolut nötig sind. Welche Notwendigkeiten dies sein könnten, zeigen die weiteren Fragen und Antworten. Hier stimmen dann immerhin 32 Prozent der Aussage zu, dass Antibiotika bei wichtigen Ereignissen wie einer Prüfung oder Hochzeit hilfreich und daher angebracht seien. Am wenigsten, nämlich nur rund sieben Prozent der Befragten waren der Meinung, Antibiotika würden bei Halsschmerzen "Schlimmeres verhindern".
• Ein für die Patientenaufklärung wichtiges Ergebnis ist der niedrigere aber immerhin noch durchaus respektabel vorhandene Wissensstand über Antibiotika und ihren richtigen Gebrauch bei Jugendlichen. Alle Befragten beantworteten im Durchschnitt 5,18 der acht Wissensfragen zu den Mitteln richtig. Die jüngste Gruppe der 15- bis 19-Jährigen gab 4,17 richtige Antworten. Auf die acht Fragen zum verantwortungsvollen Gebrauch der Mittel gaben alle Befragten im Durchschnitt 6,29 korrekte Antworten, bei den 15- bis 19-Jährigen nur 5,77. Doch auch diese Unterschiede bieten keinen Anlass zu der Befürchtung, dass Jugendliche besonders aggressiv auf die Verordnung von Antibiotika drängen. Auch für die Kinder unter 15 Jahren ergeben sich keine Hinweise auf eine besonders hohe aktive Nachfrage nach Antibiotika. Und auch für erhebliche Wissenslücken und Fehleinstellungen in der Elterngeneration gibt es keine Hinweise, im Gegenteil: In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen werden Wissensfragen sogar überdurchschnittlich gut (5,35 und 5,62 richtige Antworten) beantwortet. Dies trifft auch für die Anzahl richtig beantworteter Gebrauchsfragen zu (6,34 bis 6,50 richtige Antworten).
Die Untersuchung könnte einige methodische Verzerrungen haben (z.B. die Durchführung mit Internet-Usern) und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der Befragten als sozial erwünscht betrachtete Antworten "kontra Antibiotika" gegeben hat und ihr Verhalten in der Arztpraxis von ihrem Befragungsverhalten abweicht. Trotzdem ist es völlig unwahrscheinlich, dass sämtliche Befragten in der Praxissituation plötzlich enthemmt und gegen ihre ja durchaus artikulierten kognitiven Vorbehalte Antibiotika fordern. Und selbst, wenn man sich das Verhalten der in dieser Studie evtl. unterrepräsentierten Personen vorstellt, kann dies nicht nur aus "Antibiotika-Gier" bestehen und würde auch quantitativ nicht ausreichen, das von Ärzten bemühte Verhalten der Mehrzahl ihrer Patienten zu bestätigen.
Internationale Studien, die auch noch ausführlicher im Forum vorgestellt werden, zeigen außerdem, dass selbst dann ärztliche Aufklärung und die Kommunikation über positive konkrete Behandlungspläne (Vermeidung von reiner Verbotskommunikation!) Patienten umstimmen können.
Die Studie "Antibiotics for the common cold: expectations of Germany's general populati-on" von Faber MS, Hecken-bach K, Velasco E und Eckmanns T. ist in der Fachpublikation "Euro Surveillance" (2010; 15(35):pii=19655) veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.10
Im Krankenhaus: Vier-Minuten-Medizin für Patienten, 20 Sekunden für das Gespräch mit Angehörigen
 Von "Fünf-Minuten-Medizin" ist meist die Rede, um deutlich zu machen, dass Ärzte zu wenig Zeit aufwenden für das Gespräch mit Patienten und ihre Untersuchung. Tatsächlich hat eine Analyse unlängst gezeigt, dass deutsche Patienten sehr viel häufiger zum Arzt gehen als international üblich und dass der durchschnittliche Patientenkontakt im Jahr 2008 etwa acht Minuten dauerte (vgl. Barmer GEK Arztreport 2010: Viele Patientenkontakte, wenig Zeit). Eine deutsche Studie, die an der Universitätsklinik Freiburg durchgeführt wurde, hat jetzt deutlich gemacht, dass für Patienten in Krankenhäusern das Arzt-Patient-Gespräch noch sehr viel kürzer dauert: Als Durchschnittswert für die Kommunikation von Klinikärzten mit Patienten ermittelten die Wissenschaftler 4 Minuten und 17 Sekunden (pro Tag und Patient). Gerade mal 20 Sekunden dauerte das Gespräch mit Angehörigen.
Von "Fünf-Minuten-Medizin" ist meist die Rede, um deutlich zu machen, dass Ärzte zu wenig Zeit aufwenden für das Gespräch mit Patienten und ihre Untersuchung. Tatsächlich hat eine Analyse unlängst gezeigt, dass deutsche Patienten sehr viel häufiger zum Arzt gehen als international üblich und dass der durchschnittliche Patientenkontakt im Jahr 2008 etwa acht Minuten dauerte (vgl. Barmer GEK Arztreport 2010: Viele Patientenkontakte, wenig Zeit). Eine deutsche Studie, die an der Universitätsklinik Freiburg durchgeführt wurde, hat jetzt deutlich gemacht, dass für Patienten in Krankenhäusern das Arzt-Patient-Gespräch noch sehr viel kürzer dauert: Als Durchschnittswert für die Kommunikation von Klinikärzten mit Patienten ermittelten die Wissenschaftler 4 Minuten und 17 Sekunden (pro Tag und Patient). Gerade mal 20 Sekunden dauerte das Gespräch mit Angehörigen.
Die Studie fand statt am Universitätsklinikum Freiburg, einem Lehrkrankenhaus mit 1.700 Betten, 110 Krankenstationen und rund 55.000 stationären Patienten pro Jahr. Während des Studienverlaufs wurden die konkreten Tätigkeiten von 44 Ärzten akribisch protokolliert. Dies geschah, um subjektive Verzerrungen auszuschließen, wie in ethnologischen Studien durch Beobachtung: Ein Medizinstudent im 4.Studienjahr verfolgte einen zufällig ausgewählten Arzt einen ganzen Tag lang und notierte anhand eines zuvor erprobten Klassifizierungsschemas Art und Zeitdauer der jeweiligen Verrichtung. Dieses Schema umfasste 19 verschiedene Tätigkeiten, darunter Operationen, Schreiben von Berichten, Pausen, Gespräche mit Kollegen, mit Patienten, mit Angehörigen, Lehre und Forschung etc.
Insgesamt wurden so 374 Arbeitsstunden von Ärzten anhand objektiver Beobachtungen analysiert, im Durchschnitt 10 Stunden und 58 Minuten pro Arzt. Darüber hinaus füllten die Ärzte jedoch auch noch einen Fragebogen aus, in dem sie schätzen sollten, wie viel Zeit sie an einem Tag für die 19 unterschiedlichen Arbeitsaufgaben aufbringen.
Als Ergebnis der Beobachtungsdaten zeigte sich dann:
• Das Gespräch mit Patienten dauerte im Durchschnitt 4 Minuten und 17 Sekunden, das Gespräch mit einem Angehörigen 20 Sekunden.
• Die Wissenschaftler suchten auch danach, ob Ärzte je nach Alter, Geschlecht, Arbeitszeit und Überstunden, Zahl betreuter Patienten, Arbeitszufriedenheit usw. unterschiedlich lange Gespräche führen, konnten hierzu jedoch keine statistisch signifikanten Einflussfaktoren identifizieren.
• Diskussionen mit Kollegen nahmen die meiste Zeit in Anspruch und dauerten pro Tag etwa 2 Stunden und 30 Minuten.
• An zweiter Stelle rangierten Dokumentations-Arbeiten: DRGs vercoden, Operationsberichte verfassen, Briefe schreiben, Verwaltungsaufgaben und ähnliche Tätigkeiten nahmen pro Tag 2 Stunden und 28 Minuten in Anspruch.
Überraschender Weise schätzten die beobachteten Ärzte dann die Zeitdauer für das Patientengespräch doppelt so lang ein wie es tatsächlich war und das Gespräch mit Angehörigen sieben Mal so lang.
In der Diskussion der Befunde machen die Wissenschaftler deutlich, dass die ermittelte Zeitdauer der Arzt-Patient-Kommunikation im Rahmen einer zukünftig immer wichtigeren patientenzentrierten Versorgung auch im stationären Bereich wohl viel zu kurz ist und weisen auch darauf, dass die Qualität dieser Kommunikation noch gar nicht untersucht und berücksichtigt wurde.
Hier findet man ein Abstract der Studie und den Link zum kostenlosen Volltext (PDF): Gerhild Becker et al: Four minutes for a patient, twenty seconds for a relative - an observational study at a university hospital
(BMC Health Services Research 2010, 10:94 doi:10.1186/1472-6963-10-94)
Gerd Marstedt, 20.4.10
Gute Kommunikation zwischen Arzt und Patient verbessert auch in der Rehabilitation den Therapieerfolg
 Eine große Zahl von Studien hat bereits aufgezeigt, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient mitentscheidenden Einfluss auf den weiteren Therapieverlauf hat. Eine vertrauensvoller und intensive Kommunikation erhöht die Adhärenz (Befolgung der Medikamentenverordnung), stärkt die Selbstwirksamkeits- oder Kontrollerwartung für eine Rekonvaleszenz, verbessert Kenntnisse über die Krankheit und ihre Ursache. Dass diese Zusammenhänge nicht nur für den Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung, sondern auch für stationär durchgeführte Rehabilitationsmaßnahmen gelten, hat jetzt eine deutsche Studie gezeigt, die in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurde.
Eine große Zahl von Studien hat bereits aufgezeigt, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient mitentscheidenden Einfluss auf den weiteren Therapieverlauf hat. Eine vertrauensvoller und intensive Kommunikation erhöht die Adhärenz (Befolgung der Medikamentenverordnung), stärkt die Selbstwirksamkeits- oder Kontrollerwartung für eine Rekonvaleszenz, verbessert Kenntnisse über die Krankheit und ihre Ursache. Dass diese Zusammenhänge nicht nur für den Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung, sondern auch für stationär durchgeführte Rehabilitationsmaßnahmen gelten, hat jetzt eine deutsche Studie gezeigt, die in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurde.
Im Zentrum der Studie standen Befragungen von anfänglich 470 Patienten aus sieben nordwestdeutschen Rehabilitationskliniken, die zu Beginn ihrer Rehabilitation, im weiteren Verlauf und schließlich noch einmal 6 Monate nach der Entlassung Auskunft gaben über die erlebte Qualität der Kommunikation mit dem für sie hauptsächlich zuständigen Arzt. Vollständige Datensätze standen nach einem halben Jahr noch für 295 Patienten zur Verfügung. Die Stichprobe war nach Aussage der Wissenschaftler recht typisch für eine Reha-Klinik: 66% waren männlich, 63% waren Arbeiter, ebenso viele hatten höchstens einen Hauptschulabschluss, das Durchschnittsalter lag bei 50 Jahren.
Zur Bewertung der Arzt-Patient-Kommunikation wurde ein spezieller Fragebogen verwendet (der "P.A.INT-Fragebogen", Abkürzung für Patient-Arzt-Interaktion) der verschiedene Aspekte der Interaktion erfasst, und zwar unter anderem die emotionale Qualität des Kontakts, die instrumentelle Qualität (auf der Basis von Information und Feedback) sowie auch die Partizipation des Patienten und sein Einbezug in den Prozess des Shared Decision Making. Darüber hinaus wurden in den späteren Befragungen nach der Entlassung auch verschiedene Indikatoren zum Gesundheitszustand erhoben. 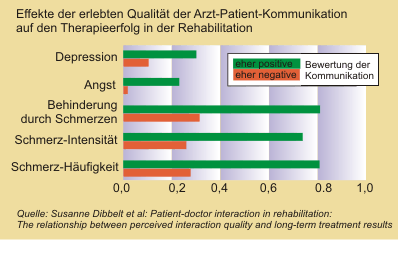
Auf der Basis der Fragebogen-Antworten zu Beginn der Studie wurden die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt, solche mit einer eher positiven und solche mit einer eher negativen Bewertung der Kommunikation mit ihrem Reha-Arzt. Im Vergleich dieser beiden Gruppen zeigten sich dann sechs Monate nach der Entlassung ganz erhebliche Unterschiede, was den Gesundheitszustand und damit Therapieerfolg anbetrifft. Besonders deutlich zeigte sich dies bei den Merkmalen: Häufigkeit von Schmerzen, Intensität von Schmerzen, Behinderungen im Alltag durch Beschwerden, Ängste, Depressivität. (vgl. Abbildung)
Hier ist ein Abstract der Studie: Susanne Dibbelt et al: Patient-doctor interaction in rehabilitation: The relationship between perceived interaction quality and long-term treatment results (Patient Education and Counseling. Volume 76, Issue 3, 2009, Pages 328-335, doi:10.1016/j.pec.2009.07.031)
Gerd Marstedt, 27.1.10
"Wie geht es uns heute?" Der ärztliche Pluralis majestatis ist für Patienten kein Beleg partnerschaftlicher Kommunikation
 Bei hohen Adligen, Monarchen und kirchlichen Würdenträgern sollte der Gebrauch des Pluralis majestatis ("Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden ...") Ausdruck ihrer Macht sein und verdeutlichen, dass sie auch für ihr Volk sprechen. Ob das auch bei Ärzten nicht selten zu vernehmende "Wir ..." solche Macht dokumentieren soll, ist unklar. Deutlich geworden ist im Rahmen einer US-amerikanischen Studie jetzt aber, dass Patienten diese Sprachhülse eher negativ bewerten. Der Kommunikationsstil solcher Ärzte wird von Patienten überwiegend als bevormundend und suggestiv eingestuft.
Bei hohen Adligen, Monarchen und kirchlichen Würdenträgern sollte der Gebrauch des Pluralis majestatis ("Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden ...") Ausdruck ihrer Macht sein und verdeutlichen, dass sie auch für ihr Volk sprechen. Ob das auch bei Ärzten nicht selten zu vernehmende "Wir ..." solche Macht dokumentieren soll, ist unklar. Deutlich geworden ist im Rahmen einer US-amerikanischen Studie jetzt aber, dass Patienten diese Sprachhülse eher negativ bewerten. Der Kommunikationsstil solcher Ärzte wird von Patienten überwiegend als bevormundend und suggestiv eingestuft.
Eine partnerschaftliche Kommunikation , wie sie etwa im Konzept des "Shared-Decision-Making" beschrieben wird, ist für viele Patienten heute eine selbstverständliche Erwartung an ärztliche Umgangsformen. Ob die von vielen Ärzten benutzten Sprachfloskeln in der ersten Person Plural ("Haben wir heute schon unsere Tabletten eingenommen?", "Wie geht es uns heute?", "Wir wollen morgen operieren" usw.) als Hinweis auf eine solch partnerschaftliche Einstellung des Arztes erlebt wird, wurde in einer Studie untersucht, die jetzt in der Zeitschrift "Journal of General Internal Medicine" veröffentlicht wurde.
Basis der Studie waren Gespräche zwischen 45 Ärzten und 418 HIV-Patienten, die auf Tonband mitgeschnitten, abgetippt und anschließend qualitativ ebenso wie quantitativ analysiert wurden. Zentrale Fragestellung war dabei: Wird die ärztliche Kommunikation von Patienten positiver bewertet, wenn im Gespräch einmal oder öfter der Pluralis majestatis auftaucht? Die Ergebnisse dieser multivariaten Analyse, in der auch viele andere denkbare Einflussfaktoren berücksichtigt wurden, waren recht eindeutig: Das Gegenteil ist der Fall, der häufige Gebrauch des "Wir" durch Ärzte führt zu einer schlechteren Note bei der Bewertung des Kommunikationsstils durch Patienten. (Die Odds-Ratio für eine positive Bewertung lag nur bei 0,57, d.h. der Gebrauch des "Wir" senkt die Wahrscheinlichkeit, vom Patienten positiv bewertet zu werden, um 43 Prozent, von 100% auf 57%).
In einer qualitativen Analyse, wann und wozu Ärzte sich in dieser Form ausdrücken, wurde dann deutlich, dass hier sehr oft bevormundende und suggestive Aussagen in das "Wir" eingekleidet wurden - was zugleich eine Erklärung ist für das zentrale empirische Ergebnis der Studie. Die Wissenschaftler analysierten auch, in welchen Fällen Ärzte häufiger den Pluralis majestatis gebrauchen. Dies ist öfter der Fall bei jüngeren Patienten und Patienten mit höheren Depressivitäts-Werten. Ebenso neigen ältere Mediziner eher dazu.
Hier ist ein Abstract der Studie: Helen Kinsman et al: "We'll Do this Together": The Role of the First Person Plural in Fostering Partnership in Patient-physician Relationships (Journal of General Internal Medicine, DOI 10.1007/s11606-009-1178-3)
Gerd Marstedt, 3.1.10
Kein Rechtsanspruch auf Widerruf einer ärztlichen Diagnose - OVG: "Alkohol-Missbrauch" ist ein Werturteil
 Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen hat in einem bereits am 2.12.2008 getroffenen aber erst am 18.10.2009 online veröffentlichten Beschluss (AZ: 13 E 1108/08) eine für Nichtjuristen nicht unmittelbar verständliche Argumentationskette mit interessantem Schluss für rechtens erklärt. In dem zur Entscheidung anhängigen Fall ging es darum, dass eine von einem Amtsarzt in einem Gutachten als Alkoholmissbraucherin diagnostizierte Frau, diese Diagnose als ehrverletzend ansah und ihren Widerruf verlangte.
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen hat in einem bereits am 2.12.2008 getroffenen aber erst am 18.10.2009 online veröffentlichten Beschluss (AZ: 13 E 1108/08) eine für Nichtjuristen nicht unmittelbar verständliche Argumentationskette mit interessantem Schluss für rechtens erklärt. In dem zur Entscheidung anhängigen Fall ging es darum, dass eine von einem Amtsarzt in einem Gutachten als Alkoholmissbraucherin diagnostizierte Frau, diese Diagnose als ehrverletzend ansah und ihren Widerruf verlangte.
Das OVG lehnte dieses Begehren ab und führte folgende Gründe an:
• Gegenstand eines Widerrufsanspruchs können "nur Tatsachenbehauptungen sein …, nicht aber Werturteile".
• "Anerkannt ist des Weiteren, dass es sich bei ärztlichen Diagnosen grundsätzlich um Werturteile handelt. Zwar werden in entsprechenden ärztlichen Äußerungen regelmäßig auch Tatsachen behauptet, etwa die Beobachtung bestimmter, der Diagnose zugrunde liegender Symptome. Der Schluss, den ein Arzt mit einer Diagnose aus den vorliegenden Fakten zieht, ist jedoch eine aus seiner fachlichen Einschätzung gewonnene Bewertung und nicht die Behauptung einer Tatsache."
• Nur wenn die Erhebung des Befundes, der die Schlussfolgerung des Arztes trägt, in fachlich-methodischer Hinsicht offensichtlich defizitär oder offenkundige persönliche Inkompetenz vorliegt, liegt eine Tatsachenbehauptung vor, die einem Widerruf zugänglich ist. Dafür muss also die fachliche Grundlage der Diagnose fehlen.
• Der behauptete Alkoholmissbrauch stützt sich auf Blutuntersuchungen nach anerkannten Diagnosekriterien für den Missbrauch und stellt daher keine haltlose Behauptung dar. Dann gilt aber erst recht, dass die Schlussfolgerung des Amtsarztes als Werturteil nicht zum Gegenstand eines Widerrufsbegehrens gemacht werden kann.
• Der Klägerin steht nach Ansicht des OVG natürlich der Weg frei, durch weitere Untersuchungen die Diagnose des Amtsarztes zu "hinterfragen".
Diese ungewohnte Einordnung ärztlicher Diagnosen kann nach Meinung eines Kommentators des Beschlusses auch im Binnenverhältnis zwischen Ärzten eine Rolle spielen. So könnten niedergelassene Ärzte z.B. durch negative Feststellungen anderer Ärzte in MDK-Gutachten betroffen sein. Auch hier würde dann aber die vom OVG dargelegte ständige Rechtsprechung gelten, dass ärztliche Diagnosen regelmäßig Werturteile darstellen und nicht dem Widerruf zugänglich sind.
Die Darstellung des Sachverhalts und wesentliche Gründe der OVG-Entscheidung sind unter der Überschrift " (Kein) Anspruch auf Widerruf der in einem amtsärztlichen Gutachten gestellten Diagnose" in der Zeitschrift Medizinrecht (Oktober/November 2009 27: 618-619) veröffentlicht und dort als "free preview" bis auf wenige Zeilen kostenlos nachlesbar.
Bernard Braun, 17.11.09
Mythos Wissensgesellschaft: Körperorgan-Wissen britischer Patienten seit fast 40 Jahren konstant gering!
 Ältere Studien aus dem Vor-Internet- und Gesundheitsportale-Zeitalter hatten immer wieder belegt, dass viele PatientInnen noch nicht einmal rudimentäre Vorstellungen über die Lage und Funktion ihrer eigenen Organe hatten. Damit verbunden hatten sie natürlich Mühe, Ausführungen ihrer Ärzte z.B. über Organsymptomatiken zu folgen.
Ältere Studien aus dem Vor-Internet- und Gesundheitsportale-Zeitalter hatten immer wieder belegt, dass viele PatientInnen noch nicht einmal rudimentäre Vorstellungen über die Lage und Funktion ihrer eigenen Organe hatten. Damit verbunden hatten sie natürlich Mühe, Ausführungen ihrer Ärzte z.B. über Organsymptomatiken zu folgen.
Nach dem Boom an elektronischen und gedruckten Informationsmöglichkeiten schien es an der Zeit zu sein, zu überprüfen, ob und in welchem Maße sich an diesen Defiziten etwas geändert hat und vor allem spezifisch erkrankte PatientInnen zumindest über das bei ihnen erkrankte Organ besser Bescheid wissen als die Allgemeinheit.
Dazu befragten britische und neuseeländische Wissenschaftler mittels eines Fragebogens, der u.a. Körpersilhouetten mit auswählbaren Lagen von 11 Körperorganen (Herz, Lungen, Magen, Nieren, Darm, Harnblase, Schilddrüse, Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase und Eierstöcke) enthielt, insgesamt 722 Personen, von denen sie je 100 einer bestimmten Krankengruppe zuordnen konnten (dies waren ambulant behandelte PatientInnen Londoner Krankenhäuser) während 133 in einer allgemeinen, relativ heterogenen Gruppe (diese wurden aus den Besuchern einer öffentlichen Bibliothek, also einer lesefähigen und eher gebildeten Gruppe im Londoner Süden gewonnen) zusammengefasst wurden. Ausgewählt wurden Personen, die am Herzen, den Nieren, der Leber, dem Verdauungstrakt und an der Bauchspeicheldrüse bzw. an der Stoffwechselerkrankung Diabetes erkrankt waren.
Das Ergebnis einer Querschnittsbefragung aller StudienteilnehmerInnen sah so aus:
• Über alle Gruppen hinweg sah das Wissen über die Lage von Körperorganen mager aus und hat sich vor allem seit einer fast 40 Jahre alten vergleichbaren Studie nicht signifikant verbessert.
• Beispielsweise wussten nur 27,1% der allgemeinen Gruppe die korrekte Lage ihrer Nieren anzugeben. Besser, aber keineswegs optimal wussten Personen, die an einem Nierenleiden erkrankt waren, wo ohre Nieren lagen: 42,2%. 55,6% der Befragten der allgemeinen Gruppe wussten anzugeben, wo ihr Herz liegt. Dies konnten von den HerzpatientInnen nur 50,5%.
• Während in der Vergleichsstudie aus dem Jahr 1970 durchschnittlich 51,4% der Befragten die korrekte Lage der abgefragten Organe angeben konnten, waren es 2007/2008 52,5%.
• Die TeilnehmerInnen in den sechs speziellen Erkranktengruppen unterschieden sich hinsichtlich ihres geringen Gesamtwissens nicht wesentlich. Lediglich Befragte, die eine Erkrankung der Leber oder Diabetes hatten, hatten ein genaueres Wissen über die Lage ihres erkrankten Organs.
• Das Wissen älterer Befragter war signifikant schlechter und Personen mit höherer Bildung hatten ein besseres Anatomiewissen als Befragte mit niedrigerer Bildung.
• Auch wenn es insgesamt keine Wissensunterschiede zwischen Männern und Frauen gab, konnten Frauen die Lage der "weiblichen Organe" signifikant besser identifizieren.
Angesichts der seit fast 40 Jahren trotz der quantitativ expandierenden Wissens- und Informationsgesellschaft im Wesentlichen unveränderten fundamentalen Wissensmängel über die menschliche Anatomie warnen die ForscherInnen Ärzte vor falschen Annahmen über wichtige Vorverständnisse und Grundwissen ihrer PatientInnen, auf die sie glauben in Arzt-Patientgesprächen setzen zu können. Dies gilt ausdrücklich auch für das Wissen von PatientInnen mit speziellen oft chronischen Organerkrankungen, die gelegentlich für "die besten Experten für ihre eigene Erkrankung" gehalten werden.
Solange es keine vergleichbaren Untersuchungen mit deutschen PatientInnen gibt, sollte die Tatsache, dass die Befragung in Großbritannien stattfand, kein Anlass sein, für Deutschland ähnliche Verhältnisse auszuschließen.
Die sechsseitige Studie "How accurate is patients' anatomical knowledge: a cross-sectional, questionnaire study of six patient groups and a general public sample" von John Weinman, Gibran Yusuf, Robert Berks, Sam Rayner und Keith J Petrie ist 2009 in der Fachzeitschrift "BMC Family Practice" (2009, 10: 10-43) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.7.09
Wie viel Prozent der Arbeitszeit verbringt ein Krankenhausarzt mit Patienten, Angehörigen und der Verwaltung? 11,8%, 0,9%, 12,5%!
 Von Ärzten aber auch Pflegekräften an Krankenhäusern sind in den letzten Jahren immer häufiger Klagen zu hören, sie hätten dank des mit den DRGs verbundenen Kodier- und Dokumentationsaufwands immer weniger Zeit für Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen oder für die Behandlung der Patienten. Darüber ob dies wirklich so ist und wie viel der täglichen Arbeitszeit für die verschiedenen Tätigkeiten verwendet werden, gibt es aber nicht allzu viele Untersuchungen aus Deutschland oder sie beschäftigen sich, und dies gilt auch für die meisten internationalen Studien, fast nur mit der Gesprächszeit in Allgemeinpraxen. Die letzte Untersuchung über die Zeitaufwände von Krankenhausärzten in DEutschland stammt aus dem Jahr 1999, also aus einer Zeit mit deutlich anderen Rahmenbedingungen und hat eine Beobachtungsbasis von 5 Ärzten.
Von Ärzten aber auch Pflegekräften an Krankenhäusern sind in den letzten Jahren immer häufiger Klagen zu hören, sie hätten dank des mit den DRGs verbundenen Kodier- und Dokumentationsaufwands immer weniger Zeit für Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen oder für die Behandlung der Patienten. Darüber ob dies wirklich so ist und wie viel der täglichen Arbeitszeit für die verschiedenen Tätigkeiten verwendet werden, gibt es aber nicht allzu viele Untersuchungen aus Deutschland oder sie beschäftigen sich, und dies gilt auch für die meisten internationalen Studien, fast nur mit der Gesprächszeit in Allgemeinpraxen. Die letzte Untersuchung über die Zeitaufwände von Krankenhausärzten in DEutschland stammt aus dem Jahr 1999, also aus einer Zeit mit deutlich anderen Rahmenbedingungen und hat eine Beobachtungsbasis von 5 Ärzten.
Welche Bedeutung Gespräche mit PatientInnen auch für Krankenhausärzte haben zeigt die Tatsache, dass sie in einem 40-jährigen Arbeitsleben nach entsprechenden Studien 150.000 bis 200.000 solcher Gespräche führen und der psychosomatisch orientierte Mediziner und Psychoanalytiker Balint mit guten Argumenten das Gespräch zwischen Arzt und Patient als das zentrale diagnostische und therapeutische Instrument bezeichnete.
Deshalb verdient auch eine bereits etwas ältere, nämlich 2007 veröffentlichte Studie Beachtung, die als Dissertationsprojekt bei immerhin 32 Ärzten auf 34 Stationen aus den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Neurologie und Strahlenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg durchgeführt wurde und in deren Mittelpunkt die möglichst detaillierte Erfassung der Gesprächszeiten mit Patienten und Angehörigen stand.
Dazu begleitete die Jungforscherin die Ärzte jeweils einen Arbeitstag lang und maß mittels einer Stoppuhr die Dauer verschiedener ärztlicher Tätigkeiten. Zusätzlich wurde jeder teilnehmende Arzt gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem er eigene Schätzwerte bezüglich der Dauer verschiedener ärztlicher Tätigkeiten angeben und seine persönliche Zufriedenheit mit der zur Verfügung stehenden Zeit für bestimmte ärztliche Tätigkeiten benoten sollte. Schließlich wurde eine Querschnitterhebung durchgeführt, in dem eine Ärztin auf einer chirurgischen Station eine Arbeitswoche lang begleitet wurde.
Der Arbeitstag eines Arztes betrug durchschnittlich 659 Minuten und war damit länger als in einigen vergleichbaren Untersuchungen mit anderem Facharztspektrum und in anderen Behandlungsinstitutionen.
Auf diese Zeit verteilten sich die verschiedenen ärztlichen Aufgaben wie folgt: 11,8% Kommunikation mit Patienten, 0,9% Kommunikation mit Angehörigen, 4,9% Ärztliche Besprechungen, 1,7% DRG, 7,6% Briefe schreiben, 0,5% Berichtswesen, 5,9% Praktische Tätigkeiten, 4,3% Befundbewertung, 0,4% Konsilanforderungen, 22,8% Besprechung mit Kollegen, 6,2% Kurvenvisite, 2,8% Anmeldung für weitere Untersuchungen, 5,9% Lehre und Forschung, 6,3% OP-Zeit, 0,3% Schreiben von OP-Berichten, 12,5% Verwaltung und Sonstiges und 5% Pausen.
Pro Arbeitstag sprach also ein Arzt durchschnittlich 4 Minuten 17 Sekunden mit einem Patienten und durchschnittlich 20 Sekunden mit einem Angehörigen.
Die Dauer der Gespräche zwischen Krankenhausarzt und Krankenhaus-Patient kommentiert die Freiburger Medizinerin: "Fraglich bleibt insgesamt, ob 4 Minuten 17 Sekunden genügend Zeit dafür bieten, dass sowohl die medizinischen als auch die psychosozialen Sorgen und Probleme eines Patienten, die im Rahmen einer physischen Erkrankung entstehen können, genügend Beachtung finden können."
Dieser Gedanke wird in einer Literaturpassage der Dissertation vertieft: Wenn der Arzt unter Zeitdruck steht hat er immer das Gefühl, das ihm bei Gesprächen Zeit für andere Aufgaben "geraubt" wird. Dies hat manchmal auch damit zu tun, dass sich Patienten spontan an den Arzt wendet und ihn oft in einer anderen Tätigkeit unterbrecht. Alles zusammen genommen erscheint die Dauer solcher Gespräche länger als sie in Wirklichkeit ist. Dies wiederum führt zu der in mehreren Studien beobachteten arzttypischen Unterbrechung des Redeflusses von Patienten nach durchschnittlich 18 oder 23 Sekunden (in den 1980er Jahren) und der damit verbundenen Gefahr, dass "diese frühen Unterbrechungen der Patienten dazu führen könnten, dass wichtige gesundheitliche Probleme des Patienten nicht zur Sprache und damit auch nicht in Behandlung kommen."
Zu der Annahme, dass der Redefluss von Patienten jeglichen Zeitplan durcheinander brächte, wenn man sie so lange reden ließe wie sie wollten, untersuchten frühere Studien "wie lange Patienten tatsächlich reden, wenn man sie reden lässt. Ergebnis war, dass von '335 Patienten 78% weniger als zwei Minuten für ihr Anliegen benötigten und nur 2% länger als fünf Minuten sprachen'. Weiterhin stellten die Ärzte, die die untersuchten Gespräche führten, fest, dass alle Patienten wichtige Informationen mitzuteilen hatten und nicht unterbrochen werden sollten."
In der Freiburger Studie und in dort zitierten anderen Studien werden als Ursachen der kurzen Arzt-Patientengespräche der ständige Zeitdruck, der steigende Verwaltungsaufwand und die organisatorische Rahmenbedingungen des Zwangs zum Multitasking genannt.
Bereits etwas resignativ schließt die Studienautorin den entsprechenden Abschnitt mit den Worten: "Die Gründe für kurz gehaltene Gespräche mit Patienten und Angehörigen sind also eigentlich bekannt. Eine mögliche Lösung des Problems wäre es, einen Teil der administrativen Aufgaben und auch der einfacheren praktischen Tätigkeiten, wie Blutentnahmen, an andere Arbeitskräfte zu delegieren."
Die gemessenen Zeiten für Arbeiten, die durch die DRG nötig waren, betrugen durchschnittlich elf Minuten pro Arzt und Arbeitstag. Die Spannweite der benötigten Arbeitszeit lag aber zwischen 0 und über 67 Minuten.
Sowohl die gemessenen Zeiten als auch die Ergebnisse aus den Fragebögen wurden anhand verschiedener Merkmale der Ärzte, wie zum Beispiel konservatives versus operatives Tätigkeitsfeld, Geschlecht des Arztes und Länge der Berufserfahrung des Arztes, in Gruppen unterteilt und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass ein berufserfahrenerer Arzt mehr Zeit mit Patientengesprächen und mit praktischen Tätigkeiten verbrachte als ein unerfahrenerer Arzt. Mit zunehmender Berufserfahrung zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verbesserung der Zufriedenheit des Arztes mit der zur Verfügung stehenden Zeit für Angehörigengespräche.
Der damit mögliche Vergleich zwischen gemessener und "gefühlter" Arbeitszeit förderte eine Reihe interessanter Divergenzen zu Tage: Die Ärzte schätzten im Fragebogen z. B. ihre Kommunikationszeit mit Patienten fast doppelt so hoch ein wie die tatsächlich gemessene Zeit. Sie gaben im Durchschnitt eine geschätzte Zeit für ihre Kommunikation mit Patienten von 133 Minuten pro Arbeitstag an deutlich mehr als die gemessene Zeit von 79 Minuten.
Für die Kommunikationszeit mit Angehörigen gaben die Ärzte eine geschätzte Zeit an, die siebenmal so lang war wie die eigentlich gemessene Zeit. Die geschätzte Zeit betrug durchschnittlich 43 Minuten pro Tag, gemessen wurden 6 Minuten.
Für die gesamte Arbeitszeitverwendungsdebatte ist interessant, dass die Ärzte auch den Anteil der auf die als "unliebsam" empfundene Dokumentation, also das Berichtswesen, OP-Berichte, Briefe schreiben, Verwaltung (Sonstiges) und DRG entfällt, kräftig überschätzen: Gemessenen 146 Minuten pro Tag stehen 226 eingeschätzte Minuten gegenüber. Fast keine Diskrepanz gab es aber immerhin bei der täglichen Gesamtarbeitszeit.
Ärztinnen waren schließlich mit der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit für praktische Tätigkeiten deutlich zufriedener als Ärzte und hatten auch eine längere Gesprächszeit mit PatientInnen - allerdings nur im Sekundenbereich.
Natürlich kann man diese Studie an einem süddeutschen Uniklinikum und bei 32 Ärzten nicht als repräsentativ ansehen. Dies sollte allerdings nicht dazu dienen, die weitere Debatte und empirische Klärung totzuschlagen. Warum nämlich die für Deutschland zum Teil erstmaligen und spannenden Ergebnisse trotz der Problemartikulation und den nachgewiesenermaßen gesundheitlichen wie ökonomischen Auswirkungen schlechter Arzt-Patient-Kommunikation bisher nicht als Hypothesen für eine umfassendere Studie gedient haben, ist unverständlich und ein weiteres Beispiel für die gut gehegte Diskrepanz zwischen öffentlichem Problemgetöse und der Bereitschaft, dessen Substanz zu belegen oder gar nach Lösungen gegen z.B. den Zeitdruck zu suchen.
Die 79 Seiten umfassende medizinische Dissertation "Untersuchung der Gesprächszeit mit Patienten und Angehörigen unter Zugrundelegung der Arbeitszeitverteilung von Krankenhausärzten" von Dorothee Kempf ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.6.09
"They don't ask me so I don't tell them" oder Warum Patienten längst nichts alles ihrem Arzt erzählen!? Beispiel Alternativmedizin
 Viele Menschen greifen, wenn es um ihre Gesundheit oder die Behandlung einer Krankheit geht, mittlerweile aktiv - allein oder mit Hilfe entsprechender Experten - zu Mitteln und Verfahren der komplementären oder alternativen Medizin bzw. Heilkunde. Nach vielen Jahren des Widerstandes gegen die breite Palette derartiger Angebote nimmt seit einigen Jahren sogar der Anteil der Ärzte zu, die ihren PatientInnen neben der traditionellen biomedizinischen Diagnostik und Behandlung auch alternative Angebote wie z.B. die Akupunktur oder Naturheilverfahren anbieten oder zumindest nicht kategorisch eine Art Parallelbehandlung ablehnen.
Viele Menschen greifen, wenn es um ihre Gesundheit oder die Behandlung einer Krankheit geht, mittlerweile aktiv - allein oder mit Hilfe entsprechender Experten - zu Mitteln und Verfahren der komplementären oder alternativen Medizin bzw. Heilkunde. Nach vielen Jahren des Widerstandes gegen die breite Palette derartiger Angebote nimmt seit einigen Jahren sogar der Anteil der Ärzte zu, die ihren PatientInnen neben der traditionellen biomedizinischen Diagnostik und Behandlung auch alternative Angebote wie z.B. die Akupunktur oder Naturheilverfahren anbieten oder zumindest nicht kategorisch eine Art Parallelbehandlung ablehnen.
Darüber, wie die Kommunikation zwischen alternativmedizinisch engagierten PatientInnen und ihren traditionell orientierten Ärzten verläuft und wie gemeinsame Entscheidungen zugunsten welcher Behandlungsorienterung zustande kommen oder auch nicht, gibt es sehr wenig Transparenz. In zahlreichen Studien wird aber ein Mangel an Kommunikation geklagt oder von unerwünschten Effekten schlecht geführter Kommunikation berichtet. Zu diesen Effekten gehören vor allem mögliche gesundheitsgefährdende Wechselwirkungen zwischen jeweils hochwirksamen traditionellen und alternativen Arzneimitteln bzw. Wirkstoffen.
In einem methodisch aufwändigen, mehrstufigen qualitativen Forschungsdesign haben dies nun WissenschaftlerInnen aus den USA bei 114 Patienten, 41 Klinik-Verwaltungskräften und 19 Allgemeinärzten in acht Kliniken in dem Forschungsnetzwerk RIOS Net (Research Involved in Outpatient Settings Network) im Südwesten der USA genauer untersucht.
Einschränkend muss von vornherein festgehalten werden, dass in den untersuchten Kliniken und Praxen hispanische und indianische US-Amerikaner überrepräsentiert waren und in diesen Bevölkerungsteilen alternative Behandlungsmethoden eine wichtige Rolle bei der Selbstbehandlung spielen.
Die wichtigsten Ergebnissen der Studie sind:
• Einige Ärzte interpretierten das niedrige Kommunikationsniveau über alternativmedizinische Behandlung als ein Zeichen dafür, dass ihre Patienten kaum Gebrauch von derartigen Behandlungsangeboten machen.
• Die Kommunikation wurde auf beiden Seiten vor allem durch drei Faktoren bestimmt, ausgelöst oder verhindert: Akzeptanz/Nichtverurteilung, die Art der Eröffnung der Kommunikation und die Thematisierung der Sicherheit und Wirksamkeit.
• Die meisten Patienten, die bei Gesundheit und Krankheit alternative Methoden anwenden, erwarten, dass ihre Ärzte das Gespräch darüber beginnen.
• Die Empfindung darüber wie offen und vorurteilsfrei ihr behandelnder Arzt auf die Inanspruchnahme alternativer Behandlung oder Mittel reagieren würde, war für die Patienten aber der wichtigste Faktor für ihre Offenheit oder Bereitschaft mit ihrem Arzt Gespräche über diesen Punkt zu führen.
• Gegenüber diesem Faktor war die empfundene fachliche alternativmedizinische Kompetenz ihres Arztes von geringerer Bedeutung.
Wegen des Risikos, dass Patienten den Gebrauch alternativer therapeutischer Mittel verschweigen, wenn sie den Eindruck haben, ihr Arzt würde das sofort "übel" nehmen, sollten Ärzte nach Ansicht der ForscherInnen bereits in der Ausbildung lernen, wie sie derartige Kommunikationsbarrieren vermeiden und aktiv überwinden. Allein schon wegen der bereits erwähnten Nichtrepräsentativität sind zum Thema hemmende und fördernde Faktoren für die Arzt-Patient-Kommunikation nicht nur zum Thema Alternativmedizin noch wesentlich mehr Untersuchungen notwendig. Das Vertrauen darauf, dass die Kommunikation schon "irgendwie" klappen würde, reicht sicherlich nicht aus, wichtige Informationsflüsse zu ermöglichen.
Der neun Seiten umfassende und gut mit Zitaten aus den Interviews angereicherte Aufsatz "'They Don't Ask Me So I Don't Tell Them': Patient-Clinician Communication About Traditional, Complementary, and Alternative Medicine" von Brian M. Shelley, Andrew L. Sussman, Robert L. Williams, Alissa R. Segal und Benjamin F. Crabtree ist in der Fachzeitschrift "Annals of Family Medicine" (Vol. 7, No. 2, März/April 2009: 139-147) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.6.09
Verbesserung der Compliance von Patientinnen zur Teilnahme an Früherkennung ist möglich - aber ärztliche Begeisterung ist nötig
 Interventionsstudien zur Erhöhung der Therapietreue ("Compliance" oder "Adhärenz") von Patienten haben sich bislang schwer getan, ganz gleich, ob es um die Befolgung ärztlicher Einnahmevorschriften für Medikamente, Verhaltensregeln zu Ernährung oder Alkoholkonsum ging oder auch um die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen. Eine Cochrane-Studie, die 83 verschiedene Interventionen noch einmal auf ihre Wirksamkeit bei der Arzneimittel-Einnahme bilanzierte, kam zu dem Schluss: Kurzfristig sind viele Maßnahmen wirksam, langfristig nur sehr wenige. Beinahe alle für eine langfristige Versorgung wirksamen Interventionen waren komplexer Natur, aber sogar die wirksamsten Interventionen führten nicht zu großen Verbesserungen bei der Adhärenz und den Behandlungserfolgen (vgl. Wie verbessert man kurz- und langfristig das Arzneimittel-Einnahmeverhalten von Patienten?).
Interventionsstudien zur Erhöhung der Therapietreue ("Compliance" oder "Adhärenz") von Patienten haben sich bislang schwer getan, ganz gleich, ob es um die Befolgung ärztlicher Einnahmevorschriften für Medikamente, Verhaltensregeln zu Ernährung oder Alkoholkonsum ging oder auch um die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen. Eine Cochrane-Studie, die 83 verschiedene Interventionen noch einmal auf ihre Wirksamkeit bei der Arzneimittel-Einnahme bilanzierte, kam zu dem Schluss: Kurzfristig sind viele Maßnahmen wirksam, langfristig nur sehr wenige. Beinahe alle für eine langfristige Versorgung wirksamen Interventionen waren komplexer Natur, aber sogar die wirksamsten Interventionen führten nicht zu großen Verbesserungen bei der Adhärenz und den Behandlungserfolgen (vgl. Wie verbessert man kurz- und langfristig das Arzneimittel-Einnahmeverhalten von Patienten?).
Eine jetzt in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlichte Studie hat nun allerdings gezeigt, dass es für die Teilnahme an Krebs-Früherkennungs- Untersuchungen eine recht wirksame Maßnahme gibt, und zwar im Bereich der Arzt-Patient-Kommunikation. Dabei hilft allerdings eine sachliche und neutrale Information durch den Arzt nur begrenzt. Effektiver sind Emotionalität und Begeisterung ("enthusiasm") für Früherkennung. Denn es zeigte sich: Zwar erhöht auch eine eher neutrale ärztliche Information zur Mammographie und zum fäkalen okkulten Bluttest auf Blut im Stuhl (FOBT) die Teilnahmequoten im Vergleich dazu, dass der Arzt sich gegenüber dem Patienten gar nicht darüber äußert. Noch höher fallen diese Teilnahmequoten jedoch aus, wenn Patienten angeben, der Arzt habe sich begeistert gezeigt, was den Nutzen der Früherkennung anbetrifft
Teilnehmer an der Studie waren 63 niedergelassene Allgemeinärzte in Los Angeles und etwa 900 Patientinnen im Alter von 50-80 Jahren. Von diesen wurden mit Hilfe von Fragebögen umfangreiche Daten erhoben: Gesundheitszustand, Bildungsniveau, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Art der Krankenversicherung, Kenntnisse über Krebs, Krebserkrankungen in der Familie und anderes mehr. Darüber hinaus wurde gefragt, ob der Arzt sich in einer der letzten Sitzungen auch einmal zur Mammographie oder zum fäkalen okkulten Bluttest geäußert habe, und wie man die Art der ärztlichen Information bewerten würde: als sachlich-neutral oder begeistert-enthusiastisch. Auch von den Ärzten wurden einige Daten berücksichtigt (Herkunftsland, Alter, Geschlecht, Art der Praxis).
Im Rahmen einer multivariaten Analyse bei gleichzeitiger Berücksichtigung vieler Arzt- wie Patientenmerkmale zeigte sich dann: Ärztliche Informationen über Früherkennungsmaßnahmen, die von Patienten als begeistert erlebt werden, haben den allerstärksten Einfluss auf spätere Teilnahmen an Krebs-Früherkennungsuntersuchungen. Diese Quoten liegen für Mammographie 4,8mal höher und für FOBT 9,8mal höher als wenn der Arzt die Untersuchungen gar nicht erwähnt. Aber auch im Vergleich zu eher neutralen Informationen des Arztes sind höhere Quoten feststellbar, die 1,5 bis 2,1mal so hoch sind bei einer begeisterten Art der Arzt-Information.
Eine Variable wurde leider gar nicht erfasst: Nämlich ob der Arzt tatsächlich ein vehementer und begeisterter Befürworter jeder Art von Früherkennung ist oder ob zur Erhöhung der Teilnahmequoten auch schon ein wenig schauspielerisches Talent genügt. Immerhin schlagen die Wissenschaftler in ihrem Schlusswort vor: Eine eindeutige Befürwortung oder enthusiastische Darstellung der Früherkennungs-Maßnahmen durch den Arzt sollte in der ärztlichen Aus- oder Fortbildung unbedingt gelehrt und getestet werden.
Abstract der Studie: Sarah A. Fox et al.: Cancer screening adherence: Does physician-patient communication matter? (Patient Education and Counseling, Volume 75, Issue 2, May 2009, Pages 178-184)
Gerd Marstedt, 14.4.09
Schweiz: Nur 50% der Ärzte ist vom Nutzen des PSA-Tests überzeugt, aber 75% empfehlen ihn aus juristischen Erwägungen
 In einer Befragung Schweizer Allgemeinärzte und Internisten wurde deutlich, dass nur jeder zweite Arzt vom Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs überzeugt ist und davon, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Zugleich erklären jedoch drei von vier Befragungsteilnehmern, dass sie den Test den Älteren unter ihren Patienten empfehlen. Der Grund dafür ist nach Meinung der Forscher, deren Studie jetzt in der Zeitschrift "Journal of Evaluation in Clinical Practice" veröffentlicht wurde, nicht in finanziellen Anreizen zu sehen, sondern im Sicherheitsdenken der Ärzte. Solche Befürchtungen zukünftiger Klagen wegen eines Kunstfehlers, falls ein Patient später an Prostatakrebs erkrankt und der PSA-Test unterblieben ist, sind zwar extrem unwahrscheinlich, gleichwohl geben viele der Befragten an, sie würden den PSA-Test auch aus Gründen der juristischen Absicherung gegen spätere Klagen empfehlen.
In einer Befragung Schweizer Allgemeinärzte und Internisten wurde deutlich, dass nur jeder zweite Arzt vom Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs überzeugt ist und davon, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Zugleich erklären jedoch drei von vier Befragungsteilnehmern, dass sie den Test den Älteren unter ihren Patienten empfehlen. Der Grund dafür ist nach Meinung der Forscher, deren Studie jetzt in der Zeitschrift "Journal of Evaluation in Clinical Practice" veröffentlicht wurde, nicht in finanziellen Anreizen zu sehen, sondern im Sicherheitsdenken der Ärzte. Solche Befürchtungen zukünftiger Klagen wegen eines Kunstfehlers, falls ein Patient später an Prostatakrebs erkrankt und der PSA-Test unterblieben ist, sind zwar extrem unwahrscheinlich, gleichwohl geben viele der Befragten an, sie würden den PSA-Test auch aus Gründen der juristischen Absicherung gegen spätere Klagen empfehlen.
Dass die Risiken des PSA-Tests aufgrund von Biopsien und Nebenwirkungen therapeutischer Eingriffe (wie Impotenz, Inkontinenz) den Nutzen überwiegen, haben erst vor kurzem wieder Studien gezeigt (vgl. Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet). Gleichwohl ist die Empfehlungsquote für die Durchführung des PSA-Tests in den USA extrem hoch. Im Deutschen Ärzteblatt heißt es: "Die meisten Männer lassen dort ab dem 50. Lebensjahr jährlich einen PSA-Test durchführen. Auch 95 Prozent der Urologen sowie 78 Prozent der Allgemeinärzte lassen sich selbst testen, was belegt, dass sie vom Nutzen überzeugt sind - im Gegensatz zu den Fachgesellschaften." (vgl.: Prostatakarzinom: Studien bestätigen Zweifel am PSA-Test) Allerdings könnte es auch sein, dass nicht nur die Überzeugung der US-Ärzte maßgeblich ist für die große Verbreitung dort, sondern auch die größere Rechtsunsicherheit der Ärzte.
Im Jahre 1999 war es, als der US-amerikanische Familien-Arzt Dr. Daniel Merenstein, der gerade eine längere Weiterbildung in Evidence-Based Medicine machte, einen 53jährigen gesunden Patienten in die Klinik bekam, der sich nach Prostatakrebs und dem PSA-Test erkundigte. Merenstein erzählte ihm, was er in der Fortbildung gelernt hatte: Dass die Risiken des Tests hoch seien, der Nutzen durch Früherkennung vergleichsweise gering. So kam es, dass der Test nicht durchgeführt wurde. Leider erkrankte der Patient einige Jahre später unheilbar an Prostatakrebs und verklagte seinen Arzt. Dieser wurde in einem Zivilprozess zwar freigesprochen, die Fortbildungseinrichtung jedoch zu Schadensersatz in Höhe von 1 Million Dollar verurteilt.
Gedanken an solche Folgen ärztlicher Unterlassungen spielen vermutlich bei vielen Medizinern in den USA eine große Rolle, wenn sie den PSA-Test empfehlen. Dass sie auch bei Schweizer oder deutschen Ärzten maßgeblich sein könnten, erscheint jedoch wenig plausibel. Denn der Test ist keineswegs in einem solchen Maße wissenschaftlich anerkannt, dass das Unterlassen der Durchführung (außer bei Verdachtsmomenten auf eine Prostata-Erkrankung) als "Kunstfehler" gelten könnte. Gleichwohl ist dies bei vielen Ärzten der Fall, wie einer Schweizer Studie jetzt gezeigt hat. Befragt wurden dort 245 Allgemeinärzte und Internisten, die an einer beruflichen Fortbildung in der deutschsprachigen Schweiz teilnahmen. Das Durchschnittsalter war 52 Jahre, drei Viertel waren männlich, 68% Allgemeinärzte, 32% Fachärzte für Innere Medizin. In der Befragung wurde deutlich:
• Nur 56% der Allgemeinärzte und 53% der Fachärzte für Innere Medizin waren der Meinung, der PSA-Test sei zur Früherkennung nützlich und sein Nutzen würde die Risiken übersteigen.
• Gleichwohl gaben in beiden Gruppen jeweils 75% an, sie würden den Test Männern ab 50 regelmäßig empfehlen.
• 41% der Allgemeinärzte und 43% der Internisten nannten als Grund dafür juristische Überlegungen.
Ein Abstract der Studie ist hier verfügbar: Johan Steurer u.a.: Legal concerns trigger prostate-specific antigen testing (Journal of Evaluation in Clinical Practice, Volume 15 Issue 2, Pages 390 - 392, Published Online: 19 Mar 2009)
Dass der PSA-Test in Deutschland zwar nicht so häufig wie in den USA eingesetzt wird, trotzdem aber für ältere Männer fast schon eine standardmäßig durchgeführte Früherkennungsuntersuchung ist, hat unlängst eine deutsche Studie gezeigt. Dort heißt es in der Zusammenfassung: "In der vorliegenden Analyse werden Einflussfaktoren auf die Inanspruchnahme der Prostatakarzinom-Früherkennung (Prostata-KFU) in Deutschland untersucht. Eine repräsentative Stichprobe von 10659 Männer im Alter von 45 - 70 Jahren (M = 55.2) wurde nach ihrer Prostata-KFU-Inanspruchnahme befragt. (...) Zwei Drittel der Stichprobe gibt an, mindestens ein Mal eine DRU erhalten zu haben, knapp die Hälfte der Männer (48 %) hat bereits einen PSA-Test durchführen lassen. Die Anzahl der Männer, die regelmäßig an einer Prostata-KFU teilnehmen, ist deutlich geringer (44 % DRU, 33 % PSA)." (DRU = digital rektale Untersuchung, ein Abtasten des hinteren Dickdarms und der angrenzenden Organemit dem Finger)
Quelle: M. Sieverding u.a.: Prostatakarzinomfrüherkennung in Deutschland. Untersuchung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe, Der Urologe, Volume 47, Number 9 / September 2008
• Abstract
• PDF Volltext
Die Aufklärung von Patienten über Nutzen und Risiken des PSA-Tests war nach einem Experiment der Stiftung Warentest im Jahre 2003 überaus unbefriedigend. Von den 135 Berliner Urologen wurden 20 ausgewählt und im September und Oktober 2003 von einem 60-jährigen Probanden besucht, mit dem Wunsch, sich zum PSA-Test auf Prostatakrebs beraten zu lassen. Ergebnis: "Einige Urologen informierten den Patienten ausführlich und richtig über den PSA-Test. Doch die meisten Ärzte erläuterten die Problematik nur lückenhaft und einige sogar falsch. Kein einziger der besuchten Fachärzte sprach die in der wissenschaftlichen Leitlinie der urologischen Fachgesellschaften genannten Beratungsinhalte von sich aus an. Sie informierten nur ganz allgemein über den Eiweißstoff PSA, den Normalwert und den Sinn eines Tests. (…) Die getesteten Ärzte lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. Etwa ein Drittel der Urologen war mit "evidenzbasierter Medizin" vertraut - sie machten also die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zur Grundlage ihrer Beratung. Rund zwei Drittel von ihnen, die zweite Gruppe, hatte aber offenbar kein gesichertes Wissen über den Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen. Ihren Äußerungen zufolge glaubten sie daran, dass eine früh erkannte Erkrankung grundsätzlich die Heilungschancen verbessere." Gesamt-Ergebnis: 2mal sehr gut, 4mal befriedigend, 7mal ausreichend, 7mal mangelhaft
Quelle: Früherkennung. Folge 1. Dilemma. Urologen im Test. Zeitschrift test, 2/2004, S. 86-89
• PDF zum kostenlosen Download
• WWW-Seite
Gerd Marstedt, 23.3.09
Finanzlasten durch medizinische Behandlung, schwindendes Patientenvertrauen und schlechtere Erwartungen zur Behandlungsqualitität
 Die zunehmende Merkantilisierung der Kontakte zwischen Ärzten und Patienten und das zunehmend Basarhafte in der gesundheitlichen Versorgung z. B. durch Zuzahlungen, Individuelle Gesundheitsleistungen (IgeL), Bonus- und Selbstbehaltprogramme führt nicht "nur" zu einer zügigen Erhöhung des zweiten Beitragssatzes, sondern hat auch unerwünschte und langfristige kulturelle, soziale und auch ökonomische Effekte.
Die zunehmende Merkantilisierung der Kontakte zwischen Ärzten und Patienten und das zunehmend Basarhafte in der gesundheitlichen Versorgung z. B. durch Zuzahlungen, Individuelle Gesundheitsleistungen (IgeL), Bonus- und Selbstbehaltprogramme führt nicht "nur" zu einer zügigen Erhöhung des zweiten Beitragssatzes, sondern hat auch unerwünschte und langfristige kulturelle, soziale und auch ökonomische Effekte.
Dies bestätigt und quantifiziert eine gerade veröffentlichte Querschnitts- und Haushaltsstudie in den USA mit 32.210 Erwachsenen, die im Jahr 2003 nach Angaben im "Community Tracking Study Household Survey" bei einem Arzt in ständiger Behandlung waren. Den Autor, Peter Cunningham vom "Center for Studying Health System Change", interessierten dabei hauptsächlich die Zusammenhänge zwischen den in den USA schon länger durch die medizinische Versorgung verursachten hohen finanziellen Lasten der Privathaushalte, dem Vertrauen der Patienten und der von ihnen erwarteten Versorgungsqualität.
Zunächst aber zeigte der Telefon- und Interview-Survey, dass insgesamt 27 % aller us-amerikanischen Erwachsenen mit einem sie fest versorgenden Arzt in Familien mit hohen medizinischen Kosten lebten. 18 % der antwortenden Personen haben im Verhältnis zu ihrem Einkommen hohe Zuzahlungen und 14 % haben Probleme, ihre Arztrechnungen zu bezahlen. Erwartungsgemäß haben verhältnismäßig mehr unversicherte Personen hohe Behandlungskosten-Lasten, nämlich 40 %. Bei Patienten mit einer privaten oder öffentlichen Krankenversicherung betrug dieser Anteil 25 % und weniger.
Auf diesem Hintergrund gab es eine Reihe zunächst "weicher" und "harter" Effekte:
• Rund 6 % aller befragten Patienten mit hohen Geldlasten durch Arztrechnungen etc. glaubten nicht, dass ihr Arzt ihre Bedürfnisse über alles stellt und 13 % bzw. 14 % glauben ebenfalls, ihr Arzt führe nicht notwendige Tests durch (odds ratio: 1,42) oder versage bei der Überweisung zu einem Facharzt (odds ratio: 1,39).
• Personen mit hohen Behandlungskosten haben wesentlich häufiger als solche ohne derartige Lasten einen Mangel an Vertrauen (odds ratio: 1,43) in die medizinische Entscheidungsfindung des Arztes und liefern negative Bewertungen ihres Zusammentreffens mit ihrem Arzt. Diese Differenz war bei Personen mit hohem Einkommen etwas größer.
• Die Daten belegen eine Art "Kulturbruch" im Arzt-Patientverhältnis mit ungewissem, aber wahrscheinlich sozial und ökonomisch folgenreichen Ende: "Patients with high medical cost burdens are more likely to view their medical encounters in terms of financial transachtions and medical providers as economic actors." Welche Verhaltensweisen der hier beschriebene Vertrauenszerfall und der Wandel der Arztrolle bei Patienten auslösen (z.B. Noncompliance) untersuchen die Autoren der Studie nicht ausdrücklich, sehen damit aber wichtige Bedingungen für eine wirksame Behandlung gefährdet. Letztlich sind damit weder kostentreibende noch der Gesundheit abträgliche Reaktionen auszuschließen.
• Die negative Assoziation zwischen hohen Behandlungskosten, Patientenvertrauen und erwarteter Behandlungsqualität ist in den USA am stärksten bei den privat versicherten Personen konzentriert.
Auch wenn manche der hier beschriebenen Wirkungen hoher finanzieller Lasten durch die medizinische Versorgung erwartbar waren, liegen immerhin jetzt so harte Daten vor, dass auch in Deutschland bedacht werden sollte, wie lange Patienten das aktuelle Gerangel ihrer Ärzte über ihre REgelleistungsvolumina und die Versuche, sie dies durch Vorauszahlungen ausbaden zu lassen, noch ohne vergleichbare unerwünschte Reaktionen hinnehmen.
Von dem Aufsatz "High Medical Cost Burdens, Patient Trust, and Perceived Quality of Care" von Peter J. Cunningham, im "Journal: Journal of General Internal Medicine",(2.Februar 2009) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 16.3.09
Offenlegung ärztlicher Interessenkonflikte fördert Vertrauen der Patienten
 Die Offenlegung ärztlicher Interessenkonflikte würde das Vertrauen der Patienten in ihre Ärzte und in die Behandlungsentscheidungen stärken. Viele Patienten befürchten, dass Interessenkonflikte sich ungünstig auf ärztliche Entscheidungen auswirken.
Die Offenlegung ärztlicher Interessenkonflikte würde das Vertrauen der Patienten in ihre Ärzte und in die Behandlungsentscheidungen stärken. Viele Patienten befürchten, dass Interessenkonflikte sich ungünstig auf ärztliche Entscheidungen auswirken.
Dies sind Ergebnisse einer Studie, die im Medical Journal of Australia erschienen ist. 906 Patienten aus drei Allgemeinmedizin-Praxen in Sydney sind im Jahr 2007 über ihr Wissen und ihre Einstellung zu Interessenkonflikte ihrer Ärzte befragt worden.
Die meisten der Befragten (76%) gaben an, keine Informationen über mögliche Interessenkonflikte ihrer Ärzte zu haben.
Die Mehrheit würde aber gerne wissen ob ihr Arzt von der Industrie Geld oder andere Zuwendungen und Unterstützung erhält (76%), insbesondere für die Teilnahme an Forschung (69%) und für den Besuch von wissenschaftlichen Tagungen (61%).
Auch würden die Patienten gerne wissen, ob dem Arzt materielle Vorteile entstehen aus
•der Durchführung einer Behandlung (80%)
•der Durchführung einer Untersuchung (77%)
•einer Überweisung 77%
•der Verschreibung eines Medikamentes.
Fast allen Befragten (98%) erscheint es wichtig, dass der Arzt sich in seinen Entscheidung ausschließlich von den Interessen des Patienten leiten lässt.
Viele Patienten befürchten jedoch, dass die Zuwendungen der Industrie diesbezüglich ein Problem darstellen. Die Frage, ob ihrer Meinung nach ihre Ärzte durch die Zuwendungen der Industrie unangemessen beeinflusst würden, beantworteten 49% mit ja, 27% mit nein, 24% waren sich nicht schlüssig.
Die meisten Befragten (78%) meinen, dass sie eine bessere informierte Entscheidung treffen können, wenn sie über die Interessenkonflikte ihres Arztes informiert sind.
Bevorzugt wird die Informationen direkt durch den Arzt im Arzt-Patient-Gespräch (78%), schriftliche Informationen wünschen sich 62%.
Die Offenlegung der Interessenkonflikte stärkt das Vertrauen der meisten Patienten - 80% geben an, dass sie bei Offenlegung den Entscheidungen des Arztes mehr vertrauen würden, 7% verneinten dies, 13% waren unentschieden.
Die Studie zeigt, dass viele Patienten mögliche Interessenkonflikte ihrer Ärzte als Problem erkannt haben. Auch wenn etwa die Hälfte der Patienten meint, die Ärzte würden nicht unangemessen beeinflusst, ist jeder 4. Befragte anderer Meinung. Interessant ist, dass nicht nur die Mehrzahl aller Befragten eine vollständige Offenlegung wünscht sondern auch 77% derjenigen, die keine unangemessene Beeinflussung ihrer Ärzte befürchten. Die Offenlegung würde zu besseren Behandlungsentscheidungen und zu höherem Vertrauen führen.
In Deutschland wird die Mitteilung von ärztlicher Interessenkonflikte außerhalb des Wissenschaftsbereiches bislang kaum diskutiert. In Australien und in den USA wird die Transparenz in Zukunft vom Staat gefordert werden. In beiden Ländern werden Gesetzte vorbereitet, mit denen die Industrie zur Veröffentlichung aller Zahlungen an Ärzte verpflichtet wird.
Die Firma Pfizer hat für ihren US-amerikanischen Bereich die Zeichen der Zeit erkannt und angekündigt, ab 2010 alle ab 1. Juli 2009 erfolgenden Zahlungen an amerikanische Ärzte öffentlich zu machen. Einbezogen sind alle praktizierende Ärzte sowie alle Forscher und Einrichtungen, die Studien durchführen.
Australische Studie (Abstract): Tattersall MHN, Dimoska A, Gan K. Patients expect transparency in doctors' relationships with the pharmaceutical industry. Medical Journal of Australia 2009;190:65-68 (19. Januar).
Pressemitteilung Pfizer 9. Februar 2009. Pfizer to Publicly Disclose Payments to U.S. Physicians, Healthcare Professionals and Clinical Investigators.
David Klemperer, 12.2.09
Ärzte sind auch nur Menschen: Bei ängstlichen Kopfschmerz-Patienten wird sehr viel mehr kostenträchtige Diagnostik betrieben
 Patienten, die seit Tagen an Kopfschmerzen leiden und beim Arzt einen überaus ängstlichen und besorgten Eindruck machen, erhalten von ihrem Arzt nicht mehr Zuwendung und Mitgefühl und auch die Zeitdauer der Kommunikation mit dem Arzt ist nicht länger als bei anderen Patienten, die ihr Leiden eher sachlich und neutral schildern. In einem Punkt aber zeigten sich in einer jetzt veröffentlichten deutschen Studie deutliche Unterschiede: Bei ängstlichen Patienten wurden sehr viel häufiger teure diagnostische Untersuchungen durchgeführt und auch Überweisungen zu einem Facharzt veranlasst.
Patienten, die seit Tagen an Kopfschmerzen leiden und beim Arzt einen überaus ängstlichen und besorgten Eindruck machen, erhalten von ihrem Arzt nicht mehr Zuwendung und Mitgefühl und auch die Zeitdauer der Kommunikation mit dem Arzt ist nicht länger als bei anderen Patienten, die ihr Leiden eher sachlich und neutral schildern. In einem Punkt aber zeigten sich in einer jetzt veröffentlichten deutschen Studie deutliche Unterschiede: Bei ängstlichen Patienten wurden sehr viel häufiger teure diagnostische Untersuchungen durchgeführt und auch Überweisungen zu einem Facharzt veranlasst.
Bei der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Studie waren insgesamt 53 männliche Hausärzte im Großraum Düsseldorf beteiligt. Diese Ärzte hatten sich einverstanden erklärt, an einer Studie teilzunehmen, bei der sie irgendwann in den nächsten Wochen ohne vorherige Anmeldung den Besuch eines sogenannten "standardisierten Patienten" bekommen würden. Dabei handelt es sich um Amateure oder auch professionelle Schauspieler, die entweder im Rahmen wissenschaftlicher Studien, teilweise aber auch innerhalb der medizinischen Berufsausbildung, einen Patienten mit ganz bestimmten Krankheitssymptomen mimen, über die sie vorher ausgiebig instruiert wurden.
Die standardisierten Patienten in dieser Studie waren durchweg jüngere Frauen, die über Kopfschmerzen klagten, welche seit 3 Tagen bestehen und bei denen Schmerztabletten nicht wirkten. Andere Begleitsymptome gab es nicht. Die Kopfschmerzen wurden so beschrieben, dass sie entweder durch einen Spannungskopfschmerz erklärbar gewesen wären als auch auf schwerwiegendere Ursachen hinweisen konnten. Das Arzt-Patient-Gespräch wurde durchweg mit folgendem Satz eingeleitet: "Ich komme zu Ihnen, weil ich seit Tagen fast unerträgliche Kopfschmerzen habe. Hier vorne (zeigt auf die vordere rechte Kopfhälfte ) ganz schlimm. So was kenne ich sonst gar nicht. Manchmal ist mir richtig übel vor Schmerzen."
Alle Ärzte wurden nacheinander von zwei verschiedenen standardisierten Patienten besucht, die sich in ihrer medizinischen und sozialen Fallgeschichte überhaupt nicht, aber in der Darstellung ihrer Gefühle deutlich unterschieden. Patiententyp A war ängstlich und besorgt, zeigte Unwohlsein und drückte in Gestik, Mimik und Wortwahl Ängstlichkeit wegen der Ursachen der Beschwerden aus. (z.B. " Könnte es etwas Schlimmes sein? Sind Sie sicher, dass es nicht doch etwas anderes ist?") Typ B hingegen war neutral, sachlich und akzeptierte die Erklärungsbemühungen und Vorschläge des Arztes und stellte sie nicht in Frage.
Anhand von Audio-Mitschnitten der Arzt-Patient-Gespräche und später durchgeführten Interviews mit den Ärzten wurde dann überprüft, wovon das diagnostische und therapeutische Vorgehen der Ärzte am meisten beeinflusst war. Denn in dieser Hinsicht zeigten sich massive Unterschiede: Bei der Anamneseerhebung erfragten die Hausärzte unter anderem Schwere, Lokalisation und Dauer der Schmerzen, Begleiterscheinungen, Krankheits-Vorgeschichte, Familie, psychosoziale Aspekte, Medikamentengebrauch. Dabei wurde eine Spannweite von 2 bis 14 dieser Kriterien erfragt. Weiterhin nahmen sie teilweise körperliche Untersuchungen vor, die je nach Patient aus 1 - 12 Einzeluntersuchungen bestanden, es gab keine körperliche Einzeluntersuchung die in jeder Konsultation vorgenommen wurde. Die Gespräche dauerten zwischen 1,5 und 26 Minuten, im Mittel knapp 10 Minuten. Es gab also eine sehr breite Variation zwischen den Ärzten hinsichtlich des Umfangs der Anamneseerhebung, der Anzahl durchgeführter Einzeluntersuchungen und der jeweiligen zeitlichen Dauer.
Die Wissenschaftler hatten erwartet, dass bei ängstlichen Patienten a) die Zeitdauer der Konsultation länger ist (wegen längerer oder detaillierterer Informationen und Erklärungen) und dass b) die Zahl körperlicher Untersuchungen größer ausfallen würde, um Patienten zu beruhigen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Tatsächlich zeigte sich jedoch: Weder bei der Zeitdauer noch bei der Zahl der Einzeluntersuchungen fanden sich signifikante Unterschiede zwischen den Patiententypen. Ein Unterschied fand sich jedoch: "Bei den ängstlich-besorgten Patientinnen kommt es in 39 %, bei den neutral-akzeptierenden in 7 % zu Schritten zu einer kostenintensiven Diagnostik." Hierunter fallen unter anderem Überweisungen zu einem Spezialisten (Neurologe oder Radiologe) oder sogar in eine Klinik.
Die Wissenschaftler fassen ihre Befunde so zusammen: "... weder die Anzahl noch die Verteilung der Untersuchungshandlungen differierten in den beiden Gruppen. Statt solcher die emotionale Färbung der Arzt-Patient- Beziehung reflektierenden, angemessenen Vorgehensweisen wurden bei den ängstlich gespielten Patienten mehr kostenträchtige und eingreifende weitere Untersuchungen und Überweisungen veranlasst. Angesichts der identischen medizinischen Fälle lässt sich diese Differenz nicht durch eine medizinische Notwendigkeit erklären."
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier nachzulesen: S. Wilm , S. Brockmann, C. Spannaus-Sakic, A. Altiner, B. Hemming, H.-H. Abholz: Machen Hausärzte Unterschiede, wenn sie mit Kopfschmerzpatienten umgehen? Eine Querschnittsstudie mit ängstlich oder neutral gespielten standardisierten Patienten (Z Allg Med 2008; 84: 273-279; DOI: 10.1055/s-2008-1081468)
Gerd Marstedt, 26.1.09
Angehörige von Schwerstkranken möchten von Ärzten auch über unsichere Krankheitsprognosen informiert werden
 Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Ärzte es bei ernsten Erkrankungen zumeist vermeiden, mit Patienten oder deren Angehörigen über Krankheitsverläufe zu sprechen, wenn ihnen dieser Verlauf unsicher erscheint. Eine jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine" veröffentlichte Untersuchung hat nun allerdings gezeigt, dass die große Mehrheit der Angehörigen von todkranken, künstlich beatmeten Patienten dieses Thema auch dann mit dem Arzt besprechen möchte, wenn die Prognose unsicher und das Irrtumsrisiko des Arztes groß ist.
Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Ärzte es bei ernsten Erkrankungen zumeist vermeiden, mit Patienten oder deren Angehörigen über Krankheitsverläufe zu sprechen, wenn ihnen dieser Verlauf unsicher erscheint. Eine jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine" veröffentlichte Untersuchung hat nun allerdings gezeigt, dass die große Mehrheit der Angehörigen von todkranken, künstlich beatmeten Patienten dieses Thema auch dann mit dem Arzt besprechen möchte, wenn die Prognose unsicher und das Irrtumsrisiko des Arztes groß ist.
Basis der Studie sind Interviews mit 142 Angehörigen von Patienten, die in vier verschiedenen Intensivstationen einer Universitätsklinik in San Francisco lagen. Alle Patienten waren todkrank und wurden künstlich beatmet. Den Angehörigen wurde dann im Rahmen von offenen Interviews eine Reihe von Fragen gestellt, darunter auch die Frage: "Ärzte zögern manchmal, eine Prognose für eine Krankheit auszusprechen, weil sie befürchten, sich zu irren. Sie denken, die Familie des Patienten würde es ihnen übel nehmen, wenn ihre Prognose sich später als falsch herausstellt. Was meinen Sie: Sollten Ärzte auch dann über Krankheitsprognosen sprechen, wenn sie nicht sicher sind, ob ihre Einschätzung zutrifft?"
Die auf Tonband mitgeschnittenen Antworten der Angehörigen, zu denen jeweils auch Nachfragen gestellt werden konnten, wurden dann systematisch ausgewertet. Es zeigte sich, dass die überwiegende Mehrheit der Befragungsteilnehmer von 87 Prozent ihren Wunsch äußerten, auch dann eine ärztliche Meinung über die Zukunftsprognose hören zu wollen, wenn diese unsicher und möglicherweise fehlerhaft ist. Nur 13 Prozent waren anderer Meinung und wollten in solchen Fällen lieber keine ärztliche Prognose hören.
Die Angehörigen lieferten in den Interviews dann auch unterschiedliche Gründe, warum ihnen eine fehleranfällige Prognose lieber war als gänzlich unterlassene Informationen. Die fünf häufigsten Aussagen waren dabei:
• Prognosen sind bei Krankheitsverläufen nie hundertprozentig sicher, egal um welche Krankheit es sich handelt, und jedes Individuum ist durch seine Krankheitsgeschichte und Lebensumstände so einzigartig, dass Krankheitsprognosen nur begrenzt zutreffen können, schließlich sind Ärzte keine Allwissenden.
• Gleichwohl sind Ärzte, so eine weitere Aussage vieler Befragter, medizinisch sehr viel kompetenter als Laien und überdies mit den Krankheitsumständen im konkreten Fall vertraut, so dass sie sehr viel besser als jeder andere ein Urteil fällen können. Niemals, so eine häufige Einlassung, würde man einen Arzt wegen einer falschen Prognose vor Gericht zerren.
• Über eine Krankheitsprognose mit dem Arzt zu sprechen und dabei auch direkt die Unsicherheit dieser Prognose einzubeziehen, dies eröffne für Angehörige auch die Möglichkeit, realistische Hoffnungen und Optimismus zu entwickeln.
• Einem Arzt, der auch seine Fehlbarkeit im Gespräch andeutet und auf die unzureichende Sicherheit einer Prognose verweist, so erklären viele Angehörige, würden sie nicht weniger, sondern ganz im Gegenteil sehr viel mehr Vertrauen entgegen bringen als jemandem, der sich hierzu gar nicht äußert.
• Schließlich wird auch darauf hingewiesen, dass die bewusste Auseinandersetzung mit verschiedenen potentiellen Entwicklungen des Krankheitsverlaufs es erst ermöglicht, Trauerarbeit einzuleiten oder auch verschiedene praktische Entscheidungen im häuslichen und familialen Umfeld zu treffen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Leah R. Evans u.a.: Surrogate Decision-Makers' Perspectives on Discussing Prognosis in the Face of Uncertainty (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 179. pp. 48-53, (2009), Published ahead of print on October 17, 2008, doi:10.1164/rccm.200806-969OC)
Die Studie ist deshalb überaus bedeutsam, weil sie erneut aufzeigt, dass das Kommunikationsverhalten von Ärzten gerade in schwierigen, emotionsbeladenen Situationen oftmals dem widerspricht, was Patienten oder ihre Angehörigen sich an freimütiger Information wünschen, auch wenn diese Information zu wenig Hoffnung Anlass gibt. vgl. hierzu etwa:
• Chemotherapie bei unheilbaren Krebsleiden: Ärzte verschweigen, dass die Lebenserwartung nur minimal verlängert wird
• Ärztliche Kommunikation über eine unheilbare Krankheit: Nächste Angehörige werden oft erst sehr spät oder gar nicht informiert
• Kommunikation mit Krebspatienten über ihre Ängste: Den meisten Ärzten fehlen die rechten Worte
• Chemotherapie am Lebensende: Krebspatienten erfahren über ihre Krankheit mehr von Mitpatienten als von ihrem Arzt
Gerd Marstedt, 30.12.08
Was bringen Interventionen, damit Patienten ihren Ärzten mehr Fragen stellen?
 Eine befriedigende Arzt-Patient-Kommunikation und Patienten-Information ist bei vielen Erkrankungen wesentliche Voraussetzung für den Therapieerfolg. Hierfür spielt die Kommunikationsfähigkeit des Arztes eine große Rolle, aber auch das Patientenverhalten. Nicht selten stellen Patienten dem Arzt zu wenig Fragen, so dass zum Beispiel Krankenkassen oder auch andere Einrichtungen wie die Patienten-Universität Checklisten herausgeben, damit Patienten Fragen für einen bevorstehenden Arztbesuch in Ruhe vorbereiten können.
Eine befriedigende Arzt-Patient-Kommunikation und Patienten-Information ist bei vielen Erkrankungen wesentliche Voraussetzung für den Therapieerfolg. Hierfür spielt die Kommunikationsfähigkeit des Arztes eine große Rolle, aber auch das Patientenverhalten. Nicht selten stellen Patienten dem Arzt zu wenig Fragen, so dass zum Beispiel Krankenkassen oder auch andere Einrichtungen wie die Patienten-Universität Checklisten herausgeben, damit Patienten Fragen für einen bevorstehenden Arztbesuch in Ruhe vorbereiten können.
In den USA wurde unlängst sogar von mehreren Gesundheitsbehörden eine große Kampagne gestartet, um Patienten zu einer stärkeren Mitarbeit bei medizinischen Behandlungen in Arztpraxen und Kliniken zu motivieren. Dazu wurde eine kostenlose Telefonhotline eingerichtet und auf einer speziellen Website "Questions Are The Answers" (Fragen sind die Antwort) finden Besucher Informationen, Anregungen und Formulierungshilfen, welche Fragen man als Patient bei welcher Gelegenheit seinem Arzt sinnvoller Weise stellen sollte. (vgl.: Große Kampagne in den USA: Patienten sollen ihren Ärzten mehr Fragen stellen)
Mittlerweile wurde auch schon eine Vielzahl von Interventionen in randomisierten Kontrollstudien (also mit einer Vergleichsgruppe und zufälliger Aufteilung der Teilnehmer) darauf hin überprüft, ob und welche Erfolge damit erzielt werden können. Eine Meta-Analyse von insgesamt 33 solcher Studien, die jetzt in der Zeitschrift "British Medical Journal" veröffentlicht wurde, hat nun versucht, ein Fazit zu ziehen: In welchem Umfang kann man Patienten dazu bringen, ihrem Arzt mehr Fragen zu stellen? Erprobt wurden in diesen Studien in erster Linie Checklisten für Patienten, daneben aber auch Broschüren, Coaching für Patienten oder auch für Ärzte, interaktive Computerprogramme, Rollenspiele, Video-Training. An den Studien beteiligt waren insgesamt 8.244 Patienten/innen.
Als Indikatoren für einen Erfolg solcher Interventionen wurden unterschiedliche Aspekte berücksichtigt: Die Zahl der Fragen, die Patienten in der Untersuchungs- und Kontrollgruppe stellen, Kenntnisse und Wissenstand der Patienten, die erlebte Angst vor und nach dem Arztgespräch sowie die Patientenzufriedenheit. Als Ergebnis der Meta-Analyse zeigte sich dann:
• Unter dem Strich zeigen sich bei einigen, aber längst nicht allen Studien leichte positive Veränderungen.
• Dies betrifft unter anderem die Zahl der Fragen, die von Patienten gestellt werden. In den Interventionsgruppen liegt diese Zahl um 0,27 (standardisierter Mittelwert) höher als in den Kontrollgruppen.
• Für die von Patienten erlebten Ängste, für die Kenntnisse der Patienten über ihre Krankheit und ebenso für die Dauer des Arzt-Patient-Gesprächs zeigen sich zwar leichte Verbesserungen, die aber statistisch nicht signifikant sind.
• Ein Coaching von Ärzten und Patienten erzielt keine größeren Effekte als wenn nur Patienten allein ein Coaching mitmachen.
Die Wissenschaftler bilanzieren ihre Ergebnisse so: "Interventionen für Patienten vor Arztbesuchen bewirken geringfügige Vorteile für Patienten. Vermutlich liegt dies daran, dass Ärzte und ebenso Patienten eingeschliffene Kommunikationsformen und Verhaltensweisen haben, die nur sehr schwer zu verändern sind."
Hier ist ein Abstract der Studie: Paul Kinnersley u.a.: Interventions before consultations to help patients address their information needs by encouraging question asking: systematic review (BMJ 2008;337:a485 Published 16 July 2008, doi:10.1136/bmj.a485)
Gerd Marstedt, 9.8.2008
Chemotherapie bei unheilbaren Krebsleiden: Ärzte verschweigen, dass die Lebenserwartung nur minimal verlängert wird
 Erneut hat eine Studie gezeigt, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient bei schweren und unheilbaren Krankheiten am Lebensende erhebliche Defizite aufweist. Die in England durchgeführte Studie ist aufgrund einer relativ kleinen Fallzahl zwar nicht repräsentativ, bestätigt aber die schon in früheren Studien gefundenen Ergebnisse. Teilnehmer waren 37 Patienten einer Klinik im Südwesten Englands, die an einer Tumorerkrankung im weit fortgeschrittenen Stadium litten: Lungenkrebs (N=12), Bauchspeicheldrüsenkrebs (N=13) und Darmkrebs (N=12).
Erneut hat eine Studie gezeigt, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient bei schweren und unheilbaren Krankheiten am Lebensende erhebliche Defizite aufweist. Die in England durchgeführte Studie ist aufgrund einer relativ kleinen Fallzahl zwar nicht repräsentativ, bestätigt aber die schon in früheren Studien gefundenen Ergebnisse. Teilnehmer waren 37 Patienten einer Klinik im Südwesten Englands, die an einer Tumorerkrankung im weit fortgeschrittenen Stadium litten: Lungenkrebs (N=12), Bauchspeicheldrüsenkrebs (N=13) und Darmkrebs (N=12).
Beteiligt waren im Rahmen von Arzt-Patient-Gesprächen 9 Onkologen. Die Gespräche, in denen mit den Patienten diskutiert werden sollte, ob eine palliative Chemotherapie durchgeführt werden sollte oder nicht, wurden mit Tonband aufgezeichnet und schriftlich dokumentiert. Palliative Chemotherapien sollen Beschwerden des Patienten lindern und darüber hinaus auch das Wachstum des Tumor und die Bildung neuer Metastasen zumindest bremsen. Eine vollständige Heilung können solche Therapien nicht bewirken und oftmals zeigt sich, dass die Lebenserwartung des Patienten bestenfalls einige Wochen oder Monate verlängert wird.
Den Wissenschaftlern erscheint es wichtig, dass Patienten zumindest eine ungefähre Vorstellung darüber bekommen, in welchen Dimensionen sich eine Verlängerung der Lebenserwartung durch die Chemotherapie bewegt - um nicht völlig unrealistische Hoffnungen zu erwecken und eine begründete Entscheidung des Patienten zu ermöglichen, ob er diese Therapie wünscht oder nicht wünscht. Denn in vielen Fällen sind die Nebenwirkungen der Therapie nicht unbeträchtlich und der Patient lebt zwar länger, aber unter nicht wirklich lebenswerten Umständen. Von daher wäre es überaus wichtig, dass Patienten auch Nutzen und Risiken gegeneinander abwägen können.
In der Analyse der Tonbandmitschnitte zeigte sich dann jedoch, dass die Onkologen in der Mehrzahl der Fälle keinerlei Angaben darüber machten oder nur äußerst vage und vieldeutige Aussagen machten. In den insgesamt 37 Gesprächen wurde die Frage nach dem zeitlichen Umfang einer verlängerten Lebenserwartung durch die palliative Chemotherapie:
• in 8 Fällen gar nicht angesprochen,
• in 18 Fällen nur überaus vage besprochen (z.B. "ein wenig länger", "einige Zeit")
• in 5 Fällen mit einer groben Zeitangabe versehen ("einige Wochen")
• in 6 Fällen relativ genau definiert ("etwa 4 Wochen).
Die Studie ist hier im Volltext verfügbar: Suzanne Audrey u.a.: What oncologists tell patients about survival benefits of palliative chemotherapy and implications for informed consent: qualitative study (BMJ 2008;337:a752, Published 31 July 2008, doi:10.1136/bmj.a752)
Die Studie hat damit erneut deutlich gemacht, dass selbst spezialisierte Onkologen, die eigentlich auf schwierige Kommunikations-Situationen mit unheilbaren Krebspatienten vorbereitet sein sollten, mit der Bewältigung dieser Aufgabe nicht zurecht kommen. Vgl. hierzu die früher schon veröffentlichten Studien:
• Chemotherapie am Lebensende: Krebspatienten erfahren über ihre Krankheit mehr von Mitpatienten als von ihrem Arzt
• Kommunikation mit Krebspatienten über ihre Ängste: Den meisten Ärzten fehlen die rechten Worte
• Ärztliche Kommunikation über eine unheilbare Krankheit: Nächste Angehörige werden oft erst sehr spät oder gar nicht informiert
Gerd Marstedt, 5.8.2008
Ärztliche Kommunikation über eine unheilbare Krankheit: Nächste Angehörige werden oft erst sehr spät oder gar nicht informiert
 Schwedische Ärzte (und vermutlich auch Ärzte in anderen Ländern) haben große Probleme, über die unheilbare Krankheit eines Patienten zu sprechen und den nächsten Angehörigen diese schlimme Prognose mitzuteilen. In einer Befragung von knapp 700 Witwern, deren Ehefrauen einige Zeit zuvor an Krebs verstorben waren, zeigte sich: 20 Prozent von ihnen wurden während der Lebzeit ihrer Frau niemals über die Diagnose "unheilbar" informiert, bei weiteren 21 Prozent geschah dies erst am Todestag der Ehefrau oder maximal eine Woche davon.
Schwedische Ärzte (und vermutlich auch Ärzte in anderen Ländern) haben große Probleme, über die unheilbare Krankheit eines Patienten zu sprechen und den nächsten Angehörigen diese schlimme Prognose mitzuteilen. In einer Befragung von knapp 700 Witwern, deren Ehefrauen einige Zeit zuvor an Krebs verstorben waren, zeigte sich: 20 Prozent von ihnen wurden während der Lebzeit ihrer Frau niemals über die Diagnose "unheilbar" informiert, bei weiteren 21 Prozent geschah dies erst am Todestag der Ehefrau oder maximal eine Woche davon.
Schon in einer früheren Studie hatte eine US-amerikanische Forschungsgruppe festgestellt, dass Fachärzte für Tumorerkrankungen erhebliche Probleme haben, mit ihren schwer und zum Teil unheilbar erkrankten Patienten über deren Ängste und Sorgen zu sprechen. Wenn Patienten solche Gefühle im Gespräch enthüllen, wurde dies nur in einem Fünftel aller Fälle auch vom behandelnden Arzt aufgegriffen und der Kranke zu weiteren Äußerungen ermuntert. (vgl.: Kommunikation mit Krebspatienten über ihre Ängste: Den meisten Ärzten fehlen die rechten Worte). In einer anderen Studie hatte sich gezeigt, dass Patienten über den Fortgang ihrer Krankheit und ihre weitere Lebenserwartung sehr viel mehr von anderen Patienten im Warteraum der Klinik erfahren als von ihrem Onkologen. (vgl.: Chemotherapie am Lebensende: Krebspatienten erfahren über ihre Krankheit mehr von Mitpatienten als von ihrem Arzt)
Jetzt hat eine schwedische Studie diese Frage nach der ärztlichen Kommunikation und Information über emotional hoch belastende Sachverhalte erneut aufgegriffen. Anhand des schwedischen Bevölkerungsregisters suchten sie nach Männern, deren Ehefrau 4-5 Jahre zuvor an Krebs gestorben war und baten diese um Teilnahme an einer Befragung. Die Auswertung der verschiedenen Fragen bei insgesamt 691 Teilnehmern ergab dann:
• 20 Prozent von ihnen wurden während der Lebzeit ihrer Frau niemals über die Diagnose "unheilbar" informiert, bei weiteren 21 Prozent geschah dies erst am Todestag der Ehefrau oder maximal eine Woche davor, bei 24% kam die Information 2 Wochen bis 2 Monate vor dem Tod, bei 35 Prozent länger als drei Monate zuvor.
• In der Mehrzahl der Fälle (79%) kam die Mitteilung vom Arzt selbst, nur in wenigen Fällen von der todkranken Patientin oder Pflegekräften.
• Nur etwa 14% der betroffenen Witwer sprachen sich dagegen aus, sofort über die unheilbare Krankheit informiert zu werden, wenn dies für den Arzt eindeutig feststeht.
• Andererseits waren wesentlich mehr Befragte dagegen (nämlich 39%), dass der krebskranke Patient sofort über die unheilbare Krankheit informiert wird. Atheisten sprachen sich viermal so oft dagegen aus wie religiös überzeugte Studienteilnehmer.
Die Wissenschaftler des Karolinska Institut in Stockholm formulieren eine sehr vorsichtige Kritik wenn sie schreiben, dass es noch "erheblichen Spielraum gibt zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient bei unheilbaren Krebserkrankungen".
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier: Hanna Dahlstrand u.a.: Disclosure of Incurable Illness to Spouses: Do They Want to Know? A Swedish Population-Based Follow-Up Study (Journal of Clinical Oncology, Vol 26, No 20 (July 10), 2008: pp. 3372-3379)
Gerd Marstedt, 24.7.2008
Ärztinnen gehen bei der Kommunikation mit Patienten stärker auf deren Bedürfnisse und Emotionen ein
 Patientinnen sind mit einer Gynäkologin meist zufriedener als mit einem männlichen Gynäkologen. Dies ist jedoch kein Zusammenhang, der durch das biologische Geschlecht verursacht wird. Vielmehr zeigt sich, dass Ärztinnen sich im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen stärker patienten-orientiert verhalten: Sie erfragen ausführlicher die Krankengeschichte, gehen intensiver auf Ängste und Hoffnungen der Patientinnen ein und besprechen mit ihnen umfassender auch die Diagnose und das weitere Vorgehen. Auch männliche Gynäkologen können also eine höhere Zufriedenheit ihrer Patientinnen erreichen, wenn sie ihre Kommunikationsfertigkeiten und Empathie verbessern. Dies ist das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Schweizer Studie, in der man anhand von knapp 200 Video-Mitschnitten Arzt-Patientinnen-Gespräche analysierte und anschließend die Frauen ausführlich nach ihrer Zufriedenheit befragte.
Patientinnen sind mit einer Gynäkologin meist zufriedener als mit einem männlichen Gynäkologen. Dies ist jedoch kein Zusammenhang, der durch das biologische Geschlecht verursacht wird. Vielmehr zeigt sich, dass Ärztinnen sich im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen stärker patienten-orientiert verhalten: Sie erfragen ausführlicher die Krankengeschichte, gehen intensiver auf Ängste und Hoffnungen der Patientinnen ein und besprechen mit ihnen umfassender auch die Diagnose und das weitere Vorgehen. Auch männliche Gynäkologen können also eine höhere Zufriedenheit ihrer Patientinnen erreichen, wenn sie ihre Kommunikationsfertigkeiten und Empathie verbessern. Dies ist das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Schweizer Studie, in der man anhand von knapp 200 Video-Mitschnitten Arzt-Patientinnen-Gespräche analysierte und anschließend die Frauen ausführlich nach ihrer Zufriedenheit befragte.
"Patienten-Zentrierung", "patient-centered care", ist ein zentraler Begriff, wenn es um Qualitätsverbesserungen in der medizinischen Versorgung geht. Die stärkere Berücksichtigung von Patienteninteressen bewirkt nicht nur eine höhere Zufriedenheit, sondern verbessert auch den Therapie-Erfolg. Auf der Internet-Seite des "Commonwealth Fund" findet man regelmäßig Kurzberichte über neue Studien, die diesen Zusammenhang belegen.
Eine Studie an der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Universitäts-Klinik Basel, ist nun der Frage nachgegangen, ob sich weibliche und männliche Ärzte/innen bei diesem Merkmal der Arzt-Patient-Beziehung voneinander unterscheiden und ob dies Auswirkungen für die Patientenzufriedenheit hat. Dazu wurden 196 Arzt-Patientinnen-Gespräche von insgesamt 49 Gynäkologen/innen aufgezeichnet, 13 männlichen und 36 weiblichen Medizinern. Die Mitschnitte wurden danach dann anhand eines detaillierten Fragenkatalogs ausgewertet und die Patientinnen in einem Fragebogen zu mehreren Aspekten ihrer Zufriedenheit befragt.
Die Bewertung der Patienten-Zentrierung erfolgte in Anlehnung an vorhandene Skalen und berücksichtigte vier Dimensionen:
• Kommunikationsstil: Namentliche Vorstellung des Arztes, ausführliches Fragen nach Patientenwünschen, entspannte Gesprächsatmosphäre, kein Zeitdruck, Eingehen auf Gefühlsäußerungen, non-verbale Kommunikation, explizites Erfragen der Zufriedenheit usw.
• Bio-psycho-soziale Perspektive: Erfassen der akuten Beschwerden, der Familien- und Krankengeschichte, Auswirkungen der Beschwerden im Alltag, frühere Erkrankungen und Verlauf, Umgang mit Beschwerden (Coping) usw.
• Informationsvermittlung: Erklärungen zum Konsultationsverlauf, Rückfragen zum Verständnis der Erläuterungen, genaue Erklärung der Diagnose, Hinweise zum wahrscheinlichen Krankheitsverlauf usw.
• Ermutigung zum Shared Decision Making, zur Partizipativen Entscheidungsfindung: Erörterung der Arzt- und Patienten-Perspektive, Diskussion von Konflikten, detaillierte Informationen zu Nutzen und Risiken möglicher Therapien usw.
Bei der Analyse dieser Bewertungen und möglicher Zusammenhänge zeigte sich dann:
• Männliche und weibliche Gynäkologen unterschieden sich bei den vier genannten Dimensionen nur hinsichtlich des Kommunikationsstils: Hier waren Ärztinnen ihren männlichen Kollegen deutlich überlegen, was die Umsetzung eines patienten-zentrierten Kommunikationsstils anbetrifft. Für die übrigen drei Dimensionen fand man keine signifikanten Unterschiede.
• Für die Patientenzufriedenheit zeigte sich dann, dass weder das Geschlecht der Ärzte/innen, noch ihre Berufserfahrung oder ihr Alter eine Rolle spielten. Ein deutlicher Zusammenhang ergab sich dann jedoch für den patienten-zentrierten Kommunikationsstil, also ganz unabhängig davon, ob dies von männlichen oder weiblichen, jungen oder alten, berufserfahrenen oder unerfahrenen Medizinern realisiert worden war.
Hier ist ein Abstract der Studie: Regula Nelly Christen u.a.: Gender differences in physicians' communicative skills and their influence on patient satisfaction in gynaecological outpatient consultations (Social Science & Medicine, Article in Press, Corrected Proof)
Gerd Marstedt, 4.2.2008
Onkologen gehen selten auf die Gefühle ihrer Patienten ein
 Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung offenbaren ihre emotionale Belastung gegenüber ihren Onkologen nur teilweise und häufig nur indirekt, obwohl eine offene Kommunikation ihrer Ängste und Nöte die Bewältigung verbessert. Die angedeuteten und indirekten Äußerungen von Gefühlen werden als empathische Gelegenheiten bezeichnet. Wissenschaftler des Duke Comprehensive Cancer Center in Durham, North Carolina, haben untersucht, wie Ärzte mit den empathischen Gelegenheiten umgehen. Dafür haben sie 398 Gespräche von 51 Onkologen und 270 Patienten gefilmt und ausgewertet. Sie fanden, dass die Zahl der empathischen Gelegenheiten zwischen 0 und 10 lag,in 37% der Gespräche fand sich mindestens eine Gelegenheit. Zwei Drittel der Äußerungen wurden als direkt und ein Drittel als indirekt klassifiziert. In 22% gingen die Onkologen darauf ein und ermunterten die Patienten zu weiterer Kommunikation. Ärztinnen gingen häufiger als Ärzte auf die Emotionen ein, insbesondere bei Patientinnen.
Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung offenbaren ihre emotionale Belastung gegenüber ihren Onkologen nur teilweise und häufig nur indirekt, obwohl eine offene Kommunikation ihrer Ängste und Nöte die Bewältigung verbessert. Die angedeuteten und indirekten Äußerungen von Gefühlen werden als empathische Gelegenheiten bezeichnet. Wissenschaftler des Duke Comprehensive Cancer Center in Durham, North Carolina, haben untersucht, wie Ärzte mit den empathischen Gelegenheiten umgehen. Dafür haben sie 398 Gespräche von 51 Onkologen und 270 Patienten gefilmt und ausgewertet. Sie fanden, dass die Zahl der empathischen Gelegenheiten zwischen 0 und 10 lag,in 37% der Gespräche fand sich mindestens eine Gelegenheit. Zwei Drittel der Äußerungen wurden als direkt und ein Drittel als indirekt klassifiziert. In 22% gingen die Onkologen darauf ein und ermunterten die Patienten zu weiterer Kommunikation. Ärztinnen gingen häufiger als Ärzte auf die Emotionen ein, insbesondere bei Patientinnen.
Die ärztlichen Äußerungen zur Unterstützung der Gefühlsäußerungen wurden nach dem NURSE-Schema klassifiziert:
• das Gefühl des Patienten benennen (Name)
• Empathie und Verständnis für die Gefühle des Patienten äußern (Understand)
• den Patienten loben (Respect)
• Unterstützung zeigen (Support)
• den Patienten ermuntern, mehr über seine Gefühle zu sprechen (Explore)
Die Autoren empfehlen, die Ärzte besser darin auszubilden, mit den negativen Gefühlen ihrer onkologischen Patienten umzugehen. Aber auch die Patienten sollten ermuntert werden, ihre Gefühle direkt zu äußern.
Journal of Clinical Oncology. Oncologist Communication About Emotion During Visits With Patients With Advanced Cancer
David Klemperer, 2.2.2008
Aus dem Grenzgebiet des Erforschbaren: Zur Existenz und Art von Machtausübung durch Sprache in Arzt-Patientkontakten
 Untersuchungen des tatsächlichen Inhalts von Gesprächen zwischen Patienten und Ärzten sind methodisch äußerst schwierig durchzuführen und bergen eine Fülle von Verzerrungsmöglichkeiten in sich. Handelt es sich darum "echte" Behandlungszimmergespräche aufzuzeichnen und sie anschließend zu analysieren, muss man beide Beteiligten über diese Aufzeichnung und das Ziel der Untersuchung informieren. Dies führt auf beiden Seiten zu einer Fülle von so genannten Interaktionseffekten. Dies meint, dass der Arzt sich natürlich besonders bemüht, "gut" und zwar bezogen auf das Untersuchungsziel (z. B. Aufklärungsverhalten des Arztes) zu sein.
Untersuchungen des tatsächlichen Inhalts von Gesprächen zwischen Patienten und Ärzten sind methodisch äußerst schwierig durchzuführen und bergen eine Fülle von Verzerrungsmöglichkeiten in sich. Handelt es sich darum "echte" Behandlungszimmergespräche aufzuzeichnen und sie anschließend zu analysieren, muss man beide Beteiligten über diese Aufzeichnung und das Ziel der Untersuchung informieren. Dies führt auf beiden Seiten zu einer Fülle von so genannten Interaktionseffekten. Dies meint, dass der Arzt sich natürlich besonders bemüht, "gut" und zwar bezogen auf das Untersuchungsziel (z. B. Aufklärungsverhalten des Arztes) zu sein.
Aber auch der Patient könnte sich angeregt fühlen als "guter" und "sozial erwünschter" (z. B. nachfragender und wenig "weinerlicher Patient) Partner dazustehen. Aus solchem Interaktionsverhalten könnten aber dadurch sogar gesundheitliche Nachteile für den Patienten entstehen, wenn er sich wegen der Dokumentation nicht traut, eine ihm peinliche, aber unter Umständen gefährliche Störung zu schildern. Bei der Auswahl von Patienten und dazu noch ihren Ärzten könnte es sich also um eine extreme Positivauswahl handeln, deren Verhalten ein völlig unrepräsentatives und wirklichkeitsfremdes Bild vermittelt.
Auf diesem Hintergrund sind trotzdem stattfindende Untersuchungen des Inhalts und der Performance von Arzt-Patientengesprächen zunächst einmal mutig und verdienen hohe Aufmerksamkeit.
Dies gilt daher auch für die gerade veröffentlichten Ergebnisse einer an der Uni Bochum von Tim Peters erstellten Masterarbeit im Fach Linguistik. Ihre empirische Basis sind Mitschnitte von 100 in 52 Düsseldorfer Hausarztpraxen geführten Gesprächen zwischen Patienten und Ärzten. Einen Teil der gerade aufgelisteten methodischen Probleme versuchte Peters durch die Auswahl eines besonderen Designs zu vermeiden.
Als erstes hatten sich Ärzte einige Monate vor den Mitschnitten schriftlich bereit erklärt, solche Gespräche heimlich aufzeichnen zu lassen. Die danach bei ihnen auftauchenden PatientInnen waren aber keine "echten" Patienten, sondern Test-Patienten, die mit fingierten und standardisierten Behandlungsanlässen oder Krankheitsgeschichten in die Praxis kamen. Dabei waren die eine Hälfte der Patienten der eher ängstlich-drängende Kopfschmerzpatient und der andere ein eher neutral-akzeptierender Typ.
Das Untersuchungsziel war, ob Ärzte unter Zeitdruck zu sprachlichen Mitteln der Machtausübung greifen und dadurch versuchen, möglichst rasch ein Gesprächsende zu erreichen oder den Behandlungsaufwand gering zu halten.
Obwohl also diese Ärzte wussten, dass ihr Verhalten in einem begrenzten Zeitraum genau auf solche Eigenarten "getestet" würden, ließ sich in den meisten Konsultationen eine breite Palette von Machtmanifestationen finden.
Dazu gehörten gezielte Unterbrechungen des Redeflusses der Patienten oder sie nie ausreden zu lassen, die Reduktion des Gesprächs über den Gesundheitszustand auf ja/nein-Fragen, die Intonation, immer lauter werdende Nachfragen, wenn Patienten z. B. die vom Arzt präferierte Therapie (eine Spritze) ablehnte und die verstärkte Nutzung von unverständlichen Fachwörtern und Wirkstoffbezeichnungen. Damit versuchen die Ärzte ihre Fachkompetenz zu verdeutlichen und diese sowie z. B. die Therapieauswahl durch verbalen Druck durchzusetzen.
Die "heute oft geforderte kooperative Entscheidungsfindung", so eine Quintessenz von Peters, "findet oft nicht statt".
Ohne selbst einen moralisch-wertenden Begriff von "Macht" und Machtausübung in Arzt-Patientenkontakten zu vertreten, kommt der Bochumer Linguist zu der Schlussfolgerung "dass Sprache in institutionellen Situationen nicht nur ein Trägermedium für Informationen ist, sondern dass allein die Form der Sprache schon verschiedenste Einflusspotentiale enthält." Dies müsse in allen Überlegungen zur Verbesserung dieser Interaktionen beachtet werden, die häufig nur auf das "ob" von Information und Gespräch und weniger auf das "wie" schauen.
Auch wenn die Fallzahl der Studie nicht allzu groß ist und damit Einschränkungen der Aussagefähigkeit der gewonnenen Erkenntnisse existieren und wenn auch hier die Gefahr einer positiven Selbstselektion der Ärzte besteht, kommt sie weit über das Niveau einer so genannten "anecdotally evidence" hinaus und könnte den Umfang und die Art der Steuerung der Arzt-Patient-Interaktion durch "Macht" sogar unterzeichnen. Der frisch gebackene Linguistik-Master will seine Forschungsfrage innerhalb einer Dissertation weiter verfolgen.
Ob es allerdings jemals möglich sein wird, valide und reliable bzw. repräsentative Daten über die Arzt-Patientenkommunikation zu erheben, darf bezweifelt werden. Nicht zuletzt und paradoxerweise tragen dazu natürlich genau solche ersten Forschungsergebnisse bei, indem sie zum Anlass genommen werden könnten, den Zugang zu solchen Gesprächen und ihre Aufzeichnung zu verweigern. Im Übrigen wurde bereits in einer Untersuchung an der Universität Hamburg in den 1980er Jahren ermittelt, dass sich kooperationsbereite Ärzte, die völlig überzeugt waren, sich präventiv und kommunikativ vorbildlich zu verhalten, in Wahrheit gegenüber einfachen Patienten deutlich anders verhielten.
Das Konzept und die wichtigsten Aussagen der Masterarbeit finden sich für Nichtmitglieder der Uni Bochum nur in einer Presseerklärung der Universität Bochum, die am 9. Januar veröffentlicht wurde.
Bernard Braun, 17.1.2008
Kommunikation mit Krebspatienten über ihre Ängste: Den meisten Ärzten fehlen die rechten Worte
 Fachärzte für Tumorerkrankungen haben erhebliche Probleme, mit ihren schwer und zum Teil unheilbar erkrankten Patienten über deren Ängste und Sorgen zu sprechen. Wenn Patienten solche Gefühle im Gespräch enthüllen, wird dies nur in einem Fünftel aller Fälle auch vom behandelnden Arzt aufgegriffen und der Kranke zu weiteren Äußerungen ermuntert. Diese Defizite der Arzt-Patient-Kommunikation in besonders schwierigen und emotionsbesetzten Situationen hat jetzt eine US-amerikanische Forschungsgruppe festgestellt. Veröffentlicht wurde ihre Studie jetzt im "Journal of Clinical Oncology".
Fachärzte für Tumorerkrankungen haben erhebliche Probleme, mit ihren schwer und zum Teil unheilbar erkrankten Patienten über deren Ängste und Sorgen zu sprechen. Wenn Patienten solche Gefühle im Gespräch enthüllen, wird dies nur in einem Fünftel aller Fälle auch vom behandelnden Arzt aufgegriffen und der Kranke zu weiteren Äußerungen ermuntert. Diese Defizite der Arzt-Patient-Kommunikation in besonders schwierigen und emotionsbesetzten Situationen hat jetzt eine US-amerikanische Forschungsgruppe festgestellt. Veröffentlicht wurde ihre Studie jetzt im "Journal of Clinical Oncology".
Basis der Studie waren Audio-Mitschnitte von Arzt-Patient-Gesprächen, an denen 51 Onkologen und 270 Patienten mit unterschiedlichen Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium beteiligt waren. Diese Gespräche wurden später von zwei unabhängigen Wissenschaftlern darauf hin bewertet, ob Patienten ihre Gefühle äußerten und dem Arzt Gelegenheit gaben, darauf zu reagieren ("empathic opportunities"). Die Eindeutigkeit und Intensität dieser von Patienten artikulierten Gesprächsanstöße über ihre Emotionen wurde auf einer Skala von 0-10 eingestuft. Die beiden unabhängigen Bewertungen wurden später auf ihre Übereinstimmung geprüft, wobei sich eine sehr hohe Korrelation (0,70) ergab. In der Auswertung der Tonbandmitschnitte wurde weiterhin protokolliert, ob Ärzte auf diese Gesprächsanstöße ihrer Patienten eingehen oder sie negieren bzw. mit anderen Themen das Gespräch fortsetzen.
Insgesamt fand man in knapp 400 Gesprächen 292 solcher Gesprächsanstöße. Ihre Häufigkeit und Intensität wechselte von Patient zu Patient, in etwa jedem dritten Gespräch (37%) war zumindest eine Textpassage zu finden, in der Patienten ihre Sorgen oder Ängste äußerten und den Arzt mehr oder minder direkt zu einer Reaktion aufforderten. Tatsächlich zeigte sich jedoch, dass nur in jedem fünften Fall (22%) der Arzt auch darauf einging.
Bei der Auswertung zeigte sich weiterhin:
• Weibliche Patienten äußerten sehr viel häufiger ihre Gefühle, wenn sie mit einer Frau als behandelnde Onkologin sprachen.
• Jüngere Ärzte und solche, die sich selbst so charakterisiert hatten, dass sie stärker an der Arzt-Patient-Kommunikation als an medizinisch-technischen Fragen interessiert seien, gingen auch häufiger auf die Gefühlsäußerungen ihrer Patienten ein.
In der Diskussion der Ergebnisse betonen die Wissenschaftler, dass Fachärzte für Onkologie nicht grundsätzlich desinteressiert seien am Gemütszustand ihrer Patienten. Ihnen würden jedoch Kenntnisse und Fertigkeiten fehlen, um auf entsprechende Patienten-Äußerungen angemessen zu reagieren. In der Mediziner-Ausbildung kämen solche Qualifikationen entschieden zu kurz.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier: Kathryn I. Pollak u.a.: Oncologist Communication About Emotion During Visits With Patients With Advanced Cancer (Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 36 (December 20), 2007: pp. 5748-5752)
Bereits zuvor hatte eine Meta-Analyse wissenschaftlicher Veröffentlichungen gezeigt, dass die Kommunikation mit Krebs-Patienten eine für Ärzte besonders schwierige Anforderung ist, die sie oftmals nur sehr unzureichend bewältigen. Eine Folge dieser Kommunikationsbarrieren sahen die Wissenschaftler darin, dass viele unheilbare Krebspatienten sich auch noch im Endstadium für eine aggressive Chemotherapie entscheiden. Etwa ein Drittel ist nämlich der Meinung, dass Zielsetzung der Chemotherapie eine "Heilung" ihrer Krebserkrankung sei. Auch wurde festgestellt, dass Krebspatienten in vielen Fällen mehr über ihre Erkrankung von Mitpatienten erfahren als von ihrem behandelnden Arzt. vgl.: Chemotherapie am Lebensende: Krebspatienten erfahren über ihre Krankheit mehr von Mitpatienten als von ihrem Arzt
Gerd Marstedt, 31.12.2007
Sprachverwirrung: Wenn Ärzte mit Patienten sprechen und ihren medizinischen Fachjargon nicht unterdrücken
 Eine Vielzahl von Studien hat in der letzten Zeit deutlich gemacht, dass viele Patienten über eine unzureichende "Gesundheitskompetenz" ("Health Literacy") verfügen, also nicht in der Lage sind, Medikamenten-Beipackzettel oder Anweisungen ihres Arztes richtig zu interpretieren. Dass für diese Problematik womöglich nicht nur individuelle Wissens- und Bildungsdefizite ursächlich sind, sondern in zumindest genau so starkem Maße Informations- und Kommunikationsmängel der Mediziner, hat jetzt eine Studie angedeutet, die in der Zeitschrift "American Journal of Health Behavior" veröffentlicht wurde. In acht von zehn normalen Arzt-Patient-Gesprächen, so das Fazit der Studie, verwenden die Ärzte mindest einmal (meist aber öfter) medizinische Fachbegriffe und Erläuterungen, die für Patienten nicht verständlich sind.
Eine Vielzahl von Studien hat in der letzten Zeit deutlich gemacht, dass viele Patienten über eine unzureichende "Gesundheitskompetenz" ("Health Literacy") verfügen, also nicht in der Lage sind, Medikamenten-Beipackzettel oder Anweisungen ihres Arztes richtig zu interpretieren. Dass für diese Problematik womöglich nicht nur individuelle Wissens- und Bildungsdefizite ursächlich sind, sondern in zumindest genau so starkem Maße Informations- und Kommunikationsmängel der Mediziner, hat jetzt eine Studie angedeutet, die in der Zeitschrift "American Journal of Health Behavior" veröffentlicht wurde. In acht von zehn normalen Arzt-Patient-Gesprächen, so das Fazit der Studie, verwenden die Ärzte mindest einmal (meist aber öfter) medizinische Fachbegriffe und Erläuterungen, die für Patienten nicht verständlich sind.
Dass es mit der Arzt-Patient-Kommunikation nicht immer zum Besten bestellt ist und Ärzte daran nicht ganz unschuldig sind , hat eine Reihe empirischer Studien zuletzt deutlich gemacht. 11-24 Sekunden dauert es, so hat eine Studie anhand von Videoaufzeichnungen gezeigt, bis der Arzt den Erzählfluss eines Patienten am Beginn einer Konsultation zum ersten Mal unterbricht. (vgl. Wann unterbricht der Hausarzt seine Patienten zu Beginn der Konsultation?) Das bei einem Arzt-Patient-Kontakt ablaufende Schema ist fast immer dasselbe, fand eine Berliner Doktorarbeit heraus. Knapp 90% der Ärzte erzählen dem Patienten, was sie vermuten und informieren ihn über die Durchführung von Tests zur Bestätigung der Diagnose. Nur 5% der Mediziner interessieren sich dafür, was Patienten über ihre Erkrankung denken. Dies ist auch Effekt einer völlig unzureichenden beruflichen Ausbildung. Von den in der Doktorarbeit befragten Medizinern haben nach eigener Aussage 24% gar nichts, 48% eher wenig, 26% etwas und 2% viel über Gesprächsführung und Kommunikation in ihrer Ausbildung gelernt. Eine amerikanische Studie fand heraus, dass Krebspatienten, die sich einer Chemotherapie unterzogen, über ihre Krankheit in den meisten Fällen mehr von Mitpatienten erfahren als von ihrem Arzt.
Die an der Universität von San Francisco durchgeführte Studie hat nun einen weiteren Aspekt von Kommunikationsstörungen aufgezeigt, die wohl nicht nur in den USA vorzufinden sind. Die Wissenschaftler wählten für ihre Untersuchung Patienten aus, die einerseits nur über eine geringe Gesundheitskompetenz verfügen (dies wurde zu Beginn der Studie mit einem Test geprüft) und zum anderen an Diabetes Typ II erkrankt waren. Mit dem Einverständnis der Teilnehmer wurden dann Gespräche, die sie mit einem Arzt führten, auf Tonband mitgeschnitten. Beteiligt waren dabei 38 Klinik-Ärzte.
Die so entstandenen 74 Audio-Mitschnitte wurden dann in mehreren Stufen darauf hin analysiert, ob sie für Laien nicht verständlichen medizinischen Fachjargon enthielten und in welchem Zusammenhang des Gesprächs diese fielen. Dabei wurde unterschieden zwischen vier Gesprächsthemen: Untersuchung und Symptomfeststellung, Erklärung von Testergebnissen und Diagnosen, Aufklärung über gesundheitliche und biologische Zusammenhänge, Ratschläge und Informationen zum Gesundheitsverhalten. Als "Fachjargon" wurden einerseits rein medizinische Begriffe eingestuft (wie Hämoglobin oder Dialyse), andererseits aber auch Begriffe, die in der Medizinersprache eine andere Bedeutung haben als in der Umgangssprache (wie: Werte sind "stabil"). Da man streiten kann, ob ein bestimmter Begriff reiner medizinischer Fachjargon ist oder nicht doch schon in die Umgangssprache vorgedrungen ist, wurden andere Patienten in Telephon-Interviews mit einer großen Zahl von Begriffen konfrontiert und sie gefragt, ob sie diesen Ausdruck kennen und was er bedeutet.
In der Auswertung der Tonbandmitschnitte zeigte sich dann:
• In 81% der Arzt-Patient-Kontakte tauchte zumindest einmal ein für Laien unverständlicher Fachjargon auf.
• Die durchschnittliche Häufigkeit solcher Begriffe lag pro Gespräch bei 4.
• In etwa jedem fünften Gespräch wimmelte es nur so von Fachjargon, hier wurden 5 oder mehr unverständliche Ausdrücke benutzt.
• Am häufigsten tauchte medizinischer Fachjargon dann auf, wenn Ärzte Ratschläge und Informationen zum Gesundheitsverhalten abgaben (37% der Fälle), am seltensten, wenn sie Untersuchungs- und Testergebnisse erklärten (10%). Offensichtlich sind sich Ärzte also bisweilen des Risikos bewusst, dass sie über die Köpfe ihrer Patienten hinwegreden, nämlich dann, wenn das Thema bereits eng medizinisch definiert ist. Sofern jedoch alltägliche Aspekte wie das Gesundheitsverhalten (Ernährung, Bewegung, Rauchen usw.) im Gespräch auftauchen, ist dies wieder vergessen.
Die Forschungsgruppe dokumentiert auch an einigen Beispielen, dass vermeintlich einfache Ausdrücke bei Laien gleichwohl unverstanden bleiben. So wurde in den vorbereitenden Telefonaten, um zu klären, was Fachjargon ist und was nicht, auch gefragt nach der Bedeutung des Satzes "Arzt: Ihr Gewicht ist stabil, seit ich sie vor einigen Monaten das letzte Mal sah". Patienten verstehen diese Aussage gar nicht oder interpretieren sie folgendermaßen: "Mein Gewicht ist in Ordnung", "Er sagt, dass ich an Gewicht zulegen muss", "Er meint, dass ich an Gewicht nicht allzu stark zunehmen darf."
Oder das Beispiel: "Arzt: Wissen Sie, was der Hauptgrund dafür ist, dass für so viele Patienten eine Dialyse nötig ist? Diabetes!" Studienteilnehmer sollen hier erläutern, was der Arzt mit "Dialyse" meint. Antworten: "Weiß nicht", "Dass man jeden Tag etwas untersuchen muss", "Hängt das mit den Zehen zusammen?", "Dass man sich körperlich mehr bewegen muss, wenn man Diabetes hat".
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier zu finden: Cesar M. Castro, Clifford Wilson, Frances Wang, Dean Schillinger: Babel Babble: Physicians' Use of Unclarified Medical Jargon with Patients (Quelle: American Journal of Health Behavior 2007;31(Suppl 1):S85-S95)
Gerd Marstedt, 7.11.2007
Viele Patienten können ihrem Arzt nicht sagen, welche Medikamente sie einnehmen
 Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Medikamenten, die einem Patienten verschrieben werden, sind eine der häufigsten Ursachen für unerwünschte und zum Teil überaus gesundheitsriskante Nebenwirkungen. Daher sollte ein Arzt vor der Verschreibung eines neuen Medikaments Bescheid wissen, welche andere Arzneimittel sein Patient schon einnimmt. Zumeist ist er dabei auf dessen persönliche Angaben angewiesen. Und genau hier gibt es ein Problem, denn viele erinnern sich bei der Frage des Arztes nicht an den Namen oder die Dosierung der Medikamente oder vergessen einige gänzlich. Dies hat jetzt eine Studie aus Chicago gezeigt, die in der Zeitschrift "Journal of General Internal Medicine" veröffentlicht wurde.
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Medikamenten, die einem Patienten verschrieben werden, sind eine der häufigsten Ursachen für unerwünschte und zum Teil überaus gesundheitsriskante Nebenwirkungen. Daher sollte ein Arzt vor der Verschreibung eines neuen Medikaments Bescheid wissen, welche andere Arzneimittel sein Patient schon einnimmt. Zumeist ist er dabei auf dessen persönliche Angaben angewiesen. Und genau hier gibt es ein Problem, denn viele erinnern sich bei der Frage des Arztes nicht an den Namen oder die Dosierung der Medikamente oder vergessen einige gänzlich. Dies hat jetzt eine Studie aus Chicago gezeigt, die in der Zeitschrift "Journal of General Internal Medicine" veröffentlicht wurde.
Beteiligt waren 119 Patienten, die in einem von drei medizinischen Versorgungszentren wegen Bluthochdrucks in Behandlung waren. Bei ihnen wurden verschiedene Angaben erfasst, darunter sozialstatistische Daten wie Alter oder Geschlecht. Darüber hinaus wurde aber auch ihre "Gesundheitskompetenz" ("health literacy") anhand eines Fragebogens überprüft, also ihr allgemeines Grundwissen in medizinischen und gesundheitlichen Fragen. Dann wurden sie gebeten, anhand einer Liste all jene Medikamente anzukreuzen, die ihnen gegen ihren Bluthochdruck von Ärzten verschrieben worden waren. Diese Angaben wurden dann verglichen mit der Krankenakte bzw. den Abrechnungsunterlagen, aus denen die tatsächlich verordneten Medikamente hervorgingen. Heraus kamen Erschreckendes:
• Lediglich bei 30% aller Befragten stimmten persönliche Angaben und tatsächliche ärztliche Verordnungen exakt überein.
• Bei jedem vierten (24%) gab es zumindest teilweise Übereinstimmungen.
• Bei fast der Hälfte der Studienteilnehmer jedoch (46%) fand sich keine einzige Übereinstimmung, das heißt, sämtliche persönlichen Angaben über verordnete Medikamente waren falsch. Entweder wurden Arzneien genannt, die ihnen nicht verschrieben worden waren, oder tatsächlich verschriebene Mittel wurden nicht genannt. Ein Großteil aus dieser Gruppe (40% aller Studienteilnehmer) musste überdies bei dieser Aufgabe vollständig passen, sie waren nicht in der Lage, den Namen auch nur eines einzigen ihnen verordneten Medikaments zu nennen.
Dabei wurden auch erhebliche Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen deutlich. Besonders großen Einfluss hatte dabei die "Gesundheitskompetenz" ("health literacy"). Bei niedriger Kompetenz lag die Quote der Patienten mit unzureichenden und falschen Angaben bei 65%, bei guter Kompetenz nur bei 38%.
Der für die Studie leitende Wissenschaftler Stephen Persell erkennt in den Befunden seiner Studie eine doppelte Problematik. Einerseits werden vermutlich aufgrund der Fehlinformationen durch die Patienten sehr viel mehr Arzneimittel verordnet und abgerechnet als tatsächlich nötig ist, andererseits könnten durch den unzureichenden Informationsstand des Arztes auch Medikamente verordnet werden, die durch ihre wechselseitige Unverträglichkeit problematische Nebenwirkungen hervorrufen.
Das Ergebnis der Studie scheint zunächst den Befürwortern der elektronischen Gesundheitskarte Argumente zu liefern, denn auf der Karte sollen ja in Deutschland zumindest in weiterer Zukunft auch alle Medikamentenverordnungen gespeichert werden. Persell sieht darin jedoch noch keine umfassende Lösung, zumindest für die USA: "Patientenakten oder ähnliche elektronische Aufzeichnungen sind keine Lösung. Denn viele Patienten benutzen ganz alte Rezepte, um sich ihre Medikamente in der Apotheke zu holen, auch dann noch, wenn der Arzt das Medikament oder die Dosierung geändert hat. Die einzige Lösung wäre es, dem Patienten zu sagen: Beim nächsten Mal bringen Sie bitte die Packungen aller Arzneimittel, die Sie zur Zeit einnehmen, hier in die Praxis mit."
• Hier ist eine Pressemitteilung der Northwestern University mit den wichtigsten Ergebnissen: Patients Can't Recall Their Medication to Tell Doctors
• Hier ist der kostenlose Volltext der Veröffentlichung: Stephen D. Persell u.a.: Limited Health Literacy is a Barrier to Medication Reconciliation in Ambulatory Care (J Gen Intern Med 22 (11): 1523-6, DOI: 10.1007/s11606-007-0334-x)
Gerd Marstedt, 22.10.2007
Beispiel Statine: Ärzte ignorieren und verschweigen oft Beschwerden von Patienten über Arzneimittel-Nebenwirkungen
 Die im August 2007 in der US-Fachzeitschrift "Drug Safety" veröffentlichten Ergebnisse einer von Beatrice Golomb et al. von der Universität von Kalifornien in San Diego durchgeführten Studie mit 650 knapp über 60 Jahre alten und in den USA lebenden Patienten unterstreichen oder belegen diese zugespitzten Formulierungen so nachdrücklich, dass es unmöglich ist, von Defiziten "weniger schwarzer Schafe" oder von Informationsschwächen oder Desinteresse bei exotischen Medikamenten zu sprechen.
Die im August 2007 in der US-Fachzeitschrift "Drug Safety" veröffentlichten Ergebnisse einer von Beatrice Golomb et al. von der Universität von Kalifornien in San Diego durchgeführten Studie mit 650 knapp über 60 Jahre alten und in den USA lebenden Patienten unterstreichen oder belegen diese zugespitzten Formulierungen so nachdrücklich, dass es unmöglich ist, von Defiziten "weniger schwarzer Schafe" oder von Informationsschwächen oder Desinteresse bei exotischen Medikamenten zu sprechen.
Dies fängt damit an, dass es in der Studie um mögliche Nebenwirkungen von Statinen geht, also hochpotenten und weltweit häufig verordneten Arzneimitteln über deren Wirkungen und Nebenwirkungen praktisch in jedem wissenschaftlichen oder auch standespolitischen Journal sowie in der guten Tagespresse ausführlich berichtet wurde und wird.
Ein erklärtes Ziel der Studie war es im übrigen, zu prüfen, ob Wahrnehmungen von Patienten über so genannte "adverse drug reactions (ADR)" nicht ergänzend zu Herstellerinformationen und Hinweisen anderer Institutionen und Expertenkreise zur Risikoberichterstattung herangezogen werden können. Dafür wäre aber die Weitergabe durch Ärzte die zentrale logistische Voraussetzung.
Die meisten der Studienteilnehmer nahmen Statine ein und 78 % der 650 PatientInnen beschwerten sich bei ihrem Arzt über Muskelschmerzen, Gedächtnisverluste, Taubheit in Händen und Füßen oder andere mögliche ADRs der Statine bzw. sprachen ihren Arzt darauf an und baten um (Er-)Klärung. Zu diesen Nebenwirkungen und der Kommunikation und Interaktion mit ihrem Arzt, befragten die kalifonischen ForscherInnen die Patienten dann nochmals ausführlich.
Dabei kamen zwei bemerkenswerte Charakteristika des Umgangs von Ärzten mit Patientenmitteilungen über Nebenwirkungen an die Öffentlichkeit:
• Bei nahezu allen Nebenwirkungskomplexen waren die Patienten und nicht die Ärzte initiativ zu klären, ob ihre Symptome etwas mit den verordneten Statinen zu tun haben könnten. 98 % der Gespräche über Wahrnehmungsproblemen wurden von Patienten und 2 % von Ärzten initiiert, 96 % zu 4 % sah das Verhältnis bei neuropathischen Problemen aus und 86 % zu 14 % bei Muskelproblemen.
• Die meisten der Patienten berichteten ferner, dass ihre Ärzte fast durchweg einen Zusammenhang oder die Möglichkeit eines Zusammenhangs der Probleme mit dem Arzneimittel ignorierten oder ins Reich der Phantasie verwiesen bzw. sie stattdessen dem Alter der Patienten anlasteten. Dies traf sogar auf Symptome zu, die in der gesamten Literatur als hochgradig mit der Einnahme von Statinen assoziiert gelten oder wo andere Umstände einen Zusammenhang individuell hochevident machte. Erstaunt fasste der Leiter der Studie dieses Geschehen so zusammen: "Person after person spontaneously (told) us that their doctors told them that symptoms like muscle pain couldn't have come from the drug. We were surprised at how prevalent that experience was."
Da die Forscher keinen Grund sehen, dass sich die Patient-Arzt-Interaktion über ADRs in den USA bei anderen Medikamenten und anderen Symptomen besser gestaltet, halten sie konsequent die Ärzte als Lieferant für eine korrekte Schätzung des Umfangs von ADR für grundsätzlich ungeeignet: Die Studie belege "that doctor reports on side effects [are] a very unreliable means of learning about the true extent of problems." Wer sich auf Arztberichte an die staatlichen Arzneimittelkontrolleinrichtungen (in den USA die "Food and Drug Administration (FDA)") verlasse unterschätze die Probleme erheblich und andere Ärzte und Patienten bekämen einen sichereren Eindruck über das Arzneimittel als er in Wirklichkeit berechtigt ist. Andere Experten wie Jerry Avorn, Professor an der Harvard Medical School, schätzen, dass 90 bis 99 % der ernsten Nebenwirkungen von den Ärzten nicht weiterberichtet werden.
Da sich Patienten prinzipiell als wichtige und verlässliche Informationsquelle für alltägliche Nebenwirkungen erwiesen hätten, müsse nach anderen Methoden und Wegen gesucht werden als dem über die Ärzte, dieses Erfahrungswissen der Sicherheitsbewertung zugänglich zu machen.
Da es keine zwingenden Hinweis darauf gibt, dass deutsche Ärzte prinzipiell anders reagieren oder solange dies nicht sauber geklärt wird, ist zu fürchten, dass dieses Verhalten auch in Deutschland verbreitet ist und zu einer Unterschätzung von Arzneimittelrisiken beiträgt.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie und einiger Berichte in US-Zeitungen liefert der immer wieder generell uneingeschränkt empfehlenswerte tägliche Informationsdienst der "Kaiser Family Foundation".
Das Abstract des Aufsatzes "Physician Response to Patient Reports of Adverse Drug Effects: Implications For Patient-Targeted Adverse Effect Surveillance. Short Communication" von Golomb, Beatrice; McGraw, John; Evans, Marcella und Dimsdale, Joel in "Drug Safety" (30(8):669-675, 2007) erhält man hier kostenfrei.
Bernard Braun, 29.8.2007
Ärzte sind auch nur Menschen: Sympathie und unterschwellige Urteile sind ein zentraler Faktor für die Patientenzentrierung des Arztes
 Eine große Zahl von Studien hat gezeigt, dass die Qualität der medizinischen Versorgung für einen Patienten auch sehr stark abhängt von den sozialen und kommunikativen Kompetenzen des Arztes. Bei Ärzten, die ausführlich informieren, dem Patienten Respekt und Verständnis entgegen bringen und ihn zu einer Beteiligung an anstehenden Entscheidungen ermuntern, wurde zumeist eine höhere Patientenzufriedenheit, Therapietreue und auch eine stärkere Verbesserung des Gesundheitszustands gefunden. Dass das Kommunikationsverhalten von Ärzten gegenüber ihren Patienten von vielen Faktoren abhängt, ist bekannt: Eine Rolle spielt hier nicht nur, ob solche Themen auch in der medizinischen Ausbildung behandelt wurden, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale des Arztes sind maßgeblich oder der Zeitdruck in der Praxis.
Eine große Zahl von Studien hat gezeigt, dass die Qualität der medizinischen Versorgung für einen Patienten auch sehr stark abhängt von den sozialen und kommunikativen Kompetenzen des Arztes. Bei Ärzten, die ausführlich informieren, dem Patienten Respekt und Verständnis entgegen bringen und ihn zu einer Beteiligung an anstehenden Entscheidungen ermuntern, wurde zumeist eine höhere Patientenzufriedenheit, Therapietreue und auch eine stärkere Verbesserung des Gesundheitszustands gefunden. Dass das Kommunikationsverhalten von Ärzten gegenüber ihren Patienten von vielen Faktoren abhängt, ist bekannt: Eine Rolle spielt hier nicht nur, ob solche Themen auch in der medizinischen Ausbildung behandelt wurden, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale des Arztes sind maßgeblich oder der Zeitdruck in der Praxis.
Eine neue Studie hat jetzt jedoch auch gezeigt, dass auch überaus "weiche" Faktoren wie Sympathie oder Antipathie, Emotionen oder Einschätzungen des Patienten eine große Rolle für die Kommunikation des Arztes spielen und seinen Respekt gegenüber dem Patienten und seinem Anliegen. Basis der vorab in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" online veröffentlichten Studie waren einerseits Audio-Aufzeichnungen von Arzt-Patienten-Gesprächen, an denen insgesamt 29 niedergelassene Ärzte in Praxen oder Versorgungszentren der Allgemeinversorgung in Texas, USA, und über 200 Patienten teilnahmen.
Diese Audio-Mitschnitte wurden von den Wissenschaftlern nachträglich bewertet hinsichtlich des vom Arzt, aber auch vom Patienten gezeigten Kommunikationsstils. Unterschieden wurden hier drei Formen, die ein unterschiedliches Ausmaß an Patientenzentrierung bedeuten: informierend, unterstützend, partnerschaftlich. Ferner wurde die im Gespräch deutlich werdende emotionale Atmosphäre klassifiziert, ob sie eher von positiven oder negativen Gefühlsäußerungen beherrscht war.
Darüber hinaus füllten die teilnehmenden Ärzte aber auch nach den Gesprächen jeweils einen Fragebogen aus, in dem sie die Patienten nach verschiedenen Merkmalen beurteilten: Ihr Kommunikationsstil, ihre Emotionalität im Gespräch, die bei ihnen vermutete Therapietreue und Zufriedenheit mit dem Behandlungsgespräch. In ähnlicher Weise bewerteten auch die Patienten in einem Fragebogen den Arzt und das Behandlungsgespräch. Erfasst wurden außerdem verschiedene Patientenmerkmale wie Rasse/Hautfarbe, Alter, Geschlecht und Bildungsniveau.
In der Auswertung dieser vielfältigen Daten zeigte sich dann unter anderem:
• Ärzte waren dann stärker patienten-orientiert und partnerschaftlich eingestellt, wenn sie den Patienten als "guten Erzähler" einstuften. Ebenso galt dies, wenn sie annahmen, dass der Patient zufrieden mit der Behandlung war und die Therapieanweisungen vermutlich befolgen würde.
• Sie zeigten einen stärker partnerschaftlichen Kommunikationsstil, wenn Patienten positive Gefühle geäußert, sich intensiv in das Gespräch eingebracht und weniger Widerspruch oder Gegenmeinungen artikuliert hatten.
• Gegenüber dunkelhäutigen Patienten waren Ärzte eher direktiv und tonangebend in ihren Äußerungen. Sie stuften Patienten dieser Hautfarbe durchweg auch als schlechtere Erzähler ihres Anliegens ein und als eher unzufrieden mit dem Gespräch.
• Ärzte, die sich selbst einstuften als tendenziell partnerschaftlich orientiert, setzten dies auch zumeist tatsächlich im Gespräch mit dem Patienten so um.
• Das Alter, Geschlecht oder Bildungsniveau eines Patienten spielte keine Rolle für den vom Arzt umgesetzten Kommunikationsstil.
Unter dem Strich wurde damit deutlich, dass unterschwellige Emotionen des Arztes eine überaus große Rolle spielen für den jeweils realisierten Kommunikationsstil: Die empfundene Sympathie oder auch die Einschätzung, ob ein Patient ein "guter Patient" ist, also sein Anliegen gut darstellt, Ängste und Hoffnungen artikuliert und nicht zuletzt auch ärztliche Therapieanweisungen befolgt. In diesen Fällen waren Ärzte überaus partnerschaftlich eingestellt. Gegenüber "unliebsamen Patienten" jedoch, die Widerspruch erhoben, ihr Anliegen verbal nur schlecht darstellten oder keinerlei Gefühle zeigten, zeigten Ärzte sich sehr viel weniger patienten-zentriert. Diese Haltung zeigte sich etwa daran, ob der Patient aufgefordert wurde, auch seine Ängste und Befürchtungen zu äußern, ob er als gleichrangig und mit Respekt behandelt wurde usw.
Auch für die Forscher war der überaus starke Einfluss psychologischer Faktoren auf die Qualität und Patientenzentrierung des ärztlichen Behandlungsgesprächs überraschend. Mit der tendenziellen Diskriminierung dunkelhäutiger Patienten hatten sie ebenfalls nicht gerechnet. Allerdings zeigte sich in einer zusätzlichen Auswertung, dass Ärzte nicht-weißer Hautfarbe diese Tendenz nicht ganz so stark zeigten. Vermutet wird von den Forschern, dass dunkelhäutige Patienten teilweise aufgrund früherer Negativerfahrungen dazu neigen, in der ärztlichen Praxis selbstbewusster und energischer aufzutreten. Sie hoffen, damit eine möglichst optimale Therapie zu bekommen - ohne zu wissen, dass dies bei vielen Ärzten eher das Gegenteil bewirkt, zumindest im Hinblick auf Aspekte wie Zuhören oder Respekt.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Richard L. Street, Jr, Howard Gordon, and Paul Haidet: Physicians' communication and perceptions of patients: Is it how they look, how they talk, or is it just the doctor? (Social Science & Medicine (2007), doi:10.1016/j.socscimed.2007.03.036)
Jetzt auch als kostenloser Volltext Download
Gerd Marstedt, 4.6.2007
Kommunikation zwischen Arzt und Patient: Noch viele Defizite bei Medizinern
 Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist eine der Aufgaben klinisch tätiger Ärzte, die einen Großteil ihrer Arbeit ausmacht. Etwa 150-200.000 Patientengespräche führt ein Arzt im Laufe seines Berufslebens. Je mehr es dabei zu einem echten Dialog kommt, der Arzt auf Fragen des Patienten eingeht und sich in sein Gegenüber versetzt, desto besser ist auch der Therapieerfolg. Viele Studie haben diesen Zusammenhang gezeigt: Die Diagnosegenauigkeit nimmt zu, Patienten halten sich genauer an Medikamentenverordnungen, unnötige Krankenhauseinweisungen oder zusätzliche Pflegefälle werden vermieden. Allerdings hapert es in diesem Bereich noch vielfach. Auch wenn Patienten in Befragungen überwiegend sehr große Zufriedenheit mit ihrem Arzt äußern, ist eine der am meisten gestellten Patientenforderungen, dass Ärzte sich mehr Zeit für das Gespräch nehmen und besser und umfassender informieren.
Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist eine der Aufgaben klinisch tätiger Ärzte, die einen Großteil ihrer Arbeit ausmacht. Etwa 150-200.000 Patientengespräche führt ein Arzt im Laufe seines Berufslebens. Je mehr es dabei zu einem echten Dialog kommt, der Arzt auf Fragen des Patienten eingeht und sich in sein Gegenüber versetzt, desto besser ist auch der Therapieerfolg. Viele Studie haben diesen Zusammenhang gezeigt: Die Diagnosegenauigkeit nimmt zu, Patienten halten sich genauer an Medikamentenverordnungen, unnötige Krankenhauseinweisungen oder zusätzliche Pflegefälle werden vermieden. Allerdings hapert es in diesem Bereich noch vielfach. Auch wenn Patienten in Befragungen überwiegend sehr große Zufriedenheit mit ihrem Arzt äußern, ist eine der am meisten gestellten Patientenforderungen, dass Ärzte sich mehr Zeit für das Gespräch nehmen und besser und umfassender informieren.
Neuere Studien zum ärztlichen Kommunikationsverhalten gegenüber Patienten sind im angloamerikanischen und skandinavischen Bereich recht gängig, in Deutschland jedoch überaus selten. Zwar gibt es viele Patientenbefragungen (etwa im "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung), jedoch kaum einmal Studien, an denen Ärzte teilnehmen. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt eine Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin sich diesem Thema ausführlich gewidmet hat. Konstanze Müller hat in ihrer Dissertation "Kenntnisse und Einstellungen klinisch tätiger Ärzte zum Patienten-Gespräch" nicht nur den Forschungsstand sehr ausführlich dargestellt, sondern auch in einer eigenen Befragung von Ärzten überaus interessante Ergebnisse erzielt - interessante Ergebnisse, aber zugleich auch Ergebnisse, die für Patienten wenig erfreulich sind. Denn es zeigt sich: Zwar gibt es bei Ärzten ein gestiegenes Bewusstsein darüber, wie wichtig die Arzt-Patient-Kommunikation für den Behandlungsverlauf ist. Zugleich zeigen sich jedoch in der Umsetzung dieser Einsicht noch immer erhebliche Defizite.
In den ersten Kapiteln werden ausführlich theoretischer Forschungsstand und Ergebnisse empirischer Studien zur Arzt-Patient-Kommunikation dargestellt, deren Bedeutung für die "Compliance", die Patientenzufriedenheit und gesundheitsökonomische Effekte. Im zweiten Teil werden dann Befunde der eigenen Ärztebefragung vorgestellt. Basis ist eine schriftliche Befragung von knapp 100 in Berlin klinisch tätigen Ärzten, insbesondere Internisten und Chirurgen, die in drei Berliner Krankenhäusern der Regel- und Akutversorgung tätig waren.
Wesentliche Ergebnisse der Befragung waren:
• Im Vergleich zu Chirurgen bewerten Internisten Kommunikationsfertigkeiten für die eigene Arbeit höher ein und halten sie und diagnostisch für wertvoller.
• Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Medizinern in der Einstellung zum Patienten-Gespräch: Ärztinnen beurteilen die Kommunikation positiver und sind stärker darum bemüht, einen Einblick in die soziale Situation ihrer Patienten zu bekommen.
• Grundsätzlich werden Gespräche mit dem Patienten als überaus wichtig eingestuft. Diese positive Bewertung findet im realen Verhalten allerdings keine Entsprechung. Es gibt Widersprüche zwischen der nach außen dargestellten patientenorientierten Einstellung zum Gespräch und dem tatsächlichen Verhalten, so wie es in der Befragung in einer fiktiven Gesprächssituation überprüft wurde. Nur sehr wenige Ärzte gaben dem Patienten hier die Möglichkeit, sein Problem im Zusammenhang darzustellen.
• Es überwiegt ein arztzentrierter, direktiver Kommunikationsstil. Dies zeigt sich auch daran, dass Ärzte sich von der Teilnahme an einem Kommunikationstraining vor allem eine bessere Steuerung des Gesprächs erhoffen.
• Trotz einer verbal geäußertem patientenorientierten Grundhaltung und einer positiven Gesprächsbewertung zeigt das ärztliche Kommunikationsverhalten Merkmale eines Aktiv-Passiv-Modells, bei dem die Autonomie des Patienten eingeschränkt und seine Mitarbeit eher bescheiden und reaktiv ist.
• Kommunikations- und Gesprächstechniken werden in der Ausbildung kaum vermittelt. Die ärztliche Ausbildungssituation im Bereich interpersoneller Kommunikation ist insofern als defizitär zu bezeichnen ist und eine Verbesserung dringend notwendig.
Hier ist eine Übersicht zur Dissertation, einzelne Kapitel können von hier als PDF-Dateien heruntergeladen werden: Konstanze Müller: Kenntnisse und Einstellungen klinisch tätiger Ärzte zum Patienten-Gespräch - Eine Untersuchung zum ärztlichen Kommunikationsverhalten, Dissertation FU Berlin
Alle Kapitel können auch als PDF-Dateien gezipt heruntergeladen werden: Alle Kapitel der Dissertation, PDF-Dateien gezipt, 220 Seiten, 19 Kapitel
Gerd Marstedt, 18.4.2007
Hormontherapie in den Wechseljahren: Studie zeigt unzureichende Information durch Ärzte
 Warum nehmen Frauen in den Wechseljahren Hormonpräparate ein? Eine vom AOK-Bundesverband finanzierte Studie "Interviews mit Frauen unter lang dauernder Einnahme weiblicher Hormone in und nach den Wechseljahren" aus dem Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen hat zur Beantwortung dieser Frage 35 qualitative Interviews mit Frauen zwischen 46 und 75 Jahren durchgeführt. Als Ergebnis zeigt sich, dass viele Frauen die Therapie auch langfristig durchführen, um Gesundheitsbeschwerden in der Menopause zu lindern und um Herausforderungen in Beruf und Familie zu meistern. Es zeigt sich allerdings auch, dass viele Frauen von ihren Frauenärzten und -ärztinnen nur sehr unzureichend über die Hormontherapie und ihre Risiken informiert wurden.
Warum nehmen Frauen in den Wechseljahren Hormonpräparate ein? Eine vom AOK-Bundesverband finanzierte Studie "Interviews mit Frauen unter lang dauernder Einnahme weiblicher Hormone in und nach den Wechseljahren" aus dem Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen hat zur Beantwortung dieser Frage 35 qualitative Interviews mit Frauen zwischen 46 und 75 Jahren durchgeführt. Als Ergebnis zeigt sich, dass viele Frauen die Therapie auch langfristig durchführen, um Gesundheitsbeschwerden in der Menopause zu lindern und um Herausforderungen in Beruf und Familie zu meistern. Es zeigt sich allerdings auch, dass viele Frauen von ihren Frauenärzten und -ärztinnen nur sehr unzureichend über die Hormontherapie und ihre Risiken informiert wurden.
Obwohl wissenschaftliche Studien inzwischen eindeutig gegen eine Dauermedikation mit postmenopausalen Hormonpräparaten sprechen, sind die Verordnungszahlen bislang noch vergleichsweise hoch. Aus der Forschung zu leitliniengerechtem Behandeln ist bekannt, dass Ärztinnen und Ärzte zum Teil dem Forschungsstand zuwider handeln, weil sie nicht auf der Höhe des Wissens sind, zum Teil aber auch, weil sie den ausgesprochenen Empfehlungen skeptisch bis ablehnend gegenüber stehen. Die daraus resultierenden Grundüberzeugungen fließen ausdrücklich wie implizit in die Beratung von Frauen ein, welche mit und ohne Menopausebeschwerden in die (frauen-)ärztliche Sprechstunde kommen.
Die in Bremen durchgeführte qualitative Studie hat nun zunächst die Perspektive der Frauen näher beleuchtet. Obwohl vielen Frauen Gesundheitsrisiken bekannt sind, gibt es für die Befragten vielschichtige Gründe, sich auf eine Hormontherapie einzulassen. Dabei werden Hormone nicht nur gegen konkrete Beschwerden eingenommen. Die Wahrung der Attraktivität spielt ebenso eine Rolle wie die Angst vor einem Leistungsabfall in Beruf oder Familie. Von den Befragten wurde ebenfalls betont, dass es große Defizite in Hinblick auf die fachliche Beratung und kontinuierliche Begleitung während der Therapie gibt. Die Ergebnisse dieser qualitativen Studie können dazu beitragen, Lücken in der gegenwärtigen Beratung von Frauen in den Wechseljahren zu schließen, erklärten die Wissenschaftler..
Weitere Ergebnisse der Studie deuteten auf eine überaus unzureichende Information durch die Frauenärzte (vgl. Studienbericht, S. 71/72):
• Die Einnahmedauer der Hormonpräparate war in den meisten Fällen anscheinend überhaupt kein Thema in der ärztlichen Praxis, selbst dann nicht, wenn die Frauen über einen sehr langen Zeitraum Hormone zu sich nahmen oder der Einnahmebeginn nach der Veröffentlichung der WHI-Studie datierte. Wenn es zu einem Gespräch diesbezüglich kam, wurde offensichtlich vielfach die Frage nach der Einnahmedauer seitens des Arztes/ der Ärztin offen gelassen bzw. als von der Frau selbst einzuschätzen dargestellt.
• Wenn die interviewten Frauen überhaupt davon berichteten, Informationen oder deutliche Warnhinweise bezüglich der Hormontherapie aufgrund Gespräche mit ihren Ärzten oder Ärztinnen erhalten zu haben, dann zumeist nur aufgrund der Eigeninitiative der Frauen. Dabei bildeten die Ärzte und Ärztinnen anscheinend eine große Ausnahme, die den Frauen ausdrücklich dazu rieten, die Hormoneinnahme aufgrund der neuen Erkenntnisse in Frage zu stellen oder gar zu beenden. Ärztliche Empfehlungen zur Umsetzung solcher Vorhaben erhielten die Frauen nach eigenen Angaben aber nur in Ausnahmefällen.
• Weit verbreitet war anscheinend der ärztliche Hinweis, dass die Ergebnisse der bekannten WHI-Studie (Women's Health Initiative Study, in der unter bestimmten Bedingungen eine erhöhte Zahl von Brustkrebserkrankungen gefunden wurde) eine Frage der Auslegung seien, wohin gegen ihre Behandlung auf die Bedarfe der Frauen individuell angepasst sei.
Die unter der Leitung von Professor Norbert Schmacke von der Arbeits- und Koordinierungsstelle Gesundheitsversorgungsforschung, Professorin Petra Kolip und Nicole Höfling-Engels vom Institut für Public Health und Pflegeforschung entstandene Studie ist im Internet abrufbar:
Abschlussbericht: Interviews mit Frauen unter lang dauernder Einnahme weiblicher Hormone in und nach den Wechseljahren
Gerd Marstedt, 12.4.2007
Der Frauenanteil unter den Ärzten steigt: Ist dadurch die "sprechende Medizin" im Kommen?
 Wie das Deutsche Ärzteblatt unter Berufung auf neuere Berechnungen der Bundesärztekammer jetzt mitteilte, steigt die Zahl der Ärztinnen unter den Berufsanfängern weiter an, während die Zahl der männlichen Ärzte weiter rückläufig ist. Rund 56 Prozent betrug der Frauenanteil im Jahre 2006 unter den Erstmeldungen bei den Ärztekammern. Darüber hinaus stieg der Anteil der Frauen unter den Studierenden im Zeitraum 1994 bis 2004 von 46 Prozent auf 59 Prozent. Seit 2002 überwiegen die weiblichen Studierenden im Fach der Humanmedizin. Für die nächsten Jahre ist absehbar, dass eine große Zahl von zumeist männlichen Ärzten in den Ruhestand geht und dafür Ärztinnen nachrücken.
Wie das Deutsche Ärzteblatt unter Berufung auf neuere Berechnungen der Bundesärztekammer jetzt mitteilte, steigt die Zahl der Ärztinnen unter den Berufsanfängern weiter an, während die Zahl der männlichen Ärzte weiter rückläufig ist. Rund 56 Prozent betrug der Frauenanteil im Jahre 2006 unter den Erstmeldungen bei den Ärztekammern. Darüber hinaus stieg der Anteil der Frauen unter den Studierenden im Zeitraum 1994 bis 2004 von 46 Prozent auf 59 Prozent. Seit 2002 überwiegen die weiblichen Studierenden im Fach der Humanmedizin. Für die nächsten Jahre ist absehbar, dass eine große Zahl von zumeist männlichen Ärzten in den Ruhestand geht und dafür Ärztinnen nachrücken.
Damit verstärkt sich, wie das Ärzteblatt schreibt, die Tendenz zur "Feminisierung" der medizinischen Profession, auch wenn bei den berufstätigen Ärzten im ambulanten Bereich aktuell noch mehr Männer als Frauen tätig sind. (Ärztestatistik: Berufsanfänger - Mehr als die Hälfte sind Ärztinnen)
Schon in wenigen Jahren dürften jedoch Frauen bei berufstätigen und niedergelassenen Ärzten in der Mehrheit sein. Die steigende Zahl von Ärztinnen ist deshalb von Bedeutung, weil eine Reihe von Studien festgestellt hat, dass Frauen im Arztberuf ein anderes Verhalten gegenüber Patienten an den Tag legen als ihre männlichen Kollegen: Sie sind kommunikativer, wenden mehr Zeit auf für den einzelnen Patienten und berücksichtigen auch die psychosozialen Hintergründe der Krankheit stärker.
So hat unlängst eine Studie der Universität Witten/Herdecke und der Unternehmensberatung "Noheto" über 200 Allgemeinmediziner, Praktiker und Internisten über ihr Verhalten in der Sprechstunde befragt. Dabei zeigten sich überraschende Unterschiede zwischen Ärzten und Ärztinnen: Die Zahl der Patientengespräche liegt bei Ärztinnen um etwa 20 Prozent niedriger als bei Ärzten, wodurch für den einzelnen Patienten mehr Zeit zur Verfügung steht. Pro Tag behandelt eine Hausärztin im Durchschnitt nur 48 Patienten. Ärztinnen legen darüber hinaus größeren Wert darauf, sich auf Patienten einzulassen und deren Anliegen zu verstehen. Im Gespräch hören sie öfter mit, wie die aktuelle Bedürfnislage oder Lebenssituation des Patienten beschaffen ist und reagieren darauf mit Einfühlungsvermögen. vgl. Pressemitteilung der Universität Witten/Herdecke: Die Zukunft der Medizin ist weiblich
Eine systematische Bilanz von 23 schon veröffentlichten Studien zum Kommunikationsverhalten männlicher und weiblicher Ärzte hat schon vor einiger Zeit ähnliche Befunde verdeutlicht. Wissenschaftler aus Boston und Baltimore (USA) hatten dort aufgrund der vorliegenden Forschungsergebnisse herausgefunden: Ärztinnen wenden für das Gespräch mit ihren Patienten mehr Zeit auf (ca. 10 Prozent längere Gespräche), sprechen mehr über seelische Hintergründe der Beschwerden, stellten ihren Patienten mehr Fragen zu ihren Bedürfnissen und Motiven und beziehen Patienten auch stärker in die Therapieentscheidung ein. Sie sind im Gespräch emotionaler und unter dem Strich sehr viel stärker patienten-zentriert als ihre männlichen Kollegen. vgl. Physician Gender Effects in Medical Communication - A Meta-analytic Review (JAMA. 2002;288:756-764)
Die Ergebnisse sind insofern von großer Bedeutung, als ein großer Teil der Patienten auch in Deutschland sich mehr "sprechende Medizin" wünscht, d.h. mehr Zeit und Gelegenheit in der ärztlichen Sprechstunde auch für eine Kommunikation über psychosoziale Hintergründe (Familie, Beruf) von Beschwerden. (vgl. etwa: Gesundheitsmonitor Newsletter "Qualität in der ambulanten Versorgung - die Sicht der Patienten"). Man schätzt, dass bei etwa 30-40% der Patienten beim Allgemein- oder Hausarzt psychische und soziale Probleme Anlass für den Arztbesuch sind. Von daher könnten Patientenbedürfnisse zukünftig eine stärkere Berücksichtigung erfahren durch den steigenden Anteil von Ärztinnen, die stärker auf solche Motive eingehen.
Gerd Marstedt, 15.3.2007
Chemotherapie am Lebensende: Krebspatienten erfahren über ihre Krankheit mehr von Mitpatienten als von ihrem Arzt
 Warum wird bei einer Vielzahl von aussichtslos an Krebs erkrankten Patienten noch in den letzten Wochen vor dem Tod so oft eine Chemotherapie durchgeführt, eine Therapie also, die das Leben um eine sehr kurze Zeitspanne (vielleicht) verlängert, dies jedoch zum Preis einer massiv schlechteren Lebensqualität? Bestehen Patienten so stark darauf, weil es ihre letzte Hoffnung ist oder drängen Ärzte dies Patienten eher auf, ohne sie hinreichend aufzuklären über die auf sie zukommenden erheblichen Beeinträchtigungen? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam am "Massey Cancer Center of Virginia" in Richmond USA jetzt anhand einer Auswertung schon veröffentlichter Studien nachgegangen.
Warum wird bei einer Vielzahl von aussichtslos an Krebs erkrankten Patienten noch in den letzten Wochen vor dem Tod so oft eine Chemotherapie durchgeführt, eine Therapie also, die das Leben um eine sehr kurze Zeitspanne (vielleicht) verlängert, dies jedoch zum Preis einer massiv schlechteren Lebensqualität? Bestehen Patienten so stark darauf, weil es ihre letzte Hoffnung ist oder drängen Ärzte dies Patienten eher auf, ohne sie hinreichend aufzuklären über die auf sie zukommenden erheblichen Beeinträchtigungen? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam am "Massey Cancer Center of Virginia" in Richmond USA jetzt anhand einer Auswertung schon veröffentlichter Studien nachgegangen.
Sie fanden über 50 Artikel, die über einen Zeitraum von 20 Jahren weltweit veröffentlicht waren. Ein vorläufiges erstes Fazit der Wissenschaftler heißt: "Der Mangel an Entscheidungshilfen für Patienten und fundierte Informationen über Vor- und Nachteile, über Chancen und Nebenwirkungen der Therapie trägt mit dazu bei, dass Patienten noch sehr kurz vor ihrem absehbaren Lebensende sich für überaus aggressive Therapien entscheiden." Sie betonen jedoch auch, dass in Anbetracht des Forschungsstandes nicht vorhersehbar ist, ob Patienten sich gänzlich anders entscheiden würden, wenn solche Patienteninformation vorlägen.
Eine Studie ihrer Auswertung hat gezeigt, das bis zu 34% der Krebskranken noch in den letzten zwei Wochen ihres Lebens chemotherapeutisch behandelt werden. Patient ist jedoch nicht Patient. Man fand auch heraus, dass einige Patienten sogar für eine Lebensverlängerung von nur einer Woche die Qualen der Therapie auf sich nehmen würden, während andere selbst bei einer in Aussicht gestellten Lebensverlängerung um zwei Jahre dazu um keinen Preis bereit wären. Insofern lässt sich die Ursache der zuletzt vermehrt eingesetzten Therapie auch bei aussichtslosen Krebserkrankungen nicht einseitig Ärzten oder Patienten zuweisen, es ist die derzeit unbefriedigende Arzt-Patient-Kommunikation und der Mangel an anderweitiger Patienteninformation.
Eines der überraschendsten Ergebnisse der Literaturstudie war nach Auffassung der Forscher, dass Patienten über den Fortgang ihrer Krankheit und ihre weitere Lebenserwartung sehr viel mehr von anderen Patienten im Warteraum der Klinik erfahren als von ihrem Onkologen. Dies fand eine Studie heraus, in der 35 an Lungenkrebs erkrankte Patienten gefragt wurden, woher sie am meisten über ihre Erkrankung erfahren haben. Es besteht ein massives Kommunikationsdefizit, stellt Dr. Matsuyama, einer der Autoren der Studie fest: "Ärzte haben eine verständliche Scheu, über den absehbaren Tod eines Patienten mit diesem zu sprechen und Patienten möchten dies nicht immer hören." So fanden zwei andere Studien unabhängig voneinander heraus, dass etwa ein Drittel von Lungenkrebspatienten annahm, dass die Chemotherapie zur "Heilung" des Krebses durchgeführt würde.
Ärzte überschätzen darüber hinaus die weitere Lebensdauer der von ihnen behandelten Krebspatienten ganz massiv, und zwar im Schnitt um etwa das Fünffache, auch dies geht aus einer Untersuchung hervor, während gleichzeitig nur etwa ein Drittel der Ärzte den Patienten eine zeitliche Prognose stellt, selbst, wenn diese darum bitten. Es scheint jedoch so zu sein, das die große Mehrzahl der Krebspatienten tatsächlich in dieser Hinsicht ein offenes Wort hören möchten: In einer Untersuchung mit 126 Patienten gaben über 90% an, sie möchten eine realistische Einschätzung von ihrem Arzt bekommen.
Solche Entscheidungshilfen und ehrliche Patienteninformationen haben einen deutlichen Einfluss auf die Therapieentscheidung. So zeigte sich, dass bei zwei Gruppen mit vergleichbarem Krankheitsbild und Krankheitsfortschritt in der einen Gruppe mit einer individuellen Prognose und Information über schädliche Nebenwirkungen der Therapie sich nur knapp 60% für eine Chemotherapie entschieden, während es in der zweiten Gruppe ohne solche Information fast 90% waren. "Allerdings," so betont Dr. Matsuyama , müssen Ärzte sich die Mühe machen herauszufinden, wie viel Information und welche Information Patienten tatsächlich wünschen.
Eine andere Wissenschaftlerin, Craig C. Earle, MD, MSc, Associate Professor of Medicine at Harvard Medical School, rät Onkologen: "Patienten können mit Unsicherheit durchaus umgehen. Machen Sie eine grobe Schätzung der Lebenserwartung, dies ist für Patienten überaus wichtig, um ihre Lebensplanung in Einklang mit eigenen Wünschen und Vorlieben zu bringen. Eine zu vage oder zu optimistische Prognose kann Patienten davon abhalten, ihr Lebensende realistisch zu planen. So mancher würde, wenn er die Wahrheit wüsste, wahrscheinlich eher einen letzten lustbetonten und persönlich bedeutungsvollen 'Trip' machen als sich für die Qual einer Chemotherapie entscheiden."
Zum Artikel der Forschergruppe "Matsuyama R, Reddy S, Smith TJ.: Why do patients choose chemotherapy near the end of life? A review of the perspective of those facing death from cancer."
• gibt es kostenlos leider nur ein Abstract in PubMed.
• In einem Aufsatz in der Zeitschrift oncology-times (www.oncology-times.com, No. 17, Sept. 10, 2006) sind allerdings alle Ergebnisse sehr ausführlich beschrieben: Charlene Laino: Near-Death Patients Often Accept Chemotherapy for Small Gains
Gerd Marstedt, 12.1.2007
Mangelnde ärztliche Kommunikation über Kosten und Einsatz neuer Arzneimittel in den USA
 Mit einem aufwändigen Design quantitativer und qualitativer Befragungen von Ärzten und Patienten und Mitschnitten von Behandlungsgesprächen untersuchte eine Gruppe von kalifornischen Wissenschaftlern (Tarn et al.) im Jahre 1999 die Kommunikation der verordnenden Ärzte über die Kosten und die Gründe des Einsatzes neuer Arzneimittel.
Mit einem aufwändigen Design quantitativer und qualitativer Befragungen von Ärzten und Patienten und Mitschnitten von Behandlungsgesprächen untersuchte eine Gruppe von kalifornischen Wissenschaftlern (Tarn et al.) im Jahre 1999 die Kommunikation der verordnenden Ärzte über die Kosten und die Gründe des Einsatzes neuer Arzneimittel.
Die in der Novemberausgabe des "American Journal of Managed Care" (12:657-664) veröffentlichten Ergebnisse zeigen erhebliche Kommunikationsdefizite über die Kosten von Medikamenten und ihre Erhältlichkeit:
• Gerade bei einem Drittel der Neuverordnungen sprachen die Ärzte ausdrücklich über einen Aspekt dieses Verordnungswechsels,
• insgesamt sprachen 33 % der Ärzte irgendeinen Kostenaspekt gegenüber den Patienten an,
• 12 % sprachen die Kosten und die Verordnungsfähigkeit durch die Krankenversicherung an,
• 18 % sprachen die Erhältlichkeit des Medikaments an und
• Kostendiskussionen fanden häufiger mit Geringverdienenden als mit Besserverdienenden statt,
• Hausärzte und Internisten sprachen weniger über die Kosten als Kardiologen und
• am wenigsten bei Arzneimittelverordnungen für ältere Patienten.
Hier finden Sie den Aufsatz "Physician Communication About the Cost and Acquisition of Newly Prescribed Medications"
Bernard Braun, 28.11.2006