



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Arzneimittel, Medikamente |
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Alle Artikel aus:
Patienten
Arzneimittel, Medikamente
"Vorsicht Studie" oder oft werden "positive" Ergebnisse durch Anpassung des primären Endpunkts produziert
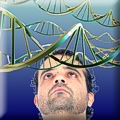 Die häufig als eine Art Schlussakkord beabsichtigte Bemerkung "das zeigt eine Studie" gehört mittlerweile zum Repertoire vieler gesundheitswissenschaftlicher und politischer Diskussionen oder Talkshows, ebenso wie die Gegenwehr in Gestalt des "aber eine andere Studie zeigt doch". Umso wichtiger ist es daher, weder jedem Argument mit dem Prädikat "Studie" zu trauen, dass die Studie korrekt wiedergegeben wird, noch blind studiengläubig zu sein. Auch Studien müssen methodisch und inhaltlich kritisch hinterfragt werden bzw. hinterfragbar sein. Faktenchecks am Folgetag der Debatte sind hilfreich, dürften aber nur von einer Minderheit der Zuhörer/-schauer und dazu überwiegend nur von jenen genutzt werden, die bereits Zweifel haben. Auch Faktenchecks sollten vielleicht einmal ihre quantitative und qualitative Reichweite und Wirksamkeit überprüfen.
Die häufig als eine Art Schlussakkord beabsichtigte Bemerkung "das zeigt eine Studie" gehört mittlerweile zum Repertoire vieler gesundheitswissenschaftlicher und politischer Diskussionen oder Talkshows, ebenso wie die Gegenwehr in Gestalt des "aber eine andere Studie zeigt doch". Umso wichtiger ist es daher, weder jedem Argument mit dem Prädikat "Studie" zu trauen, dass die Studie korrekt wiedergegeben wird, noch blind studiengläubig zu sein. Auch Studien müssen methodisch und inhaltlich kritisch hinterfragt werden bzw. hinterfragbar sein. Faktenchecks am Folgetag der Debatte sind hilfreich, dürften aber nur von einer Minderheit der Zuhörer/-schauer und dazu überwiegend nur von jenen genutzt werden, die bereits Zweifel haben. Auch Faktenchecks sollten vielleicht einmal ihre quantitative und qualitative Reichweite und Wirksamkeit überprüfen.
Wie notwendig dies ist, zeigt eine lange Reihe von vorsätzlich oder fahrlässig verzerrter oder manipulierter Ergebnisse von Studien mit einem auf den ersten Blick wissenschaftlichen Anspruch. Da fehlen z.B. Angaben zu den Interessenkonflikten der Autor:innen; Studien, in denen das als Endpunkt angegebene Ziel (z.B. die Reduktion einer Erkrankung durch das Medikament) nicht erreicht wurde; werden nicht veröffentlicht oder werden selbst in "good journals" nicht angenommen, bei zunächst beeindruckenden relativen Verbesserungen fehlen Angaben zur absoluten Anzahl der dahinter stehenden Studienteilnehmer:innen oder man erfährt nichts über die Anzahl und Art von Studienabbrechern.
Ăśber eine bisher nicht bekannte Variante, Ergebnisse einer ansonsten wissenschaftlichen Studie zu manipulieren, berichtet eine Gruppe von Wissenschaftler:innen jetzt als ein Ergebnis ihrer systematischen Analyse von 755 klinischen Studien zu Krebsmedikamenten, also einer gesundheitlich aber auch kommerziell bedeutsamen Arzneimittelgruppe.
Ihre Ergebnisse sind u.a.:
• 145 (19,2 %) dieser Studien verändern den fĂĽr die Beurteilung der Wirksamkeit und anderer Faktoren elementaren und zu Beginn jeder methodisch korrekten Studie festzulegenden primären Endpunkt nachträglich, d.h. im Lichte von Zwischenergebnissen.
• In ihren Veröffentlichungen gibt es bei 102 (70,3 %) dieser Studien keinen Hinweis auf diese Veränderungen.
• Zu den häufigsten erkennbaren Veränderungen gehört bei 49 Studien die Umwidmung primärer zu sekundären Endpunkte und bei 47 Studien eine neue Definition der primären Endpunkte.
• Obwohl ein Protokoll mit Endpunkten, Methodik etc. der beabsichtigten Studie vor ihrem Beginn zu den Essentials einer methodisch hochwertigen Studie gehören, gab es fĂĽr 473 der 755 Studien kein verfĂĽgbares Protokoll.
• Und honni soit qui mal y pense: Studien mit Veränderungen beim primären Endpunkt enthielten fast doppelt so häufig (odds ratio 1,86) "positive" Ergebnisse wie Studien ohne solche Aenderungen. Dies bedeutet zwar nicht automatisch, dass solche Medikamente unwirksam sind, sondern "nur", dass dies sein könnte oder andere Medikamente, bei denen das Ergebnis nicht durch Endpunktveränderungen mitproduziert wurde, nicht zugelassen werden.
In der Oktober-/Novemberausgabe 2023 des wie gewohnt informativen "Pharma-Briefs" der BUKO Pharma-Kampagne (u.a. Beiträge über verschwiegene Interessenkonflikte bei versteckter Werbung für die Abnehmspritze und die in die Ferne gerückte universelle Gesundheitsversorgung) wird dieses Geschehen so charakterisiert: "Das ist etwa so, wenn bei einem Schießwettbewerb erst geschossen und anschließend die Zielscheibe um den Treffer herum gemalt wird."
Die im Mai 2023 im "JAMA Netw Open" veröffentlichte Studie Incidence of Primary End Point Changes Among Active Cancer Phase 3 Randomized Clinical Trials von Marcus A. Florez, Joseph Abi Jaoude et al. ist komplett kostenlos erhältlich
, 3.12.23
Anwendungsbeobachtungen erhöhen die Arzneimittelausgaben
 Über Anwendungsbeobachtungen von Arzneimitteln, die von einem Hersteller veranlasst werden, haben wir mehrfach kritisch berichtet. Dieser Beitrag aus 2007 hat nach wie vor weitgehend Gültigkeit.
Über Anwendungsbeobachtungen von Arzneimitteln, die von einem Hersteller veranlasst werden, haben wir mehrfach kritisch berichtet. Dieser Beitrag aus 2007 hat nach wie vor weitgehend Gültigkeit.
Anwendungsbeobachtungen (AWB) sind eine Form der nichtinterventionellen Studien, die zumeist vom Hersteller der zu untersuchenden Substanz veranlasst und finanziert werden. Der Lobbyverband der forschenden Parma-Unternehmen bezeichnet AWB auch heute noch als "unverzichtbares Instrument für die Arzneimittelforschung" und ignoriert dabei Studien, wie die von Spelsberg et al. aus dem Jahr 2017. Eine Analyse von 558 AWBs konnte keinen nennenswerten Wissensgewinn für die Arzneimittelsicherheit entdecken; bemerkenswert war auch, dass weniger als 1% der Studien in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurden.
Eine neue Studie hat jetzt die lange gehegte Vermutung bestätigt, dass AWB sich auf das Verschreibungsverhalten der teilnehmenden Ärzte in dem Sinne auswirkt, dass sie das von ihnen in der AWB untersuchte Medikament nach Beendigung der AWB häufiger verschreiben als nicht teilnehmende Ärzte. Da in AWB vorzugsweise hochpreisige Medikamente untersucht werden, folgen daraus höhere Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung. Fehlender Erkenntnisgewinn aber erhöhte Verschreibung unterstreichen die Annahme, dass es sich bei Hersteller-gesponserten AWBs um ein Marketinginstrument handelt und nicht um seriöse wissenschaftliche Forschung.
In dieser Studie verglichen die Autoren das Verschreibungsverhaltens von 2354 Ärzten, die an einer von 24 AWBs teilgenommen hatten, mit 6996 Ärzten ohne Beteiligung an einer AWB. Die Daten wurden vom GKV-Spitzenverband zur Verfügung gestellt, an den jede AWB vor Beginn gemeldet werden muss mit dem Datum von Beginn und Ende, dem Ziel der Studie, den Namen und der lebenslangen Arztnummer der teilnehmenden Ärzte, dem Studienplan, der Vergütung der Ärzte und einem Vertragsmuster. Das arztindividuelle Verschreibungsverhalten wurde über die Arzneimittel-Schnellinformation für Vertragsärztinnen und -ärzte des GKV-Spitzenverbandes bestimmt.
Primärer Endpunkt war der Vergleich der Verschreibungen von AWB-ÄrztInnen mit den Verschreibungen der Vergleichsgruppe 1 Jahr vor, während und 1 Jahr nach der AWB.
Sekundärer Endpunkt war der Anteil der Verschreibungen für das Studienmedikament im Vergleich zu alternativen Medikamenten und der Umsatz, der durch die Verschreibungen generiert wurde.
In den 24 AWBs wurden am häufigsten Krebsmedikamente und Medikamente zur Beeinflussung des Immunsystems sowie Medikamente bei neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Ärzte, die an AWBs teilnahmen, verschrieben 8 bzw. 7% mehr von dem untersuchten Medikament während und ein Jahr nach Beendigung der Studie. Andere Medikamente für dieselbe Krankheit verschrieben sie seltener.
Die Autoren merken an, dass AWBs wenig reguliert sind, nur gemeldet aber nicht genehmigt werden müssen, keine Einverständniserklärung der einbezogenen Patienten erfordern aber die Behandlung der Patienten verändern. Erlaubt sollten nur solche Studien ein, die von der Zulassungsbehörde veranlasst werden bzw. über ein wissenschaftlich solides Design verfügen, das geeignet ist, Daten zu erheben, die für Patienten und ihre Sicherheit relevant sind.
Koch C, Schleeff J, Techen F, Wollschläger D, Schott G, Kölbel R, et al. Impact of physicians' participation in non-interventional post-marketing studies on their prescription habits: A retrospective 2-armed cohort study in Germany. PLOS Medicine. 2020;17(6):e1003151. Link
Spelsberg A, Prugger C, Doshi P, Ostrowski K, Witte T, Hüsgen D, et al. Contribution of industry funded post-marketing studies to drug safety: survey of notifications submitted to regulatory agencies. BMJ. 2017;356. Link
David Klemperer, 29.6.20
Hohe Preise für 65 Krebsmedikamente sind nicht durch ihren Nutzen gerechtfertigt. Daten aus UK, USA, D, F und CH
 Folgt man den Begründungen der Hersteller von Medikamenten, die pro Dosis, Jahr oder gesamter Behandlung bis zu sechs- oder siebenstellige Summen kosten, sind diese Preise durch den damit ermöglichten Nutzen gerechtfertigt. Ob dies für die besonders teuren Krebs-Medikamente zutrifft, untersuchten jetzt Wissenschaftler*innen der Universität in Zürich und der Harvard Medical School mittels einer "cost-benefit"-Analyse für 65 zur Behandlung von festen Tumoren (Leber-, Lungen- oder Brustkrebs und verschiedene Arten von Blutkrebs in der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich und den USA neu auf den Markt gebrachten Medikamente.
Folgt man den Begründungen der Hersteller von Medikamenten, die pro Dosis, Jahr oder gesamter Behandlung bis zu sechs- oder siebenstellige Summen kosten, sind diese Preise durch den damit ermöglichten Nutzen gerechtfertigt. Ob dies für die besonders teuren Krebs-Medikamente zutrifft, untersuchten jetzt Wissenschaftler*innen der Universität in Zürich und der Harvard Medical School mittels einer "cost-benefit"-Analyse für 65 zur Behandlung von festen Tumoren (Leber-, Lungen- oder Brustkrebs und verschiedene Arten von Blutkrebs in der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich und den USA neu auf den Markt gebrachten Medikamente.
Sie untersuchten dafür ob und inwieweit die monatlichen Preise für diese Medikamente mit den Ergebnissen zweier wissenschaftlich anerkannten und etablierten Verfahren zur Messung des Nutzens von Krebstherapeutika korrelierten. Bei den Nutzenmessinstrumenten handelt es sich um das "American Society of Clinical Oncology Value Framework" und die "European Society of Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale". Die Frage war, ob die hochpreisigen Krebsmedikamente einen höheren Nutzen haben als solche mit niedrigeren Preisen. Korrelationskoeffizienten (hier der von Spearman's) sind dafür ein relativ grober, aber zur Bestimmung eines statistischen Zusammenhangs durchaus geeigneter Indikator.
Die Ergebnisse sind eindeutig und differenziert:
• Laut der Hauptautorin Kerstin Vokinger: "Our study clearly shows that, in general, for Switzerland, Germany, England and the United States, there is no association between clinical benefit of a cancer drugs and their prices,"
• Eines der Nutzenmessverfahren zeigte zwar eine positive Korrelation zwischen höheren Preisen und höherem Nutzen, dies gilt allerdings nur für Frankreich.
Das letzte Ergebnis weist auch auf ein weiteres Ergebnis dieser Studie hin, dass es nämlich auch bei dieser Medikamentengruppe erhebliche Preisunterschiede zwischen untersuchten Ländern gibt. Aufgrund des nahezu nicht regulierten, d.h. freien Marktes in den USA waren dort auch die Preise dieser Medikamente rund doppelt so hoch wie den europäischen Vergleichsländern. Aber auch unter denen gibt es ein deutliches Preisgefälle von der Schweiz bis zu Deutschland und Frankreich.
Der Aufsatz Prices and clinical benefit of cancer drugs in the USA and Europe: a cost-benefit analysis von Kerstin N Vokinger, Thomas J Hwang, Thomas Grischott, Sophie Reichert, Ariadna Tibau, Thomas Rosemann und Aaron S Kesselheim ist am 1. Mai 2020 in der renommierten Fachzeitschrift "The Lancet Oncology" (21 (5): 664-670) veröffentlicht. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Auch vom möglichen Ersatzargument für die hohen Preise, den riesigen Forschungs- und Produktionskosten, bleibt bei genauerer Untersuchung ebenfalls nicht viel übrig.
Bernard Braun, 11.5.20
Die pharmazeutische Industrie in den USA - kritische Analysen
 Eine Schwerpunktausgabe des Journal of the American Medical Association vom 3. März 2020 befasst sich in mehreren Studien, Editorials und Kommentaren mit Strategien der Gewinnmaximierung und politischen Einflussnahme der pharmazeutische Industrie in den USA.
Eine Schwerpunktausgabe des Journal of the American Medical Association vom 3. März 2020 befasst sich in mehreren Studien, Editorials und Kommentaren mit Strategien der Gewinnmaximierung und politischen Einflussnahme der pharmazeutische Industrie in den USA.
Einige Kernergebnisse:
Pharmazeutische Firmen
• erwirtschaften höchste Profite
• erhöhen die Preise für ihre Produkte unaufhörlich
• übertreiben die Entwicklungskosten von Medikamenten zur Rechtfertigung überhöhter Preise
• nehmen gezielt Einfluss auf Politiker und Parteien.
Die Analyse von Ledley et al. zeigt, dass große pharmazeutische Unternehmen deutlich profitabler sind als große nicht pharmazeutische Unternehmen. Sie verglichen unterschiedliche Maße der Profitabilität von 35 großen pharmazeutischen Unternehmen mit 357 der größten nicht-pharmazeutischen börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen aus dem S&P 500 Index. Im Zeitraum 2000 bis 2018 war der Nettogewinn (net income margin) der pharmazeutischen Unternehmen mit 13,8% fast doppelt so hoch im Vergleich zum Nettogewinn der nicht-pharmazeutischen Unternehmen mit 7,7%.
Hernandez et al. untersuchten, in welchem Ausmaß die Hersteller von Medikamenten in den USA die Preise für ihre Produkte im Zeitraum von 2007 bis 2018 erhöhten. Sie unterschieden zwischen dem Listenpreis, den der Hersteller für Großhändler und Direktabnehmer festsetzt und dem Nettopreis, in den Rabatte und andere Formen von Preisnachlässen eingehen. Untersucht wurden 602 Markenprodukte, die unterschiedlichen Indikationsgruppen zugeordnet wurden. Die Listenpreise stiegen insgesamt um 159%, entsprechend 9,1% pro Jahr. Die Nettopreise stiegen um 60%, entsprechend 4,5% pro Jahr. Multiple Sklerose-Medikamente verteuerten die Hersteller am meisten (Listenpreis 439%, Nettopreis 157%), gefolgt von Blutfett-senkenden Medikamenten (Listenpreis 278%, Nettopreis 95%) und Insulinen (Listenpreis 278%%, Nettopreis 51%). In einem Kommentar merken Deb und Curfman an, dass die Firmen die Erhöhung von Listenpreisen mit gleichzeitiger Rabattierung der Abwehr von Konkurrenzprodukten und der günstigen Positionierung des eigene Produkts dient. Patienten erhalten keine Ermäßigungen, insbesondere müssten Nichtversicherte sowie Versicherte mit hohem Selbstbehalt Listenpreise bezahlen. Sie weisen auch auf eine Befragung der Kaiser Family Foundation hin, der zufolge viele Patienten Schwierigkeiten haben, die Kosten für Medikamente aufzubringen - 35% sind es unter denen, die mehr als 3 Medikamente einnehmen müssen, bei den über 65-Jährigen mit subjektiv schlechter Gesundheit sind es 49%.
Wouters et al. berechneten die Kosten, die für ein neues Medikament bis zur Marktzulassung in den USA entstehen. Dafür werteten sie 63 Substanzen von 47 Firmen aus, für die öffentlich zugängliche Daten vorlagen. Die Zulassung erfolgte zwischen 2009 und 2018. Die Kosten für Forschung und Entwicklung betrugen im Durchschnitt 1,4 Mrd. Dollar, im Median 985 Mio. Dollar. Die Berechnungen unterscheiden sich für unterschiedliche therapeutische Bereiche und sind für Krebsmedikamente am mit durchschnittlichen Kosten höchsten. Eine von der Industrie häufig genannte Zahl liegt mit 2,8 Mrd. Dollar (in 2018 US Dollar) wesentlich höher, sie beruht auf einer 2013 veröffentlichten Studie eines Industrie-nahen Institutes, das die Berechnungen mit dem Argument der Vertraulichkeit von Daten nicht offen legte.
In einer weiteren Studie untersuchten Wouters et al. die Frage, wie viel Geld die pharmazeutische Industrie in den USA ausgab, um Einfluss auf Wahlen und Gesetzgebung auf Bundesebene und auf Bundesstaatenebene auszuüben. Grundlage waren Daten für die Jahre von 1999 bis 2018, die vom Center for Responsive Politics und vom National Institute on Money in Politics erhältlich waren. Auf Bundesebene betrugen die Zahlungen von 1999 bis 2018 insgesamt 4,7 Mrd. Dollar, entsprechend einem Jahresdurchschnitt von 233 Mio. Dollar. Im Vergleich zu den Lobby-Bemühungen aller anderen Industriezweigen sind dies die höchsten Geldbeträge. Die Pharmaceutical Research and Manufacturers of America waren der größte Einzelgeldgeber. Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen und für die Kongresswahlen sowie Nationale Parteikomitees erhielten insgesamt 414 Mio. Dollar, davon Präsidentschaftskandidaten 22 Mio. Dollar und Kongresskandidaten 214 Mio. Dollar. Besonders bedacht wurden Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses, die mit der der Gesundheitsgesetzgebung befasst sind. Auf der Ebene der Bundesstaaten zahlte die Industrie 877 Mio. Dollar an Kandidaten und Parteikomitees. Die Zahlungen stiegen sprunghaft an, wenn Gesetzgebung zur Regulation der Medikamentenpreise anstand. In diesem Zusammenhang ist es wenig verwunderlich, wie Deb und Curman. anmerken, dass Gesetzesvorhaben, die zu Preissenkungen bei Medikamenten führen würden, von Mitch McConnell, dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, als "sozialistische Preiskontrollen" abgekanzelt werden.
Ledley, F. D., McCoy, S. S., Vaughan, G., & Cleary, E. G. (2020). Profitability of Large Pharmaceutical Companies Compared With Other Large Public Companies. JAMA, 323(9), 834-843. doi:10.1001/jama.2020.0442 Link
Wouters, O. J., McKee, M., & Luyten, J. (2020). Estimated Research and Development Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018. JAMA, 323(9), 844-853. doi:10.1001/jama.2020.1166 Link
Wouters, O. J. (2020). Lobbying Expenditures and Campaign Contributions by the Pharmaceutical and Health Product Industry in the United States, 1999-2018. JAMA Internal Medicine. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0146 Link
Hernandez, I., San-Juan-Rodriguez, A., Good, C. B., & Gellad, W. F. (2020). Changes in List Prices, Net Prices, and Discounts for Branded Drugs in the US, 2007-2018. JAMA, 323(9), 854-862. doi:10.1001/jama.2020.1012 Link
Deb, C., & Curfman, G. (2020). Relentless Prescription Drug Price Increases. JAMA, 323(9), 826-828. doi:10.1001/jama.2020.0359 Link
David Klemperer, 5.3.20
Wie die Familie Sackler trotz der Mitverantwortung für 300.000 Tote noch lange als Kultursponsor und Philantrop geschätzt wurde.
 Die selbst in der Vergangenheit extrem medikamenten-und heroinabhängige Künstlerin Nan Goldin und einige andere KünstlerInnen machen seit Anfang 2019 zumindest auf den Feuilletonseiten dadurch Schlagzeilen, dass sie Museen und anderen Kunsteinrichtungen (z.B. dem Guggenheim Museum in New York oder der National Portait Gallery in London) mit Boykott drohen, wenn sie nicht auf die Millionen Dollar oder Pfund schwere Förderung durch die Familie Sackler aus den USA verzichten. Diese Familie gehört seit langem zu den weltweit größten und vielfach gewürdigten Sponsoren zahlreicher Museen und Universitätseinrichtungen, sodass es bis heute u.a. einen Sackler-Flügel im Metropolitan Museum of Art in New York, eine Sackler-Bibliothek an der Universität Oxford und ausgerechnet eine Sackler-Medizinfakultät an der Universität Tel Aviv gibt.
Die selbst in der Vergangenheit extrem medikamenten-und heroinabhängige Künstlerin Nan Goldin und einige andere KünstlerInnen machen seit Anfang 2019 zumindest auf den Feuilletonseiten dadurch Schlagzeilen, dass sie Museen und anderen Kunsteinrichtungen (z.B. dem Guggenheim Museum in New York oder der National Portait Gallery in London) mit Boykott drohen, wenn sie nicht auf die Millionen Dollar oder Pfund schwere Förderung durch die Familie Sackler aus den USA verzichten. Diese Familie gehört seit langem zu den weltweit größten und vielfach gewürdigten Sponsoren zahlreicher Museen und Universitätseinrichtungen, sodass es bis heute u.a. einen Sackler-Flügel im Metropolitan Museum of Art in New York, eine Sackler-Bibliothek an der Universität Oxford und ausgerechnet eine Sackler-Medizinfakultät an der Universität Tel Aviv gibt.
Das Geld, das die überwiegend aus Ärzten bestehende Familie verteilte, stammt nicht aus erfolgreicher hausärztlicher Tätigkeit oder vergleichbaren Tätigkeiten, sondern aus den Milliarden-Gewinnen der dieser Familie mehrheitlich gehörenden US-Pharmafirma Purdue Pharma. Auf den ersten Blick würde aber noch nicht die aktuellen Boykotte rechtfertigen.
Diese stützen sich vielmehr darauf, dass diese Firma und persönlich ihre Eigentümer bewusst und zum Teil vorsätzlich die Herstellung und aktive sowie über die Risiken der Verordnung hinwegtäuschende Vermarktung des morphiumähnlichen Schmerzmedikaments Oxycontin zu verantworten haben. Dabei nahmen sie die Abhängigkeit von Millionen von Menschen und den Tod von zig- oder gar hunderttausenden von Menschen billigend in Kauf und verdienten damit Milliarden von US-Dollars.
Die Geschichte dieses Pharmaskandals hat in zweierlei Hinsicht gesundheitspolitischen und -wissenschaftlichen Lehrstückcharakter:
• Egal, ob es um die Herstellung und den Vertrieb verschleißträchtiger Silikon-Brustimplantate oder nebenwirkungsmächtiger Arzneimittel geht, wird die kritische öffentliche Debatte oft durch das Stereotyp des "grundbösen" profitgierigen Unternehmens oder Unternehmers geprägt. Dies ist eine Art Fortsetzung des in den 60-er und 70-er Jahren weit verbreiteten Bildes vom dickbäuchigen, zigarrerauchenden, melonetragenden kurz völlig unsympathischen Kapitalisten. Undenkbar, dass solche "Typen" gleichzeitig kulturfördernde und weltweit angesehene Philantropen sind. Aber genau dies waren im Lichte der Öffentlichkeit die Mitglieder der Familie Sackler trotz aller langsam bekannt gewordenen Details ihrer Unternehmertätigkeit über viele Jahre. Sie passten einfach nicht in das Bild des "bösen" Unternehmens oder Unternehmers, was u.a. dazu beitrug, dass ihr eigentliches Image von niemand aktiv wahrgenommen wurde und fast niemand störte, also nicht zu Boykotten und anderen Maßnahmen führte. Und dies selbst dann als der US-Präsident Trump bereits im August 2017 wegen der u.a. durch Oxycontin in den USA verursachten Opioid-Epidemie den nationalen Notstand ausrief.
• Die Firma steht mittlerweile wegen der Vermarktung ihres Medikaments vielfach vor Gericht und muss in den USA Strafen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollars bezahlen. Für die Debatte über die Kommunikation gesundheitlich riskanter Mittel und Maßnahmen stellt sich aber die Frage warum es erst 10 bis 20 Jahren nach den ersten wissenschaftlichen Aufsätzen zu den Risiken von Oyxcontin und vergleichbaren Medikamenten (vgl. unter zahlreichen anderen den 2009 erschienenen Aufsatz The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy von Ard van Zee in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" (Februar 2009; 99(2): 221-227 und die dort zitierten weiteren Veröffentlichungen seit Ende der 1990er Jahre) und komplett kostenlos erhältlich), fast zwei Jahre nach Trumps Notstandserklärung (welche wirksamen Maßnahmen diese nach sich zog steht auf einem anderen Blatt), nach schätzungsweise 300.000 durch dieses Medikament mitbewirkten Toten in den USA und vollständiger und verständlicher journalistischer Darstellungen der durch Oxycontin verursachten und befeuerten Gesundheitsgefahren weltweit zu zivilgesellschaftlichen Reaktionen wie den eingangs geschilderten gegen die Hauptverantwortlichen kam. Verglichen mit dem bei wesentlich geringeren gesundheitsbezogenen unerwünschten Ereignissen in Sekundenschnelle aufziehenden Shitstorm in den so genannten sozialen Medien, handelt es sich, wenn es um die Sacklers und Oxycontin geht, höchstens um ein laues Lüftchen. Hinzu kommt in den Worten der Künstlerin Nan Goldin noch das: "Ich würde diese Nachricht (von der ersten kostenträchtigen Verurteilung im US-Bundesstaat Oklahoma - bb) begrüßen, wenn das Geld als Reparationen an die Menschen ginge, deren Leben die Sackler-Familie zerstört hat. 300.000 Menschen in diesem Land sind tot. (Die Familie) sollte in irgendeiner Weise für den Schaden aufkommen, den sie angerichtet hat." Trotz aller Opioid-Krisendebatte gibt es vor allem in den USA auch noch kaum regulative Maßnahmen gegen eine mögliche Wiederholung einer derartig "gelungenen" Vermarktung eines Medikaments.
Wer genauer wissen will, um was es geht und was einer kritischen Öffentlichkeit spätestens seit Herbst 2017 zugänglich war, kann dies mit zwei komplett kostenlos erhältlichen Texten tun.
Dies ist erstens der am 30. Oktober 2017 in der us-amerikanischen Zeitschrift "New Yorker" veröffentlichte brilliant recherchierte und sehr gut wie verständlich verfasste und an keiner Stelle widersprochene Essay The Family That Built an Empire of Pain. The Sackler dynasty's ruthless marketing of painkillers has generated billions of dollars—and millions of addicts. von Patrick Radden Keefe.
Zweitens ist dies der am 8. November 2018 in der britischen Tageszeitung "The Guardian" veröffentlichte Artikel The making of an opioid epidemic. When high doses of painkillers led to widespread addiction, it was called one of the biggest mistakes in modern medicine. But this was no accident. von Chris McGreal. Wer es lieber hören will, kann dies auch mit einem 27-Minuten-Podcast tun.
Bernard Braun, 29.3.19
"Was kümmern uns Antibiotikaeinnahme und resistente Bakterien in Rufisque (Senegal)?": Warum vielleicht doch!
 Auch wenn es kaum einen europäischen Leser geben dürfte, dem der Ort um den es in einer Ende 2018 veröffentlichten Studie geht bekannt ist, gehört das Wissen seiner EinwohnerInnen über Antibiotika bzw. das Wissen über den richtigen Umgang mit Antibiotika unbedingt zu "unserem" Wissen über die Triebkräfte der Globalisierung von Gesundheitsrisiken und der Notwendigkeit ihrer globalen Prävention.
Auch wenn es kaum einen europäischen Leser geben dürfte, dem der Ort um den es in einer Ende 2018 veröffentlichten Studie geht bekannt ist, gehört das Wissen seiner EinwohnerInnen über Antibiotika bzw. das Wissen über den richtigen Umgang mit Antibiotika unbedingt zu "unserem" Wissen über die Triebkräfte der Globalisierung von Gesundheitsrisiken und der Notwendigkeit ihrer globalen Prävention.
In einer mit EinwohnerInnen der Stadt Rufisque im Senegal durchgeführten Studie ging es einer Gruppe senegalesischer Mediziner und GesundheitswissenschaftlerInnen um deren Wissen über die Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit der Einnahme von Antibiotika überhaupt und die Art und Weise der Einnahme und das Wissen darüber, dass die gesundheitlich nicht notwendige oder z.B. eine zu kurze Einnahme von Antibiotika zu Resistenzbildungen von Bakterien gegenüber immer mehr Antibiotika führt und sich auch derartige Bakterien dank der weltweiten Mobilität länder- und kontinentübergreifend verbreiten können. Das aus der Chaostheorie bekannte Bild, dass und wie sich ein umfallender Reissack in China auf wesentlich bedeutendere Ereignisse in Europa auswirken kann, gilt also im übertragenen Sinn auch für durch irrationale Einnahme von Antibiotika verursachte resistente Bakterien.
Die Bildung von Resistenzen findet weltweit statt, also auch unter bestimmten Bedingungen im Senegal. Dass diese Bedingungen existieren zeigen die Ergebnisse einer mündlichen Befragung von 400 in der senegalesischen Stadt wohnenden und für die dortige erwachsene Bevölkerung repräsentativen Personen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören die folgenden:
• Die meisten Befragten, zwischen 64,4% und 72,3%, glaubten Antibiotika würden gegen eine Reihe von Erkrankungen der oberen Atemwege helfen, obwohl die Mehrzahl dieser Erkrankungen auch im Senegal Viruserkrankungen sind gegen die Antibiotika wirkungslos sind.
• 42,8% der Befragten waren sich sicher, dass die Antibiotikatherapie sofort gestoppt werden könne, wenn die Symptome verschwunden sind, was u.a. die Bildung von Resistenzen fördert.
• Nur 8,8% und 41,8% der Befragten wussten von der präventiven Bedeutung von Händewaschen und Impfen gegen eine Reihe von Erkrankungen, die unsinnigerweise mit Antibiotika behandelt werden.
• Insgesamt hatten nur 7% aller Befragten ein insgesamt gutes Wissen über die Bedeutung und richtige Einnahme von Antibiotika sowie das Risiko der bakteriellen Resistenzen, und zwar unabhängig von soziodemografischen Merkmalen. Dies schloss nicht aus, dass mehr als 7% der Befragten bei Einzelaspekten über mehr Wissen verfügten.
• Ähnlich wie in Befragungsstudien in europäischen Ländern, dachten auch 78,3% der im Senegal Befragten, dass die Bevölkerung zu viele Antibiotika verordnet bekommt und einnimmt.
• Zwischen 28% und 53,5% der Befragten fühlten sich auch nicht genug während Arztbesuchen informiert. 45% dachten außerdem, dass sie keine große Rolle beim Kampf gegen resistente Bakterien spielten.
Daran durch geeignete Public Health-Aktionen sowohl im Senegal als auch nn vielen vergleichbaren Regionen etwas zu ändern und im Sinne der dort lebenden Menschen auch bei uns, gehört dazu, wenn es um die Zusammenhänge von Globalisierung und Gesundheit geht.
Die Studie Assessment of General Public's Knowledge and Opinions towards Antibiotic Use and Bacterial Resistance: A Cross-Sectional Study in an Urban Setting, Rufisque, Senegal von Oumar Bassoum et al. ist im September 2018 in der Zeitschrift "Pharmacy" (6(4), 103) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.2.19
Massive Interessenkonflikte bei Leitlinienautoren in den USA
 Interessenkonflikte bei Autoren von Leitlinien gefährden die Objektivität und Glaubwürdigkeit von Leitlinien (wir berichteten z.B. Link.
Interessenkonflikte bei Autoren von Leitlinien gefährden die Objektivität und Glaubwürdigkeit von Leitlinien (wir berichteten z.B. Link.
Khan et al. untersuchten jetzt, wie häufig in den USA Interessenkonflikte bei Autoren vorliegen, die an der Entwicklung von Leitlinien für umsatzstarke Arzneimitteln beteiligt waren. Darüber hinaus überprüften sie die Einhaltung von 3 der 8 Standards des Institute of Medicine zur Entwicklung von glaubwürdigen Leitlinien:
1. Schriftliche Offenlegung aller potentiellen Interessenkonflikte
2. Leitlinienengruppen-Vorsitzender ohne Interessenkonflikte
3. Mehrheit der Mitglieder der Leitliniengruppe ohne Interessenkonflikte
Im ersten Schritt identifizierten sie die 10 umsatzstärksten Medikamente des Jahres 2016 in den USA und im zweiten Schritt die dazugehörigen Leitlinien amerikanischer Fachgesellschaften aus den Jahren 2013 bis 2017. Dann überprüften sie die Zahlungen der Industrie an Leitlinien-Autoren. Eine Verpflichtung zur Meldung besteht für die pharmazeutische Industrie durch den Physician Payment Sunshine Act (wir berichteten, siehe z.B. Link. Diese Zahlungen sind öffentlich einsehbar in der Open Payment-Website der U.S. Centers for Medicare &Medicaid Services.
18 Leitlinien mit Bezug zu den 10 umsatzstarke Medikamenten wurden gefunden. An diesen Leitlinien waren insgesamt 160 US-amerikanische Autoren beteiligt. 79 Autoren (49,4%) gaben an, eine Zahlung erhalten zu haben, 50 (31%) von ihnen von Firmen, die eines der 10 umsatzstärksten Medikamente herstellt. Weitere 41 Autoren (25,6%) hatten Zahlungen von einer dieser Firmen erhalten aber nicht angegeben. Insgesamt lag bei 91 Autoren (56%) ein finanzieller Interessenkonflikt vor.
In keiner der 18 Leitlinien wurde der Standard der schriftlichen Offenlegung aller Interessenkonflikte erfüllt, nur 4 Leitliniengruppen hatten einen Vorsitzenden ohne finanziellen Interessenkonflikt und in nur 8 Leitliniengruppen war der Anteil der Mitglieder mit Interessenkonflikt auf weniger als 50% beschränkt.
Im Ergebnis hatte in den USA die Mehrzahl der Autoren von Leitlinien, die sich mit den umsatzstärksten Medikamenten befassten, finanzielle Interessenkonflikte, die sie teils nicht angaben. Darüber hinaus verfehlten die Leitliniengruppen die Erfüllung der Standards des Institute of Medicine für die Glaubwürdigkeit von Leitlinien beträchtlich.
Trotz vorbildlicher Offenlegung finanzieller Interessenkonflikte liegt die Entwicklung von Leitlinien in den USA offensichtlich darnieder.
Anzumerken ist hier, dass der Entwicklung von Leitlinien in Deutschland durch die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) eine stringente Methodik zur Minimierung von Bias durch Interessenkonflikte zugrunde liegt, über die in Kürze berichtet werden soll.
Khan R, Scaffidi MA, Rumman A, Grindal AW, Plener IS, Grover SC: Prevalence of financial conflicts of interest among authors of clinical guidelines related to high-revenue medications. JAMA Internal Medicine 2018. Abstract
David Klemperer, 31.10.18
Hersteller nehmen massiv Einfluss auf die von ihnen gesponserten Studien
 Es ist bekannt, dass Hersteller-gesponserte Studien häufig einen Bias zugunsten des geprüften Produkts zeigen. Dies ist im Einzelfall nicht immer ohne weiteres nachweisbar, aber auf der aggregierten Ebene offensichtlich (wir berichteten, z.B Link, s.a Rubrik Einflussnahme der Pharma-Industrie).
Es ist bekannt, dass Hersteller-gesponserte Studien häufig einen Bias zugunsten des geprüften Produkts zeigen. Dies ist im Einzelfall nicht immer ohne weiteres nachweisbar, aber auf der aggregierten Ebene offensichtlich (wir berichteten, z.B Link, s.a Rubrik Einflussnahme der Pharma-Industrie).
In jeder Phase einer Studie kann manipulativ auf das Ergebnis Einfluss genommen werden, so bei der Fragestellung, der Studienendpunkte, der Studienpopulation, der Art und der Dosierung der Vergleichssubstanz, der Studiendauer, der Darstellung und Veröffentlichung der Ergebnisse.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Rasmussen et al. beleuchtet erstmals die Beteiligung bzw. den Einfluss der Wissenschaftler bzw. akademischen Autoren und der Vertreter des Sponsors bei Industrie-gesponserten Studien.
Rasmussen et al. werteten im ersten Schritt die zum Zeitpunkt der Erhebung 200 aktuellsten Studien aus den 7 wichtigsten medizinischen Fachzeitschriften (New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA BMJ, Annals of Internal Medicine, JAMA Internal Medicine, PLoS Medicine) aus.
Die Anzahl der Autoren pro Studie lag zwischen 5 und 103, im Mittel bei 19. Nach den veröffentlichten Angaben war der korrespondierende Autor bei 192 (96%) der Studien ein akademischer Autor. In 173 Studien (87%) war mindestens einer der Ko-Autoren ein Mitarbeiter des Sponsors. In den meisten Studien waren der Sponsor und der akademische Autor am Design, der Durchführung und dem Berichten der Studie beteiligt. Die Datenanalyse wurde dagegen bei etwa der Hälfte der Studien ausschließlich von Mitarbeitern des Sponsors oder einem Auftragsforschungsinstitut durchgeführt. Nur 8 Studien (4%) waren unabhängig in dem Sinne, dass der Sponsor keinen direkten Einfluss nahm.
Im zweiten Schritt nahmen 80 akademische Erstautoren (40%) an der Befragung teil. Die meisten bewerteten die Zusammenarbeit mit dem Sponsor positiv, insbesondere wegen der Finanzierung. Die meisten (79%) unterschrieben einen Vertrag, der in der Mehrzahl der Fälle dem Sponsor das Recht gab, das Manuskript zu prüfen, zu kommentieren und sogar zu genehmigen. Bei 17 der 80 Studien gab der akademische Autor seinen Namen, ohne aber entsprechend beteiligt gewesen zu sein ("ghost authorship") und 9 Autoren gaben Streitigkeiten mit dem Sponsor bezüglich des Studiendesigns und des Berichtens an.
Zusammenfassend nimmt in fast allen Studien der Sponsor direkt Einfluss auf einen oder mehrere Arbeitsschritte. Hervorzuheben ist die alleinige Durchführung der Datenanalyse von Mitarbeitern des Sponsors in der Hälfte der Studien.
Mehr Transparenz über die Beteiligung des Sponsors ließe sich durch Verfeinerung der Anforderungen des ICJME und des CONSORT-Statement sowie durch Anwendung des SPIRIT-Statements erreichen. Mehr über das Biasrisiko zu erfahren, vermeidet nur leider nicht den Bias.
Angesichts des - nachvollziehbar - sehr starken Interesses des Sponsors an einer positiven Bewertung des untersuchten Produkts und angesichts der mehr oder weniger subtilen Möglichkeiten eine Studie zu manipulieren, ergibt die Arbeit von Rasmussen et al. ein weiteres Argument dafür, Herstellerinteressen ganz aus Studien herauszuhalten. Mehr Wissen über Biasrisiken vermindern den Bias nicht.
Rasmussen K, Bero L, Redberg R, Gřtzsche PC, Lundh A: Collaboration between academics and industry in clinical trials: cross sectional study of publications and survey of lead academic authors. BMJ 2018, 363. Link
David Klemperer, 31.10.18
Weltweite Über- und Fehlversorgung von stationär behandelten Kindern mit Antibiotika zur Prophylaxe und nicht zur Behandlung
 Die ambulante Verschreibung von Antibiotika zur "Behandlung" meist viraler Infektionen der oberen Atemwege bei Kindern und Erwachsenen wird weltweit als wirkungslose Fehlversorgung, Verschwendung von Ressourcen und wegen der damit verbundenen Gefahr von Resistenzbildung kritisiert und mit vielfältigen Mitteln der Aufklärung von Ärzten und Patienten zu vermeiden versucht. Leider gibt es noch keinen durchschlagenden Erfolg.
Die ambulante Verschreibung von Antibiotika zur "Behandlung" meist viraler Infektionen der oberen Atemwege bei Kindern und Erwachsenen wird weltweit als wirkungslose Fehlversorgung, Verschwendung von Ressourcen und wegen der damit verbundenen Gefahr von Resistenzbildung kritisiert und mit vielfältigen Mitteln der Aufklärung von Ärzten und Patienten zu vermeiden versucht. Leider gibt es noch keinen durchschlagenden Erfolg.
Ein jetzt veröffentlichter Report über die Verordnung von Antibiotika für 6.818 von 17.693 Kindern in 226 pädiatrischen Klinikstationen in weltweit 41 Ländern an einem Stichtag im Jahr 2012 liefert ein noch problematischeres Bild:
• Es gab insgesamt 11.899 Verordnungen von Antibiotika.
• 28,6 % dieser Verordnungen erfolgten prophylaktisch. Dies bedeutet, dass von den stationär behandelten Kindern, die wenigstens eine Antibiotika-Verordnung erhielten, 32,9% (2.242 Kinder) Antibiotika erhielten, um eine potenzielle Infektion zu verhindern und nicht zur Behandlung einer vorhandenen Infektion.
• 26,6% aller dieser prophylaktisch verordneten Antibiotika wurden verordnet, um mit einer bevorstehenden Operation assoziierte mögliche Infektionen zu verhindern. Von diesen PatientInnen erhielten rund Dreiviertel das Antibiotikum länger als einen Tag. Die restlichen 73,4% wurden prophylaktisch gegen andere Typen einer möglichen Infektion verordnet.
• Auch im Krankenhaus war die Mehrheit der prophylaktisch verordneten Antibiotika (51,8%) Breitband-Antibiotika, was die Gefahr von damit bewirkten Mehrfachresistenzen erhöht.
• In 36,7% der Verordnungen wurden offensichtlich "für alle Fälle" gleichzeitig zwei oder mehr systemisch wirkende Antibiotika verordnet.
Die Vorschläge diese Verordnungspraxis durch mehr Aufklärung der verordnenden Ärzte über zum größten Teil vorhandene Behandlungs-Leitlinien und die stärkere Kontrolle der Umsetzung dieser Leitlinien zu verändern, wirken angesichts der eigentlich jedem Arzt bekannten Problematik einer derartigen Verordnungspraxis ziemlich hilflos.
Der Aufsatz High Rates of Prescribing Antimicrobials for Prophylaxis in Children and Neonates: Results From the Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children Point Prevalence Survey. von Markus Hufnagel et al. ist am 22. März 2018 in der Fachzeitschrift "Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society" veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.3.18
November 2017: Die Serie zu neuen Krebsmedikamenten besteht jetzt aus 7 Beiträgen
 Die Beiträge mit den zugrunde liegenden Studien geben ein recht konsistentes Bild: • Krebsmedikamente werden überwiegend auf Grundlage von Studien zugelassen, die keine oder nur unzureichende Aussagen über Mortalität, Morbidität und Lebensqualität enthalten.
Die Beiträge mit den zugrunde liegenden Studien geben ein recht konsistentes Bild: • Krebsmedikamente werden überwiegend auf Grundlage von Studien zugelassen, die keine oder nur unzureichende Aussagen über Mortalität, Morbidität und Lebensqualität enthalten.
• Wenn die Zulassungsbehörden ergänzende Studien fordern, kommen die Hersteller dem zumeist zögerlich oder gar nicht nach. Die Zulassungsbehörden lassen sich das gefallen.
• Die Preise für die neuen Krebsmedikamente sind exorbitant.
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant
Link.
Mailankody S, Prasad V. Five years of cancer drug approvals: Innovation, efficacy, and costs. JAMA Oncology 2015;1:539-40
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA
Link.
Prasad V, Kim C, Burotto M, Vandross A: The strength of association between surrogate end points and survival in oncology: A systematic review of trial-level meta-analyses. JAMA Internal Medicine 2015
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen Link
Krishnamurti T, Woloshin S, Schwartz LM, Fischhoff B: A randomized trial testing us food and drug administration "breakthrough" language. JAMA Internal Medicine 2015, 175(11):1856-1858
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig
Link
Abola MV, Prasad V: THe use of superlatives in cancer research. JAMA Oncology 2015:1-2
Neue Krebsmedikamente 5: Niedrige Zulassungshürden behindern Fortschritte in der Forschung
Link
Fojo T, Mailankody S, Lo A: Unintended consequences of expensive cancer therapeutics—the pursuit of marginal indications and a me-too mentality that stifles innovation and creativity: The John Conley Lecture. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery 2014, 140:1225-123
Neue Krebsmedikamente 6 - FDA: Hürde für Zulassung niedrig, kein Biss bei Postmarketing-Studien
Link
Kim, C., & Prasad, V. (2015). Cancer Drugs Approved on the Basis of a Surrogate End Point and Subsequent Overall Survival: An Analysis of 5 Years of US Food and Drug Administration Approvals. JAMA Intern Med, 175(12), 1992-1994. doi:10.1001/jamainternmed.2015.5868
Neue Krebsmedikamente 7 - EMA: Patientennutzen auch nach Jahren häufig unbekannt
Link
Davis, C., Naci, H., Gurpinar, E., Poplavska, E., Pinto, A., & Aggarwal, A. (2017). Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13. BMJ, 359. doi:10.1136/bmj.j4530
David Klemperer, 4.11.17
Neue Krebsmedikamente 7 - EMA: Patientennutzen auch nach Jahren häufig unbekannt
 In einer vor kurzem im British Medical Journal veröffentlichten Studie ging es um die Frage, ob bei Krebsmedikamenten zum Zeitpunkt der Zulassung durch Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA (European Medicines Agency) oder ggf. Jahre später Evidenz über den Patientennutzen vorlag. Als patientenrelevante Behandlungsendpunkte werden die Verlängerung des Lebens und die Verbesserung der Lebensqualität angesehen.
In einer vor kurzem im British Medical Journal veröffentlichten Studie ging es um die Frage, ob bei Krebsmedikamenten zum Zeitpunkt der Zulassung durch Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA (European Medicines Agency) oder ggf. Jahre später Evidenz über den Patientennutzen vorlag. Als patientenrelevante Behandlungsendpunkte werden die Verlängerung des Lebens und die Verbesserung der Lebensqualität angesehen.
In Jahren 2009 bis 2013 sprach die EMA 68 Zulassungen für Krebsmedikamente aus.
Art der Zulassung:
• neue Substanzen: 33
• Erweiterung der Indikation bereits zugelassener Medikamenten: 35
Art der Krebserkrankung;
• solide Tumoren (Brust, Lunge, Darm Prostata) 51
• hämatologische Erkrankungen 17
Ziel der Therapie
• kurativ 7
• nicht-kurativ 61
Zulassungsweg
• reguläre Zulassung (market authorisation) 58
• verkürzter Zulassungsweg (conditional market authorisation) 10
Für die 68 Zulassungen lagen insgesamt 72 Studien vor.
Nur 18 der 72 Studien untersuchten die Verlängerung des Lebens als primären Endpunkt, die übrigen 54 Studien untersuchten Surrogatendpunkte, die sich auf die biologische Aktivität eines Tumors beziehen, aber keine Aussage über den Patientennutzen erlauben.
Für 35 Studien lagen Ergebnisse zur Lebensqualität vor, in keiner Studie war die Lebensqualität als primärer Endpunkt definiert.
Für nur 24 der 68 Zulassungen lag zum Zeitpunkt der Zulassung Evidenz vor bezüglich
• Lebensverlängerung für 21 der 51 Zulassungen für solide Tumoren und für 3 der 17 Zulassungen für hämatologische Erkrankungen, wobei die Dauer der Lebensverlängerung zwischen 1,0 und 5,8 Monaten lag.
• Verbesserung der Lebensqualität für lediglich für 7 der 68 Zulassungen
Von den 68 Zulassungen erfolgten somit
• 44, ohne Evidenz für die Lebensverlängerung
• 61 ohne Evidenz für die Verbesserung der Lebensqualität.
Für gerade 29 der 68 Zulassungen (43%) lag somit Evidenz entweder für die Lebensverlängerung oder für die Verbesserung der Lebensqualität vor.
Die Untersuchung der Evidenzlage mehrere Jahre (zwischen 3,3 und 8,1 Jahren) nach der Zulassung ergab Folgendes:
• Von den 44 Zulassungen ohne Patientennutzen zum Zeitpunkt der Zulassung wurde für 3 Zulassungen eine Verlängerung der Lebenszeit und für 5 eine Verbesserung der Lebensqualität nachgewiesen. Für keine der 10 verkürzten Zulassungen lag zum Zeitpunkt der Zulassung oder Jahre danach Evidenz für eine Lebensverlängerung oder Verbesserung der Lebensqualität vor.
• Von den 23 Zulassungen mit Evidenz für einen Überlebensvorteil sind nach den Maßstäben der European Society for Medical Oncology nur 11 als klinisch bedeutsam zu bewerten.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:
Für die Mehrzahl der Krebsmedikamente, die von der EMA eine Marktzulassung erhalten, ist nicht bekannt, ob und wenn ja welchen Nutzen die Patienten zu erwarten haben. Fehlende Kenntnisse sollten zwar in der Phase nach der Zulassung durch sog. Postmarketing-Studien gewonnen werden. Die EMA akzeptiert aber offensichtlich, dass die Hersteller hier nicht liefern.
Patienten erhalten somit Krebstherapien, mit unklarem Nutzen, die häufig sehr belastend sind und 5- bis 6-stelligen Eurobereich kosten.
Aus Sicht des Verfassers ist dies ein völlig unhaltbarer Zustand.
Davis, C., Naci, H., Gurpinar, E., Poplavska, E., Pinto, A., & Aggarwal, A. (2017). Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13. BMJ, 359. doi:10.1136/bmj.j4530 Link
Kommentar
Prasad, V. (2017). Do cancer drugs improve survival or quality of life? BMJ, 359. doi:10.1136/bmj.j4528 Link
David Klemperer, 4.11.17
Neue Krebsmedikamente 6 - FDA: Hürde für Zulassung niedrig, kein Biss bei Postmarketing-Studien
 Krebstherapien sollen das Leben von Kranken verlängern, darüber hinaus Beschwerden lindern, Komplikationen vermeiden und die Lebensqualität verbessern. Die Arzneimittelzulassungsbehörden legen ihren Entscheidungen über die Neuzulassung von Krebsmedikamenten jedoch häufig nicht diese patientenrelevanten Behandlungsendpunkte sondern Surrogatendpunkte zugrunde. Surrogatendpunkte messen z.B. die vorübergehende Verkleinerung eines Tumors (Ansprechrate) oder die Zeit bis zum Fortschreiten des Tumorwachstums (progressionsfreies Überleben). Dabei setzen die Zulassungsbehörden auf die Hoffnung, dass Medikamente, die auf Grundlage von Surrogatendpunkten zugelassen wurden, sich später als wirksam auf die Lebensdauer bzw. die Lebensqualität erweisen.. Um dies zu prüfen, verpflichtet die Zulassungsbehörde die Hersteller zu weitere Studien, sog. Postmarketing-Studien.
Krebstherapien sollen das Leben von Kranken verlängern, darüber hinaus Beschwerden lindern, Komplikationen vermeiden und die Lebensqualität verbessern. Die Arzneimittelzulassungsbehörden legen ihren Entscheidungen über die Neuzulassung von Krebsmedikamenten jedoch häufig nicht diese patientenrelevanten Behandlungsendpunkte sondern Surrogatendpunkte zugrunde. Surrogatendpunkte messen z.B. die vorübergehende Verkleinerung eines Tumors (Ansprechrate) oder die Zeit bis zum Fortschreiten des Tumorwachstums (progressionsfreies Überleben). Dabei setzen die Zulassungsbehörden auf die Hoffnung, dass Medikamente, die auf Grundlage von Surrogatendpunkten zugelassen wurden, sich später als wirksam auf die Lebensdauer bzw. die Lebensqualität erweisen.. Um dies zu prüfen, verpflichtet die Zulassungsbehörde die Hersteller zu weitere Studien, sog. Postmarketing-Studien.
Chul Kinnund und Vinay Prasad, zwei Amerikanische Onkologen, haben untersucht, wie hoch der Anteil von Surrogatendpunkten bei der Neuzulassung von Krebsmedikamenten durch die Food and Drug Administration (FDA) ist und inwieweit bei alleinigem Vorliegen von Surrogatendpunkte die Hersteller ihrer Pflicht nachkommen, die Verbesserung des Überlebens in weiteren Studien zu untersuchen.
Untersucht wurden alle 54 Neuzulassungen von Krebsmedikamenten durch die FDA von Anfang 2008 bis Ende 2012.
Surrogatendpunkte als Grundlage für die Zulassung akzeptierte die FDA bei 36 der 54 Substanzen (67%), und zwar bei allen 15 Substanzen im beschleunigten Zulassungsverfahrens und bei 21 von 39 Substanzen (54%) im traditionellen Zulassungsverfahren.
Die Ansprechrate akzeptierte die FDA bei 19 (53%) der 36 Neuzulassungen aufgrund von Surrogatendpunkten und das progressionsfreie Überleben 17 (47%).
Nach knapp 4 ˝ Jahren wurde der Überlebensvorteil für 5 Medikamente in randomisierten kontrollierten Studien erbracht und zwar für eines der 15 Medikamente aus dem beschleunigten und für 4 der 21 Medikamente aus dem traditionellen Zulassungsverfahren.
Bei 18 Medikamenten zeigten randomisierte kontrollierte Studien keine Verbesserung des Überlebens und zwar in 6 der 15 Medikamente aus dem beschleunigten und für 12 der 21 Medikamente aus dem traditionellen Zulassungsverfahren.
Bei 13 Medikamenten bleibt unbekannt, ob sie die Überlebenszeit verlängern und zwar bei 8 der 15 Medikamente aus dem beschleunigten und bei 5 der 21 Medikamente aus dem traditionellen Zulassungsverfahren.
Zusammenfassend besteht bei 36 der 54 neu zugelassenen Krebsmedikamente kein Nachweis eines Überlebensvorteils vorliegt, insbesondere für keines der 15 beschleunigt zugelassenen Krebsmedikamente. Bezüglich der 36 Medikamente mit unbekanntem Nutzen zum Zeitpunkt der Zulassung liegen Jahre später Studien vor, die für 5 einen Überlebensvorteil und für 18 keinen Überlebensvorteil belegen. Für die übrigen 13 der 36 Medikamente haben die Hersteller auch nach Jahren keine aussagekräftigen Studien vorgelegt.
Bereits im Jahr 2009 hatte das U.S. Government Accountability Office (GOA), eine Aufsichtsbehörde des amerikanischen Kongresses, in einem Bericht grobe Mängel der FDA in der Handhabung von Postmarketing-Studien festgestellt. Es fehlten insbesondere Vorgehensweisen, Hersteller unter Druck zu setzen, die ihrer Verpflichtung, Postmarketing-Studien vorzulegen, nicht nachkommen. Auch fehlten Kriterien dafür, wann einem Medikament die Zulassung entzogen wird.
Kim, C., & Prasad, V. (2015). Cancer Drugs Approved on the Basis of a Surrogate End Point and Subsequent Overall Survival: An Analysis of 5 Years of US Food and Drug Administration Approvals. JAMA Intern Med, 175(12), 1992-1994. Link
United States Government Accountability Office (GOA). (2009). NEW DRUG APPROVAL. FDA Needs to Enhance Its Oversight of Drugs Approved on the Basis of Surrogate Endpoints. {Link}{http://www.gao.gov/products/GAO-09-866
David Klemperer, 4.11.17
Wie gelingt es ohne Nachteile für Patient und Arzt bei den meisten Atemwegserkrankungen Antibiotika zu verhindern?
 Darüber, dass die Verordnung und Einnahme von Antibiotika bei den meisten Infektionen der oberen Atemwege und des Mittelohrs, da durch Viren verursacht, keine heilende oder nur eine symptomatische Wirkung hat, dafür aber massiv die Entstehung von immer mehr resistenten Keimen fördert und daher eine Gesundheitsgefahr darstellt, besteht seit Jahren ein weltweiter Konsens. Trotz einiger Fortschritte zögern aber immer noch viele Ärzte "für alle Fälle" oder weil es bei Kindern "die besorgten Eltern so wollen" auf Antibiotika zu verzichten oder mit einer "watchful waiting"-Behandlung zu reagieren und allenfalls etwas gegen Schmerzen zu verordnen oder zu empfehlen.
Darüber, dass die Verordnung und Einnahme von Antibiotika bei den meisten Infektionen der oberen Atemwege und des Mittelohrs, da durch Viren verursacht, keine heilende oder nur eine symptomatische Wirkung hat, dafür aber massiv die Entstehung von immer mehr resistenten Keimen fördert und daher eine Gesundheitsgefahr darstellt, besteht seit Jahren ein weltweiter Konsens. Trotz einiger Fortschritte zögern aber immer noch viele Ärzte "für alle Fälle" oder weil es bei Kindern "die besorgten Eltern so wollen" auf Antibiotika zu verzichten oder mit einer "watchful waiting"-Behandlung zu reagieren und allenfalls etwas gegen Schmerzen zu verordnen oder zu empfehlen.
Um diese Ärzte doch noch für eine zurückhaltende Behandlungsweise zu gewinnen, entwickelte sich in einigen Ländern ein völlig neuer Verordnungstypus. Der Arzt kann weiterhin für Patienten mit einer der genannten Krankheiten ein Antibiotikum verordnen, empfiehlt dann aber den Patienten das Rezept erst nach einem oder zwei Tagen oder erst dann einzulösen, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Erkrankungssymptome nicht verschwunden sind bzw. sich nicht erheblich verbessert haben.
Da aber auch diese Strategie von Befürchtungen über erhöhte Komplikationsraten oder eine größere Unzufriedenheit der Patienten und damit deren möglicher Verlust als Praxisnutzer begleitet wurde und wird, bereitet eine Cochrane Reviewergruppe seit 2007 Studien auf, die Vergleiche zwischen drei verschiedenen Verordnungsstrategien (sofortige Verordnung und Einlösung, Verordnung mit dem Hinbweis mit der Einlösung noch etwas zu warten und gar keine Verordnung von Antibiotika) und ihren verschiedenen Wirkungen angestellt haben.
Der neueste, dazu am 7. September 2017 veröffentlichte Cochrane Review bilanziert die über mehrere Jahre gewonnenen und evidenten Erkenntnisse folgendermaßen:
• Symptome wie Schmerzen oder Fieber werden bei Empfängern von sofort verordneten und eingenommenen Antibiotika gegenüber Empfängern eines erst verzögert einzulösenden Rezepts etwas mehr gebessert.
• Zwischen den drei Verordnungsweisen gab es keinen Unterschied bei den Komplikationsraten.
• Die Zufriedenheit der Patientengruppen unterscheidet sich nicht signifikant.
• Vergleicht man Patienten mit verzögertem Rezept mit Patienten, die überhaupt keine Verordnung bekamen, war die Zufriedenheit der ersten Gruppe sogar etwas höher (87%) als die der zweiten (82%).
• Der Anteil von Patienten, die während einer Halsentzündung oder einer Mittelohrentzündung Antibiotika eingenommen haben, ist bei einer sofortigen Verordnung erheblich höher (93%) als bei den Patienten, die ihr Rezept bei Bedarf erst nach ein paar Tagen einlösen sollten (31%).
• Bei Patienten, die zunächst gar kein Antibiotikarezept erhalten, beträgt der Anteil, der dann doch noch Antibiotika verordnet bekommt und einnimmt nur noch 14%.
Die meisten Befürchtungen für Patient wie Arzt gegenüber der Ausstellung von erst verzögert einzulösenden Rezepten erweisen sich also nahezu vollständig als unberechtigt.
Von dem 2017er Cochrane Review Delayed antibiotic prescriptions for respiratory infections von Spurling GKP, Del Mar CB, Dooley L, Foxlee R und Farley R. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9) gibt es kostenlos ein umfangreiches Abstract.
Mit welch relativ einfachen Mitteln erwachsene Patienten aber auch Eltern von erkrankten Kindern überzeugt werden können, daran mitzuwirken, den Gebrauch von Antibiotika bei Erkrankungen der oberen Atemwege möglichst gering zu halten, zeigte bereits ein 2016 veröffentlichter anderer Cochrane Review über zum Teil methodisch hochwertige Studien in den USA und Großbritannien. Danach führte die Verteilung einer zweiseitigen schriftlichen Information über die Vor- und Nachteile der Verordnung von Antibiotika zu einer signifikanten Verringerung der Menge von eingenommenen Antibiotika ohne dass es zu einem signifikanten Anstieg der Patient-Arzt-Kontakte oder zu Unterschieden der Zufriedenheit von Eltern mit der Behandlung kam.
Wegen der geringen Zahl der an diesen Studien teilnehmenden Kindern und ihren Eltern und einer Reihe nicht erhobener Aspekte der Behandlung (z.B. Patientenwissen) plädieren die Reviewer für eine Fortsetzung derartiger Untersuchungen.
Auch von dem Review Written information for patients (or parents of child patients) to reduce the use of antibiotics for acute upper respiratory tract infections in primary care von O'Sullivan JW, Harvey RT, Glasziou PP und McCullough A. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11) gibt es kostenlos ein längeres Abstract.
Bernard Braun, 28.9.17
Vorbild USA: US-Kongress will von 7 Pharmafirmen komplette Transparenz über ihre Preisgestaltung für Medikamente gegen MS
 Auch wenn es in den USA seit einigen Jahren gesundheitspolitisch ausgesprochen schrill, makaber und wiedersprüchlich zugeht wäre es ein großer Fehler die dortige Gesundheitspolitik auf Obama- versus Trumpcare oder auf die Dominanz radikal marktwirtschaftlicher und anbieterhöriger Positionen zu reduzieren. Jenseits der großen Care-Debatten gibt es eine Vielzahl von verabschiedeten Innovationen oder Initiativen, die zum Teil wesentlich anbieter- oder wettbewerbskritscher oder evidenbzbasierter sind als z.B. im GKV-System.
Auch wenn es in den USA seit einigen Jahren gesundheitspolitisch ausgesprochen schrill, makaber und wiedersprüchlich zugeht wäre es ein großer Fehler die dortige Gesundheitspolitik auf Obama- versus Trumpcare oder auf die Dominanz radikal marktwirtschaftlicher und anbieterhöriger Positionen zu reduzieren. Jenseits der großen Care-Debatten gibt es eine Vielzahl von verabschiedeten Innovationen oder Initiativen, die zum Teil wesentlich anbieter- oder wettbewerbskritscher oder evidenbzbasierter sind als z.B. im GKV-System.
Dazu gehört beispielsweise eine am 17. August 2017 an sieben Pharmaunternehmen (darunter auch die Firma Bayer) versandte parlamentsoffizielle Anfrage des "House-Committee of Oversight and Government Reform" des US-Congresses für eine so genannte "in-depth investigation" zu den Ursachen der Preisentwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS). Für deren Beantwortung erhielten die Unternehmen eine Frist bis zum 31. August 2017.
Die Ausgangslage für diese Untersuchung sieht so aus:
• Eine komplett kostenlos erhältliche Studie über The cost of multiple sclerosis drugs in the US and the pharmaceutical industry von Daniel Hartung et al. in der Fachzeitschrift "Neurology" vom 25. Mai 2015 (84(21): 2185-2192) wies nach, dass der Preis der gängigsten Medikamente gegen die multiple Sklerose zwischen 1993 und 2013 von von 8 bis 11.000 US-$ auf über 60.000 US-$ gestiegen war. Der Zuwachs lag damit um das 5- bis 7-Fache über der durchschnittlichen Preissteigerung für alle Arzneimittelverordnungen (3 bis 5%).
• Der Autor wies ferner nach, dass immer dann, wenn neue und zum Teil berechtigterweise teurere MS-Arzneimittel auf den Markt, die Preise für die älteren am stärksten stiegen (!) und nicht gleichblieben oder gemäß der klassischen ökonomischen Theorie sanken.
• Dies führte die AutorInnen zu folgendem bemerkenswerten Schluss: "However, the unbridled rise in the cost of MS drugs has resulted in large profit margins and the creation of an industry "too big to fail." It is time for neurologists to begin a national conversation about unsustainable and suffocating drug costs for people with MS—otherwise we are failing our patients and society."
• Bayer machte allein mit dem Alt-Präparat Betaseron 2016 in den USA einen Umsatz von 386 Millionen Euro.
Wenn man so will greifen die Kongressabgeordneten nur den letzten Satz der WissenschaftlerInnen auf und versuchen die "Unterhaltung" mit der Pharmaindustrie auf der Basis von deren internen Dokumenten zu führen.
So wird in dem Brief an die Firma Bayer für deren altes MS-Präparat Betaseron ein Anstieg des Preises von 11.532 US-$ im Erstzulassungsjahr 1993 auf 91.261 US-$ im Jahr 2017, also ein Anstieg um 691% nachgewiesen. Für die Abgeordneten ist dies ein "skyrocketing price" dessen "underlying causes" sie mit Hilfe der Firma bzw. Firmen untersuchen wollen. Dafür fordern sie "a list of your company's profits and expenses for Betaseron, including, but not limited to" 17 detailliert angeforderte Arten von Unterlagen zum Gewinn, Zuzahlungen der Patienten, Marketingausgaben, Forschungsausgaben, Steuern und alle weiteren Ausgaben und Kosten im Kontext des Medikaments. Desweiteren werden die Firmen um 5 weitere Dokumentenarten bis hin zu internen Memoranden, Patentkorrespondenz oder Rückerstattungen an Apotheken gebeten.
So akribisch diese Untersuchung angelegt und ist und wahrscheinlich auch zu Preissenkungen führen wird, so problematisch ist, dass damit der weitgehend unregulierte US-Markt zunächst weiterbestehen wird.
Wann deutsche Gesundheitspolitiker als Mitglieder des Bundestages bei ähnlichen Preissprüngen vergleichbare tiefgehende Untersuchungen ermöglichen und dann auch durchführen, bleibt abzuwarten - wahrscheinlich lange.
Der Brief des Congress oft he United States an Bayer Healthcare Pharmaceuticals kann wie die ähnlich argumentierenden Briefe an die anderen 6 Pharmafirmen (darunter Roche, Sanofi oder Novartis) kostenlos heruntergeladen werden.
Ob die Firmen pünktlich geantwortet haben, die Unterlagen vollständig waren und was damit geschieht, ist bisher nicht öffentlich erfahrbar. Wer will kann aber am Ball bleiben.
Bernard Braun, 17.9.17
Mehr Stillstand und Rück- statt Fortschritt - Aktuelle Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel
 "Seit 2011 werden neu in den Markt eingeführte Medikamente oder bereits etablierte Arzneien mit erweitertem Indikationseinsatz einer sogenannten "frühen Nutzenbewertung" durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) unterzogen. Gesetzliche Basis ist das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG). Es hinterfragt, ob ein neues Medikament gegenüber bereits verfügbaren Präparaten einen Zusatznutzen aufweist. Es geht dabei nicht um die Qualität, Wirksamkeit oder Sicherheit einer neuen Therapie. Dies wurde bereits vor der Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft. Die Ergebnisse dieser Bewertung dienen vielmehr den Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem GKV-Spitzenverband." Soweit die Zusammenfassung dessen was Gegenstand einer umfassenden Analyse der Ergebnisse aller AMNOG-Verfahren von 2011 bis 2016 durch eine Ad-hoc-Kommission (20 Mitglieder aus verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften) der "Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e.V." war, die im Mai 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
"Seit 2011 werden neu in den Markt eingeführte Medikamente oder bereits etablierte Arzneien mit erweitertem Indikationseinsatz einer sogenannten "frühen Nutzenbewertung" durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) unterzogen. Gesetzliche Basis ist das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG). Es hinterfragt, ob ein neues Medikament gegenüber bereits verfügbaren Präparaten einen Zusatznutzen aufweist. Es geht dabei nicht um die Qualität, Wirksamkeit oder Sicherheit einer neuen Therapie. Dies wurde bereits vor der Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft. Die Ergebnisse dieser Bewertung dienen vielmehr den Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem GKV-Spitzenverband." Soweit die Zusammenfassung dessen was Gegenstand einer umfassenden Analyse der Ergebnisse aller AMNOG-Verfahren von 2011 bis 2016 durch eine Ad-hoc-Kommission (20 Mitglieder aus verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften) der "Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e.V." war, die im Mai 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Die Ergebnisse:
• Ende 2016 waren 224 Verfahren mit 469 ausgewerteten Subgruppen abgeschlossen.
• Bei 61,1% war der Zusatznutzen durch die u.a., von den Herstellern vorgelegten Unterlagen nicht belegt, bei 15,8% war der Zusatznutzen gering und bei 12,1% beträchtlich.
• Der Anteil von Verfahren deren Zusatznutzen nicht belegt war, schwankte zwischen 88% im Fachgebiet Diabetologie und 45% im Bereich Infektiologie.
• In Verfahren auf der Basis von nicht randomisierten klinischen Studien betrug der Anteil mit quantifizierbarem Zusatznutzen nur 12%.
• Der G-BA entscheidet nicht nur über den Zusatznutzen, sonderen berichtet auch die jeweilige Aussagesicherheit. Für 343 aller Subgruppen (73,1%) macht er keine Aussage, was überwiegend Arzneimittel ohne Zusatznutzen betrifft. Für 68 (14,5% gibt es für die Sicherheit der Aussage Anhaltspunkte, für 53 (11,3%) Hinweise und für lediglich 5 (1,1%) Belege. Auf die mit dieser Nichtfestlegung zur Aussagesicherheit verbundenen Probleme weist die AWMF-Kommission ausdrücklich hin: "Das ist kritisch, weil diese Festlegung auf einer sehr unterschiedlichen Studienlage basieren kann, vom Fehlen ausreichender Daten bis zum negativen Ergebnis in einer Metaanalyse. Die hohe Datenunsicherheit der frühen Nutzenbewertung zeigt sich auch darin, dass in der Hälfte der Subgruppen bei Neubewertungen eine andere Festlegung als im ersten Verfahren getroffen wurde."
• Schließlich kritisiert die AWMF, dass auch im AMNOG und folgerichtig bei den G-BA-Bewertungen Indikatoren des patientenbezogenen Outcomes (z.B. Schmerzen statt ausschließlich Morbidität im allgemeinen) weitgehend fehlen - ein weitverbreiteter Mangel bei den Endpunkten vieler Studien und Bewertungen von Behandlungsmethoden und -mittel.
Ob die offen geäußerte Befürchtung der AWMF, die dargestellten Entwicklungen würden "aktuell den langfristigen Wert des Verfahrens in Frage (stellen)", eintreten, hängt sicherlich auch von der öffentlichen Diskussion der Ergebnisse des AWMF-Berichts ab.
Die Ergebnisbroschüre Frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel in Deutschland 2011 - 2016. Analysen und Impulse. ist kostenlos erhältlich.
Ebenso das Positionspapier der Ad-hoc-Kommission Frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel 2017.
Bernard Braun, 25.5.17
Polypharmazie - Wie werden welche Krankenversicherten von wem und warum mit zu vielen Medikamenten versorgt?
 Seit mehreren wird international wie national über die gesundheitliche Bedeutung der so genannten Polypharmazie und die Notwendigkeit wie Möglichkeiten diskutiert sie einzuschränken oder abzubauen. Dabei stehen zweierlei Risiken der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - dies ist die am meisten verwendete Definition von Polypharmazie - im Vordergrund: Erstens nimmt die Wahrscheinlichkeit von oftmals unbekannten unerwünschten Wechselwirkungen mit der Anzahl von Arzneimitteln rasch zu und zweitens steigt das sowieso schon bei rund der Hälfte der verordneten Medikamente vorhandene Problem einer nicht korrekten Einnahme mit der Anzahl der einzunehmenden Medikamente kräftig an - mit ebenfalls möglichen zusätzlichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen.
Seit mehreren wird international wie national über die gesundheitliche Bedeutung der so genannten Polypharmazie und die Notwendigkeit wie Möglichkeiten diskutiert sie einzuschränken oder abzubauen. Dabei stehen zweierlei Risiken der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - dies ist die am meisten verwendete Definition von Polypharmazie - im Vordergrund: Erstens nimmt die Wahrscheinlichkeit von oftmals unbekannten unerwünschten Wechselwirkungen mit der Anzahl von Arzneimitteln rasch zu und zweitens steigt das sowieso schon bei rund der Hälfte der verordneten Medikamente vorhandene Problem einer nicht korrekten Einnahme mit der Anzahl der einzunehmenden Medikamente kräftig an - mit ebenfalls möglichen zusätzlichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen.
Wer hoffte, dass die Diskussion die Sensibilität für Polypharmazie mit praktischen Folgen erhöht und ihre Häufigkeit sich verringert, wird durch die Ergebnisse aktueller Studie enttäuscht.
Was dies konkret heißt zeigt zuletzt eine im April 2017 veröffentlichte Studie über das Verordnungsgeschehen bei den Versicherten der Handelskrankenkasse Bremen (hkk), die im Jahr 2015 ganzjährig versichert waren und mindestens ein Medikament verordnet bekamen. Analysiert wurde, wie viele hkk-Versicherte fünf oder mehr pharmazeutisch unterschiedliche Medikamente gleichzeitig verordnet bekamen. Auch in dieser Studie konnte nicht ermittelt werden, wie viel weitere oft stark wirksame Arzneimittel sich die untersuchten Personen zusätzlich ohne Rezept in einer Apotheke gekauft haben, der Umfang und die Risiken von Polypharmazie also zum Teil noch beträchtlich ausgeprägter sein dürfte.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Von allen im Jahr 2015 durchgängig bei der hkk Versicherten waren 26,7 % von Polypharmazie betroffen. Von den Angehörigen der Verordnungspopulation, d.h. aller ganzjährig in der hkk versicherten Personen, die mindestens ein Arzneimittel verordnet bekamen, waren 2015 bei ganzjähriger Betrachtung 35 % von Polypharmazie betroffen. Bei den älteren Versicherten dieser Population ab 65 Jahren waren es 61,5 %.
• Bei quartalsweiser Betrachtung waren in jedem Quartal zwischen 15,6 % und 16,6 % aller Angehörigen der hkk-Verordnungspopulation von Polypharmazie betroffen. Dieser Wert schwankte bei den über 64-jährigen zwischen 33,1 % im zweiten und 34,4 % im vierten Quartal.
• Es gibt einen starken Zusammenhang von Polypharmazie und Polymorbidität. Klassifiziert man Versicherte mit jährlich mehr als 20 unterschiedlichen ambulant gestellten Diagnosen als multimorbide, waren dies 17,6 % aller medikamentös behandelten hkk-Versicherte.
• Ein alternder Organismus reagiert generell anders auf Medikamente als ein junger, was womöglich deren Wirksamkeit beeinflusst oder die Gefahr für Neben- und Wechselwirkungen erhöht. Verschärft werden diese Risiken, weil besonders ältere Menschen oft an mehreren Erkrankungen gleichzeitig leiden und entsprechend viele Medikamente benötigen. Als Anhaltspunkt für eine möglichst sichere Arzneimitteltherapie im Alter haben Experten in verschiedenen Ländern Listen mit "potenziell inadäquaten Medikamenten (PIM)" zusammengestellt. Das Ergebnis der deutschen Untersuchung, die finale so genannte Priscus-Liste, umfasst 83 Wirkstoffe, die als potenziell ungeeignet für älter Menschen gelten und 18 verschiedenen Arzneistoffklassen aus einem breiten Spektrum an Behandlungsgebieten entstammen (durchweg hoch wirksame und oft Abhängigkeit erzeugende Schlaf- und Beruhigungsmittel bzw. Neuroleptika). Im Jahr 2015 erhielten 18,6 % der über 64-jährigen hkk-Versicherten, die in diesem Jahr wenigstens ein Medikament verordnet bekamen, mindestens ein nach der PRISCUS-Liste potenziell inadäquates, d.h. ein möglicherweise gesundheitlich riskantes Arzneimittel oder einen derartigen Wirkstoff.
• Ein grober Vergleich mit einer ähnlichen Analyse von Polypharmazie bei den Versicherten der hkk im Jahr 2010, bestätigt den Eindruck, dass sich an der Häufigkeit von Polypharmazie prinzipiell nichts geändert hat.
Die bisher erprobten Strategien und Instrumente zur Beeinflussung von Polypharmazie haben oft gar keine oder nicht die erhoffte Wirkung. Das Hoffen auf die eine Patentlösung sollte daher aufgegeben werden und durch einen mehrdimensionalen Ansatz ersetzt werden.
Dieser sollte mindestens drei Handlungsebenen oder Ansatzpunkte umfassen:
• An die Stelle der weit verbreiteten Behandlungsform von Multimorbidität jede einzelne Erkrankung auf der Basis krankheitsspezifischer evidenzbasierter Leitlinien optimal oder maximal zu behandeln führt in bester Absicht gerade bei älteren Patienten zu Polypharmazie. Um dieses Dilemma zu vermeiden braucht es ebenfalls evidenzbasierte Leitlinien für die Behandlung von Multimorbidität für Ärzte und PatientInnen.
• Die Absicht, Art und Umfang von Polypharmazie zu beeinflussen erfordert eine kontinuierliche, systematische und verständliche Information von Ärzten und polypharmazeutisch behandelte PatientInnen. Dies kann in gesonderten Beratungsgesprächen für PatientInnen durch die verordnenden Ärzte erfolgen. Als aktueller Anlass bietet sich die gesetzlich seit Oktober 2016 vorgeschriebene Aushändigung eines schriftlichen Medikationsplans für alle PatientInnen mit mindestens drei verordneten Arzneimitteln an. Hier bietet sich auch die Möglichkeit an, mehr über den Erwerb und die Einnahme von OTC-Medikamenten zu erfahren und damit noch ein Stück näher an die Realität von Polypharmazie heranzukommen.
• Im Rahmen des ebenfalls für gesetzliche Krankenkassen gesetzlich verpflichtenden Versorgungsmanagement sollte eine regelmäßige Berichterstattung über den Umfang und die Art der Arzneimittelverordnungen mit dem Schwerpunkt Polypharmazie auf dem Hintergrund der Informationen der Krankenkassen über ambulante und stationäre Diagnosen, Ärzte und Krankenhausaufenthalte stattfinden.
Der 47-seitige hkk-Gesundheitsreport 2017 Polypharmazie. Eine Analyse mit hkk-Routinedaten des Bremer Gesundheitswissenschaftlers Bernard Braun ist kostenlos erhältlich. Zusätzlich zu den Auswertungen des Verordnbungsgeschehens enthält der Report kurze Überblicke über andere Studien zur Polypharmazie und zur Literatur über die Art und Wirksamkeit von Strategien und Maßnahmen zur Reduktion von Polypharmazie.
Bernard Braun, 16.5.17
...fragen sie ihren...Apotheker, aber was wenn der selber Antworten sucht und nicht findet?
 Ein nicht unbeträchtlicher Anteil aller Medikationsmittel werden nicht von Ärzten verordnet, sondern direkt von PatientInnen oder um ihre Gesunderhaltung besorgten Gesunden in Apotheken erworben und komplett privat bezahlt. Die meisten dieser Mittel werden von ihren Herstellern als kurativ wie präventiv hilfreich beworben.Eine ganze Reihe dieser so genannten "Over-The-Counter (OTC)"-Arzneimittel sind auch nachgewiesenermaßen hochwirksame Mittel, die zum Teil auch mit anderen Arzneimitteln und dann auch noch zum Nachteil des sie einnehmenden Menschen interagieren können. Wenn es darum geht den Nutzen der OTC-Präparate oder auch das bei der Einnahme zu Beachtende zu bestätigen oder zu erfahren, sind ihre Käufer in hohem Maße von der fachlichen Beratung der ApothekerInnen abhängig. Dies umso mehr als dass rund die Hälfte der in Apotheken abgegebenen Packungen Präparate zur Selbstmedikation enthalten.
Ein nicht unbeträchtlicher Anteil aller Medikationsmittel werden nicht von Ärzten verordnet, sondern direkt von PatientInnen oder um ihre Gesunderhaltung besorgten Gesunden in Apotheken erworben und komplett privat bezahlt. Die meisten dieser Mittel werden von ihren Herstellern als kurativ wie präventiv hilfreich beworben.Eine ganze Reihe dieser so genannten "Over-The-Counter (OTC)"-Arzneimittel sind auch nachgewiesenermaßen hochwirksame Mittel, die zum Teil auch mit anderen Arzneimitteln und dann auch noch zum Nachteil des sie einnehmenden Menschen interagieren können. Wenn es darum geht den Nutzen der OTC-Präparate oder auch das bei der Einnahme zu Beachtende zu bestätigen oder zu erfahren, sind ihre Käufer in hohem Maße von der fachlichen Beratung der ApothekerInnen abhängig. Dies umso mehr als dass rund die Hälfte der in Apotheken abgegebenen Packungen Präparate zur Selbstmedikation enthalten.
Dazu benötigen sie aber bei der Vielzahl alter und neuer Präparate selber wissenschaftlich gesicherte oder evidente Informationen. Und um diese in knapper, verständlicher aber dennoch inhaltlich valider Form zugänglich zu machen, startete eine der populären pharmazeutischen Fachzeitschriften, die "Pharmazeutische Zeitung (PZ)" im Jahr 2015 eine Serie "Evidenzbasierte Selbstmedikation".
Das Mitglied der Chefredaktion, Professor Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, begründete dieses Angebot folgendermaßen, was wegen der weiteren Ereignisse ausführlich zitiert werden soll: "Kommt ein Kunde in die Apotheke, dann entscheidet er zusammen mit dem Apotheker über die nächsten Schritte. Behandlung unnötig? Selbstmedikation? Arztbesuch? Die Apotheker sind hier als Berater in der Schlüsselrolle. Das setzt eine hohe heilberufliche Kompetenz voraus. Aber nicht nur bei der Beantwortung dieser wichtigen Frage, auch bei der Auswahl des am besten für einen bestimmten Patienten geeigneten OTC-Arzneimittels ist die Kompetenz des Apothekers gefragt. Rationale OTC-Arzneimittel sind wahrlich keine Arzneimittel »zweiter Klasse«, vielmehr gelten auch für sie die Prinzipien Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und pharmazeutische Qualität als Grundlage einer jeden Zulassung. Darüber hinaus gilt es im Kontext evidenzbasierter Pharmazie das für die jeweilige Erkrankung am besten geeignete OTC-Arzneimittel auszuwählen. Entscheidende Kriterien müssen dabei an erster Stelle die Ergebnisse klinischer Studien sein. Aber auch die individuellen therapeutischen Erfahrungen des beratenden Apothekers und die Wünsche des Patienten sollten in die Entscheidung eingebracht werden. In den letzten zehn Jahren hat es einen nicht unerheblichen Zuwachs an molekular-pharmakologischen Erkenntnissen und neuen Studiendaten für OTC-Arzneimittel gegeben, weshalb es sich lohnt, Umfang und Qualität der klinischen Evidenz der am häufigsten eingesetzten OTC-Arzneimittel zu kennen und die daraus zu ziehenden Schlüsse in den Beratungsgesprächen zu berücksichtigen."
Worüber die LeserInnen dann durch fundierte und mit Verweisen auf hochwertige Studienliteratur versehene Beiträge von PharmazeutInnen informiert wurden und welche Hinweise auf wissenschaftlich fundierte Hinweise zur Abgabe oder Nichtabgabe an nachfragende Personen sie erhielten, soll an zwei Beispielen aufgezeigt werden:
• Zu Vitamin C-präparaten gegen oder bei Erkältungen heißt es im PZ-Heft 48 2015: "Fazit: Auf der Datenbasis des Cochrane-Reviews senkt die prophylaktische Einnahme von Vitamin C das Risiko für eine Erkältung in der Allgemeinbevölkerung nicht. Eine Ausnahme sind Menschen, die akut starker körperlicher Belastung oder großer Kälte ausgesetzt sind. Dauer und Schweregrad (Zustand von Arbeitsunfähigkeit) verkürzen sich bei regelmäßiger Supplementierung für Erwachsene nur um einige Stunden. Bei therapeutischer Einnahme nach Beginn der Erkältungssymptome ist kein eindeutiger Effekt auf Dauer oder Schweregrad nachweisbar. Unklar ist bisher, ob für die therapeutische Anwendung höhere Dosierungen unter Umständen stärkere Therapieeffekte erzielen - für eine allgemeine Empfehlung sind derzeit aber bessere Belege aus qualitativ hochwertigen Studien nötig."
• Und zum Pelargonium-Extrakt, als "traditionelles Arzneimittel" angepriesen heißt es in der PZ-Ausgabe 8/2016 knapp: "Nutzen wahrscheinlich, aber nur für Tropfen".
Mindestens noch acht vergleichbare Artikel waren geplant, von denen aber letztlich ohne öffentliche Begründung nur vier erschienen.
Woran dies lag, erfuhr der Vorstand des "Verbandes der Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (VdPP)" auf eine Anfrage bei der PZ in seltener Klar- und Offenheit. Der Chefredakteur Daniel Rücker nannte in seinem Antwortschreiben (zitiert nach der Veröffentlichung auf der Website doccheck vom 25. April 2017 zwei Gründe:
• "Zeitschriften wie die PZ sind nach unseren Erfahrungen mit der Serie wegen eines nicht auflösbaren Interessenkonflikts ungeeignet, OTC-Arzneimittel zu bewerten. OTC-Anzeigen sind eine wesentliche Einnahmequelle der PZ. (…) Es gibt schon einzelne OTC-Hersteller, die schnell dabei sind, mit der Stornierung von Anzeigen zu drohen." Und weiter: ""Es gab durchaus Gegenwind von pharmazeutischen Unternehmen. Manche wünschen sich, dass ihre Präparate positiver dargestellt werden, als es die Datenlage hergibt. Doch es war nicht so, dass wir die Serie hätten einstellen müssen. Wir haben nach sechs Folgen aufgehört."
• "Wir hatten erwartet, dass die Serie eine größere Aufmerksamkeit unter Apothekern erzeugt und es sie sehr stark interessiert, welche OTC-Arzneimittel tatsächlich erwiesen wirksam sind und welche nicht. Das war nicht der Fall."
Im Übrigen: Die PZ erscheint in der Avoxa Mediengruppe, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Spitzenverbandes der deutschen Apothekerschaft: der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., ist also keine beliebige Publikation, sondern ein Standesorgan. Die Standesvertretung der ApothekerInnen soll aber nach Angaben des VdPP bisher auf das Bekanntwerden der Gründe "gelassen" reagiert haben.
So müssen ApotherInnen weiterhin auf alltagstaugliche (natürlich könnten sie auch selber stunden- oder tagelang nach Cochrane Reviews etc. suchen und sie zu lesen anfangen, würden dann aber genauso lang in der Apotheke fehlen) valide Antworten zum Nutzen wichtiger OTC-Präparate in ihrer verbandseigenen Fachzeitschrift warten bzw. verzichten und PatientInnen oder KundInnen bekommen entweder keine oder ausschließlich herstellergetränkte Antworten.
Bernard Braun, 27.4.17
Weite Teile der Pharmaindustrie in der wunderbaren Gewinnwelt von Ferrari und Porsche - und manche noch weit darüber
 Ein großer Teil der Beiträge von Ärzten, Krankenhäusern und Produzenten von Gesundheitsprodukten zur gesundheitspolitischen Debatte kreist um fehlende oder u.a. für die immer gewaltigen Investitionen zur Entwicklung neuer Produkte zu geringen Erträge. Einen rhetorischen Spitzenplatz nimmt hierbei die Pharmabranche ein.
Ein großer Teil der Beiträge von Ärzten, Krankenhäusern und Produzenten von Gesundheitsprodukten zur gesundheitspolitischen Debatte kreist um fehlende oder u.a. für die immer gewaltigen Investitionen zur Entwicklung neuer Produkte zu geringen Erträge. Einen rhetorischen Spitzenplatz nimmt hierbei die Pharmabranche ein.
Dass dies nicht der einzige Spitzenplatz ist, zeigt nun ein aktuell möglicher Vergleich eines anerkannten Indikators für die Ertragssituation von Wirtschaftsunternehmen. Es geht um die so genannte EBIT-Marge, die den Anteil des gesamten Gewinns vor Steuern und anderen Abzügen (Earnings Before Interest and Taxes) am Gesamtumsatz angibt. Je höher desto besser.
Für das Jahr 2015 schwankt diese Marge nach entsprechenden Bilanzanalysen der Unternehmensberatung Ernest & Young (trotz der aktuellen Zweifeln an der Verlässlichkeit dieser Branche - siehe die Debatte um die Beratungsleistung beim Verkauf des Flughafens Hahn - trauen wir ihrer EBIT-Analyse) zwischen den Branchen erheblich. Und: "Eine zweistellige EBIT-Marge spricht in der Regel für ein gesundes und profitables Unternehmen."
Der Vergleich zwischen Pharmaunternehmen, Herstellern von PKW's und Herstellern von PKW-Zubehör, also volkswirtschaftlich durchaus bedeutenden Unternehmen zeigt für das Jahr 2015 folgendes:
• Die EBIT-Marge der Autozulieferer betrug 7,4%, die als "Rekordwert" bewertet wird.
• In der Automobilindustrie gab es je nach Hersteller leichte Unterschiede: Toyotas Marge betrug 10,3%, Mercedes-Benz landete bei 9% und BMW bei 10,4%. Dass die Spannbreite in dieser Branche durchaus noch größer sein kann, zeigt eine differenziertere Statistik für das Jahr 2013. Damals schwankte die Marge zwischen 18% für Porsche, 12,5% für Ferrari Maserati und 5% bis 7% bei den meisten anderen Herstellern. Einige Unternehmen hatten allerdings auch negative Werte.
• Die EBIT-Marge der TopTen der Pharmabranche betrug 2015 dagegen rund 28%. Auch hier gab es große Unterschiede: Biotech-Unternehmen landeten zum Teil bei Margen von über 40%, einige der großen Pharmaunternehmen mussten sich mit kleineren, aber immer noch zweistelligen Margen begnügen. Die Margen der auf den Plätzen 11 bis 20 stehenden Unternehmen betrugen z.B. immer noch durchschnittlich 19,6%. Die Margen haben durchweg von 2014 auf 2015 um bis zu zweistellige Prozentbeträge zugenommen. Richtig ist aber auch, dass es vor 2014 bei einigen Unternehmen niedrigere Margen gab, was aber im Nachhinein lediglich als "Schwächephase" bewertet wird. Ernest & Young titelt daher im Mai 2016: "Weltweit größte Pharma-Unternehmen wachsen kräftig - Big Biotech legt am stärksten zu."
Auch wenn das Streben von Managern und Anteilseignern nach hohen zweistelligen oder gar dreistelligen EBIT-Margen nachvollziehbar sein mag, rechtfertigen die aktuellen Werte in der Pharmaindustrie in keiner Weise das Krisenlamento, wenn gesundheitspolitisch z.B. über die teilweise exorbitanten Preise einiger Arzneimittel diskutiert wird.
Die Angaben zur Margensituation bei den Autozulieferern stammen aus der Wirtschaftswoche vom 7.7.2016.
Die 2015er-EBIT-Daten zur Pharmabranche finden sich in einem Report von Ernest & Young.
Mehr über die Margensituation ausgewählter Pkw-Hersteller im Jahr 2015 erfährt man mit Zugangsbeschränkungen bei statistik.com und hier uneingeschränkt für 2013.
Bernard Braun, 25.7.16
Unheilbarer Krebs: die meisten Patienten wünschen vollständige Informationen
 Welche Informationen wünschen Patienten mit Krebs und welche wünschen sie nicht - diese Frage untersuchten holländische Wissenschaftler an 77 Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Zweitlinien-Chemotherapie standen. Bei diesen Patienten lag ein fortgeschrittener, nicht heilbarer Brustkrebs oder Darmkrebs vor, der sich unter der ersten Chemotherapie (Erstlinientherapie) weiter ausgebreitet hatte. Die Erfolgsaussichten einer Zweitlinientherapie sind zumeist eher gering oder auch unklar.
Welche Informationen wünschen Patienten mit Krebs und welche wünschen sie nicht - diese Frage untersuchten holländische Wissenschaftler an 77 Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Zweitlinien-Chemotherapie standen. Bei diesen Patienten lag ein fortgeschrittener, nicht heilbarer Brustkrebs oder Darmkrebs vor, der sich unter der ersten Chemotherapie (Erstlinientherapie) weiter ausgebreitet hatte. Die Erfolgsaussichten einer Zweitlinientherapie sind zumeist eher gering oder auch unklar.
Im Gegensatz zu anderen Studien, in denen Patienten mit einer hypothetischen Situation konfrontiert wurden, ging es in dieser Studie um eine "echte" Behandlungsentscheidung.
Die Patienten erhielten von ihrem Onkologen die üblichen Informationen über die Behandlung. Eine Pflegekraft bot ihnen zusätzlich Informationen auf Grundlage einer Entscheidungshilfe zu den Bereichen unerwünschte Wirkungen (Schaden), Tumorwachstum und Überleben an.
Die Information erfolgte schrittweise, indem die Pflegekraft erst erklärte, was für Informationen der Patient zu erwarten hatten damit dieser entscheiden konnten, ob er die Informationen erhalten wollte. Zum Thema Überleben erklärte die Pflegekraft beispielsweise das Konzept der mittleren Überlebenszeit mit dem Hinweis darauf, dass sich die Überlebenszeit für den einzelnen Patienten nicht genau vorhersagen lässt.
Die Patienten wurden befragt, zu welchen Bereichen sie sich informieren wollten. Die Ärzte wurden befragt, zu welchen Bereichen die Patienten nach ihrer Einschätzung informiert werden wollten.
95% der Patienten wollten zu unerwünschten Wirkungen informiert werden, 91% über das Ansprechen des Tumors auf die Therapie und 75% über die Überlebenszeit.
Die Ärzte schätzten den Informationswunsch auf 100%, 97% und 81%.
Informationswunsch des Patienten und Einschätzung des Arztes stimmten in 62% der Fälle überein.
Diese Studie zeigt, dass die meisten aber nicht alle Patienten voll über den Nutzen und den Schaden einer Chemotherapie informiert werden möchten. Selbst über die sehr sensible Frage der verbleibenden Lebenszeit wünschen 75% der Patienten informiert zu werden. Von Seiten der Ärzte werden die Informationsbedürfnisse der Patienten zwar zutreffend als hoch eingeschätzt, bezogen auf den einzelnen Patienten liegen sie aber nur zu 62% richtig. Dies unterstreicht einmal mehr die Aufgabe des Arztes, auf jeden Patienten einzugehen und ihn darin zu unterstützen, seine Bedürfnisse bezüglich Information und Behandlung zu erkennen und mitzuteilen.
Oostendorp LJM, Ottevanger PB, van de Wouw AJ, et al. Patients' Preferences for Information About the Benefits and Risks of Second-Line Palliative Chemotherapy and Their Oncologist's Awareness of These Preferences. Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education 2015. Volltext
David Klemperer, 11.7.16
Über- und Fehlbehandlung von älteren Personen: Blutdrucksenkung trotz normalem oder niedrigem Blutdruck
 Nicht genug, dass Überversorgung ein national wie international trotz aller Transparenz über die Art und den Umfang und entsprechenden versorgungspolitischen Debatten weit verbreitetes Behandlungsmuster ist und immer wieder Krankheiten für Therapeutika gesucht und kreiert werden, die eigentlich keine bzw. nichts Behandlungsbedürftiges sind (um was es geht findet man unter dem Stichwort "disease mongering" u.a. in diesem Forum). Es gibt aber offensichtlich auch kontinuierliche Behandlungen mit hochwirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Therapeutika ohne Behandlungsgrund oder Erkrankung, also tendenziell schädigende Fehlbehandlung.
Nicht genug, dass Überversorgung ein national wie international trotz aller Transparenz über die Art und den Umfang und entsprechenden versorgungspolitischen Debatten weit verbreitetes Behandlungsmuster ist und immer wieder Krankheiten für Therapeutika gesucht und kreiert werden, die eigentlich keine bzw. nichts Behandlungsbedürftiges sind (um was es geht findet man unter dem Stichwort "disease mongering" u.a. in diesem Forum). Es gibt aber offensichtlich auch kontinuierliche Behandlungen mit hochwirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Therapeutika ohne Behandlungsgrund oder Erkrankung, also tendenziell schädigende Fehlbehandlung.
Ein aktuelles und auch quantitativ relevantes Beispiel sind die Ergebnisse einer retrospektiven Analyse der Blutdruckwerte und Behandlung mit bluthochdrucksenkenden Arzneimitteln von 11.167 über 70-jährigen Versicherten des National Health Service (NHS) in Großbritannien in den Jahren 2005 und 2015. 9.870 von duiesen Personen hatten einen systolischen Blutdruckwert von 120 mmHg und größer, waren also, sofern dies ein Dauerwert war, potenziell behandlungsbedürftig. 1.297 von diesen Personen hatten einen systolischen Blutdruck von unter 120 mmHg, also einen völlig "gesunden" und nicht behandlungsbedürftigen Wert.
Trotzdem erhielten rund 65% der Personen mit einem bereits niedrigen systolischen Blutdruckwert zwischen 100 und 119 mmHg und 70% der Personen mit einem noch niedrigeren systolischen Wert mindestens ein blutdrucksenkendes Medikament verordnet. Von den Personen mit einem systolischen Blutdruckwert von weniger als 100 mmHg nahmen jeweils 17,2% zwei oder drei Blutdrucksenker ein. Daran änderte sich während des gesamten Untersuchungszeitraums für 41% dieser Personen nichts, bei 34% von ihnen wurde die Medikation aber etwas verringert.
Dass es sich dabei nicht nur um eine gesundheitlich nicht notwendige aber kostenträchtige Behandlung handelt, sondern die Absenkung eines bereits niedrigen Blutdruckwertes auch gesundheitlich nachteilig sein könnte, legen die für diese Personengruppe erhöhten Werte für Krankenhauseinweisungen, Sterblichkeit und Herzschwäche nahe. In multivariaten Analysen war der Blutdruckwert außerdem ein unabhjängiger Prädiktor für diese Behandlungsereignisse. Dies alles
schließt allerdings nicht aus, dass die Ereignisse Folgen einer nicht erfassten Erkrankung waren.
Zusammenfassend kommen die AutorInnen zu dem Schluss: "The results demonstrate that low SBP (systolic blood pressure) is associated with adverse events, it is possible that the pursuit of BP (blood pressure) control at a population level may lead to over-treatment in certain groups of patients. This may result in an increased incidence of adverse events particularly in older people."
Die Studie Older people remain on blood pressure agents despite being hypotensive resulting in increased mortality and hospital admission von Yvonne Morrissey, Michael Bedford, Jean Irving und Chris K. T. Farmer ist am 30. Juni 2016 in der Zeitschrift "Age and Ageing" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.7.16
Viel hilft viel - auch bei rezeptfreien Arzneimitteln nicht zu empfehlen, wie viel nicht schadet, kann aber reichlich unklar sein.
 Wer es nicht schon immer gewusst hat, dass rezeptfreie Arzneimittel nicht nur gegen Beschwerden wirksam sein können, sondern auch gravierende, ja lebensgefährliche Nebenwirkungen haben können, erfährt dies für ein häufig genutztes Mittel gegen Durchfall heute durch eine Warnmeldung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Sie hat darauf hingewiesen, dass eine Überdosierung des Wirkstoffs Loperamid zu schwerwiegenden Nebenwirkungen am Herzen führen kann.
Wer es nicht schon immer gewusst hat, dass rezeptfreie Arzneimittel nicht nur gegen Beschwerden wirksam sein können, sondern auch gravierende, ja lebensgefährliche Nebenwirkungen haben können, erfährt dies für ein häufig genutztes Mittel gegen Durchfall heute durch eine Warnmeldung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Sie hat darauf hingewiesen, dass eine Überdosierung des Wirkstoffs Loperamid zu schwerwiegenden Nebenwirkungen am Herzen führen kann.
Wie verbreitet der Wirkstoff seit langem ist, zeigt der folgende Auszug aus der Herstellerinformation eines loperamidhaltigen Markenmedikaments: "Loperamid ist in Deutschland schon seit 1976 unter IMODIUM® erhältlich und als IMODIUM® akut die Nummer 1 in der Selbstmedikation von akutem Durchfall."
Während auf derselben Website nur noch von vielen positiven Eigenschaften berichtet wird (Stand: 10. Juni 2016), äußert sich der AMK-Vorsitzende Martin Schulz unmissverständlich so: "Rezeptfrei heißt nicht harmlos: Wenn Loperamid missbräuchlich oder aus Versehen überdosiert wird, kann das lebensgefährlich sein".
Wie schwierig es aber auch bei solchen Medikamenten für PatientInnen ist, sich verlässliche Informationen zu verschaffen und sich vor Schäden zu bewahren, zeigt das Informationsgeschehen dieser Woche mehrfach.
• Erstens folgt die Meldung der AMK einer bereits am 7. Juni 2016 von der US-amerikanischen "Food and Drug Administration (FDA)" verbreiteten Meldung (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse). Dort wird zu der Menge des Wirkstoffs, die zu den gefährlichen Nebenwirkungen führen kann, folgendes gesagt: "The maximum approved daily dose for adults is 8 mg per day for OTC use and 16 mg per day for prescription use." Ergänzt wird diese Information noch durch deutliche Hinweise, Arzneimittel mit diesem Wirkstoff nicht länger als 2 Tage einzunehmen.
• Zweitens verbreitet eine Presseinformation der ABDA die Warnung der AMK am 10. Juni 2016 um 9.16 Uhr mit dem ausdrücklichen Hinweis, "die empfohlene Höchstdosis für Loperamid liegt für Erwachsene bei 16 Milligramm pro Tag". Da die "meisten Präparate ... 2 Milligramm pro Kapsel (enthalten)", "darf die Tageshöchstdosis von 8 Kapseln...nicht überschritten werden".
• Drittens meldet schließlich eine weitere ABDA-Presseinformation um 11.57 Uhr desselben Tages, dass in der ersten Meldung ein "Fehler unterlaufen" sei und die Tageshöchstdosis 12 Milligramm betrüge, was 6 Kapseln entspräche. Dies empfiehlt im Übrigen auch der Hersteller von Imodium selber auf seiner Website und wahrscheinlich auch schon längere Zeit im Beipackzettel.
Am Ende der informationsträchtigen Woche stellt sich also die Frage, ab welcher Menge des Wirkstoffs es denn jetzt für Erwachsene gefährlich werden kann: 8 mg oder 16 mg der FDA (diese Empfehlung gibt es offensichtlich auch schon länger, ohne dass selbst bei Lektüre der gesamten Information klar wird, warum 16 mg auf Rezept und mit verordnendem Arzt (?) keine gefährlichen Nebenwirkungen haben) oder doch lieber die fehlerfreien 12 mg der AMK bzw. des Herstellers? Und was, wenn die einzelne Kapsel oder Tablette mehr oder weniger als 2 mg Loperamid enthält - was man hoffentlich weiß und findet?
Und wenn sich offensichtlich im Moment verschiedene Experten nicht auf eine einfache mg-Höchstdosis einigen können, wirkt der zusätzliche Hinweis der AMK, "dass auch durch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln das Risiko für Nebenwirkungen von Loperamid steigt" und Personen, die z.B. Imodium einnehmen, "sollten in der Apotheke nach möglichen Wechselwirkungen fragen" nicht wirklich hilfreich. Es darf geraten werden: Auf wie viel Milligramm Loperamid muss man verzichten, um das genannte Risiko wieder zu senken und auf welches Niveau?
Klar ist also bei Reisedurchfall: so wenig wie möglich auch wenn trotz aller Informationsfülle nicht klar ist, was wenig ist und dies nicht länger als 48 Stunden ohne Arzt. Was zu tun ist, wenn kein gut informierter Arzt oder Apotheker in Reichweite des mit der Rache des Montezuma oder den Wirkungen sonstiger sommerlicher Salmonellenzuchtbasen (z.B. Tiramisu oder Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Ei) kämpfenden Reiseapotheken-Urlaubers ist, bleibt hier mal offen.
Die Größe des Risikos unerwünschter gesundheitlicher Wirkungen im Falle des Überschreitens einer der Höchstdosen sieht in den USA laut FDA so aus: Von 1976 bis 2015 wurden der FDA 48 Berichte über schwere, mit der Anwendung von Loperamid-assozierte Herzprobleme gemeldet. In 10 Fällen verstarben die Patienten. Der Anteil der geschädigten PatientInnen, die versehentlich eine zu hohe Dosis eingenommen hatten war sogar kleiner, da die FDA vermutet, dass Loperamid in einigen Fällen absichtlich in hohen Dosen konsumiert wurde, um Sucht-Entzugssymptome zu lindern oder Euphoriegefühle auszulösen.
Bernard Braun, 11.6.16
"Sugar shock": Das zehnjährige Ab und gewaltige Auf der Preise für orale Antidiabetika und Insulin in den USA
 Passend zum diesjährigen Weltgesundheitstag am 7. April 2016 und seinem Schwerpunktthema Diabetes liegen die Ergebnisse einer Analyse der Kostenentwicklung verschiedener Diabetes-Therapeutika bzw. blutzuckersenkenden Arzneimittel in den Jahren 2002 bis 2013 für die USA vor.
Passend zum diesjährigen Weltgesundheitstag am 7. April 2016 und seinem Schwerpunktthema Diabetes liegen die Ergebnisse einer Analyse der Kostenentwicklung verschiedener Diabetes-Therapeutika bzw. blutzuckersenkenden Arzneimittel in den Jahren 2002 bis 2013 für die USA vor.
Dazu werteten die ForscherInnen die Diagnose- und Behandlungsdatren von fast 28.000 Personen, die in diesem Zeitraum aufgrund einer Diabetesdiagnose behandelt worden sind.
Danach erhöhten sich die Kosten für Insulin innerhalb eines Jahrzehnts um gut das Dreifache von durchschnittlich 231 US-Dollar auf 736 US-Dollar pro Jahr. Die Kosten für einen Milliliter Insulin stiegen entsprechend von 4,34 US-Dollar auf 12,92 US-Dollar.
Interessant ist, dass im Untersuchungszeitraum der durchschnittliche jährliche Verbrauch von Insulin von 171 auf 206 Milliliter stieg - wahrscheinlich aufgrund des gestiegenen Gewichts der PatientInnen und neuer nationaler Empfehlungen für das Erreichen des Behandlungsziels.
Ganz anders sah die Preisentwicklung bei allen anderen oralen Antidiabetika aus: Die Ausgaben für sie sanken in konstanten Preisen von rund 600 US-Dollar auf 502 US-Dollar. Der Preis für das weit verbreitete und als Generika verfügbare Metformin sank von 1,24 US-Dollar pro Tablette auf gerade noch 31 Cent. Der stärkste Preisrückgang erfolgte bis 2011. Und selbst die neuen Medikamente, wie z.B. der DPP4-Inhibitoren, Gliptine oder Inkretinverstärker verteuerten sich ab ihrem Marktzugang 2006 bis 2013 "nur" um 34 %.
25% der untersuchten Personen wurden mit Insulin behandelt und zwei Drittel nahmen zusätzlich orale Mittel zur Blutzuckersenkung. Nur wenige Prozent begannen neuentwickelte injizierbare Arzneimittel zu nutzen.
Unbekannt war in dieser Studie welche Art von Insulin gespritzt wurde und ob die PatientInnen von den oralen Antidiabetika Original-Präparate oder Generika einnahmen.
Ob es eine solche unterschiedliche Entwicklung auch in Deutschland gab, ist nicht bekannt, könnte aber mit vorhandenen Daten für einen längeren Zeitraum untersucht werden. Ein erster Hinweis: 2011 betrugen die jährlichen Kosten für Insulin für Typ 2 Diabetiker 774 Euro, also sogar mehr als im selben Jahr in den USA.
Von dem am 5. April 2016 erschienenen Forschungsbrief Expenditures and Prices of Antihyperglycemic Medications in the United States: 2002-2013 von Xinyang Hua et al. - erschienen in der Fachzeitschrift "Journal of the American Medical Association" (315(13): 1400-1402) - ist ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.4.16
Handy-Textbotschaften verbessern die Therapietreue bei chronisch kranken Personen: Ja, aber mit zahlreichen Einschränkungen.
 Die so genannte Therapietreue, Compliance oder Adhärenz von PatientInnen mit der langanhaltenden medikamentösen Behandlung einer chronischen Erkrankung ist schlecht. Zahlreiche Studien und ein Review der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommen zum Ergebnis, dass rund die Hälfte dieser PatientInnen die ihnen verordneten Medikamente entweder gar nicht oder nicht in der für ihre Wirkung notwendigen Menge oder Frequenz einnehmen. Dies kann erhebliche gesundheitliche Nachteile auslösen und stellt eine enorme finanzielle Verschwendung knapper Ressourcen dar.
Die so genannte Therapietreue, Compliance oder Adhärenz von PatientInnen mit der langanhaltenden medikamentösen Behandlung einer chronischen Erkrankung ist schlecht. Zahlreiche Studien und ein Review der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommen zum Ergebnis, dass rund die Hälfte dieser PatientInnen die ihnen verordneten Medikamente entweder gar nicht oder nicht in der für ihre Wirkung notwendigen Menge oder Frequenz einnehmen. Dies kann erhebliche gesundheitliche Nachteile auslösen und stellt eine enorme finanzielle Verschwendung knapper Ressourcen dar.
Daher untersuchten ebenfalls zahlreiche Studien immer wieder, ob es nicht Instrumente, Prozeduren oder Methoden gibt, diesen Anteil zu veringern. Meistens blieb deren Wirkung aber gering.
Mit der wachsenden Verbreitung und Nutzung von mobilen Telefonen und von mit ihnen zu empfangenden Textbotschaften, untersuchten weitere Studien, ob sie eines dieser Hilfsmittel sein könnten.
Eine im März 2016 veröffentlichte Meta-Analyse von 16 randomisierten kontrollierten Studien versuchte darauf belastbare Antworten zu geben. In 5 der Studien waren die Textbotschaften personalisiert, 8 erlaubten Zweiwegkommunikation und in 8 gab es tägliche Botschaften oder Hinweise. Die durchschnittliche Interventionsdauer betrug 12 Wochen und die Feststellung der Wirksamkeit auf die Therapietreue beruhte auf Selbsteinschätzung der PatientInnen.
Die Ergebnisse lauteten:
• Die Meta-Analyse der Effekte auf 2.742 PatientInnen zeigte eine signifikante Verbesserung der Therapietreue. Die Chance verdoppelte sich (odds ratio 2,11). Und verringerte sich nach einer rechnerischen Berücksichtung eines so genannten "publication bias" leicht auf den immer noch signifikanten Wert von 1,68.
• Die unterschiedlichen Kommunikationsweisen wirkten sich nicht auf die Wirkung der Intervention aus.
• Einschränkend weisen die AutorInnen darauf hin, dass sich der Anteil der therapietreuen PatientInnen durch die Textbotschaften per Smartphone lediglich von 50% auf 67,8% vergrößert und nachwievor über 30% noncompliant sind.
• Unklar bleibt außerdem, ob sich der Effekt nach einer längeren Interventionszeit weiter erhöht, stagniert oder sogar wieder abnimmt. Dies gilt auch dann, wenn die Interventionen aufhören.
• Die AutorInnen sind sich auch unsicger, ob sie sich gerade bei der Therapietreue auf die Selbstangaben der PatientInnen verlassen können, die u.U. dadurch als zu positiv angegeben werden, weil Therapetreue ein offensichtlich sozial erwünschtes Ergebnis ist.
• Offen bleibt schließlich, ob die verbesserte Therapietreue überhaupt einen positiven Einfluss auf die Behandlungsergebnisse hat.
Bevor diese offenen Fragen und Schwächen nicht in weiteren Studien eindeutig geklärt sind, sollten Textbotschaften per Mobiltelefon nicht als die Lösung für alle Therapietreueprobleme betrachtet werden.
Der Aufsatz Mobile Telephone Text Messaging for Medication Adherence in Chronic DiseaseA Meta-analysis von Jay Thakkar et al. ist im März 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" (176(3): 340-349) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.4.16
Keine "schwarze Schafe" sondern Schattenseite der gewinnorientierten Gesundheitswirtschaft?! Die "Fälle" Olympus und Valeant
 Über das Verhalten der Pharmaindustrie oder anderer Produzenten von Gesundheitsgütern gibt es zahlreiche negative Urteile, Behauptungen oder Erwartungen, die von den damit gemeinten Unternehmen und ihren Verbänden fast reflexartig als Vorurteile oder als Herauspicken weniger oder kleiner "schwarzer Schafe" abgetan werden. Konkret werden beispielsweise exorbitant hohe Preise der Produkte mit den milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungskosten begründet und stets das Image des vor allem dem Wohl des Patienten verpflichteten Unternehmens gepflegt.
Über das Verhalten der Pharmaindustrie oder anderer Produzenten von Gesundheitsgütern gibt es zahlreiche negative Urteile, Behauptungen oder Erwartungen, die von den damit gemeinten Unternehmen und ihren Verbänden fast reflexartig als Vorurteile oder als Herauspicken weniger oder kleiner "schwarzer Schafe" abgetan werden. Konkret werden beispielsweise exorbitant hohe Preise der Produkte mit den milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungskosten begründet und stets das Image des vor allem dem Wohl des Patienten verpflichteten Unternehmens gepflegt.
Dafür, ob dies wirklich so oder völlig anders ist, gibt es fast nie oder nur selten griffige Belege bzw. die sprichwörtlichen "rauchenden Colts".
Umso interessanter sind zwei gut mit Originaldokumenten belegte Fälle eines der weltweit größten Anbieter von diagnostischen Geräten (Olympus) und eines großen kanadischen Arzneimittelherstellers (Valeant Pharmaceuticals), die beide erhebliche Zweifel an der positiven Selbstdarstellung zu lassen.
Im Falle der Firma Olympus geht es um endoskopische Geräte der Firma, die durch ihre Konstruktion so schwer oder gar nicht keimfrei gemacht werden können, dass Patienten durch den Einsatz dieser Geräte infiziert werden können. Dies bemerkte u.a. eines der größten Krankenhäuser im US-Bundesstaat Kalifornien und Anwender dieser Geräte, das "Ronald Reagan Medical Center" der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) u.a. durch den Tod von drei Patienten und die schwere Erkrankung von fünf weiteren Patienten an resistenten Bakterien, die im Gerät existieren konnten und durch dessen Gebrauch übertragen wurden. Nachdem das Krankenhaus diesen Konstruktionsfehler und die unerwünschten Folgen dem Hersteller mitteilte und den Ersatz von 35 Geräten verlangte, weigerte sich Olympus mit einer einmaligen Ausnahme. Stattdessen bot die Firma dem Krankenhaus mit dem es im Übrigen jahrelang eng zusammenarbeitete, die Lieferung neuer Geräte zu einem Preis an, der 28% höher lag als der, den sie selber wenige Monate vorher für die dann fehlerhaften Geräte verlangt und erhalten hatte. Auf den Hinweis, die Firma versuche damit von einer Versorgungskrise zu profitieren (die Firma sprach für das betreffende Geschäftsjahr selber von einer "record breaking" Gewinnerhöhung von 13%), die sie durch ihre Gerätemängel selber geschaffen habe, bot Olympus lediglich an, über Rabatte nachzudenken, wenn das Krankenhaus mehr Geräte bestellen würde.
Nach der bundesweiten Warnung vor den Risiken der Geräte durch die "Food and Drug Administration (FDA)" behauptete Olympus sowohl gegenüber den Angehörigen eines verstorbenen Patienten als auch im Rahmen eines ersten Gerichtsverfahrens, die Schuld an den Vorfällen läge bei Beschäftigten der Klinik, die sich nicht an die Instruktionen des Herstellers gehalten hätten. Daran hielt Olympus trotz der Feststellung der FDA fest, die Infektionen würden selbst dann stattfinden, wenn sich die Kliniken an die Herstellerhinweise hielten. Und auch eine Untersuchung des US-Senats, in der für den Zeitraum 2012 bis 2015 19 schwere Infektionsausbrüche ("superbug outbreaks") in den USA und Europa durch Olympusgeräte dokumentiert sind und auch die mangelhafte oder zögerliche Aufklärung von Kliniken durch die Firma kritisiert wurde, änderte am aktuellen Verhalten der Firma bisher nichts. Das UCLA-Krankenhaus kauft die Geräte mittlerweile bei einem anderen Hersteller.
Dass es sich nicht um einen einmaligen "Ausrutscher" der Firma oder einzelner Mitarbeiter handelte, zeigt schließlich die Tatsache, dass Olympus bereits in 2016 einer Strafzahlung von 646 Millionen US-Dollar zustimmte, damit weitere Ermittlungen wegen massiver Verstöße gegen geltendes US-Recht (u.a. Verbot diverser finanzieller Vergünstigungen für Ärzte) eingestellt werden.
Die ganze Geschichte, verfasst von Chad Terhune und Melody Petersen, ist versehen mit Auszügen von Mails der Firma an die Klinik am 25. März 2016 unter der Überschrift Device Maker Olympus Hiked Prices For Scopes As Superbug Infections Spread in der Los Angeles Times und den Kaiser Health News veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Ebenfalls in dem von jedermann abonnierbaren aber fast ausschließlich über US-Ereignisse berichtende Newsletter "Kaiser Health News" erschien am 28. März 2016 der Bericht Pharmaceutical Company Has Hiked Price On Aid-In-Dying Drug von April Dembosky.
Für das weitere Verständnis sei daran erinnert, das im Bundesstaat Kalifornien ähnlich wie z.B. schon länger im Bundesstaat Oregon nach langen öffentlichen Debatten mit einer parlamentarischen Mehrheit ein Gesetz verabschiedet wurde - das so genannte "aid-in-dying law" -, das bestimmten todkranken PatientInnen die Selbsttötung mit legal zugänglichen bzw. verschreibungspflichtigen Medikamenten ermöglicht. Selbstverständlich kann und darf man dazu weiterhin verschiedener Meinung sein und diese Möglichkeit ethisch ablehnen.
Das Verhalten des Herstellers eines dafür gut geeigneten und die PatientInnen relativ gering belastenden Arzneimittels hat aber nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun.
Das Mittel Seconal auch mit der Bezeichnung Secobarbital erhältlich, wurde im Jahr 1930 als Schlafmittel entwickelt und erwies sich bei einer Überdosierung oder in Kombination mit Alkohol als potenziell tödlich. Daher gilt es auch als "Mittel der Wahl" für die Selbsttötung nach dem geltenden Gesetz.
Im Jahr 2009 kostete eine tödliche Dosis von maximal 100 Kapseln (dies wird oft genannt, wird aber ebenso häufig bestritten und für zu hoch erklärt) weniger als 200 US-Dollar. Während der folgenden sechs Jahre stieg der Preis für diese Dosis auf 1.500 US-Dollar, um nach dem Kauf des Herstellers durch die Firma Valeant im Februar 2015 auf 3.000 US-Dollar zu steigen.
Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Dieselbe Firma erhöhte nach weiteren Aufkäufen anderer Pharmaunternehmen deren Preise um bis zu 500%. Sie kann dies vor allem bei dem vor 80 Jahren entwickelten Seconal nicht durch Forschungskosten rechtfertigen, sondern nutzt nur ohne jegliche Zurückhaltung das Fehlen von ähnlich wirksamen Generika oder den bei der 400-Dollar-Alternative eines Cocktails von drei Medikamenten erforderlichen Aufwand.
Auch wenn das Verhalten der kanadischen Firma Valeant in Deutschland nicht 1:1 möglich wäre, unterstreicht es, dass das Vertrauen auf ein "vernünftiges Marktverhalten" oder das Sichverlassen auf freiwillige Selbstverpflichtungen bzw. Verhaltens-Kodes solcher Firmen nicht zwangsläufig gegen "schwarze Schafe" hilft und stattdessen gezielte staatliche Regulation notwendig ist.
Bernard Braun, 30.3.16
Verständliche Transparenz über die Arbeit wichtiger Akteure im Gesundheitswesen: Das Beispiel IQWiG.
 Angesichts der Bedeutung, die das "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" mit seinen wissenschaftlichen Gutachten für den "kleinen Gesetzgeber" im Gesundheitswesen, den "Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)" hat, und für was es inhaltlich zuständig ist, ist möglichst viel Transparenz über seine Funktion und Tätigkeit in verständlicher Form notwendig.
Angesichts der Bedeutung, die das "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" mit seinen wissenschaftlichen Gutachten für den "kleinen Gesetzgeber" im Gesundheitswesen, den "Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)" hat, und für was es inhaltlich zuständig ist, ist möglichst viel Transparenz über seine Funktion und Tätigkeit in verständlicher Form notwendig.
Daher ist der Start einer Reihe von Berichten zu begrüßen, die unter dem Titel "Auf den Punkt gebracht" Übersichten und Grafiken enthalten, welche die IQWiG-Arbeit veranschaulichen und Erkenntnisse aus Arbeitsergebnissen illustrieren sollen.
Der Schwerpunkt der ersten 25-seitigen Ausgabe liegt im Bereich der durch das "Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG)" (§ 35a SGB V) geregelten frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Dort wird "über den Weg eines Arzneimittels von der Entwicklung über die Marktzulassung bis hin zu Preisgestaltung und Erstattung, die einzelnen Phasen des AMNOG-Verfahrens, die Bewertungsergebnisse des IQWiG seit 2011 und den Informationsgewinn durch zusätzliche Studiendaten" berichtet.
Weitere Informationen erhält man zu folgenden Themen:
• "Fakten zum selektiven Publizieren von Studienergebnissen sowie zu Anforderungen an klinische Studien bei seltenen Erkrankungen oder Behandlungswechseln in onkologischen Indikationen."
• Wie vermitteln gute Gesundheitsinformationen die Häufigkeit von Nebenwirkungen am besten an Patientinnen und Patienten.
• "In welcher Weise führen verschiedene Länder Kosten-Nutzen-Bewertungen durch?"
Zum Schluss werden die Rechtsgrundlagen des IQWiG und sein Aufbau dargestellt.
Umso problematischer ist es, dass es für andere, zum Teil seit vielen Jahren für wichtige Bereiche der Finanzierung, der Qualität und Regulierung im Gesundheitswesen zuständigen traditionell korporatistisch verfassten Einrichtungen wie z.B. den Bewertungsausschuss (§ 87 Abs. 1 SGB V) oder die u.a. für die Entwicklung und Einführung der elektronischen Gesundheitskarte gegründete Gesellschaft für Telematik (§ 291b SGB V) keine vergleichbare Transparenz gibt. Immerhin hat die Gesellschaft für Telematik seit ihrer Gründung rund 1 Milliarde Euro Versichertengelder ausgegeben und damit gerade mal ein gedrucktes Bild des GKV-Versicherten auf der eGK zustande gebracht. Jetzt droht ihr bzw. ihren Trägern zusammen mit der Industrie durch das sogenannte eHealth-Gesetz zum nächsten praktischen Schritt gezwungen zu werden.
Die Broschüre "Auf den Punkt gebracht. Zahlen und Fakten aus dem IQWiG 2015 - Schwerpunkt AMNOG" ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.12.15
Neue Krebsmedikamente 5: Fortgeschrittener Krebs - keine Chemotherapie ist auch eine Option
 Beitrag Fortgeschrittener Krebs - keine Chemotherapie ist auch eine Option
Beitrag Fortgeschrittener Krebs - keine Chemotherapie ist auch eine Option
David Klemperer, 25.11.15
Neue Krebsmedikamente 5: Niedrige Zulassungshürden behindern Fortschritte in der Forschung
 In den Jahren 2002 bis 2014 hat die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde 71 Krebsmedikamente zur Behandlung fortgeschrittener Krebserkrankungen ("metastatic and/or advanced and/or refractory solid tumors") neu zugelassen. In ihrer Analyse dieser 71 Medikamente berechnen die Autoren einer amerikanischen Studie den Gewinn an Lebenszeit über alle Medikamente hinweg mit 2,1 Monaten (Median).
In den Jahren 2002 bis 2014 hat die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde 71 Krebsmedikamente zur Behandlung fortgeschrittener Krebserkrankungen ("metastatic and/or advanced and/or refractory solid tumors") neu zugelassen. In ihrer Analyse dieser 71 Medikamente berechnen die Autoren einer amerikanischen Studie den Gewinn an Lebenszeit über alle Medikamente hinweg mit 2,1 Monaten (Median).
Mit 19,7 Monaten Verlängerung der Überlebenszeit ist die Substanz Cetuximab bei einer bestimmten Form eines Kopf- und Halstumors (Plattenepithelkarzinom) in Verbindung mit Bestrahlung am effektivsten. Mit weitem Abstand folgt als zweiteffektivste Substanz Oxaliplatin als Ersttherapie bei metastasiertem Dickdarmkrebs, das einen Gewinn an Lebenszeit von 5,6 Monaten verspricht. Zugelassen wurden auch 2 Medikamente, die die Lebenszeit verkürzen. Pemetrexed lässt Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom in der Erstbehandlung 0,3 Monate kürzer leben, Pazopanib verkürzt das Leben von Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom gar um 0,6 Monate.
23 der 71 Medikamente wurden zugelassen, obwohl keine Informationen über die Auswirkungen auf die Lebenszeit vorlagen.
Der Median für das Surrogatkriterium progressionsfreies Überleben beträgt 2,5 Monate. Ein deutlicher Zusammenhang zwischen diesem Surrogatkriterium und dem patienterelevanten Kriterium Überlebenszeit erschließt sich zumindest auf den ersten Blick nicht.
Im Jahr 2014 hat das Cancer Research Committee der American Society of Clinical Oncology Kriterien für klinisch sinnvolle Behandlungsergebnisse ("Clinically Meaningful Outcomes) für 4 Krebsarten (Lungenkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs) definiert und veröffentlicht. Mit einem Gewinn an Lebenszeit von mindestens 2,5 bis 4 Monaten je nach Tumorart sind die Kriterien eher niedrig angesetzt. Gemessen an diesen Kriterien fallen nur 30 der 71 (42%) Medikamente in die Kategorie "klinisch sinnvoll".
Die Autoren argumentieren, dass die niedrige Hürde für die Zulassung von Krebsmedikamenten zur Folge hat, dass viele Medikamente zur Zulassung gebracht werden, die keine oder keine nennenswerte Verbesserung bedeuten. Die Industrie habe zur Kenntnis genommen, dass Arzneimittel mit nur geringem oder nicht nachgewiesenem Patientennutzen zugelassen werden und für Therapiekosten von zumeist mehr als 10.000 Dollar pro Monat vermarktbar sind. Damit werde der pharmazeutischen Industrie ein starker Anreiz gesetzt, ähnliche Substanzen - sog. Me-too-Medikamente - zu entwickeln anstatt nach neuen und effektiveren Substanzen zu suchen. Ersteres erfordert einen vergleichsweise geringen, letzteres hingegen einen höheren Forschungsaufwand.
Diesen Sachverhalt unterstreicht ein Bericht des Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Bis zum 31.5.2015 hat das Institut im Rahmen des Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes 29 Bewertungen für onkologische Erkrankungen auf Grundlage von 28 Dossiers erstellt. Alle Dossiers bezogen sich auf fortgeschrittene Krebserkrankungen und kein einziges auf ein Frühstadium.
Fojo T, Mailankody S, Lo A: Unintended consequences of expensive cancer therapeutics—the pursuit of marginal indications and a me-too mentality that stifles innovation and creativity: The John Conley Lecture. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery 2014, 140:1225-123 Volltext
Ellis LM, Bernstein DS, Voest EE, Berlin JD, Sargent D, Cortazar P, Garrett-Mayer E, Herbst RS, Lilenbaum RC, Sima C et al: American Society of Clinical Oncology Perspective: Raising the Bar for Clinical Trials by Defining Clinically Meaningful Outcomes. Journal of Clinical Oncology 2014, 32(12):1277-1280 Volltext
Lange S: Besonderheiten von Onkologischen Studien im Rahmen der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln. ZEFQ 2015, 109(6):417-430 Volltext
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA Link
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen Link
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig Link
Neue Krebsmedikamente 5: Niedrige Zulassungshürden behindern Fortschritte in der Forschung Link
David Klemperer, 17.11.15
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig
 Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Eine amerikanische Studie ging der Frage nach, wie häufig neue Krebstherapien mit Superlativen beschrieben wurden. Die Autoren durchsuchten dafür Google news für den kurzen Zeitraum vom 21. bis 25. Juni 2015 mit dem Suchbegriff "cancer drug" in Verbindung mit den folgenden superlativen Begriffen: breakthrough, game changer, miracle, cure, home run, revolutionary, transformative, life saver, groundbreaking, marvel.
Sie fanden 94 Nachrichten aus 66 unterschiedlichen Nachrichtenquellen mit 97 Superlativen bezogen auf 36 bestimmte und 3 unbenannte Medikamente.
Unter den Therapieformen wurde die gezielte Therapie in 17 der 36 Artikel am häufigsten aufgegriffen, die zytotoxische Therapie bzw. Chemotherapie in 9 Artikeln, Checkpoint Inhibitoren in 5 Artikeln. 3 Artikel mit Superlativen bezogen sich auf Krebsimpfungen bzw. therapeutische Vakzine, einer auf Bestrahlungstherapie und einer auf Gentherapie.
Von den 97 Superlativen bezogen sich 39 auf eine gezielte Therapie, 37 auf einen Checkpoint-Inhibitor, 10 auf ein zytotoxisches Medikament, 5 auf eine Krebsimpfung, 3 nannten keine Therapieform, 2 auf eine Strahlentherapie, eine auf eine Gentherapie.
Von den 36 Substanzen hatten 18 bis Mitte Juli 2015 noch keine Zulassung von der Food and Drug Administration erhalten. Allein auf Grundlage von Tierversuchen, Zellkulturen oder präklinischer Forschung, also ohne Erkenntnisse aus Versuchen an Menschen, wurde 5 Substanzen mit einem Superlativ bedacht.
Die Superlative wurden 53 Journalisten, 26 Ärzten, 9 Industrievertretern, 8 Patienten und einem Kongressabgeordneten zugeschrieben. In der Mehrheit der Fälle wurde der Superlativ nicht vom Autor kommentiert.
Superlative wurden genauso häufig für zugelassene wie für nicht zugelassene Substanzen und für alle Arten von Krebstherapie gebraucht. Superlative erhielten auch Substanzen, wie z.B. Palbociclib und auch Krebsimpfungen, für die bisher keine Daten für einen Patientennutzen aus klinischen Studien vorliegt. Insgesamt wurden 5 Substanzen mit einem Superlativ vorgestellt, für die noch keinerlei Daten aus Studien an Menschen vorlagen.
Krebsmedikamente werden somit in der amerikanischen Öffentlichkeit häufig auf eine Weise dargestellt, dass die Leserinnen und Leser gefährdet sind, den Nutzen weit zu überschätzen, Risiken zu unterschätzen und falsche Hoffnungen zu entwickeln.
Dass eine entsprechende Studie in Deutschland ähnliche Ergebnisse erbringen könnte, zeigen die Ergebnisse bei Google News für die Eingabe der Begriffe "Krebstherapie" und "Durchbruch": zwischen dem 14.10. und 14.11.2015 finden sich 5 unkritische Berichte und 1 Bericht über die hier vorgestellte Studie. "Krebstherapie" und "Innovation" ergibt für denselben Zeitraum 14 Treffer.
Abola MV, Prasad V: THe use of superlatives in cancer research. JAMA Oncology 2015:1-2 Abstract
Serie Neue Krebsmedikamente
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA Link
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen Link
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig Link
Neue Krebsmedikamente 5: Niedrige Zulassungshürden behindern Fortschritte in der Forschung Link
David Klemperer, 14.11.15
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen
 Krebspatienten gründen ihre Entscheidungen über eine Chemotherapie auf den zu erwartenden Gewinn an Lebenszeit und auf die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die Toxizität der Behandlung. Dafür benötigen sie evidenzbasierte Informationen über ihr Krankheitsbild und die zu erwartenden Behandlungsergebnisse, insbesondere die Verlängerung der Überlebenszeit.
Krebspatienten gründen ihre Entscheidungen über eine Chemotherapie auf den zu erwartenden Gewinn an Lebenszeit und auf die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die Toxizität der Behandlung. Dafür benötigen sie evidenzbasierte Informationen über ihr Krankheitsbild und die zu erwartenden Behandlungsergebnisse, insbesondere die Verlängerung der Überlebenszeit.
Die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (Food and Drug Administration, FDA) kann seit dem Food and Drug Administration Safety and Innovation Act von 2012 Arzneimittel beschleunigt zulassen, wenn sie, als "Durchbruch" ("Breakthrough Therapy", dazu FDA Fact Sheet) anerkannt sind. Dies gilt für ein Arzneimittel zur Behandlung einer "ernsten Erkrankung", für das "vorläufige klinische Evidenz" für die substantielle Verbesserung von mindestens einem klinischen Endpunkt vorliegt im Vergleich zu den existierenden Therapien. Anerkannt werden u.a. Belege aus nicht-kontrollierten Studien und Surrogatendpunkte (Einzelheiten in der Broschüre für die Industrie). Eine Verbesserung der Prognose und/oder Lebensqualität ist nicht Bedingung.
Es liegt nahe, dass eine als "Durchbruch" bezeichnete Therapie hohe Erwartungen weckt. Eine Forschergruppe aus Dartmouth prüfte dies in einer kleinen, unaufwändigen Studie.
In einer Online-Befragung erhielten 597 Teilnehmer je eine von 4 Fallvignetten.
Alle 4 Gruppen erhielten einen Text mit den Fakten, dass die FDA ein neues Medikament gegen Lungenkrebs zugelassen habe, dass bei der Hälfte der Probanden den Tumor vorübergehend verkleinert. Genannt wurden auch unerwünschte Wirkungen, wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Veränderung von Laborwerten.
• Gruppe 1 erhielt nur diese Fakten (Basisinformation)
• Gruppe 2 erhielt zusätzlich die Information, dass die FDA das Medikament als "aussichtsreich" (promising) bezeichnet hat
• Gruppe 3 erhielt zusätzliche die Information, dass die FDA das Medikament als "Durchbruch" (breakthrough) bezeichnet hat
• Gruppe 4 wurde wie Gruppe 3 mit dem Begriff "Durchbruch" konfrontiert und erhielt zusätzlich die (eher vorsichtig formulierte) Erklärung, dass damit eine Verbesserung des Überlebens oder eine Minderung der Krankheitssymptome nicht gesichert sei und die Aufrechterhaltung der vorläufigen Zulassung möglicherweise vom Ergebnis weiterer Studien abhänge.
• Gruppe 5 wurde wie Gruppe 3 mit dem Begriff "Durchbruch" konfrontiert und erhielt zusätzlich die deutlich Erklärung, dass die vorübergehende Verkleinerung des Tumors noch keine Verbesserung des Überlebens oder eine Minderung der Krankheitssymptome bedeute und die Aufrechterhaltung der vorläufigen Zulassung definitiv vom Ergebnis weiterer Studien abhänge.
Die Probanden gaben dann an auf einer Likert-Skala an, wie sie den Nutzen, die Schäden und die Stärke der Evidenz des Medikaments beurteilten.
Zusammenfassend erhöhten die Begriffe "breakthrough" und "promising" den Glauben an den Nutzen und an die Stärke der Evidenz, die Information über den nicht erwiesenen Patientennutzen minderte den Glauben.
Im Einzelnen:
Die Zusatzinformation "promising" oder "breakthrough" erhöhte den Anteil der positiven Bewertungen
• sehr oder vollständig effektiv: Basisinformation 11% / promising 23% / breakthrough 25%
• viel oder etwas effektiver als die bisher verfügbaren Medikamente: Basisinformation 69% / promising 78% / breakthrough 86%
• Evidenz stark oder sehr stark: Basisinformation 43% / promising 59% / breakthrough 63%
•
• würde das Medikament vielleicht oder sicher einnehmen: Basisinformation 72% / promising 84% / breakthrough 76%
Die Frage, ob bewiesen sei, dass das Medikament leben rette bejahten 31% aus der breakthrough-Gruppe, 16% aus der Gruppe mit zurückhaltend erklärender Information und 10% aus der Gruppe mit deutlich erklärender Information.
Fazit
Die Verwendung von Begriffen wie "vielversprechend" (promising) oder "Durchbruch" (breakthrough) weckt in einer Gruppe Gesunder falsche und überhöhte Vorstellungen über den Nutzen des mit einem dieser Begriffe bezeichneten Medikaments. Dies wirkt der Anforderung an informierte Entscheidung durch den Patienten entgegen und erscheint auch ethisch bedenklich, denn Patienten treffen Entscheidungen über Chemotherapie differenziert entsprechend der Toxizität und der zu erwartenden Lebensverlängerung.
Die Tendenz zu illusionären Erwartungen an die Effekte einer Chemotherapie wird so verstärkt. Es sei daran erinnert, dass die Mehrheit der Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs und Darmkrebs die Chemotherapie fälschlich als möglicherweise heilend einschätzen {(wir berichteten){http://forum-gesundheitspolitik.de/artikel/artikel.pl?artikel=2170}.
Krishnamurti T, Woloshin S, Schwartz LM, Fischhoff B: A randomized trial testing us food and drug administration "breakthrough" language. JAMA Internal Medicine 2015, 175(11):1856-1858 Volltext.
Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Eine amerikanische Studie ging der Frage nach, wie häufig neue Krebstherapien mit Superlativen beschrieben wurden. Die Autoren durchsuchten dafür Google news für den kurzen Zeitraum vom 21. bis 25. Juni 2015 mit dem Suchbegriff "cancer drug" in Verbindung mit den folgenden superlativen Begriffen: breakthrough, game changer, miracle, cure, home run, revolutionary, transformative, life saver, groundbreaking, marvel.
Sie fanden 94 Nachrichten aus 66 unterschiedlichen Nachrichtenquellen mit 97 Superlativen bezogen auf 36 bestimmte und 3 unbenannte Medikamente.
Unter den Therapieformen wurde die gezielte Therapie in 17 der 36 Artikel am häufigsten aufgegriffen, die zytotoxische Therapie bzw. Chemotherapie in 9 Artikeln, Checkpoint Inhibitoren in 5 Artikeln. 3 Artikel mit Superlativen bezogen sich auf Krebsimpfungen bzw. therapeutische Vakzine, einer auf Bestrahlungstherapie und einer auf Gentherapie.
Von den 97 Superlativen bezogen sich 39 auf eine gezielte Therapie, 37 auf einen Checkpoint-Inhibitor, 10 auf ein zytotoxisches Medikament, 5 auf eine Krebsimpfung, 3 nannten keine Therapieform, 2 auf eine Strahlentherapie, eine auf eine Gentherapie.
Von den 36 Substanzen hatten 18 bis Mitte Juli 2015 noch keine Zulassung von der Food and Drug Administration erhalten. Allein auf Grundlage von Tierversuchen, Zellkulturen oder präklinischer Forschung, also ohne Erkenntnisse aus Versuchen an Menschen, wurde 5 Substanzen mit einem Superlativ bedacht.
Die Superlative wurden 53 Journalisten, 26 Ärzten, 9 Industrievertretern, 8 Patienten und einem Kongressabgeordneten zugeschrieben. In der Mehrheit der Fälle wurde der Superlativ nicht vom Autor kommentiert.
Superlative wurden genauso häufig für zugelassene wie für nicht zugelassene Substanzen und für alle Arten von Krebstherapie gebraucht. Superlative erhielten auch Substanzen, wie z.B. Palbociclib und auch Krebsimpfungen, für die bisher keine Daten für einen Patientennutzen aus klinischen Studien vorliegt. Insgesamt wurden 5 Substanzen mit einem Superlativ vorgestellt, für die noch keinerlei Daten aus Studien an Menschen vorlagen.
Krebsmedikamente werden somit in der amerikanischen Öffentlichkeit häufig auf eine Weise dargestellt, dass die Leserinnen und Leser gefährdet sind, den Nutzen weit zu überschätzen, Risiken zu unterschätzen und falsche Hoffnungen zu entwickeln.
Dass eine entsprechende Studie in Deutschland ähnliche Ergebnisse erbringen könnte, zeigen die Ergebnisse bei Google News für die Eingabe der Begriffe "Krebstherapie" und "Durchbruch": zwischen dem 14.10. und 14.11.2015 finden sich 5 unkritische Berichte und 1 Bericht über die hier vorgestellte Studie. "Krebstherapie" und "Innovation" ergibt für denselben Zeitraum 14 Treffer.
Abola MV, Prasad V: THe use of superlatives in cancer research. JAMA Oncology 2015:1-2 Abstract
Serie Neue Krebsmedikamente
1 Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
2 Leichtfertige Zulassung in den USA Link
3 "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen
Link
4 Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - neue Krebstherapien werden in der amerikanischen Presse häufig mit Superlativen bezeichnet Link
5 folgt: Patientennutzen meistens gering Link
David Klemperer, 6.11.15
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA
 Den Zusammenhang von Surrogatendpunkten und patientenrelevanten Endpunkten von Krebsmedikamenten untersuchten Mitarbeiter des amerikanischen National Cancer Institute.
Den Zusammenhang von Surrogatendpunkten und patientenrelevanten Endpunkten von Krebsmedikamenten untersuchten Mitarbeiter des amerikanischen National Cancer Institute.
Surrogatendpunkte sind dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zufolge "Endpunkte, die selbst nicht von unmittelbarer Bedeutung für einen Patienten sind, aber mit patientenrelevanten Endpunkten assoziiert sind (zum Beispiel Senkung des Blutdrucks als Surrogatparameter für Vermeidung eines Schlaganfalls)".
Als wichtigster patientenrelevanter Endpunkt wird in der Onkologie die Überlebenszeit, also die Verbesserung der Prognose angesehen (overall survival). Ein gebräuchlicher Surrogatendpunkt in der Onkologie ist das Schrumpfen ("Ansprechen") des Tumors (auch wenn es nur vorübergehend ist), was in Studien als Ansprechrate (response rate) erfasst wird.
Ein weiterer Surrogatendpunkt bezieht sich auf die Zeit, in der die Krankheit nicht voranschreitet und wird als krankheitsfreies Überleben (progression-free survival) bezeichnet.
Surrogatendpunkte werden in vielen Fällen von Zulassungsbehörden als ausreichend für die Zulassung anerkannt. Die Klärung der Frage, ob z.B. das Schrumpfen des Tumors tatsächlich mit längerer Überlebenszeit einhergeht, muss jedoch in Studien geprüft werden, die beide Arten von Endpunkt untersuchen (s.a. IQWiG "Validierung von Surrogatendpunkten").
Die amerikanischen Autoren fanden in ihrer Recherche 36 Studien mit 65 Korrelationen zwischen Surrogatendpunkten und patientenrelevanten Endpunkten.
• 34 von 65 Korrelationen (52%) waren schwach.
• 16 von 65 (25%) waren von mittlerer Stärke
• 15 von 65 (23%) waren hoch korreliert.
Surrogatendpunkte lassen also in der Mehrzahl der Fälle keine Verbesserung der patientenrelevanten Endpunkte erwarten.
Die Autoren stellen daher in der Diskussion die verbreitete Praxis der Zulassung von Krebsmedikamenten auf Grundlage von Surrogatendpunkten infrage. Sie weisen auch darauf hin, dass sie zahlreiche Studien einschließen konnten, weil zur Analyse notwendige Daten nicht veröffentlicht waren und ihnen auch auf Anfrage nicht zur Verfügung gestellt wurden. Möglicherweise sind daher die dargestellten Ergebnisse positiver als die Wirklichkeit.
Weit überwiegend erscheint daher der Nutzen von Krebsmedikamenten, von denen man lediglich weiß, dass sie einen Tumor vorübergehend schrumpfen lassen oder sein Wachstum verzögern, sehr fraglich. Viele Patienten erhalten somit hochtoxische Medikamente, die ihnen höchstwahrscheinlich nicht nutzen. Dass diese Medikamente mit exorbitanten Preisen zu bezahlen sind, berichteteÜber die Preisgestaltung neuer Krebsmedikamente berichteten wir im Forum.
Es gibt Beispiele dafür, dass die Zulassung eines Medikaments erhalten bleibt, selbst wenn sich in weiteren Studien herausstellt, dass der patientenrelevante Endpunkt Überleben nicht verbessert wird, wie bei Bevacizumab/Avastin® bei metastasiertem Brustkrebs. Bevacizumab war aufgrund der Verlängerung des progessionsfreien Überlebens zugelassen worden, obwohl aus früheren Analysen bekannt war, dass dieses Kriterium kein verbessertes Überleben erwarten ließ.
Die Autoren belegen an einer Reihe weiterer Beispiele die Zulassung von Krebsmedikamenten in den USA auf Grundlage einer sehr schmalen Evidenzlage.
Einen Einblick darin, wie die Akteure in Deutschland denken und fühlen, geben die Vortragsfolien zur Veranstaltung "BfArM im Dialog: Gemeinsam Gesundheit gestalten - Strategie BfArM 2025", die hier herunterladbar sind.
Prasad V, Kim C, Burotto M, Vandross A: The strength of association between surrogate end points and survival in oncology: A systematic review of trial-level meta-analyses. JAMA Internal Medicine 2015 Abstract
Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Eine amerikanische Studie ging der Frage nach, wie häufig neue Krebstherapien mit Superlativen beschrieben wurden. Die Autoren durchsuchten dafür Google news für den kurzen Zeitraum vom 21. bis 25. Juni 2015 mit dem Suchbegriff "cancer drug" in Verbindung mit den folgenden superlativen Begriffen: breakthrough, game changer, miracle, cure, home run, revolutionary, transformative, life saver, groundbreaking, marvel.
Sie fanden 94 Nachrichten aus 66 unterschiedlichen Nachrichtenquellen mit 97 Superlativen bezogen auf 36 bestimmte und 3 unbenannte Medikamente.
Unter den Therapieformen wurde die gezielte Therapie in 17 der 36 Artikel am häufigsten aufgegriffen, die zytotoxische Therapie bzw. Chemotherapie in 9 Artikeln, Checkpoint Inhibitoren in 5 Artikeln. 3 Artikel mit Superlativen bezogen sich auf Krebsimpfungen bzw. therapeutische Vakzine, einer auf Bestrahlungstherapie und einer auf Gentherapie.
Von den 97 Superlativen bezogen sich 39 auf eine gezielte Therapie, 37 auf einen Checkpoint-Inhibitor, 10 auf ein zytotoxisches Medikament, 5 auf eine Krebsimpfung, 3 nannten keine Therapieform, 2 auf eine Strahlentherapie, eine auf eine Gentherapie.
Von den 36 Substanzen hatten 18 bis Mitte Juli 2015 noch keine Zulassung von der Food and Drug Administration erhalten. Allein auf Grundlage von Tierversuchen, Zellkulturen oder präklinischer Forschung, also ohne Erkenntnisse aus Versuchen an Menschen, wurde 5 Substanzen mit einem Superlativ bedacht.
Die Superlative wurden 53 Journalisten, 26 Ärzten, 9 Industrievertretern, 8 Patienten und einem Kongressabgeordneten zugeschrieben. In der Mehrheit der Fälle wurde der Superlativ nicht vom Autor kommentiert.
Superlative wurden genauso häufig für zugelassene wie für nicht zugelassene Substanzen und für alle Arten von Krebstherapie gebraucht. Superlative erhielten auch Substanzen, wie z.B. Palbociclib und auch Krebsimpfungen, für die bisher keine Daten für einen Patientennutzen aus klinischen Studien vorliegt. Insgesamt wurden 5 Substanzen mit einem Superlativ vorgestellt, für die noch keinerlei Daten aus Studien an Menschen vorlagen.
Krebsmedikamente werden somit in der amerikanischen Öffentlichkeit häufig auf eine Weise dargestellt, dass die Leserinnen und Leser gefährdet sind, den Nutzen weit zu überschätzen, Risiken zu unterschätzen und falsche Hoffnungen zu entwickeln.
Dass eine entsprechende Studie in Deutschland ähnliche Ergebnisse erbringen könnte, zeigen die Ergebnisse bei Google News für die Eingabe der Begriffe "Krebstherapie" und "Durchbruch": zwischen dem 14.10. und 14.11.2015 finden sich 5 unkritische Berichte und 1 Bericht über die hier vorgestellte Studie. "Krebstherapie" und "Innovation" ergibt für denselben Zeitraum 14 Treffer.
Abola MV, Prasad V: THe use of superlatives in cancer research. JAMA Oncology 2015:1-2 Abstract
Serie Neue Krebsmedikamente
1 Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
2 Leichtfertige Zulassung in den USA Link
3 "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen
Link
4 Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - neue Krebstherapien werden in der amerikanischen Presse häufig mit Superlativen bezeichnet Link
5 folgt: Patientennutzen meistens gering Link
David Klemperer, 6.11.15
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant
 Die Behandlung mit neuen Krebsmedikamenten kostet in den USA zumeist mehr als 100.000 Dollar pro Jahr. Zwei Mitarbeiter des National Cancer Institute der National Institutes of Health sind der Frage nachgegangen, ob der Preis mit wesentlichen Verbesserungen der Behandlungsergebnisse im Vergleich zu den vorher verfügbaren Medikamenten oder zumindest mit neuen Wirkmechanismen zusammenhängt, die einen pharmakologischen Fortschritt bedeuten.
Die Behandlung mit neuen Krebsmedikamenten kostet in den USA zumeist mehr als 100.000 Dollar pro Jahr. Zwei Mitarbeiter des National Cancer Institute der National Institutes of Health sind der Frage nachgegangen, ob der Preis mit wesentlichen Verbesserungen der Behandlungsergebnisse im Vergleich zu den vorher verfügbaren Medikamenten oder zumindest mit neuen Wirkmechanismen zusammenhängt, die einen pharmakologischen Fortschritt bedeuten.
Dafür wurden alle 51 Krebsmedikamente untersucht, die von Anfang 2009 bis Ende 2013 von der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde, der Food and Drug Administration, für 63 Indikationen zugelassen wurden. 21 Substanzen hatten einen neuartigen Wirkmechanismus, 30 hingegen einen bereits bekannten Wirkmechanismus ("me-too"-Arzneimittel oder "next-in-class drugs").
Die Preise für die 30 Substanzen mit bekanntem Wirkmechanismus lagen mit durchschnittlich 119.765 Dollar für eine 12-monatige Behandlung etwas höher als die Preise für 21 Substanzen mit neuem Wirkmechanismus, die im Durchschnitt 116.100 Dollar pro Jahr kosteten.
Die Zulassung erfolgte auf Grund der Erfüllung von mindestens einem von 3 Kriterien, die im Folgenden mit den durchschnittlichen Jahresbehandlungskosten genannt werden.
• Gesamtüberlebens (overall survival) 112.370 Dollar
• Ansprechrate (response rate) 137.952 Dollar
• progressionsfreie Überleben 102.677 Dollar
Anzumerken ist hier, dass sowohl eine Verbesserung der Ansprechrate als auch ein verlängertes progressionsfreies Überleben keine Verbesserung der Prognose garantieren und lediglich Surrogatendpunkte darstellen.
Surrogatendpunkte sind dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zufolge "Endpunkte, die selbst nicht von unmittelbarer Bedeutung für einen Patienten sind, aber mit patientenrelevanten Endpunkten assoziiert sind (zum Beispiel Senkung des Blutdrucks als Surrogatparameter für Vermeidung eines Schlaganfalls)".
Kein Zusammenhang bestand zwischen dem Ausmaß des Zusatznutzens (erfasst in progessionsfreiem Überleben oder Gesamtüberleben) und dem Preis.
Davon ausgehend, dass die Entwicklung von Substanzen mit neuartigem Wirkmechanismus aufwändiger ist, als die Modifikation einer vorhandenen Substanz, spiegeln sich im Preis also auch nicht die Entwicklungskosten.
Die Autoren gelangen zum Ergebnis, dass die derzeitige Preisfindung für neue Krebsmedikamente nicht rational sei sondern allein reflektiere, was der Markt hergibt.
Hier ist zu ergänzen, dass von einem Markt nicht gesprochen werden kann, weil neu zugelassene Substanzen unter Patentschutz stehen das damit verbundene Monopol alle Marktmechanismen außer Kraft setzt. Der Hersteller kann den Preis nach Belieben festlegen. Entwicklungskosten und Forschungskosten spielen offensichtlich eine nachgeordnete Rolle. Aus Sicht der Hersteller dürfte es durchaus rational sein, den höchstmöglichen Preis zu erzielen.
Aus Patientensicht ist es hingegen wenig rational, dass Medikamente aufgrund von Surrogatparametern zugelassen werden und es ungeklärt ist, ob sie ob sie überhaupt einen Nutzen für die Patienten haben.
Mailankody S, Prasad V. Five years of cancer drug approvals: Innovation, efficacy, and costs. JAMA Oncology 2015;1:539-40 Volltext
Serie Neue Krebsmedikamente
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA Link
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen Link
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig Link
Neue Krebsmedikamente 5: Niedrige Zulassungshürden behindern Fortschritte in der Forschung Link
David Klemperer, 5.11.15
Antibiotikaresistenzen - Aus der Traum von der Beherrschbarkeit aller Krankheiten
 Die ausbleibende Wirksamkeit von Antibiotika weckt weltweit wachsende Besorgnis. Selbst das G7 genannte informelle Forum der Staats- und Regierungschefs hat sich bei ihrem letzten Treffen im bayerischen Elmau dieses Themas angenommen. Die deutsche Präsidentschaft hatte neben anderen Gesundheitsthemen auch die zunehmenden Multiresistenzen auf die Tagesordnung gesetzt. Doch die auf dem G7-Gipfel im Juni 2015 verabredeten Ansätze und Strategien sind ernüchternd, denn sie gehen nicht über gängige technokratische Vorgehensweisen hinaus. Ein Erfolg versprechendes Umdenken lassen die Beschlüsse von Elmau ebenso vermissen wie ein Rühren an grundlegenden Ursachen und Faktoren der Resistenzentwicklung.
Die ausbleibende Wirksamkeit von Antibiotika weckt weltweit wachsende Besorgnis. Selbst das G7 genannte informelle Forum der Staats- und Regierungschefs hat sich bei ihrem letzten Treffen im bayerischen Elmau dieses Themas angenommen. Die deutsche Präsidentschaft hatte neben anderen Gesundheitsthemen auch die zunehmenden Multiresistenzen auf die Tagesordnung gesetzt. Doch die auf dem G7-Gipfel im Juni 2015 verabredeten Ansätze und Strategien sind ernüchternd, denn sie gehen nicht über gängige technokratische Vorgehensweisen hinaus. Ein Erfolg versprechendes Umdenken lassen die Beschlüsse von Elmau ebenso vermissen wie ein Rühren an grundlegenden Ursachen und Faktoren der Resistenzentwicklung.
Auch die unter Federführung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina entstandene Stellungnahme G7 Science Academies' Statement 2015 verharrt bei den gängigen biomedizinischen Ansätzen - Entwicklung neuer antibiotischer Wirkstoffe, Eindämmung der Ausbreitung von Multiresistenzen und bessere Überwachung - und ergänzt sie durch das andere gesundheitsbezogene Gipfel-Thema der Gesundheitssystemstärkung.
Überraschend ist das allerdings nicht bei der Leopoldina, die sich bezeichnenderweise auch Akademie der Naturforscher nennt. Das innovative Potenzial dieser und anderer Stellungnahmen - siehe zum Beispiel den Beitrag Public Health als Weg zur Optimierung des Menschen im Sinne besserer Resilienz auf dieser Website - beschränkt sich regelhaft auf Genomik und andere evolutionäre Forschungsansätze. Wichtige gesellschaftliche Zusammenhänge und insbesondere Einflussfaktoren außerhalb des Gesundheitswesens im engeren Sinne spielen in der Problemanalyse und den Lösungsansätzen einflussreicher WissenschaftlerInnen ebenso wie in der Politik allenfalls eine untergeordnete Rolle.
Die Ausführungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Thema Antibiotikaresistenzen bei ihrer Pressekonferenz zum Abschluss des G7-Gipfels in Elmau zeugen allerdings von erheblich grundlegenderem Aufklärungsbedarf bei politischen EntscheidungsträgerInnen: "Erstens: der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Das ist ein Thema, das die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer gleichermaßen interessiert und für beide wichtig ist. Man denkt immer, gegen alle Krankheiten seien Antibiotika vorhanden ‑ aber wenn einmal Resistenzen auftreten, dann ist es heute sehr, sehr schwer, neue Antibiotika zu entwickeln. Hier haben uns die nationalen Akademien der G7-Staaten geholfen, Maßstäbe zu entwickeln und Handlungen durchzuführen, mit denen wir dann besser die Entwicklung von Antibiotika begleiten können und die sachgerechte Anwendung von Antibiotika sicherstellen können. Dazu haben sich die G7-Staaten zu dem einen Gesundheitsansatz bekannt. Was heißt das? Das heißt, Menschen und Tier gleichermaßen in den Blick zu nehmen und Antibiotika auch verschreibungspflichtig zu machen. Das ist von äußerster Wichtigkeit für den sachgerechten Umgang."
Tatsächlich stellt die zunehmende Multiresistenz vieler Erreger gegen gängige Antibiotika weltweit ein wachsendes Problem dar. Das deutsche Bundesgesundheitsministerium legte im März 2015 seinen 10-Punkte-Plan zur Bekämpfung resistenter Erreger vor, und die Bundesregierung hat sich auf die Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie DART verständigt. Die Weltgesundheitsorganisation legte bereits 2001 ihre Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance vor und erst letztes Jahr ihren bisher letzten Bericht zu Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014 vor.
So richtig und wichtig all diese Ansätze auch sind - ihre nachhaltige Wirksamkeit ist allerdings zweifelhaft. Sie beschränken sich darauf, die Vorbeugungs- und Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Die Verhältnisse, die zur Entstehung gefährlicher Multiresistenzen geführt haben, lassen sie ebenso außer Acht wie die Beseitigung ihrer vielschichtige Ursachen. Darauf macht ein Hintergrundpapier der Deutschen Plattform für Globale Gesundheit DGPP aufmerksam, das sich kritisch mit den bisherigen Ansätzen der Resistenzeindämmung befasst.
Zweifellos ist es erforderlich und hilfreich, die Entwicklung neuer, wirksamer Antibiotika zu fordern und zu fördern und auf einen rationalen Einsatz dieser Medikamente sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin zu drängen. Dazu bedarf es allerdings einer erheblichen Umsteuerung bei Anreizen und Finanzierung des Krankenversorgungssystems - hiervon ist in den bisherigen Verlautbarungen und Strategien wenig bis nichts zu lesen. Auch reicht es nicht aus, den TierärztInnen schärfer auf die Finger zu schauen oder Verordnung und Vertrieb von Antibiotika zu trennen, denn die Voraussetzungen für die Entstehung von Multiresistenzen stecken in der Renditeorientierung des agroindustriellen Wirtschaftszweigs.
Die wirksame Vermeidung von Multiresistenzen erfordert aber letztlich ein weitaus umfassenderes Verständnis relevanter Zusammenhänge. Wie im Forum Gesundheitspolitik bereits dargelegt - siehe Korruption sowie private Finanzierung von Gesundheitsleistungen - wichtigste Ursachen für zunehmende Antibiotikaresistenzen - nehmen auch der Umfang der privaten Gesundheitsausgaben in einem Versorgungssystem und vor allem die Güte der Regierungsführung Einfluss auf die Entstehung von Antibiotikaresistenzen. Das DGPP-Hintergrundpapier weist an Hand verschiedener Beobachtungen und Zusammenhänge nach, dass die Bekämpfung und Vermeidung von Multiresistenzen über biomedizinische und technische Ansätze hinausgehen muss, um erfolgreich zu sein.
Unerwähnt bleibt dabei allerdings der Zusammenhang zwischen den herrschenden Bedingungen, unter denen wissenschaftliche Forschung stattfindet, und den Erfolgsaussichten bei der nachhaltigen Überwindung von Resistenzentwicklungen. Schließlich ist es kein Zufall, dass die Pharma-Industrie zuletzt wenig in die Entwicklung neuer Antibiotika investiert hat, denn hohe Gewinne locken woanders. Selbst wenn sich dies ändert, steht zu befürchten, dass die bestehenden Patentregelungen neue Antibiotika für zu viele unerschwinglich machen, um Resistenzentwicklungen tatsächlich vermeiden zu können. Die gleichzeitig in Elmau beschworene Forcierung internationaler Handelsabkommen beraubt die Staaten zunehmend ihrer Möglichkeiten, steuernd und Gefahr mindernd in das globale Geschehen einzugreifen. Doch dieser Widerspruch bleibt im herrschenden Diskurs unerkannt - oder zumindest unbenannt.
Das Hintergrundpaper zu Antibiotika-Resistenzen steht in voller Länge zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 8.7.15
Über- oder Fehlversorgung: Über 50% der US-Kinder/Heranwachsenden mit antipsychotischen Arzneimitteln bekamen sie ohne Diagnose
 Der gelegentliche Einwand gegen Forschungsprojekte über gesundheitsbezogene Behandlungen, das worüber mehr Transparenz geschaffen werden solle, sei doch reichlich an den Haaren herbeigezogen und gegen Ärzte voreingenommen, erweist sich häufig bei genauerem Hinsehen als unberechtigt und selber parteilich.
Der gelegentliche Einwand gegen Forschungsprojekte über gesundheitsbezogene Behandlungen, das worüber mehr Transparenz geschaffen werden solle, sei doch reichlich an den Haaren herbeigezogen und gegen Ärzte voreingenommen, erweist sich häufig bei genauerem Hinsehen als unberechtigt und selber parteilich.
Dies zeigt ein aktuelles Beispiel einer etwas genaueren Analyse der Verordnungen von antipsychotischen Arzneimittel, also alles andere als harmlosen Mitteln, für us-amerikanische Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen einem und 24 Jahren in den Jahren 2006 und 2010.
Das Ergebnis lautet:
• Für 57% und 67% der Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppe fanden die WissenschaftlerInnen weder aus dem ambulanten noch aus dem stationären Bereich dokumentierte Hinweise auf eine diagnostizierte psychische Erkrankung oder Beschwerde.
• Damit ist es auch trotz aller auch im US-Gesundheitswesen verbreiteten Rufe nach Qualität nicht möglich, die Angemessenheit der Verordnung zu überprüfen.
• Dass daran aber gezweifelt werden darf, zeigt ein weiteres Ergebnis: Obwohl gerade bei psychischen Leiden fachlich geboten, stammten die Verordnungen der spezifischen Arzneimittel nur bei etwas mehr als einem Drittel der PatientInnen von Kinder- oder Heranwachsendenpsychiatern.
• Wenn es Diagnosen gab, waren Depressionen, bipolare und Angststörungen unter den 18- bis 24-Jährigen am häufigsten. In der Gruppe der unter 18-Jährigen stand ADHD an der Spitze.
Obwohl die Verordnung der antipsychotischen Medikamente zwar in Leitlinien nur für schwere Fälle vorgeschlagen wird, fördert ein Blick auf die sonstige Behandlung diesbezüglich Zweifel. Nur 13,5% bis 24,8% der MedikamentennutzerInnen erhielten auch noch eine fachlich empfohlene psychotherapeutische Behandlung.
Man darf gespannt sein, welche Ergebnisse eine vergleichbare Studie in Deutschland oder außerdem für Erwachsene über 24 Jahre zu Tage fördern würde.
Der Aufsatz Treatment of Young People With Antipsychotic Medications in the United States von Mark Olfson et al. ist am 1. Juli 2015 als Onlinepublikation der Fachzeitschrift "JAMA Psychiatry" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.7.15
Therapietreue und Wirkung bei Medicare-PatientInnen mit Statin-Generika signifikant besser als mit Originalpräparaten
 Auch bei hochwirksamen gesundheitlich notwendigen Arzneimitteln ist häufig die Therapietreue gering, d.h. bis zu 50% der Patienten nehmen das verordnete Arzneimittel gar nicht, nicht in der notwendigen Menge oder nicht im notwendigen Rhythmus ein. Dies ist auch bei den zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse (z.B. Herzinfarkt) eingesetzten Statinen der Fall.
Auch bei hochwirksamen gesundheitlich notwendigen Arzneimitteln ist häufig die Therapietreue gering, d.h. bis zu 50% der Patienten nehmen das verordnete Arzneimittel gar nicht, nicht in der notwendigen Menge oder nicht im notwendigen Rhythmus ein. Dies ist auch bei den zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse (z.B. Herzinfarkt) eingesetzten Statinen der Fall.
In einer jetzt veröffentlichten Studie, die erstmals mit den Routinedaten von 90.111 Medicare-Versicherten, also 65-Jährigen und Älteren, die zwischen 2006 und 2008 ein Statin verordnet bekommen hatten, udie Therapietreue und die Wirksamkeit der Behandlung untersuchte, gab es zwei mehr oder weniger unerwartete Ergebnisse:
• Von den im Durchschnitt 75,6 Jahre alten und zu 61% weiblichen Patienten erhielten 93% ein Statin-Generikum und nur 7% ein Originalpräparat. Die Zuzahlung betrug für die Generika im Durchschnitt 10 und für die Originalpräparate 48 US-Dollar. Der als Maß für Therapietreue gewählte Anteil der Tage an denen das Präparat eingenommen wurde, belief sich bei Originalpräparaten auf 71% und bei Generika auf signifikant höhere 77%. Hier taucht ein bereits mehrfach in den USA entdeckter Zusammenhang zwischen niedrigen oder fehlenden Zuzahlungen und besserer Therapietreue erneut auf (vgl. dazu u.a. die folgende Meldung im "forum-Gesundheitspolitik": Keine Zuzahlungen für die Arzneimittelbehandlung von Herzinfarkt-Patienten verbessert Therapietreue und reduziert Ungleichheit ).
• Unterschiede gab es zusätzlich bei einem aus der Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen oder Schlaganfällen, akuten koronaren Symptomen und Sterblichkeit gebildeten Outcome-Indikator. Die Häufigkeit dieser unerwünschten Ereignisse war bei den PatientInnen, die ein Statin-Generikum einnahmen um signifikante 8% geringer. Der absolute Unterschied betrug 1,53 Ereignisse pro 100 Personenjahre.
Die AutorInnen schränken die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse auf Personen mit anderen, eher besseren Einkommensverhältnissen und eventuell anderen Mustern der Arzneimittelbehandlung selber ein. Ohne dass dies erkennbar die Ergebnisse beeinzuflussen scheint, geben sie außerdem an, dass diese Untersuchung von einem Hersteller von Statin-Generika finanziert wurde. Angesichts der Brisanz der Ergebnisse ist eine weitere unabhängige Untersuchung in anderen Versicherten- und Patientengruppen wünschenswert. Dabei wäre den möglichen Ursachen für diese Ergebnisse aber noch gründlicher nachzugehen.
Von dem Aufsatz Comparative effectiveness of generic and brand-name statins on patient outcomes: A cohort study. von Gagne JJ et al., erschienen in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" vom 16. September 2014 (161: 400) ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.14
Kein "Schubs" aber ein "Stups": Der Nutzen von SMS-Erinnerungen an die Einnahme von Malariamedikamenten
 Trotz einiger wirksamer primärpräventiver Anstrengungen (z.B. Verteilung von Moskitonetzen und Trockenlegung von Sumpfgebieten) ist Malaria immer noch eine der weltweit größten Todesursachen. Die Schätzungen schwanken für 2010 zwischen 655.000 und 1,24 Millionen. Die Hälfte dieser Toten waren Kinder unter 5 Jahren. 92% der Malariatoten stammten aus der Sub-Sahara-Region Afrikas.
Trotz einiger wirksamer primärpräventiver Anstrengungen (z.B. Verteilung von Moskitonetzen und Trockenlegung von Sumpfgebieten) ist Malaria immer noch eine der weltweit größten Todesursachen. Die Schätzungen schwanken für 2010 zwischen 655.000 und 1,24 Millionen. Die Hälfte dieser Toten waren Kinder unter 5 Jahren. 92% der Malariatoten stammten aus der Sub-Sahara-Region Afrikas.
Speziell gegen den in dieser Region verbreiteten Erregertyp der Malaria gibt es ein wirksames Medikament bzw. eine Arzneimitteltherapie (Artemisin-basiert), die von der WHO mit wenigen Ausnahmen als "first-line treatment" empfohlen wird. Da dieser Erreger bereits gegen andere Medikamente Resistenzen entwickelt hat, stellt die Artemisinbehandlung im Moment aber auch eine "last-line"-Behandlungsmöglichkeit dar.
Um sowohl die Sterblichkeit unter den mit Malaria infizierten Personen zu verringern als auch zu verhindern, dass durch mangelnde Therapietreue, d.h. das vorzeitige Absetzen der Einnahme des Arzneimittels, auch hier Resistenzen entstehen können, kommt es vor allem darauf an, die Therapietreue zu verbessern.
In einer Interventionsstudie mit 1.140 TeilnehmerInnen in Ghana erhielten nun 277 bzw. 309 TeilnehmerInnen kurze ("Please take your MALARIA drugs!") bzw. längere ("Please take your MALARIA drugs! Even if you feel better, you must take all the tablets to kill all the malaria.") SMS-Texte mit denen sie an die Einnahme ihres Medikaments erinnert wurden. Diese SMS erhielten sie zusätzlich zu den von Ärzrten gegebenen Einnahmehinweisen in 12-Stunden-Abständen drei Tage lang. Die 538 TeilnehmerInnen in der Kontrollgruppe erhielten keine SMS-Erinnerungen. Sämtliche TeilnehmerInnen wurden aber auch noch über den primärpräventiven Nutzen von Mückennetzen informiert.
Die Ergebnisse unterschieden sich signifikant:
• Von den TeilnehmerInnen an der Kontrollgruppe nahmen 61,5% das ihnen verordnete Medikament vollständig ein.
• Die Wahrscheinlichkeit der Therapietreue wurde bei den 572 EmpfängerInnen der kurzen SMS um 45% erhöht (adjustierte OR 1,45, p=0,028). Eine längere SMS hatte keinen zusätzlichen signifikanten Nutzen.
• Nach Beendigung der Behandlung durchgeführte mündliche Interviews mit den TeilnehmerInnen ergaben allerdings, dass der Erhalt der SMS-Erinnerung sich nicht signifikant auf den Anteil der PatientInnen ausgewirkt hat, die weiter an Malariasymptomen litten. Dieser betrug rund 30%.
Angesichts der anhaltend hohen Anzahl von überwiegend vermeidbaren Malariatoten sollten trotz aller Begrenzungen (z.B. der Nichterreichbarkeit der ärmeren Bevölkerung per Mobilgeräten) und der bescheidenen Erfolge, die elektronischen Möglichkeiten, die Therapietreue zu verbessern, weiter genutzt und verbessert werden. Dies gilt in besonderem Maße für die zusätzliche Information der betreffenden Bevölkerungen über die Wirksamkeit von Moskitonetzen (mit oder ohne Einsatz von Insektiziden) und deren möglichst kostenlose Verteilung bei ärmeren Personen oder Familien. Ein kostenlos verteiltes Netz kostet insgesamt rund 4 Euro.
Hier wie bei der immer noch zögerlichen Unterstützung der westafrikanischen durch europäische oder nordamerikanische Länder bei der Bewältigung der Ebola-Epidemie stellt sich die Frage warum es keine rechtzeitige und entschiedenere internationale öffentliche Hilfe bei den "afrikanischen Krankheiten" gibt. Da Unkenntnis über die Ursachen, Mangel an bekannten präventiven und therapeutischen Interventionsmöglichkeiten und Unfinanzierbarkeit als Erklärungen ausscheiden, bleiben sehr unangenehme wie z.B. latente ethnische Geringschätzung übrig.
Der Aufsatz The Impact of Text Message Reminders on Adherence to Antimalarial Treatment in Northern Ghana: A Randomized Trial. von Raifman JRG, Lanthorn HE, Rokicki S und Fink G ist am 28. Oktober 2014 in der Zeitschrift "PLoS ONE" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.10.14
USA: Umfang und Art von Medikationsfehlern bei Kleinkindern unter Obhut ihrer Eltern.
 Kinder in den ersten Lebensjahren gehören aus vielen nachvollziehbaren Gründen (z.B. wegen der zahlreichen Infektionserkrankungen) zu den Bevölkerungsgruppen denen relativ viel Arzneimittel verordnet werden. Deren Einnahme geschieht überwiegend unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer Erwachsenen.
Kinder in den ersten Lebensjahren gehören aus vielen nachvollziehbaren Gründen (z.B. wegen der zahlreichen Infektionserkrankungen) zu den Bevölkerungsgruppen denen relativ viel Arzneimittel verordnet werden. Deren Einnahme geschieht überwiegend unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer Erwachsenen.
Anders als über die Einnahmetreue von und Einnahmefehler bei Erwachsenen wusste man über die Korrektheit der von Eltern bestimmten Einnahme von Medikamenten bei kleinen und größeren Kindern bisher relativ wenig.
Einige in den letzten Jahren veröffentlichten Studien zeigten allerdings beispielsweise, dass z.B. die Rechenschwächen von Eltern in den USA zu spürbaren Medikationsfehlern führte (siehe die Studienzusammenfassung Parents' Poor Math Skills May Lead to Medication Errors auf der Website der "American Academy of Pediatrics") und auch den Aufsatz über den kräftigen Anstieg der Anzahl der Kinder, die zwischen 2001 und 2008 in den USA mit schweren Medikamentenvergiftungen in Notfallstationen eingewiesen wurden, (der dies genau schildernde Aufsatz The Growing Impact of Pediatric Pharmaceutical Poisoning. von G. Randall Bond, Randall W. Woodward und Mona Ho. ist 2011 im "The Journal of Pediatrics" (Volume 160, Issue 2: 265-270) erschienen).
Eine am 20. Oktober 2014 veröffentlichte Studie zeigte mit Daten des "Nation Poison Database System" der USA für den Zeitraum von 2002 bis 2012 und für insgesamt 696.937 Kinder unter 6 Jahren mit berichteten Medikationsfehlern zahlreiche Details dieser Fehler in häuslicher Umgebung:
• Im Durchschnitt gab es jährlich über 63.000 derartiger Ereignisse oder jede achte Minute bekam ein Kind dieses Alters von seinen Eltern eine falsche Dosis, gar keines des verordneten oder ein falsches Medikament verabreicht.
• Die jährliche Rate der Medikationsfehler betrug daher 26,42 pro 10.000 Angehörigen dieser Kinderjahrgänge.
• Neben einer signifikanten Abnahme von Fehlern bei der Einnahme von Erkältungsarzneimitteln über die gesamten 11 Jahre um 42,9% stieg die Rate der Fehler bei allen anderen Arzneimitteln um 37,2%.
• Anzahl und Rate der Einnahmefehler fielen mit zunehmendem Alter der Kinder. Auf die unter Einjährigen entfielen 25,2% aller Episoden.
• Schmerzmittel und Mittel gegen Erkältungskrankheiten waren an rund 50% der fehlerhaften Einnahmen beteiligt.
• 27% der Einnahmefehler beruhten auf unachtsames Einnehmen oder die zweifache Einnahme einer Portion.
• 93,5% der Ereignisse fanden außerhalb einer Gesundheitseinrichtung statt, d.h. in alleiniger Verantwortung der Eltern. 4,4% der Kinder mit Einnahmefehlern waren in Gesundheitseinrichtungen behandelt und entlassen worden. 25 Kinder starben wegen der Fehleinnahme.
Die AutorInnen schließen ihre Analyse mit einer Reihe von Präventionsm ethoden technischer Art, zum Beispiel Timer, besser verschließbare Packungen, aber auch die stärkere Berücksichtigung der Lese- und Sprachschwächen der Eltern. Trotzdem räumen sie ein, dass sie zu wenig über die konkreten Abläufe und Ursachen der durch Eltern beeinflussten Medikationsfehler wissen.
Der Aufsatz Out-of-Hospital Medication Errors Among Young Children in the United States, 2002-2012. von Maxwell D. Smith, Henry A. Spiller, Marcel J. Casavant, Thiphalak Chounthirath, Todd J. Brophy und Huiyun Xiang. ist in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (867-876) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.10.14
Je später der Tag desto mehr Antibiotikaverordnungen gegen Atemwegsinfekten oder "mach lieber mal 'ne Pause".
 Die mehrfach problematische Verordnung von Antibiotika bei akuten Atemwegserkrankungen erfolgt weltweit trotz einiger langfristiger Verbesserungen immer noch zu häufig. Zu den Verbesserungen, aber auch einer Reihe von weiterhin unerwünschten Aspekten der Entwicklung (zu starker Einsatz so genannter "Reserve-Antibiotika") zwischen 2008 und 2012 liefert die Studie der Wissenschaftler vom Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) Entwicklung der ambulanten Antibiotikaverordnungen im Zeitraum 2008 bis 2012 im regionalen Vergleich von Hering R, Schulz Mandy und Bätzing-Feigenbaum J. aktuelle Hinweise. Da es sich bei akuten Atemwegsinfekten meist um virale, d.h. überhaupt nicht mit Antibiotika beeinflussbare Erkrankungen handelt, bleiben nur unerwünschte Wirkungen wie Verdauungsprobleme, die Entstehung von mehrfach resistenten Bakterienarten und eine zunehmende Anzahl von aus diesen Gründen gescheiterten Behandlungen übrig.
Die mehrfach problematische Verordnung von Antibiotika bei akuten Atemwegserkrankungen erfolgt weltweit trotz einiger langfristiger Verbesserungen immer noch zu häufig. Zu den Verbesserungen, aber auch einer Reihe von weiterhin unerwünschten Aspekten der Entwicklung (zu starker Einsatz so genannter "Reserve-Antibiotika") zwischen 2008 und 2012 liefert die Studie der Wissenschaftler vom Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) Entwicklung der ambulanten Antibiotikaverordnungen im Zeitraum 2008 bis 2012 im regionalen Vergleich von Hering R, Schulz Mandy und Bätzing-Feigenbaum J. aktuelle Hinweise. Da es sich bei akuten Atemwegsinfekten meist um virale, d.h. überhaupt nicht mit Antibiotika beeinflussbare Erkrankungen handelt, bleiben nur unerwünschte Wirkungen wie Verdauungsprobleme, die Entstehung von mehrfach resistenten Bakterienarten und eine zunehmende Anzahl von aus diesen Gründen gescheiterten Behandlungen übrig.
Zu letzterem vermittelt eine am 23. September 2014 veröffentlichte Langzeitstudie aus Großbritannien wichtige Informationen: Antibiotic treatment failure in four common infections in UK primary care 1991-2012: longitudinal analysis von Craig J Currie et al., veröffentlicht im "Britrish Medical Journal (BMJ)" (349: g5493) - kostenlos-komplett).
Für die Beantwortung der letztlich immer noch nicht abschließend geklärten Frage warum Ärzte trotz des Wissens über Viren und Bakterien und trotz eindeutiger Behandlungsleitlinien bei akuten Atemwegsinfekten Antibiotika verordnen und Eltern dies trotz weit verbreiteter Vorbehalte gegenüber Antibiotika nach Ärzteberichten für sich und ihre Kinder hartnäckig fordern, gibt es nun aus einer am 6. Oktober 2014 veröffentlichten Auswertung von Behandlungsdaten eine weiteres interessantes Puzzleteil.
Dazu werteten us-amerikanische Wissenschaftler über 17 Monate lang die Abrechnungsunterlagen sowie die elektronischen Behandlungsdaten aus 23 verschiedenen Allgemeinarztpraxen aus. Dabei untersuchten sie speziell Diagnosen, Besuchszeiten im Verlauf des Tages (von morgens 8 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr), die Verordnung von Antibiotika und den sonstigen Gesundheitszustand von über 21.000 Kontakten von Ärzten mit Patienten, die an einem akuten Atemwegsinfekt litten. Ihr Fund: Die Häufigkeit von Antibiotikaverordnungen für dieselbe diagnostistizierte Erkrankung stieg im Laufe des Tages und insbesondere am Nachmittag an.
Am Ende der Nachmittagssprechzeit erhielten 5% mehr Patienten ein Antibiotikum verordnet als zu Beginn der morgendlichen Sprechstunden.
Auch wenn die AutorInnen vorschlagen, noch genauer nach den Ursachen zu forschen und dann eventuell Lösungsmöglichkeiten zu testen, formulieren sie folgende möglicherweise hilfreichen Ratschläge: "Remedies for this problem might include different schedules, shorter sessions, more breaks or maybe even snacks."
Von dem in der online first-Ausgabe der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" am 6. Oktober 2014 ertschienenen Aufsatz Time of Day and the Decision to Prescribe Antibiotics von Jeffrey A. Linder et al. gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 7.10.14
Wer oder was sorgt für desolate Gesundheitssysteme in Afrika? Die Rolle von Pharmafirmen am Beispiel Uganda.
 Zu den Bedingungen welche die Ausbreitung der akuten Ebola-Erkrankungswelle in Westafrika förderten und zukünftige Ausbrüche ermöglichen, zählen u.a. das Fehlen öffentlicher Krankenversicherungen und fehlende oder personell wie infrastrukturell desolate Versorgungssysteme.
Zu den Bedingungen welche die Ausbreitung der akuten Ebola-Erkrankungswelle in Westafrika förderten und zukünftige Ausbrüche ermöglichen, zählen u.a. das Fehlen öffentlicher Krankenversicherungen und fehlende oder personell wie infrastrukturell desolate Versorgungssysteme.
Dabei entsteht oft der Eindruck oder wird sogar erzeugt, es handle sich dabei ausschließlich um die Unfähigkeit oder den Unwillen der afrikanischen Staaten und Gesellschaften.
Dass für das schwache oder dysfunktionale Gesundheitsversorgungssystem jenseits von Ebola aber auch europäische Akteure aktiv verantwortlich sind, zeigt der gerade veröffentlichte "Pharma Brief spezial" 1/2014 von BUKO Pharma-Kampagne und HEPS Uganda über das Geschäftsverhalten der Pharmafirmen Boehringer Ingelheim, Bayer und Baxter in Uganda, einem der ärmsten Länder Afrikas.
Fakten- und facettenreich kommt diese Untersuchung zu dem Fazit: "Die Markenhersteller haben kein oder nur geringes Interesse daran, ein Land ohne zahlungskräftige PatientInnen mit Arzneimitteln zu beliefern und sich dort in der Forschung zu engagieren. Während Baxter den ugandischen Markt bereits aufgegeben hat, plant Boehringer Ingelheim den Rückzug. Nur die Firma Bayer vertreibt weiterhin Medikamente in Uganda - darunter etliche Hormonpräparate und Verhütungsmittel, manche von eher zweifelhaftem Nutzen."
Das "manche" eine sehr zurückhaltende Bewertung ist, zeigt das Angebot der Firma Bayer auf dem ugandischen Markt: Dort "sind 49 Mayer-Medikamente registriert, von denen wir 21 als irrational bewerteten. 13 Produkte wurden als unentbehrlich eingestuft." Als "irrational" bewerteten die damit beauftragten Pharmazeuten vor allem Meduikamente mit mehreren Wirkstoffen.
Die Studie schildert ausführlich und aus Sicht aller daran Beteiligten oder davon Betroffenen die Folgen dieser Art des freien Marktes, also u.a. die massive gesundheitliche Benachteiligung und Schädigung der sozial schwachen Mehrheit der Bevölkerung.
Und schließlich spricht die Studie noch Fragen an, "denen sich entwicklungs- und gesundheitspolitische Akteure und EntscheidungsträgerInnen stellen sollten: Wie kann es z.B. gelingen, gravierende Versorgungslücken zu schließen, wenn der freie Markt versagt? Wie kann die lokale Produktion gestärkt werden? Und last but not least: Sind Entwicklungshilfegelder - die etwa im Rahmen der Contraceptive-Security-Initiative oder des Jadelle-Access-Programms an die Firma Bayer fließen - ein sinnvoller Anreiz, um Pharmaunternehmen dazu zu bewegen, einen vernachlässigten Markt wie Uganda zu bedienen?"
Positiv vermerken die AutorInnen schließlich das insgesamt positive und konstruktive Kommunikationsverhalten der Firmen, insbesondere im Vergleich zu ihrem Verhalten im Rahmen einer Vorgängerstudie. Dies zeigt, dass Studie wie die jetzt vorgelegte keineswegs nur ohnmächtige Anklagen sind, sondern etwas bewegen können.
Den 52 Seiten umfassenden und ansprechend aufgemachten "Pharma Brief Spezial 1/2014" Arm und vergessen - Untersuchung des Geschäftsverhaltens von Boehringer Ingelheim, Bayer und Baxter in Uganda erhält man als PDF-Datei kostenlos, kann ihn aber auch für 5 € bei der BUKO Pharma-Kampagne in Bielefeld bestellen (info@bukopharma.de).
Über den Stand der Verbreitung des Ebola-Fiebers in Westafrika erfährt man Verlässliches in dem Aufsatz Ebola Virus Disease in West Africa — The First 9 Months of the Epidemic and Forward Projections des WHO Ebola Response Team. Er ist auf der "Ebola Outbreak site" der Fachzeitschrift NEJM am 23. September 2014 veröffentlicht und kostenlos erhältlich. Sein Fazit lautet: "These data indicate that without drastic improvements in control measures, the numbers of cases of and deaths from EVD are expected to continue increasing from hundreds to thousands per week in the coming months."
Bernard Braun, 1.10.14
Das "Ebola Ressource Center" der Zeitschrift "The Lancet" startet mit kritischer Darstellung zur Ethik des Umgangs mit Ebola
 Nach einer ersten im Forum Gesundheitspolitik vorgestellten Sammlung wissenschaftlicher Literatur zu Ebola in Verantwortung der Redaktion des "New England Journal of Medicine (NEJM)" gibt es nun vom ebenso renommierten Medizinjournal "The Lancet" eine eigene Sammlung zum Thema. Das Ebola Ressource Center "wishes to assist health workers and researchers working under difficult and dangerous conditions to bring this outbreak to a close. This Ebola hub contains all related resources from The Lancet family of journals offered with free access to support their vital work."
Nach einer ersten im Forum Gesundheitspolitik vorgestellten Sammlung wissenschaftlicher Literatur zu Ebola in Verantwortung der Redaktion des "New England Journal of Medicine (NEJM)" gibt es nun vom ebenso renommierten Medizinjournal "The Lancet" eine eigene Sammlung zum Thema. Das Ebola Ressource Center "wishes to assist health workers and researchers working under difficult and dangerous conditions to bring this outbreak to a close. This Ebola hub contains all related resources from The Lancet family of journals offered with free access to support their vital work."
Der im Moment aktuellste Beitrag befasst sich mit dem in vielen gesundheitspolitischen und -wissenschaftlichen Veröffentlichungen heftig und zum Teil kontrovers diskutierten Thema des experimentellen Einsatzes des bisher nicht zugelassenen Medikaments bzw. Wirkstoffs Zmapp bei an Ebola erkrankten Personen. Auf dem Hintergrund des bisherigen, sehr selektiven Einsatzes an wenigen Personen, des zweimaligen "Erfolges" und einmaligen "Misserfolgs" der Behandlung ohne einen Nachweis von Kausalität, der Forderung nach der Behandlung möglichst aller Erkrankter und des aktuellen Mangels an ZMapp, kommen die beiden angesehenen Bioethiker Ezekiel Emanuel von der University of Pennsylvania in Philadelphia und Annette Rid vom King's College in London zu zwei Feststellungen:
• Sie setzen sich zum einen kritisch mit der bisherigen und möglicherweise auch künftigen Praxis des Einsatzes solcher Mittel auseinander. Aus ethischer Sicht kommen sie zu folgendem Schluss: "Consequently, these interventions should not be distributed for compassionate use outside clinical trials—which might also undermine the feasibility of trials. If compassionate use nonetheless occurs, transparency is key and data about patient outcomes should be collected and shared in full. Of concern, it appears that the existing stock of Zmapp has been used only for compassionate use, and details about patient outcomes are not (yet) readily available. To ensure that data from compassionate use and clinical trials are rapidly integrated, a neutral body should oversee the use of experimental interventions during this epidemic."
• Zum anderen weisen sie auf die nach dem Ebolaausbruch ethisch adäquate Konzentration der gesundheitspolitischen Interventionen auf die Stärkung des Gesundheits- und Versorgungsystems hin: "Now that the response is picking up, the international community needs more focus on strengthening of health systems and infrastructure and less on experimental treatments. Adoption of containment measures with a view to strengthen health systems and infrastructure is the most effective way to curb this epidemic and prevent future ones; it has positive externalities for health promotion and offers fair benefits to communities who engage in research in this outbreak."
Über den aktuellen Anlass des Ebolaausbruchs hinaus lesenswert sind die im Aufsatz zusammengestellten "Ethical principles for trials of experimental treatments or vaccines for Ebola (selected implications)".
Der Aufsatz Ethical considerations of experimental interventions in the Ebola outbreak. von Annette Rid und Ezekiel J Emanuel ist in der Zeitschrift "The Lancet" im August 2014 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.8.14
Keine Zuzahlungen für die Arzneimittelbehandlung von Herzinfarkt-Patienten verbessert Therapietreue und reduziert Ungleichheit
 In die mittlerweile lange Reihe von Interventionsstudien, die insbesondere in den USA nachgewiesen haben, dass die Verringerung oder Streichung von Zuzahlungen zu Gesundheitsleistungen zu positiven Verhaltensweisen (insbesondere mehr Therapietreue) und Gesundheitseffekten führt bzw. innere Zusammenhänge bestehen, passen jetzt die in der Fachzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Ergebnisse einer vergleichbaren Intervention bei Patienten mit einer nachakut behandlungsbedürftigen koronaren Herzerkrankung.
In die mittlerweile lange Reihe von Interventionsstudien, die insbesondere in den USA nachgewiesen haben, dass die Verringerung oder Streichung von Zuzahlungen zu Gesundheitsleistungen zu positiven Verhaltensweisen (insbesondere mehr Therapietreue) und Gesundheitseffekten führt bzw. innere Zusammenhänge bestehen, passen jetzt die in der Fachzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Ergebnisse einer vergleichbaren Intervention bei Patienten mit einer nachakut behandlungsbedürftigen koronaren Herzerkrankung.
Von den 5.855 randomisierten TeilnehmerInnen an der "Post-Myocardial Infarction Free Rx Event and Economic Evaluation (MI FREE)"-Studie bezahlten 2.845 Patienten für 36 Monate keine Zuzahlung für die zahlreichen sekundärpräventiv notwendigen Medikamente (z.B. Statine, Beta-Blocker, ACE-Hemmer), 3.010 andere TeilnehmerInnen mussten die gewöhnlichen Zuzahlungen leisten. Alle TeilnehmerInnen waren bei dem großen privaten Krankenversicherungsunternehmen Aetna versichert. Für die TeilnehmerInnen gab es umfassende soziodemografische Angaben, insbesondere zur ethnischen Aufteilung in weiße und nicht-weiße Personen. Hinzu kamen eine Vielzahl von Krankheits- und Behandlungsdaten.
Bekannt waren bereits vor dieser Studie, dass nichtweiße Patienten mit kardio-vaskulären Erkrankungen zwischen 10 bis 40% weniger sekundärpräventive Therapien wie z.B. Aspirin oder andere Blutverflüssiger und Beta-Blocker erhalten. Mit weißen Schlaganfallpatienten verglichen ist der Anteil der nichtweißen Erkrankten, die z.B. eine Beratung über den Rauchverzicht erhielten um 15% geringer. Dieser Unterschied zum Nachteil der nichtweißen Patienten beträgt beim Erhalt von antithrombotischer Medikation bei der Entlassung 16% und beinahe 10% bei der Lipidtherapie.
Aus früheren Studien ist ebenfalls bereits bekannt, dass eine Absenkung der Zuzahlungen für die medikamentöse Behandlung von Patienten mit Herzinfarkt sich spürbar, wenngleich nicht gewaltig, positiv auf die Therapietreue und das Behandlungsergebnis auswirkt.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie lauten:
• Der komplette Verzicht auf Zuzahlungen erhöhte sowohl bei weißen als auch bei nichtweißen Patienten die Therapietreue.
• Die Therapietreue bei der Einnahme spezifischer Medikamente (z.B. Statine) war bei nichtweißen signifikant geringer als bei weißen Patienten. Unerwünschte klinische Ereignisse (z.B. Re-Infarkt) waren dagegen bei den nichtweißen signifikant häufiger als bei weißen Patienten.
• Die Streichung von Zuzahlungen führte nach dem rechnerischen Ausschluss des Einflusses anderer Faktoren außerdem bei den nichtweißen Patienten zu einer Reduktion der Rate großer vaskulärer Ereignisse um 35% und reduzierte die gesamten Behandlungskosten um 70%.
• Da die Streichung von Zuzahlungen zu keinen vergleichbaren Effekten bei den weißen Patienten führte, stellt diese Intervention allein eine wirksame und gewichtige Methode dar, die rassische und ethnischen Ungleichheiten bei der Behandlung von Infarktpatienten zu reduzieren.
Für die USA resümieren die Verfasser daher: "The broader implementation of this change should be considered."
Ob die Effekte auch nach einem Verzicht auf Zuzahlungen in anderen Gesundheitssystemen mit zum Teil geringerer ethnischen Behandlungsungleichheit, also z.B. in Deutschland, ebenfalls auftreten, käme auf einen Versuch an.
Von dem Aufsatz Eliminating Medication Copayments Reduces Disparities In Cardiovascular Care von Niteesh K. Choudhry et al., 2014 erschienen in "Health Affairs" (33, no.5 (2014):863-870) ist kostenlos das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 5.6.14
Opioide=Patentmittel gegen chronische Schmerzen? Nebenwirkungsarme Alternativen genauso wirksam oder Nutzen zweifelhaft
 Opioide, sind eine dem Opium ähnliche "uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen" (Wikipedia). Sie gehören zu den stärksten Mitteln gegen schwere chronische Schmerzen, die durch einen Tumor oder andere schmerzintensive Erkrankungen hervorgerufen werden.
Opioide, sind eine dem Opium ähnliche "uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen" (Wikipedia). Sie gehören zu den stärksten Mitteln gegen schwere chronische Schmerzen, die durch einen Tumor oder andere schmerzintensive Erkrankungen hervorgerufen werden.
Da diese Mittel eine erhebliche Menge schwerer Nebenwirkungen haben, gibt es zahlreiche Untersuchungen, die zu klären versuchen, ob Opioide z.B. bei rheumatischen Erkrankungen wie Arthritis, Erkrankungen des Nervensystems oder Problemen mit der Rückenmuskulatur oder Wirbelsäule gegenüber anderen Therapien wirklich so viel wirksamer sind, dass die Nachteile vernachlässigt werden können. Bei den anderen Therapien handelt es sich vor allem um psychologische und physiotherapeutische Verfahren. Die praktische Bedeutung dieses Vergleichs ergibt sich u.a. daraus, dass rund ein Viertel der Bevölkerung an chronischen Schmerzen leidet, die nicht Folge einer Krebserkrankung sind.
Eine von Wissenschaftlern der Berliner Charité und der Technischen Universität Darmstadt durchgeführte Meta-Analyse von 46 randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) mit insgesamt 10.742 TeilnehmerInnen aus insgesamt 3.647 dazu durchgeführten Studien zeigten ein unerwartetes Ergebnis:
• Starke Schmerzmittel, die über einen längeren Zeitraum gegen nicht tumorbedingte chronische Schmerzen eingenommen werden, haben den gleichen Effekt wie eine Behandlung ohne Medikamente, d.h. mit Placebos, psychologischen oder physiotherapeutischen Verfahren. Bei längerfristigen Opioidbehandlungen ist der Anteil der Behandlungsabbrecher außerdem sehr hoch und erschwert unverzerrte Nutzenbewertungen.
• Die Schlussfolgerung des Charité-Autors Stein lautet daher: "Bei der Behandlung chronischer Schmerzen, die nicht durch einen Tumor hervorgerufen werden, sollte ein multidisziplinärer Ansatz, also einer, der nicht nur die medizinischen, sondern auch die psycho-sozialen und physiotherapeutischen Aspekte berücksichtigt, im Vordergrund stehen".
Die Studienergebnisse wurden in dem Aufsatz Analgesic efficacy of opioids in chronic pain - recent meta-analyses von Reinecke H, Weber C, Lange K, Simon M, Stein C und Sorgatz H. in der Fachzeitschrift "British Journal of Pharmacology" am 15. Februar 2014 online veröffentlicht. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ebenfalls auf methodisch hohem Niveau beschäftigte sich bereits am 29. August 2013 ein gegenüber einer älteren Version aus dem Jahr 2006 aktualisierter Cochrane Review damit, welchen Nutzen und welche gesundheitlich unerwünschten Wirkungen eine Opioidbehandlung neuropathischer Schmerzen hat. In den Review gingen 31 RCTs ein. Die VerfasserInnen weisen generell darauf hin, dass es sich dabei häufig um sehr kurzzeitige Behandlungen von wenigen Stunden und Tagen handelt, Untersuchungen der Wirkungen längerer Behandlungen also fehlen. Außerdem sind an den meisten Studien nur sehr wenige PatientInnen beteiligt.
Die Studienlage fassen die Cochrane-Reviewer so zusammen: "Short-term studies provide only equivocal (zweifelhaft, mehrdeutig) evidence regarding the efficacy of opioids in reducing the intensity of neuropathic pain. Intermediate-term studies demonstrated significant efficacy of opioids over placebo, but these results are likely to be subject to significant bias because of small size, short duration, and potentially inadequate handling of dropouts. Analgesic efficacy of opioids in chronic neuropathic pain is subject to considerable uncertainty. Reported adverse events of opioids were common but not life-threatening." Und: "All these features are likely to make effects of opioids look better in clinical trials than they are in clinical practice. We cannot say whether opioids are better than placebo for neuropathic pain over the long term."
Von dem Cochrane Review Opioids for neuropathic pain von McNicol ED, Midbari A und Eisenberg E. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8) ist die Zusammenfassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.4.14
Generalisierte Angststörung: Lavendelöl in RCT signifikant und knapp nicht-signifikant wirksamer als Placebo und Antidepressiva
 Homöopathische aber auch aus Pflanzen gewonnene Präparate haben häufig damit zu kämpfen, dass ihre Wirksamkeit nicht auf ähnlich methodisch hohem Niveau nachgewiesen wird bzw. angeblich werden kann wie dies bei verordnungspflichtigen Arzneimitteln der Fall ist.
Homöopathische aber auch aus Pflanzen gewonnene Präparate haben häufig damit zu kämpfen, dass ihre Wirksamkeit nicht auf ähnlich methodisch hohem Niveau nachgewiesen wird bzw. angeblich werden kann wie dies bei verordnungspflichtigen Arzneimitteln der Fall ist.
Unter der eigentlich falschen Überschrift "homöopathische Präparate" wurde in einem 2013 veröffentlichten Aufsatz, der sich mit der Diagnose und Behandlung generalisierter Angststörungen befasste, folgendes zur Wirksamkeit eines Pflanzenextrakts ausgeführt: "In einer Studie ohne Placebokontrolle war ein standardisierter Lavendelölextrakt ebenso wirksam wie das Benzodiazepin Lorazepam. Allerdings war die Teststärke der Studie mit n = 77 für einen Non-inferiority-Vergleich nicht ausreichend. …Die bisher verfügbaren placebokontrollierten Studien mit "subsyndromalen" Angststörungen weisen jedoch auf einen möglichen Substanzeffekt des Lavendelölextrakts hin, der in weiteren Vergleichen mit Standardmedikamenten abzuklären wäre. In der einzigen kontrollierten Studie mit einem homöopathischen Präparat fand sich kein Unterschied zu Placebo."
Bereits im Januar 2014 wurde dann das Ergebnis einer randomisierten kontrollierten und doppelblinden Studie mit 539 Erwachsenen veröffentlicht. Die mit Standardinstrumenten und -skalen (Hamilton Anxiety Scale (HAMA)) als Patienten mit einer generalisierten Angststörung diagnostizierten Personen wurden sowohl mit der Lavendelölzubereitung Silexan, einem Placebo und Paroxetin, einem antidepressiv wirkenden Arzneistoff aus der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) behandelt.
Als primärer Endpunkt für den Nachweis der Wirksamkeit wurde die Veränderung des HAMA-Werts zwischen Beginn und Ende der Behandlung untersucht.
Der HAMA-Wert sank, d.h verbesserte sich
• unter der Behandlung mit zwei Lavendelölkapseln unterschiedlicher Dosis um 14,1 bzw. 12,8 Punkte,
• unter der Behandlung mit dem Placebo um 9,5 Punkte und
• unter der Behandlung mit Paroxetin um 11,3 Punkte.
Die Wirkungsunterschiede zwischen den Lavendelölkapseln jeder Dosis gegenüber dem Placebo waren statistisch signifikant (p<0,01), gegenüber dem Medikament Paroxetin aber nicht, wenn man das übliche Signifikanzniveau von weniger als 5% Irrtumswahrscheinlichkeit nimmt. Die Autoren sehen aber bei dem trotzdem absolut vorhandenen Unterschied zugunsten des Lavendelöls "a trend towards significance (p=0,10)". Die insgesamt positive Bewertung des Lavendelöls stützte sich auch auf seinen zusätzlich nachweisbaren antidepressiven Effekt, die mit ihm assoziierte Verbesserung der allgemeinen mentalen Gesundheit sowie der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Auch wenn damit keineswegs das Ende der Wirksamkeitsforschung über solche Präparate erreicht ist, zeigt die Studie, dass es Sinn macht und möglich ist solche Untersuchungen zu machen und interessante Ergebnisse zur Wirksamkeit so genannter alternativer Therapeutika zu finden.
Der Aufsatz Generalisierte Angststörung: Diagnostik und Therapie von Bandelow B, Boerner RJ, Kasper S, Linden M, Wittchen HU, Möller HJ ist am 26. April 2013 im Deutschen Ärzteblatt (110 (17): 300-10) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz Lavender oil preparation Silexan is effective in generalized anxiety disorder - a randomized, double-blind comparison to placebo and paroxetine. von Kasper S, Gastpar M, Müller WE, Volz HP, Möller HJ, Schläfke S, Dienel A ist im "International Journal of Neuropsychopharmacology" veröffentlicht und am 23. Januar elektronisch vorveröffentlicht worden. Von ihm ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.3.14
Zur Kumulation von 13 Qualitätsmängeln bei der Arzneimittelbehandlung von 65+-BürgerInnen am Beispiel Italien
 Es gibt auch in Deutschland immer mehr Untersuchungen, die speziell für die älteren und oft kränkeren BürgerInnen auf einzelne, unerwünschte oder nachteilige Einzelheiten der Behandlung mit Arzneimitteln hinweisen. Dazu gehören z.B. die Polypharmazie, d.h. die gleichzeitige Behandlung mit 5 und mehr verschiedenen Medikamenten oder die Verschreibung von gesundheitlich nachteiligen Medikamenten.
Es gibt auch in Deutschland immer mehr Untersuchungen, die speziell für die älteren und oft kränkeren BürgerInnen auf einzelne, unerwünschte oder nachteilige Einzelheiten der Behandlung mit Arzneimitteln hinweisen. Dazu gehören z.B. die Polypharmazie, d.h. die gleichzeitige Behandlung mit 5 und mehr verschiedenen Medikamenten oder die Verschreibung von gesundheitlich nachteiligen Medikamenten.
Dass die potenziellen Qualitätsmängel der Arzneimittelbehandlung damit bei weitem nicht vollständig erfasst sind und bewertet werden können, zeigt jetzt eine Untersuchung aller Verordnungsdaten aus dem Jahr 2011 für sämtliche in Italien krankenversicherte Personen im Alter von 65 und mehr Jahren (12,3 Millionen Personen).
Dafür definierten Wissenschaftler der "Italian Medicines Agency (AIFA)" 13 Qualitätsindikatoren, die aus Routinedaten gebildet werden können. Dazu gehörten Indikatoren für Polypharmazie, Therapietreue bei Medikamenten zur Behandlung einiger chronischer Erkrankungen, Verschreibungs-Kaskaden, Unterbehandlung, Arzneimittelwechselwirkungen und die Verordnung von Arzneimitteln, die besser nicht verordnet würden.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• 60,3% aller älterer Krankenversicherten erhielten 5 und mehr Arzneimittel verordnet,
• bei 63,9% der neu behandelten Patienten war die Therapietreue z.B. bei der Behandlung mit Antidepressiva gering (definiert als Versorgung an weniger als 40% der Behandlungstage),
• ein Anteil von 7,5% aller älterer Versicherter waren diabetische Patienten mit einer Unterversorgung mit Statinen,
• 0,8% aller älterer Versicherten wurden gleichzeitig mit Arzneimitteln (hier Warfarin und Aspirin) behandelt, welche Blutungsrisiken erhöhten,
• das für Verordnungs-Kaskaden ausgewählte Beispiel der Verordnung und Einnahme von Anti-Parkinson- und antipsychotischen Medikamenten prägte die Behandlung von 0,2% oder immerhin noch 25.949 älterer Versicherter,
• 1,6% aller älterer Versicherten wurden mit blutdrucksenkenden Medikamenten mit ungünstigem Risiko-Nutzen-Profil behandelt und
• 0,7% aller Älteren wurden mit blutzuckersenkenden Mitteln mit einem damit verbundenen hohen Risiko einer Unterzuckerung behandelt. Nimmt man nur die Gruppe der mit Blutzuckersenkern behandelten Älteren, haben 5,1% von ihnen dieses Risiko.
Zu Recht heben die AutorInnen hervor, dass ihr bevölkerungsbezogener Ansatz "highlighted the huge dimension of suboptimal drug prescribing in older adults, a finding demanding the urgent implementation of national educational programs".
Wer sich näher mit den 13 Indikatoren auseinandersetzen will, sie eventuell unverändert oder verändert im deutschen Gesundheitssystem überprüfen und ihre Bildung nachvollziehen will, findet eine ausführliche Beschreibung in einem Anhang zum Aufsatz, der leider nur für Abonnenten der Zeitschrift zugänglich ist.
Der Aufsatz High Prevalence of Poor Quality Drug Prescribing in Older Individuals: A Nationwide Report From the Italian Medicines Agency (AIFA) von Graziano Onder et al. ist im April 2014 im "Journal of Gerontology A Biol Sci Med Sci" 69 (4): 430-437 erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.3.14
Bedeutung der Therapietreue für den Behandlungserfolg weiter unbestritten
 Wiederholt hat das Forum Gesundheitspolitik das Thema Adherence aufgegriffen und den Forschungsstand auf diesem relativ neuen gesundheitswissenschaftlichen bzw. -politischen Gebiet zusammengefasst, zuletzt in den Beiträgen Therapietreue - vorrangiges Ziel von Gesundheitsreformen und Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung. Seither sind einige neue erwähnenswerte Untersuchungen zu diesem Thema veröffentlicht, die im Wesentlichen die bisher vorliegenden Ergebnisse bestätigen oder untermauern.
Wiederholt hat das Forum Gesundheitspolitik das Thema Adherence aufgegriffen und den Forschungsstand auf diesem relativ neuen gesundheitswissenschaftlichen bzw. -politischen Gebiet zusammengefasst, zuletzt in den Beiträgen Therapietreue - vorrangiges Ziel von Gesundheitsreformen und Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung. Seither sind einige neue erwähnenswerte Untersuchungen zu diesem Thema veröffentlicht, die im Wesentlichen die bisher vorliegenden Ergebnisse bestätigen oder untermauern.
Nennenswert ist dabei eine im Jahr 2012 in Medical Care veröffentlichte Arbeit aus Los Angeles. Zur Erfassung der Therapietreue und ihrer Auswirkungen auf die beiden großen Volkskrankheiten Bluthochdruck und Zuckerkrankheit werteten Forscher von der University of Southern California die Abrechnungsdaten sowie elektronischen Krankenakten von über 2.300 Ärzten eines großen Versorgungsnetzes aus. So konnten sie etwa 770.000 Patientenleben von Diabetikern und Hypertonikern in ihre große retrospektive Beobachtungsstudie aufnehmen. Endpunkte waren alle mikro- und makrovaskulären Komplikationen einschließlich Myokardinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen und diabetische Retinopathie. Die Datenauswertung erfolgte mittels multivariater logistischer Regression und einer instrumentellen Variablen-Bewertung an Hand arztbezogener Größen zur Abschätzung kausaler Zusammenhänge.
Dabei zeigte sich, dass gute Therapietreue bei einer Arzneimittelmehrfachbehandlung durchblutungsbedingte Komplikationen bei beiden Patientengruppen signifikant senkt: Eine Steigerung der Einnahmerate von 50 auf 80 % verringerte die Auftrittswahrscheinlichkeit solcher Ereignisse um fast ein Drittel (29,5 %), optimale Einnahme sogar um fast die Hälfte (46,9 %). Bei kardiovaskulären Komplikationen zeigte sich der gleiche Trend in geringerer Ausprägung (23 % bei guter Adherence). Die Studie von Jae-Jin An und Michael Nichol mit dem Titel Multiple Medication Adherence and its Effect on Clinical Outcomes Among Patients With Comorbid Type 2 Diabetes and Hypertension in Med Care 51 (10), S. 879-887 steht nur als Abstract kostenfrei zur Verfügung.
Bereits aus dem Jahr 2010 stammt eine retrospektive Längsschnittskohortenstudie mit insgesamt 4.708 Typ-2-Diabetikern. Im Rahmen einer 7,5-jähriger Verlaufskontrolle mit vierteljährlichen Erhebungen zur Arzneimittel-Adherence und multiplen anderen, zeitlich variablen Confoundern zeigten mehr als die Hälfte (2.644 bzw. 56,2 %) Komplikationen in Folge mikroangiopathischer Veränderungen. Bei der Anwendung des marginalen strukturellen Modells, einer Methode zur Wirksamkeitsmessung medizinischer Interventionen mit Hilfe der Gewichtung der inversen Wahrscheinlichkeit für erfolgte Behandlung, und nach Adjustierung nach zeitvariablen Faktoren reduzierte gute Adherence gegenüber Antidiabetika die Häufigkeit mikrovaskulärer Komplikationen signifikant um ein Viertel (Hazard Ratio 0,76 (95 % bootstrap KI: 0,60, 0,92). Der Artikel Estimating the effect of medication adherence on health outcomes among patients with type 2 diabetes - an application of marginal structural models von Andrew Yu, Yanny Yu und Michael Nichol aus in Value in Health: S.1038-1045, steht in voller Länge kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Auch bei Personen mit schwer behandelbarem Asthma bronchiale besteht ein erkennbarer Zusammenhang zwischen der Zuverlässigkeit bei der Anwendung ihrer die Bronchen erweiternden Medikation und dem Verlauf der Erkrankung. Dies zeigen Anna Murphy, Amandine Proeschal, Christopher Brightling, Andrew Wardlaw, Ian Pavord, Peter Bradding und Ruth Green in ihrer 2012 in der Zeitschrift Thorax publizierten Studie The relationship between clinical outcomes and medication adherence in difficult-to-control asthma. Geringere Therapietreue führte nicht nur zu einer schlechteren Lungenfunktion gemessen an der Einsekundenausatmungskapazität (75,5 % (Standardabweichung 20,9) bei wenig gegenüber 84,3 % (St.abw.23,5) bei sehr therapietreuen Asthmatikern, p= 0,049). Klinisch relevant war dabei, dass mit schlechterem Einnahmeverhalten das Risiko beatmungspflichtiger Asthmakrisen signifikant ansteigt (Odds Ratio 0,054; 95 % KI 0,01-0,47; p=0.008). Demnach steigt mit einer zehnprozentigen Abnahme der Therapietreue gegenüber bronchodilatatorischen Arzneimitteln die Wahrscheinlichkeit auf beatmungspflichtige Komplikationen um 35 %. Der Artikel von Murphy und Kollegen steht Abonnenten als Volltext und Nicht-Abonnenten als Abstract zur Verfügung.
Im Oktober 2013 publizierte das American Journal of Medicine eine Metaanalye zum Zusammenhang zwischen Therapietreue und Verlauf sowie Kosten bei Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Die Forscher Asaf Bitton, Niteesh Choudhry, Olga Matlin, Kellie Swanton, und William Shrank aus Boston werteten im Rahmen ihrer systematischen Literaturanalyse letztlich 25 Studien aus, die sämtliche Einschlusskriterien erfüllten und von hoher Qualität waren. Ein Fünftel der Untersuchungen gingen den primärpräventiven Effekten nach, während 20 die Beziehungen zwischen Adherence und Ausgaben oder klinischem Verlauf analysierten, die meisten davon bei blutdrucksenkender Therapie und Einnahme von Aspirin. Zwar erfolgte bei der Mehrzahl der Studien eine Adjustierung nach Begleiterkrankungen und soziodemografischen Faktoren, aber nur bei wenigen nach dem "healthy adherer effect" genannten Placebo-Effekt. Drei Studien zeigten, dass gute Therapietreue die klinischen Ergebnisse signifikant verbessert und die Ausgaben für die Sekundärprävention bei koronarer Herzkrankheit um knapp 300 bis fast 870 US-Dollar pro Person senkt; daraus ergeben sich bei Therapietreue Einsparungen zwischen 10 und knapp 18 % gegenüber unzuverlässiger Medikamenteneinnahme. Der Artikel The Impact of Medication Adherence on Coronary Artery Disease Costs and Outcomes: A Systematic Review ist nur für Abonnenten in voller Länge zugänglich; kostenfrei steht das Abstract zur Verfügung.
Der Vollständigkeit halber sei zu guter Letzt eine Studie genannt, die erneut die unerwünschten Folgen von Selbstbeteiligungen auf die Adherence und damit auf den klinischen Verlauf bei chronischen Erkrankungen bestätigt. Zuzahlungssenkungen z. B. im Rahmen wirksamkeitsbasierter Versicherungspläne (value-based benefit design) um durchschnittlich ein Drittel (bei gleichzeitiger geringfügiger Erhöhung des Eigenanteils um knapp 5 % in der Kontrollgruppe) erhöhten die Wahrscheinlichkeit zuverlässiger Medikamenteneinnahme bei Diabetikern von 75,3 auf 82,6 %, während die Adhärenz bei der Kontrollgruppe im Vergleichszeitraum sogar diskret von 79,1 auf 78,5 % sank. Anders ausgedrückt: Sinkende Zuzahlungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit zuverlässiger Medikamenteneinnahme auf mehr als das Anderthalbfache (Odds Ratio = 1,56, P=0,03, 95 % Konfidenzintervall 1,04-2,34). Die lesenswerte Studie der kalifornischen Forschergruppe um Zeng steht kostenfrei zum Download zur Verfügung: The Impact of Value-Based Benefit Design on Adherence to Diabetes Medications:A Propensity Score-Weighted Difference in Difference Evaluation.
Jens Holst, 17.2.14
Überdiagnose und Übertherapie durch Interessenkonflikte in Leitliniengruppen
 Definitionen von Krankheiten und die Kriterien, nach denen sie diagnostiziert werden, beruhen zumeist auf der Übereinkunft der Spezialisten des jeweiligen Fachgebiets. Was auf den ersten Blick vernünftig erscheint, hat sich in der Wirklichkeit als problematisch erwiesen, weil Experten stets auch akademische Eigeninteressen verfolgen und sich um eine möglichst große Bedeutung und Beachtung ihres Gebietes sorgen. Weiterhin sind Experten gerade wegen ihrer Definitionsmacht von größtem Interesse für die Hersteller der Arzneimittel, die im jeweiligen Bereich angewendet werden. Schon fast unbezahlbar werden die Experten für die pharmazeutischen Unternehmen, wenn sie Leitlinien-Gruppen angehören, die sich mit der (Neu-)Festsetzung von Definitionen und diagnostischen Kriterien befassen. Hier kann ein Federstrich zu einer Vergrößerung der Zahl der Betroffenen und zu Millionen zusätzlich medikamentös behandlungsbedürftiger Patienten führen.
Definitionen von Krankheiten und die Kriterien, nach denen sie diagnostiziert werden, beruhen zumeist auf der Übereinkunft der Spezialisten des jeweiligen Fachgebiets. Was auf den ersten Blick vernünftig erscheint, hat sich in der Wirklichkeit als problematisch erwiesen, weil Experten stets auch akademische Eigeninteressen verfolgen und sich um eine möglichst große Bedeutung und Beachtung ihres Gebietes sorgen. Weiterhin sind Experten gerade wegen ihrer Definitionsmacht von größtem Interesse für die Hersteller der Arzneimittel, die im jeweiligen Bereich angewendet werden. Schon fast unbezahlbar werden die Experten für die pharmazeutischen Unternehmen, wenn sie Leitlinien-Gruppen angehören, die sich mit der (Neu-)Festsetzung von Definitionen und diagnostischen Kriterien befassen. Hier kann ein Federstrich zu einer Vergrößerung der Zahl der Betroffenen und zu Millionen zusätzlich medikamentös behandlungsbedürftiger Patienten führen.
Eine Gruppe australischer und amerikanischer Wissenschaftler hat jetzt für den Zeitraum 2000 bis April 2013 für die USA untersucht,
• ob in Leitlinien zu den häufigsten und pharmazeutisch am teuersten zu behandelnden Krankheiten die Krankheitsdefinitionen verändert wurden
• wie groß der Anteil der Wissenschaftler war, die finanzielle Beziehungen zu pharmazeutischen Unternehmen unterhielten
• ob die entsprechenden Firmen Arzneimittel für den Geltungsbereich der jeweiligen Leitlinie anboten.
Die Forscher fanden 16 Leitlinien zu 14 Krankheiten. Für die Ausweitung der Definition bzw. Kriterien bildeten sie 3 Kategorien:
• Prä-Krankheit, wie z.B. Prä-Hypertonie
• Absenkung der diagnostischen Schwelle bzw. niedrigerer Grenzwert
• frühere Diagnosestellung oder andersartige diagnostische Methode.
Bei 2 Krankheiten - HIV und Arthrose - stellten die Autoren keine Veränderungen fest. Eine Ausweitung stellten sie in 10 Leitlinien zu 9 Krankheiten fest (ADHD, Alzheimer, Depression, Cholesterin, Refluxösophagitis, Bluthochdruck, Multiple Sklerose, Herzinfarkt, rheumatoide Arthritis), eine Einengung für die Anämie bei chronischer Niereninsuffizienz und Veränderungen mit unklaren Folgen in 5 Leitlinien zu 4 Krankheiten (Asthma, bipolare Störung, COPD, Diabetes Typ 2).
Als Begründung für die Ausweitung gaben die Leitlinien-Gruppen u.a. die Minderung künftiger Risiken (Cholesterin, Bluthochdruck) oder neue Untersuchungsmethoden und früheren Behandlungsbeginn (Alzheimer) an.
Die Ausweitung einer Krankheitsdefinition kann erwünschte Folgen haben, wie Minderung der Sterblichkeit oder Verbesserung der Lebensqualität aber auch unerwünschte Folgen, wie Überdiagnose, Überbehandlung, Medikalisierung und die Etikettierung beschwerdefreier Menschen als krank. 6 der insgesamt 15 Leitlinien-Gruppen sprachen die unerwünschten Folgen an, zumeist jedoch in sehr knapper und allgemeiner Form, wie z.B. "ethische und praktische Implikationen einer Diagnose des M. Alzheimer in einer präklinischen Phase müssen untersucht werden".
Als finanzielle Verbindung definierten die Autoren Honorare für Vorträge und Beratung, Reisekostenerstattung, Forschungsförderung, Aktienbesitz, Lizenzgebühren und Angestelltenverhältnis. In 13 der 15 Leitlinien-Gruppen fanden sich derartige Verbindungen. Die Diabetes-Gruppe machte die eher nicht glaubwürdige Angabe, niemand habe einen relevanten Interessenkonflikt, die Cholesterin-Gruppe äußerte sich erst gar nicht dazu. Bei den insgesamt 262 Leitlinien-Gruppenmitgliedern bestanden insgesamt 2081 Verbindungen zur Industrie.
Finanzielle Beziehungen zur Industrie hatten u.a.
• 12 der 15 Vorsitzenden der Leitlinien-Gruppen
• 5 von 9 Mitgliedern der ADHD-Gruppe
• 26 von 46 Mitgliedern der Alzheimer-Gruppe
• 23 der 24 Mitglieder einer der beiden Asthma-Gruppen
• 9 der 11 Mitglieder Hypertonie-Gruppe
Im nächsten Schritt prüften die Autoren, wie zielgenau die Industrie ihre Beziehungen zu Mitgliedern von Leitlinien-Gruppen knüpfte.
Bluthochdruck: Die pharmazeutischen Unternehmen Bristol-Myers Squibb, Merck und Novartis bieten die zum damaligen Zeitpunkt (2004) noch Patent-geschützten und daher hochpreisigen Substanzen Irbesartan, Losartan und Amlodipin an. Jeder der 3 Firmen unterhielt finanzielle Beziehungen zu 8 der 11 Mitglieder der Bluthochdruckgruppe. Diese Gruppe prägte den Begriff "Prä-Hypertonie".
COPD: Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim und GlaxoSmithKline bieten zu dieser Krankheit Arzneimittel an. Jede dieser 3 Firmen unterhielt Beziehungen zu 11 der 12 Mitglieder, incl. des Vorsitzenden.
In den Jahren 2009 (wir berichteten) und 2011 (Link) veröffentlichte das amerikanische Institute of Medicine Empfehlungen zur Beschränkung des Einflusses von interessenkonfliktbeladenen Mitgliedern auf die Inhalte der Leitlinien. Die Autoren stellten fest, dass diese Empfehlungen kaum befolgt werden.
Zusammenfassend sind finanzielle Verbindungen von Leitlinien-Gruppenmitgliedern zu Firmen, die Medikamente zur Behandlung der jeweiligen Krankheiten anbieten, eher die Regel als die Ausnahme. Diese Studie belegt, dass die Industrie Beziehungen zu den Experten pflegt, die über die Ausweitung der Krankheitsdefinitionen und damit über die Größe des Absatzmarktes für Medikamente entscheiden. Damit werden der Überdiagnose - eine Diagnose mit negativer Nutzen-Schaden-Bilanz - und der Übertherapie der Weg gebahnt.
Moynihan RN, Cooke GPE, Doust JA, Bero L, Hill S, Glasziou PP: Expanding Disease Definitions in Guidelines and Expert Panel Ties to Industry: A Cross-sectional Study of Common Conditions in the United States. PLoS Med 2013; 10: e1001500. Download Volltext
Report zu Interessenkonflikte in der medizinischen Forschung, Ausbildung und Praxis:
Lo B, Field MJ. Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice. Washington D.C., 2009. Website
Report zu klinischen Leitlinien
Institute of Medicine (IOM). Clinical Practice Guidelines We Can Trust, 2011 Website
s.a. Kategorie Einflussnahme der Pharma-Industrie Link
David Klemperer, 19.12.13
Wenn es darauf ankommt, kann es auch Unterversorgung mit Antibiotika geben - Sepsis-Patienten in Notfallambulanzen
 Viele Untersuchungen über die Verordnung von Antibiotika belegen eine Überversorgung, und wenn man die unerwünschte Folgen von zu vielen und dann noch nicht einmal gesundheitlich notwendigen Antibiotika für die rasch zunehmenden resistenten Bakterienstämme bedenkt, auch eine gesundheitlich folgenschwere Fehlversorgung. Seltener ist, dass es eine gesundheitlich relevante Unterversorgung mit Antibiotika gibt.
Viele Untersuchungen über die Verordnung von Antibiotika belegen eine Überversorgung, und wenn man die unerwünschte Folgen von zu vielen und dann noch nicht einmal gesundheitlich notwendigen Antibiotika für die rasch zunehmenden resistenten Bakterienstämme bedenkt, auch eine gesundheitlich folgenschwere Fehlversorgung. Seltener ist, dass es eine gesundheitlich relevante Unterversorgung mit Antibiotika gibt.
Dass dies selbst bei offensichtlichem Bedarf in gravierendem Umfang passiert, zeigt eine jetzt veröffentlichte Studie zum Einsatz von Antibiotika bei Patienten mit einer Sepsis in den Jahren 1994 bis 2009 in den USA. Die dazu vorhandene Leitlinie empfiehlt eine frühe, zielgerichtete und angemessene Antibiotikatherapie, die den Erkrankungsverlauf positiv beeinflusst und das Sterblichkeitsrisiko reduziert.
Um zu klären, ob und wie dieser Leitlinie entsprochen wird, analysierten US-WissenschaftlerInnen Daten des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey" für alle erwachsenen Patienten in den USA, die wegen einer Sepsis in Notfallstationen von Krankenhäusern versorgt wurden.
Unterschieden wurden dabei Patienten bei denen eine explizite ICD-Diagnose Sepsis gestellt wurde von Patienten mit einer impliziten Sepsis. Dies rekonstruierten die ForscherInnen aus anderen dokumentierten Angaben zur Infektionsart und von Fehlfunktionen von Organen, die einen sicheren Schluss auf Sepsis zuließen.
Die Anzahl der Notfallstations-Aufenthalte mit einer expliziten Sepsis-Diagnose bewegte sich in den 16 untersuchten Jahren nahezu unverändert bei 1,23 Personen pro 1.000 Einwohner. Dies entspricht im Durchschnitt 260.000 Personen. Die Anzahl der Personen mit einer impliziten Sepsis-Diagnose erhöhte sich dagegen alle 2 Jahre um 0,07 Personen pro 1.000 Einwohner.
Von den Notfallpatienten mit expliziter Sepsisdiagnose erhielten zwischen 52% (1994-1997) und 69% (2006-2009) eine medizinisch sofort notwendige Behandlung mit Antibiotika in der Notfallstation und nicht erst möglicherweise später in der endgültigen Krankenhaus-Intensivstation. Obwohl eine Behandlung gegen multiresistente Bakterien vom Typ MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) bei diesen Patienten eigentlich die Regel sein sollte, stellten entsprechende Antibiotika nur 18% der gesamten Verordnungen. Wie gefährlich eine Sepsis und dazu auch noch eine zunächst nicht behandelte Sepsis sein kann, zeigte die Studie auch: 31% der explizit diagnostizierten Sepsispatienten wurden in die Intensivstation aufgenommen, wo 40% verstarben. Die Gesamtsterblichkeit aller Sepsispatienten in Krankenhäusern betrug 17%. In beiden Fällen liefert die Studie allerdings keine Daten für einen Zusammenhang von Nicht-Verordnung und Tod.
Die praktischen Schlussfolgerungen der Autoren lauteten: Als erstes müssen die Diagnostik von Sepsis-Patienten verbessert und so früh und gezielt wie möglich geeignete Antibiotika verordnet werden. Aktuell müsste der Schutz gegen MRSA-Erreger an vorderster Stelle stehen.
Der Aufsatz Sepsis visits and antibiotic utilization in U.S. emergency departments von Filbin MR et al. ist am 6. November 2013 als elektronische Vorab-Veröffentlichung der Fachzeitschrift "Critical Care Medicine" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.12.13
"Wer hat noch nicht, wer will noch mal": Ist die "Statinisierung" der Weltbevölkerung zwingend, sinnvoll oder vermeidbar?
 Nach der im November 2013 erfolgten Veröffentlichung einer neuen, von zahlreichen renommierten Experten erarbeiteten Leitlinie der beiden seriösen US-Fachgesellschaften "American College of Cardiology" und "American Heart Association" zur Bewertung des individuellen kardiovaskulären Risikos und zur Senkung erhöhter "böser" oder LDL-Cholesterinwerte (low-density lipoprotein cholesterol) insbesondere mit Statinen merkt die interessierte Öffentlichkeit erst langsam deren quantitative und qualitative Bedeutung.
Nach der im November 2013 erfolgten Veröffentlichung einer neuen, von zahlreichen renommierten Experten erarbeiteten Leitlinie der beiden seriösen US-Fachgesellschaften "American College of Cardiology" und "American Heart Association" zur Bewertung des individuellen kardiovaskulären Risikos und zur Senkung erhöhter "böser" oder LDL-Cholesterinwerte (low-density lipoprotein cholesterol) insbesondere mit Statinen merkt die interessierte Öffentlichkeit erst langsam deren quantitative und qualitative Bedeutung.
Im Mittelpunkt dieser Leitlinie steht eine selbst nach Meinung der Leitlinienkritiker monumentale Aufarbeitung der wissenschaftlichen Evidenz für einen Nutzen der Statintherapie. So taucht allein der Begriff "evidence" im Teil der Leitlinien über die Bewertung des kardiovaskulären Risikos 346 mal und im Teil, in dem es um die Behandlung geht sogar 522 mal auf. Die Anzahl der zitierten randomisierten kontrollierten Studien, die den Sinn und Nutzen einer Senkung des "bösen" Cholesterins und die Möglichkeiten der Prävention von Herzinfarkt und Schlaganfall untersucht haben, ist entsprechend groß.
Die Problematik der Leitlinie und ihrer praktischen Konsequenzen spitzt der Präventionsexperte J. Ioannidis vom "Stanford Prevention Research Center" in einem Kommentar ("viewpoint") in der Ausgabe des "Journal of the American Medical Association" vom 2. Dezember 2013 so zu: "It is uncertain whether this would be one oft he greatest achievements or one oft the worst disasters of medical history".
Die für ihn dabei leitenden Folgen und Umstände der Leitlinie und ihres Risikoberechnungsmodells sind u.a. folgende:
• Von den 101 Millionen Angehörigen der Bevölkerung in den USA, die aktuell an keiner kardiovaskulären Erkrankung leiden und zwischen 40 und 79 Jahre alt sind, hätten 33 Millionen nach dem Modell für die folgenden 10 Jahre ein Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall etc. von 7,5% und höher. Ihre intensive Behandlung mit Statinen wäre nach der Leitlinie in höchstem Maße empfehlenswert. Für 13 Millionen mit einem Risiko zwischen 5% und 7,4% empfiehlt die Leitlinie, die Einnahme von Statinen zu erwägen. Fast die Hälfte der aktuell kardiovaskulär gesunden Bevölkerung müsste bzw. könnte also dauerhaft mit Stationen behandelt werden.
• Der Autor berechnet schließlich nach demselben Modell und mit eher zurückhaltenden Annahmen, dass weltweit mindestens 920 Millionen kardiovaskulär gesunder Menschen mit Statinen behandlungsbedürftig wären. Berücksichtigt man dann noch, dass weltweit auch ein paar hundert Millionen kardiovaskulär kranker oder Menschen mit extrem hohen Cholesterinwerten schon mit Statinen behandelt werden, wird die quantitative Wirkung der Leitlinie und deren qualitative Relevanz für die Dauermedikation von weltweit mindestens anderthalb Milliarden Personen noch deutlicher.
• Die Kritik des Kommentators richtet sich vor allem auf die wissenschaftliche Qualität des der Leitlinie zu Grunde liegenden Modells der Risikovorhersage sowie die Unabhängigkeit eines Teils ihrer Verfasser. So hatten laut eines 2013 im "British Medical Journal" erschienenen Aufsatzes 8 der 15 Leitlinienautoren Beziehungen zu Pharmaunternehmen.
• Die Kritik am Modell richtet sich vor allem darauf, dass es zwar randomisierte kontrollierte Studien zur Wirkung von Statinen auf das LDL gibt, aber "no randomized evidence that this particular risk model, rather than any of its predecessors built with the same, similar, or other predictors, would identify the patients who benefit most from statin therapy and that the optimal treatment threshold is 5%, 7,5%, or even 2,5% or 15%." Zwischen jedem dieser Risiko-Schwellenwerte liegen mehrere hundert Millionen behandelter oder unbehandelter gesunder Menschen und natürlich mindestens genauso hohe Summen erzielter oder nicht erzielter Umsätze der Statinhersteller.
• Nicht zuletzt müssten nach Ansicht des Autors bei den Schwellenwerten für die Behandlungsnotwendigkeit aber auch die bekannten unerwünschten Wirkungen bei Statinen (stärker) berücksichtigt werden.
• Der Kommentar endet mit dem Appell, es müsse angesichts der bisherigen und künftigen Umsätze mit Statinen doch möglich sein, einen im Verhältnis kleinen Betrag einzusetzen um das beste Modell zur Prädiktion und der Behandlungsschwellenwerten von kardiovaskulären Erkrankungen zu erforschen und dafür genügend StudienteilnehmerInnen zu finden.
Die rund 50-seitige Leitlinie 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines von Goff Jr DC, Lloyd-Jones DM, Bennett G, O'Donnell CJ, Coady S, Robinson J, D'Agostino Sr RB, Schwartz JS, Gibbons R, Shero ST, Greenland P, Smith Jr SC, Lackland DT, Sorlie P, Levy D, Stone NJ, Wilson PWF ist am 12. November 2013 online und komplett kostenlos in der Zeitschrift "Journal of the American College of Cardiology" und in der Zeitschrift "Circulation" erschienen.
Die jüngste und mit Sicherheit nicht letzte kritische Auseinandersetzung mit der Leitlinie More Than a Billion People Taking Statins?Potential Implications of the New Cardiovascular Guidelines von John Ioannidis ist am 2. Dezember 2013 online und ebenfalls kostenlos im "Journal of the American Medical Association" erschienen. Der Autor verweist auf eine Reihe für die weitere Debatte lehr- und hilfreiche Veröffentlichungen.
Bernard Braun, 3.12.13
Polypharmazie bei Allgemeinärzten: Ein Drittel der Arzneimittel hatte keinen Nutzen - CDU/CSU/SPD-Kompromiss: Kasse statt Klasse!!
 Polypharmazie, d.h. die gleichzeitige Verordnung von mehr als 5 unterschiedlichen Arzneimitteln in einem definierten Zeitraum, ist wegen der nicht mehr bekannten oder überschaubaren Wechselwirkungen und den praktischen Schwierigkeiten, sie korrekt einzunehmen, ein generelles Versorgungsproblem (vgl. dazu "Viel hilft viel" - Folgenreicher Irrtum über den Nutzen von Arzneimitteln. Polypharmazie-Studie und Leitlinie Multimedikation). Dass dabei von niedergelassenen Allgemeinärzten auch noch bis zu einem Drittel dieser Medikamente ohne eine wissenschaftliche Evidenz für ihren Nutzen verordnet werden, ist der wesentliche Fund einer am 15. November 2013 veröffentlichten Vorabstudie des Instituts für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Universität Witten/Herdecke.
Polypharmazie, d.h. die gleichzeitige Verordnung von mehr als 5 unterschiedlichen Arzneimitteln in einem definierten Zeitraum, ist wegen der nicht mehr bekannten oder überschaubaren Wechselwirkungen und den praktischen Schwierigkeiten, sie korrekt einzunehmen, ein generelles Versorgungsproblem (vgl. dazu "Viel hilft viel" - Folgenreicher Irrtum über den Nutzen von Arzneimitteln. Polypharmazie-Studie und Leitlinie Multimedikation). Dass dabei von niedergelassenen Allgemeinärzten auch noch bis zu einem Drittel dieser Medikamente ohne eine wissenschaftliche Evidenz für ihren Nutzen verordnet werden, ist der wesentliche Fund einer am 15. November 2013 veröffentlichten Vorabstudie des Instituts für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Universität Witten/Herdecke.
In dieser Studie wurde das Verordnungsgeschehen von 169 Patienten aus 22 allgemeinmedizinischen Praxen untersucht, denen im Durchschnitt täglich rund neun verschiedene Arzneimittel verordnet worden waren.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Im Durchschnitt gab es für 2,7 Arzneimittel pro Patient keine wissenschaftliche Begründung für den Nutzen der Verordnung.
• "Über 90% der Patienten wiesen mindestens eine unbegründete Arzneimittelverschreibung auf."
• Bei 56% der Patienten gab es Dosierungsfehler, relevante Interaktionen zwischen den Medikamenten traten bei 59% der Patienten auf und Medikamente, die bei alten Menschen nicht verordnet werden sollten erhielten trotzdem 37% der über 65jährigen.
Die Forschergruppe um Andreas Sönnichsen halten als ERklärung die Hausärzte für "überfordert" die Medikamente kritisch zu durchforsten, vor allem wenn Patienten mit "langen Medikationslisten aus der Klinik entlassen werden oder von verschiedenen Fachärzten zurückkommen: "Wie sollen sie entscheiden, welches Medikament wirklich erforderlich ist".
"In einer neuen europaweiten Studie des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Witten/Herdecke soll den Hausärzten nun geholfen werden. Unter Berücksichtigung von Diagnosen, Laborwerten und Begleiterkrankungen wird eine elektronische Entscheidungshilfe Vorschläge machen, welche Medikamente am ehesten entbehrlich oder gar schädlich sind."
Dem Wissensansatz dieser Studie ist Erfolg zu wünschen. Zu bedenken ist allerdings dass besseres und elektronisch verfügbares Wissen allein nicht verlässlich die Verordnung von unwirkksamen, nicht indizierten oder zu vielen Arzneimitteln verhindert (vgl. dazu die aktuellen Studien zur besonderen Dynamik der Arzneimittel-Verordnung: "Overrides of medication-related clinical decision support alerts in outpatients" und 'Too much, too late': mixed methods multi-channel video recording study of computerized decision support systems and GP prescribing).
In diesem Zusammenhang sei schließlich daran erinnert, dass in Deutschland gegen die Verordnung von zu vielen Arzneimitteln, die keinen nachweisbaren Nutzen haben, nicht nur eine bessere Arztinformation helfen könnte. Seit 2011 schrieb ein Gesetz zunächst für neue, aber tendenziell auch für Altbestand-Medikamente vor, diese Medikamente bei fehlendem Zusatznutzen nur zu einem niedrigeren Preis als dem, den sich die Hersteller gedacht hatten, auf den Markt kommen zu lassen. Dies nahm in Kauf, dass Hersteller wegen Unrentabilität auch komplett auf das Angebot verzichten könnten.
Wie notwendig eine harte Prüfung des Nutzens ist und wie groß qualitative Effekte sein könnten, zeigten die ersten zwei Praxis-Jahre des Gesetzes. Selbst als jedem Hersteller klar war, seine neuen Medikamente würden nach den Kriterien und Methoden des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) aus dem Jahr 2011 auf ihren Zusatznutzen geprüft und ihr erzielbarer Preis hinge davon, waren von den 50 Medikamenten mit 78 Anwendungsmöglichkeiten, die der Gemeinsame Bundesausschuss bis Ende September 2013 bewertete, 55% ohne Zusatznutzen und nur 12% hatten einen beträchtlichen Zusatznutzen.
Um so unsinniger ist daher allerdings das zwischen den CDU/CSU und SPD-KoalitionsunterhändlerInnen erzielte "Verhandlungsergebnis(se) Gesundheit - Pflege, Stand: 18.11.2013; 23:08 Uhr". Dort wird auf die bisherige qualitative Nutzenbewertung für die Unmassen von bereits zugelassenen Arzneimitteln zu Gunsten einiger finanzieller Vorteile für die GKV verzichtet: "Die mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz eingeführte Nutzenbewertung und die an schließende Verhandlung von Erstattungsbeträgen für innovative Arzneimittel ist ein entscheidender Schritt für eine qualitätsorientierte und wirtschaftliche Arzneimittelversorgung. Allerdings zeigen sich beim Aufruf des so genannten Bestandsmarktes eine Reihe rechtlicher, verfahrenstechnischer und praktischer Probleme. Daher werden wir den gesamten Bestandsmarktaufruf nach § 35a Abs. 6 SGB V beenden. Dies gilt auch für laufende Verfahren. Um das hier ursprünglich geplante Einsparvolumen doch zu erreichen, werden wir das Preismoratorium auf dem Niveau der Preise vom 1.8. 2009 nahtlos fortführen und den Herstellerrabatt auf verschreibungspflichtige Arzneimittel nach § 130a Abs. 1 SGB V ab dem Jahr 2014 von sechs auf sieben Prozent erhöhen." Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass hier ein von der immer als pharmanah kritisierten FDP und der CDU/CSU verabschiedetes Gesetz mit aktiver Unterstützung der SPD gekippt bzw. an einem elementaren Punkt entschärft wird.
Einen Überblick über die Witten-Herdecker Vorabstudie vermittelt eine Pressemitteilung der Universität.
Über das Ziel der Hauptstudie Medikationscheck per Software gibt ein Artikel in einer Branchenzeitschrift etwas Auskunft.
Bernard Braun, 25.11.13
… und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker - nur bekommen Sie die richtige Antwort und befolgen Ärzte wirklich Alarmhinweise?
 PISA-Tests mit Patienten über die richtige Einschätzung von Risiken und Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen sowie das Beklagen einer mangelnden "health literarcy" als einer Quelle von Fehlentscheidungen im Gesundheitswesen, werden international wie national häufig durchgeführt. Obwohl in einigen Untersuchungen auch Ärzte erhebliche Wissenslücken (in Einzelfällen sogar mehr als Patienten) und daraus resultierend auch Beratungs- und Behandlungsdefizite hatten, macht die Arzneimittelwerbung das korrekte Wissen von Ärzten und Apothekern unvermindert zum Allheilmittel bei möglichen Wissenslücken und Verhaltensunsicherheiten der Patienten.
PISA-Tests mit Patienten über die richtige Einschätzung von Risiken und Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen sowie das Beklagen einer mangelnden "health literarcy" als einer Quelle von Fehlentscheidungen im Gesundheitswesen, werden international wie national häufig durchgeführt. Obwohl in einigen Untersuchungen auch Ärzte erhebliche Wissenslücken (in Einzelfällen sogar mehr als Patienten) und daraus resultierend auch Beratungs- und Behandlungsdefizite hatten, macht die Arzneimittelwerbung das korrekte Wissen von Ärzten und Apothekern unvermindert zum Allheilmittel bei möglichen Wissenslücken und Verhaltensunsicherheiten der Patienten.
Dass daran Zweifel erlaubt sind, zeigte eine im Oktober 2013 im "Deutschen Ärzteblatt" veröffentlichte Studie über das Verständnis der durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)" standardisierten und kodierten Nebenwirkungsrisiken von Arzneimitteln in Beipackzetteln. Das BfArM hat die Wahrscheinlichkeit bzw. Häufigkeit von Nebenwirkungen mit den Begriffen "häufig", "gelegentlich" und "selten" beschrieben. Diesen Begriffen werden seit langem eindeutige numerische Werte zugeordnet. "Häufig" bedeutet eine Häufigkeit zwischen 1% und 10%, "gelegentlich" 0,1% bis 1% und "selten" 0,01% bis 0,1%. Eine Forschungsgruppe an der Universität Lübeck fragte insgesamt 1.000 Ärzte, Apotheker und Juristen postalisch zum einen nach ihrer numerischen Schätzung einer kontextfreien Liste von 20 verbalen Wahrscheinlichkeitsausdrücken. Zum anderen sollten die Befragten einem konkreten Arzt-Patient-Gesprächbeispiel in dem Nebenwirkungen thematisiert wurden, freie Prozentangaben für die BfArM-Begriffe zuordnen.
Die Ergebnisse zeigten insgesamt,
• dass nicht nur Patienten oder die Allgemeinbevölkerung die in der zitierten Weise kodierten Risiken deutlich überschätzen, sondern auch ärztliche, pharmazeutische und juristische Experten.
• Im Mittel gaben bei der kontextfreien Liste alle drei Experten als Wert von "häufig" 75% statt der richtigen 1% bis 10% an. Ähnliche Überschätzungen gab es auch bei "gelegentlich" und "selten".
• Bei der Wahrscheinlichkeitszuordnung zur Häufigkeit von Nebenwirkungen innerhalb eines Patientengesprächs wurden allgemein niedrigere und zum Teil auch korrekte Prozentwerte genannt. Trotzdem stimmen die Interpretationen von Ärzten nur selten mit den vom BfArM vorgegebenen tatsächlichen Risikowerten überein. Bei der Kodierung als "häufig" stimmten die Angaben von 3,5% aller befragten Ärzte, 5,8% aller Apotheker und 0,7% aller Juristen. Bei "gelegentlich" machten nur noch 0,3% der Ärzte, 1,9% der Apotheker und 0% der Juristen zutreffende Angaben. Noch weiter sank der Anteil von antwortenden Experten, wenn es um eine "seltene" Nebenwirkungen ging: 0,9% der Ärzte, 1,9% der Apotheker und 0,7% der Juristen lagen mit ihren Werten richtig.
• Angesichts des Risikos, dass falsche und auch noch durch Ärzte oder Apotheker stimulierte oder gestützteVorstellungen Risikowahrscheinlichkeiten die Therapietreue der Patienten beeinträchtigen können, schlagen die AutorInnen vor, die verbalen Umschreibungen in den Beipackzettel "eher dem umgangssprachlichen Verständnis von Wahrscheinlichkeiten" anzupassen. Welche Begriffe dies sein könnten, bleibt aber im Unklaren. Die Lücke zwischen den bei Ärzten für "häufig" genannten Werte und den tatsächlichen 1% bis 10% sprachlich zu schließen ist allerdings auch nicht ganz einfach.
Unter der Überschrift "Realitätsfernes Memorieren" versucht der Kommentator Matthias Wallenfels in der Online-Ausgabe der Ärzte Zeitung vom 17.10.2013 allerdings zumindest aufkommende Zweifel am Wissen und Handeln von Ärzten im Keim zu ersticken: "Welche Konsequenzen hat das für die Praxisroutine? Eigentlich gar keine! Denn vollkommen ausgeblendet wird im Zuge der Lübecker Studie die reale Praxissituation im Versorgungsalltag. So hat jeder Arzt in der Praxis via EDV, Web oder auch die klassische Rote Liste die Möglichkeit, schnell die spezifischen Angaben zu Nebenwirkungen eines Präparates inklusive absoluter Zahlen zu finden. Er muss nicht zwangsweise Werte memorieren. Nicht nur im Interesse einer belastbaren, intakten Arzt-Patienten-Beziehung wird er gewissenhaft recherchieren und den Patienten dann aufklären. Es geht auch um das Berufsethos."
Ob das ja eigentlich unschlagbare Duo von Technik und Ethos wirklich so segensreich ist und die Befragten ihr Gedächtnis lieber für andere Informationen geschont haben, ist leider nicht mit Daten deutscher Ärzte überprüfbar, sondern erfordert einen Blick in die USA und Großbritannien. Auch dort gibt es gedächtnisentlastende technische Hilfen und Ärzteethos, nur glaubt man dort nicht so naiv wie hierzulande, dass dies automatisch zu positiven Ergebnissen führt.
Bei 2.004.069 ambulanten Arzneimittelverordnungen in den USA meldete sich ein elektronisches Alarm- oder Unterstützungssystem ("clinical decision support (CDS)") in 157.483 Fällen, d.h. bei 7,9% aller Verordnungen. Zu den wichtigsten Warnungen gehörten die auf Doppelverordnungen (33% aller Warnungen), Patientenallergien (17%) und Wechselwirkungen von Medikamenten (16%).
Der Umgang mit diesen Hinweisen war keineswegs durch "Folgsamkeit" geprägt:
• 52,6% aller Warnhinweise oder Alarme wurden übergangen ("overridden").
• Am häufigsten setzten sich die verordnenden Ärzte über Warnhinweise zu gleich wirksamen Medikamenten mit einer anderen Zusammensetzung (bei 85% solcher Hinweise), altersbezogene Empfehlungen (79%), Empfehlungen für eine nierenschonende Medikation (78%) und Patientenallergien (77,4%) hinweg.
• Insgesamt waren 53% aller Fälle der Missachtung von Warnhinweisen medizinisch angemessen, 47% also nicht.
• Die Angemessenheit dieses Umgangs mit Warnhinweisen schwankte aber je nach Thema zwischen 12% bei Empfehlungen zur Nierenschonung und 92% bei Patientenallergien.
Die ForscherInnen empfahlen zur Reduktion der Alarmmüdigkeit qualitative und die Relevanz des Hinweises besser vermittelnde Verbesserungen der Alarmhinweise.
Dass dies u.U. aber den ignoranten Umgang mit Alarmhinweisen auch nicht sofort und vollständig verringert, zeigt eine nur wenige Monate ältere kleine Beobachtungs-Studie über die Nutzung eines computergestützten CDS innerhalb von 112 Arztkonsultationen in drei Praxen von acht britischen Allgemeinärzten. Bei 73 dieser Konsultationen wurden insgesamt 132 Arzneimittelverordnungen ausgestellt. Bei 61% der Verordnungen erhielt der Arzt mindestens einen Alarmhinweis. Bei insgesamt 117 Warnungen berücksichtigten die britischen Ärzte lediglich drei, was die Ausstellung des jeweiligen Rezepts aber nicht verhinderte.
Die entscheidenden Gründe für die völlige Nichtbeachtung der Warnungen des CDS brachten die britischen ForscherInnen auf die Formel "too much, too late". In den beobachteten Fällen lieferte das CDS seine Informationen erst zum Zeitpunkt der Ausstellung eines Rezepts am PC und damit viel zu spät bzw. am Ende eines langen "Arbeitsprozesses". Davor hatten sich die Ärzte mehr oder weniger aufwändig mit der Definition des gesundheitlichen Problems beschäftigt, hatten sich minutenlang die notwendige Behandlung überlegt, sie dem Patienten erklärt, andere Therapien ausgeschlossen, sich mit dem Patienten über das vorgeschlagene Vorgehen geeinigt, ihm Instruktionen für die Einnahme des geplanten Medikaments gegeben und evtl. ein dafür geeignetes schriftliches Merkblatt ausgehändigt. Würden Ärzte zu diesem späten Zeitpunkt auf den Alarm ihres CDS reagieren, müssten sie nicht nur mögliche Fehler und Schwächen eingestehen, sondern den beschriebenen Entscheidungs- und Vermittlungsprozess größtenteils erneut abarbeiten.
Die AutorInnen empfehlen daher eine Umorganisation des Entscheidungsprozesses von Ärzten, welche dafür sorgt, dass CDS-Hilfen wesentlich früher bzw. zu Beginn des Therapieentscheidungsprozess abgefragt und genutzt werden.
Ob diese und die bereits erwähnte Empfehlung wirklich dazu führen, dass fachlich korrekte elektronische Alarmhinweise wesentlich mehr als bisher berücksichtigt werden, muss erst untersucht werden. Und dann auch bei mehr Ärzten.
Sicher ist nur, dass blindes Vertrauen in die Ärzte und den Nutzen technisch verfügbarer Entscheidungsunterstützungssysteme unangebracht ist. Ohne die genannten und möglicherweise noch mehr kognitive und organisatorische Verbesserungen nutzen solche Systeme offensichtlich relativ wenig bzw. werden nicht praxisrelevant beachtet.
Nicht geglaubt oder erhofft, sondern untersucht werden müsste natürlich auch, ob deutsche Ärzte eventuell völlig anders mit ihren elektronischen Entscheidungshilfen oder mit "Roter Liste" und anderen potenziellen Hilfsmitteln umgehen.
Zu dem Aufsatz Overrides of medication-related clinical decision support alerts in outpatients von Karen C Nanji et al. - online erschienen am 28. Oktober 2013 in der Fachzeitschrift "Am Med Inform Association" ist kostenlos das Abstract zu erhalten.
Die Studie 'Too much, too late': mixed methods multi-channel video recording study of computerized decision support systems and GP prescribing von James Hayward et al. ist bereits am 7. März 2013 in derselben Fachzeitschrift erschienen. Auch hier gibt es das Abstract kostenlos.
Die Studie Verständnis von Nebenwirkungsrisiken im Beipackzettel: Eine Umfrage unter Ärzten, Apothekern und Juristen von Andreas Ziegler et al. ist 2013 im Deutschen Ärzteblatt (110(40): 669-73) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Der Kommentar zum Beipackzettel: Realitätsfernes Memorieren von M. Wallenfels ist in der Ärzte Zeitung vom 17. 10. 2013 erschienen.
Bernard Braun, 13.11.13
Erhöht Vitamin D die Knochendichte und senkt damit das Frakturrisiko? Nur sehr geringe Evidenz und dann nur bei einzelnen Knochen!
 Die Furcht vor der Verringerung ihrer Knochendichte und der möglichen Folge schwerer Knochenbrüche und damit oft assoziierter langer Erkrankungsdauern oder gar anhaltender Pflegebedürftigkeit plagt relativ viel ältere Menschen ab ihrem 50. Lebensjahr. Als präventiv wirksam gilt u.a. die regelmäßige nahrungsergänzende Einnahme von Vitamin D zusammen mit oder ohne Kalzium. Untersuchungen zeigen, dass bis zur Hälfte der über 50-Jährigen ihre Ernährung so ergänzen. Frühere methodisch hochwertige Meta-Analysen kamen bereits zu dem Schluss, dass Vitamin D allein nicht das Risiko von Knochenbrüchen verringert. In Studien, die zu diametral anderen Ergebnissen kamen, erhielten die TeilnehmerInnen neben Vitamin auch noch Kalzium, das erwiesenermaßen de Knochendichte verbessern kann und daher auch eine präventive Wirkung auf das Risiko von Knochenbrüchen hat.
Die Furcht vor der Verringerung ihrer Knochendichte und der möglichen Folge schwerer Knochenbrüche und damit oft assoziierter langer Erkrankungsdauern oder gar anhaltender Pflegebedürftigkeit plagt relativ viel ältere Menschen ab ihrem 50. Lebensjahr. Als präventiv wirksam gilt u.a. die regelmäßige nahrungsergänzende Einnahme von Vitamin D zusammen mit oder ohne Kalzium. Untersuchungen zeigen, dass bis zur Hälfte der über 50-Jährigen ihre Ernährung so ergänzen. Frühere methodisch hochwertige Meta-Analysen kamen bereits zu dem Schluss, dass Vitamin D allein nicht das Risiko von Knochenbrüchen verringert. In Studien, die zu diametral anderen Ergebnissen kamen, erhielten die TeilnehmerInnen neben Vitamin auch noch Kalzium, das erwiesenermaßen de Knochendichte verbessern kann und daher auch eine präventive Wirkung auf das Risiko von Knochenbrüchen hat.
Einige ForscherInnen waren sich aber nicht sicher, ob die Solo-Wirkung von Vitamin D nicht doch noch durch höhere Dosen oder durch einen gezielten Einsatz in besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen eintreten könnte. Deshalb führten sie einen systematischen Review und eine Meta-Analyse über alle randomisierten kontrollierten Studien durch, welche die Einnahme verschiedenster Vitamin D-Dosen und Kombinationen von Vitamin D mit anderen als hilfreich vermuteten Mitteln auf Personen ab dem 20. Lebensjahr untersuchten. Der primäre Endpunkt der Studien war die prozentuale Veränderung, d.h. im positiven Fall Erhöhung der Knochendichte.
In ihre Studie gingen von 3.930 bis 2012 gefundenen Studien 23 mit einer mittleren Beobachtungszeit von fast 2 Jahren und mit 4.082 TeilnehmerInnen ein. 92% von ihnen waren Frauen, das Durchschnittsalter betrug 59 Jahren. Die Knochendichte wurde an bis zu fünf Stellen bzw. Knochen gemessen: Lendenwirbelsäule, Oberschenkelhalsknochen, am Schenkelring, am Unterarm und am gesamten Körper.
Die Ergebnisse:
• Es gab sechs Studien, in denen es bei der Dichte eine signifikante Erhöhung gab, vier Studien zeigten lediglich bei einem einzigen Knochen eine höhere Knochendichte, zwei Funde zeigten eine signifikante Verschlechterung und die restlichen 11 Studien fanden keinerlei signifikanten Nutzen der Vitamineinnahme für die Knochendichte. Nur eine Studie fand Verbesserungen der Knochendichte bei mehr als einem der untersuchten Knochen(orte).
• Bei der Meta-Analyse ergab sich lediglich für die Dichte des Oberschenkelhalsknochens ein kleiner Nutzen der Vitamineinnahme. Die für diese Analyse einbezogenen Studien waren aber sehr heterogen, was zur Vorsicht bei der Verallgemeinerung des Ergebnisses führen sollte. Umso verwunderlicher ist es trotzdem, dass bei den unmittelbar benachbarten Hüftknochen keinerlei Veränderungen ihrer Dichte gefunden werden konnten.
Die ForscherInnen kommen daher zu dem Ergebnis, dass ihr systematischer Review "provides very little evidence of an overall benefit of vitamin D supplementation on bone density". Kleine Verbesserungen bei einzelnen Knochen seien gegen mögliche unerwünschte Effekte abzuwägen. Und außerdem sei die "number of positive results ... little better than what would have been expected by chance." Auf die teure Messung der Knochendichte und der generellen Einnahme von Vitamin D könne verzichtet werden, außer bei der kleinen Gruppe von erkennbar besonders gefährdeten Personen. Bevölkerungsbezogene Messungen des Vitamin-D-Spiegels in den USA hätten schließlich gezeigt, dass "most adults ... do not need supplementation."
Dass dies die Hersteller und Verkäufer von Vitamin D-Präparaten anders sehen, ihnen dies auch nicht untersagt ist und sie damit auch enorme Verkaufserfolge erzielen, ist ein Beispiel dafür, dass bei allen Produkten, die eine Gesundheitswirkung behaupten oder mit ihr werben, die Hersteller dazu gesetzlich verpflichtet werden müssen, diesen Nutzen und/oder die Schädigungsfreiheit durch unabhängige Studien nachzuweisen. Gelingt ihnen dies nicht, sollten sie in keiner Weise mehr mit der hoch angesehenen und verkaufsfördernden Gesundheitswirkung werben dürfen.
Der Aufsatz Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis. von Ian Reid et al. ist am 11. Oktober 2013 in der Zeitschrift "Lancet" "early online" veröffentlicht worden. Sein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.10.13
USA: Interregionale Unterschiede beim Zuviel und Zuwenig von Arzneiverordnungen mit der Kumulation nachteiliger Verordnungsmuster
 Die Altmeister der "small area variation"-Forschung vom Dartmouth Atlas Projekt der gleichnamigen US-Universität veröffentlichen immer noch regelmäßig Reports, welche die regionale Ungleichverteilung wichtiger Gesundheitsleistungen insbesondere unter den Versicherten der staatlichen Krankenversicherung Medicare für Rentner und bestimmte arme Personen. Diese Forschungsarbeiten wirkten weltweit ansteckend und ihre Kernhypothese und Methodik liegen mittlerweile in Deutschland z.B. den Arbeiten in der von der Bertelsmann Stiftung gegründeten und gesponsorten Berichtsreihe "Faktencheck" zugrunde.
Die Altmeister der "small area variation"-Forschung vom Dartmouth Atlas Projekt der gleichnamigen US-Universität veröffentlichen immer noch regelmäßig Reports, welche die regionale Ungleichverteilung wichtiger Gesundheitsleistungen insbesondere unter den Versicherten der staatlichen Krankenversicherung Medicare für Rentner und bestimmte arme Personen. Diese Forschungsarbeiten wirkten weltweit ansteckend und ihre Kernhypothese und Methodik liegen mittlerweile in Deutschland z.B. den Arbeiten in der von der Bertelsmann Stiftung gegründeten und gesponsorten Berichtsreihe "Faktencheck" zugrunde.
Der aktuellste, am 15. Oktober 2013 veröffentlichte Report des Dartmouth Atlas Project untersucht die regionalen Variationen der Verordnung von Arzneimitteln. Der Report stellt zum ersten fest, dass viele Medicare-Versicherte Medikamente, die bei ihrer Behandlung wirksam wären, nicht erhalten und gleichzeitig eine andere Gruppe von Versicherten Arzneimittel verordnet bekommen, die bekannterweise hohe Nebenwirkungsrisiken haben und nicht notwendigerweise wirksam sind. Zum zweiten stellt der Report fest, dass beide Verordnungsmuster je nach Region sehr unterschiedlich sind und dabei auch Konstellationen bzw. Risikokumulationen von zu geringer Verordnung wirksamer Arzneimittel und zu häufiger Verordnung von riskanten Arzneimitteln auftreten.
Die Spannbreiten bei Medikamenten, die sehr spezifisch eingesetzt werden sollten und für deren Zweck es auch Alternativen gibt, zeigt sich bei Protonenpumpenhemmern, die u.a. bei nicht selten schmerzmittelbedingtem Sodbrennen und Geschwüren im Verdauungstrakt angezeigt sind. Der Prozentsatz der Patienten, denen diese Arzneimittel verordnet wurden schwankte zwischen 15,8% in Grand Junction, Colorado und 45,5% in Miami.
Die tatsächlichen Gründe für diese Unterschiede sind den ForscherInnen unbekannt. Es handle sich um "the million dollar question". Sie schließen nach ihrer Analyse allerdings einen bestimmenden Einfluss von unterschiedlichen Einkommen und unterschiedlichen Gesundheitzuständen aus. Obwohl die Mehrheit der Verordnungen ambulant erfolgt, weisen sie für das Krankenhaus auf die Bedeutung einer guten Vorbereitung auf die nachstationäre Verordnung von Medikamenten und deren Einnahme im Rahmen des Entlassungsmanagements hin. Beispielsweise ende die Therapietreue von stationär behandelten Herz-/Kreislaufpatienten bei der Einnahme von gesundheitlich notwendigen Betablockern häufig ohne gezielte Vorbereitung und Aufklärung bereits sechs Monate nach der Entlassung, obwohl bis zu drei Jahre für die erwünschte Wirkung notwendig wären.
Die Studie schließt mit einer knappen Darstellung der Bedeutung ihrer Ergebnisse für die Gesundheitspolitik. Dabei betonen die in solchen Analysen ja bereits seit Jahren erfahrenen ForscherInnen, der kritische Blick sollte nicht nur auf die mangelhaften Zustände in vielen Regionen, sondern auch auf die positiven Regionen gerichtet werden. Es ginge vielleicht sogar vorrangig darum "successful regions that provide effective care efficiently" genauer zu betrachten und dabei "determine what factors lead to this success, and disseminate these systems more broadly."
Der Report The Dartmouth Atlas of Medicare Prescription Drug Use von Jeffrey C. Munson, David C. Goodman, Luca F. Valle und John E. Wennberg ist 59 Seiten lang, enthält interessante Grafiken und Verteilungsdarstellungen und komplett kostenlos erhältlich.
Das jüngste Beispiel der deutschen Variante der "small area variation"-Berichterstattung ist der im Oktober 2013 erschienene Faktencheck Gesundheit: Knieoperationen (Endoprothetik) - Regionale Unterschiede und ihre Einflussfaktoren Zusammenfassung einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, basierend auf Daten der AOK von Chr. Lühring et al.
Zwei herausragende und gesundheitspolitisch brisante Ergebnisse lauten:
• "Bei Kniegelenkersatz-Operationen, Folgeoperationen und Arthroskopien gibt es z. T. erhebliche regionale Unterschiede: Auf der Ebene der Bundesländer unterscheidet sich die Rate der Kniegelenkersatz-Operationen um das 1,8-Fache, auf der Ebene der Kreise um das Dreifache, bezogen nur auf Männer sogar um das Vierfache. Bei der Häufigkeit von Folgeoperationen gibt es Unterschiede bis zum Fünffachen, bei Arthroskopien bis zum 65-Fachen.
• Patienten im Südosten Deutschlands erhalten im Verhältnis fast doppelt so häufig ein neues Kniegelenk wie Patienten im Nordosten."
Was diese gleichzeitige Über- und Unterversorgung innerhalb weniger hundert Kilometer bewirkt und was daran verändert werden kann, wissen aber auch die deutschen ExpertInnen nicht.
Bernard Braun, 23.10.13
USA: Über 80% aller Antibiotika-Verordnungen bei Halsentzündungen sind nicht notwendig und zu viele Breitband-Antibiotika
 Um verstehen zu können warum Antibiotika bei vielen Krankheiten nicht helfen aber trotzdem durch Resistenzbildungen schädliche Auswirkungen haben können und man bei bestimmten Erkrankungen lieber Penicillin statt Breitband-Antibiotika verordnet und einnimmt, braucht man keine komplexen Risikoraten rechnen oder Dreisatzaufgaben bewältigen. Es reichen regelmäßige Blicke in die medizinische und pharmakologische Fachliteratur, gute Tageszeitungen oder TV-Magazine in denen seit Jahren vor der herrschenden Verordnungs- und Behandlungspraxis bei Antibiotika mit immer drastischeren Eckzahlen gewarnt wird.
Um verstehen zu können warum Antibiotika bei vielen Krankheiten nicht helfen aber trotzdem durch Resistenzbildungen schädliche Auswirkungen haben können und man bei bestimmten Erkrankungen lieber Penicillin statt Breitband-Antibiotika verordnet und einnimmt, braucht man keine komplexen Risikoraten rechnen oder Dreisatzaufgaben bewältigen. Es reichen regelmäßige Blicke in die medizinische und pharmakologische Fachliteratur, gute Tageszeitungen oder TV-Magazine in denen seit Jahren vor der herrschenden Verordnungs- und Behandlungspraxis bei Antibiotika mit immer drastischeren Eckzahlen gewarnt wird.
Trotzdem scheinen diese Informationen und Szenarien nicht bei verordneten Ärzten und ihren PatientInnen anzukommen - in den USA. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer Analyse der Verordnung von Antibiotika bei banalen Halsentzündungen ("sore throat") in den Jahren 1997 bis 2010, über die am 3. Oktober 2013 in einem "Research letter" in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" berichtet wird.
Für die weitere Bewertung sind zwei gesicherte Erkenntnisse wichtig: Erstens werden lediglich rund 10% aller Halsentzündungen durch einen mit Antibiotika überhaupt behandelbaren Erreger verursacht. Dieser Erreger ist zweitens am besten mit dem "schmalen" und preisgünstigen Antibiotika-Klassiker Penicillin behandelbar und braucht nicht den Einsatz eines wesentlich teureren Breitband-Antibiotikums.
Wie sich die Verschreibungshäufigkeiten von Ende der 1980er Jahre bis 1993, 1998 und zuletzt 2010 verändert haben, wie also der Public Health-Diskurs zu den Antibiotika bei Ärzten und PatientInnen angekommen ist, untersuchten zwei Gesundheitswissenschaftler mit Daten aus zwei repräsentativen Surveys zur ambulanten Versorgung in den USA.
Dabei kam mehrerlei heraus:
• Der Anteil der Besuche bei Allgemeinärzten wegen einer Halsentzündung sank von 1997 bis 2010 signifikant von 7,5% auf 4,3%. Der Anteil von Halsentzündungen an sämtlichen Besuchen einer stationären Notfallstation bewegte sich zwischen 2,2% und 2,3%.
• Bis 1993 sank die Rate der PatientInnen, die einen niedergelassenen Arzt mit einer Halsentzündung konsultierten und von ihm Antibiotika verordnet bekamen, von rund 80% auf 70%. Im Jahr 2000 war die Rate noch einmal auf 60% gefallen - also gemessen an der versorgungsepidemiologischen Notwendigkeit von rund 10% immer noch auf ein völlig unangemessenes Niveau.
• Trotz verstärkter Aufklärungsbemühungen über den nicht notwendigen Antibiotika-Einsatz betrug die Rate 2010 aber immer noch 60%.
• 2010 wurde die von Leitlinien unentwegt empfohlene Verordnung von Penicillin mit stabiler Tendenz während 9% der Arztbesuche wegen einer Halsentzündung verordnet, ein Breitband-Antibiotikum dagegen mit steigender Tendenz während 15% der Besuche.
• Allein die nicht notwendige Verordnung von Antibiotika kostete zwischen 1997 und 2010 konservativ geschätzt 500 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen noch erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit den unerwünschten Wirkungen der Antibiotika-Einnahme.
Offensichtlich kann die enorme Resistenz gegen allgemeine wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Aufklärung bei Ärzten selbst nach jahrelange Bemühungen nicht beseitigt werden. Die bereits in Modellversuchen getestete direkte und datengestützte Information der einzelnen Ärzte über ihre Antibiotika-Verordnungspraxis könnte u.U. wirklich die einzige Methode sein, an ihrer gesundheitlich problematischen Praxis etwas zu ändern. Das Problem ist nur, dass kein Arzt verpflichtet werden kann, diese Information zu erhalten und auch umzusetzen.
Der Forschungsbrief Antibiotic Prescribing to Adults With Sore Throat in the United States, 1997-2010 von Michael L. Barnett und Jeffrey A. Linder ist in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" zuerst online erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.10.13
Holpriger "Königsweg": Öffentliche Informationskampagnen gegen unnötigen Antibiotika-Einsatz haben gemischte Wirkungen
 Die Einsicht, dass die bisherige Verordnungshäufigkeit von Antibiotika bei vielen Infektionserkrankungen nicht sinnvoll ist und bei anderen Erkrankungen besser mit einer so genannten "watchful waiting"- oder "wait and see"-Behandlung begonnen werden sollte, verbreitet sich zwar immer mehr, verändert die Verordnungspraxis aber bisher relativ wenig. Deshalb stellt sich die Frage, wie man die vorhandene Evidenz und Notwendigkeit für einen wesentlich zurückhaltenderen Einsatz von Antibiotika noch weiter verbreitet.
Die Einsicht, dass die bisherige Verordnungshäufigkeit von Antibiotika bei vielen Infektionserkrankungen nicht sinnvoll ist und bei anderen Erkrankungen besser mit einer so genannten "watchful waiting"- oder "wait and see"-Behandlung begonnen werden sollte, verbreitet sich zwar immer mehr, verändert die Verordnungspraxis aber bisher relativ wenig. Deshalb stellt sich die Frage, wie man die vorhandene Evidenz und Notwendigkeit für einen wesentlich zurückhaltenderen Einsatz von Antibiotika noch weiter verbreitet.
Dass gesetzliche Verbote nicht der Königsweg sind, zeigt im Moment der zähe Versuch den nahezu flächendeckenden Einsatz von Antibiotika in der Tiermast in Deutschland zu regulieren. Umso interessanter sind daher auch Versuche, das Ziel über breite und facettenreiche Informationskampagnen auf lokaler oder regionaler Ebene zu erreichen.
Die Ergebnisse einer nicht-randomisierten aber kontrollierten Informationskampagne, die von November 2011 bis Februar 2012 in den Provinzen Modena und Parma in der norditalienischen Region Emilia Romagna durchgeführt wurde, liefern jetzt die aktuellsten Erkenntnisse über die Machbarkeit und Wirksamkeit solcher Interventionen.
Die Information über die unerwünschten Effekte unnötiger Verordnungen von Antibiotika wurde vor allem über Poster, Broschüren, Anzeigen in örtlichen Medien und einen Newsletter zur örtlichen Resistenzsituation speziell für Ärzte und Apotheker verbreitet und war relativ kostengünstig. Bei der Gestaltung der Botschaften der Kampagne waren die örtlichen Allgemein- und Kinderärzte beteiligt.
Die messbaren Effekte der Kampagne sahen folgendermaßen aus:
• Die Verordnungsrate in der Interventionsprovinz war gegenüber der in der Kontrollprovinz statistisch signifikant um 4,3% gesenkt worden.
• Die Verordnungshäufigkeit unterschied sich je nach der Sorte des Antibiotikums deutlich und folgte dabei zum Teil den Empfehlungen im Informationsmaterial für Ärzte und andere Behandlungsexperten.
• Die beabsichtigte Senkung der Ausgaben für Antibiotika variierte je nach Beobachtungszeitraum zwischen signifikanten und nicht-signifikanten Effekten.
• Das Wissen und die Einstellungen der angesprochenen Bevölkerung über und gegenüber dem korrekten Gebrauch von Antibiotika unterschieden sich zwischen Interventions- und Kontrollgebieten weder vor noch nach der Studiendurchführung nennenswert. Interessant ist, dass das in der Befragung zu Beginn der Studie erhobene Wissen beider Gruppen in teilweise hohem Maße mit den Botschaften der Informationskampagne übereinstimmte, aber offensichtlich keine richtige Wirkung auf die Verordnung und den Einsatz von Antibiotika hatte.
• Beim Wissen und den Einstellungen gibt es mit einer paradoxen Ausnahme keine wesentlichen Verbesserungen nach Beendigung der fünf Monate langen Kampagnenzeit. Paradox ist die signifikante Zunahme falscher Annahmen über den Nutzen von Antibiotika bei Virusinfektionen: Dem Statement "Antibiotika sind gegen Viren wirksam" stimmten vor der Kampagne 47% der Bewohner der Interventionsprovinz und 59% der Kontrollprovinz. Fünf Monate später taten dies 62% und 67%.
Die WissenschaftlerInnen haben zum einen die relativ kostengünstige Machbarkeit einer solchen facettenreichen Aufklärungskampagne nachgewiesen und haben kurzfristige Veränderungen der Verordnungshäufigkeit erzielt. Sie weisen besonders auf die Schwierigkeiten der Bewertung positiver Effekte hin.
Ob sich die positiven Effekte ohne weitere Inputs halten, ist angesichts der geringen Veränderungen beim Wissen und den Einstellungen und sogar einer markanten Verschlechterung, im Bereich des Möglichen. Auch solche Kampagnen sind offensichtlich nicht der ohne Einschränkungen begehbare Königsweg.
Der Aufsatz Feasibility and effectiveness of a low cost campaign on antibiotic prescribing in Italy: Community level, controlled, non-randomised trial. von Formoso G et al. ist ein komplett kostenloser Open Access-Beitrag im "British Medical Journal (BMJ)", der vorab am 12. September 2013 elektronisch veröffentlicht wurde.
Bernard Braun, 24.9.13
Rosarote Brille - Gefahr für Patienten. Interessenkonflikte bei Autoren von Leitlinien
 Interessenkonflikte beeinträchtigen das Urteilsvermögen und bringen die Menschen dazu, Dinge so zu sehen, wie sie nicht sind. Was im Alltag bisweilen ein Teil von Lebenskunst darstellt, kann in der Medizin zu einer ernsten Gefahr für Patienten werden. Interessenkonflikte lassen Personen den Nutzen einer Technologie, z.B. eines Arzneimittels, höher erscheinen und den Schaden niedriger als Personen ohne Interessenkonflikt. Gegebene Studiendaten bewerten sie optimistisch, Gefahren und Risiken ignorieren sie. Dem liegt zumeist keine böse Absicht vor, vielmehr laufen die entsprechenden kognitive Vorgänge unbewusst ab. Am Beispiel des Diabetesmittels Avandia (Rosiglitazon) haben wir dieses Phänomen bereits im Forum dargelegt (Link).
Interessenkonflikte beeinträchtigen das Urteilsvermögen und bringen die Menschen dazu, Dinge so zu sehen, wie sie nicht sind. Was im Alltag bisweilen ein Teil von Lebenskunst darstellt, kann in der Medizin zu einer ernsten Gefahr für Patienten werden. Interessenkonflikte lassen Personen den Nutzen einer Technologie, z.B. eines Arzneimittels, höher erscheinen und den Schaden niedriger als Personen ohne Interessenkonflikt. Gegebene Studiendaten bewerten sie optimistisch, Gefahren und Risiken ignorieren sie. Dem liegt zumeist keine böse Absicht vor, vielmehr laufen die entsprechenden kognitive Vorgänge unbewusst ab. Am Beispiel des Diabetesmittels Avandia (Rosiglitazon) haben wir dieses Phänomen bereits im Forum dargelegt (Link).
Über einen neuen Fall berichten jetzt Autoren, die aus dem Kreis der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft stammen. Die im Deutschen Ärzteblatt erschienene Studie "Besteht ein Einfluss pharmazeutischer Unternehmen auf Leitlinien? Zwei Beispiele aus Deutschland" wurde von der Förderinitiative Versorgungsforschung der Bundesärztekammer unterstützt.
Untersucht wurde die Bewertung des Medikaments Raptiva (Substanz: Efalizumab), das gegen eine bestimmte Form der Schuppenflechte (Psoriasis) eingesetzt wurde, in 2 Leitlinien, eine erstellt von Autoren mit und eine von Autoren ohne Interessenkonflikte.
• Die S3-Leitlinie (Version 2006) der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) wurde von einer 15-köpfigen Gruppe verfasst, in der 10 Mitglieder finanzielle Verbindungen zur Firma Serono hatten, dem Lizenzinhaber von Raptiva. Darüber hinaus wurde die Arbeit der Leitlinien-Gruppe von einer Stiftung gefördert wurde, die u.a. von Serono unterstützt wurde.
• Ohne Interessenkonflikte war hingegen die Arbeitsgruppe, welche die Leitlinie für das englische National Institute of Health and Care Excellence (NICE) verfasste.
Die Unterschiede in der Bewertung kritischer Sachverhalte zeigen die Autoren durch den Vergleich der Formulierungen zu identischen Sachverhalten auf.
Dazu 3 Beispiele aus der Studie:
• Die NICE-Leitlinie sieht die Indikation für Efalizumab nur dann gegeben, wenn eine andere Substanz, Etanercept, unwirksam ist bzw. nicht gegeben werden darf. In der S3-Leitlinie wird Efalizumab hingegen bei mittelschwerer und schwerer Form der Psoriasis zur Ersttherapie empfohlen. Zugelassen war es aber nur für Patienten, bei denen alle Standardtherapien versagt haben.
• In die NICE-Leitlinie wurden 5 randomisierte kontrollierte Studien einbezogen, von denen 4 wegen mangelnder Darstellung als in ihrer Qualität nicht beurteilbar bewertet wurden. Die S3-Leitlinie stützt sich auf 6 Studien, das Evidenzniveau bezeichnen die Autoren als insgesamt sehr gut. Eine Studie wird als vergleichende Studie klassifiziert, obwohl sie das nicht ist.
• Zur Frage der Kombination mit anderen Arzneimitteln rät das NICE ab, weil keine Studien dazu vorliegen. Die Autoren der S3-Leitlinie stellen ebenfalls fest, dass keine kontrollierten Studien zu dieser Frage vorliegen, stellen dann aber im Folgesatz unvermittelt fest: "Eine Kombination (...) erscheint möglich und sinnvoll."
An anderer Stelle lassen sich die S3-Leitlinie-Autoren zu der Aussage hinreißen: "Efalizumab besitzt aus heutiger Sicht ein günstiges Sicherheitsprofil." Die NICE-Autoren urteilen hier sehr viel zurückhaltender und weisen auf die Unsicherheit der Datenlage hin.
Die Beispiele zeigen, dass die Autorengruppe mit Interessenkonflikten das Medikament wie durch eine rosarote Brille betrachten, hinter der Unsicherheiten und Probleme verschwinden. Raptiva ist ein - weiteres - Beispiel dafür, dass dies für Patienten tödlich ausgehen kann: Das immunsuppressiv wirkende Raptiva wurde im Februar 2009 wegen einiger Fälle von schweren, teils tödlichen endenden Infektionen vom Markt genommen (Link zur Information des Herstellers).
Das Fallbeispiel Raptiva ist auch ein weiterer Beleg dafür, dass Leitlinien vom Einfluss der Industrie durch eine undurchlässige Wand geschützt werden müssen.
Ein zweiter Aspekt der Studie - der hier nicht näher ausgeführt werden soll - ist der an der Substanz Gabapentin geführte Nachweis, dass Daten, die von einem pharmazeutischen Unternehmen betrügerisch manipuliert wurden, Eingang in S3-Leitlinie gefunden haben.
Schott G, Dünnweber C, Mühlbauer B, Niebling W, Pachl H, Ludwig W-D. Besteht ein Einfluss pharmazeutischer Unternehmen auf Leitlinien? Zwei Beispiele aus Deutschland. Deutsches Ärzteblatt 2013;110:575-583 Link
Deutsche Gesellschaft für Dermatologie. S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris.
Version 2006: Nast A, Kopp IB, Augustin M, et al.: S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris. J Dtsch Dermatol Ges 2006; 4 Suppl 2, 1-126 Link zum kostenpflichtigen Download
National Institute of Health and Care Excellence (NICE). Bewertung von Raptiva im Juli 2006. Link
Wang AT, McCoy CP, Murad MH, Montori VM. Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review.
Link BMJ 2010;340:c1344
Link Forum Gesundheitspolit
David Klemperer, 8.9.13
USA: Antibiotika ohne gesundheitlichen Nutzen und Breitband-Antibiotika werden anhaltend zu oft verordnet.
 Sowohl die Verordnung von Antibiotika bei offensichtlich damit nicht behandlungsfähigen Erkrankungen (z.B. Virusinfektionen) als auch die Verordnung von Breitband-Antibiotika an Stelle von Antibiotika mit schmalerem oder spezifischerem Wirkungsspektrum, werden seit Jahren kritisch diskutiert. Die dabei vor allem angesprochenen unerwünschten und gefährlichen Effekte stellen die damit verbundenen Resistenzbildungen bei immer mehr bakteriellen Erregern sowie die Kosten dar.
Sowohl die Verordnung von Antibiotika bei offensichtlich damit nicht behandlungsfähigen Erkrankungen (z.B. Virusinfektionen) als auch die Verordnung von Breitband-Antibiotika an Stelle von Antibiotika mit schmalerem oder spezifischerem Wirkungsspektrum, werden seit Jahren kritisch diskutiert. Die dabei vor allem angesprochenen unerwünschten und gefährlichen Effekte stellen die damit verbundenen Resistenzbildungen bei immer mehr bakteriellen Erregern sowie die Kosten dar.
Wie die Verordnungsweise Über mehrere Jahre hinweg aussieht, ob also die Kritik nachweisbare positive Spuren hinterlässt, hat jetzt ein Team us-amerikanischer Spezialisten für die Behandlung von Infektionserkrankungen für die Jahre 2007 bis 2009 in den USA untersucht. Sie nutzten dazu Daten des "National Ambulatory Medical Care Survey" und des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey", repräsentative Datensammlungen zu den Behandlungsvisiten von 238.624 erwachsenen PatientInnen in normalen stationären und ambulanten ärztlichen Sprechstunden und Notfallambulanzen.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• Antibiotika wurden jährlich am Ende von 101 Millionen ambulanten Arztbesuchen, d.h. nach rund 10% aller Arztbesuche verordnet.
• Die jährliche Rate der Antibiotika-Verordnungen veränderte sich in dem dreijährigen Untersuchungszeitraum nicht.
• 41% aller Antibiotika-Verordnungen erfolgten wegen einer Erkrankung der oberen Atemwege, 19% bei Hautinfektionen/Akne und 8% bei Infektionen der Harnwege.
• 61% aller Antibiotika-Verordnungen waren Breitband-Antibiotika.
• Rund 21% aller Behandlungskontakte in Notfallambulanzen endeten in einer Antibiotika-Verordnung. In normalen stationären Arzt-Patientkontakten betrug dieser Anteil nur 9% und in ambulanten Settings 11%. Diese Unterschiede waren statistisch hochsignifikant.
• Insgesamt waren 28% aller Antibiotika-Verordnungen wahrscheinlich unnötig, erfolgten also z.B. bei Erkrankungen gegen die sie wirkungslos waren. Dies trifft u.a. für 68% aller Verordnungen gegen Atemwegsinfektionen zu.
• Der Anteil nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen war in Notfallambulanzen am höchsten und in Kliniksprechstunden für ambulante Patienten am niedrigsten.
• Der Anteil der verordneten Breitband-Antibiotika war u.a. bei vorhandener Komorbidität, bei älteren PatientInnen und privat Krankenversicherten signifikant überdurchschnittlich.
Von der elektronischen Vorveröffentlichung der Studie Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007-09 von Shapiro DJ et al. am 25. Juli 2013 in der britischen Fachzeitschrift "Journal of Antimicrobial Chemotherapy" gibt es ein kostenloses Abstract.
Bernard Braun, 5.9.13
Wie kommt es zu mangelnder Therapietreue? Ergebnisse einer qualitativen Studie mit an rheumatoider Arthritis erkrankten Menschen
 Zu einer der langlebigsten Erklärungen oder Schuldzuweisungen durch Ärzte aber auch Krankenkassenvertreter, warum eine Krankenbehandlung nicht das gewünschte Ergebnis hat oder wodurch unnötig Kosten verursacht werden, gehört die Non-Compliance oder -Adherence bzw. die Therapieuntreue der Patienten. Wer nachdenkt statt Schuld zuzuweisen, stellt fest, dass zumindest ein Teil der "untreuen" oder "ungehorsamen" Patienten nicht aus Jux und Tollerei z.B. verordnete Medikamente gar nicht oder in einer anderen Dosierung einnimmt als es ihnen der Arzt oder Apotheker oder der Beipacktext möglicherweise gesagt hat und dabei u.a. gesundheitlich unerwünschte Folgen riskiert. Und auch die sporadisch transparent werdenden Medikamentenlager in den Badezimmerschränkchen mancher Menschen, entstehen nicht (allein) wegen der Sammelwut von Patienten.
Zu einer der langlebigsten Erklärungen oder Schuldzuweisungen durch Ärzte aber auch Krankenkassenvertreter, warum eine Krankenbehandlung nicht das gewünschte Ergebnis hat oder wodurch unnötig Kosten verursacht werden, gehört die Non-Compliance oder -Adherence bzw. die Therapieuntreue der Patienten. Wer nachdenkt statt Schuld zuzuweisen, stellt fest, dass zumindest ein Teil der "untreuen" oder "ungehorsamen" Patienten nicht aus Jux und Tollerei z.B. verordnete Medikamente gar nicht oder in einer anderen Dosierung einnimmt als es ihnen der Arzt oder Apotheker oder der Beipacktext möglicherweise gesagt hat und dabei u.a. gesundheitlich unerwünschte Folgen riskiert. Und auch die sporadisch transparent werdenden Medikamentenlager in den Badezimmerschränkchen mancher Menschen, entstehen nicht (allein) wegen der Sammelwut von Patienten.
Eine gerade veröffentlichte Studie von GesundheitswissenschaftlerInnen aus Bremen, Hannover und Kiel untersuchte jetzt diese Gründe für und mit PatientInnen, die langjährig unter behandlungsbedürftiger rheumatoider Arthritis litten. Die AutorInnen zeigen auf dem Boden leitfadengestützter Interviews mit 29 aus 900 bzw. 103 ausgewählten und interviewbereiten PatientInnen, dass es nicht weiterführt, von fehlender Compliance zu sprechen, wenn die Betroffenen verordnete Medikamente überhaupt oder vorübergehend nicht einnehmen. Diese chronisch Kranken sind trotz gelegentlicher "Noncompliance" außerordentlich an guter Medizin interessiert. Der häufige krankheitsbedingte Wechsel der Medikamente, das Verurteiltsein zu dauerhafter Medikation samt teils deutlicher Nebenwirkungen und häufig unzureichende Kommunikation ihrer ÄrztInnen sind wichtige Ursachen für die so genannte Noncompliance. Während die sozialwissenschaftliche Literatur dies seit gut 25 Jahren ergiebig thematisiert hat, wird im medizinischen Diskurs allen Bemühungen um "Modernisierung" des Compliance-Diskurses am Konzept der Folgsamkeit festgehalten. Eine Idee, die ohnehin nur dann gut wäre, wenn die verordneten Medikamente tatsächlich immer evidenzbasiert wären. Die Studie plädiert dafür, die Unterstützung für chronisch Kranke bei der Bewältigung ihrer langstreckigen Krankheitskarrieren zu verbessern statt ihnen de facto immer wieder mit Vorwürfen zu begegnen.
Was in einem modernen, d.h. nicht schuldzuweiserischen Compliance-Dialog zwischen Arzt und Patient zu beachten und zu erreichen ist, wird in der 26 Seiten umfassenden Studie durch ausführliche Zitate aus den Interviews anschaulich verdeutlicht.
Im Anhang findet sich der Frageleitfaden für die qualitativen Interviews, einige Hinweise zur Kodierung der transkribierten Interviews, eine Auflistung der Vielzahl erkrankungsspezifischer Medikamente und ein umfangreiches Literaturverzeichnis.
Die Studie Noncompliance: A Never-Ending Story. Understanding the Perspective of Patients with Rheumatoid Arthritis von Maren Stamer, Norbert Schmacke und Petra Richter erscheint im September 2013 im "Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research" (14 [3], Art. 7) und kann komplett kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 11.8.13
Selten teure "rauchende Colts": Fast 500 Millionen US-$ Strafe für vorsätzlich gesetzwidrige Vermarktung eines Medikaments
 Weil die kritische Auseinandersetzung mit Vermarktungsstrategien der Arzneimittelhersteller, die Gewinnziele vor Patienteninteressen stellen, oft keine eindeutigen Belege findet, verdienen die wenigen klaren Fälle umso mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Weil die kritische Auseinandersetzung mit Vermarktungsstrategien der Arzneimittelhersteller, die Gewinnziele vor Patienteninteressen stellen, oft keine eindeutigen Belege findet, verdienen die wenigen klaren Fälle umso mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Dies gilt auch für die am 30 Juli 2013 öffentlich abgeschlossene Auseinandersetzung zwischen dem bis 2009 selbstständigen und dann vom Branchenführer Pfizer gekauften Pharmaunternehmen Wyeth und der in den USA für die Zulassung von Arzneimitteln zuständigen US-Food and Drug Administration (FDA) bzw. dem US-Justizministerium. Das Unternehmen akzeptiert damit, für die mit Vorsatz und mit enormem Aufwand betriebene ungesetzliche Vermarktung seines Medikaments Rapamune eine Strafe von 490,9 Millionen US-Dollar bezahlen zu müssen.
Das Medikament sollte Abstoßreaktionen des körpereigenen Immunsystems gegen ein implantiertes Organ verhindern. 1999 erhielt die Firma nach entsprechenden Vorstudien und Prüfungen durch die FDA die Zulassung - allein und ausdrücklich für den Einsatz bei Patienten mit einer Nierentransplantation. Die Firma hinderte dies nicht daran, fast unmittelbar nach dieser Zulassung ihre Pharmareferenten mit Vertriebsmaterialien auszustatten, in denen das Medikament ohne Nutzenbelege und vor allem ohne FDA-Zulassung auch für Patienten empfohlen wurde, die ein anderes Organ implantiert bekommen hatten. Um Ärzte zu diesem so genannten "off label"-Einsatz überreden zu können, trainierte die Firma ihre Referenten speziell und offerierte ihnen für den Erfolgsfall auch spezielle finanzielle Anreize bzw. Bonusse. Die staatlichen Aufseher und Ermittler sahen darin nicht nur ein Verhalten, das den Firmengewinn "ahead of the health and safety of a highly vulnerable patient population dependent on life-sustaining therapy" stellte, sondern einen von 1998 bis 2009 reichenden fortgesetzten Verstoß gegen den "False Claims Act".
Weitere Einzelheiten können in der vom US-Justizministerium erstellten Presseerklärung Wyeth Pharmaceuticals agrees to pay $490,9 million for marketing the prescription drug Rapamune for unapproved uses" nachgelesen werden.
Bernard Braun, 9.8.13
Finger weg von Makrolidantibiotika bei Herzkranken
 Antibiotika vom Typ der Makrolide erfreuen sich wegen Ihrer einfachen Anwendung und eher leichten unerwünschten Arzneimittelwirkungen insbesondere im ambulanten Bereich seit Jahren größter Beliebtheit bei der Behandlung von Atemwegs- und anderen Infektionen. Nach dem Arzneimittelverordnungs-Report 2012 gehören Makrolide in Deutschland mit 56,7 Mio. verordneten Tagesdosen zu dem am häufigsten verordneten Antibiotika (nach Amino-Penicillinen, Cephalosporinen und Tetrazyklinen (59,1 Mio.)). Die breite massenhafte Anwendung von Makrolidantibiotika nicht nur in Deutschland lässt auch seltene unerwünschte Wirkungen zu Tage treten, die vor allem für die Verordnungspraxis und therapeutische Verwendung von großer Bedeutung sind.
Antibiotika vom Typ der Makrolide erfreuen sich wegen Ihrer einfachen Anwendung und eher leichten unerwünschten Arzneimittelwirkungen insbesondere im ambulanten Bereich seit Jahren größter Beliebtheit bei der Behandlung von Atemwegs- und anderen Infektionen. Nach dem Arzneimittelverordnungs-Report 2012 gehören Makrolide in Deutschland mit 56,7 Mio. verordneten Tagesdosen zu dem am häufigsten verordneten Antibiotika (nach Amino-Penicillinen, Cephalosporinen und Tetrazyklinen (59,1 Mio.)). Die breite massenhafte Anwendung von Makrolidantibiotika nicht nur in Deutschland lässt auch seltene unerwünschte Wirkungen zu Tage treten, die vor allem für die Verordnungspraxis und therapeutische Verwendung von großer Bedeutung sind.
Lange Zeit galten Antibiotika und insbesondere Makrolide auch als Ansatz zur medizinischen Prävention oder sogar Behandlung der koronaren Herzkrankheit (KHK). Bereits Ende der 1980er Jahre war zunächst in Finnland aufgefallen, dass Patienten mit KHK häufiger als bei Vergleichspersonen einen positiven Titer von Antikörpern gegen Chlamydia pneumoniae aufwiesen. Mit ihrem Artikel Serological Evidence of an Association of a Novel Chlamydia, TWAR, with Chronic Coronary Heart Disease and Acute Myokardial Iinfarction, von dem kostenfrei nur das Abstract zur Verfügung steht, erweckte die Helsinkier Forschungsgruppe um Pekka Saikku Hoffnungen, die KHK nicht mehr nur symptomatisch, sondern auch antibiotisch und damit ursächlich behandeln zu können. Später gelang den finnischen Experten auch der Nachweis von Clamydien in atheromatösen Plaques - die 1993 in der Zeitschrift Circulation (87 (4), S: 1130-1134) veröffentlichte Studie von Eila Linnanmäki und Kollegen mit dem Titel Chlamydia pneumoniae-specific circulating immune complexes in patients with chronic coronary heart disease steht allen Interessierten als Volltext zur Verfügung. Da Makrolide gegen Chlamydien wirksam sind, folgten alsbald erste Untersuchungen zur Behandlung der Arteriosklerose mit Azithromycin oder Roxithromycin unter der sich anfangs abzeichnenden Erwartung, unter den behandelten Patienten die Häufigkeit koronarer Ereignisse senken zu können.
Allerdings waren die Fallzahlen waren eher klein, die Befunde waren insgesamt uneinheitlich und blieben folglich umstritten, wie aus einer Übersichtsarbeit der drei Epidemiologen John Danesh, Rory Collins und Richard Peto aus Oxford hervorgeht. Ihre Studie mit dem Titel Chronic infections and coronary heart disease: is there a link? erschien 1997 im Lancet, kostenfrei ist hier für Nicht-Abonenten wiederum nur das Abstract einsehbar. Ihre Zusammenfassung spricht für sich: "The available evidence about chronic infections and CHD is still sparse and its interpretation is limited by potential biases. For H(elicobacter) pylori , residual confounding by causal risk factors may account entirely for the rather weak epidemiological associations that have been reported. For C(hlamydia) pneumoniae, the evidence of association is stronger, but the temporal sequence of infection and CHD is uncertain." Eine deutschsprachige Zusammenfassung der damaligen Studienlage findet sich in dem mittlerweile frei zugänglichen Artikel Behandlung der Koronaren Herzerkrankung mit Antibiotika? aus dem Arzneimittelbrief Nr 31 von 1997 (AMB 1997, 31, 75b).
Einer Reihe größerer kontrollierter Studien zur Wirksamkeit von Makroliden bei KHK bestätigte in der Folgezeit zunehmend die Zweifel an der These einer wirksamen Behandlung von Durchblutungsstörungen des Herzens mit chlamydien-wirksamen Antibiotika. Eine Metaanalyse dieser Untersuchungen kam zu dem Ergebnis, dass Makrolide auf den Verlauf der Erkrankung keinen wesentlichen Einfluss nehmen. Das Journal of the American Medical Association stellt den Beitrag Effects of Antibiotic Therapy on Outcomes of Patients With Coronary Artery Disease: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trialsder New Yorker Kardiologen Richard Andraws, Jeffrey Berger und David Brown kostenfrei als Volltext zum Download bereit.
Spätestens seit 2006 kam zusätzlich zu den Zweifeln an der Wirksamkeit einer antiobiotischen KHK-Behandlung der Verdacht auf, die Gabe von Makroliden an Patienten mit manifester Erkrankung der Herzkranzgefäße könnte sogar deren Sterblichkeit erhöhen. Verschiedene kürzlich erschienen epidemiologische Studien bestätigen nun die Hinweise aus kleineren Studien, dass antibiotische Behandlungen mit Makroliden, insbesondere mit Clarithromycin und Azithromycin, kardiovaskuläre Risikopatienten gefährlichen Komplikationen aussetzen.
Im Rahmen der Randomisierten, placebokontrollierten multizentrischen Studie zur Bewertung einer kurzfristigen Clarithromycin-Gabe bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit berichtete eine Forschergruppe der Universität Kopenhagen über eine signifikant gesteigerte Letalität unter Makrolid-Behandlung. In einem doppeltblinden Ansatz und hatten sie randomisiert insgesamt 4.373 Patienten nach ihrer Entlassung aus stationärer Behandlung wegen akuten Myokardinfarkts oder Koronarsyndroms sowie nach Bypass-Operation zwei Wochen lang entweder mit Clarithromycin (2.172 Personen) oder Placebo (2.201 Patienten) behandelt. Im Anschluss verfolgten sie über drei Jahre personenbezogen den Krankheitsverlauf an Hand des dänischen Krankenhaus- und Sterberegisters. Endpunkte des CLARICOR trial waren Gesamtletalität, Myokardinfarkt oder instabile Angina pectoris sowie Letalität aufgrund von Durchblutungsstörungen des Herzens, Myokardinfarkt oder instabile Angina pectoris. Bei der Häufigkeit dieser beiden Endpunkte zeigten beide Gruppen keinen bedeutsamen Unterschied, aber die kardiovaskuläre Letalität war in der mit Clarithromycin behandelten Gruppe signifikant erhöht (5,1 % vs. 3,5 %; p = 0,01). Dieser Unterschied zeigte sich allerdings nicht kurzfristig, sondern erst ab dem zweiten Jahr. Auf der Homepage der angesehenen Medizinerzeitschrift British Medical Journal (BMJ) steht die CLARICOR-Studie von Christian Jespersen und Kollegen in voller Länge kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Eine bereits im Mai 2012 publizierte Studie aus Nashville in Tennessee hatte ebenfalls einen Zusammenhang zwischen einer Azithromycin-Therapie und der anschließenden kardiovaskulären Sterblichkeit aufgezeigt. Die Auswertung von mehr als 3 Millionen Medicaid-Patienten hatte gezeigt, dass das Risiko, nach 5-tägiger Behandlung mit diesem Makrolid an einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben, mit 85,1 Fällen pro 1 Million zwar insgesamt gering, aber dennoch signifikant höher als in der Kontrollgruppe (29,8 / 1 Million) und im Vergleich zu der mit einem Penicillin behandelten (31,5 / 1 Million). Auch dabei zeigte sich, dass eine Azithromycon-Behandlung vor allem bei Patienten mit vorbestehender KHK das Sterblichkeitsrisiko erhöhte. Die Studie der Nashviller Forscher um Wayne Ray stellt das New England Journal of Medicine allen Interessenten kostenfrei zum Download zur Verfügung: Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death
Im März 2013 publizierte nun das BMJ die Ergebnisse einer Untersuchung über das kardiovaskuläre Risiko einer kurzzeitigen Therapie mit Clarithromycin bei Patienten mit akuter Exazerbation einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung und mit ambulant erworbener Lungenentzündung. Das britisch-australische Forscherteam wertete dafür die Daten zweier prospektiver multizentrischer Beobachtungsstudien mit insgesamt etwa 3.000 Teilnehmern aus, und zwar der Edinburgh-Pneumonie-Kohortenstudie und der EXODUS-Studie (Exacerbations of Obstructive Lung Disease managed in UK Secondary care). Dabei betrachteten Stuart Schembri und seinen Kollegen einen kombinierten Endpunkt aus Krankenhausaufnahme infolge akuten Koronarsyndroms, dekompensierter Herzinsuffizienz, bedrohlichen Rhythmusstörungen oder plötzlichem Herztod im ersten Jahr nach der Akuttherapie. Ein multivariater Vergleich der Patienten der Verum- mit denen der Kontrollgruppe, die ein anderes Antibiotika erhalten hatten, aber hinsichtlich Alter, Geschlecht, Anamnese, Schweregrad ihrer Erkrankung und Begleittherapie den Patienten entsprachen, die eine Makrolid-Therapie erhalten hatten, zeigten sich interessante Befunde.
Bei Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung traten im Verlauf des ersten Jahres insgesamt 268 bedrohliche kardiovaskuläre Ereignisse auf, die unter Clarithromycin signifikant häufiger als in der Kontrollgruppe waren. Ebenso waren akute Koronarereignisse in der Verum-Gruppe häufiger und die kardial bedingte Sterblichkeit höher. Der kombinierte Endpunkt war zwar bei den durchschnittlich jüngeren und gesünderen Pneumonie-Patienten insgesamt seltener, aber auch zeigte sich bei den Clarithromycin-Behandelten eine erhöhte Inzidenz. Das galt nicht nur beim Koronarsyndrom und der kardialen Letalität, sondern eine Subgruppen-Analyse zeigte eine Korrelation zwischen Dauer und Schwere der Herzkrankheit und der Häufigkeit des Auftretens kardiovaskulärer Komplikationen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass das Komplikationsrisiko mit der dem Alter der Patienten und der Dauer der Einnahme von Makroliden steigt.
Im Zuge seiner Open-Access-Politik stellt das BMJ den vollständigen Bericht über die Studie Cardiovascular events after clarithromycin use in lower respiratory tract infections: analysis of two prospective cohort studies zum Download zur Verfügung.
Zu etwas anderen Ergebnissen kommt eine im Mai 2013 ebenfalls im New England Journal of Medicine 368 (18): 1704-1712 publizierte Studie auf Grundlage des umfangreichen dänischen Patientenregisters mit Daten von fast 5 Millionen Bürgern zwischen 18 und 64 Jahren. Die Untersuchung bezog Arzneimittelverordnungen, die kardiovaskuläre Letalität sowie mehr als sechzig Daten zu Diagnostik und Therapie ein und wertete sie retrospektiv unter multivariater Adjustierung aus. Die Kopenhagener Forscher analysierten die Sterblichkeit wegen Durchblutungsstörungen des Herzens während und bis 35 Tage nach Gabe von Azithromycin und verglichen mehr als 1,1 Millionen Behandlungsperioden mit der von gleich vielen Kontrollen ohne antibiotische Therapie sowie 7.364.292 Patienten, die während der 13-jährigen Beobachtungszeit teilweise wiederholt Penicillin eingenommen hatten. Dabei konnten sie nachweisen, dass die kardiovaskuläre Letalität während der Behandlungsphasen mit dem Makrolidantibiotikum signifikant höher war als bei Patienten, die kein Antibiotikum erhalten hatten. Ein signifikantes Zusatzrisiko der AM-Therapie gegenüber der Penicillin- Therapie war dabei nicht erkennbar.
Dies scheint auf den ersten Blick im Widerspruch zu den Ergebnissen aus und Tennessee und Großbritannien zu stehen. Bei genauerer Analyse zeigt sich aber, dass die Patienten der dänischen Registerstudie durchschnittlich neun Jahre jünger waren und entsprechend seltener an einer Herzkreislauferkrankung litten. Betrachtet man die Ergebnisse älterer und kränkerer Patienten isoliert, belegt auch die dänische Kohorte eine höhere Letalität nach Azithromycin-Behandlung. Die aktuelle Studienlage lässt nur einen Schluss zu: Je höher das kardiovaskuläre Ausgangsrisko eines Patienten, desto größer ist die Gefährdung durch Makrolidgaben. Also: Finger weg von diesem Antibiotikum bei älteren Koronarpatienten!
Von der dänischen Kohortenstudie mit dem Titel Use of Azithromycin and Death from Cardiovascular Causes steht nur das einigermaßen ausführliche Abstract kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 4.8.13
"Within the coming days" oder wie aus Tagen Jahre werden können: Die "Tamiflu Campaign" 2003/2009 bis 2013 - und (k)ein Ende!?
 Seit 2009 führen die HerausgeberInnen des renommierten Medizinjournals "British Medical Journal (BMJ)" und Wissenschaftler der Influenza-Cochrane-Reviewergruppe eine zähe Auseinandersetzung um die tatsächliche Wirkung des zur Wirkstoffgruppe der Neuraminidasehemmer gehörenden Medikaments Tamiflu des Pharma-Großunternehmens Roche (siehe dazu u.a. den folgenden Tamiflu III-Betrag im forum-gesundheitspolitik).
Seit 2009 führen die HerausgeberInnen des renommierten Medizinjournals "British Medical Journal (BMJ)" und Wissenschaftler der Influenza-Cochrane-Reviewergruppe eine zähe Auseinandersetzung um die tatsächliche Wirkung des zur Wirkstoffgruppe der Neuraminidasehemmer gehörenden Medikaments Tamiflu des Pharma-Großunternehmens Roche (siehe dazu u.a. den folgenden Tamiflu III-Betrag im forum-gesundheitspolitik).
Nachdem die Cochrane-Reviewer in einem ersten Review an der vom Hersteller und in einer einzigen Metaanalyse diverser Einzelstudien durchweg positiv dargestellten Wirkung zweifelten und Zugang zu einer Vielzahl von Roche offensichtlich nicht veröffentlichten Wirkungsstudien forderten, begann eines der spannendsten und lehrreichsten Kapitel in der neueren Gesundheitspolitikgeschichte. Dies verhinderte aber nicht, dass Tamiflu und ein weiteres vergleichbares Mittel zeitweise von vielen Aerzten und Regierungen als präventives und kuratives Wundermittel gegen die Vogel- und zur Pandemie hochgejazzten Schweinegrippe gehalten und millionenfach steuerfinanziert eingelagert wurden und zu Milliardenumsätzen führten.
Dieses Kapitel ist vor allem durch das Nebeneinander von wiederholten Versprechungen Roche's geprägt, die Informationen zur Verfügung zu stellen, und dies gleichzeitig durch fintenreiche Manöver und ohne irgendeinen Täuschungsversuch auszulassen zu verhindern. Nachdem die ForscherInnen und die Oeffentlichkeit bis 2012 zwar von immer mehr unveröffentlichten Untersuchungen und Reports von Roche und anderen erfuhr, aber keinen Zugang zu ihnen erhielten, startete das BMJ eine einmalige so genannte "open data campaign", die das Ziel verfolgte "to achieve appropriate and necessary independent scrutiny of data from clinical trials. Working with others, we seek to highlight the problems caused by lack of access to data, and we welcome any suggestions on how to take things further."
Mit dem erneuten Versprechen, sämtliche ("full") anonymisierten Daten samt den unveröffentlichten Studien im April 2013 zu veröffentlichen, ist möglicherweise nach über vier Jahren die Basis geschaffen, die Wirkungen des zwischenzeitlich zu einem wahren Blockbuster gewordenen Tamiflu unabhängig zu überprüfen.
Wer das reich mit Originalkorrespondenzen zwischen Wissenschaftlern, dem BMJ, der WHO und der Firma Roche sowie einer Reihe von nationalen wie europäischen Aufsichts- und Zulassungsinstitutionen für Arzneimittel sowie frei zugänglichen Aufsätzen illustrierte Lehrstück überblicken und sich in sein Studium vertiefen will, findet den Zugang über die stetig aktualisierte BMJ-Website "Tamiflu campaign". Auf ihr findet sich auch eine interaktive Zeitschiene der pharmakologischen und medizinischen Untersuchungen über die erwünschten und unerwünschten Wirkungen von Tamiflu, die im Moment die Jahre 2003 bis 2013 umfasst. Dort gibt es auch eine Fülle von Links zu wichtigen vor allem im BMJ publizierten Tamiflu-Aufsätze.
Wer nachvollziehen will, warum manche Akteure dieser Debatte auch dem letzten Transparenzversprechen der Firma Roche nicht recht glauben wollen, sollte sich die vier Seiten umfassende Antwort von Peter Doshi auf die letzte Erklärung zur "Roche data transparency policy" vom 1. März 2013 durchlesen. Dort wird u.a. klar, wie eine unabhängige Forschung ŕ la Roche aussieht. Die Firma schlägt in einer Art "samtenem" Junktim vor, die Datensichtung und -bewertung durch eine "Multiparty Group for Advice on Science" begleiten zu lassen, als einem "fair, transparent and independent way of adressing data transparency regarding Tamiflu". Laut Doshi zeigen aber eindeutige und auch per Link zugängliche Dokumente, dass wenigstens drei der vier von Roche ins Auge gefassten Leiter der Gruppe nicht unabhängig sind, sondern bis vor kurzem noch finanzielle Beziehungen zu Roche hatten.
Wer jemals wieder behauptet, mangelnde Transparenz über den Nutzen und den Schaden von Arzneimitteln, die signifikante Nichtveröffentlichung von negativen Studienergebnissen und zahlreiche weitere Methoden Transparenz über Arzneimittel zu verhindern, seien "Ausrutscher" oder das Werk einzelner "schwarzer Schafe", sollte sofort mittels der Internetadresse der "Tamiflu Campaign" und mit dem Beispiel der durchgeplanten Strategien eines der größten Pharmaunternehmen der Welt eines Besseren belehrt werden.
Bernard Braun, 7.4.13
Mehr Schaden als Nutzen oder Fehlversorgung? Antidepressiva und Hüftfrakturen im höheren Lebensalter
 Die Heilung von Knochenfrakturen aller Art und die Wiederherstellung der vorherigen Beweglichkeit und Sicherheit zahlreicher körperlicher Prozesse dauert insbesondere bei älteren Menschen sehr lange, belastet die Lebensqualität (z.B. Schmerzen und Schmerzbehandlung) oder kommt teilweise auch gar nicht mehr zustande.
Die Heilung von Knochenfrakturen aller Art und die Wiederherstellung der vorherigen Beweglichkeit und Sicherheit zahlreicher körperlicher Prozesse dauert insbesondere bei älteren Menschen sehr lange, belastet die Lebensqualität (z.B. Schmerzen und Schmerzbehandlung) oder kommt teilweise auch gar nicht mehr zustande.
Die Hüftfraktur gehört zu den Erkrankungen mit den gravierendsten Folgen und sollte daher möglichst verhindert werden. Eine verminderte Knochendichte und -stabilität sowie Stürze gehören zu den wichtigsten Ursachen und damit auch präventiven Ansatzpunkten.
Eine landesweite prospektive Kohortenstudie mit allen 906.422 in Norwegen vor 1945 geborenen Personen untersuchte jetzt, ob nicht auch Arzneimittel und dabei insbesondere die für ältere Personen relativ häufig verordneten Antidepressiva eine wichtige Rolle als Risikofaktor spielen.
Die ForscherInnengruppe erhielt für ihre Untersuchung sämtliche Informationen über alle zwischen 2004 und 2010 erfolgten Verordnungen von Antidepressiva und Angaben über alle Hüftfrakturen im Zeitraum 2005-10. Der für den Vergleich des Neueintretens einer Hüftfraktur bei PatientInnen mit oder ohne Antidepressiva-Verordnungen genutzte Indikator war die standardisierte Inzidenzrate (SIR).
Die Ergebnisse:
• 4,4% dieser Kohorte oder 39.938 Personen hatten im Untersuchungszeitraum eine Hüftfraktur.
• Dieses Risiko war bei Menschen mit der Verordnung irgendeines Antidepressivums signifikant höher als bei Personen ohne die Einnahme eines solchen Medikaments. Die SIR lag bei 1,7.
• Bei trizyklischen Antidepressiva lag SIR etwas niedriger, und zwar bei 1,4. Unter der Einnahme von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (selective serotonin reuptake inhibitors [SSRIs]) war die Rate mit 1,8 am höchsten. Alle anderen Antidepressiva hatten eine SIR von 1,6.
• Daraus ergibt sich für Hüftfrakturen insgesamt ein zusätzliches oder attributives Risiko der Exposition gegen Antidepressiva von 4,7%.
Wer nicht der Meinung ist, Hüftfrakturen gehörten zum normalen stofflichen Altersrisiko und seien daher nicht vermeidbar, sollte sich nach dieser und weiteren Studien mit ähnlichen Ergebnissen intensiver mit der Art und dann auch noch der Menge der verordneten Arzneimittel (Stichwort Polypharmazie) kümmern. Auch wenn mit dieser Studie kein abschließender Beleg für einen ursächlichen Zusammenhang vorliegt, sollten die Ergebnisse trotzdem zu einer defensiveren Verordnung dieser Art von Arzneimittel Anlass sein und weitere Studien die jetzige signifikante Assoziation zu einem Ursache-Wirkungszusammenhang verdichten.
Der Aufsatz Increased risk of hip fracture among older people using antidepressant drugs: data from the Norwegian Prescription Database and the Norwegian Hip Fracture Registry von Marit Stordal Bakken et al. ist am 24. Februar 2013 in der Online-Ausgabe der Zeitschrift "Age Ageing" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.3.13
Ein Hauch von Sisyphos: Vitamin C verhindert Erkältungen nicht und hat bescheidene Wirkungen auf ihre Dauer und Schwere.
 Wenn es nach den Herstellern von Vitamin C-Kapseln und zahllosen Gesundheitsfibeln wie Ratgeberseiten ginge, würden wir alle "für alle Fälle" im gesamten Winterhalbjahr zur Verhinderung von Erkältungen oder der Abkürzung von Dauer und Schwere ihrer Symptome Ascorbinsäure in allen natürlichen oder industriellen Formen oder Zubereitungen zu uns nehmen. Ob das wirklich hilft ist aber seit über 70 Jahren umstritten.
Wenn es nach den Herstellern von Vitamin C-Kapseln und zahllosen Gesundheitsfibeln wie Ratgeberseiten ginge, würden wir alle "für alle Fälle" im gesamten Winterhalbjahr zur Verhinderung von Erkältungen oder der Abkürzung von Dauer und Schwere ihrer Symptome Ascorbinsäure in allen natürlichen oder industriellen Formen oder Zubereitungen zu uns nehmen. Ob das wirklich hilft ist aber seit über 70 Jahren umstritten.
Um hier mehr Klarheit zu schaffen, durchkämmte eine Cochrane-Reviewergruppe jetzt alle Studien der letzten Jahrzehnte, in denen täglich mehr als 200 Milligramm Vitamin C aufgenommen wurden und in denen eine Kontrollgruppe ein Placebo eingenommen hatte. Die meisten Studien waren auch randomisiert und doppel-blind. In den Review gingen dann 29 Studien mit 11.306 TeilnehmerInnen ein.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Das relative Risiko, eine Erkältung zu bekommen, unterschied sich zwischen denjenigen, die Vitamin C oder ein Placebo zu sich nahmen bei den der Durchschnittsbevölkerung zuzurechnenden 10.708 TeilnehmerInnen nicht (RR=0,97).
• Anders war dies nur bei den 598 TeilnehmerInnen in 5 Studien, die Marathonläufer waren oder Skiläufer und Soldaten, deren Tätigkeit oder sportliche Betätigung kurzfristig unter schwersten klimatischen Bedingungen stattfand. Das relative Risiko eine Erkältung zu bekommen war für diesen Personenkreis deutlich geringer, wenn Vitamin C eingenommen wurde (RR=0,48).
• Die Dauer der Erkältung reduzierte sich bei Erwachsenen unter Vitamin C-Aufnahme um 8%, die von Kindern um 14%. Wenn Kinder zwischen 1 und 2 Gramm pro Tag an Vitamin C aufnahmen, sank die Erkrankungsdauer um 18%.
• Nachweisbare und signifikante Wirkungen von Vitamin C gibt es auch auf die Ernsthaftigkeit der Erkältungssymptome. Die Reviewer schränken dies aber mit dem Hinweis "it is modest in absolute terms" deutlich ein.
• Die therapeutischen Studien, d.h. Studien in denen nach Beginn einer Erkältung versucht wird, mittels hoher und sehr hohen Vitamin C-Dosen die Dauer und Schwere der Erkältung zu beeinflussen, "showed no consistent effect" auf beide Zielgrößen. Hier ist auf jeden Fall vor einer uneingeschränkten Empfehlungen z.B. 8 Gramm Vitamin C pro Tag aufzunehmen weitere Forschung notwendig.
• Etwas Gutes zum Schluss: In keiner Studie wurde über unerwünschte Nebenwirkungen der Vitamin C-Ein- oder Aufnahme berichtet.
Die Bewertung der Einnahme von Vitamin C zur Verhinderung von Erkältung ist eindeutig: "Routine vitamin C supplementation is not justified". Trotz teilweise geringen und auch nicht eindeutig zu replizierenden Wirkungen bewerten die Cochrane-Reviewer die Einnahme von Vitamin C zur Beeinflussung von Dauer und Schwere einer eingetretenen Erkältung etwas weniger ablehnend: "It may be worthwhile for common cold patients to test on an individual basis whether therapeutic vitamin C is beneficial for them."
Auch hier gilt natürlich, dass Orangen, Paprika oder andere Vitamin C-Träger aus vielen anderen und guten Gründen weiter verzehrt werden sollten - nur eben nicht mit der Erwartung Erkältungskrankheiten verhindern oder uneingeschränkt zu beeinflussen können.
Von dem am 31. Januar 2013 veröffentlichten Cochrane-Review Vitamin C for preventing and treating the common cold von Hemilä H. und Chalker E. gibt es kostenlos das gewohnt umfangreiche Abstract.
Wer Materialien für ein Lehrstück zur geringen Geschwindigkeit der Verbreitung und Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis sucht, wird auch beim Vitamin C fündig.
So gab es bereits innerhalb des letzten Jahrzehnts mehrere ähnlich lautende Ergebnisse verschiedener methodisch hochwertiger Reviews und Metaanalysen, die bisher offensichtlich kaum erkennbare Wirkungen auf die Werbung für die präventive und therapeutische Aufnahme von Vitamin C und natürlich auf deren wirkliche Aufnahme erzielten.
Zum Beispiel schrieb einer der Autoren des aktuellen Cochrane-Reviews, Hemilä, zusammen mit einem anderen Autoren bereits 2005 u.a.: "The lack of effect of prophylactic vitamin C supplementation on the incidence of common cold in normal populations throws doubt on the utility of this wide practice. The clinical significance of the minor reduction in duration of common cold episodes experienced during prophylaxis is questionable, although the consistency of these findings points to a genuine biological effect. In special circumstances, where people used prophylaxis prior to extreme physical exertion and/or exposure to significant cold stress, the collective evidence indicates that vitamin C supplementation may have a considerable beneficial effect." Der komplette Text dieses Aufsatzes Vitamin C for preventing and treating the common cold. von Douglas RM und Hemilä H ist 2005 in der Open Access-Zeitschrift PLoS Medicine (2(6): e168) erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.2.13
Wie der Streit zweier Arzneimittelhersteller die Werbung für Arzneimittel zukünftig verlässlicher machen könnte - oder auch nicht!
 Erneut hat ein deutsches Gericht, und dieses Mal sogar der Bundesgerichtshof (BGH), etwas zu regeln versucht, was eigentlich Aufgabe der Gesundheitspolitik sein müsste. In einem Urteil (Aktenzeichen: I ZR 62/11 - Basisinsulin mit Gewichtsvorteil) dessen Kernaussagen in der Pressemitteilung 22/2013 des BGH vom 6. Februar 2013 veröffentlicht wurden, stellt das Gericht in einem Rechtsstreit zwischen den Insulin-Produzenten Sanofi-Pasteur und Novo Nordisk folgendes Kriterium für die "Zulässigkeit einer Heilmittelwerbung" auf: "Studienergebnisse, die in der Werbung oder im Prozess als Beleg einer gesundheitsbezogenen Aussage angeführt werden, (sind) grundsätzlich nur dann hinreichend aussagekräftig, wenn sie nach den anerkannten Regeln und Grundsätzen wissenschaftlicher Forschung durchgeführt und ausgewertet wurden. Dafür ist im Regelfall erforderlich, dass eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung vorliegt, die durch die Veröffentlichung in den Diskussionsprozess der Fachwelt einbezogen worden ist."
Erneut hat ein deutsches Gericht, und dieses Mal sogar der Bundesgerichtshof (BGH), etwas zu regeln versucht, was eigentlich Aufgabe der Gesundheitspolitik sein müsste. In einem Urteil (Aktenzeichen: I ZR 62/11 - Basisinsulin mit Gewichtsvorteil) dessen Kernaussagen in der Pressemitteilung 22/2013 des BGH vom 6. Februar 2013 veröffentlicht wurden, stellt das Gericht in einem Rechtsstreit zwischen den Insulin-Produzenten Sanofi-Pasteur und Novo Nordisk folgendes Kriterium für die "Zulässigkeit einer Heilmittelwerbung" auf: "Studienergebnisse, die in der Werbung oder im Prozess als Beleg einer gesundheitsbezogenen Aussage angeführt werden, (sind) grundsätzlich nur dann hinreichend aussagekräftig, wenn sie nach den anerkannten Regeln und Grundsätzen wissenschaftlicher Forschung durchgeführt und ausgewertet wurden. Dafür ist im Regelfall erforderlich, dass eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung vorliegt, die durch die Veröffentlichung in den Diskussionsprozess der Fachwelt einbezogen worden ist."
In dem Rechtsstreit ging es darum, dass der dänische Pharmakonzern für sein Insulin zur Behandlung von Diabetes mellitus mit den Ergebnissen einer Metaanalysen-Studie geworben hatte, nach der es weniger dick mache als andere Insuline. Dies hielt der französische Pharmakonzern Sanofi-Pasteur, der ebenfalls Insulinpräparate anbietet, für irreführende Werbung und versuchte seit 2009 diese per Gerichtsurteil verbieten zu lassen. Über zwei Vorinstanzen landete das Verfahren jetzt beim BGH.
Dieses Gericht stellte nicht nur den zitierten Qualitätsmaßstab für die Arzneimittelwerbung auf, sondern kritisierte konkret, dass die Werbeaussage von Novo Nordisk sich auf eine Subgruppenanalyse bzw. eine Metaanalyse mehrerer wissenschaftlicher Untersuchungen gestützt habe, deren grundsätzlicher methodischer Charakter und konkrete Hinweise auf begrenzte Aussagefähigkeit unerwähnt geblieben seien.
Ob Ergebnisse einer Metaanalyse "eine Werbeaussage tragen können, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dabei kommt es für die Frage der Irreführung neben der Einhaltung der für diese Studien geltenden wissenschaftlichen Regeln vor allem darauf an, ob der Verkehr in der Werbung hinreichend deutlich auf die Besonderheiten der Art, Durchführung oder Auswertung dieser Studie und gegebenenfalls die in der Studie selbst gemachten Einschränkungen im Hinblick auf die Validität und Bedeutung der gefundenen Ergebnisse hingewiesen und ihm damit die nur eingeschränkte wissenschaftliche Aussagekraft der Studie vor Augen geführt wird. Solche aufklärenden Hinweise enthält die beanstandete Werbung nicht, obwohl die in Bezug genommene Studie Anlass dazu gegeben hat."
Der BGH hält also in dieser Hinsicht die Klage von Sanofi-Pasteur für berechtigt und verweist den Fall zur endgültigen Entscheidung an das zuvor urteilende Kammergericht Berlin zurück. Dieses hat nun unter Berücksichtigung der Maßstäbe des BGH endgültig die Qualität der Metaanalyse zu prüfen.
Der zusätzliche Hinweis des BGH, die Behauptung des Gewichtsvorteils wäre "ohne konkreten Bezug zu der Studie … im Streitfall rechtlich nicht zu beanstanden", da sich dies "aus der arzneimittelrechtlichen Zulassung und der Fachinformation entnehmen lässt", ist aber aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht sehr problematisch und entschärft die hohen wissenschaftlichen Anforderungen des Gerichts erheblich. Denn der Hinweis, ein Hersteller könne sich bei der Werbung für sein Produkt "zum wissenschaftlichen Nachweis der Richtigkeit seiner Werbebehauptung auf den Inhalt der Zulassung und der Fachinformation berufen, weil diese Unterlagen Gegenstand der Überprüfung durch die Zulassungsbehörde sind" ignoriert die seit vielen Jahren in der Fachliteratur vielfach kritisierten Qualitätsmängel der Zulassungspraxis in Deutschland und auf europäischer Ebene. Die Lektüre mehrerer Jahrgänge des renommierten "Arznei-Telegramm" bzw. eine Googlerecherche mit den Suchworten "Arzneimittelzulassung, Fachinformation, Arznei-Telegramm" zeigt, dass viele Arzneimittel trotz unzulänglicher Studien zugelassen wurden, deutliche Warnungen vor massiven unerwünschten Wirkungen ignoriert werden, Arzneimittel in Deutschland oder Europa zugelassen werden, deren Zulassung z.B. die Zulassungsbehörde in den USA explizit verweigert hat und Fachinformationen unvollständig sind oder unerwünschte Wirkungen hartnäckig verschweigen.
Die vom BGH vertretene Meinung, die einzige Möglichkeit die Wissenschaftlichkeit der Zulassungspraxis zu erschüttern, wären neue wissenschaftliche Erkenntnisse, "die gegen die wissenschaftliche Tragfähigkeit der durch die Zulassung belegten Aussagen sprechen" ist daher im Lichte einer kritischen Sichtung der Zulassungspraxis selbst nicht wissenschaftlich abgesichert. Der Hinweis des Gerichtes, Sanofi-Pasteur habe keine neuen Erkenntnisse über das Präparat ihres Konkurrenten geltend gemacht und damit sei die Klageabweisung in der Vorinstanz in dieser Hinsicht rechtens gewesen, mag zwar juristisch stimmen, doch könnte Sanofi-Pasteur immerhin auch versuchen die Wissenschaftlichkeit der Zulassungsbasis in Zweifel zu ziehen.
Die Mitteilung 22/2013 der Pressestelle des BGH "Bundesgerichtshof zum Merkmal der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnis als Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Heilmittelwerbung" vom 6. Februar 2013 ist kostenlos erhältlich. Wer auch den Text BGH-Entscheidung lesen will - was sicherlich auch für Nichtjuristen zu empfehlen ist -, kann sich auf der Website des BGH bereits jetzt und unaufwändig für den Empfang per E-Mail anmelden.
Bernard Braun, 8.2.13
"Viel hilft viel" - Folgenreicher Irrtum über den Nutzen von Arzneimitteln. Polypharmazie-Studie und Leitlinie Multimedikation
 Polypharmazie oder Multimedikation, d.h. die gleichzeitige Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - so ein Konsens unter Experten -, stellt für viele PatientInnen, Ärzte und Krankenkassen ein quantitativ und qualitativ gewichtiges Problem dar.
Polypharmazie oder Multimedikation, d.h. die gleichzeitige Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - so ein Konsens unter Experten -, stellt für viele PatientInnen, Ärzte und Krankenkassen ein quantitativ und qualitativ gewichtiges Problem dar.
Ein vom Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen erstellter, Ende 2012 veröffentlichter Versorgungsreport der gesetzlichen Krankenkasse hkk, skizziert den derzeitigen Forschungsstand zur Polypharmazie und analysiert mit Routinedaten den Umfang, die Art und die Risiken von Polypharmazie unter den Versicherten dieser Kasse im Jahre 2010.
Die wichtigsten Erkenntnisse der bisherigen Forschung über Polypharmazie sind:
• Ab welcher Anzahl von verordneten oder eingenommenen Arzneimitteln die Fachwelt von Polypharmazie spricht, ist nicht eindeutig. Mehrheitlich gilt aber die Verordnung von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln innerhalb eines festgelegten Zeitraums als Polypharmazie.
• Eine vollständige Erfassung von Polypharmazie ist nur durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Informationsquellen möglich, darunter vor allem Informationen über die Einnahme frei verkäuflicher Medikamente. Bisherige Studien berücksichtigen diesen Aspekt jedoch kaum.
• Die Prävalenz von Polypharmazie in der Gesamtbevölkerung oder in ausgewählten Teilgruppen - wie zum Beispiel Ältere, Frauen oder sozial isolierte Menschen - schwankt je nach Zeitpunkt, Land oder Region erheblich. Dies gilt auch für Verbindungen zwischen Polypharmazie und ausgewählten sozialen Charakteristika untersuchter Personen wie etwa sozialer Status, Alter, Geschlecht oder soziale Situation.
• Polypharmazie wirkt sich in vielerlei Hinsicht und zum Teil auch erheblich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Betroffener aus. Die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Wirkungen (z.B. Wechselwirkungen und viele gleichzeitige Nebenwirkungen, schwächelnde Therapietreue) von Polypharmazie steigt mit dem Alter.
Die wichtigsten Ergebnisse der hkk-Polypharmaziestudie sind:
• 35,6 Prozent aller hkk-Versicherten, die 2010 mindestens ein Arzneimittel verordnet bekamen, sind durchgängig das ganze Jahr von Polypharmazie betroffen. Bei denjenigen, die 65 Jahre und älter sind, steigt dieser Anteil auf 61,3 Prozent.
• Im Falle der hkk-Versicherten gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Anzahl gleichzeitig verordneter, unterschiedlicher Arzneimittel und der Anzahl unterschiedlicher, ambulant gestellter Diagnosen. Polypharmazie ist also in erheblichem Maße die Antwort auf Polymorbidität.
• Untersucht man die gleichzeitige Verordnung unterschiedlicher Arzneimittel in Quartalen, so schwankt der Anteil der Polypharmazie-Betroffenen insgesamt zwischen 15,7 Prozent und 17,4 Prozent. Bei den Versicherten, die 65 Jahre und älter sind, steigt dieser Anteil je nach Quartal auf minimal 33,8 Prozent und maximal 34,8 Prozent an.
• Unter allen pflegebedürftigen hkk-Versicherten waren 83,4 Prozent von Polypharmazie betroffen.
• Der Anteil der von Polypharmazie betroffenen hkk-Versicherten unter denjenigen, die wegen einer unerwünschten Arzneimittelwirkung stationär behandelt werden mussten, betrug 71,2 Prozent.
• Das Risiko von Polypharmazie stieg mit der Anzahl unterschiedlicher Ärzte. Von den hkk-Versicherten, die von fünf und mehr Ärzten behandelt und denen dabei Arzneimittel verordnet wurden, waren fast immer nahezu 100 Prozent von Polypharmazie betroffen.
Will man Polypharmazie in nennenswertem Umfang verringern oder gar vermeiden reichen nach Meinung zahlreicher Wissenschaftler und Versorgungspraktiker weder ein- oder auch mehrmalige Appelle an verordnende Ärzte und betroffene PatientInnen noch einzelne praktische Interventionen oder allein Informationsschriften aus. Vielmehr bedarf es einer langfristigen, kombinierten Strategie für und mit Ärzten und Patienten. Diese muss zunächst ein gemeinsames Problembewusstsein über die Existenz und das damit verbundene Risiko von Polypharmazie sowie die Notwendigkeit verschiedener präventiver und kurativer Maßnahmen erzeugen. Danach müssen diese mit langem Atem und unter Beteiligung aller Akteure einschließlich der Krankenkassen umgesetzt und auf Wirksamkeit untersucht werden. Zu den wichtigsten Voraussetzungen - so auch die Meinung zweier für den Versorgungsreport interviewter Bremer Ärzte - gehört eine Leitlinie für die medikamentöse Behandlung multimorbider PatientInnen, die es ermöglicht bestimmte Medikamente abzusetzen, um damit mögliche unerwünschte Ereignisse durch Polypharmazie zu vermeiden aber keinen gesundheitlichen Schaden anzurichten.
Die am 16. Januar 2013 veröffentlichte fast einhundert Seiten umfassende "Hausärztliche Leitlinie. Multimedikation. Empfehlungen zum Umgang mit Multimedikation bei Erwachsenen und geriatrischen Patienten" der Leitliniengruppe Hessen stellt einen wichtigen Beitrag für die künftige hausärztliche Verordnungs-, Beratungs- und Steuerungspraxis dar. In der Leitlinie findet man auch einen umfassenden Überblick zur Forschungslage und zu Grundfragen des Medikationsprozesses in Hausarztpraxen. Die Leitlinie ist vollständig kostrenlos erhältlich.
Die bis 2016 gültige Leitlinie Multimedikation wurde in Kooperation mit Mitgliedern der »Ständigen Leitlinien-Kommission der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin« (DEGAM), der einzigen wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin in Deutschland, erarbeitet. Die Moderation der Leitliniensitzungen, die wissenschaftliche Begleitung und Konzeption hausärztlicher Leitlinienerarbeitung erfolgt durch die "PMV forschungsgruppe" von der Universität zu Köln. Zur Erstellung der Leitlinie führte das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ, Berlin) eine systematische Literaturrecherche durch. Die erarbeiteten Leitlinien werden über das ÄZQ [www.leitlinien.de] und die PMV forschungsgruppe regelmäßig im Internet veröffentlicht.
Der 45 Seiten umfassende hkk-Versorgungsreport 2012 "Polypharmazie" ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.2.13
Auch bei akuter Bronchitis Älterer schaden Antibiotika mehr als sie nutzen, außer bei begründetem Verdacht auf Lungenentzündung
 Die geläufigsten Argumente, bei Infektionen der oberen und besonders der unteren Atemwege Antibiotika zu verordnen, waren, dass dies "für alle Fälle" zur Verhinderung einer Lungenentzündung erfolge, man ja nie wisse ob es statt eines Virus- ein bakterieller Infekt sei bzw. die Klärung der Infektionsverursachers so aufwändig ist, dass "im Zweifelsfall" lieber Antibiotika verordnet werden und es z.B. bei Bronchitis "gut wäre" ein schnelles Ende zu erreichen, um eine Chronifizierung zu verhindern. Untersucht wurden der Wahrheitsgehalt bzw. die Evidenz für diese Annahmen und der Nutzen dieser Therapie bisher eher selten. Für die möglichen unerfreulichen Nebenwirkungen und vor allem das Risiko von Resistenzbildungen gab es dagegen bereits zahlreiche empirische Belege.
Die geläufigsten Argumente, bei Infektionen der oberen und besonders der unteren Atemwege Antibiotika zu verordnen, waren, dass dies "für alle Fälle" zur Verhinderung einer Lungenentzündung erfolge, man ja nie wisse ob es statt eines Virus- ein bakterieller Infekt sei bzw. die Klärung der Infektionsverursachers so aufwändig ist, dass "im Zweifelsfall" lieber Antibiotika verordnet werden und es z.B. bei Bronchitis "gut wäre" ein schnelles Ende zu erreichen, um eine Chronifizierung zu verhindern. Untersucht wurden der Wahrheitsgehalt bzw. die Evidenz für diese Annahmen und der Nutzen dieser Therapie bisher eher selten. Für die möglichen unerfreulichen Nebenwirkungen und vor allem das Risiko von Resistenzbildungen gab es dagegen bereits zahlreiche empirische Belege.
Eine aktuelle Studie mit 1.038 (Interventionsgruppe) und 1.023 (Kontroll-/Placebogruppe) über 60-jährigen PatientInnen mit Infektionen der unteren Atemwege untersuchte nun den Nutzen und Schaden des bei Bronchitis etc. häufig eingesetzten Antibiotikums Amoxicillin. Ausgeschlossen wurden PatientInnen mit nichtinfektiösen Ursachen ihrer Atemwegsinfekte und Personen bei denen der Verdacht auf eine bereits vorhandene Lungenentzündung bestand.
Die Ergebnisse:
• Mit Symptomen, die im Krankheitsverlauf auftraten oder sich verschlechterten, hatten die Antibiotika-PatientInnen statistisch signifikant weniger häufig zu kämpfen (15,9%) als die Angehörigen der Kontrollgruppe (19,3%). Der Unterschied war aber absolut recht gering.
• Bei der Dauer der Symptome gab es keine Unterschiede.
• Die StudienautorInnen sahen daher keine Evidenz für einen selektiven Nutzen des Antibiotikums Amoxicillins bei über 60-jährigen PatientInnen und empfehlen bei akuter Bronchitis, kein Antibiotikum zu verordnen und einzunehmen. Davon raten sie nur dann ab, wenn ein diagnostisch oder durch den Gesamtzustand des Patienten begründeter Verdacht auf eine Lungenentzündung vorliegt.
• Bei den mit dem Antibiotika behandelten PatientInnen traten Übelkeit, Hautausschläge oder Durchfall statistisch signifikant häufiger auf.
Die Autoren setzen sich selber mit einigen anderslautenden Ergebnissen und Empfehlungen in dem 2004 erschienen und 2010 geupdateten Cochrane-Review "Antibiotics for acute bronchitis" von Smith S, Fahey T, Smucny J, Becker L. auseinander und liefern plausible Begründungen für die Ursache der Unterschiede und für die höhere Gültigkeit ihrer Ergebnisse.
Trotzdem waren auch die Cochrane-Reviewer gegenüber dem Einsatz sämtlicher Antibiotika eher zurückhaltend: "There is limited evidence to support the use of antibiotics in acute bronchitis. Antibiotics may have a modest beneficial effect in some patients with acute bronchitis though data on subsets of patients who may benefit more from treatment is lacking. However, the magnitude of this benefit needs to be considered in the broader context of potential side effects, medicalisation for a self limiting condition, increased resistance to respiratory pathogens and cost of antibiotic treatment."
Von dem Aufsatz "Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial" von Paul Little et al., erschienen in der Februarausgabe 2013 der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" (Volume 13, Issue 2, Pages 123 - 129) gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 28.1.13
Wie wichtig sind bei Generika andere Merkmale als die Bioäquivalenz für die Therapietreue und den gesundheitlichen Nutzen?
 Eine immer größere Anzahl von Arzneimitteln sind Generika, d.h. Mittel mit Wirkstoffen deren Patentschutz ausgelaufen ist und die jetzt von verschiedenen Pharmaunternehmen zumeist preisgünstiger angeboten werden als zuvor vom Patentinhaber. Generika sind also ein gewichtiges Mittel im jahrzehntelangen Versuch, die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung ohne Qualitätseinbußen zu senken oder zumindest nicht weiter zunehmen zu lassen.
Eine immer größere Anzahl von Arzneimitteln sind Generika, d.h. Mittel mit Wirkstoffen deren Patentschutz ausgelaufen ist und die jetzt von verschiedenen Pharmaunternehmen zumeist preisgünstiger angeboten werden als zuvor vom Patentinhaber. Generika sind also ein gewichtiges Mittel im jahrzehntelangen Versuch, die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung ohne Qualitätseinbußen zu senken oder zumindest nicht weiter zunehmen zu lassen.
Unabdingbar für die Qualität der Behandlung mit Arzneimitteln und deshalb auch im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit ist die Pflicht zur Bioäquivalenz, d.h. der Wirkstoffgleichheit und -sicherheit mit dem der Markenpräparate. Für die Form oder die Farbe der Generika gibt es dagegen keine Pflicht, den Markenpräparaten gleich zu sein.
Ob dies ein Problem für die Versorgungsqualität darstellt, untersuchte nun eine us-amerikanische Forschergruppe für die Behandlung von 11.472 PatientInnen, denen wenigstens dreimal hintereinander Anti-Epileptika verordnet wurden und die dann eine Folgeverordnung verpassten, also therapieuntreu wurden (unerwartet nur 1,2% aller PatientInnen) und für 50.050 Anti-Epileptika-PatientInnen einer Kontrollgruppe, die therapietreu geblieben waren. Den meisten dieser PatientInnen wurden sieben der Generika-Präparate gegen epileptische Anfälle, Gemütsleiden oder chronische Schmerzen verordnet. Der Anteil von Generika an allen verordneten Arzneimitteln in diesem Indikationsbereich betrug nahezu 80%. Die Mittel, sämtliche Generika, wurden in 37 Farben und zum Teil in verschiedenen Formen und Größen angeboten.
Analysen des für soziodemografische Merkmale (z.B. Alter) und für Behandlungsformen adjustierten Nutzungsverhalten (damit ist der mögliche Einfluss dieser Merkmale auf das Einnahmeverhalten rechnerisch ausgeschlossen) zeigten Folgendes:
• Die Wahrscheinlichkeit mit der PatientInnen ihre gesundheitlich notwendige Weiterbehandlung unterbrachen, also therapieuntreu wurden, wird signifikant durch eine Veränderung der Farbe des Medikaments erhöht. Sie steigt im Vergleich mit dem Verhalten der PatientInnen ohne ein andersfarbiges Medikament insgesamt um 27%.
• Diese Wahrscheinlichkeit lag bei PatientInnen mit einem behandlungsbedürftigen Anfallleiden sogar um 53% höher.
• Unterschiedliche Formen wirkten sich dagegen nicht auf die Therapietreue aus.
Je mehr Generika eines Wirkstoffs auf den Markt kommen und verordnet werden desto größer wird die Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit, dass ihre Hersteller versuchen, sich voneinander zu unterscheiden. Nach den Ergebnissen der Studie muss dabei gründlicher als bisher bedacht und notfalls reguliert werden, dass alle möglichen Unterschiede zu Marken- oder auch anderen Generika-Medikamenten wegen der möglichen gesundheitlichen Nachteile unzureichender Therapietreue nicht zu groß sein dürfen.
Von dem am 31.12.2012 im "Archives of Internal Medicine" online erschienenen Aufsatz "Variations in pill appearance of antiepileptic drugs and the risk of nonadherence." von Kesselheim AS et al. gibt es den gesamten Text im Moment kostenlos.
Bernard Braun, 23.1.13
Brustkrebs: Studienergebnisse häufig verfälscht und verzerrt
 Übertreibung des Nutzens und Verschweigen der unerwünschten Wirkungen sind weit verbreitet, so lautet das Fazit einer Analyse von 164 Studien zur Wirksamkeit der Behandlung von Brustkrebs. Die Folge: Ärzte und Patienten gründen Behandlungsentscheidungen auf falsche, schöngefärbte Vorstellungen.
Übertreibung des Nutzens und Verschweigen der unerwünschten Wirkungen sind weit verbreitet, so lautet das Fazit einer Analyse von 164 Studien zur Wirksamkeit der Behandlung von Brustkrebs. Die Folge: Ärzte und Patienten gründen Behandlungsentscheidungen auf falsche, schöngefärbte Vorstellungen.
Ein kanadische Arbeitsgruppe untersuchte 164 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) unter der Frage, ob die Ergebnisse in Fachzeitschriften wahrheitsgemäß oder verfälscht bzw. verzerrt wiedergegeben werden.
In RCTs geht es um die Frage, ob eine neue Therapiemethode, z.B. ein neues Medikament oder eine neue Operationstechnik, besser ist als die bis dahin für am Besten erachtete. Der Begriff "primärer Endpunkt" bezeichnet das Kriterium, an dem der Erfolg bzw. Misserfolg der Intervention gemessen wird, also z.B. die Überlebenszeit. Sekundäre Endpunkte (SE) sind Ergebnisse, die ebenfalls wissenswert sind, aber nicht den Erfolg einer Therapie ausmachen. Übertragen auf ein Fußballmatch ist die Anzahl der Tore der PE, die Anzahl der Ecken ein SE. Würde die nach Toren unterlegene Mannschaft die erzielten bzw. nicht erzielten Tore (PE) verschweigen und stattdessen das für sie günstige Eckenverhältnis (SE) angeben, entstünde ein falsches bzw. verzerrtes Bild davon, welche Mannschaft besser ist.
In die Analyse gingen 164 Studien aus den Jahren 1995 bis 2011 ein. 148 Studien befassten sich mit medikamentösen Therapien, 11 mit Bestrahlungstherapie und 5 mit operativer Behandlung. Zu gleichen Teilen ging es um Therapien zur Verbesserung der Heilungsaussichten (adjuvante Therapie) und um Therapien bei metastasiertem Brustkrebs, wo eine Verbesserung der Überlebenszeit möglich aber eine Heilung nicht zu erwarten ist.
Ein sicheres Erfolgskriterium für eine Krebstherapie ist das Gesamtüberleben (overall survival, OS). Unsicher sind hingegen Kriterien wie progressionsfreies Überleben (progession-free survival, PFS) oder krankheitsfreies Überleben (disease-free survival, DFS), weil z.B. eine längere Zeit ohne feststellbares Tumorwachstum häufig mit nicht verbesserter oder gar verkürzter Überlebenszeit einhergeht. Umso bemerkenswerter ist es, dass in 137 Studien mit PFS bzw. DFS unsichere PE zum Erfolgskriterium ausgewählt wurden und OS, also Gesamtüberleben, nur in 27 Studien (16,5%).
Verzerrungen (Bias) stellten die Forscher im Berichten der PEs in 33% und im Berichten der Toxizität in 67% fest. 92 der 164 Studien hatten ein negatives Ergebnis bezüglich des PE, die neue Therapie war also nicht besser als die herkömmliche Behandlung. In 59% dieser Studien wurde der eigentlich negative PE positiv dargestellt oder verschwiegen und stattdessen ein positiver SE berichtet. Hier wurde also Nutzen suggeriert, wo keiner war.
Die schwere und lebensbedrohliche Folgen der Therapie (Toxizität Grad 3 und 4) wurden nur in einem Drittel der Veröffentlichungen im Abstract angegeben.
30 der Studien waren im Studienregister ClinicalTrials.gov eingetragen. Der Vergleich der hier eingetragenen PE mit den in der Veröffentlichung aufgeführten PE zeigte, dass in 7 Studien der PE verändert wurde (im Sinne von Eckstöße statt Tore). In 130 Studien konnte dieser Vergleich nicht durchgeführt werden, weil sie nicht registriert waren.
Diese Studie ist ein weiterer Beleg für die gravierenden Missstände im Bereich der medizinischen Forschung.
So erscheint es inakzeptabel, dass Studien mit hochwirksamen Medikamenten durchgeführt werden, deren Erfolg an Kriterien gemessen wird, die zweifelsfrei unzulänglich sind. Hier sind die Ethikkommissionen, die Zulassungsbehörden und auch die Fachzeitschriften gefordert. Letztere könnten z.B. die Veröffentlichung derartiger Studien ablehnen.
Verfälschungen und Verzerrungen bei der Veröffentlichung von Studienergebnissen -nach wie vor eher die Regel als die Ausnahme - sind nur verhinderbar durch Transparenz: alle Informationen über eine Studie müssen überprüfbar gemacht werden. Dafür ist nicht nur die Registrierung aller Studien zu fordern sondern auch die Pflicht zur zeitnahen Veröffentlichung der Ergebnisse sowie der Einblick in das Studienprotokoll und die Möglichkeit zur unabhängigen Überprüfung der gewonnenen Daten.
Die Autoren haben folgerichtig ihre eigene Arbeit frei zugänglich gemacht.
Vera-Badillo FE, Shapiro R, Ocana A, Amir E, Tannock IF.
Bias in reporting of end points of efficacy and toxicity in randomized, clinical trials for women with breast cancer. Annals of Oncology 2013 Volltext der Studie
Zur Vertiefung des Themas hier ein Link auf die Website eines wissenschaftlichen Symposiums, das am 10. und 11.10.2012 in Freiburg stattgefunden hat mit dem Thema "ACT now: Accuracy, Completeness, and Transparency in health research reporting". Die Vorträge und Vortragsfolien sind abrufbar.
Ebenfalls zum Thema ein 13-minütiges sehenswertes Video von Ben Goldacre, das sich an die breite Öffentlichkeit wendet. Es wurde im September 2012 veröffentlicht und verzeichnet bislang 572.000 Aufrufe.
Ben Goldacre: What doctors don't know about the drugs they prescribe. Link
David Klemperer, 15.1.13
Resultate und Schlussfolgerungen von herstellergesponsorten Medikamenten- und Gerätestudien vielfach signifikant verzerrt
 Resultate aus klinischen Studien über Arzneimittel oder medizinische Geräte stellen zunehmend die verpflichtende (Stichwort: evidenzbasierte Leitlinien) Grundlage für das diagnostische und therapeutische Handeln von Ärzten und damit für die Qualität der Behandlung von Patienten dar: Evidenz statt Eminenz!
Resultate aus klinischen Studien über Arzneimittel oder medizinische Geräte stellen zunehmend die verpflichtende (Stichwort: evidenzbasierte Leitlinien) Grundlage für das diagnostische und therapeutische Handeln von Ärzten und damit für die Qualität der Behandlung von Patienten dar: Evidenz statt Eminenz!
Parallel hierzu werden aber aus verschiedenen Gründen immer mehr dieser Studien von den Herstellern dieser Produkte selber durchgeführt oder werden von diesen vollkommen oder teilweise gefördert. Frühere systematische Reviews aber auch Einzelbeobachtungen oder -Berichte haben immer wieder auf das potenzielle oder auch reale Risiko hingewiesen, dass solche herstellergesponsorte Studien verzerrte ("industry bias") Ergebnisse produzieren oder veröffentlichen, die viel mehr als in Studien, die anderweitig finanziert und organisiert sind, zugunsten der Produkte der Sponsoren ausfallen. Diesen systematischen Zusammenhang bestreiten die Hersteller und Sponsoren meist mit dem Hinweis, es handle sich um Einzelfälle oder "schwarze Schafe" oder um Altfälle.
Ein Ende 2012 von Mitgliedern der international besetzten "Cochrane Methodology Review Group", darunter Mitarbeiter des renommierten "Nordic Cochrane Centre" in Kopenhagen, als Update früherer Reviews vorgelegter Methodenreview von 48 Studien (darunter Querschnittsstudien, Kohortenstudien, systematische Reviews und Metaanalysen) aus den Jahren 1948 bis Sommer 2011, nimmt den genannten Verharmlosungsstrategien aber den meisten Wind aus den Segeln.
Der Vergleich von Ergebnissen der beiden Sponsorenschaftstypen zeigt Folgendes:
• Herstellergesponsorte Studien haben statistisch signifikant mehr für den Sponsor vorteilhafte Ergebnisse zur Wirkung der untersuchten Medikamente und medizinische Geräte (RR: 1,24), zu ihren möglichen Nachteilen oder Schadenspotenzial (RR: 1,87) und bei den gesamten Schlussfolgerungen (RR: 1,31).
• Von den 10 Papieren, die über die Wirkstärken der untersuchten Produkte und der Sponsorenschaft der Studien berichten, finden 5 Papiere im Vergleich beider Sponsorenschaftstypen in Herstellerstudien durchweg größere Wirkstärken. Die restlichen 5 Studien finden dagegen keine Unterschiede bei der berichteten Wirkstärke.
• Der nachgewiesene Zusammenhang von Sponsorenschaft und der Art der Schlussfolgerungen unterscheidet sich zwischen Arzneimittel- und Gerätestudien nicht bzw. zeigt sich in beiden Studienarten.
• In industriegesponsorten Studien gab es statistisch signifikant weniger Übereinstimmung zwischen den berichteten Resultaten und den Schlussfolgerungen (RR: 0,84).
• Bei den meisten Standardfaktoren, die das Risiko einer systematischen Verzerrung erhöhen, gibt es zwischen industriegesponsorten und anderweitig finanzierten Studien keinen Unterschied - mit Ausnahme der Verblindung, wo Industriestudien ein signifikant leicht erhöhtes Risiko (RR: 1,32) für dadurch induzierte Verzerrungen haben.
Die gerade zitierten Spuren des "industry bias" bei herstellergesponsorten Studien lassen sich nach Feststellung der Reviewer schließlich nicht mit der Wirkung anderer Standard-Verzerrungsfaktoren erklären.
Die Gesamtbewertung Wirkungen der Studienförderung durch die Hersteller lautet daher: "Sponsorship of drug and device studies by the manufacturing company leads to more favorable results … and conclusions than studies sponsored by other sources. Our analyses suggest the existence of an industry bias"
Für die Methodik der weiteren Erforschung dieses Bias lautet die Empfehlung der Reviewer so: "Consequently, our data suggest that industry sponsorship should be treated as bias-inducing and industry bias should be treated as a separate domain. There are many subtle mechanisms through which sponsorship may influence outcomes, and an assessment of sponsorship should therefore be used as a proxy for these mechanisms. Interestingly, the AMSTAR tool for methodological quality assessment of systematic reviews includes funding and conflicts of interest as a domain."
Von dem 85-seitigen Cochrane-Review "Industry sponsorship and research outcome" von Lundh A, Sismondo S, Lexchin J, Busuioc OA und Bero L. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12) gibt es kostenlos das ausführliche Abstract.
, 11.1.13
Fortschritt der Prädiktion von Herz-/Kreislaufrisiken durch Biomarker gegenüber Cholesterinindikatoren nur sehr gering
 Seit ein paar Jahren fließt ein wachsender Teil der Forschungsausgaben der pharmazeutischen Industrie in die Entwicklung so genannter Biomarker. Diese sollen so früh wie möglich, unaufwändiger und zuverlässiger als andere Diagnostika das Risiko des Eintretens schwerer chronischer Erkrankungen anzeigen und schwere Risiken einer Behandlung zuführen. Dazu zählen auch drei verschiedene Protein-Biomarker, die zur Entdeckung des Risikos von Herz-Kreislauferkrankungen dienen sollen. Ob sie wirklich besser sind als die schon seit langem etablierten Prädiktoren Gesamtcholesterinspiegel und HDL-C, sollte die Analyse der Krankenakten von 37 Kohorten mit insgesamt 165.544 Personen aus den Jahren 1968 bis 2007 klären helfen. Die TeilnehmerInnen der Studie litten zu Beginn der Studie an keiner Herz-Kreislauferkrankung. Bei einem durchschnittlich nach 10,4 Jahren durchgeführten Follow up waren 10.132 der TeilnehmerInnen an koronarer Herzkrankheit erkrankt und 4.994 hatten einen Schlaganfall hinter sich.
Seit ein paar Jahren fließt ein wachsender Teil der Forschungsausgaben der pharmazeutischen Industrie in die Entwicklung so genannter Biomarker. Diese sollen so früh wie möglich, unaufwändiger und zuverlässiger als andere Diagnostika das Risiko des Eintretens schwerer chronischer Erkrankungen anzeigen und schwere Risiken einer Behandlung zuführen. Dazu zählen auch drei verschiedene Protein-Biomarker, die zur Entdeckung des Risikos von Herz-Kreislauferkrankungen dienen sollen. Ob sie wirklich besser sind als die schon seit langem etablierten Prädiktoren Gesamtcholesterinspiegel und HDL-C, sollte die Analyse der Krankenakten von 37 Kohorten mit insgesamt 165.544 Personen aus den Jahren 1968 bis 2007 klären helfen. Die TeilnehmerInnen der Studie litten zu Beginn der Studie an keiner Herz-Kreislauferkrankung. Bei einem durchschnittlich nach 10,4 Jahren durchgeführten Follow up waren 10.132 der TeilnehmerInnen an koronarer Herzkrankheit erkrankt und 4.994 hatten einen Schlaganfall hinter sich.
Bei der Berechnung der Anzahl von Personen, deren Gesamtrisiko einer Herz-/Kreislauferkrankung sowohl mit den konventionellen Risikofaktoren bzw. -indikatoren und einer oder allen der neuen Biomarkern untersucht wurde, zeigte sich Folgendes:
• Die Verbesserung der Bewertung des Gesamtrisikos belief sich durch die erneute Klassifikation mit den Biomarkern auf weniger als 1%.
• Bei 100.000 Erwachsenen im Alter von 40 und mehr Lebensjahren würde die konventionelle Cholesterinwert-Messmethode bei 15.436 Personen ein mittleres Risiko identifizieren.
• Zusätzliche Tests mit einem oder einer Kombination der neuen Biomarker würden darüber hinaus 1,1%, 4,1% oder 2,7% der 100.000 Erwachsenen einer Hochrisikogruppe für Herz-/Kreislauferkrankung (Risiko >20%) zuweisen, die nach geltenden Leitlinien auch sofort mit Statinen behandelt werden müssten.
• Die ForscherInnen,insgesamt fast 200 Personen, lehnen sowohl den generellen zusätzlichen Einsatz der Biomarker als auch einen Ersatz der konventionellen Klassifikation mit Cholesterinwerten durch die neuen Biomarker ab, und zwar weil diese "lipid parameters does not improve CVD prediction".
Von dem am 20. Juni 2012 in JAMA (307: 2499-2506) erschienenen Aufsatz "Lipid-related markers and cardiovascular disease prediction.", verfasst von zahlreichen Mitgliedern der "The Emerging Risk Factors Collaboration", ist sowohl ein Abstract als auch der komplette Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.12.12
Über- und Fehlversorgung mit Antibiotika bei Kleinkindern könnte entzündliche chronische Darmerkrankungen im höheren Alter fördern
 Zu den bekannten unerwünschten Nah- und Fernwirkungen der Verordnung und Einnahme von gesundheitlich nicht notwendigen und damit völlig nutzlosen Antibiotika gehört der Public Health-relevante Effekt der Förderung resistenter Bakterien. Zu diesen Risiken gesellen sich aber auch noch andere langfristige negative Wirkungen für die sinnlos mit Antibiotika behandelten Personen.
Zu den bekannten unerwünschten Nah- und Fernwirkungen der Verordnung und Einnahme von gesundheitlich nicht notwendigen und damit völlig nutzlosen Antibiotika gehört der Public Health-relevante Effekt der Förderung resistenter Bakterien. Zu diesen Risiken gesellen sich aber auch noch andere langfristige negative Wirkungen für die sinnlos mit Antibiotika behandelten Personen.
Eine jetzt abgeschlossene explorative Fall-Kontroll-Studie über mögliche Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit der meist mit Antibiotika behandelten Mittelohrentzündungen im Alter bis 5 Jahren und der Häufigkeit einer Reihe von Darmerkrankungen (z.B. Morbus Crohn) im höheren Kindes- und Jugendlichenalter untermauert diese Zusammenhänge. An der Studie nahmen zum einen 294 Kinder mit einem Durchschnittsalter von 13 Jahren teil, die zwischen 1989 und 2008 an einer entzündlichen Erkrankung des Darmes gelitten hatten. Zum anderen stellten 2.377 Kinder, die im Alter, dem Geschlecht und der Region zu den erstgenannten Kindern passten aber keine Darmentzündungen aufwiesen die Kontrollgruppe.
Das Ergebnis einer aufwändigen multivariaten Analyse der beiden Gruppen sah so aus:
• 5% der Angehörigen der Erkranktengruppe und 12% der Angehörigen der Kontrollgruppe waren vor der Studie nicht an einer Mittelohrentzündung erkrankt.
• Im Alter von 5 Jahren hatten 89% der an einer Darmentzündung erkrankten Kinder mindestens eine Mittelohrentzündung hinter sich, wohingegen es bei den Kontrollkindern 82% waren.
• Die Wahrscheinlichkeit mit der diejenigen Kindern, die im Alter von 5 Jahren mindestens eine mit Antibiotika behandelte Mittelohrentzündung hinter sich hatten, eine Darmentzündung bekamen war statistisch signifikant um das 2,8-Fache höher als bei Kindern ohne eine Mittelohrentzündung in diesem Lebensabschnitt. Die Wahrscheinlichkeit einer Morbus Crohn-Erkrankung war um das 2,7-Fache größer, die der chronisch entzündlichen Colitis ulcerosa um das 3-Fache größer. Das am häufigsten eingesetzte Antibiotikum war Penicillin.
• Die kanadischen ForscherInnen vermuten, dass die frühkindliche Antibiotika-Behandlung die Darmflora so stark verändert hat, dass sich die genannten Darmentzündungen besser entwickeln konnten als bei den Kindern ohne Antibiotika im Zusammenhang mit einer Mittelohrentzündung.
Obwohl die retrospektive Methode der Studie keine kausalen Zusammenhänge nachweist und keine kausalen Schlussfolgerungen zulässt, sollten die statistischen Assoziationen Anlass sein, noch sorgfältiger über die gesundheitliche Notwendigkeit und den Sinn eines kritiklosen Einsatzes von Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen nachzudenken - und natürlich weiter zu forschen.
Von dem am 19. Oktober 2012 elektronisch vorab publizierten Aufsatz "Association between early childhood otitis media and pediatric inflammatory bowel disease: An exploratory population-based analysis" von Shaw SY et al. in der Zeitschrift "Journal of Pediatrics" gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 12.11.12
Verringerung gesundheitlich nicht notwendiger Verordnungen von Antibiotika für Kinder und Jugendlichen gar nicht so schwer
 Auch die jüngsten Analysen der Verordnung von Antibiotika für Kinder und Jugendliche, die an Infektionen der oberen Atemwege oder Virusinfektionen litten, mittels Routinedaten regional (hier ist es die hkk-Studie "Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen") oder bundesweit (hier die Barmer GEK-Studie "Faktencheck Gesundheit. Antibiotika-Verordnungen bei Kindern") agierenden gesetzlichen Krankenkassen, belegt, dass ein Großteil der Verordnungen gesundheitlich nicht notwendig ist, nicht wirksam sein kann oder sogar kurz- wie vor allem mittel- bis langfristig individuell wie in Public Health-Hinsicht Schaden anrichtet (z.B. durch Resistenzbildungen bei Bakterien).
Auch die jüngsten Analysen der Verordnung von Antibiotika für Kinder und Jugendliche, die an Infektionen der oberen Atemwege oder Virusinfektionen litten, mittels Routinedaten regional (hier ist es die hkk-Studie "Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen") oder bundesweit (hier die Barmer GEK-Studie "Faktencheck Gesundheit. Antibiotika-Verordnungen bei Kindern") agierenden gesetzlichen Krankenkassen, belegt, dass ein Großteil der Verordnungen gesundheitlich nicht notwendig ist, nicht wirksam sein kann oder sogar kurz- wie vor allem mittel- bis langfristig individuell wie in Public Health-Hinsicht Schaden anrichtet (z.B. durch Resistenzbildungen bei Bakterien).
Daher dokumentieren die genannten Berichte auch Beispiele wie PatientInnen, Eltern und Ärzte zu einem defensiveren Umgang mit Antibiotika veranlasst werden können.
Eine gerade in den USA durchgeführte Interventionsstudie bei und mit ambulant tätigen Kinderärzten zeigt, dass dies mit multimodalen aber gar nicht so aufwändigen Mitteln erreicht werden kann.
Ausgangspunkt der Studie war die auch in den USA weit verbreitete Über- und Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Antibiotika. So fand eine Fachveröffentlichung aus dem Jahr 2011 für die Jahre 2006 bis 2008 trotz leicht sinkender Häufigkeit mehr als 30 Millionen Antibiotika-Verordnungen für die bis 18-Jährigen, die in 21% aller Arztbesuche verordnet worden waren. Bei 72,3% der Arztbesuche bei denen Antibiotika verordnet wurden erfolgte dies wegen akuter Infektionen der Atmungswege. Den 48,9% der Fälle mit einer Erkrankung aus dieser Krankheitsgruppe, bei denen Antibiotika geboten waren, standen 23,4% aller derartiger Erkrankungsfälle gegenüber bei denen Antibiotika potenziell nicht notwendig waren. In vielen der sinnvollen Verordnungen wurden Breitband-Antibiotika verordnet, deren üppiger Einsatz kritikwürdig ist.
Zu den Personen denen Antibiotika verordnet worden waren, gehörten übrigens bevorzugt junge Patienten, Bewohner der Südstaaten der USA und privat Krankenversicherte.
Die Interventionsstudie wurde in 18 zufällig einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeordneten großen pädiatrischen Zentren im Nordosten der USA mit durchschnittlich 174 Ärzten durchgeführt. In diesen Praxen erhielten 28% aller Kinder eine nach fachlichen Kriterien unangemessene Verordnung von Breitband-Antibiotika bei Nasennebenhöhleninfektionen, Gruppe A-Streptokokkeninfektionen des Rachens oder der Haut oder bestimmten Stadien einer Lungenentzündung.
Die Kinderärzte in der Interventionsgruppe erhielten innerhalb der Interventionszeit von drei Jahren als Einstimmung eine kurze Erinnerung an die aktuellsten Leitlinien zur Verordnung von Arzneimitteln bei Infektionserkrankungen. Danach erhielten sie vierteljährliche Berichte mit der Darstellung ihrer Verordnungsgewohnheiten im Vergleich zu den bekannten Leitlinien und außerdem einen Vergleich mit den Werten ihrer Kollegen. Die Ärzte in der Kontrollgruppe erhielten keine dieser Informationen.
Nach einem Jahr erhielten nur noch 14% der Kinder in den Interventionspraxen unangemessene Antibiotika-Verordnungen, während es in der Kontrollgruppe immer noch 23% waren.
Über die Ergebnisse der Interventionsstudie erfährt man mehr in der am 18. Oktober 2012 veröffentlichten Zusammenfassung "Study Succeeds in Cutting Inappropriate Antibiotic Prescribing by Pediatricians" eines Vortrags der ForscherInnen auf der "IDWeek-2012-Konferenz" in San Diego.
Zu dem Aufsatz "Antibiotic prescribing in ambulatory pediatrics in the United States" von Hersh AL et al. - veröffentlicht im Dezember 2011 in der Zeitschrift "Pediatrics" (2011 Dec; 128:1053) gibt es kostenlos das Abstract, aber auch auf der Website der Universität des Hauptautors eine kostenlose Komplettversion.
Bernard Braun, 5.11.12
Erneut kein signifikanter Nutzen "gekaufter Gesundheit": Magnesium bei Muskelkrämpfen von älteren Personen und Schwangeren.
 Wer nach Beispielen nach Über- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem sucht, wird insbesondere im Bereich von oft frei käuflichen Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Nahrungsergänzungsmitteln fast immer fündig.
Wer nach Beispielen nach Über- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem sucht, wird insbesondere im Bereich von oft frei käuflichen Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Nahrungsergänzungsmitteln fast immer fündig.
Dies gilt nach den gründlichen Analysen eines am 12. September 2012 veröffentlichten Cochrane-Reviews auch für Magnesium, das offensiv und auch häufig von Ärzten als prophylaktisches "natürliches" Mittel gegen Muskelkrämpfen bei Schwangeren, Höheraltrigen und Personen mit Krämpfen nach körperlicher Bewegung gepriesen wird.
Dazu analysierten die Reviewer zunächst alle zwischen Mitte der 1970er Jahren und heute durchgeführten randomisierten kontrollierten Studien, welche die behaupteten und vermuteten Wirkungen auf bzw. gegen Muskelkrämpfe im Vergleich von Personen, die Magnesium einnahmen, mit unbehandelten Personen, Placebobehandelten oder sonstig therapierten Personen untersucht hatten.
Dabei fanden sich sieben aussagefähige Studien mit insgesamt 406 TeilnehmerInnen. Drei Studien kümmerten sich um Muskelkrämpfe in den Beinen von Schwangeren und vier Studien um Personen, die ohne fassbare Ursachen an Krämpfen litten.
Die wesentlichen Ergebnisse des erstmalig durchgeführten systematischen Reviews lauteten:
• Für die vor allem bei älteren Erwachsenen auftretenden idiopathischen Krämpfe gab es in der Magnesiumgruppe gegenüber den TeilnehmerInnen in der Placebogruppe zwar einen kleinen Unterschied, der aber nicht statistisch signifikant war. So nahm die Anzahl der Krämpfe pro Woche gegenüber dem Ausgangswert zu Beginn der Studie bei den MagnesiumnutzerInnen um 3,93% ab. Der Unterschied bei der Anzahl betrug zwischen den beiden Personengruppen nach vier Wochen gerade einmal 0,01 Krämpfe pro Woche.
• Der Anteil der Personen, deren Krampfrate nach Start der Studie um 25% oder mehr abnahm, war in der Magnesiumgruppe (-8%) nicht wesentlich größer als in der Placebogruppe - der Unterschied daher auch nicht signifikant, also möglicherweise rein zufällig.
• Nach vier Wochen gab es ferner keinen signifikanten Unterschied bei der Krampfintensität und -dauer. Einschränkend erwähnen die Reviewer hier aber die geringe Anzahl von Studien, die diese Indikatoren überhaupt erhoben und bewerteten.
• In ihren Schlussfolgerungen halten die Reviewer es insbesondere für ältere Erwachsene für unwahrscheinlich, dass zusätzliche Einnahmen von Magnesium zu einer klinisch spürbaren und bedeutenden Prophylaxe von Krämpfen beitragen. Für die möglichen Wirkungen von Magnesium auf Muskelkrämpfe von Schwangeren ist die Forschungsliteratur widersprüchlich. Und schließlich beschäftigte sich bisher noch keine RCT mit bewegungsassoziierten oder mit bestimmten Erkrankungen assoziierten Muskelkrämpfen.
Über den Cochrane-Review Magnesium for skeletal muscle cramps. von Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK, et al. (Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12; 9: CD009402) gibt auch der gewohnt ausführliche kostenlose Abstract Auskunft.
Bernard Braun, 29.10.12
Weniger ist mehr: Antibiotikabehandlung bei milder Sinusitis = wenig Nutzen, viele kurzfristige und langfristige Probleme
 Antibiotika sollten in der ersten Woche einer milden oder mäßigen Sinusitis bzw. Nasennebenhöhlenentzündung nicht verordnet werden. Dies ist die Kernerkenntnis eines Reviews wissenschaftlicher Studien zum Nutzen und Schaden einer Antibiotika-Therapie der daran Erkrankten im Rahmen des Projektes "Promoting Good Stewardship in Clinical Practice" der "National Physicians Alliance (NPA)" in den USA.
Antibiotika sollten in der ersten Woche einer milden oder mäßigen Sinusitis bzw. Nasennebenhöhlenentzündung nicht verordnet werden. Dies ist die Kernerkenntnis eines Reviews wissenschaftlicher Studien zum Nutzen und Schaden einer Antibiotika-Therapie der daran Erkrankten im Rahmen des Projektes "Promoting Good Stewardship in Clinical Practice" der "National Physicians Alliance (NPA)" in den USA.
Nasennebenhöhlenentzündungen stellen einen der häufigsten Gründe für den Besuch einer Allgemeinarztpraxis dar. Die Diagnose einer Sinusitis ist in den USA außerdem die dritt- bis fünfthäufigste Diagnose bei der ein Antibiotikum verordnet wird. Ihre Behandlung löst dort zwischen 15% und 21% aller Antibiotikaverordnungen eines Jahres aus.
In den letzten 10 Jahren sind daher auch vier große Metaanalysen mit den Ergebnissen von 45 randomisierten placebokontrollierten Studien erstellt worden, die den Nutzen und die unerwünschten Effekten der Behandlung einer milden oder mäßigen Sinusitis mit Antibiotika untersucht haben.
Für die Empfehlung der NPA mit dem Tenor "Less is more"waren folgende wissenschaftlichen Ergebnisse maßgeblich:
• Bei einer milden oder mäßigen Sinusitis, d.h. einer Erkrankung ohne hohem Fieber, starken Schmerzen oder Druckschmerzempfindlichkeit war der erwünschte gesundheitliche Effekt innerhalb der ersten zwei Wochen in der Antibiotika-Gruppe statistisch signifikant höher als in der Placebo-Gruppe. Der Unterschied war aber sehr klein: Der Anteil der geheilten oder deutlich von Beschwerden befreiten PatientInnen schwankte in der Antibiotika-Gruppe zwischen 71% und 90% und in der Placebo-Gruppe zwischen 64% und 80%. Der Anteil der PatientInnen mit Heilung oder Linderung war daher in der Antibiotika-Gruppe 7% bis 14% höher.
• Keine Unterschiede gab es zwischen beiden Gruppen beim Auftreten von Komplikationen oder Rückfällen.
• 30% bis 74% der PatientInnen mit Antibiotika-Behandlung litten an ihrer häufigsten unerwünschten Nebenwirkung, dem Durchfall. Er trat 80% häufiger auf als in den Placebo-Gruppen. Hinzu kamen einige seltenere Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Richtige schwere und lebensbedrohliche Wirkungen traten aber in keiner der Studien auf.
• In jedem Fall stellt aber die Anwendung von Antibiotika wegen der Förderung antibiotikaresistenter Erregerstämme eine potenzielle Gefährdung der Bevölkerungsgesundheit dar. Diese Gefährdung ist im Rahmen einer Nutzen-Schadenbilanz umso gravierender desto geringer der individuelle Nutzen ist.
Ähnliche Reviews zur Evidenz von Behandlungskonzepten beabsichtigt die NPA für weitere in einer so genannten "Top 5"-Liste genannten häufigen Erkrankungen zu veröffentlichen.
Von dem Aufsatz "Treatment of mild to moderate sinusitis." von Smith SR, Montgomery LG, Williams JW Jr, erschienen in den "Archives of Internal Medicine" (172(6): 510-3) ist kostenlos ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 5.8.12
Ausgeprägte Interessenkonflikte bei der Erarbeitung des DSM-V
 Was eine psychiatrische Diagnose ist und was nicht, entscheiden Experten. Die Definitionsmacht liegt hier weitgehend bei der American Psychiatric Association (APA). Im Jahr 1952 erschien die erste Version ihres Diagnosekataloges "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM). Im Mai 2013 soll die fünfte Version erscheinen. Da sich die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) der Weltgesundheitsorganisation im psychiatrischen Bereich am DSM orientiert, prägt der DSM die Psychiatrie weltweit.
Was eine psychiatrische Diagnose ist und was nicht, entscheiden Experten. Die Definitionsmacht liegt hier weitgehend bei der American Psychiatric Association (APA). Im Jahr 1952 erschien die erste Version ihres Diagnosekataloges "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM). Im Mai 2013 soll die fünfte Version erscheinen. Da sich die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) der Weltgesundheitsorganisation im psychiatrischen Bereich am DSM orientiert, prägt der DSM die Psychiatrie weltweit.
Über die sich abzeichnende hochproblematische Ausweitung der psychiatrischen Diagnosekategorien habe wir berichtet (Medikalisierung der emotionalen Höhen und Tiefen - Neu ab 2013 im "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder" Link)
In einer Pressemitteilung zur Berufung der Steuerungsgruppe im Juli 2007 erklärte die APA, dass die Patienten ein Anrecht auf ein Manual hätten, das auf dem Stand der Wissenschaft und frei von Interessenkonflikten sei. Alle Mitglieder müssten ihre finanziellen Verbindungen zur Industrie offenlegen. Im Jahr 2007 und den Folgejahren durfte das Einkommen aus Industriequellen nicht mehr als 10.000 Dollar betragen mit Ausnahme von Studiensponsoring.
In einem Beitrag in PLoS Medicine untersuchten die amerikanischen Wissenschaftler Lisa Cosgrove und Sheldon Krimsky, inwieweit die Öffentlichkeit darauf vertrauen kann, dass die APA in der Erarbeitung des DSM-V ihrem Anspruch auf Objektivität und Freisein von finanziellen Interessenkonflikte gerecht wird.
Die Steuerungsgruppe besteht 29 Mitgliedern, von denen 19 (71%) einen finanziellen Interessenkonflikt (financial conflict of interest - FCOI) angeben.
Die 13 Arbeitsgruppen mit insgesamt 141 Mitgliedern sind verantwortlich für die Überarbeitung der diagnostischen Kategorien und für die Aufnahme neuer Störungen in eine diagnostische Kategorie. In den meisten Arbeitsgruppen stellen Mitglieder mit FCOI die Mehrheit. Am stärksten ausgeprägt sind die FCOI in den Arbeitsgruppen, die sich mit Krankheitsbildern befassen, die an erster Stelle mit Medikamenten behandelt werden. Mit anderen Worten: die Mehrheit der Arbeitsgruppen, die sich mit der Überarbeitung und der Definition der jeweiligen Störungen befassen, stellen Experten, welche finanzielle Beziehungen zu den Firmen haben, die Medikamente für genau diese Störungen herstellen, so z.B.
• 12 von 18 Experten in der Arbeitsgruppe Affektive Störungen
• 12 von 14 Experten in der Arbeitsgruppe Psychotische Störungen
• 7 von 7 Experten in der Arbeitsgruppe Schlaf-Wach-Störungen.
Bereits im Jahr 2006 hatte Lisa Cosgrove über die Interessenkonflikte in der DSM-IV-Gremien berichtet (Link). Da es zur Zeit der Erarbeitung des DSM-IV noch keine Verpflichtung zur Offenlegung von Interessenkonflikte gab, suchte man im Internet nach Publikationen, in denen die Interessenkonflikte erklärt werden mussten und fand heraus, dass 95 der damaligen 170 Arbeitsgruppen-Mitglieder (65%) finanzielle Beziehungen zur Industrie pflegten, in den Arbeitsgruppen Affektive Störungen und Psychotische Störungen jeweils 100%.
Die Autoren erkennen es als Fortschritt an, dass die APA mittlerweile die Offenlegung von Interessenkonflikten für Mitglieder des Steuerungskomitees und der Arbeitsgruppen verpflichtend vorschreibt, weist jedoch auf folgende Lücken hin:
• Eine Begrenzung der Einnahmen aus Industriequellen auf 10.000 Dollar pro Jahr sowie des Aktienbesitzes auf 50.000 Dollar ist willkürlich. Die Vorstellung, dass Interessenkonflikte erst oberhalb dieser Grenzen entstehen ist falsch.
• Industriegelder für Studien müssen nicht genannt werden, obwohl die Abhängigkeit der Studienergebnisse vom Sponsor ("funding effect") hinlänglich bekannt ist (wir berichteten).
• Die Mitglieder müssen die Geldbeträge, die sie von der Industrie erhalten, nicht nennen.
• Die Mitgliedschaft in sog. speakers' bureaus ist nicht explizit anzugeben sondern kann in der Kategorie "Vortragshonorare" verbucht werden. Speakers' bureaus sind Agenturen, die der Industrie Wissenschaftler als Referenten vermitteln. Die Kontrolle über die Inhalte liegen zumeist auf Seiten der Firma. Da es sich bei dieser Vortragstätigkeit um reines Marketing handelt, empfiehlt die Association of American Medical Colleges ihren Mitgliedern, mit diesen Agenturen nicht zu kooperieren (wir berichteten).
Tatsächlich gab kein einziges DSM-V- Arbeitsgruppen-Mitglied diese Art von Verbindung an, obwohl eine Internetrecherche der Autoren über die Jahre 2006 bis 2011 ergab, dass 15% der 141 Mitglieder an anderer Stelle angaben, Mitglied eines Speakers' Bureau oder eines Advisory Boards zu sein.
Die Autoren ziehen das Fazit, dass die bislang getroffenen Regeln nicht dazu ausreichen, die neue Version des psychiatrischen Diagnosemanuals vor der Einflussnahme der Industrie zu schützen, so wie es die APA zumindest verbal anstrebt ("… transparent process of development for the DSM, and …an unbiased, evidence-based DSM, free
from any conflicts of interest'').
Die Autoren empfehlen:
• Alle Arbeitsgruppenmitglieder sollten frei sein von finanziellen Interessenkonflikten
• Personen, die an Speakers Bureaus teilgenommen haben, sollen nicht an Arbeitsgruppen teilnehmen.
• Für den Fall, dass nicht ausreichend Personen mit der erforderlichen Expertise zu finden sind, die keinen Interessenkonflikt haben, sollen Personen mit Beziehungen zur Industrie in die Beratungen einbezogen werden, ohne jedoch an den Entscheidungsprozessen teilzunehmen.
Cosgrove L, Krimsky S. A Comparison of DSM V and DSM 5 Panel Members' Financial Associations with Industry: A Pernicious Problem Persists. PLoS Med 2012;9:e1001190 Volltext
Cosgrove L, Krimsky S, Vijayaraghavan M, Schneider L. Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry. Psychotherapy and Psychosomatics 2006;75:154-60 Abstract
Pressemitteilung der APA 23.7.2007: APA Names DSM-V Task Force Members Download
David Klemperer, 20.5.12
Bis zu 10 Überdiagnosen auf einen durch Früherkennung verhinderten Tod an Brustkrebs
 Durch Brustkrebs-Früherkennungs-Untersuchungen werden 2 Arten von Brustkrebs frühzeitig entdeckt: zum einen Tumoren, die später, nach Auftreten von Beschwerden, diagnostiziert worden wären, zum anderen Tumoren, die sich nie im weiteren Leben bemerkbar gemacht hätten. Letzteres ist dann der Fall, wenn der Tumor nicht soweit wächst, dass er Beschwerden verursacht oder aber wenn die betroffene Frau stirbt, bevor sich der Tumor klinisch bemerkbar macht.
Durch Brustkrebs-Früherkennungs-Untersuchungen werden 2 Arten von Brustkrebs frühzeitig entdeckt: zum einen Tumoren, die später, nach Auftreten von Beschwerden, diagnostiziert worden wären, zum anderen Tumoren, die sich nie im weiteren Leben bemerkbar gemacht hätten. Letzteres ist dann der Fall, wenn der Tumor nicht soweit wächst, dass er Beschwerden verursacht oder aber wenn die betroffene Frau stirbt, bevor sich der Tumor klinisch bemerkbar macht.
Über dieses als Überdiagnose bezeichnete Phänomen haben wir berichtet (Link). Überdiagnose stellt ein gravierendes Problem dar, weil die überdiagnostizierten Tumoren von "normalen" Tumoren bisher nicht unterschieden werden können und somit zur Übertherapie führen. Frauen erhalten überflüssigerweise eine belastende und eingreifende Therapie.
Eine präzise Quantifizierung der Überdiagnose ist methodisch schwierig, weil zeitliche Trends in der Brustkrebsinzidenz berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich tritt bei Neueinführung eines Screening-Programms stets eine Inzidenzerhöhung auf, weil die bislang asymptomatischen Tumoren entdeckt werden. Nach Ablauf der sog. lead time, also der Zeitspanne, um die die Diagnose durch Früherkennung vorverlegt wird, sollte die Inzidenz insgesamt auf das Niveau vor Einführung der Früherkennung zurückgehen, bei älteren Frauen jedoch abnehmen, weil ihre Diagnose durch das Screening ja früher gestellt wurde.
Präzisere Daten können nur Langzeit-Vergleiche einer gescreenten mit einer nicht gescreenten Gruppe im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie erbringen. Von diesen Studien gibt es nur wenige und auch hier treten methodische Probleme auf. So werden auch nicht-randomisierte Formen des Vergleichs durchgeführt mit entsprechend unpräzisen und weit streuenden Ergebnissen - je nach Datengrundlage wird die Überdiagnose bislang auf 0 bis 54% geschätzt.
Genauere und zuverlässigere Ergebnisse erbrachte eine kürzlich veröffentlichte norwegische Studie. Das staatliche Gesundheitssystem mit einem annähernd vollständigen nationalen Krebsregister liefert zuverlässige Diagnosedaten. Da das Brustkrebs-Screening-Programm zwischen 1996 und 2005 schrittweise in die 6 norwegischen Regionen eingeführt wurde, konnte die Brustkrebsinzidenz in den Regionen mit und ohne Screening-Programm verglichen werden. Zusätzlich wurden die zeitlichen Trends erfasst, indem der jeweilige 10-Jahreszeitraum vor Einführung des Screenings mit einbezogen wurde. Dies ist erforderlich, weil auch in den Jahren vor Einführung des Screenings die Inzidenz bereits angestiegen ist, vermutlich infolge erhöhter Aufmerksamkeit und vermehrter Untersuchungen sowie dem starken Anstieg der Hormongabe in den Wechseljahren in den 1990er-Jahren. Die Teilnahme am Screening-Programm ist mit 77% hoch. In den Regionen ohne Screening war die Inanspruchnahme der Mammographie hingegen niedrig.
Die Forscher beschränkten die Untersuchung auf die Inzidenz von invasivem, also die Gewebsgrenzen durchbrechendem Brustkrebs. Nicht betrachtet wurde das sog. duktale Karzinom in situ, ein Tumor in den Milchgängen der weiblichen Brust, der den Milchgang (noch) nicht durchbrochen hat. Auch für diesen Tumor gibt es Überdiagnose, die Forscher wollten jedoch die zwei unterschiedlichen Arten von Brustkrebs nicht vermischen.
In den ersten 10 Jahren des Brustkrebs-Screening-Programms, also von 1996 bis 2005, wurden etwa 500.000 Frauen zur Mammographie eingeladen. Bei 7.793 wurde ein invasiver Brustkrebs diagnostiziert. Unter Berücksichtigung der Inzidenz im Zehnjahreszeitraum vor der Einführung des Programms sowie der Inzidenz in den Regionen, die nach 1995 noch nicht im Programm waren, errechnen die Forscher für die Frauen im Screening-Programm eine Überdiagnose von 15 bis 25%.
Darauf folgt, dass von den 7.793 Frauen mit invasivem Brustkrebs zwischen 1.169 (15% von 7.793) und 1.948 (25% von 7.793) nie die Diagnose erhalten hätten, wenn sie nicht gescreent worden wären, also eine Überdiagnose erhalten haben.
Bezogen auf 2.500 Frauen wird ein Tod an Brustkrebs verhindert, 20 Diagnosen sind keine Überdiagnose und 6 bis 10 sind eine Überdiagnose.
Die Zahlen sind etwas niedriger als frühere Berechnungen aus Norwegen und Dänemark. Dies begründen die Wissenschaftler mit unterschiedlichen Annahmen für die zeitlichen Trends und die lead time (Norwegen) sowie mit der Einbeziehung des duktalen Karzinoms in situ (Dänemark).
Diese Studie stellt einen weiteren deutlichen Beleg für den Sachverhalt dar, dass Krebsfrüherkennung entgegen verbreiteten intuitiven Vorstellungen sowohl Nutzen als auch Schaden bewirken kann. Der Schaden kann erheblich sein. Die Schadensrisiken sollten den Frauen, die zur Screening-Untersuchung eingeladen werden, in aller Klarheit vermittelt werden, fordern die Autoren.
Zu lösen ist das Problem der Überdiagnose allein durch Methoden, mit denen fortschreitende Tumoren von nicht bzw. nur langsam wachsenden Tumoren unterschieden werden können. Diese Methoden gibt es bislang nicht.
In einer Studie, die am 18. April 2012 im Wissenschaftsjournal NATURE erschienen ist, berichten Forscher über die neu geschaffene Unterteilung von Tumoren der weiblichen Brust in 10 nach genetischen Merkmalen definierte Untergruppen. Inwieweit diese genetischen Merkmale eine Prognose über das Wachstumsverhalten erlauben, ist noch nicht bekannt.
Kalager M, Adami H-O, Bretthauer M, Tamimi RM. Overdiagnosis of Invasive Breast Cancer Due to Mammography Screening: Results From the Norwegian Screening Program. Annals of Internal Medicine 2012;156(7):491-99 Abstract
Curtis C, Shah SP, Chin S-F, Turashvili G, Rueda OM, Dunning MJ, et al. The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups. Nature 2012;advance online publication. Abstract
David Klemperer, 21.4.12
Zunehmende Fragwürdigkeit von Cholesterinwerten als Risikofaktoren und der Einnahme von Cholesterinsenkern bei älteren Menschen
 Die Annahme, ein hoher Gesamtcholesterinspiegel oder hohe Werte des "bösen" "Low Density Lipoprotein (LDL)-Cholesterins" in Kombination mit niedrigen Werten des "guten" "High Density Lipoprotein-(HDL)-Cholesterins" seien bedeutende Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Morbidität und -mortalität, führte nicht nur zu Milliarden von Laboruntersuchungen der Cholesterinwerte, sondern auch dazu, dass die Cholesterinsenker, und darunter besonders die Statine zu den Blockbustern der Pharmabranche gehören.
Die Annahme, ein hoher Gesamtcholesterinspiegel oder hohe Werte des "bösen" "Low Density Lipoprotein (LDL)-Cholesterins" in Kombination mit niedrigen Werten des "guten" "High Density Lipoprotein-(HDL)-Cholesterins" seien bedeutende Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Morbidität und -mortalität, führte nicht nur zu Milliarden von Laboruntersuchungen der Cholesterinwerte, sondern auch dazu, dass die Cholesterinsenker, und darunter besonders die Statine zu den Blockbustern der Pharmabranche gehören.
Seit mittlerweile Jahrzehnten stellen aber methodisch hochwertige Studien auch immer wieder die erwarteten negativen Effekte der "zu hohen" Cholesterinspiegel und damit auch den Nutzen von Veränderungen des Lebensstils oder der Ernährung sowie der medikamentösen Behandlung wenigstens für einen Teil der Bevölkerung in Frage.
Bereits 1994 kamen Krumholz et al. in einer prospektiven Kohortenstudie in den USA mit 997 über 70-jährigen TeilnehmerInnen zu folgendem Ergebnis: Die Hypothese, hohe Cholesterinspiegel oder niedrige HDL-Werte seien wichtige Risikofaktoren für die Gesamtsterblichkeit, das Risiko an koronaren Herzerkrankungen zu sterben, wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus zu kommen oder an einer instabilen Angina pectoris zu leiden, wird für Personen dieses Alters eindeutig nicht unterstützt.
Eine im Herbst 2011 veröffentlichte prospektive Kohortenstudie aus den Niederlanden mit 5.750 TeilnehmerInnen im Alter von 55 bis 99 Jahren weist nach einer fast 14 Jahre währenden Untersuchungszeit sogar auf einen möglichen gesundheitlichen Nutzen eines hohen Gesamtcholesterinspiegels hin. So war ein höherer Gesamtcholesterinwert über alle Altersstufen hinweg signifikant mit einem geringeren Risiko assoziiert, an einer nicht-kardiovaskulären Erkrankung (vor allem Krebs) zu sterben. Mit jedem Millimol pro Liter Blut (mmol/L) mehr sank das genannte alters- und geschlechtsadjustierte Sterberisiko um rund 12%. Dabei gab es deutliche altersspezifische Unterschiede: Bei den 65- bis 74-jährigen TeilnehmerInnen sank dieses Risiko mit jedem Millimol/Liter mehr an Gesamtcholesterin ebenfalls um 12%, bei den 75- bis 84-Jährigen um 14% und schließlich bei den 85 Jahre alten und älteren Personen um 20%. Gleichzeitig fanden die holländischen ForscherInnen keine signifikanten Assoziationen zwischen dem Wert des "guten" Cholesterin und der Sterblichkeit an nicht-kardiovaskulären Krankheiten.
In einer zusätzlichen Untersuchung der Zusammenhänge von Cholesterinwerten und der kardiovaskulären Sterblichkeit (vor allem Herzinfarkt und Schlaganfall) zeigte sich nur in einer einzigen Altersgruppe signifikante Zusammenhänge zwischen diesem Risiko und den verschiedenen Cholesterinwerten: Einerseits reduzierte ein Anstieg des Gesamtcholesterinspiegels um 1-Millimol pro Liter bei Personen, die 85 Jahre alt und älter waren, die spezifische Sterblichkeit um 21%. Andererseits senkte aber ein vergleichbarer Anstieg des HDL-Wertes die Herz-Kreislaufmortalität um 59%.
Auch wenn die AutorInnen nach einer kritischen Auseinandersetzung mit anderen Untersuchungen weitere Forschungen über den genauen Mechanismus der identifizierten Assoziationen für notwendig halten, sprechen ihre Ergebnisse für zweierlei: Zumindest für über 55- oder 65-Jährige müssen hohe Gesamtcholesterin- und LDL-Werte entdramatisiert werden und positive Erwartungen an hohe HDL- oder niedrige LDL-Werte eingeschränkt werden. Der Nutzen der Einnahme von Cholesterinsenkern bei ansonsten gesunden Angehörigen dieser Altersgruppen und besonders bei hochaltrigen Personen über 80 Jahren sollte schließlich gründlich überlegt werden.
Zum Aufsatz "Lack of association between cholesterol and coronary heart disease mortality and morbidity and all-cause mortality in persons older than 70 years" von Krumholz HM, Seeman TE, Merrill SS, Mendes de Leon CF, Vaccarino V, Silverman DI, Tsukahara R, Ostfeld AM und Berkman LF. in "JAMA" (1994 Nov 2; 272(17): 1335-40) gibt es kostenlos das Abstract.
Zum Aufsatz "Association between serum cholesterol and noncardiovascular mortality in older age" von Newson RS, Felix JF, Heeringa J, Hofman A, Witteman JC und Tiemeier H., veröffentlicht im "Journal of American Geriatric Society" (2011; 59 (10): 1779-85) gibt es kostenlos ebenfalls das Abstract.
Bernard Braun, 2.4.12
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) mit Krankenhausaufenthalt beruhen zu 67% auf Effekten von vier Arzneimitttelgruppen
 In den USA nehmen 40% der 65 Jahre alten und älteren BürgerInnen regelmäßig und gleichzeitig 5 bis 9 unterschiedliche Arzneimittel und 18% sogar10 und mehr. Die Einnahme von 5 und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln wird in Fachkreisen als Polypharmazie bezeichnet, die mit mehreren gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dazu gehört, dass mit der Anzahl unterschiedlicher Mittel die Therapietreue, d.h. die Einnahme der korrekten Menge zum richtigen Zeitpunkt, abnimmt und unerwünschte Wechselwirkungen auftreten können. Bei älteren Menschen modifizieren außerdem physiologische Veränderungen die Pharmakokinetik und -dynamik in unkalkulierbarem Umfang.
In den USA nehmen 40% der 65 Jahre alten und älteren BürgerInnen regelmäßig und gleichzeitig 5 bis 9 unterschiedliche Arzneimittel und 18% sogar10 und mehr. Die Einnahme von 5 und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln wird in Fachkreisen als Polypharmazie bezeichnet, die mit mehreren gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dazu gehört, dass mit der Anzahl unterschiedlicher Mittel die Therapietreue, d.h. die Einnahme der korrekten Menge zum richtigen Zeitpunkt, abnimmt und unerwünschte Wechselwirkungen auftreten können. Bei älteren Menschen modifizieren außerdem physiologische Veränderungen die Pharmakokinetik und -dynamik in unkalkulierbarem Umfang.
Eine ForscherInnengruppe untersuchte nun mit den USA-repräsentativen Daten des "National Electronic Injury Surveillance System-Cooperative Adverse Drug Event Surveillance Project" für die Jahre 2007 bis 2009, wie viele unerwünschte Polypharmaziefolgen in Gestalt von Notfällen in Krankenhäuser es bei 65+-Personen gab und was die wichtigsten Ursachen waren.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• In jedem der drei Jahre gab es schätzungsweise und im Durchschnitt 99.628 Notfalleinweisungen und -aufenthalte in Krankenhäusern wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Damit gab es mehr oder vergleichbar viele Krankenhaus-Fälle wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen als für Delirium, Demenz sowie Hautinfektionen.
• 48,1% dieser Notfälle passierten bei 80+-Personen. Die arzneimittelassoziierte Einweisungsrate in Krankenhäuser war bei 85+-Personen 3,5 mal so hoch wie bei den 65- bis 69-Jährigen. Die Rate bei den hochbetagten Personen blieb auch unabhängig von der Anzahl der Einnahme unterschiedlicher Arzneimittel gegenüber der Rate bei jüngeren Personen signifikant erhöht.
• Wenn aus einem notwendigen Besuch einer Notfallstation eine Einweisung in das Krankenhaus wurde, lag dies vor allem an der unbeabsichtigten Einnahme einer Überdosis (65,7% versus 45,7%) und war dann notwendig, wenn der Patient 5 oder mehr unterschiedliche Arzneimittel eingenommen hatte (54,8% versus 39,9%).
• 65,7% aller Krankenhauseinweisungen waren wegen der unbeabsichtigten Überdosierung eines Arzneimittels notwendig gewesen.
• 67% aller Einweisungen beruhten auf unerwünschten Wirkungen der Einnahme eines oder mehrerer Arzneimittel aus einer Gruppe von weit verbreiteten und von jedem Arzt häufig verordneten Standardarzneimitteln: Warfarin, ein blutverflüssigendes Arzneimittel, das in Deutschland als Marcumar im Einsatz ist (33,3% aller medikamentenbedingten Notfälle). Insulin (13,9%), orale Thrombozytenaggregationshemmer wie z.B. ASS, Clodioprogrel (13,3%) und orale hypoglykämische Medikamente bei Diabetes mellitus Typ 2 wie z.B. Sulfonylharnstoffe (10,7%). Risikoreiche und auch oft nicht so häufig verordnete Arzneimittel waren dagegen wider Erwartungen nur bei 1,2% der Krankenhauseinweisungen wegen einer unerwünschten Arzneimittelwirkung beteiligt.
Wer die Arzneimittelsicherheit für ältere Menschen spür- und messbar verbessern will, braucht sich nach den Ergebnissen dieser Studie nicht mit Vorrang, allein oder zunächst mit der möglicherweise sehr komplexen und komplizierten Wirk- und Nebenwirkweise zahlreicher riskanter Arzneimittel beschäftigen. Er oder sie kann und sollte sich auf eine Verbesserung des Managements und des Umgangs mit antithrombotischen und antidiabetischen Arzneimitteln konzentrieren, die in den USA 67% der insgesamt rund 66.000 unerwünschten stationär behandelten Notfälle bedingen. Dies ist umso wichtiger, weil die genannten Arzneimittelgruppen meist gegen chronische Erkrankungen und damit über lange Zeiten eingesetzt werden, d.h. das Risiko langsam aber sicher steigt.
Dazu sollte sicherlich noch genauer untersucht werden, welche Wirkungen im Zusammenhang mit diesen Arzneimittelgruppen auftreten und ob sie auf fehlende oder gar fehlerhafte Erklärungen des Arztes oder auch des Apothekers zum Medikament beruhen oder ob die PatientInnen etwas durcheinander bringen bzw. mangels besseren Wissens etwas falsch machen.
Der Aufsatz "Emergency Hospitalizations for Adverse Drug Events in Older Americans" von Daniel S. Budnitz et al. ist im November 2011 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" erschienen. Er ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.2.12
Es werde Licht - Transparenzregelungen in den USA werden konkretisiert
 Licht ins Dunkle der Beziehungen zwischen Ärzten und Industrie sollen Regelungen bringen, die als Teil der US-amerikanischen Gesundheitsreform im Jahr 2009 verabschiedet wurden.
Licht ins Dunkle der Beziehungen zwischen Ärzten und Industrie sollen Regelungen bringen, die als Teil der US-amerikanischen Gesundheitsreform im Jahr 2009 verabschiedet wurden.
Der Patient Protection and Affordable enthält einen Teil Physician Payment Sunshine Provision. Darin ist grundsätzlich festgelegt, dass Zuwendungen der pharmazeutischen Industrie und der Geräteindustrie an Ärzte zu melden und in einer Datenbank zu veröffentlichen sind. Am 19.12.2011 haben die Centers for Medicare & Medicaid Services als zuständige Stelle einen 32-seitigen Vorschlag für die konkrete Umsetzung veröffentlicht.
Transparenz-Berichte ("transparency reports") sollen ab September 2013 auf einer öffentlichen Website veröffentlicht werden. Betroffen auf Seite der Gebenden sind alle Firmen, die Medikamente oder Medizinprodukte herstellen, die von Medicare bzw. Medicaid / Children's Health Insurance Program finanziert werden. Die Firmen haben alle Zahlungen und Zuwendungen an Ärzte und an "teaching hospitals" zu melden, worunter solche Krankenhäuser zu verstehen sind, die Zahlungen von Medicaid für Fortbildungszwecke erhalten. Darüber hinaus müssen Firmen die Ärzte melden, die Besitzer Firmenanteilen besitzen oder in die Firma investiert haben.
Die Industrie muss alle Beträge ab 10 Dollar melden. Summieren sich Beträge von weniger als 10 Dollar von einer Firma an einen Arzt pro Jahr auf mehr als 100 Dollar, ist auch dies zu melden. Zu melden ist auch das Arzneimittel bzw. das Medizinprodukt, auf das sich die Zahlung bezieht.
Auch indirekte Zuwendungen sind zu melden, wenn sie letzten Endes Ärzten zugute kommen, so Zahlungen an medizinische Fachgesellschaften, Auftragsforschungsinstitute und Firmen, die ärztliche Fortbildung anbieten.
Um eine eindeutige Identifikation der Ärzte zu gewährleisten, werden sie nach ihrer Nationalen Arztnummer (National Provider Identifier) gelistet.
Als Anforderungen an die Datenbank gilt, dass sie durchsuchbar sowie klar und verständlich sein muss. Die Daten müssen ohne Mühe aggregierbar und herunterzuladen sein.
Die Veröffentlichung von Zahlungen darf bis zur Zulassung des betroffenen Produktes oder maximal 4 Jahre hinausgeschoben werden, wenn es die Geschäftsinteressen der Firma schädigen würde. Dessen unbenommen, müssen die Zahlungen aber gemeldet werden.
Bevor die gemeldeten Daten veröffentlicht werden, stehen sie den Firmen und Ärzten 45 Tage zur Stellungnahme und Korrektur zur Verfügung.
Die zu meldenden Daten sollten ursprünglich ab 1.1.2012 gesammelt, am 31.3.2013 erstmals übermittelt und am 1.9.2013 erstmals veröffentlicht werden. Daten, die vor erscheinen der Endversion der Regelungen anfallen, werden die Firmen jedoch nicht übermitteln müssen..
Stellungnahmen zu diesem Vorschlag der Centers for Medicare & Medicaid Services sind bis zum 17.2.2012 möglich. Die Endversion wird Mitte 2012 erwartet.
Centers for Medicare & Medicaid Services. Transparency Reports and Reporting of Physician Ownership or Investment Interests Download
Physician Payment Sunshine Provision Download Gesetzestext
"Transparency Reports" on Industry Payments to Physicians and Teaching Hospitals. Journal of the American Medical Association. Online first 14.2.2012 Volltext
Patient Protection and Affordable Care Act Download Volltext
Forum-Beitrag zum Gesamtpaket der amerikanischen Gesundheitsreform Link
David Klemperer, 16.2.12
"Tamiflu III": Warum ein Review auf Daten von 68% der durchgeführten Studien zum Grippe-Blockbuster verzichten muss?
 Wäre das Ganze ein Hollywoodfilm, finge spätestens jetzt die Kritik an von einem überzogenen, tendenziösen oder ideologischen Plot von notorischen Pharmagegnern und Halbwissenschaftlern zu reden. Das sprachlich etwas sperrige "Drehbuch" zur jüngsten Inszenierung des Themas "Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children" stammt aber weder aus Hollywood noch von dortigen Drehbuchschreibern, sondern von Mitgliedern der "Cochrane Acute Respiratory Infections Group" u.a. aus Rom (dort arbeitet der Leiter der Gruppe, Tom Jefferson). Auch wenn manche Aspekte filmreif sind, gibt es keine Bilder, sondern 217 ausnahmsweise frei zugängliche Seiten des neuesten, am 18. Januar 2012 veröffentlichten Band der "Cochrane Library". Wer mehr und fundiertere Informationen zum Thema vorsätzlicher Blockaden von Erkenntnissen über den Nutzen und die Wirksamkeit von Medikamenten durch Pharmakonzerne sucht, wird hier umfassend fündig.
Wäre das Ganze ein Hollywoodfilm, finge spätestens jetzt die Kritik an von einem überzogenen, tendenziösen oder ideologischen Plot von notorischen Pharmagegnern und Halbwissenschaftlern zu reden. Das sprachlich etwas sperrige "Drehbuch" zur jüngsten Inszenierung des Themas "Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children" stammt aber weder aus Hollywood noch von dortigen Drehbuchschreibern, sondern von Mitgliedern der "Cochrane Acute Respiratory Infections Group" u.a. aus Rom (dort arbeitet der Leiter der Gruppe, Tom Jefferson). Auch wenn manche Aspekte filmreif sind, gibt es keine Bilder, sondern 217 ausnahmsweise frei zugängliche Seiten des neuesten, am 18. Januar 2012 veröffentlichten Band der "Cochrane Library". Wer mehr und fundiertere Informationen zum Thema vorsätzlicher Blockaden von Erkenntnissen über den Nutzen und die Wirksamkeit von Medikamenten durch Pharmakonzerne sucht, wird hier umfassend fündig.
Sachlich geht es um die Enzymfamilie der Neuraminidase, die Wirkstoffe Oseltamivir (Roche) und Zanamivir (GlaxoSmithKline) sowie das von der Firma Roche produzierte Medikament Tamiflu. Spätestens seit der vermeintlich Millionen von Menschen tödlich bedrohenden Schweinegrippe-Pandemie wurde vor allem Tamiflu als "das" Wundermittel zur Prävention und Kuration dieser und anderer Grippeerkrankungen propagiert, was die öffentlichen Arzneimittel-Vorratslager für den Ernstfall füllte und der Firma einen kräftigen Gewinn bescherte.
Bereits früh meldeten Virologen wie T. Jefferson und Gesundheitswissenschaftler Zweifel an der Wirksamkeit und der Seriosität bzw. Korruptionsfreiheit der unverhohlenen Empfehlungen des Präparats durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und nationale Public Health-Institutionen sowie Gesundheitsministerien an.
Zu den Highlights dieser Phase ("Tamiflu I und II") gehörte
• das hartnäckige Ignorieren der Bitten von Cochrane-Reviewern nach mehr Informationen über einige der schon damals bekannten unveröffentlichten Studien und Primärdaten. Die methodisch versierten Anfrager wurden mit Tabellen vertröstet und durch Ankündigungen von mehr Transparenz ruhig zu stellen versucht, die nach dem bekannten Veröffentlichungstermin im seriösen "British Medical Journal (BMJ)" lagen. Von den versprochenen, frei zugänglichen Daten war und ist "natürlich" nichts zu sehen.
• die Tatsache, dass einige Experten, die an den offiziellen Empfehlungen der WHO zugunsten des Wirkstoffs und von Tamiflu mitwirkten, mehr oder weniger üppig bezahlt mit der Firma Roche zusammengearbeitet hatte oder sonstige finanzielle Vorteile genossen hatte. Der Skandal im Skandal: Die betreffenden Wissenschaftler hatten diese Interessenkonflikte offen der WHO gemeldet, was diese aber nicht davon abhielt, sie genau zum Einsatz von Tamiflu weiter als Berater und Empfehlungsgeber agieren zu lassen. Wer mehr über diese vergangenen Höhepunkte erinnern oder erfahren will, kann dies mit einem umfangreichen Beitrag im Forum-Gesundheitspolitik beginnen.
Der aktuelle Höhepunkt ist durch eine mindestens bis zum April 2011 (dem Redaktionsschluss für den jetzt veröffentlichten Cochrane Review) anhaltende Informationsvernebelung und -blockade vor allem des Tamifluherstellers Roche geprägt. Dass aber die Studientransparenz auch nach dem April 2011 nicht besser wurde, sei der Vollständigkeit halber festgehalten. Schon früh hatten die Reviewer den Eindruck, dass es einen enormen so genannten "publication bias" und in der Folge einen "reporting bias" vor allem durch nicht veröffentlichte Studien gab. So waren und sind 60% aller Patientendaten aus Phase III-Studien zur Wirksamkeit der Behandlung mit Oseltamivir nicht veröffentlicht. Dies und weitere Funde veranlassten die Reviewer zum Background der aktuellen Version ihres Reviews zu folgender deprimierenden Äußerung: "Our confidence in the conclusions of previous versions of this review has been subsequently undermined."
Trotz zahlreicher Versuche (darunter zwischen Juni 2010 und Februar 2011 fünf offizielle Bitten an die Firma Roche), möglichst viele Studienergebnisse berücksichtigen und bewerten zu können und dann evtl. eine Metaanalyse durchführen zu können und trotz der Veröffentlichung einer ersten, weitgehend resonanzfreien kritischen Bewertung im Dezember 2010, konnten die WissenschaftlerInnen 42 ihnen bekannte Studien nicht berücksichtigen und mussten sich auf "nur" 25, sämtlich von den Herstellern finanzierte Studien (darunter 15 Oseltamivir-Studien) stützen.
Trotz der relativen kleinen und methodisch dazu noch oft eingeschränkten Basis von 38% der bekannten Studien, kommt der Review zu mehreren wichtigen Ergebnissen:
• Die Wirkstoffe verkürzen gegenüber Placebos statistisch signifikant die symptomreiche Leidenszeit nach dem Eintritt der Erkrankung um 21 Stunden.
• Für positive Effekte auf die Häufigkeit einer Krankenhauseinweisung und -"behandlung liefern die Studien keinerlei signifikanten Beleg.
• Ob Oseltamivir in der Lage ist, Komplikationen einer Grippeerkrankung zu verhindern, konnte angesichts der Materiallage nicht bewertet werden
• In einer nachträglichen Zusatzanalyse zeigte sich bei Angehörigen der Interventionsgruppe eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit, als grippekrank diagnostiziert zu werden. Hier wie an anderen inhaltlich unklaren Punkten sind auch die durchweg sachkundigen Reviewer unsicher oder zur Spekulation gezwungen. Wer oder was hier helfen könnte, sagen sie dann aber auch: "We expect full clinical study reports containing study protocol, reporting analysis plan, statistical analysis plan and individual patient data to clarify outstanding issues. These full clinical study reports are at present unavailable to us."
• Auf die längst überfällige und auch für die öffentliche Gesundheit und die Finanzen der Krankenversicherungen und Staaten notwendige Metaanalyse verzichten die Reviewer angesichts der systematischen Entöffentlichung von 62% der durchgeführten Untersuchungen.
• Um die offensichtlich permanente Informationsblockade von Roche und möglichen Nachahmern umgehen zu können, überlegen Jefferson et al. sich künftig stärker auf Materialien zu stützen, die den staatlichen Zulassungsbehörden (in den USA die "US Food and Drug Administration (FDA)") von den Herstellern zur Verfügung gestellt und von ihnen auch häufig umfangreich kommentiert werden. Ob diese zum Teil sehr umfangreichen "clinical study reports" und "regulatory informations" aber wirklich für Metaanalysen genutzt werden können und möglicherweise deren Ergebnisse unkontrollierbar verändern, wird in den Reihen der Cochrane Collaboration intensiver als in der Vergangenheit diskutiert werden.
Der komplett 217 Seiten umfassende Cochrane-Intervention Review "Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children" von Jefferson T, Jones MA, Doshi P, Del Mar CB, Heneghan CJ, Hama R und Thompson MJ. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1) ist kostenlos erhältlich.
Das Editorial Neuraminidase inhibitors for influenza: methods change, principles don't von Lasserson T, Tovey D. ist ebefalls kostenlos erhältlich. Es beschäftigt sich vor allem mit der Frage der von Roche und möglichen Nachahmern betriebenen Informationsblockade, der Gefahr von Publikations-Verzerrungen und der Vor- und Nachteile des Ausweichens auf Materialien der Zulassungsbehörden. Zu den Schlüsselprinzipien der Cochrane Collaboration, die sich nicht ändern sollen,zählt "to identify and minimise bias".
Erste Reaktionen der Firma Roche (Tenor: Das stimmt alles nicht) können Serienfreunde freudig stimmen: "Tamiflu IV" wird kommen!!
Bernard Braun, 20.1.12
Avastin bei Eierstockkrebs: Länger leben ohne Krankheitsverschlimmerung aber mit Nebenwirkungen und insgesamt nicht länger!?
 Während der Pharmakonzern Roche pünktlich vor Weihnachten 2011 von der "European Medicines Agency (EMA)" die Zulassung ihres Medikaments Avastin für die Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt, zögert das us-amerikanische Tochterunternehmen Genentech nach einem Gespräch mit der US-Zulassungsbehörde "Food and Drug Administration (FDA)" und dem Vorliegen zweier von ihr mitfinanzierten Studien, die Zulassung in den USA aktiv zu betreiben. Unter der Überschrift "Avastin Disappoints Against Ovarian Cancer" zitiert die Nachrichtenagentur "Associated Press" jedenfalls am 28. Dezember 2011 unwidersprochen einen Sprecher der Firma so: "We do not believe the data will support approval".
Während der Pharmakonzern Roche pünktlich vor Weihnachten 2011 von der "European Medicines Agency (EMA)" die Zulassung ihres Medikaments Avastin für die Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt, zögert das us-amerikanische Tochterunternehmen Genentech nach einem Gespräch mit der US-Zulassungsbehörde "Food and Drug Administration (FDA)" und dem Vorliegen zweier von ihr mitfinanzierten Studien, die Zulassung in den USA aktiv zu betreiben. Unter der Überschrift "Avastin Disappoints Against Ovarian Cancer" zitiert die Nachrichtenagentur "Associated Press" jedenfalls am 28. Dezember 2011 unwidersprochen einen Sprecher der Firma so: "We do not believe the data will support approval".
Die Zulassung und Verordnung des Krebsmedikaments Avastin zur Behandlung unterschiedlicher Krebsarten entwickelt sich somit in kürzester Zeit zu einem Lehrstück über verschiedene interregionale Besonderheiten und Probleme der Arzneimittelzulassung und die unterschiedliche Bewertung des Nutzens solcher mit großen Heilungserwartungen entwickelten und vermarkteten Medikamente.
Über den ersten dramatischen Akt dieses Lehrstücks im Bereich der Behandlung von metastasierten Brustkrebs berichteten wir im "forum-gesundheitspolitik" bereits ausführlich. Nach langer fachlicher Debatte zog die FDA für die USA die Anerkennung von Avastin als dafür geeignetes Arzneimittel mit der offiziellen Begründung zurück: "There is no benefit to breast cancer patients that would justify its risks." Trotzdem ist Avastin in Europa auch weiter für die Behandlung von Brustkrebspatientinnen zugelassen.
Im zweiten, wiederum überwiegend in den USA spielenden Akt, verschließen selbst die Hersteller des Medikaments nicht ihre Augen vor den Ergebnissen zweier am 29. Dezember 2011 im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichten und von ihnen mitfinanzierten Studien über die empirischen gesundheitlichen Effekte einer Behandlung von Eierstockkrebs mit Avastin.
Man unterscheidet dabei zwei Wirkungen: Um wieviel die progressionsfreie, d.h. ohne Verschlimmerung der Erkrankung erlebbare Zeit verlängert und um wieviel Wochen, Monate oder auch Jahre das Gesamtüberleben nach dem Erstauftritt der Erkrankung verlängert wird. In beiden Fällen muss abgewogen werden, welche zusätzlichen gesundheitlichen Risiken oder gravierenden Nebenwirkungen mit der Einnahme des Medikaments verbunden sind und möglicherweise die sonstige Lebensqualität gewaltig verschlechtern.
Die doppelblinde, placebokontrollierte Studie von Burger et al. mit 1.873 teilnehmenden Frauen mit Eierstockkrebs untersuchte als primären Endpunkt ihrer Intervention das progressionsfreie Überleben durch das während der Chemotherapie und den 10 Monaten nach ihrer Beendigung eingenommene Avastin.
Das Ergebnis weist für die mit einer Standardchemotherapie und einem Placebo behandelte Kontrollgruppe von Partientinnen 10,3 Monate progressionsfreies Überleben nach. In der Gruppe, die zu allen Zeitpunkten ihrer Behandlung Avastin erhielt, betrug diese Zeit 14,1 Monate. Avastin verlängerte also wahrscheinlich diese Art des Überlebens um 4 Monate. Auf der Schattenseite war die Rate derjenigen Angehörigen der Avastin-Gruppe, die sich wegen höheren Blutdrucks und schweren Magen-/Darmstörungen behandeln lassen mussten, signifikant höher als in der Kontrollgruppe.
Auch in der zweiten Studie (Perren et al.) mit 1.528 Frauen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung ihrer Eierstöcke von wurde primär die Verlängerung des progressionsfreien Lebens untersucht. 36 Monate nach Beginn der Therapie fanden die ForscherInnen in der Kontrollgruppe mit Chemotherapie und ohne Avastin ein progressionsfreies Überleben von 20,3 Monaten und von 21,8 Monaten in der Avastin-Gruppe. Der Unterschied war statistisch signifikant. In einer zusätzlichen Analyse nach 42 Monaten betrug das progressionsfreie Überleben in der Kontrollgruppe 22,4 Monate und lag in der Avastingruppe bei 24,1 Monate. Auch wenn sich die Abstände der progressionsfreien Zeiten zwischen den beiden Gruppen gegenüber der ersten Studie verringert hatten, war der Unterschied immer noch statistisch signifikant. Zu den letztlich nicht eindeutig kausal zu klärenden Beobachtungen dieser Studie gehört, dass die Wirkung von Avastin, das progressionsfreie Überleben zu verlängern, nicht zu jedem Zeitpunkt der Studie existierte. Während die Wirkung nach 12 Monaten der Intervention eindeutig auftrat, war sie nach 24 Monaten so schwach, dass die Chance des progressionsfreien Überlebens für die Nutzerinnen der Standardtherapiegruppe sogar leicht höher war.
Auch bei den Teilnehmerinnen dieser Studie traten eine Reihe der bereits genannten Art in schwerem Maße wie z.B. schwerer Bluthochdruck auf.
Auch wenn beide ForscherInnen-Gruppen nicht das Gesamtüberleben als primären Endpunkt der Avastin-Intervention untersuchten bzw. Burger et al. sogar während der laufenden Studie auf diesen Endpunkt zugunsten des progressionsfreien Überlebens verzichteten, muss man auf gesicherte Daten darüber, ob Avastin das Gesamtüberleben verlängert bei Perren et al. noch bis 2013 warten. Burger et al. liefern eher nebenbei einige Daten, die belegen, dass Avastin die Chance, die Erkrankung insgesamt zu überleben, nicht erhöht bzw. Unterschiede nicht signifikant sind. Angehörige der Placebo-Kontrollgruppe überlebten danach 39,3 Monate, die nur zeitweise mit Avastin behandelten Frauen 38,7 Monate und die in der gesamten Behandlungszeit auch mit Avastin behandelten Frauen 39,7 Monate. Wenn also eine Behandlung mit Avastin überhaupt das Gesamtüberleben verlängert, ist der maximale Lebensgewinn 12 Tage.
Das Lehrstückhafte der aktuellen Debatten über und Entscheidungen zu Avastin besteht u.E. darin; dass sich in diesem Zusammenhang nicht zum ersten Mal einige bedeutende und schwierige Fragen aufdrängen: Was ist der Grund für die beträchtlichen Bewertungsunterschiede des Nutzens von bestimmten Therapien zwischen europäischen und us-amerikanischen Arzneimittel-Zulassungsinstitutionen? Warum bewerten die europäischen Experten die Studienlage, die z.B. in den USA zu einem einstimmigen Urteil über den mangelnden Nutzen von Avastin zur Brustkrebsbehandlung beigetragen hat, völlig anders? Warum freuen sich Vertreter des Herstellers Roche auf der Grundlage ein- und desselben Wissens über die Zulassung von Avastin zur Eierstockkrebstherapie in Europa und scheuen andere Vertreter des Unternehmens in den USA davor zurück, das Mittel dort für diese Indikation zuzulassen? In beiden Ländern generiert ein Jahr Behandlung mit Avastin im Übrigen einen Umsatz von rund 100.000 US-Dollar.
Noch drängender sind Fragen, wie im Rahmen der "evidence-based-medicine"-Orientierung neben der wissenschaftlichen Evidenz für den Nutzen einer Behandlung gleichrangig die "patient values" aussehen bzw. erfasst werden können: Welche "Überlebens"-Variante ist aus Sicht der Kranken wichtiger: die möglichst lange Zeit der Nichtverschlimmerung oder des Nichtwiederauftretens einer Erkrankung nach ihrem ersten Auftreten oder das möglichst lange Überleben der Erkrankung? Bei welchen Größenordnungen (z.B. wenige Monate und wenige Tage) von positiven Wirkungen im Bereich des progressionsfreien oder Gesamtüberlebens nehmen PatientInnen das Risiko von schweren Nebenwirkungen in Kauf und ist die Therapie mit Mitteln wie Avastin aus Patientensicht gerechtfertigt? Ist die Annahme, Kranke griffen zu jedem "Strohhalm", der ihnen Hilfe verspricht, "koste es, was es wolle", wirklich realistisch
Antworten erhält man darauf mit Sicherheit nicht mit noch so aufwändigen "hazard of death"-, "Was-wäre-wenn"- oder Survival-Analysen, sondern wahrscheinlich nur durch qualitative Studien, in denen die letztlich entscheidenden Wahrnehmungen, Entscheidungskalküle und Erfahrungen der betreffenden Patientinnen ernst genommen und systematisch erhoben werden.
Von den am 29. Dezember 2011 veröffentlichten Studien "Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer" von Robert A. Burger et al. (New England Journal of Medicine 2011; 365: 2473-2483) und "A Phase 3 Trial of Bevacizumab in Ovarian Cancer" von Timothy J. Perren et al. (New England Journal of Medicine 2011; 365: 2484-2496) sind Abstracts erhältlich.
Bernard Braun, 6.1.12
Nackenschmerzen? Es muss nicht immer ein nichtsteroidales Antirheumatikum sein: Anderes ist mehr!
 An Nackenschmerzen leiden ca. 70% aller Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens. Umso verwunderlicher ist der Mangel an Untersuchungen, die bei der Wahl von Therapien gegen das akute oder auch bereits chronische Auftreten dieser Schmerzen Entscheidungshilfen liefern können. Vielfach greifen daher Ärzte und Patienten zu den symptomatisch meist wirksamen nichtsteroidalen Antirheumatika - Schmerzmittel mit entzündungshemmender Zusatzwirkung.
An Nackenschmerzen leiden ca. 70% aller Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens. Umso verwunderlicher ist der Mangel an Untersuchungen, die bei der Wahl von Therapien gegen das akute oder auch bereits chronische Auftreten dieser Schmerzen Entscheidungshilfen liefern können. Vielfach greifen daher Ärzte und Patienten zu den symptomatisch meist wirksamen nichtsteroidalen Antirheumatika - Schmerzmittel mit entzündungshemmender Zusatzwirkung.
Dass es auch anders und ohne die nicht seltenen und mehr oder weniger schweren Nebenwirkungen dieser Arzneimittel geht, unterstreicht nun eine Studie, welche die Wirkung einer jeweils zwölfwöchigen Behandlung mit diesen Arzneimitteln mit der von chiropraktischen Interventionen im Bereich der Wirbelsäule und des Rückens und häuslichen körperlichen Übungen (vorbereitet in zwei externen Übungsterminen) vergleicht.
Die Studie wurde bei 272 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt, die zwischen 2 und 12 Wochen an unspezifischen Nackenschmerzen litten. Der primäre Endpunkt zur Beurteilung der Wirksamkeit war das Auftreten von Schmerzen nach 2, 4, 8, 12, 26 und 52 Wochen nach der Aufteilung der StudienteilnehmerInnen auf die Interventionsgruppen. Zusätzlich wurden als sekundärer Outcome u.a. die Lebensqualität, der Grad der Behinderung und die Beweglichkeit des Nackens an verschiedenen Zeitpunkten gemessen.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Die chiropraktische Intervention hatte fast zu jedem Zeitpunkt nach Beginn der UIntervention einen statistisch signifikanten Vorteil gegenüber der Behandlung mit den genannten Arzneimitteln.
• Auch die Wirksamkeit der häuslichen Gymnastik war gegenüber der von Arzneimitteln zumindest nach 26 Wochen statistisch signifikant besser.
• Bei der Wirksamkeit gegen Schmerzen gab es zu keinem Zeitpunkt wichtige Unterschiede zwischen den chiropraktischen und eigenaktiven Interventionen.
• Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den verschiedenen Merkmalen des sekundären Outcomes der Interventionen.
Egal, ob man sich immer noch lieber in die Hände von Experten, d.h. hier in die von ChiropraktikerInnen begibt oder die Therapie doch gut vorbereitet in die eigenen Hände nimmt, sind die Effekte auf Nackenschmerzen und sonstige gesundheitliche Merkmale stärker als die der entzündungshemmenden Schmerzmittel. Die wenigen von den AutorInnen eingeräumten Grenzen ihrer Studie (z.B. keine Verblindung der Interventionsformen) ändern an dieser grundsätzlichen Erkenntnis nichts.
Der am 3. Januar 2012 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (vol. 156 no. 1 Part 1: 1-10) erschienene Aufsatz "Spinal Manipulation, Medication, or Home Exercise With Advice for Acute and Subacute Neck Pain. A Randomized Trial" von Gert Bronfort et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.1.12
Als ob es nicht bereits genug multiresistente Krankheitserreger gäbe: Breitband-Antibiotika gegen Erkältungen boomen in den USA.
 Winterzeit ist Erkältungszeit und damit auch Antibiotika-Verordnungszeit. Und da auch Krankheitskeimen sich global verbreiten, verbreiten sich erwünschte aber auch unerwünschte Effekte unangebrachter Behandlungen rasch in den Erdteilen und Regionen mit hohem Mobilitätspotential. Was also in den USA im Bereich der Verordnung von Antibiotika passiert und welche besonderen Problematiken dabei auftreten, ist daher auch für die künftige Entwicklung in Deutschland relevant (siehe zur Situation in Deutschland u.a. eine mit zahlreichen Hintergrundinformationen angereicherte regionale Studie aus dem letzten Jahr.
Winterzeit ist Erkältungszeit und damit auch Antibiotika-Verordnungszeit. Und da auch Krankheitskeimen sich global verbreiten, verbreiten sich erwünschte aber auch unerwünschte Effekte unangebrachter Behandlungen rasch in den Erdteilen und Regionen mit hohem Mobilitätspotential. Was also in den USA im Bereich der Verordnung von Antibiotika passiert und welche besonderen Problematiken dabei auftreten, ist daher auch für die künftige Entwicklung in Deutschland relevant (siehe zur Situation in Deutschland u.a. eine mit zahlreichen Hintergrundinformationen angereicherte regionale Studie aus dem letzten Jahr.
Was in den USA im Bereich der Verordnung von Antibiotika aktuell passiert zeigt eine aktuelle Auswertung der Diagnose- und Verordnungsdaten einer national repräsentativen Stichprobe aus den "National Ambulatory and National Hospital Ambulatory Medical Care Surveys" von mehr als 60.000 Besuchen von Jugendlichen und Kindern unter 18 Jahren in ambulanten Kinderarztpraxen in den Jahren 2006 bis 2008. Das besondere Augenmerk lag dabei auf den Verordnungen von Antibiotika und den Besuchsanlässen oder Diagnosen, die ihnen zugrundelagen.
Zu den wesentlichen Funden gehören:
• Am Ende von 21% aller Arztbesuche wurden Antibiotika verordnet.
• Mehr als 70% der Arztbesuche an deren Ende die Verordnung von Antibiotika oder Breitband-Antibiotika stand, erfolgten wegen einer Infektion der oberen Atemwege.
• 23% aller Arztbesuche, die mit der Verordung von Antibiotika endeten, erfolgten wegen akuten Infektionen der oberen Atemwege, bei denen Antibiotika meistens nicht angebracht gewesen waren. Dabei handelt es sich um mehr als 10 Millionen Arztbesuche pro Jahr.
• Bei der Hälfte der Arztbesuche, die mit einer Antibiotika-Verordnung abgeschlossen wurden, wurde ein Breitband-Antibiotika verordnet, das in den meisten Fällen nicht angemessen war und aufgrund seiner breiten Wirkung auch besonders breite unerwünschte Effekte hatte. Das Paradoxe ist: Mit der schrottschussartigen Verordnung von Breitband-Antibiotika versuchen die Ärzte einerseits den vermuteten Resistenzen vieler Bakterien gegen einfache Antibiotika auszuweichen. Andererseits forcieren sie mit der häufigen aber nicht notwendigen und unwirksamen Verordnung von Breitband-Antibiotika bei den überwiegend durch Viren verursachten Atemwegserkrankungen erst recht Resistenzbildungen bei einer Vielzahl von Erregern.
• Multivariate Analysen zeigen, dass die "Chance" der Verordnung von Breitband-Antibiotika u.a. im Süden der USA, bei privat Krankenversicherten und jüngeren PatientInnen am größten ist.
Zu dem am 1. Dezember 2011 in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (Vol. 128 No. 6: 1053 -1061) veröffentlichten Aufsatz "Antibiotic Prescribing in Ambulatory Pediatrics in the United States" von Adam L. Hersh, Daniel J. Shapiro, Andrew T. Pavia und Samir S. Shah gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 12.12.11
96,4% des in NRW untersuchten Mastgeflügels mit Antibiotika behandelt. Nie erfolgte dies in Kleinbetrieben mit längerer Mastdauer.
 Auch wenn jetzt der öffentliche Aufschrei auf einen am 14. November 2011 veröffentlichten Bericht des NRW-Verbraucherschutzministeriums groß ist und eigentlich alle Beteiligten, Verantwortlichen und Betroffenen "rasche und entschiedene Maßnahmen" fordern: Das Problem des Antibiotika-Einsatzes in der Tierzucht und das der wachsenden Anzahl der u.a. dadurch resistent gewordenen Krankheitserreger ist mindestens schon zwei, drei Jahrzehnte bekannt und taucht etwa zusammen oder in bunter Reihe mit dem Tranquilizereinsatz bei Schweinen und weiteren vergleichbaren Tierpharma-Usancen regelmäßig im Skandal-Zirkus auf. Genauso regelmäßig verschwindet aber der Skandal wieder, nicht ohne Appelle und Versprechungen der Mastbetriebe, ihren Verbänden und den approbierten Pharmadealern, so etwas nie wieder zu tun.
Auch wenn jetzt der öffentliche Aufschrei auf einen am 14. November 2011 veröffentlichten Bericht des NRW-Verbraucherschutzministeriums groß ist und eigentlich alle Beteiligten, Verantwortlichen und Betroffenen "rasche und entschiedene Maßnahmen" fordern: Das Problem des Antibiotika-Einsatzes in der Tierzucht und das der wachsenden Anzahl der u.a. dadurch resistent gewordenen Krankheitserreger ist mindestens schon zwei, drei Jahrzehnte bekannt und taucht etwa zusammen oder in bunter Reihe mit dem Tranquilizereinsatz bei Schweinen und weiteren vergleichbaren Tierpharma-Usancen regelmäßig im Skandal-Zirkus auf. Genauso regelmäßig verschwindet aber der Skandal wieder, nicht ohne Appelle und Versprechungen der Mastbetriebe, ihren Verbänden und den approbierten Pharmadealern, so etwas nie wieder zu tun.
Ein Indiz für das Dauerproblem sind die mit einer Ausnahme auch in den letzten Jahren stetig gegenüber dem Vorjahr steigenden Mengen von für die "Tiergesundheit" eingesetzten Antibiotika: Für das Jahr 2005 schätzte der Bundesverband für Tiergesundheit und berichtete am 1. September 2011 die Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen, dass 784,4 Tonnen Antibiotika verabreicht worden sind. Das war gegenüber 2004 eine Zunahme um 8,8%. 2006 stieg der Verbrauch um 7%, 2007 um 9,2%, 2008 um 1%, um 2009 sogar einmal um 2,5% abzunehmen, die aber 2010 durch eine erneute Zunahme um 2% zum größten Teil wieder aufgeholt wurde. Bisher wurde aber von Seiten der Politik wenig getan, um das datengestützte Problembewusstsein zu fördern. In der seit Januar 2011 geführten bundeseinheitlichen DIMDI-Datenbank zu den nach Postleitzahlen aufgeschlüsselten Arzneimittelverwendungen war und ist die Geflügelwirtschaft ausgenommen.
Der Untersuchung des "Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen" liegen die "Daten von 962 Mastdurchgängen und von 182 verschiedenen Betrieben in NRW innerhalb des Zeitraums von Februar bis Juni 2011" zugrunde. Die amtlichen Experten halten dies, ohne dass ihnen bisher jemand direkt widersprach, für eine "belastbare Datengrundlage". Nebenbei erfährt man, dass allein in den nordrhein-westfälischen Hühnermastbetrieben jährlich fast 57 Millionen Tiere gehalten und geschlachtet werden. Die Betriebsgröße schwankt zwischen 3.400 und 170.000 Tieren.
Das Fazit der 10-seitigen Expertise ist an Deutlichkeit nicht zu übertreffen und lautet im Wortlaut:
• "Die Haltung von Masthühnern erfolgte bei 163 (17 %) aller Mastdurchgänge bzw. in 18 (10 %) der ausgewerteten Betriebe durchgehend ohne den Einsatz von antimikrobiellen Substanzen. Auffallend ist, dass auf diesen 10 % der Betriebe lediglich 3,6 % der Tiere gehalten wurden, also 96,4% der Masthühner einer antibiotischen Behandlung unterzogen wurden."
• "Bei den erfassten Mastdurchgängen mit Antibiotikaeinsatz kam eine Vielzahl von Wirkstoffen zum Teil zeitgleich zum Einsatz (1-8 Wirkstoffe pro Mastdurchgang) und die jeweilige Behandlungsdauer eines Wirkstoffes lag bei 53 % (924 von 1748) der Behandlungen mit 1-2 Tagen deutlich unter den Zulassungsbedingungen der verabreichten Wirkstoffe." Dies ist vor allem deshalb gefährlich, weil durch diese zu kurze Behandlung Bakterien Resistenzen entwickeln können.
• "Bei kleinen Betrieben (<20.000 Tiere) und bei einer Mastdauer >45 Tage wurde eine signifikant geringere Behandlungsintensität (Dauer, Anzahl der Wirkstoffe) festgestellt. Ein genereller Zusammenhang zwischen Behandlungsintensität und Betriebsgröße war auf Basis der Einzelbetriebsdaten dagegen nicht erkennbar."
• "Die dargestellte Situation, wonach über 96 % der Masthühner behandelt werden, ist nicht akzeptabel und legt den Schluss nahe, dass das Haltungssystem nicht den Vorgaben des Tierschutzgesetzes entspricht, da die angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung in Frage gestellt werden muss."
Unklar bleibt, ob der Antibiotika-Einsatz als Wachstumsförderung stattfindet, und damit seit 2006 ausdrücklich verboten ist, oder als Gesundheitsförderung bzw. Krankheitsprophylaxe. Angesichts der oberen Betriebsgrößen und dem damit verbundenen Risiko einer Masseninfektion aufgrund der Massenhaltung, dürfte letzteres das Hauptmotiv für den Antibiotika-Einsatz sein.
Die Reaktion des "Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft" und des "Deutschen Bauernverbandes" ist als Musterbeispiel für Problemvernebelung lesenswert: Natürlich "nehmen (wir) diese Ergebnisse sehr ernst" und starten jetzt "in enger Abstimmung mit der Tierärzteschaft ein Monitoring-Programm innerhalb des QS-Systems". Dabei geht es aber lediglich darum, dass der "im EU-Vergleich ohnehin niedrige Antibiotika-Einsatz weiter minimiert" wird. Und im Übrigen könne trotz "der ermittelten Antibiotikagaben Geflügelfleisch bedenkenlos verzehrt werden". Deswegen und aus ein paar Gründen mehr "sollte die Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen über den Antibiotika-Einsatz beim Hähnchen auch nicht im Zusammenhang mit dem Thema Antibiotikaresistenzen missbraucht werden."
Und wer ein großes Merkzettelbrett hat, sollte die folgende Schlusspassage der Verbändeerklärung mindestens 5 Jahre lang dort hängen lassen: "'Die Ergebnisse der Studie (aus NRW) machen einmal mehr deutlich, dass eine verlässliche Auswertung vorhandener Daten bisher nicht möglich ist - das muss nun unverzüglich angegangen werden', fordert DBV-Generalsekretär Dr. Born. Die Wirtschaft ergreift daher die Initiative und hat die Etablierung eines eigenen Monitoringsystems für Antibiotikagaben in der Geflügelaufzucht in die Wege geleitet. Eine Meldepflicht besteht ohnehin schon: DBV und ZDG machen deutlich, dass bereits seit zehn Jahren alle tierhaltenden Betriebe in Deutschland verpflichtet sind, jeden Einsatz von Tierarzneimitteln zu dokumentieren. Zudem müssen die Betriebsleiter den Amtsveterinären jederzeit Einsicht in diese Unterlagen geben. Darüber hinausgehend soll das von der Geflügelwirtschaft initiierte QS-Monitoring eine verlässliche bundesweite Auswertung als Grundlage für eine Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes liefern: So hat sich die deutsche Geflügelwirtschaft auf die Zielvereinbarung verständigt, durch Verbesserungen im Tierhaltungsmanagement den Antibiotika-Einsatz in den kommenden fünf Jahren um 30 Prozent zu verringern.
Den "Abschlussbericht. Evaluierung des Antibiotikaeinsatzes in der Hähnchenhaltung gibt es kostenlos herunterzuladen.
Und wem bisher nicht der Appetit vergangen ist: Weitere Informationen, Debatten und Erklärungen aus den letzten Jahren und diverse Links findet man auf der Antibiotika-Themenseite des Verbraucherschutzministeriums. Zwei Beispiele: "Mehr Gewicht in kürzerer Zeit: Um 1,6 Kilogramm zuzunehmen brauchte ein Masthähnchen 1970 noch 48 Tage. 2007 waren es nur noch 27 Tage" und "Zwischen 1985 und 2007 stieg das durchschnittliche Gewicht bei Masthähnchen um 61 Prozent."
Bernard Braun, 16.11.11
0,92% aller Krankenhaus-Fälle im Jahre 2006 sind mit Sicherheit unerwünschte Arzneimittelereignisse gewesen.
 Die Anzahl der unerwünschten Arzneimittelereignisse (UAE), d.h. der medizinischen Ereignisse, die in Verbindung mit der Anwendung eines Arzneimittels auftreten, wird auf der Basis spezieller Meldesysteme und Spontanmeldungen in den Industriestaaten auf 1 bis 5% aller Krankenhausaufnahmen geschätzt. In 1,7 bis 8,2% dieser Fälle endet das Ereignis tödlich. In Deutschland bedeutet dies 160.000-800.000 UAE-bedingte Krankenhaus-Fälle und ca. 10.000 bis 40.000 Todesfälle pro Jahr.
Die Anzahl der unerwünschten Arzneimittelereignisse (UAE), d.h. der medizinischen Ereignisse, die in Verbindung mit der Anwendung eines Arzneimittels auftreten, wird auf der Basis spezieller Meldesysteme und Spontanmeldungen in den Industriestaaten auf 1 bis 5% aller Krankenhausaufnahmen geschätzt. In 1,7 bis 8,2% dieser Fälle endet das Ereignis tödlich. In Deutschland bedeutet dies 160.000-800.000 UAE-bedingte Krankenhaus-Fälle und ca. 10.000 bis 40.000 Todesfälle pro Jahr.
Da die speziellen Meldesysteme gelegentlich als unzuverlässig und selektiv bewertet werden, untersuchten drei deutsche WissenschaftlerInnen jetzt mit den mit Sicherheit nicht durch Selektionseffekte und Meldesonderwege verzerrten DRG-Routinedaten aus dem gesamten Jahr 2006 die Häufigkeit des diagnostizierten Auftretens von UAEs in allen deutschen Krankenhäusern. Zur Identifikation der UAE-bedingten Krankenhaus-Aufnahmen wurden einschlägige ICD-Hauptdiagnosen herangezogen.
Unter den insgesamt 16.230.407 Krankenhaus-Fällen des Jahres 2006 erwiesen sich 0,92 % durch eine explizite Diagnose gesichert als UAE bedingt.
Zu den besonderen Ergebnissen der Analyse gehört, dass UAE-Fälle gegenüber Nichtbetroffenen eine verkürzte Verweildauer zeigten. Die Krankenhaussterblichkeit war mit einer Odds Ratio (OR) von 0,59 bei den UAE kleiner. Dagegen war der Anteil von Notaufnahmen wegen einer Fehlmedikation etc. mit einer OR von 3,10 erhöht. Fälle mit einem UAE waren häufig in der Inneren Medizin, Pädiatrie, Dermatologie, Intensivmedizin und Neurologie zu finden.
Auch wenn die AutorInnen die Aussagekraft der Routinedatenanalyse in diesem Zusammenhang positiv bewerten und für weitere Untersuchungen empfehlen, stehen z.B. die kürzere Verweildauer von UAE-Betroffenen, das niedrigere Alter und die geringere Mortalitätsrate im Widerspruch zu einigen anderen Studien.
Dabei kann es sich nach Meinung der AutorInnen um Effekte der DRG-Daten-Besonderheiten handeln. So führt die Vollerhebung z.B. dazu, dass die in anderen Meldesystemen meist nicht erfassten UAEs von Kindern und Jugendlichen über die DRG-Abrechnungsunterlagen erfasst wird. Ebenso könnte es sein, dass in diesen Datensätzen auch viele leichtere UAEs erfasst sind, die sonst nicht berichtet werden.
Selbst wenn DRG-Daten wahrscheinlich ein vollständigeres Bild dieser unerwünschten Ereignisse liefern, tragen bestimmte Besonderheiten aber auch zu einer Unterschätzung des Risikos bei. So besteht auch hier die Gefahr, dass bestimmte gesundheitliche Ereignisse nicht als UAE interpretiert werden und auch nicht als solche diagnostiziert werden. Da DRG-Diagnosen primär Abrechnungszwecken dienen, kann es auch sein, dass UAEs nur als Nebendiagnose auftauchen und daher in dieser Studie überhaupt nicht erfasst wurden.
Bei dem Anteil von 0,92% UAEs an allen Krankenhaus-Fällen, was 149.320 Fälle sind, handelt es sich also immer noch um eine Unterfassung und Unterschätzung des Risikos.
Dass der Auswertung von derartigen Routinedaten trotzdem ein fester Platz in der Analyse von UAEs eingeräumt werden sollte, belegen die WissenschaftlerInnen mit einem Vergleich von Routinedaten- und dem UAE-Meldesystem der Spontanberichte an die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: 2006 wurden 16.410 Krankenhaus-Fälle wegen einer Entzündung des Dünn- oder Dickdarms (Enterokolitis) durch das nach einer Antibiotikabehandlung als bösartiger Erreger agierende Clostridium difficile abgerechnet. Dem standen maximal 141 Fälle in den Spontanberichten gegenüber.
Von dem 2011 bisher nur in der Onlineausgabe der Zeitschrift "Gesundheitswesen" veröffentlichten Aufsatz "Stationäre Aufnahmen wegen unerwünschter Arzneimittelereignisse (UAE): Analyse der DRG-Statistik 2006" von Amann, C.; Hasford, J. und Stausberg gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 7.11.11
Avastin: Zulassungsverlust in den USA wegen Unwirksamkeit und Nebenwirkungen?! "Geld-zurück"-Vermarktungsstrategie in Deutschland!
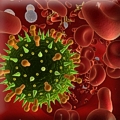 Die Verordnung des unter dem Markennamen Avastin seit einigen Jahren u.a. zur Behandlung eines bestimmten Brustkrebstyps (Her2-negativ-Typ mit Metastasen) eingesetzten Antikörpers Bevacizumab ist wegen empirisch bestätigtet erheblicher Zweifel an seiner Wirksamkeit und seinen zahlreichen schweren Nebenwirkungen in den USA spätestens seit Sommer 2010 massiv in die fachwissenschaftliche Kritik geraten. Die Kritik reicht so weit, dass seit Ende 2010 eine Expertengruppe der für die Zulassung von Arzneimittel in den USA zuständigen "Food and Drug Administration (FDA)" beraten hat, ob diese Zulassung nicht zurück genommen werden sollte. Im Juni 2011 haben die Experten der FDA in einer offenen Abstimmung einstimmig (6:0) empfohlen, diesen Schritt zu tun. Die Zulassung zur Behandlung anderer schwerer Krebserkrankungen wie Lungen-, Nieren- und Hirntumoren war davon nicht betroffen. Trotz dieses eindeutigen Votums und der ihm zugrunde liegenden Fakten, hat sich die FDA bisher (Ende Oktober 2011) nicht zu diesem Schritt entschieden.
Die Verordnung des unter dem Markennamen Avastin seit einigen Jahren u.a. zur Behandlung eines bestimmten Brustkrebstyps (Her2-negativ-Typ mit Metastasen) eingesetzten Antikörpers Bevacizumab ist wegen empirisch bestätigtet erheblicher Zweifel an seiner Wirksamkeit und seinen zahlreichen schweren Nebenwirkungen in den USA spätestens seit Sommer 2010 massiv in die fachwissenschaftliche Kritik geraten. Die Kritik reicht so weit, dass seit Ende 2010 eine Expertengruppe der für die Zulassung von Arzneimittel in den USA zuständigen "Food and Drug Administration (FDA)" beraten hat, ob diese Zulassung nicht zurück genommen werden sollte. Im Juni 2011 haben die Experten der FDA in einer offenen Abstimmung einstimmig (6:0) empfohlen, diesen Schritt zu tun. Die Zulassung zur Behandlung anderer schwerer Krebserkrankungen wie Lungen-, Nieren- und Hirntumoren war davon nicht betroffen. Trotz dieses eindeutigen Votums und der ihm zugrunde liegenden Fakten, hat sich die FDA bisher (Ende Oktober 2011) nicht zu diesem Schritt entschieden.
Die Umstände vor und nach der Entscheidung sind ein Lehrstück über die Schwierigkeiten, rationale und patientenorientierte Erkenntnisse gegen die mit der Behandlung einer der häufigsten Krebserkrankungen von Frauen verbundenen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Deutlich wird dabei auch, dass Herstellerfirmen, wirtschaftlich abhängige Wissenschaftler, einige Patienten, die sich erfolgreich behandelt fühlten (so genannte "super-responders") und möglicherweise auch wirtschaftlich interessierte Leistungserbringer eigentlich vor nichts zurück schrecken, um am Markt zu bleiben und dabei grundsätzlich "die Patienten" aus dem Sinn verlieren.
Dies zeigt u.E. die folgende unvollständige Übersicht wichtiger Etappen der Ver- und Entmarktung von Avastin und des Einfallsreichtums der Herstellerfirma Roche:
• Avastin wurde in den USA 2008 zur Behandlung des o.g. Brustkrebstyps aufgrund des Ergebnisses einer einzi-gen Studie der Herstellerfirma Genentech im Schnellverfahren zugelassen. In dieser Studie versprach das allein eingesetzte Mittel gegenüber dem alleinigen Einsatz eines anderen Mittels (Paclitaxel/Taxol) eine um 5,5 Monate längere progressions-freie Überlebenszeit als (11,3 Monate versus 5,8 Monate). Die beiden Mittel wurden auch gemeinsam verordnet und hatten Wirkungen auf beim Brustkrebs gezeigt. Die FDA verband diese Zulassung mit der Hersteller-Auflage, die Wirksamkeit und die Sicherheit/Nebenwirkungsfreiheit von Avastin durch weitere Studien zu untermauern. Dem folgte Genentech weitgehend nicht, und auch die Herstellerstudien AVADO und RIBBON-1 versagten aus Sicht aller FDA-Gutachter beim Versuch doch noch einen Nutzen für Avastin zu belegen. Andere Studien zeigten allerdings auch, dass der Nutzen höchstens durchschnittlich 0,8 Monate betrug und diese gewonnene progressionsfreie Überlebenszeit noch durch schwere, behandlungsbedürftige Nebenwirkungen, wie beispielsweise innere Blutungen und Magengeschwüre belastet wurde. Ob sich diese Art der Überlebenszeit aber auch auf die gesamte Überlebenschance der Erkrankten auswirkt war und ist ungeklärt. Der am 4. Oktober 2011 in den "Annals of Oncology 2011" veröffentlichte systematische Review samt Meta-Analyse der Ergebnisse von 5 RCTs "Adverse events risk associated with bevacizumab addition to breast cancer chemotherapy: a meta-analysis" von Cortes et al. belegt für vier unerwünschte Wirkungen ein vielfach erhöhtes Risiko (odds ratio): Das Risiko einer Proteinurie, d.h. einer übermäßigen Konzentration von Eiweiß im Urin, war unter einer Avastinbehandlung um das 27-Fache erhöht, das eines zu hohen Blutdrucks um das 3-Fache, das einer Fehlfunktion der linken Herzkammer um mehr als das Doppelte und das von diversen Blutungen um das 4-Fache. Dem während des FDA-Entscheidungsprozesses von behandelnden Onkologen bemühten Argument, die Nebenwirkungen seien deshalb hinzunehmen, weil die "disease is so terrible" konnten die Gutachter nichts abgewinnen, weil dies nur erwägenswert wäre, wenn das Medikament überhaupt etwas Positives schaffe. Die meisten hier geschilderten Ereignisse und noch ein paar mehr Hintergründe können in dem längeren Beitrag von Emily Walker "FDA Panel votes to yank Avastin's breast cancer indication" auf der Website "Medpage today" vom 29. Juni 2011 nachgelesen werden. Hier könnte u.U. eine kurze Anmeldung als LeserIn notwendig sein, die aber nach den Erfahrungen des Autors nicht zu Spam- oder Werbefluten führt.
• Der Empfehlung der Gutachter folgt eine Flut von Reaktionen und Ereignissen, deren Hintergründe sicherlich noch Gegenstand weiterer kritischer Nachforschungen sein werden. Einige, insbesondere private Krankenversicherunternehmen bezahlten selbst ohne eine endgültige Entscheidung der FDA ihren Versicherten die monatlich 8.000 US-Dollar kostende Behandlung nicht mehr. Die staatlichen Versicherungen Medicare und Medicaid bezahlen die Leistung weiter und kündigen auch an sie trotz einer möglichen Entscheidung der FDA gegen Avastin weiter zu bezahlen. Zahlreiche Onkologen und ihre Fachverbände erklärten außerdem, sie würden Avastin, wenn es weiter für die Behandlung der anderen Krebserkrankungen zugelassen bliebe, weiter und dann eben "off-label" zur Behandlung von Brustkrebspatienten verschreiben.
Dass dies keine spontanen Einzelmeinungen waren, zeigt eine von September bis November 2010 durchgeführte Mailbefragung von 3.000 Ex-TeilnehmerInnen eines Krebskongresses in Dubai. Von den 564 Antwortenden, also einer wahrscheinlich nicht repräsentativen Gruppe von praktizierenden Onkologen, vertrat die Mehreheit die Meinung, bei den FDA-Überlegungen ginge es vor allem um Kostenersparnis und außerdem würde damit die Entwicklung künftiger Medikamente gegen Brustkrebs be- oder verhindert. 46,5% der Befragten betrachteten die Verordnung von Avastin bei Personen, die an einem Her2-3x-negativen Brustkrebs erkrankt sind, als nützlich. 44,7% sagten, sie würden das Antikörperpräparat bei diesem Brustkrebstyp trotz aller FDA-Argumente mit Vorrang ("first line") weiter verordnen. 52% sagten schließlich, sie würden Avastin in der Regel zusammen mit Taxol als Therapeutikum einsetzen. Zu erwarten ist also, dass sehr viele Ärzte bei einer Streichung des Anwendungsgebiets Brustkrebs weiterhin "off-label" (Verordnung eines nicht zur Behandlung einer bestimmten Krankheit zugelassenen Medikaments) Avastin verordnen. Der Aufsatz "The use of bevacizumab among women with metastatic breast cancer: A survey on clinical practice and the ongoing controversy" von Dawood u.a. ist gerade online in der Fachzeitschrift "Cancer" erschienen und enthält neben weiteren Einzelheiten zur Entwicklungs- und Zulassungsgeschichte des Antikörpers differenziertere Ergebnisse der Befragung. Kostenlos ist nur das Abstract erhältlich.
• Auf dem 2011-"European Multidisciplinary Cancer Congress" in Stockholm hob eine deutsche Forschergruppe hervor, dass eine Subgruppenanalyse von Daten einer an Brustkrebs erkrankten Personengruppe aus onkologischen Praxen in Deutschland sowohl bei der Gesamtsterblichkeit als auch der progressionsfreien Überlebenszeit einen Nutzen der kombinierten Behandlung mit Avastin und Taxol zeige. Bevacizumab gälte daher in DEutschland zu Recht als "first line"-Präparat zur Behandlung des bereits mehrfach charakterisierten Brustkrebstyps. Anders als die der FDA-Experten-Empfehlung zugrunde liegenden Studien verglichen die deutschen Forscher aber nicht die Avastin/Taxol-Intervention mit einer anderen Interventionsform, sondern verglichen das Überleben einer dreifach-negativen Krankengruppe mit einer, die nicht an dieser Variante von Brustkrebs litten. Neben den um mehrere Monate längeren Überlebenszeiten in der Avastin/Taxol-Gruppe, konnten die ForscherInnen auch nur wenige der schweren unerwünschten Wirkungen beobachten. Ein Bericht über ihre Präsentation schloß daher auch mit den Worten "that the regimen is active in patients with triple-negative disease and is well-tolerated in routine practice."
Was an Wichtigem zu berichten übrigbleibt ist Folgendes: Die Studie wurde von der Firma Roche, also dem Hersteller von Avastin, gesponsert, was aber die AutorInnen nicht daran hinderte anzugeben, sie hätten "no conflicts of interest" gehabt. Einzelheiten zu den Ergebnissen der Präsentation "Bevacizumab combined with paclitaxel as first-line therapy for metastatic triple-negative breast cancer" von Schneeweiss et al auf dem ECCO-ESMO-Kongress 2011 (Abstract 5073) finden sich in einer kostenlosen Zusammenfassung auf einer der vielen Brustkrebs-Spezial-Websites. Ob die mündliche Präsentation jemals in einer Fachzeitschrift mit einem "peer review"-Verfahren erscheinen wird, verdient angesichts ihrer in diesem Zusammenhang eigentümlichen Methodik und ihren speziellen Ergebnissen besondere Aufmerksamkeit
• Dass die Firma Roche nicht nur offen Kongressbeiträge unterstützt, sondern auch noch andere Strategien verfolgt, zeigt sich an einer seit wenigen Tagen bekannten Vertragsstrategie des Konzerns gegenüber Krankenhäusern in Deutschland. Wie die "Süddeutsche Zeitung (SZ)" am 24.10.2011 in dem komplett kostenlos erhältlichen Beitrag "Rabatt bei Misserfolg" von Christina Berndt berichtet, bietet Roche Krankenhäusern einen so genannten "pay for performance"-Vertrag an, der folgendes Angebot enthält: Wenn in einem Krankenhaus Avastin zur Erstbehandlung fortgeschrittener Tumore des Darms, der Lunge, der Nieren und der Brust eingesetzt wird, was in Deutschland etwa 3.300 Euro pro Monat kostet, und der Krebs nicht zu wachsen aufhört, erhalten die Krankenhäuser das aufgewandte Geld zurück. Diese wohl einmalige "Geld-zurück"-Garantie kommentiert das pharmakritische "Arznei-Telegramm" in einem demselben Thema gewidmeten Beitrag in der leider nicht frei bzw. kostenlos zugänglichen neuesten Ausgabe (a-t 2011; 42: 83-4) so: "Die Regelung lädt geradezu ein, auch Patienten mit Bevacizumab zu behandeln, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es ihnen nützt." Noch folgenreicher für Patienten ist, dass den Avastin-Patientinnen möglicherweise eine wirksamere Therapien mit weniger attraktiven finanziellen Anreizen vorenthalten wird. Der Clou der "P4P"-Verträge ist nämlich, dass die Krankenhäuser Kostenerstattungen angeboten werden, hinter denen gar keine Ausgaben stehen. Die Behandlung mit Avastin bezahlen nämlich die Krankenkassen. In dem SZ-Artikel wird dann auch ein AOK-Vertreter zitiert, der meint, solche Preisvorteile müssten an die Kassen weitergegeben werden. Ein Überblick über die 12 in den letzten Jahren u.a. zu Avastin im "Arznei-Tegramm" erschienenen ebenfalls mehrheitlich nicht kostenlos zugänglichen Beiträge zeigt, dass der Nutzen des Medikaments schon seit längerem auch in Deutschland bezweifelt wird.
Unabhängig von legitimen und legalen Finanzierungsdetails bleibt die Frage, warum nach Bekanntwerden des Angebots Krankenkassen und Krankenhäuser nicht auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse über Avastin gemeinsam ein solches Angebot grundsätzlich als inhuman, patientengefährdend und unethisch ablehnten.
Nachtrag vom 20. November 2011: In einer FDA-Presseerklärung vom 18. November 2011 kündigte die FDA-Leiterin Margret A. Hamburg an, die Zulassung des Medikaments Avastin bzw. seines Wirkstoffs zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen werde in den USA zurückgezogen.
Die der Entscheidung zugrundeliegende Abwägung von Vor- und Nachteilen lautet: "This was a difficult decision. FDA recognizes how hard it is for patients and their families to cope with metastatic breast cancer and how great a need there is for more effective treatments. But patients must have confidence that the drugs they take are both safe and effective for their intended use." Und: "After reviewing the available studies it is clear that women who take Avastin for metastatic breast cancer risk potentially life-threatening side effects without proof that the use of Avastin will provide a benefit, in terms of delay in tumor growth, that would justify those risks. Nor is there evidence that use of Avastin will either help them live longer or improve their quality of life."
Ob und wie sich die europäischen und deutschen Zulassungsinstitutionen dieser Entscheidung anschließen, kann man hoffentlich nicht allzu lange beobachten.
Bernard Braun, 30.10.11
Was müde Maultiere mit Strafzahlungen der pharmazeutischen Industrie in Milliardenhöhe zu tun haben
 Lahme Gäule, müde Maultiere, defekte Gewehre, verdorbene Lebensmittel - skrupellose Händler betrogen die Nordstaatenarmee im Sezessionskrieg (1861-1865) auf jede nur erdenkliche Weise. Der "False Claim Act" (FCA) von 1863 sollte den Betrügern Einhalt gebieten. Durch dieses Bundesgesetz haften seitdem Personen und Firmen, welche den Staat durch falsche Behauptungen oder falsche Angaben finanziell schädigen. Ein bis heute wichtiger Aspekt ist das Recht von Privatpersonen, ihnen bekannte Fälle von Betrug zur Anklage zu bringen und dafür einen Teil der Schadenssumme als Belohnung zu erhalten ("whistleblower").
Lahme Gäule, müde Maultiere, defekte Gewehre, verdorbene Lebensmittel - skrupellose Händler betrogen die Nordstaatenarmee im Sezessionskrieg (1861-1865) auf jede nur erdenkliche Weise. Der "False Claim Act" (FCA) von 1863 sollte den Betrügern Einhalt gebieten. Durch dieses Bundesgesetz haften seitdem Personen und Firmen, welche den Staat durch falsche Behauptungen oder falsche Angaben finanziell schädigen. Ein bis heute wichtiger Aspekt ist das Recht von Privatpersonen, ihnen bekannte Fälle von Betrug zur Anklage zu bringen und dafür einen Teil der Schadenssumme als Belohnung zu erhalten ("whistleblower").
Wie in einer Studie in den Archives of Internal Medicine berichtet, mussten pharmazeutische Firmen im Zeitraum von 1996 bis 2010 in 31 Strafverfahren im Rahmen des FCA insgesamt 12 Mrd. Dollar als Strafe und zum Vergleich an die Bundesregierung und die Bundesstaaten zahlen.
Zumeist handelte es sich um Vergehen gegen die Marketing-Regeln, wie Off-Label-Marketing, betrügerisches Marketing, falsche Bezeichnungen von Chargen und betrügerische Preisauszeichnungen.
Den höchsten Betrag - 2,3 Mrd. Dollar - musste die Firma Pfizer 2009 im Zusammenhang mit der Vermarktung des inzwischen vom Markt genommenen Rheumamittels Bextra (Substanz Valdecoxib) zahlen wegen falscher Bezeichnung (misbranding), illegalem Marketing und der Zahlung von Bestechungsgeldern (kickbacks) an Ärzte. Wirklich weh getan hat Pfizer diese Summe bei einem weltweiten Jahresumsatz von 55,6 Mrd. Dollar im Jahr 2010 (IMS Health, Top 20 Global Corporations 2010) wohl eher nicht.
Den zweithöchsten Betrag - 1,4 Mrd. Dollar - zahlte Eli Lilly 2009 wegen der Off-Label-Vermarktung des Antipsychotikums Zyprexa (Substanz: Olanzapin). Zyprexa ist für die Behandlung der Bipolaren Störung und der Schizophrenie zugelassen. Eli Lilly bekannte sich des Versuchs schuldig, Ärzten gegenüber Werbung betrieben zu haben für den off-label-Einsatz bei Kindern und auch bei alten Menschen - bei Letzteren z.B. für die Behandlung von Demenz, Depression, Angst, Schlafproblemen und Verhaltensproblemen, insbesondere bei Bewohnern von Pflegeheimen. Die Strafzahlung von 515 Mio. Dollar war die höchste bis dahin jemals verhängte Zahlung (Department of Justice 2009).
Unter den wegen Betrugs verurteilten pharmazeutischen Firmen sind alle großen Namen vertreten einige sogar mehrfach.
Die vollständige Liste findet sich in der Studie, deren Volltext leider nicht frei zugänglich ist.
Qureshi ZP, Sartor O, Xirasagar S, Liu Y, Bennett CL. Pharmaceutical Fraud and Abuse in the United States, 1996-2010. Arch Intern Med 2011;171(16):1503-06
Link zu den ersten 150 Wörtern der Studie
Larry D. Lahman. Bad Mules. A Primer on the Federal False Claims Act. Link
Department of Justice. Presseerklärung 15.1.2009: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa Link
New York Times 2.9.2009. Pfizer Pays $2.3 Billion to Settle Marketing Case Link
David Klemperer, 28.10.11
52% der Verfasser von Cholesterin- und Diabetes-Leitlinien in Nordamerika haben offen und verdeckt finanzielle Interessenkonflikte
 Klinische Leitlinien für das Screening, die Behandlung oder beide Aktivitäten spielen eine zunehmende Rolle in der medizinischen Versorgungspraxis. Umso wichtiger ist, dass sie sich ausschließlich am wissenschaftlich gesicherten Stand des Wissens über den patientenbezogenen Nutzen und die Schädigungsfreiheit der diagnostischen und therapeutischen Verfahren und Interventionen orientieren und nicht an den Interessen der Hersteller oder der behandelnden Ärzte und Nicht-Ärzte.
Klinische Leitlinien für das Screening, die Behandlung oder beide Aktivitäten spielen eine zunehmende Rolle in der medizinischen Versorgungspraxis. Umso wichtiger ist, dass sie sich ausschließlich am wissenschaftlich gesicherten Stand des Wissens über den patientenbezogenen Nutzen und die Schädigungsfreiheit der diagnostischen und therapeutischen Verfahren und Interventionen orientieren und nicht an den Interessen der Hersteller oder der behandelnden Ärzte und Nicht-Ärzte.
Wie verschiedene Studien aber seit Jahren zeigen, versuchen immer mehr Gesundheitsprodukteanbieter über finanzielle und organisatorische Angebote bis hin zu Beteiligungen an den Unternehmen offen oder verborgen Einflussnahme auf einzelne Studienergebnisse und am besten auch auf Behandlungsleitlinien zu nehmen.
Wie groß bereits der Umfang der offenen Einflussnahmen ist lässt sich u.a. an den zunehmend geforderten öffentlichen Erklärungen von finanziellen und anderen Interessenkonflikten der Forscher oder Mitglieder der Expertenteams für spezifische Leitlinien ablesen.
Wie viele der Verfasser von 14 zwischen 2000 und 2010 in den USA und Kanada von nationalen Fachgesellschaften publizierten relevanten Leitlinien für die Behandlung eines hohen Cholesterinspiegels und von Diabetes, also häufigen Erkrankungen bzw. Risikofaktoren, selber finanzielle Interessenkonflikte angaben und wohl auch hatten, analysierte jetzt eine Gruppe von us-amerikanischen Wissenschaftlern.
Die wesentlichen Ergebnisse sehen so aus:
- An der Entwicklung dieser Leitlinien waren insgesamt 288 Experten beteiligt. Bei 5 der Leitlinien waren Erklärungen über Interessenkonflikten überhaupt nicht vorgesehen.
• Von den Mitgliedern der Expertenteams gaben 138 oder 48% an, zum Zeitpunkt der Leitlinienbearbeitung Interessenkonflikte gehabt zu haben. Die restlichen 52% der Leitlinienverfasser erklärten, entweder keine Konflikte gehabt zu haben oder sie nicht erklären konnten.
• Unter den 73 Experten, die formal erklärten, keine Konflikte gehabt zu haben, zeigte sich bei genauerer Recherche, dass 8 bzw. 11% mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere Konflikte gehabt hatten.
• Insgesamt hatte also mehr als die Hälfte der Panelmitglieder, nämlich 52% oder 150 Personen einen Interessenkonflikt - 138 erklärter Maßen und 12 unerklärt.
• Angehörige von regierungsgetragenen Expertenteams hatten wesentlich weniger seltener Interessenkonflikte als ihre KollegInnen, deren Arbeit aus Nicht-Regierungstöpfen finanziert und organisiert worden waren. Der Anteil von Mitgliedern mit Interessenkonflikten betrug in den regierungsgetragenen Teams 16% und in den von der Pharma- oder Medizintechnikindustrie gesponsorten Teams 69%.
Der 8 Seiten umfassende Aufsatz "Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and United States: cross sectional study" von Jennifer Neuman, Deborah Korenstein, Joseph Ross und Salomeh Keyhani ist am 11. Oktober 2011 in der renommierten Fachzeitschrift "British Medical Journal" erschienen (BMJ 2011; 343: d5621) und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.10.11
Gegen ghost writing. Die Herkunft von Studien offen legen - schwierig aber notwendig
 Die pharmazeutische Industrie initiiert die überwiegende Mehrzahl der Arzneimittelstudien (wir berichteten mehrfach, z.B. Link). Dabei verfolgen sie sowohl wissenschaftliche als auch kommerzielle Ziele. Die kommerziellen Ziele wirken sich häufig verzerrend und verfälschend auf die Studienergebnisse aus (wir berichteten mehrfach, z.B. Link).
Die pharmazeutische Industrie initiiert die überwiegende Mehrzahl der Arzneimittelstudien (wir berichteten mehrfach, z.B. Link). Dabei verfolgen sie sowohl wissenschaftliche als auch kommerzielle Ziele. Die kommerziellen Ziele wirken sich häufig verzerrend und verfälschend auf die Studienergebnisse aus (wir berichteten mehrfach, z.B. Link).
Daher ist es wenig verwunderlich - wenn auch nicht akzeptabel - dass die Industrie die kommerziellen Aspekte ihrer Studien verbirgt oder herunterspielt. Eine Methode dafür ist die ghost authorship - ein professioneller Schreiber verfasst den Artikel ("ghost author") ohne als Autor genannt zu werden und ein neutral erscheinender Wissenschaftlers erscheint als Autor ("guest author"), obwohl Mitarbeiter bzw. Beauftrage des Unternehmens die entscheidenden Arbeiten in der Konzipierung der Studie, dem Studiendesign, der Datenanalyse, der Interpretation und dem Schreiben geleistet haben (wir berichteten mehrfach, z.B. Link).
Diese Art der Verschleierung des Ursprungs einer Studie gilt mittlerweile als Verstoß gegen akademische Standards. In einem Beitrag in PLoS Medicine legt Alastair Matheson dar, wie Firmen in perfekter Einhaltung der Leitlinien des International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) weiterhin ihren Einfluss auf eine Studie verbergen können.
Um als Autor einer Arbeit zu gelten, sind den ICMJE-Leitlinien zufolge drei Kriterien zu erfüllen:
1) Substantieller Beitrag zu Konzeption und Design oder der Erfassung der Daten oder Analyse und Interpretation der Daten
2) Entwurf oder inhaltliche Überarbeitung des Artikels und
3) Verantwortlichkeit für die Freigabe des Manuskripts
Somit ist es mit den Leitlinie vereinbar, dass ein oder mehrere Mitarbeiter eines pharmazeutischen Unternehmens oder von ihr beauftrage Personen oder Firmen die Hauptarbeit für die Kriterien 1 und 2 leisten, aber nicht als Autor genannt werden, wenn sie keine Verantwortung für die Freigabe des Manuskripts tragen. Anders herum qualifiziert sich ein Wissenschaftler als Autor, wenn er zu Kriterium 1 einen Beitrag geleistet hat, dem er oder jemand anders die dehnbare Bezeichnung "substantiell" verpasst, an einem vorformulierten Artikel einige Änderungen vornimmt und dann formal den Artikel zum Druck frei gibt. Der Mitarbeiter des Unternehmens erscheint im veröffentlichten Artikel entweder gar nicht im Kleingedruckten als "contributor".
Matheson bezeichnet die Leitlinine des ICJME daher nicht als Hindernis sondern als Vehikel zur Vertuschung des Ursprungs einer Studie und ihrer Autorschaft für Marketingzwecke.
Zur Abhilfe empfiehlt er eine grundlegende Revision der ICMJE-Leitlinien mit dem Ziel, die Urheberschaft von Studien und die Beiträge aller Personen und Organisationen wahrheitsgemäß darzustellen.
In derselben Ausgabe von PLoS Medicine argumentieren Simon Stern und Trudo Lemmens, dass es sich bei ghost bzw guest authorship sowohl von Seiten des guest authors als auch von Seiten der Industrie rechtlich um Betrug handelt, was entsprechend bestraft werden sollte.
In einem Editorial fordern die Herausgeber des PLoS Medicine entschiedene Maßnahmen gegen die Verschleierung der Urheber- und Autorenschaft, weisen aber auch darauf hin, dass die derzeitige Situation der Ausdruck einer gewachsenen Kultur der Einflussnahme der Industrie ist, von der nicht nur die Industrie und die Autoren, sondern auch die Fachzeitschriften profitieren - industriegesponserte Studien werden häufiger zitiert als anderweitig finanzierte Studien und erhöhen damit den Impact Factor (wir berichteten) - eines der wichtigsten Kriterien für das Ansehen einer Zeitschrift.
Matheson A. How Industry Uses the ICMJE Guidelines to Manipulate Authorship- And How They Should Be Revised. PLoS Med 2011;8(8):e1001072 Link
Stern S, Lemmens T. Legal Remedies for Medical Ghostwriting: Imposing Fraud Liability on Guest Authors of Ghostwritten Articles. PLoS Med 2011;8(8):e1001070. Link
Editorial. The PLoS Medicine Editors. Ghostwriting Revisited: New Perspectives but Few Solutions in Sight. PLoS Med 2011;8(8):e1001084. Link
David Klemperer, 3.9.11
Weltweit sozial ungleiche Unterversorgung mit Medikamenten zur Sekundärprävention nach Herzinfarkt und Schlaganfall
 Zu den notwendigen, nachweislich wirksamen und zum Teil auch relativ preisgünstigen Mitteln, die Patienten nach einem Herzinfakt oder Schlaganfall sekundärpräventiv einnehmen sollten, gehören blutverflüssigende Wirkstoffe wie die Acetylsalicylsäure (ASS), diverse Blutdrucksenker (Betablocker, ACE-Hemmer) und Statine.
Zu den notwendigen, nachweislich wirksamen und zum Teil auch relativ preisgünstigen Mitteln, die Patienten nach einem Herzinfakt oder Schlaganfall sekundärpräventiv einnehmen sollten, gehören blutverflüssigende Wirkstoffe wie die Acetylsalicylsäure (ASS), diverse Blutdrucksenker (Betablocker, ACE-Hemmer) und Statine.
Eine kanadische Forschergruppe untersuchte nun in einer so weltweit erstmals durchgeführten Studie (die so genannte "Prospective Urban Rural Epidemiological (PURE) study") mit 153.996 erwachsenen Personen zwischen 35 und 70 Jahren aus 628 städtischen und ländlichen Gemeinden, wie der Versorgungsalltag der in dieser Population identifizierten 7.942 Herzinfakt- und Schlaganfallpatienten aussieht. Die Länder der Studienteilnehmer wurden nach ihrem durchschnittlichen Einkommensniveau in drei reichere, sieben mit mittlerem Einkommen und vier arme Länder unterschieden.
Das Gesamtbild war eindeutig: Meist weniger die Hälfte der Patienten erhielt auf schriftliches oder mündliches Befragen eines der Medikamente verordnet. Zusätzlich gab es überall auch noch ein mehr oder weniger starkes und meist statistisch hochsignifikantes soziale Gefälle bei der Behandlung.
Im Einzelnen sah es so aus:
• ASS erhielten durchschnittlich nur rund 25% der Patienten verordnet, die sekundärpräventiv behandelt wurden. Die Verordnungsrate schwankte dabei zwischen 62% in wohlhabenderen Länddern wie Kanada oder Schweden, 20 bis 25% in Ländern mit mittlerem Durchschnittseinkommen wie etwa Polen oder China und 9% in armen Ländern wie Pakistan oder Simbabwe.
• Statine erhielten durchschnittlich 14,6% der Patienten. Der Wert lag in reicheren Ländern bei 66% und in armen Ländern bei 3%.
• ACE-Hemmer nahmen insgesamt 19,5% aller an den beiden Krankheiten erkrankten Personen. Und auch hier stand einer Verordnungs-/Einnahmerate von knapp 50% in den reicheren Ländern eine Rate von 5% in den ärmeren Ländern gegegenüber.
• In den reicheren Ländern erhielten 11,2% der Herzinfarkts- und Schlaganfallspatienten überhaupt keines der sekundärpräventiven Arzneimittel. Dieser Wert stieg in über 45% und 69% in der Gruppe der Länder mit mittlerem Einkommen (differenziert in oberes und unteres mittleres Einkommen) bis auf 80,2% in Ländern mit geringem Durchschnittseinkommen.
• Korrespondierend mit dieser Ungleich- bzw. Unterversorgung gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen der Versorgung der Stadt- und Landbevölkerung: Zum Beispiel wurden Medikamente mit dem Wirkstoff ASS 29% der in Städten lebenden Kranken verordnet aber nur 21% der auf dem Lande lebenden Kranken. Auch hier waren die Stadt-Landunterschiede in ärmeren Ländern größer als in reicheren.
• Interessant war schließlich noch, dass die Nutzung dieser sekundärpräventiven Arzneimittel stärker mit dem sozialen und ökonomischen Niveau des jeweiligen Landes assoziiert war als mit Individualfaktoren wie dem Alter, Geschlecht, Rauchverhalten, Gewicht etc.
Zu dem am 28. August 2011 "early online" publizierten Aufsatz "Use of secondary prevention drugs for cardiovascular disease in the community in high-income, middle-income, and low-income countries (the PURE Study): a prospective epidemiological survey" von Salim Yusuf et al. aus der Fachzeitschrift "The Lancet" gibt es kostenlos ein relativ üppiges Abstract.
Bernard Braun, 31.8.11
Interventionen an den Herzkranzgefäßen - weniger ist mehr, wird aber nicht umgesetzt
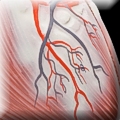 Im Jahr 2007 erregte die COURAGE-Studie große Aufmerksamkeit. In dieser Studie wurde belegt, dass eine sorgfältige und konsequente medikamentöse Behandlung von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit die besten Ergebnisse bringt. Die Vergleichsgruppe von Patienten, die zusätzlich zur medikamentösen Therapie noch Eingriffe an den Herzkranzgefäßen erhielten, erzielte keinerlei Vorteile - weder im Überleben noch in der Rate von Herzinfarkten. Auch der Anteil beschwerdefreier Patienten war gleich.
Im Jahr 2007 erregte die COURAGE-Studie große Aufmerksamkeit. In dieser Studie wurde belegt, dass eine sorgfältige und konsequente medikamentöse Behandlung von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit die besten Ergebnisse bringt. Die Vergleichsgruppe von Patienten, die zusätzlich zur medikamentösen Therapie noch Eingriffe an den Herzkranzgefäßen erhielten, erzielte keinerlei Vorteile - weder im Überleben noch in der Rate von Herzinfarkten. Auch der Anteil beschwerdefreier Patienten war gleich.
Die COURAGE-Studie hatte somit gezeigt, dass Eingriffe wie Aufdehnung von Engstellen an den Herzkranzgefäßen (PTCA) und Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent) bei Herzpatienten ohne Angina-pectoris-Beschwerden keinen Nutzen erbringt und somit unterlassen werden sollte. Jeder Patient hingegen sollte die optimale medizinische Therapie (OMT) aus Blutverdünnungsmittel wie Aspirin, Blutfettsenker und Betablocker erhalten, soweit keine Gegenanzeigen bestehen. Bei Patienten mit Beschwerden sind Eingriffe nur erforderlich, wenn die Beschwerden mit der OMT nicht ausreichend gelindert werden können und der Patient sich so beeinträchtigt fühlt, dass er den Eingriff wünscht.
Wünschenswert ist es natürlich, dass derartige wegweisende Erkenntnisse umgehend den Patienten zugute kommen, in diesem Fall, dass sie die nützliche Behandlung mit Arzneimitteln erhalten und vor nutzlosen Eingriffen bewahrt werden.
Amerikanische Wissenschaftler werteten jetzt Angaben aus einem nationalen Register aus, in dem die Behandlung von Patienten aus mehr als 1.000 Krankenhäusern mit Herzkrankheiten sorgfältig dokumentiert werden. Die Ergebnisse sind ernüchternd.
Zur Verfügung standen Daten von 467.211 Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit, die in einem umschriebenen Zeitraum vor (173.416 Patienten) bzw. nach (293.795 Patienten) Veröffentlichung der COURAGE-Studie einen Eingriff an den Herzkranzgefäßen (PTCA)erhielten. Gefragt wurde nach dem Anteil der Patienten die in der jeweiligen Periode die optimale medikamentöse Therapie (OMT) vor bzw. nach dem Eingriff erhielten
Vor Veröffentlichung der COURAGE-Studie am 27.3.2007 erhielten vor dem Eingriff 43,5% die OMT, nach dem Eingriff 63,5%. Nach der Veröffentlichung der Studie erhielten vor dem Eingriff 44,7% die OMT, nach dem Eingriff 66,0%.
Die Ergebnisse der COURAGE-Studie wurden somit von den amerikanischen Kardiologen nicht umgesetzt. Die konsequente Umsetzung hätte eine annähernd vollständige Versorgung der Patienten mit OMT erfordert, bevor ein Eingriff mit dem Ziel der Beschwerdelinderung mit den Patienten auch nur diskutiert wird.
Diese eindrucksvolle Studie belegt, dass auf Seiten der Anbieter die Anreize zur Durchführung der PTCA stärker wiegen als Evidenz und Ethik. Den Patienten wird die bestmögliche Therapie vorenthalten. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf ein - lange bekanntes - Systemversagen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Unabdingbar dürfte aber sein, Patienten dadurch zu stärken, dass sie aufgrund evidenzbasierter Informationen Entscheidungen unabhängig von den Anbieterinteressen treffen können.
Die Frage der Erbringung nutzloser PTCAs stellt sich auch für Deutschland, kann aber aufgrund fehlender Daten derzeit nicht beantwortet werden.
Borden WB, Redberg RF, Mushlin AI, Dai D, Kaltenbach LA, Spertus JA. Patterns and Intensity of Medical Therapy in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2011;305(18):1882-89.
Abstract
Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom 11.5.2011 Link
COURAGE-Studie:
Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, Hartigan PM, Maron DJ, Kostuk WJ, et al. Optimal Medical Therapy with or without PCI for Stable Coronary Disease. N Engl J Med 2007;356(15):1503-16 Link zum Volltext
David Klemperer, 20.7.11
Fehlversorgung: 70% bis 80% der erkälteten Kinder und Jugendlichen in Bremen, Oldenburg und umzu werden mit Antibiotika therapiert
 Die jüngsten alarmierenden Meldungen über das Auftauchen eines gegen sämtliche Antibiotika resistenten Tripper-Keims in Japan zeigen, dass derartige Gefahren nicht nur bei exotischen, sondern auch bei weit verbreiteten übertragbaren Krankheiten wie der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe (z.B. jährlich 700.000 Neuerkrankte allein in den USA) real werden können. Unter der zunächst sinnvollen und wirksamen Dauerbehandlung mit Antibiotika seit den 1940er Jahren habe das "Bakterium eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, sich gegen sämtliche Wirkstoffe zu wehren, die es kontrollieren sollen" - so die Entdecker des resistenten Bakteriums.
Die jüngsten alarmierenden Meldungen über das Auftauchen eines gegen sämtliche Antibiotika resistenten Tripper-Keims in Japan zeigen, dass derartige Gefahren nicht nur bei exotischen, sondern auch bei weit verbreiteten übertragbaren Krankheiten wie der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe (z.B. jährlich 700.000 Neuerkrankte allein in den USA) real werden können. Unter der zunächst sinnvollen und wirksamen Dauerbehandlung mit Antibiotika seit den 1940er Jahren habe das "Bakterium eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, sich gegen sämtliche Wirkstoffe zu wehren, die es kontrollieren sollen" - so die Entdecker des resistenten Bakteriums.
Auch wenn es keine weiteren inhaltlichen Gemeinsamkeiten gibt, sollte mit Antibiotika dort umso zurückhaltender umgegangen werden, wo weder die Schwere der Erkrankheit noch die Art des Erregers einen präventiven noch einen kurative Wirksamkeit versprechenden Einsatz versprechen. Gemeint ist die Verordnung für und die Einnahme von Antibiotika durch Kinder und Jugendliche vor allem gegen die überwiegend durch Viren ausgelösten Erkältungserkrankungen der oberen Atemwege.
Im Auftrag der Handelskrankenkasse (hkk) Bremen untersuchten die Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun und Gerd Marstedt vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen die Diagnosen aus der ambulanten Behandlung und die verordneten Arzneimittel für die jungen hkk-Versicherten aus Bremen, Oldenburg und dem ländlichen Umfeld der beiden Städte aus den Jahren 2007, 2008 und 2009. Insgesamt bestätigt diese Studie die wenigen ebenfalls regionalen Erkenntnisse z.B. aus Hessen. Sie zeigt ferner, dass die Verordnungswirklichkeit über mehrere Jahre hinweg relativ unbeeindruckt von der fachlichen und politischen Debatte geblieben ist.
Nachdem die Wissenschaftler zunächst den Forschungs-Erkenntnisstand über die Notwendigkeit der Verordnung von Antibiotika und die Gefahren einer gesundheitlich überflüssigen Verordnung von Antibiotika für das Entstehen resistenter Bakterien zusammengefasst haben, kommen sie zu folgenden Grundzügen des Verordnungsverhaltens der Ärzte für die hkk-Kinder und -Jugendlichen:
• Der Anteil der Bremer Kinder und Jugendlichen zwischen 0 und 18 Jahren, die zwischen 2007 und 2009 mindestens einmal im Jahr ein Antibiotika verordnet bekamm pendelte zwischen 34 und 35%.
• In der wenige Kilometer entfernten Stadt Oldenburg bewegte sich derselbe Wert zwischen 44 und 46%.
• Betrachtet man nur die Kinder und Jugendlichen, die mit einer Erkältungserkrankung zu ihrem Haus- oder Kinderarzt kamen bzw. von ihren Eltern gebracht wurden, erhielten in Bremen rund 70% diese PatientInnen und in Oldenburg zwischen 75 und 80% von ihnen Antibiotika verordnet. Ihre Altersgenossinnen im ländlichen Bereich lagen in etwa zwischen diesen Werten. Diese Häufigkeit ist dann, wenn man beachtet, dass rund 90% aller Atemwegserkrankungen durch Viren und nicht durch Bakterien verursacht werden und Antibiotika daher hier definitiv keinen gesundheitlichen Nutzen haben, sehr hoch. Experten schätzen, dass mindestens die Hälfte der Verordnungen ohne jeglichen Nachteil für die PatientInnen ersatzlos und ohne negativen gesundheitlichen Effekt wegfallen könnte.
Zusätzlich stellen die Wissenschaftler die recht kurze Reihe von Studien vor, die zu erklären versuchen, warum Ärzte "wieder besseres Wissen" und letztlich nur auf Druck der Eltern (so eine häufig gehörte entschuldigende Floskel, die offen gegen professionelle Basisnormen verstößt) Antibiotika verordnen. Sie versuchen auch das Eltern zu erklären, von denen nur weniger als 10% sachkundig sagen, sie nähmen gerne ein Antibiotika ein und trotzdem mehrheitlich Antibiotika widerspruchslos verordnen lassen und ihre Kinder einnahmen lassen.
Eine Veränderung der Arzt-Patient-Kommunikation, gezieltere Patientenaufklärung, ein besseres Schmerzmanagement durch die Ärzte (Schmerz ist häufig das kritische Symptom einer Infektion der oberen Atemwege oder des Mittelohrs), ein expliziter Behandlungsplan und öffentliche Aufklärungskampagnen könnten alle zusammen - so die noch geringere Anzahl von Studien, die sich darum kümmerten - zu einer Abnahme der Verordnungshäufigkeit führen.
Die Analyse "Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen" von Bernard Braun und Gerd Marstedt ist in der hkk-Berichtsreihe "Aspekte der Versorgungsforschung" als Teil I der 2011er Ausgabe erschienen und kostenlos erhältlich.
Wer sich auch noch für den Auslöser-Text der aktuellen Debatte über das Auftreten eines komplett Antibiotika-resistenten Trippererreger interessiert, kann sich den wissenschaftlichen Aufsatz "Is Neisseria gonorrhoeae Initiating a Future Era of Untreatable Gonorrhea?: Detailed Characterization of the First Strain with High-Level Resistance to Ceftriaxone" von Ohnishi et al., erschienen im Juli 2011 in der Fachzeitschrift "Antimicrobial Agents and Chemotherapy" (Vol. 55, No. 7: 3538-3545) komplett kostenlos downloaden. Angeblich soll es 10 bis 20 Jahre dauern, bis dieser Erreger in Europa angekommen sein dürfte, eine Vermutung, die unter den Bedingungen globaler Mobilität eher unwahrscheinlich klingt.
Bernard Braun, 14.7.11
E-Rezepte sind nicht fehlerfreier als handschriftliche Rezepte oder der Mythos der Fehlerfreiheit und Nützlichkeit von E-Health.
 Elektronische Arzneimittelverordnungen gehören seit Beginn der Einführung von Informationstechnologien in Arztpraxen und Krankenhäuser zu den vorgeblich multinützlichen Vorzeigetools der von Regierungs-, Krankenversicherungs- und Geräteherstellern systematisch forcierten Elektronisierung weiter Teile der Gesundheitsversorgung. Wer könnte angesichts der nicht seltenen und immer wieder belegten nicht zuletzt gesundheitsgefährdenden Fehlern in handschriftlichen Rezepten gegen elektronische Rezepte sein: Praktisch fehlerfrei und damit qualitätssichernd oder gar -verbessernd, kostengünstiger und auch noch papierlos?
Elektronische Arzneimittelverordnungen gehören seit Beginn der Einführung von Informationstechnologien in Arztpraxen und Krankenhäuser zu den vorgeblich multinützlichen Vorzeigetools der von Regierungs-, Krankenversicherungs- und Geräteherstellern systematisch forcierten Elektronisierung weiter Teile der Gesundheitsversorgung. Wer könnte angesichts der nicht seltenen und immer wieder belegten nicht zuletzt gesundheitsgefährdenden Fehlern in handschriftlichen Rezepten gegen elektronische Rezepte sein: Praktisch fehlerfrei und damit qualitätssichernd oder gar -verbessernd, kostengünstiger und auch noch papierlos?
Die gerade in der Fachzeitschrift "Journal of American Medical Information Association" veröffentlichten Ergebnisse einer retrospektiven Untersuchung von 3.850 computergenerierter Rezepten niedergelassener Ärzte, die innerhalb von vier Wochen im Jahr 2008 bei mehreren Geschäfts-Apotheken in drei US-Staaten eingingen, zeigten, dass auch E-Rezepte keineswegs fehlerfrei sind.
Die Ergebnisse zeigen, dass es sich hier auch nicht um "Ausrutscher" handelt, sondern um ein quantitativ und qualitativ häufiges und ernstes Versagen der Technik:
• Insgesamt 11,7% der Rezepte enthielten irgendeine Sorte von Fehler.
• Die Fehlerraten schwankten je nach Verschreibungssystem zwischen 5.1% und 37.5%.
• Auch wenn keines der Rezepte, die von einer Gruppe von Klinikern bewertet wurden, lebensgefährliche Fehler enthielt, enthielten insgesamt 4% aller Rezepte Fehler, die ernst genug waren, um zu einem unerwünschten Ereignis führen zu können. Dazu gehörten in einigen Fällen auch Hinweise zur Überdosierung.
• Der häufigste Fehler (60,7%) waren Auslassungen von Daten (z.B. Informationen über die Dauer der Einnahme, die Dosis oder Häufigkeit der Einnahme) über und zu dem verordneten Medikament.
• Damit sind E-Rezepte in etwa so fehlerträchtig wie das frühere Studien für handschriftliche Rezepte immer wieder nachgewiesen haben.
Die AutorInnen empfehlen in jedem Fall bei der weiteren Verbreitung von E-Rezeptausstellungssystemen systematisch auf Fehlerquellen zu achten und einige der offensichtlichsten Lücken im Verschreibungssystem zu schließen. So sollte z.B. technisch dafür gesorgt werden, dass in keinem Rezept wichtige Informationen nicht auftauchen, unvollständige Arzneimittelnamen "durchgehen" oder unangemessene Abkürzungen auftauchen. Außerdem empfehlen die AutorInnen, dass jede Angabe zur Dosis von einem eingebauten Rechner errechnet wird und nicht den "Rechenkünsten" der Ärzte überlassen bleibt.
Selbst wenn diese jetzt bekannt gewordenen Fehlerquellen aber technisch geschlossen werden können, sollte von der weiter fortbestehenden Möglichkeit von Fehlern bei der Ausstellung von E-Rezepten und bei anderen Highlights von E-Health ausgegangen werden, die nur durch IT- oder E-Health-kritische systematische Studien identifiziert werden können.
Warum werden eigentlich bei der Einführung dieser Technologien (z.B. bei der Ende dieses Jahres für 10% der GKV-Versicherten beendeten Zwangseinführung der elektronischen Gesundheitskarte) nicht vergleichbare harte und klare Nachweise eines evidenten Nutzen bzw. der Schadensfreiheit verlangt wie es in der Evidence based medicine für Arzneimittel oder neue Therapien immer mehr verlangt werden? Bei dieser Gelegenheit sollte auch im deutschen Gesundheitssystem nicht nur nach dem Auftreten von Fehlern geschaut werden, sondern auch die Versprechungen der Anbieter für die Versorgungsqualität und Wirtschaftlichkeit gründlich verifiziert und evaluiert werden.
Von dem Aufsatz "Errors associated with outpatient computerized prescribing systems" von Karen C Nanji et al., der in der Fachzeitschrift "Journal of American Medical Information Association (JAMIA)" am 29. Juni 2011 "Online First" veröffentlicht wurde, gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 3.7.11
Pharmavertreter und Medizinstudenten - eine verhängnisvolle Affäre
 Die meisten Medizinstudenten haben von Beginn ihres Studiums an Kontakt zu Pharmavertretern und nehmen gerne Einladungen zu Mahlzeiten und kleine Geschenke an. Dies und mehr fanden amerikanische Forscher in einer systematischen Übersichtarbeit heraus, in sie der Frage nach Kontakten von Medizinstudenten mit Pharmavertretern und ihrer Haltung gegenüber den Marketingpraktiken der Industrie nachgingen. Die Ergebnisse stützen sich auf 32 Studien, zumeist Befragungen, aus den Jahren 1971 bis 2010 mit insgesamt 9.850 Studenten an 76 Kliniken bzw. Lehrkrankenhäusern.
Die meisten Medizinstudenten haben von Beginn ihres Studiums an Kontakt zu Pharmavertretern und nehmen gerne Einladungen zu Mahlzeiten und kleine Geschenke an. Dies und mehr fanden amerikanische Forscher in einer systematischen Übersichtarbeit heraus, in sie der Frage nach Kontakten von Medizinstudenten mit Pharmavertretern und ihrer Haltung gegenüber den Marketingpraktiken der Industrie nachgingen. Die Ergebnisse stützen sich auf 32 Studien, zumeist Befragungen, aus den Jahren 1971 bis 2010 mit insgesamt 9.850 Studenten an 76 Kliniken bzw. Lehrkrankenhäusern.
Die häufigsten Interaktionen sind Industrie-gesponserte Fortbildung, Einladungen zum Essen, Geschenke wie Kugelschreiber und Tassen, Lehrbücher und Fortbildungsmaterialien, Sonderdrucke von Studien, Arzneimittelmuster und "social events", womit Einladungen in Restaurants, Konzerte, Theater und Sportereignisse gemeint sein dürften. Im vorklinischen Teil des Studiums waren die einzelnen Interaktionen teils selten - so gab es keine Einladungen zu feinem Essen - addierten sich aber auf, so dass fast alle Studenten Kontakt zur Industrie hatten. Im Verlauf des Studiums wurden die Kontakte mit jedem Semester häufiger.
Die Haltungen der Studenten bezüglich der Marketing-Praktiken unterschieden sich und waren teils gegensätzlich. Viele hielten Mahlzeiten, kleine Werbegeschenke und Lehrbücher bzw. Informationsmaterialien für akzeptabel, weniger Zustimmung fanden social events und Reisen. Geschenke anzunehmen rechtfertigten sie mit Geldknappheit und damit, dass es die anderen ja auch täten. Die Zustimmungsraten zur Annahme von Geschenken durch Studenten stiegen von der vorklinischen zur klinischen Phase des Studiums an, ebenso wie die Zustimmung zur Annahme von Geschenken durch Ärzte. Die große Mehrheit (85%) meinte hingegen, dass es für Regierungsbeamte unangemessen sei, Geschenke anzunehmen.
Die meisten Studenten (je nach Studie bis zu 92%) gingen davon aus, dass die Informationen der Industrie verzerrt sind. Nicht alle, aber viele Studenten waren trotzdem der Meinung, dass die Informationen nützlich für ihre Ausbildung sind. 2/3 waren der Meinung, gegenüber den Beeinflussungsversuchen der Industrie immun zu sein. Die meisten hielten ihre Mit-Studenten - im Gegensatz zu sich selbst - für beeinflussbar.
Je ausgeprägter die Kontakte zur Industrie waren, desto seltener hielten die Studenten die Kontakte für unangemessen, die Informationsmaterialien für verzerrt und generell die Marketing-Praktiken für negativ.
Deutliche Auswirkungen zeigte die jeweilige Lernumgebung. Manche Fakultäten bzw. Lehrkrankenhäuser beschränken oder unterbinden die Aktivitäten von Pharmavertretern. In diesen Einrichtungen waren die Interaktionen der Studenten mit Pharmavertretern deutlich seltener, ihre Einstellungen kritischer und die Einschätzung der Werbebotschaften skeptischer.
Befragt nach ihrer Einstellung zu Reformen lehnten es die meisten Studenten ab, den Pharmavertretern den Zugang zur Klinik zu verwehren. Die Mehrheit wünscht jedoch mehr Fortbildung in Fragen der Interaktion von Ärzten und Industrie.
Zusammenfassend entsprechen die Ergebnisse dieser Studie über Medizinstudenten dem, was man aus anderen Studien über Ärzte weiß:
• Die Mehrheit zeigt eine unkritische Haltung gegenüber den Marketinganstrengungen der Industrie.
• Die Mehrheit erkennt die Unzuverlässigkeit der Informationen der Industrie und hält sie trotzdem für wertvoll
• Die meisten halten sich für immun gegenüber den Beeinflussungsversuchen der Industrie, seine Kollegen nicht.
An anderer Stelle haben wir Studien referiert, die aufgezeigt haben,
• dass Ärzte in ihrem Verschreibungsverhalten durch das Marketing der Industrie beeinflusst werden mit dem Ergebnis einer schlechteren Arzneimittelversorgung (Link) und
• dass es keine Immunität gegenüber "weapons of influence" wie Reziprozität und Freundschaft gibt Link.
Austad KE, Avorn J, Kesselheim AS. Medical Students' Exposure to and Attitudes about the Pharmaceutical Industry: A Systematic Review. PLoS Med 2011;8(5):e1001037, Volltext kostenlos Link
Studie über Ärzte:
Lieb K, Brandtönies S. Eine Befragung niedergelassener Fachärzte zum Umgang mit Pharmavertretern. Dtsch Arztebl 2010;107(22):392-8. Link
dazu Forum Gesundheitspolitik: Ärzte und Pharmavertreter - eine verhängnisvolle Affäre Link
David Klemperer, 21.6.11
Die gar nicht so wettbewerblichen Methoden der US-Markenmedikamenthersteller, den Verkauf von Generika zu behindern!
 Die staatliche "Federal Trade Commission" (FTC) der USA und ihr "Bureau of Competition" berichten in einem aktuellen Verwaltungsbericht, dass 2010 die Anzahl der Deals der pharmazeutischen Industrie, mit denen mit allen Mitteln der Zugang zu preisgünstigeren und gleichwertigen Generika-Arzneimittel möglichst lange verzögert werden soll, gegenüber 2009 um 60% (von 19 auf 31 Fällen) gestiegen ist.
Die staatliche "Federal Trade Commission" (FTC) der USA und ihr "Bureau of Competition" berichten in einem aktuellen Verwaltungsbericht, dass 2010 die Anzahl der Deals der pharmazeutischen Industrie, mit denen mit allen Mitteln der Zugang zu preisgünstigeren und gleichwertigen Generika-Arzneimittel möglichst lange verzögert werden soll, gegenüber 2009 um 60% (von 19 auf 31 Fällen) gestiegen ist.
Die dem FTC und dem Justizministerium für das Jahr 2010 offiziell mitgeteilten 131 Patentverzögerungen beruhten in 31 Fällen auf direkten Zahlungen der Hersteller von Original-Arzneimittelherstellern an den Generikaproduzenten und auf diversen Einschränkungen ihrer Vermarktungsfähigkeiten. 66 finale Verzögerungen erschwerten die Fähigkeit des Generikaproduzenten sein Produkt zu vermarkten. Was dies im Einzelnen wirklich heißt und wie hoch die Dunkelziffer ist, bleibt leider auch in den veröffentlichten Berichten im Dunkeln. Geschützt werden sollten damit aber eindeutig und ausschließlich die wirtschaftlichen Interessen der Hersteller von 22 verschiedenen Originalpräparate mit einem Marktpreisvolumen von 9,3 Mrd. bis 20 Mrd. US-$.
Der Chef der FTC, Jon Leibowitz, fasste die Effekte dieser organisierten Verzögerungen des Markteintritts von Generika so zusammen: "The increasing number of these deals is a win-win proposition for the pharmaceutical industry, but a lose-lose for everyone else."
Und was "win-win" und "lose-lose" konkret bedeutet, wird von der FTC so quantifiziert:
• Die Stillhalteprämien zwischen den Markenmedikamente- und Generikahersteller führten in den vergangenen Jahren zu einem durchschnittlich 17 Monate späteren Markteintritt des Generikums.
• Durch den dadurch längeren wettbewerbsfreien Verbleib von Originalpräparaten auf dem Arzneimittelmarkt zahlen die us-amerikanischen Krankenversicherungen bzw. die Patienten jährlich mindestens 3,5 Mrd. US-$ mehr als sie bei vorhandenem Wettbewerb mit Generika bezahlen müssten.
Eine Presseerklärung vom 5. Mai 2011 mit der Überschrift "FTC Staff Report Finds 60 Percent Increase in Pharmaceutical Industry Deals That Delay Consumers' Access to Lower-Cost Generic Drugs" gibt es kostenlos. Ebenso den Report des "Bureau of Competition"Agreements Filed with the Federal Trade Commission under the Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003 Overview of Agreements Filed in FY 2010".
Für die vergleichbare Praxis vor 2010 und einige normative Grundlagen für diese Art von Wettbewerbsbehinderung gibt der im Januar 2010 ebenfalls von der FTC veröffentlichte 16-Seiten-Bericht "Pay-for-Delay: How Drug Company Pay-Offs Cost Consumers Billions. An FTC Staff Study" Auskunft. Auch dieser Bericht steht kostenlos zur Verfügung.
Bernard Braun, 10.5.11
Lücken in der Transparenz: Meta-Analysen zumeist ohne Angaben von Interessenkonflikten
 Angaben über Finanzierungsquellen und Interessenkonflikten von Autoren der zugrundeliegenden Studien sind in Meta-Analysen eher rar.
Angaben über Finanzierungsquellen und Interessenkonflikten von Autoren der zugrundeliegenden Studien sind in Meta-Analysen eher rar.
Dies ist das Ergebnis einer im Journal of the American Medical Association erschienenen Studie. Die Autoren suchten dafür in medizinischen Fachzeitschriften mit hohem Impact-Factor und in der Cochrane-Datenbank Systematischer Übersichtsarbeiten nach jeweils drei Meta-Analysen über pharmakologische Themen mit dem jüngsten Erscheinungsdatum. Ausgewertet wurden 29 Meta-Analysen.
Bei Meta-Analysen und Systematischen Übersichtsarbeiten handelt es sich um "Studien über Studien", d.h. um die Zusammenfassung der Ergebnisse der verfügbaren Primärstudien zu einer Frage. Die Primärstudien werden "nach expliziten Methoden identifiziert, ausgewählt und kritisch bewertet und die Ergebnisse extrahiert und deskriptiv (Systematische Übersicht) oder mit statistischen Methoden quantitativ (Meta-Analyse) zusammengefasst " (EBM-Glossar, Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin).
Die 29 Meta-Analysen umfassten insgesamt 509 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs). Nur in 2 der Meta-Analysen wurde über die Finanzierung der ausgewerteten RCTs berichtet. Verbindungen von Autoren zur Industrie oder Mitarbeiterstatus wurden von den Autoren der Meta-Analyse gar nicht mitgeteilt.
Eine Analyse aller 509 RCTs ergab Folgendes:
• in 318 Studien (63%) wurde die Finanzierungsquelle genannt
• 219 (69% bezogen auf 318 Studien) Studien waren von der Industrie finanziert
• in 132 RCTs wurden die finanziellen Verbindungen der Autoren veröffentlicht, in 91 Studien hatte ein oder mehr als ein Autor Verbindungen zur Industrie
• in 7 der 29 Meta-Analysen lag bei allen eingeschlossenen RCTs mindestens ein Interessenkonflikt vor, aber nur 1 dieser 7 Meta-Analysen berichtete über die Finanzierungsquellen und keine über die Verbindungen der Autoren zur Industrie.
Die Autoren weisen darauf hin, dass die Notwendigkeit einer vollständigen und transparenten Darlegung von Interessenkonflikten allgemein anerkannt und in vielen Bereichen Standard ist. So fordert das CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) statement die Nennung der Finanzierungsquelle und die Beschreibung der Rolle des Sponsors. Die im International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) zusammengeschlossenen Herausgeber medizinischer Fachzeitschriften fordern von ihren Autoren die Angabe materieller und anderer Interessenkonflikte.
Das PRISMA Statement (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) fordert für Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen die Offenlegung ihrer Finanzierung. Nicht gefordert wird hier jedoch die Einbeziehung der Finanzierungsquellen und Interessenkonflikte der Einzelstudien, die in die Analyse einbezogenen werden.
Die somit vorhandene Lücke ist besonders schwerwiegend, weil Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen Evidenz der höchsten Stufe darstellen und für Behandlungsentscheidungen aber auch für die Leitlinienerstellung genutzt werden. Die Verzerrungen, die in Industrie-gesponserten Studien häufig zu finden sind, können zur Folge haben, dass der Nutzen von Arzneimitteln überschätzt und die möglichen Schäden unterschätzt werden, was für den Patienten eine Gefährdung darstellen kann - eine Sammlung von Beiträgen im Forum findet sich hier.
Roseman M, Milette K, Bero LA, Coyne JC, Lexchin J, Turner EH, et al. Reporting of Conflicts of Interest in Meta-analyses of Trials of Pharmacological Treatments. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2011;305:1 Abstract
David Klemperer, 3.4.11
Zur gar nicht kleinen Rolle öffentlicher Einrichtungen bei der Entdeckung und Entwicklung neuer und hoch wirksamer Medikamente.
 Die Arzneimittelindustrie verweist auf die Frage nach ihren zum Teil insgesamt oder auch nur in Ländern wie Deutschland sehr teuren Produkten gerne auf den hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand für hoch wirksame Arzneimittel. Dies mag zum Teil so sein und der durch mehrstufige Erprobungsverfahren hohe und teure Aufwand ist auch notwendig und seinen Preis wert. Trotzdem verweist ein genauerer Blick auf das Forschungs- und Entwicklungsgeschehen einen nicht geringen Anteil dieses Aufwandes in den Bereich der interessierten Legendenbildung.
Die Arzneimittelindustrie verweist auf die Frage nach ihren zum Teil insgesamt oder auch nur in Ländern wie Deutschland sehr teuren Produkten gerne auf den hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand für hoch wirksame Arzneimittel. Dies mag zum Teil so sein und der durch mehrstufige Erprobungsverfahren hohe und teure Aufwand ist auch notwendig und seinen Preis wert. Trotzdem verweist ein genauerer Blick auf das Forschungs- und Entwicklungsgeschehen einen nicht geringen Anteil dieses Aufwandes in den Bereich der interessierten Legendenbildung.
In einer gerade im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie schauten sich Wissenschaftler nämlich gründlicher als andere ForscherInnen in der Vergangenheit die Entwicklung neuer Arzneimittel in den USA während der letzten 40 Jahre an. Sie wollten wissen, was an der alten aber immer noch weit verbreiteten Vorstellung stimmt, im öffentlichen Wissenschaftsbereich würde Grundlagenforschung über Krankheiten und ihre Ansatzpunkte und Mechanismen zur Heilung (so genannter "upstream") gemacht und in privaten Unternehmen sei vor allem die angewandte Forschung zur Entwicklung und Vermarktung von Arzneimittel (so genannter "downstream") verortet.
Dass daran nichts oder relativ wenig stimmt, machen die AutorInnen an den folgenden Funden fest:
• 153 von der Arzneimittelzuzahlungsbehörde FDA der USA im Betrachtungszeitraum zugelassenen neuen Arzneimnittel, Impfstoffe oder neuen Anwendungsindikationen bereits entwickelter Mittel wurden durch öffentliche Forschungseinrichtungen entdeckt und auch zum Teil bis zur Marktreife entwickelt worden. Darunter stellten Mittel zur Krebsprävention und zur Prävention von Infektionserkrankungen aber auch Mittel gegen seltene Erkrankungen den größeren Anteil dar.
• Der Anteil aller in öffentlichen Forschungseinrichtungen entdeckter Behandlungsmöglichkeiten und Arzneimittel an den zwischen 1990 und 2007 neu zugelassenen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten bewegt sich zwischen 9,3 % und 21,2 %.
• Den therapeutisch-klinisch wichtigen Effekt der im öffentlichen Bereich entdeckten Arzneimittel halten die AutorInnen für überproportional groß.
Eine wichtige Ergänzung ihrer Recherchen wäre der Nachweis der Weiter-oder Wiederexistenz von Tendenzen gewesen, dass die mit Steuer- oder anderen öffentlichen Mitteln entdeckten Therapeutika weit unter Wert von privaten Pharmahersteller erstanden und nicht selten als so genannte "Blockbuster" zur Marktreife gelangen, ohne dass ein nennenswerter "return of investment" für die öffentlichen Einrichtungen erfolgt.
Der Aufsatz "The Role of Public-Sector Research in the Discovery of Drugs and Vaccines" von Ashley J. Stevens et al. ist im "New England Journal of Medicine" (2011;364: 535-41) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Eine bereits im November letzten Jahres veröffentlichte Studie über insgesamt 252 Arzneimittel, deren Zulassung durch die FDA im wesentlich kürzeren und jüngeren Zeitraum zwischen 1998 und 2007 erfolgte, hatte vergleichbare Ergebnisse geliefert. Robert Kneller von der Universität Tokio verglich dabei den Anteil der Beiträge von Pharmaunternehmen, Biotech-Firmen und öffentlichen Forschungsinstituten an der Entwicklung neu zugelassener Medikamente. In dem Artikel The importance of new companies for drug discovery: origins of a decade of new drugs errechnet Kneller, dass 58 % der Neuentwicklungen auf das Konto der Pharmaindustrie und 18 % auf das von Biotech-Firmen gingen; bei insgesamt 24 % der Innovationen hatten öffentliche Einrichtungen wesentliche Vorarbeiten geleistet, die in zwei Drittel der Fälle Biotech-Firmen und in den übrigen Fällen Pharmaunternehmen zur Marktreife weiterentwickelten.
Bezieht man nun den erwarteten therapeutischen Nutzengewinn in die Betrachtung ein, geht der Anteil der von der Pharmaindustrie auf weniger als die Hälfte zurück (46 %) und der von Biotech-Firmen bleibt nahezu konstant gegenüber der Gesamtschau (23 %), während der Beitrag öffentlicher Einrichtungen immerhin bei fast einem Drittel der real innovativen Neuzulassungen liegt (30 %). Das bedeutet, dass nach Knellers Berechnungen nahezu jede dritte wichtige Entwicklung im Arzneimittelsektor auf die Leistungen öffentlicher Forschungseinrichtungen zurückgeht. Insgesamt stammen etwa die Hälfte aller von der FDA zwischen 1998 und 2007 zugelassenen, wissenschaftlich innovativen Arzneimittel und jedes Medikamente, das bis dahin nicht bestehende therapeutische Möglichkeiten eröffnete, von Biotechnologiefirmen und von Universitäten, die ihre Entdeckungen solchen kleineren Unternehmen übertrugen.
Enorme regionale Unterschiede bestehen bei den Forschungserfolgen der Pharmaindustrie, denn die großen Pharmafirmen liefern in den USA nicht mehr als 38 % der Erfindungen während in Deutschland 86 % der neuartigen Arzneimittel aus der Pharmaindustrie stammen. Offenbar spielt die öffentliche Forschung in Deutschland im Vergleich zu den USA eine weniger bedeutsame Rolle: Nur fünf der insgesamt 252 neuen Medikamenten entstanden an deutschen Hochschulen oder mit ihrer Beteiligung.
Von dem Artikel The importance of new companies for drug discovery: origins of a decade of new drugs steht nur das Abstract kostenfrei zur Verfügung.
Kostenfrei zugänglich ist hingegen ein auf diesen beiden Studien beruhender deutschsprachiger Beitrag zur Bedeutung der öffentlichen Pharma-Forschung und der nicht-traditionellen Pharmahersteller findet sich in der Januar-Ausgabe der Pharma-Briefs der Buko Pharmakampagne. Dieser Beitrag, den Sie hier auch einzeln herunterladen können, betont auch den Aspekt der so genannten Orphan-Drugs, also der Medikamente gegen seltene Erkrankungen, und beleuchtet zusätzlich die Frage der Forschung für typische Krankheiten in Entwicklungsländern, wo öffentliche Forschung eine noch größere Bedeutung hat.
Bernard Braun, 4.3.11
Ein Fall von Über- und Fehlversorgung: Antidepressiva haben bei "minor depression" keinen größeren Nutzen als Placebos!
 Je nach definitorischer Abgrenzung leiden 2,5 % bis 9,9 % der Bevölkerung und 5 % bis 16 % der primärärztlich versorgten Personen an einer so genannten "minor depression". Dabei handelt es sich um eine in bestimmten Zeitintervallen wiederkehrende aber dann nur kurz anhaltende depressive Störung und entsprechend manische und depressive Episoden kurzer Dauer. Die Erkrankung führt zu psychischem Leiden, einer signifikanten Verschlechterung der Gesundheit und hat eine beachtliche negative Wirkung auf die Lebensqualität. "Minor depression" ist zudem ein starker Risikofaktor für das Entstehen einer "major depression", bei der die Erkrankten wesentlich länger anhaltend und schwerer leiden und eingeschränkt sind. 10 bis 25 % der Personen mit einer "minor depression" entwickeln innerhalb von 1 bis 3 Jahren nach der Erkrankung an einer "minor depression" auch die schwerere Depressionsform.
Je nach definitorischer Abgrenzung leiden 2,5 % bis 9,9 % der Bevölkerung und 5 % bis 16 % der primärärztlich versorgten Personen an einer so genannten "minor depression". Dabei handelt es sich um eine in bestimmten Zeitintervallen wiederkehrende aber dann nur kurz anhaltende depressive Störung und entsprechend manische und depressive Episoden kurzer Dauer. Die Erkrankung führt zu psychischem Leiden, einer signifikanten Verschlechterung der Gesundheit und hat eine beachtliche negative Wirkung auf die Lebensqualität. "Minor depression" ist zudem ein starker Risikofaktor für das Entstehen einer "major depression", bei der die Erkrankten wesentlich länger anhaltend und schwerer leiden und eingeschränkt sind. 10 bis 25 % der Personen mit einer "minor depression" entwickeln innerhalb von 1 bis 3 Jahren nach der Erkrankung an einer "minor depression" auch die schwerere Depressionsform.
Nicht zuletzt diese Gefahr führte dazu, dass Personen mit der an sich "leichteren" Form einer Depression häufig antidepressive Arzneimittel und Benzodiazepine verordnet werden, die eigentlich für die Behandlung der "schweren" Form der Depression gedacht sind.
Ob dies wirklich einen Nutzen für die Erkrankten hat und/oder das Hineinwachsen in einer "major depression" verhindert wurde bisher erst in einer Handvoll randomisierter kontrollierter Studien untersucht. Ein systematischer Review und eine Metaanalyse der Effekte dieser Arzneimittel im Vergleich mit denen von Placebos stand aber fast erwartungsgemäß immer noch aus.
Italienische Wissenschaftler beendeten nun diesen Zustand und legten entsprechende Ergebnisse aus 6 RCTs vor. Deren Gesamtergebnisse sehen so aus:
• Bei Benzodiazepinen oder Tranquilizern fanden die Wissenschaftler trotz aufwändiger Suche in allen Standardquellen (z.B. in der Cochrane Library) keine Studie, die den Effekt dieser Arzneimittel mit dem Effekt von Placebos verglichen hatte. Der systematische Review kommt daher für diese Arzneimittel zu keiner Bewertung und Empfehlung. Vorsorglich weisen die Wissenschaftler aber auf das große Potential unerwünschter Wirkungen der meist notwendigen längeranhaltenden Behandlung mit Benzodiazepinen hin (z.B. Suchtabhängigkeit). Um zu einer positiven Nutzenbewertung zu kommen, müsse ihr nachgewiesener gesundheitlicher Nutzen schon extrem und eigentlich unvorstellbar hoch sein.
• Für Antidepressiva gibt es placebokontrollierte Interventionen. Diese zeigen in sämtlichen Studien für die Wirkung der beiden eingesetzten Mittel oder Substanzen keinen statistisch signifikanten Unterschied (RR=0,94). Ebenfalls kein signifikanter Unterschied existiert zwischen beiden Interventionstypen was das subjektive Annehmen (acceptability) der Arzneimittels oder des Placebos (RR=1,06) bei Patienten anbelangt.
Auch wenn die Studienautoren darauf hinweisen, dass sowohl die zum Teil geringe Anzahl von Patienten (drei Studien hatten weniger als 50 TeilnehmerInnen) als auch die bei allen 6 berücksichtigten Studien relativ kurze Nachuntersuchungszeit wichtige Beschränkungen für ihren Review darstellen, sind sie sich sicher, dass der unreflektierte Einsatz von Antidepressiva bei Patienten mit "minor depression" eine Form von Über- und/oder Fehlversorgung darstellt. Die Einnahme solcher Arzneimittel kann ohne gesundheitliche Nachteile für die Patienten unterlassen werden: "Doctors should still shift away from drug intervention as resources may be better spent elsewhere in the health system." Psychotherapeutische Interventionen haben beispielsweise bereits einen spezifischen Nutzen bei depressiven Patienten nachgewiesen und über weitere vergleichbare Ansätze sollte verstärkt nachgedacht werden.
Der Aufsatz "Efficacy of antidepressants and benzodiazepines in minor depression: systematic review and meta-analysis" von Barbui C, Cipriani A, Patel V, Ayuso-Mateos JL und M. van Ommeren ist im renommierten Fachjournal "British Journal of Psychiatry" (2011 Jan; 198:11-16) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.1.11
Auf niedrigem Niveau weiter fallend: Die öffentliche Reputation der Pharmaindustrie in den USA im Jahr 2009.
 Über die Art und Weise wie viele Pharmahersteller in der Öffentlichkeit agieren berichten mittlerweile eine Vielzahl von Medien - darunter auch das Forum-Gesundheitspolitik - regelmäßig. Dies gilt auch und vor allem für die Transparenz über ihre Methoden auch nutzlose, gesundheitsgefährdende oder überteuerte Arzneimittel auf den Markt zu bringen und dort so lange wie profitabel zu halten.
Über die Art und Weise wie viele Pharmahersteller in der Öffentlichkeit agieren berichten mittlerweile eine Vielzahl von Medien - darunter auch das Forum-Gesundheitspolitik - regelmäßig. Dies gilt auch und vor allem für die Transparenz über ihre Methoden auch nutzlose, gesundheitsgefährdende oder überteuerte Arzneimittel auf den Markt zu bringen und dort so lange wie profitabel zu halten.
Wie jetzt der aktuelle, elfte "Annual Reputation Quotient" des Meinungsforschungsinstituts "Harris interactive" für das Jahr 2009 zeigt, wirkt sich das Verhalten der Arzneimittelhersteller zumindest in den USA auch immer stärker auf das Ansehen der Branche und ihrer größten Vertreter aus.
Im RQ wurden 29.963 US-BürgerInnen nach ihrer Bewertung von 20 Attributen mit jeweils mehreren Unterpunkten gefragt, die als Komponenten von Reputation angesehen werden: vision & leadership, social responsibility, emotional appeal, products & services, workplace environment und financial performance. Aus den Antworten wird ein sogenannter RQ-Score gebildet. Der maximale Wert des Scores kann 100 Punkte betragen. Die Befragten müssen zuerst angeben, welche Unternehmen ihnen im Zusammenhang mit Reputation überhaupt einfallen und dann für diese die Reputationsfragen beantworten.
Die wichtigsten Ergebnisse im Jahr 2009 lauteten:
• Unter den 60 Unternehmen mit dem höchsten Reputationswert gibt es ein einziges Pharmaunternehmen, die Firma Pfizer. Mit 69 Punkten liegt sie auf Platz 40 der Rangliste, an deren Spitze mit jeweils über 80 Punkten Firmen wie Google oder Intel liegen.
• Die gesamte Branche erreicht 2009 29 Punkte. Noch weniger Reputationspunkte erreichen nur noch Fluggesellschaften, Versicherungs- und Finanzdienstleister (16) oder das fast ewige Schlusslicht, die Tabakindustrie mit 11 Punkten. Im Vergleich mit 2008 ist die Pharmaindustrie die einzige Branche, deren Reputation sinkt, und zwar um 2 Punkte.
Auch wenn selbst diese Resonanz in der Öffentlichkeit die Pharmaindustrie wenig beeindrucken dürfte, kann ihre geringe Reputation der interessierten Öffentlichkeit nicht völlig egal sein. Möglicherweise ist damit nämlich auch ein Verfall des Vertrauens in die Produkte der Branche verknüpft ist, die nützlich sind und bei denen es aber auch auf eine maximale Therapietreue ankommt. Die offensichtlich weitverbreiteten negativen Assoziationen, wenn es um Pharmahersteller und ihre Produkte geht, können diese beeinträchtigen.
Wer mehr über die Methode des RQ und die weiteren Ergebnisse wissen will, kann sich die knapp 30 Seiten umfassende Zusammenfassung des "Annual RQ. 2009 Summary Report. A survey of the U.S. General pubic using the reputation quo-tient" kostenlos herunterladen.
Dass es auch in Deutschland erhebliche Vertrauensdefizite gegenüber der Pharma-Industrie gibt, hatte eine repräsentative Bevölkerungsumfrage im Jahr 2009 gezeigt: Arzneimittel-Information: Deutsche haben ähnliche Vorbehalte gegenüber der Pharma-Industrie wie US-Bürger
Bernard Braun, 8.11.10
Industriegesponserte Studien sind einträglicher - Interessenkonflikte bei Herausgebern von Fachzeitschriften
 Fachzeitschriften können von der Veröffentlichung von Studien über den Anstieg des Impact Factor und über die Einnahmen aus Sonderdrucken profitieren. Diese Faktoren können die Entscheidung des Herausgebers über die Annahme oder die Ablehnung der Veröffentlichung einer Studie beeinflussen und stellen somit einen Interessenkonflikt dar.
Fachzeitschriften können von der Veröffentlichung von Studien über den Anstieg des Impact Factor und über die Einnahmen aus Sonderdrucken profitieren. Diese Faktoren können die Entscheidung des Herausgebers über die Annahme oder die Ablehnung der Veröffentlichung einer Studie beeinflussen und stellen somit einen Interessenkonflikt dar.
Medizinisches Wissen und Handeln gründet auf den Ergebnissen von Studien. Wichtigster Ort für die Veröffentlichung von Studien sind Fachzeitschriften - auch in Zeiten des Internet. Der Herausgeber einer Fachzeitschrift trifft die letzte Entscheidung darüber, ob eine eingereichte Studie angenommen oder abgelehnt wird. Diese Entscheidung sollte der Herausgeber im Idealfall ausschließlich aufgrund der Relevanz und Qualität der Studie treffen.
Die Autoren untersuchten die in den Zeiträumen 1995-1996 und 2005-2006 veröffentlichten randomisierten kontrollierten Studien in sechs renommierten medizinischen Journalen (Annals of Internal Medicine, Archives of Internal Medicine,
British Medical Journal / BMJ, Journal oft he American Medical Association / JAMA, The Lancet, New England Journal of Medicine /NEJM). Für diese Studien wurde die Finanzierungsquelle ermittelt und die Anzahl der Arbeiten, in denen die Studien zitiert wurden. Die Anzahl der zitierenden Arbeiten geht in den sog. Impact Factor ein, der als ein Maß für die Bedeutung einer Fachzeitschrift gilt - auch wenn dieses Maß fragwürdig ist (siehe z.B. Beitrag in Wikipedia).
Der Anteil der Arbeiten, die allein von der Industrie finanziert wurde betrug im Zeitraum 2005-2006
• 7% im BMJ,
• 19% in den Annals of Internal Medicine
• 15% in den Archives of Internal Medicine
• 26% im JAMA
• 22% im Lancet
• 32% im NEJM.
Die durchschnittliche Zahl der zitierenden Arbeiten liegt bei Industrie-finanzierten Studien allgemein höher. So wurden Industrie-finanzierte Studien aus dem NEJM im Durchschnitt 82,2 Mal zitiert, hingegen Studien ohne Industrieunterstützung 47,3 Mal.
Erfolgreiche Studien streuen Firmen gerne weltweit in Form von Sonderdrucken, die sie von den Verlagen für Beträge bis über 1 Mio. Dollar kaufen, wie Richard Smith, der frühere Herausgeber des BMJ mitteilte. Die Autoren befragten die Herausgeber der sechs Fachzeitschriften per Email, welchen Anteil ihrer Einnahmen Anzeigen, Sonderdrucke und Industrie-gesponserte Beilagen in den Jahren 2005-2006 ausmachten.
Antworten erhielten sie nur vom BMJ und vom Lancet - JAMA, NEJM sowie die Archives bzw. Annals of Internal Medicine verweigerten die Informationen.
Das BMJ erzielte 16% seiner Einnahmen aus Anzeigen und 3% aus den 967.930 verkauften Sonderdrucken. Der Lancet erzielte 1% seiner Einnahmen aus Anzeigen und 41% aus 11.514.137 Sonderdrucken. Aufgrund öffentlich zugänglicher Daten berechneten die Autoren für das NEJM den Einnahmenanteil aus Anzeigen auf 23% sowie für die Archives und das JAMA den Anteil aus Anzeigen auf 53% und aus Sonderdrucken auf 12%.
Diese Studie bestätigt deutlich, worauf Richard Smith schon 2005 (und früher) hingewiesen hat: mit der Annahme oder Ablehnung einer Industrie-gesponserten Studie entscheidet ein Herausgeber sowohl über den Impact Factor seines Journals als auch über die Einnahme oder Nicht-Einnahme von sechs- bis siebenstelligen Dollarbeträgen.
Deutlicher kann ein Interessenkonflikt nicht sein. Für den Umgang mit diesen Interessenkonflikten bestehen bislang keine anerkannten Regeln. In einem begleitenden Editorial weist Harvey Marcovitch auf die langjährigen und intensiven Bemühungen der Herausgeber im Umgang mit Interessenkonflikten von Autoren hin. Als Paradox bezeichnet er den Umstand, dass ausgerechnet Fachzeitschriften, die an diesem Aspekt wissenschaftlicher Integrität Pionierarbeit geleistet haben (insbesondere JAMA und NEJM), Offenheit und Transparenz verweigern, wenn es um ihre eigenen Interessenkonflikte geht.
Marcia Angell, bis 2001 Herausgeberin des NEJM, hat im Jahr 2009 festgestellt: "It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of TheNew England Journal of Medicine."
Entschiedene Schritte scheinen erforderlich, damit die medizinischen Fachzeitschriften ihre Glaubwürdigkeit wiedererlangen. Verzerrte Studienergebnisse führen zur Überschätzung des Nutzens und Unterschätzung des Schadens von Arzneimitteln - dies gefährdet Menschenleben, wie es sich zuletzt am Beispiel des Diabetes-Medikaments Avandia (Rosiglitazon) gezeigt hat (wir berichteten).
Lundh A, Barbateskovic M, Hrobjartsson A, Götzsche PC. Conflicts of Interest at Medical Journals: The Influence of Industry-Supported Randomised Trials on Journal Impact Factors and Revenue. A Cohort Study. PLoS Med 2010;7(10):e100035 Link zum Volltext
Richard Smith (2005). Medical journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies. PLoS Med 2005;2(5):e138. Link zum Volltext
Marcia Angell. Drug companies and doctors: A story of corruption. New York Review of Books 2009. Link zum Volltext
David Klemperer, 7.11.10
Warum verordnen Ärzte erkälteten Patienten "gegen besseres Wissen" immer noch viel zu viele Antibiotika?
 Mit der kühleren Jahreszeit steigt die Anzahl erkälteter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener schlagartig an. Damit steigt auch die Anzahl der Verordnungen von Antibiotika an und damit eine ursächlich meist nutzlose aber mittel- bis langfristig zu unerwünschten oder gar gefährlichen Effekten führende Fehlversorgung.
Mit der kühleren Jahreszeit steigt die Anzahl erkälteter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener schlagartig an. Damit steigt auch die Anzahl der Verordnungen von Antibiotika an und damit eine ursächlich meist nutzlose aber mittel- bis langfristig zu unerwünschten oder gar gefährlichen Effekten führende Fehlversorgung.
Nutzlos, weil es sich bei Erkältungskrankheiten und verwandten Erkrankungen meist um Virusinfektionen handelt, Antibiotika aber nur bei bakteriellen Infektionen wirksam und nützlich sind.
Gefährlich, weil auch nutzlose Antibiotika zur Entwicklung resistenter Erreger führen und damit das Risiko künftig nicht mehr behandelbarer Erreger mit erhöhen.
Dass dieses Problem nicht nur in Deutschland besteht, sondern auch in europäischen Nachbarländern, zeigt ein soeben im Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics (Volume 35, Issue 6 Page 617-736) veröffentlichter Artikel aus Polen. Unter dem Titel Antibiotics in the treatment of upper respiratory tract infections in Poland. Is there any improvement?, von dem das Abstract kostenfrei erhältlich ist, hinterfragen Wissenschaftler verschiedener polnischer Universitäten den ungerechtfertigten und potenziell schädlichen Einsatz von Antibiotika bei Infektionen der oberen Luftwege.
Warum viele Ärzte trotz dieses hinlänglich wissenschaftlich belegten und auch verbreiteten Wissens Antibiotika bereits ab dem Kleinkindalter zu häufig verordnen, liegt nach ihrer hartnäckig vertretenen Ansicht und Erfahrung an den Patienten oder ihren Eltern selber. Diese drängten Ärzte derart massiv, Antibiotika zu verordnen und drohten dabei auch, den Arzt zu wechseln, dass ihnen gar nichts übrig bliebe auch "wider besseres Wissen" doch Antibiotika zu verordnen.
An dieser "Schlachtordnung" weckt oder fördert die Lektüre einer bereits im September 2010 veröffentlichten Befragungsstudie in der deutschen Bevölkerung erhebliche Zweifel. Bereits 2008 versuchten nämlich Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) genauer zu ermitteln, inwieweit die deutsche Bevölkerung von ihren Ärzten erwartet, bei einer normalen Erkältung Antibiotika verschrieben zu bekommen. Dazu wurden 1.778 zufällig aus rund 30.000 Internetnutzern ausgewählte Personen online befragt.
Die wichtigsten Befragungsergebnisse lauten:
• Nur 7,7 Prozent der Befragten sagten, sie würden gerne ein Antibiotikum erhalten und brächten diese Erwartung auch zu einem Arztbesuch mit.
• 47,3 Prozent wollen zuerst einmal untersucht werden und dann einen Rat für den weiteren Umgang mit der Erkrankung sowie bei Bedarf eine Krankschreibung erhalten.
• 44,4 Prozent möchten Mittel zur Beseitigung der Erkältungssymptome, beispielsweise schmerzstillende Mittel oder Hustenbonbons. 18,2 Prozent erwarten pflanzliche oder alternative Therapeutika. Ebenso viele meinen, ihr Arzt solle entscheiden, was zu tun sei.
• Unter den wenigen, die erklärtermaßen eine Antibiotika-Verordnung erwarten, würde sich der Großteil (70,8%) passiv verhalten und dem Arzt vertrauen, wenn dieser eine solche Verordnung von sich aus aktiv für unnötig halten würde. 7,1 Prozent wären zwar unzufrieden, würden aber die Entscheidung ihres Arztes akzeptieren. 12,4 Prozent würden an ihrem Wunsch festhalten aber nur 2,7 Prozent einen anderen Arzt konsultieren. Da sich dieser Anteil nur auf die 7,7 Prozent derjenigen bezieht, die überhaupt ein Antibiotikum erwarten, sind es also gerade einmal 0,21 Prozent aller erkälteten Patienten, die ein Arzt nach der Ablehnung einer Antibiotika-Verschreibung vermutlich verlieren würde. Nur bei 0,95 Prozent träfe ein Arzt, der kein Antibiotikum verordnen will, auf hartnäckigen Widerstand, der ihn u.U. viel Zeit kosten würde.
• Die Befragungsergebnisse zeigen außerdem, dass viele Patienten fast durchweg ein fachlich korrektes Wissen um den Sinn und die Risiken von Antibiotika haben. Trotzdem stimmt immer noch eine starke Minderheit der Behauptung zu, Antibiotika seien gegen Viren wirksam und daher geeignet, Erkältungserkrankungen zu behandeln. Die somit offensichtliche Bereitschaft, im Krankheitsfall "für alle Fälle" nach jedem "Strohhalm" zu greifen, zeigt den Aufklärungsbedarf durch Krankenkassen und Ärzte. Dies gilt auch für die Befragten, die auf bestimmte Fragen keine Antworten geben können.
• Eine weitere wichtige Frage war, ob die Einstellungen und Verhaltensweisen von erkälteten Personen möglicherweise von ihrem Wissensstand abweichen. So stimmen rund 94 Prozent der Be-fragten "voll" oder "eher" der Aussage zu, Antibiotika nur einzunehmen, wenn sie absolut nötig sind. Welche Notwendigkeiten dies sein könnten, zeigen die weiteren Fragen und Antworten. Hier stimmen dann immerhin 32 Prozent der Aussage zu, dass Antibiotika bei wichtigen Ereignissen wie einer Prüfung oder Hochzeit hilfreich und daher angebracht seien. Am wenigsten, nämlich nur rund sieben Prozent der Befragten waren der Meinung, Antibiotika würden bei Halsschmerzen "Schlimmeres verhindern".
• Ein für die Patientenaufklärung wichtiges Ergebnis ist der niedrigere aber immerhin noch durchaus respektabel vorhandene Wissensstand über Antibiotika und ihren richtigen Gebrauch bei Jugendlichen. Alle Befragten beantworteten im Durchschnitt 5,18 der acht Wissensfragen zu den Mitteln richtig. Die jüngste Gruppe der 15- bis 19-Jährigen gab 4,17 richtige Antworten. Auf die acht Fragen zum verantwortungsvollen Gebrauch der Mittel gaben alle Befragten im Durchschnitt 6,29 korrekte Antworten, bei den 15- bis 19-Jährigen nur 5,77. Doch auch diese Unterschiede bieten keinen Anlass zu der Befürchtung, dass Jugendliche besonders aggressiv auf die Verordnung von Antibiotika drängen. Auch für die Kinder unter 15 Jahren ergeben sich keine Hinweise auf eine besonders hohe aktive Nachfrage nach Antibiotika. Und auch für erhebliche Wissenslücken und Fehleinstellungen in der Elterngeneration gibt es keine Hinweise, im Gegenteil: In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen werden Wissensfragen sogar überdurchschnittlich gut (5,35 und 5,62 richtige Antworten) beantwortet. Dies trifft auch für die Anzahl richtig beantworteter Gebrauchsfragen zu (6,34 bis 6,50 richtige Antworten).
Die Untersuchung könnte einige methodische Verzerrungen haben (z.B. die Durchführung mit Internet-Usern) und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der Befragten als sozial erwünscht betrachtete Antworten "kontra Antibiotika" gegeben hat und ihr Verhalten in der Arztpraxis von ihrem Befragungsverhalten abweicht. Trotzdem ist es völlig unwahrscheinlich, dass sämtliche Befragten in der Praxissituation plötzlich enthemmt und gegen ihre ja durchaus artikulierten kognitiven Vorbehalte Antibiotika fordern. Und selbst, wenn man sich das Verhalten der in dieser Studie evtl. unterrepräsentierten Personen vorstellt, kann dies nicht nur aus "Antibiotika-Gier" bestehen und würde auch quantitativ nicht ausreichen, das von Ärzten bemühte Verhalten der Mehrzahl ihrer Patienten zu bestätigen.
Internationale Studien, die auch noch ausführlicher im Forum vorgestellt werden, zeigen außerdem, dass selbst dann ärztliche Aufklärung und die Kommunikation über positive konkrete Behandlungspläne (Vermeidung von reiner Verbotskommunikation!) Patienten umstimmen können.
Die Studie "Antibiotics for the common cold: expectations of Germany's general populati-on" von Faber MS, Hecken-bach K, Velasco E und Eckmanns T. ist in der Fachpublikation "Euro Surveillance" (2010; 15(35):pii=19655) veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.10
Künftige Arzneimittel-Romanschreiber werden es schwer haben, die Wirklichkeit bei GlaxoSmithKline zu übertreffen.
 Noch am Fuße der Presseerklärung, in der die Firma GlaxoSmithKline (GSK), also einer der weltweit führenden Pharmakonzerne, erklären muss, Strafgelder von insgesamt 750 Millionen US-Dollar für die wissentliche jahrelange Duldung schwerster Qualitätssicherheitsmängel und den Weiterverkauf möglicherweise gefährlich kontaminierter Arzneimittel zu zahlen, steht offentlich unbeeindruckbar das Selbstlob: "is committed to improving the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer."
Noch am Fuße der Presseerklärung, in der die Firma GlaxoSmithKline (GSK), also einer der weltweit führenden Pharmakonzerne, erklären muss, Strafgelder von insgesamt 750 Millionen US-Dollar für die wissentliche jahrelange Duldung schwerster Qualitätssicherheitsmängel und den Weiterverkauf möglicherweise gefährlich kontaminierter Arzneimittel zu zahlen, steht offentlich unbeeindruckbar das Selbstlob: "is committed to improving the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer."
Bei dem damit öffentlich bekanntwordenen und ausführlich in der Ausgabe der New York Times vom 26. Oktober 2010 dargestellten Arzneimittelsicherheitsskandal geht es kurz gefasst um Folgendes:
• In einer der weltweit größten Produktionsanlagen der Firma, Cidra bei San Juan in Puerto Rico (USA), mit einem zu Hochzeiten jährlichen Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar wurden bis 2009 u.a. 20 Arzneimittel hergestellt, darunter Blockbuster wie Avandia oder Tagamet.
• In dieser Fabrikanlage gab es eine Kumulation von Verseuchungsrisiken, das von der vollkommen verschmutzten betriebseigenen Wasseranlage bis zu einem Belüftungssystem reichte, das verseuchte Luft, Keime und gefährliche Mikroorganismen im gesamten Betrieb verteilte.
• Der Verdacht über derartige Zustände war der staatlichen US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA bereits Anfang 2002 gekommen und sie teilte ihn der Firma GSK auch mit. Diese schickte dann im August 2002 eine Spezialistin nach Puerto Rico und ließ die dortigen Verhältnisse von insgesamt 100 Qualitätsexperten untersuchen. Diese entdeckte selber, dass die dortige Qualitätskontrolle eine "einzige Schweinerei" war. Neben der verkeimten Wasseranlage und dem maroden Belüftungssystem entdeckte sie z.B. noch, dass Arzneimittel wegen überfüllter spezieller Lagerräume in gemieteten Kraftfahrzeugen gelagert wurden, dass die Fabrik auch nicht die Sterilität von intravenösen Krebsmedikamenten gewährleisten konnte und Pillen unterschiedlicher Stärke manchmal in ein und derselben Dose landeten.
• Obwohl die Expertin führenden Mitgliedern des GSK-Managements die eindeutigen Probleme berichtete und auch empfahl damit zu beginnen die unsicheren und meist gesundheitsgefährdenden Medikamente zurückzurufen, passierte praktisch nichts. Im Mai 2003 wurde ihr Arbeitsverhältnis unter Hinweis auf Arbeitsmangel ("redundancy") beendet.
• Sie beschwerte sich bei Vorstandsmitgliedern von GSK und drohte dabei sogar, ihre Ergebnisse der FDA mitzuteilen, ohne dass GSK mit der Beendigung der bekannten Zustände begann.
• Daraufhin machte die Spezialistin mit ihrer Ankündigung ernst, informierte die FDA und verklagte die Firma auch auf Schadenersatz.
• Die FDA startete darauf eine Kriminaluntersuchung und ließ 2005 durch hunderte von bewaffneten Polizisten in der Fabrik in Puerto Rico Produkte im Wert von nahezu 2 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen.
• Unfähig, an den Sicherheitsproblemen in der Fabrik etwas zu ändern, schloss GSK sie im Jahr 2009. In ihrer Presseerklärung vom 25. Oktober 2010 brachte ein Topmanager des Unternehmens diese Unfähigkeitserklärung auf den Punkt: "We regret that we operated the Cidra facility in a manner that was inconsistent with current Good Manufacturing Practice (cGMP) requirements and with GSK's commitment to manufacturing quality. GSK worked hard to resolve fully the manufacturing issues at the Cidra facility prior to its closure in 2009 and we are committed to continuous improvement in our manufacturing processes."
Die eingangs erwähnte Summe von einer dreiviertel Milliarde US-Dollar umfassende Strafe bezahlt GSK nach eigenem Bekunden u.a. um weitere straf- und zivilrechtliche Verfahren vor mehreren US-Gerichten zu stoppen und auch weitere Aktivitäten von so genannten "whistle-blower" zu verhindern.
Die in der genannten Presserklärung des Unternehmens enthaltene abwiegelnde Bemerkung, es gäbe seit 2001 keinen vergleichbaren Warnhinweis des FDA, ist angesichts der fast ein Jahrzehnt dauernden Unfähigkeit oder des konstant fehlenden Willens nach dem Bekanntwerden des Problems substantiell Abhilfe zu verschaffen, eigentlich nicht beruhigend.
Der ausführliche Artikel in der New York Times vom 26. Oktober 2010 ist kostenlos und evtl. mit geringem Anmeldeaufwand erhältlich.
Und natürlich gilt dies auch für die GSK-Pressemitteilung zur Zahlung der Strafe. Und selbst angesichts dieses Schaustücks über Vertuschung und billigendem Inkaufnehmen von lebensgefährlichen Auswirkungen eigener Qualitätsmängel auf kranke Menschen, offenbart der Pharmakonzern ein seltsames oder fragwürdiges Verständnis von Transparenz. Er startet seine Pressemitteilung nämlich öffentlich mit der Bemerkung: "This press release is intended for business journalists and analysts/investors. Please note that this release may not have been issued in every market in which GSK operates."
Bernard Braun, 29.10.10
Free the data! Verheimlichte Daten führen zu falscher Bewertung. Das Beispiel Reboxetin.
 Veröffentlichte Arzneimittelstudien, die von der Industrie gesponsert werden, führen häufig zu einer Überschätzung des Nutzens und einer Unterschätzung der Schäden. Dies ist verschiedenen Manipulationsmethoden geschuldet, deren Anwendung durch industrielle Sponsoren in zahlreichen Fällen erwiesen ist. Wir berichten dazu in der Rubrik "Einflussnahme der Pharma-Industrie". Eine der Methoden besteht darin, Studien mit unerwünschten Ergebnissen nicht zu veröffentlichen, was zu einer verzerrten Bewertung führt, dem sog. Publikationsbias.
Veröffentlichte Arzneimittelstudien, die von der Industrie gesponsert werden, führen häufig zu einer Überschätzung des Nutzens und einer Unterschätzung der Schäden. Dies ist verschiedenen Manipulationsmethoden geschuldet, deren Anwendung durch industrielle Sponsoren in zahlreichen Fällen erwiesen ist. Wir berichten dazu in der Rubrik "Einflussnahme der Pharma-Industrie". Eine der Methoden besteht darin, Studien mit unerwünschten Ergebnissen nicht zu veröffentlichen, was zu einer verzerrten Bewertung führt, dem sog. Publikationsbias.
Ein aktuelles Beispiel wird in einer Studie dargelegt, die jetzt im British Medical Journal erschienen ist. Darin geht es um die Substanz Reboxetin, die unter den Markennamen Edronax und Solvex gegen Depression eingesetzt wird. Im Jahr 2009 wurden in Deutschland noch 13,3 Mio. Tagesdosen an gesetzlich Krankenversicherte verschrieben (Arzneimittelreport 2010, S. 815), was einem eher kleinen Anteil an der Gesamtverschreibung von Antidepressiva (1.580 Mio. Tagesdosen) ausmacht.
Im Jahr 2009 sollte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) den Nutzen von Reboxetin und anderen Antidepressiva bewerten. Dabei wurde deutlich, dass der Hersteller Pfizer nicht alle durchgeführten Studien veröffentlicht hat. Pfizer weigerte sich anfangs, die nicht veröffentlichten Studien dem IQWiG zur Verfügung zu stellen, gab aber in der Folge aufgrund öffentlichen Drucks nach (wir berichteten).
Der Zugang zu den bislang unveröffentlichten Studien zu Reboxetin ermöglicht den Vergleich der Nutzenbewertung mit und ohne Einbezug der unveröffentlichten Studien. Insgesamt werteten die Wissenschaftler des IQWiG 13 Studien zur Akutbehandlung der Depression mit 4.098 Patienten aus. Acht dieser 13 Studien waren nicht veröffentlicht. Damit waren bislang die Daten von 3.033 Patienten nicht berücksichtigt. Pfizer hatte somit 74% der vorhandenen Daten zurückgehalten.
In den 13 Studien wurde die Wirkung von Reboxetin im Vergleich zu Plazebo bzw. zu anderen Antidepressiva untersucht. Das Ergebnis lautet, dass Reboxetin ineffektiv bezüglich der erwünschten depressionsmindernden Wirkung und somit zur Behandlung der Depression ungeeignet ist. Patienten, die Reboxetin einnahmen, gaben mehr unerwünschte Wirkungen an als Patienten, die ein anderes Antidepressivum oder Plazebo erhielten.
Die veröffentlichten Studien überschätzten die erwünschten Wirkungen im Vergleich zu Plazebo um 115%, im Vergleich zu anderen Antidepressiva um 23% und sie unterschätzten die unerwünschten Wirkungen.
Somit hat der Hersteller die Zulassungsbehörden, die Ärzte und die Patienten mit einem geschönten Bild dieses im Jahr 1997 zugelassenen Arzneimittels getäuscht.
Aus diesem Sachverhalt leiten verschiedene Kommentatoren eine Reihe von Forderungen ab, wie z.B. das Recht von Prüfinstitutionen (wie z.B. das IQWiG) auf Erhalt aller Daten und das Recht von den Herausgebern von Fachzeitschriften, in Zweifelsfällen Einblick in die Rohdaten einer Studie nehmen zu können.
Lesenswert ist eine aktuelle Meldung von Pfizer, in der es blauäugig heißt: "Auch dem IQWiG liegen alle verfügbaren und bekannten Studien zu Reboxetin vor. Nachdem das IQWiG zu dem Ergebnis gekommen war, dass weitere Daten für die Bewertung des Nutzens des Präparats erforderlich seien, hat Pfizer diese zur Verfügung gestellt." Das Pfizer die Herausgabe erst verweigert hat, wird hier dreist unterschlagen.
Eyding D, Lelgemann M, Grouven U, Härter M, Kromp M, Kaiser T, et al. Reboxetine for acute treatment of major depression: systematic review and meta-analysis of published and unpublished placebo and selective serotonin reuptake inhibitor controlled trials. BMJ 2010;341.
Volltext kostenlos.
Editorial der Herausgeberinnen des British Medical Journal:
Godlee F, Loder E. Missing clinical trial data: setting the record straight. BMJ 2010;341. Volltext kostenlos
Kommentar von zwei früheren Herausgebern des New England Journal of Medicine.
Steinbrook R, Kassirer JP. Data availability for industry sponsored trials: what should medical journals require? BMJ 2010;341. Volltext kostenlos
Kommentar
Gigerenzer G, Wegwarth O, Feufel M. Misleading communication of risk. BMJ 2010;341. Volltext kostenlos
David Klemperer, 15.10.10
Europäische Arzneimittelbehörde: Rosiglitazon soll vom Markt
 Die Zulassung für das Diabetesmittel Rosiglitazon (Avadia®) aufheben, lautet die am 23.9. ausgesprochene Empfehlung des Ausschusses Humanarzneimittel (CHMP) der Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde (EMA) an die Europäische Kommission. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat noch am selben Tag bekannt gegeben, dass Rosiglitazon ab 1. November in Deutschland nicht mehr verkauft werden darf. Ebenfalls am selben Tag hat der Hersteller GlaxoSmithKline einen sog. Rote-Hand Brief an alle Ärzte in Deutschland verschickt.
Die Zulassung für das Diabetesmittel Rosiglitazon (Avadia®) aufheben, lautet die am 23.9. ausgesprochene Empfehlung des Ausschusses Humanarzneimittel (CHMP) der Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde (EMA) an die Europäische Kommission. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat noch am selben Tag bekannt gegeben, dass Rosiglitazon ab 1. November in Deutschland nicht mehr verkauft werden darf. Ebenfalls am selben Tag hat der Hersteller GlaxoSmithKline einen sog. Rote-Hand Brief an alle Ärzte in Deutschland verschickt.
Die Zulassungsbehörden begründen ihre Entscheidung mit einer Neubewertung der Nutzen-Risiko-Relation auf Grund kürzlich veröffentlichter Studien.
Damit gelangt eine Angelegenheit zu einem vorläufigen Ende, die in mehrfacher Hinsicht die Gefahren derzeitiger Arzneimittelregelungen für die Patienten aufgezeigt hat. Wir berichteten mehrfach. Hier einige Aspekte:
• Rosiglitazon wurde 1999 in den USA und im Juli 2000 in Deutschland als Avandia® zur Behandlung des Diabetes mellitus zugelassen, weil es den Blutzucker zu senken vermag. Der Nachweis für eine Minderung von Mortalität und / oder Morbidität wurde nie erbracht. Vielmehr lagen bereits vor der Zulassung deutliche Hinweise für ein erhöhtes Risiko für Herzschwäche und für Herzinfarkte vor.
• Das Fazit des arzneimittel-telegramms zu Rosiglitazon am 21. Juli 2000 lautete folgendermaßen:
"Das neue Diabetes-Mittel Rosiglitazon (AVANDIA) ist wegen Wirkschwäche nur als Zusatztherapeutikum zugelassen. Es handelt sich unseres Erachtens um ein bedenkliches Arzneimittel. Rosiglitazon kann lebensbedrohliche Herzinsuffizienz und Leberversagen auslösen. (...) Diesen gefährlichen Risiken steht kein adäquater Nutzen gegenüber. Deshalb täuscht die Werbung - 'sehr gut vertraeglich' - Anwender und Patienten. Die Marktzulassung des Mittels können wir nicht nachvollziehen."
• Der Hersteller hat vor und nach der Zulassung Daten zur (Un-) Sicherheit von Rosiglitazon nicht veröffentlicht. Dies ist durch interne Dokumente zweifelsfei belegt (Committe on Finance, 12.7.2010 und Januar 2010, Forum Gesundheitspolitik).
• Die Europäische Zulassungsbehörde verpflichtete den Hersteller GlaxoSmithKline zu einer Studie, in der die Herz-Kreislauf-Komplikationen überprüft werden sollten, die sog. RECORD-Studie. Dabei akzeptierte die Behörde ein defizitäres Studiendesign - eine nicht verblindete randomisierte kontrollierten Studie. Die Ergebnisse dieser Studie sind aus verschiedenen Gründen nicht glaubhaft.
• Interessenkonflikte beeinflussen die Bewertung der vorliegenden Daten in hohem Maße. Wissenschaftler, die finanzielle Zuwendungen vom Hersteller erhielten, schätzten die Risiken von Rosiglitazon zumeist viel niedriger ein als unabhängige Wissenschaftler (Forum Gesundheitspolitik).
Mit einer durch Interessenkonflikte verzerrten Urteilsfähigkeit lässt sich möglicherweise erklären, warum die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) sich noch Ende Juni in einer Erklärung vehement gegen die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) geforderte Beendigung der Erstattungsfähigkeit von Rosiglitazon ausgesprochen hat. Die Hinweise der DDG, die Beschlüsse des GBA in den letzten 2 Jahren hinsichtlich der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2
- würden die Therapie auf den Stand der frühen 80iger Jahre zurückwerfen,
- stünden im Widerspruch zu den Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft und zu internationalen Leitlinien,
- stünden im Widerspruch zu den Maßgaben der nationalen und internationalen Zulassungsbehörden
entbehren nicht einer gewissen Ironie. Wenige Wochen nach dieser Beschimpfung des GBA durch die DDG revidierte die Europäische Zulassungsbehörde ihr Urteil im Sinne des GBA.
Die Zulassung und Rücknahme von Rosiglitazon ist ein Lehrbeispiel (das hier nur skizziert werden kann) für
• die fehlende Orientierung der Arzneimittelzulassung an den Patienteninteressen,
• die Möglichkeiten der Industrie, Daten zur Sicherheit zu unterdrücken oder gar nicht erst zu generieren,
• die lange Dauer zwischen dem Auftreten gravierender Sicherheitsbedenken und dem Handeln der Zulassungsbehörden,
• die unselige, wenn nicht verwerfliche Rolle einiger Meinungsführern innerhalb der Diabetes-Community sowie von Diabetes-Fachgesellschaften, die mit einer unkritisch-befürwortenden Haltung wesentlich zur Zulassung und Verbreitung von Rosiglitazon beigetragen haben,
• die industriefreundliche und Verbraucher-gefährdende Haltung einer Patientengruppe, wie z.B. dem Deutschen Diabetiker Bund, wie sie sich z.B. in dieser Pressemitteilung vom 30.6.2010 zeigt,
• die unzureichende Bedeutung des Verbraucherschutzes, die sich noch im Widerspruch des Bundesgesundheitsministeriums vom 4.8.2010 (Schreiben des BMG) gegen den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 17.6.2010 (Beschlusstext) zum Ausschluss der Verordnungsfähigkeit von Rosiglitazon zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung zeigt.
Rosiglitazon hätte nie zugelassen werden dürfen und hat bei fehlendem Nutzennachweis vielen Patienten Krankheit und Tod gebracht.
Vertiefung:
Forum Gesundheitspolitik:
"These data should not see the light of day to anyone outside of GSK". Risikowissen vorsätzlich durch Hersteller unterdrückt! Link
Täuschen, leugnen, desinformieren und einschüchtern - Strategien von GlaxoSmithKline zur Vermarktung ihres Diabetes-Blockbusters Link
Lehrstück "Rosiglitazone und Herzinfarktrisiko" zum Zweiten - Assoziation von finanziellen Interessenskonflikten und Bewertung. Link
Gar nicht rosig. Ein Diabetesmittel, das es nicht geben dürfte Download
Committee on Finance. Staff Report on GlaxoSmithKline and the Diabetes Drug Avandia Download
Steven Nissen. Setting the RECORD Straight. JAMA, 24.3.2010 Download
besonders lehrreich und mit internen Aussagen aus den Zulassungsbehörden gespickt:
Cohen D. Rosiglitazone: what went wrong? BMJ 2010 6.Sept 2010 Download Volltext (kostenlos)
David Klemperer, 26.9.10
Studienregister - kein Schutz vor manipulierten Studien
 Die Integrität biomedizinischer Forschung gilt als gefährdet. So ist z.B. die Nicht-Veröffentlichung ganzer Studien oder der Teile, die den Interessen industrieller Sponsoren widersprechen, gängige Praxis (Rubrik "Einflussnahme der Industrie").
Die Integrität biomedizinischer Forschung gilt als gefährdet. So ist z.B. die Nicht-Veröffentlichung ganzer Studien oder der Teile, die den Interessen industrieller Sponsoren widersprechen, gängige Praxis (Rubrik "Einflussnahme der Industrie").
Eine Reaktion der Politik auf die Missstände sind Studienregister, in denen vor Beginn bestimmte Angaben über die jeweilige Studie hinterlegt werden sollen. So hat das International Committe of Medical Journal Editors die Registrierung von Studien vor ihrem Beginn ab 2005 zur Voraussetzung der Veröffentlichung gemacht.
Die amerikanische Regierung hat mit ClinicalTrals.gov im Jahr 1999 ein öffentlich zugängliches Register für Studien über Arzneimittel und Hilfsmittel geschaffen, die in den USA zugelassen werden sollen.
Eine Studie untersuchte jetzt, wie es sich bei registrierten Studien mit dem Zusammenhang von Sponsor und der Studie verhält.
Hierfür wurden die in clinicaltrial.gov registrierten Studien aus folgenden 5 Arzneimittelkategorien herangezogen: Lipidsenker, Antidepressiva, Neuroleptika, Protonenpumpen-Inhibitoren und Vasodilatantien. Der Beginn der Studien lag nach dem 1.1.2000, das Ende vor dem 31.12.2006. So konnte auch geprüft werden, ob die Studien drei Jahre nach ihrer Beendigung veröffentlicht waren oder nicht.
Die Studien bezogen sich auf die Wirksamkeit, Sicherheit bzw. Nicht-Unterlegenheit (non-inferiority trials) der Arzneimittel.
Unterschieden wurde die drei Kategorien Sponsoring der Industrie, des Staates sowie Non-profit nicht-staatlich.
Gefunden wurde 546 Studien, die folgendermaßen finanziert waren:
• 346 (63%) von der Industrie
• 74 (15%) staatlich
• 126 (23%) non-profit / nicht-staatlich
Die Industrie war weiterhin beteiligt an
• 3 (4 %) der staatlichen Studien
• 126 (48%) der non-profit /nicht-staatlichen Studien
Der Anteil der positiven Ergebnisse unterschied sich je nach Sponsor:
• Industrie 85,4%
• Staat 50%
• nicht-staatlich / non-profit 71,9%
Studien aus der 3. Kategorie mit Industriebeteiligung fielen zu 85,0% positiv aus, ohne zu 61,2%.
Die Veröffentlichungsraten 24 Monate nach Beendigung lag insgesamt bei 39,7% und je nach Sponsor bei
• 32,4% Industrie
• 53,7% Staat
• 56,2% nicht-staatlich / non-profit insgesamt und
• 39,0% nicht-staatlich / non-profit mit Industriebeteiligung.
Diese Studie belegt, dass auch bei registrierten Studien die Ergebnisse den kommerziellen Interessen des industriellen Sponsors folgen. Über die Methoden, mit denen Studien manipuliert werden können, haben wir berichtet.
Bourgeois, F. T., S. Murthy, et al. (2010). "Outcome Reporting Among Drug Trials Registered in ClinicalTrials.gov." Annals of Internal Medicine 153(3): 158-166.
Abstract der Studie
David Klemperer, 19.8.10
Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung
 Zwei Studien aus Kanada liefern überzeugende Hinweise auf die große Bedeutung der Adherence sowohl für das Auftreten und den klinischen Verlauf chronischer Krankheiten als auch für die Ausgabenentwicklung eines Gesundheitswesens. Adherence lässt sich im Deutschen am treffendsten als Therapietreue übersetzen und umfasst sowohl den Aspekt fortgesetzter Behandlung (Persistenz) als auch die Einnahme nach empfohlener Dosierung (Compliance). Nicht zuletzt die wachsende Diskrepanz zwischen medizinisch-pharmakologischem Fortschritt und der hinterher hinkenden Eindämmung der Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, koronare Herzkrankheit oder Schlaganfall lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Frage, wie Gesundheitssysteme den in vielfachen Studien erwiesenen Nutzen evidenzbasierter Behandlungen zuverlässig der wachsenden betroffenen Bevölkerung zukommen lassen kann. Die beiden kanadischen Studien bestätigen nicht nur unübersehbare Mängel bei der Einnahme wirksamer Medikamente, sondern untermauern vor allem eindrücklich, dass dabei der Therapietreue bzw. Adherence eine entscheidende Funktion zukommt.
Zwei Studien aus Kanada liefern überzeugende Hinweise auf die große Bedeutung der Adherence sowohl für das Auftreten und den klinischen Verlauf chronischer Krankheiten als auch für die Ausgabenentwicklung eines Gesundheitswesens. Adherence lässt sich im Deutschen am treffendsten als Therapietreue übersetzen und umfasst sowohl den Aspekt fortgesetzter Behandlung (Persistenz) als auch die Einnahme nach empfohlener Dosierung (Compliance). Nicht zuletzt die wachsende Diskrepanz zwischen medizinisch-pharmakologischem Fortschritt und der hinterher hinkenden Eindämmung der Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, koronare Herzkrankheit oder Schlaganfall lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Frage, wie Gesundheitssysteme den in vielfachen Studien erwiesenen Nutzen evidenzbasierter Behandlungen zuverlässig der wachsenden betroffenen Bevölkerung zukommen lassen kann. Die beiden kanadischen Studien bestätigen nicht nur unübersehbare Mängel bei der Einnahme wirksamer Medikamente, sondern untermauern vor allem eindrücklich, dass dabei der Therapietreue bzw. Adherence eine entscheidende Funktion zukommt.
Die Arbeitsgruppe um Sylvie Perreault von der Universität Montreal verwendete die umfangreiche öffentliche Krankenversicherungsdatenbank Régie de l'Assurance Maladie der Provinz Québec, die detaillierte Angaben zu den Versicherten, Abrechnungendaten sämtlicher ambulanten und stationären Therapien sowie Kodierung und Kosten aller Behandlungen beinhaltet, und die Med-Echo-Datenbank, die stationäre Akutbehandlungen erfasst, für eine retrospektive Beobachtungsstudie mit eingebetteter Fall-Kontroll-Untersuchung. Dafür suchten sie insgesamt 112.092 Patienten zwischen 45 und 85 Jahren (Durchschnittsalter 63 Jahre) heraus, die an keiner kardiovaskulären Krankheit litten und zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2004 eine Statintherapie begannen. 41 % der Personen waren männlich, 54 % von ihnen litten an Bluthochdruck und 26 % an Diabetes mellitus. Primärer Endpunkt war das Auftreten zerebrovaskulärer Erkrankungen (ischämischer oder hämorrhagischer Hirninfarkt, ICD 9: 431, 433, 434, 436, 437) zwischen dem Eintritt in die Kohorte und dem Ende der Studienperiode, dem 30. Juni 2005, wobei die mittlere Beobachtungszeit bei 2,95 Jahren lag.
3,5 % der Kohorte erlitten in diesem Zeitraum ein zerebrovaskuläres (1,2/100 Personenjahre) und 12,5 % ein kardiovaskuläres Ereignis (4.2/100 Personenjahre), 4,0 % erkrankten an chronischer Herzinsuffizienz (1,4/100 Personenjahre), 3,6 % am peripherer arterieller Verschlusskrankheit(1,2/100 Personenjahre), 10,6 % an anderen kardiovaskulären Erkrankungen (3.6/Personenjahre 100 Personenjahre) und 32,9 % nahmen Thrombozytenaggregationshemmer (11,1/100 Personenjahre) ohne vorhergehende Diagnose eine koronare Herzkrankheit. Die kardiovaskuläre Mortalität lag bei 0,4 % und die ursachenunabhängige Gesamtsterblichkeit bei 2,9 %.
Die Adherence erfassten die kanadischen ForscherInnen als Anteil der Therapietage, an denen den Versicherten laut Rezepteinlösung die verordneten Medikamente zur Verfügung standen (Medication Possession Ratio - MPR), die sie in 20er Schritten zwischen weniger als 20 und über 80 % einteilten. Nur gut die Hälfte der eingeschlossenen PatientInnen (55 %) wiesen eine gute Therapietreue mit einer MPR von 80 % oder mehr auf, wobei die durchschnittliche Adherence in dieser Gruppe im ersten Jahr nahezu 98 % und im Anschluss immerhin noch 95 % betrug; in der Gruppe mit eingeschränkter Therapietreue lag der Durchschnittswert im ersten Jahr bei 13 % und im weiteren Verlauf bei 9 %.
Mit Hilfe konditionaler logistischer Regressionsmodelle und Fall-Kontroll-Vergleiche zwischen PatientInnen mit sehr guter und mit schlechter Adherence ermittelten die ForscherInnen aus Montreal das relative Risiko zerebrovaskulärer Erkrankungen und adjustierten ihre Ergebnisse nach verschiedenen Kovariablen. Demnach senkt regelmäßige Einnahme von Statinen in empfohlener Dosierung (MPR ≥ 80 %) das relative Risiko des Auftretens zerebrovaskulärer Erkrankungen um 26 % (relative Rate 0,74; 95 % KI, 0,65 - 0,84) im Vergleich zu solchen PatientInnen, die nur geringe Therapietreue an den Tag legten (MPS < 20 %). Dies gilt allerdings nur für ischämische Schlaganfälle (RR 0,67; 95 % KI, 0,58-0,77), nicht aber für hämorrhagische Ereignisse (RR 0,97; 95 % KI, 0,59 - 1,58), was von pharmakologischer Wirkung und Pathogenese nachvollziehbar erscheint. Außerdem war die Risikominderung bei Personen unter 65 Jahren nicht signifikant (RR 0,80; 95 % KI, 0,65-1,00), wohl aber für über 65-Jährige (28 % Reduktion, RR 0,72; 95 % KI, 0,63 - 0,84). Kein nennenswerter Unterschied bestand dabei zwischen Hochrisiko-PatientInnen, die nicht nur an Hyperlipoproteinämie, sondern zugleich an Bluthochdruck und Diabetes mellitus litten (RR 0.71, 95% KI, 0.60-0.83) und solchen geringen Risikos (RR 0.72; 95 % KI, 0,58 - 0,89). Bemerkenswert auch im Hinblick auf andere Studien und die Untersuchung zwischen Adherence und klinischem Verlauf bei Lipidsenkern ist die Beobachtung, dass die positiven Effekte einer Statin-Therapie erst nach mindestens einem Jahr sichtbar werden. Insgesamt liefert diese kanadische Studie weitere Belege für die unzureichende Therapietreue gegenüber Statinens sowohl in der primär- als auch in der Sekundärprävention sowie Einblicke in die Ursachen mangelhafter Adherence (vgl. auch Bates et al. 2009, S. 2982).
Die gleiche kanadische Arbeitsgruppe, diesmal unter Federführung von Alice Dragomir, publizierteAnfang 2010die Ergebnisse einer weiteren großen Kohortenstudie auf Grundlage der Datenbanken Régie de l'Assurance Maladie der Provinz Québec und Med-Echo. Dabei analysierten sie die Daten von insgesamt 55.134 PatientInnen zwischen 45 und 85 Jahren ohne vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankung, die zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 30. Juni 2002 eine Statintherapie aufnahmen. Die Studienperiode begann am 1. Juli 2002 und erstreckte sich bis zum 30. Juni 2005; Endpunkte waren die Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen, relevante stationäre Aufnahmen wegen kardiovaskulärer Ereignisse sowie die dadurch verursachten Kosten. In dem dreijährigen Beobachtungszeitraum erfolgten 7.326 stationäre Behandlungen wegen akuter Koronar-, 2.189 wegen zerebrovaskulärer Ereignissen und 2.171 wegen chronischer Herzinsuffizienz.
Die Adherence erfassten die kanadischen ForscherInnen als Anteil der Tage, an denen den PatientInnen laut Rezeptausstellung Arzneimittel zur Verfügung standen, an der gesamten Beobachtungszeit und unterschieden zwischen therapietreuen Personen mit mindestens 80 % und mit weniger als 80 % eingenommen Medikamenten. Die mittlere Adherencerate lag bei den therapietreuen ProbandInnen bei 96 % und bei den nicht therapietreuen bei 42 %.
Eine nach diversen Unteraspekten durchgeführte logistische Analyse (polytomous logistic analysis) zeigte, dass gegenüber Statinen wenig therapietreue PatientInnen mit größerer Wahrscheinlichkeit an KHK (OR 1.07; 95 % KI, 1.01-1.13), zerebrovaskulären Ereignissen (OR 1.13; 95 % KI 1.03-1.25) und chronischer Herzinsuffizienz (OR 1.13; 95 % KI 1.01-1.26) erkrankten. Außerdem war eingeschränkte Therapietreue mit einem um 4 % erhöhten Risiko von Krankenhausaufnahmen (OR 1.04; 95 % CI 1.01-1.09) und in der dreijährigen Beobachtungszeit bei jedem/r stationär behandelten PatientIn durchschnittlich mit ca. 1.060 Kanadischen Dollar höheren Krankenhauskosten verbunden. Die durch schlechte Compliance verursachten zusätzlichen Kosten berechneten die kanadischen ForscherInnen auf 9,5 und die potenziellen Einsparungen durch gute Adherence auf 10,2 Millionen Kanadische Dollar. Damit liefern sie Belege dafür, dass eingeschränkte Therapietreue nicht nur das Auftreten von Krankheiten und Komplikationen fördert, sondern auch die Ausgaben steigen lässt.
Für Nicht-Abonnenten des American Journal of Medicine ist von der Studie von Sylvie Perreault, Laura Ellia, Alice Dragomir, Robert Côté, Lucie Blais, Anick Bérard und Lyne Lalonde Effect of statin adherence on cerebrovascular disease in primary prevention über die Ausgabe 122 (7) auf den Seiten 647-655 nur das Abstract kostenfrei zugänglich, während sich die Untersuchung von Alice Dragomir, Robert Côté, Michel White, Line Lalonde, Lucie Blais, Amik Bérard und Sylvie Perreault Relationship between Adherence Level to Statins, Clinical Issues and Health-Care Costs in Real-Life Clinical Setting aus Value in Health (13 (1), S. 87-94) als Volltext einsehen lässt.
Jens Holst, 15.8.10
"These data should not see the light of day to anyone outside of GSK". Risikowissen vorsätzlich durch Hersteller unterdrückt!
 Der damals für die Arzneimittel-Richtlinien verantwortliche Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (also eine Art Vorläufer des heutigen Gemeinsamen Bundesausschuss [G-BA]) hat in seiner Sitzung am 3. Mai 2001 den Therapiehinweis nach Ziffer 14 Arzneimittel-Richtlinien für Thiazolidindione ("Glitazone") beschlossen, der zum Beispiel für die Wirkstoffe Pioglitazon und Rosiglitazon gilt. Der Wirkstoff wurde u.a. in den Mitteln Actos und Avandia der Arzneimittelunternehmen Takeda und GlaxoSmithKline (GSK) galt.
Der damals für die Arzneimittel-Richtlinien verantwortliche Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (also eine Art Vorläufer des heutigen Gemeinsamen Bundesausschuss [G-BA]) hat in seiner Sitzung am 3. Mai 2001 den Therapiehinweis nach Ziffer 14 Arzneimittel-Richtlinien für Thiazolidindione ("Glitazone") beschlossen, der zum Beispiel für die Wirkstoffe Pioglitazon und Rosiglitazon gilt. Der Wirkstoff wurde u.a. in den Mitteln Actos und Avandia der Arzneimittelunternehmen Takeda und GlaxoSmithKline (GSK) galt.
Zu den Risiken heißt es unter anderem:
• "Über die Sicherheit der Thiazolidindion-Medikation wird erst eine Langzeitanwendung Aufschluss geben."
• Und: "Eine Herzinsuffizienz kann durch Thiazolidindione ausgelöst bzw. eine bestehende Herzinsuffizienz verschlechtert werden. Thiazolidindione sind daher bei allen Graden der Herzinsuffizienz kontraindiziert. Eine erhöhte Inzidenz von Herzinsuffizienz wurde im Rahmen klinischer Studien, bei denen Rosiglitazon in Kombination mit Insulin verwendet wurde, beobachtet. Die Kombination von Rosiglitazon mit Insulin ist deshalb kontraindiziert."
• Außerdem: "Entsprechend der Zulassung und im Hinblick auf die Nebenwirkungen kommt Thiazolidindionen derzeit nur ein limitierter Einsatzbereich zu; es handelt sich um eine Untergruppe von Diabetespatienten, für die das therapeutische Potential von Metformin bzw. Sulfonylharnstoffen ausgeschöpft ist und die keiner Insulinbehandlung bedürfen. Die langfristigen Vorteile einer Therapie mit Thiazolidindionen wurden nicht nachgewiesen. Das gilt insbesondere für die bei Diabetes relevanten Endpunkte Mikro-/Makroangiopathie oder kardiovaskuläre bzw. Gesamt-Mortalität."
Am 17. Juni 2010 beschloss der G-BA, die Wirkstoffklasse der Glitazone aus der Erstattungsfähigkeit durch die GKV wegen des seit Jahren durch mehrere Studien nachgewiesenen Überwiegens des möglichen gesundheitlichen Schadens - durch Herzprobleme bis zum Tode und Knochenbrüche - gegenüber dem nachweisbaren Nutzen herauszunehmen und damit Arzneimittel wie Avandia von GSK vom Markt verschwinden zu lassen. Dass GSK dies angesichts des weltweit mit diesem Mittel erzielten Umsatzes von jährlich 1,2 Milliarden US-Dollar als "nicht gerechtfertigt" und "stark fehlerbehaftet" bewertet, und eine entgültige Entscheidung verhindern will, verwundert nicht.
Ein Großteil der derzeitigen öffentlichen Debatte pro und contra der GKV-Erstattungsfähigkeit und eines sogar gerechtfertigten Verbots der Wirkstoffe stützt sich auf die seit 2007 in aller Breite in den USA geführte Debatte. Wie der Mai/Juni 2010-Ausgabe des für dieses Themenfeld wie immer exzellenten "Pharma-Brief" der BUKO Pharma-Kampagne u.v.a. zu entnehmen ist, schätzte die "Federal DRug Administration (FDA)" der USA bereits im Juli 2007 auf der Basis mehrerer Studien (darunter der Studie von Nissen und Wolski im "New England Journal of Medicine" aus dem Jahr 2007), dass Rosiglitazone, also der Wirkstoff von Avandia seit seiner Zulassung 83.000 zusätzliche Herzinfarkte allein in den USA ausgelöst hat. Trotz dieses gesicherten Beitrags zur Herz-Kreislauf-Morbidität und -Mortalität passierte weder in den USA noch in Europa zunächst etwas.
Für den Umgang der Pharmahersteller mit erkannten Gesundheitsrisiken ihrer Produkte ist aber interessant, dass die Herz-Kreislauf-Risiken von Avandia bereits seit 1999 bekannt waren. Wie der auch bereits im "forum-gesundheitspolitik" vorgestellte Bericht eines US-Senatsausschusses im Januar 2010 dokumentierte, sprach GSK selber damals bereits von "increased risk of ischemic events, ranging from 30 % to 43 %" aus fremden aber auch eigenen Studien.
Noch direkter offenbart aber ein am12. Juli 2010 in der "New York Times" veröffentlichter Vorgang, die Bereitschaft von GSK, vorsätzlich kritische Erkenntnisse zu unterdrücken. Hier sieht man nicht nur die "rauchenden Colts", sondern auch das "Laden der Waffen".
Als Ergebnis einer eigenen Studie, welche Avandia mit Actos verglich, stand fest, dass Actos einen höheren Nutzen hatte und dass die Einnahme von Avandia mit erhöhten Herz-Kreislaufrisiken verbunden war. Das erschreckend Neue des Artikels der NYT ist der Beleg, dass dieses Ergebnis von GSK vorsätzlich unveröffentlicht blieb. In einer E-Mail vom 29. März 2001 heißt es von einem GSK-Verantwortlichen dazu: "Per Sr. Mgmt request, these data should not see the light of day to anyone outside of GSK."
Und wenig später antwortet ein GSK-Manager am 20 Juli 2001 einer Mitarbeiterin auf die Frage, ob die ebenfalls nicht vorteilhaften Ergebnisse eines weiteren Vergleichs von Rosiglitazone veröffentlicht werden sollten, so: "Rhona — Not a chance. These put Avandia in quite a negative light when folks look at the response of the RSG monotherapy arm … It is a difficult story to tell and we would hope that these do not see the light of day."
Dass sich GSK im Umgang mit Arzneimittelsicherheitsbehörden einer "minimal language" rühmt, und nicht nur Studienergebnisse verbirgt, sondern auch beweisbar unerwünschte Ereignisse in Studien löschte, wundert in dem gesamten Lehrstück nicht mehr.
Die Frage ist allerdings nur, warum es so lange brauchte bis erste Zulassungsinstitutionen wie z.B. der G-BA reagierten und warum die von industrienahen Diabetesorganisationen rasch angezettelte Debatte, die Herausnahme des Wirkstoffes und der entsprechenden Medikamente aus der Erstattungfähigkeit durch die GKV zum Teil zu verhindern, öffentliches Gehör findet?
Der von Jörg Schaaber verfasste, sehr informative Artikel "Gar nicht rosig. Ein Diabetesmittel, das es nicht geben dürfte" über Avandia ist im "Pharma-Brief" Nr. 4-5 (Mai/Juni 2010) abgedruckt, der komplett und kostenlos heruntergeladen werden kann.
Eine Reihe der internen Belege für die Unterdrückung bekannter Risiken von Avandia findet man unter der Überschrift "Avandia and Its Risks" auf einer Website der NYT.
Bernard Braun, 13.7.10
Therapien mit Antibiotika: Meta-Analyse von 24 Studien stellt erneut massive Risiken der Resistenzbildung fest
 Die Verschreibung von Antibiotika bei Atemwegs-Erkrankungen oder anderen, ganz überwiegend nicht bakteriell verursachten Krankheiten ist wohl ein besonders prägnantes Beispiel für die im Gesundheitswesen immer noch verbreiteten Wege medizinischer Über- und Fehlversorgung. Die Verschreibung von Antibiotika hat zwar bei vielen Patienten eine emotional beruhigende Wirkung. Dies führt aber bei Infektionskrankheiten durch Viren zu keiner schnelleren Rekonvaleszenz und birgt das Risiko, dass damit Krankheitserreger zunehmend gegen Antibiotika resistent werden.
Die Verschreibung von Antibiotika bei Atemwegs-Erkrankungen oder anderen, ganz überwiegend nicht bakteriell verursachten Krankheiten ist wohl ein besonders prägnantes Beispiel für die im Gesundheitswesen immer noch verbreiteten Wege medizinischer Über- und Fehlversorgung. Die Verschreibung von Antibiotika hat zwar bei vielen Patienten eine emotional beruhigende Wirkung. Dies führt aber bei Infektionskrankheiten durch Viren zu keiner schnelleren Rekonvaleszenz und birgt das Risiko, dass damit Krankheitserreger zunehmend gegen Antibiotika resistent werden.
Eine jetzt in der renommierten Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichte Literaturübersicht, in der Ergebnisse aus 24 Studien mit 15.505 Erwachsenen und 12.103 Kindern berücksichtigt wurden, zeigte sich erneut, dass eine eindeutige Verbindung besteht zwischen der Verschreibung von Antibiotika und der Entwicklung einer Resistenz gegen eben diese Antibiotika. Schlichter gesagt: Antibiotika versagen bei der zweiten oder dritten Verschreibung oftmals. Der beobachtete Effekt, die Arzneimittel-Resistenz, war in den Studien einen Monat nach der Therapie am stärksten ausgeprägt, nahm im Verlauf der Zeit auch ab, hielt aber bis zu 12 Monate an.
Bereits mehrfach wurde im Forum Gesundheitspolitik berichtet
• über die überaus häufige Verbreitung medizinisch nutzloser Antibiotikaverordnungen (Altes und Neues von der gefährlichen Dauer-Fehlversorgung von Erwachsenen und Kindern mit Antibiotika, Mehrheitlich Über- und Fehlversorgung mit Antibiotika durch Hausärzte bei Nasennebenhöhlenentzündungen),
• über den fehlenden Nutzen und die Risiken (Die Verschreibung von Antibiotika bei Husten variiert erheblich in Europa - und bewirkt nirgends eine schnellere Rekonvaleszenz, Früher aber nicht notwendiger Einsatz von Antibiotika bei Kindern - Kein Nutzen der Antibiotikaprophylaxe bei Harnwegsinfekten)
• oder auch über Hintergründe und ärztliche Motive dieser Fehlversorgung (Der Kunde ist König: Kinderärzte verschreiben öfter Antibiotika, wenn sie vermuten, dass die Eltern dies von ihnen erwarten, Antibiotika-Niedrigverbrauchsregion Ostdeutschland: Woran liegt es?).
Die jetzt veröffentlichte Meta-Analyse bezog lediglich solche Studien ein, in denen ein Zusammenhang untersucht worden war zwischen Antibiotika-Verschreibungen in der ambulanten medizinischen Grundversorgung einerseits und der Resistenzentwicklung beim einzelnen Patienten andererseits. Fünf der einbezogenen Studien waren randomisierte Kontrollstudien (mit zufälliger Zuweisung der Teilnehmer zu einer Interventions- oder auch Kontrollgruppe), 19 waren Beobachtungsstudien (17 davon retrospektiv erhoben). Die meisten Studien betrafen entweder Patienten mit Harnwegs-Infektionen (N=8) oder Atemwegs-Infektionen (N=9).
Das Forschungsteam aus Bristol und Oxford kam dann zu folgenden zentralen Befunden bei der erneuten Auswertung der Studien:
• Der Effekt, die Resistenz, war am stärksten einen Monat nach der Therapie, nahm im Laufe der Zeit ab, war teilweise aber auch noch einem Jahr noch zu beobachten.
• Die Risiken einer Resistenzbildung waren im Durchschnitt zwei Monate nach der Einnahme 2,5mal so hoch (Odds-Ratio) und nach 12 Monaten noch 1,3mal so hoch.
• Eine methodisch sehr fundierte Langzeit-Studie zeigte einen sehr markanten zeitlichen Effekt: Das Risiko der Resistenz fiel von 12,5 nach einer Woche auf 6,1 nach einem Monat und 2,2 nach 6 Monaten.
• Es gibt einen Zusammenhang zwischen der verordneten Menge an Antibiotika und der Einnahmedauer und dem Resistenz-Risiko. Ebenso wirken sich zeitlich gestaffelte mehrfache Verordnungen aus.
• Es gab keine einheitlichen Befunde, was die Art der Antibiotika bzw. den Wirkstoff anbetrifft. Auch wenn die Zahl der hierzu vorliegenden Studien recht klein ist, kann man vermuten, dass es keine grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen von Antibiotika gibt.
In der zusammenfassenden Bilanz und Interpretation der Daten formulieren die Wissenschaftler auch einige Empfehlungen. Da in einigen Studien ein Zusammenhang deutlich wurde zwischen Einnahmedauer eines Medikaments und Resistenzbildung, empfehlen sie eine möglichst kurze Dauer der Behandlung mit Antibiotika ("… the fewest number of antibiotic courses should be prescribed for the shortest period possible"). Patienten, die im vergangenen Jahr eine oder mehrere Behandlungen mit Antibiotika erhielten, sollten bei einer erneut notwendigen weiteren Therapie ein anderes Antibiotikum verschrieben bekommen.
Die Studie ist kostenlos im Volltext verfügbar: Céire Costelloe et al: Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-analysis (BMJ 2010;340:c2096, doi:10.1136/bmj.c2096)
Gerd Marstedt, 27.6.10
Trotz einem Positivlisten-System für Arzneimittel: Frankreich fast immer in der Spitzengruppe des Arzneimittelmarktes dabei!
 Im Herbst 2009 hat ein bei SPIEGEL-Online veröffentlichter Artikel über das Preisdiktat der Pharmaindustrie in Deutschland auf einen interessanten externen Effekt der deutschen Verhältnisse hingewiesen: "Im europäischen Ausland gilt Deutschland wegen dieser Einzigartigkeit als Referenzmarkt - zur Freude der dortigen Behörden. In Frankreich zum Beispiel wartet man gern, welchen Preis die Hersteller in Deutschland den Kassen diktieren. Dort hat die Pharmaindustrie dann wenig zu melden - sogenannte Verhandlungen laufen vielmehr nach dem Prinzip: Preis in Frankreich = deutscher Preis minus 20 Prozent." (SPIEGEL-Online 8.10.2009)
Im Herbst 2009 hat ein bei SPIEGEL-Online veröffentlichter Artikel über das Preisdiktat der Pharmaindustrie in Deutschland auf einen interessanten externen Effekt der deutschen Verhältnisse hingewiesen: "Im europäischen Ausland gilt Deutschland wegen dieser Einzigartigkeit als Referenzmarkt - zur Freude der dortigen Behörden. In Frankreich zum Beispiel wartet man gern, welchen Preis die Hersteller in Deutschland den Kassen diktieren. Dort hat die Pharmaindustrie dann wenig zu melden - sogenannte Verhandlungen laufen vielmehr nach dem Prinzip: Preis in Frankreich = deutscher Preis minus 20 Prozent." (SPIEGEL-Online 8.10.2009)
Bei der Zulassung von Arzneimitteln zur Verordnung auf Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherung wird in Frankreich aber nicht nur auf die Deutschen gewartet. Es existieren vielmehr eine Reihe von Maßnahmen, Instrumenten und Prozeduren, die auch in Frankreich so etwas wie die Quadratur des Kreises hinbekommen sollen: So viel qualitativ hochwertige, d.h. wirksame und nützliche Arzneimittel wie nötig und diese einem möglichst fairen Preis.
Eines dieser in Frankreich und einer ganzen Reihe anderer europäischer Länder existierenden Instrumente ist ein differenziertes System von Positivlisten, also jener unter primär pharmakologischen und medizinischen Kriterien gebildeten Listen, auf denen nicht mehr jedes von den nationalen oder internationalen Zulassungsbehörden zugelassene Arzneimittel steht, sondern wesentlich weniger und auf ihre Wirksamkeit überprüfte.
In Deutschland gab es zwar 1993 und zuletzt 2003 wiederholte Anläufe ein Positivlistensystem einzuführen und es gab sogar schon fertige Listen. Doch ausgerechnet der heutige Kopfpauschalen-Rebell Horst Seehofer knickte als damaliger Bundesgesundheitsminister so tief vor der Pharmaindustrie ein, dass er 1995 die fertige Liste in einem Akt politischer Pornografie schreddern ließ und die in einen Plastiksack gepackten Schnipsel durch seinen Staatssekretär Baldur Wagner dem Präsidenten des Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, Hans-Rüdiger Vogel, als Geburtstagsgeschenk überreichen ließ (der Beleg findet sich u.a. in einem umfassenden Text über die Pharmalobby auf der Seite 141).
Außerdem gibt es in Frankreich die "Haute Autorité de Santé (HAS)", die ähnlich wie das deutsche "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen" - aber schon etwas länger und deswegen produktiver - die entscheidende Einrichtung für die Benennung von Kosten-Nutzenrelationen für Arzneimittel aber auch andere Medizinprodukte ist. Zu dem, was die HAS ist und was sie macht, findet sich auf ihrer Website eine ganze Menge und speziell unter der Überschrift "Key facts and figures" zahlreiche Daten und Arbeitsüberblicke für die letzten Jahre. Die meisten Dokumente stehen in französischer und englischer Sprache zur Verfügung.
Wie das französische System der Positivlisten, der HAS und weiterer Prozeduren gesetzlich fundiert ist und wie es zu welchen Grundlagen für die Regulierung von Menge, Preis und Qualität der Arzneimittelversorgung durch die Gesetzliche Krankenversicherung kommt, ist in einem aktuellen Text der französischen Medizinerin und Kennerin des dortigen Gesundheitssystems, Dr. Ursula Descamps, übersichtlich dargestellt. Dort wird sehr gut die Komplexität dargestellt, welche die Maßnahmen, die diese Ziele erreichen will, in Frankreich erreicht haben. Und natürlich versucht auch in Frankreich die Pharmaindustrie Einfluss auf die Positionierung innerhalb der Positivlisten zu nehmen.
Das damit in der Struktur deutlich andere System der Arzneimittelregulation muss sich aber auch auf dem Prüfstand der empirischen Wirksamkeit bewähren.
Ein systematischer internationaler Vergleich wichtiger Indikatoren des Arzneimittelgeschehens mit den OECD-Health Data 2009, zeigt, dass auch die Wirksamkeit des französischen Systems der Zulassung von Arzneimitteln als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen nicht so aussieht wie es dort und von denjenigen, die von Positivlisten spürbare Effekte erwartet wird:
• Frankreich belegt bei den Arzneimittelausgaben (in Kaufkraftparitäten - PPP) mit 711 PPP pro Kopf Rang 3 (Deutschland mit 656 PPP: Rang 6)
• Frankreich erreicht bei dem Anteil sämtlicher Arzneimittelausgaben an den gesamten Gesundheitsausgaben mit 16,3 % Rang 11 (Deutschland mit 15,1 % Rang 13)
• Beim Anteil öffentlich finanzierter Arzneimittelausgaben pro Kopf liegen Frankreich und Deutschland auf dem zweiten und ersten Platz.
• Und auch beim Anteil der öffentlich finanzierten Arzneimittelausgaben an sämtlichen Ausgaben für Arzneimittel liegen beide Länder in der Spitzengruppe: In Deutschland sind dies 75,9 %, was es auf Platz 1 bringt. In Frankreich 69,4 % und Platz 4.
Auch wenn diese Verhältnisse nicht als absoluter Beleg für die völlige Nutzlosigkeit eines Positivlistensystems interpretiert werden sollten, zeigen sie aber, dass es sich auch bei Positivlisten um kein selbstlaufendes Patentrezept oder Wundermittel handelt. Ähnlich wie in dem von der Anzahl der Instrumente her überregulierten deutschen Arzneimittelsystem kommt es wahrscheinlich auf eine Kombination von Maßnahmen an.
Die kurze informative Übersicht " Zulassung zur Kostenübernahme durch die Krankenversicherung, Kosten-Nutzen-Evaluation, Preisfestsetzung von Arzneimitteln in Frankreich" von U. Descamps kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 20.6.10
Ärzte und Pharmavertreter - eine verhängnisvolle Affäre
 Drei von vier Ärzten gehen davon aus, dass Pharmavertreter sie darin beeinflussen wollen, welche Medikamente sie verschreiben. Über 90% halten sich für völlig oder weitgehend immun gegenüber den Beeinflussungsversuchen - 9% der Befragten glauben, überhaupt nicht beeinflussbar zu sein, weitere 83% geben an, nur selten oder gelegentlich beeinflusst zu werden. Ihre Kollegen betrachten die Ärzte jedoch als beeinflussungsgefährdet: 21% glauben, dass diese den Beeinflussungsversuchen der Pharmavertreter häufig oder immer erliegen.
Drei von vier Ärzten gehen davon aus, dass Pharmavertreter sie darin beeinflussen wollen, welche Medikamente sie verschreiben. Über 90% halten sich für völlig oder weitgehend immun gegenüber den Beeinflussungsversuchen - 9% der Befragten glauben, überhaupt nicht beeinflussbar zu sein, weitere 83% geben an, nur selten oder gelegentlich beeinflusst zu werden. Ihre Kollegen betrachten die Ärzte jedoch als beeinflussungsgefährdet: 21% glauben, dass diese den Beeinflussungsversuchen der Pharmavertreter häufig oder immer erliegen.
Zu diesen und weiteren Ergebnissen gelangen Klaus Lieb und Simone Brandtönies in einer heute im Deutschen Ärzteblatt erschienen Studie. Die Ergebnisse beruhen auf einer Befragung von Fachärzten für Neurologie/Psychiatrie, Allgemeinmedizin und Kardiologie - den Facharztgruppen mit den höchsten Kosten für Arzneimittelverordnungen pro Arzt. Die Befragung wurde 2008 durchgeführt und bezieht sich auf das Jahr 2007.
Diese deutsche Studie bestätigt die Ergebnisse angloamerikanischer Studien: Ärzte meinen von sich selbst, nicht beeinflussbar zu sein, sehen das Problem aber bei ihren Kollegen. Nicht bekannt ist den Befragten offensichtlich, dass die Beeinflussung unbewusst erfolgt ("Marketing für Medikamente wirkt - selbst in subtiler Dosis").
Der Kontakt zwischen Industrie und Ärzten mittels der Vertreter funktioniert bestens. 77% der Befragten lassen sich mindestens 1x pro Woche besuchen, fast jeder 5. erhält täglich Besuch.
Fast die Hälfte der Befragten fühlt sich häufig oder immer adäquat und korrekt von den Pharmavertretern informiert, lediglich 15% selten oder nie. Dies erstaunt, denn bezüglich der Objektivität von Informationsquellen erhalten Pharmavertreter mit 4 die schlechteste (Schul-)Note. Pharmafinanzierten Fortbildungen geben Ärzte die Note 3, unabhängigen Fortbildungen 1,9 und Fachbüchern als am besten bewertete Quelle 1,8.
Die Mehrheit nimmt regelmäßig Geschenke an, und zwar im Durchschnitt pro Jahr: Arzneimuster 66 x, Schreibwaren 34 x, Kalender 9 x. Lediglich 4% nehmen keinerlei Geschenke an.
Durchschnittlich nahmen die Ärzte an 6,3 unabhängigen und 5,2 pharmafinanzierten Fortbildungen teil. Bei mehr als 2/3 der pharmafinanzierten Fortbildungen gab es kostenloses Essen, bei etwa einem Viertel kostenlose Übernachtung und Übernahme der Reisekosten.
43% führten 2007 mindestens eine Anwendungsbeobachtung durch, jeder 5. mehr als drei. Anwendungsbeobachtungen sind Studien, die anerkanntermaßen mehr dem Marketing als dem Wissensgewinn dienen ("Einflussnahme der Pharma-Industrie auf Medikamentenverschreibungen"".
Fazit der Autoren: "Eine kritischere Haltung der Ärzte gegenüber den Einflussversuchen der pharmazeutischen Unternehmen und die aktive Förderung alternativer Informationsangebote könnten zu mehr Unabhängigkeit und zu einer rationaleren und möglicherweise günstigeren Arzneimitteltherapie führen."
Diese Studie erweitert das Wissen um die Beeinflussung der Ärzte durch die Industrie. Erst kürzlich hatte das Deutsche Ärzteblatt eine Studie über die Beeinflussung der Ärzte durch manipulierte Studien veröffentlicht (wir berichteten).
Die unkritische Haltung vieler Ärzte mag auf den ersten Blick verwundern. Dahinter steht ein hochsystematisches und wissenschaftlich begründetes Vorgehen der Industrie. Sie lässt ihre Vertreter Beziehungen zu den Ärzten aufbauen, die von diesen als freundschaftlich wahrgenommen werden und wenden durch kleine und größere Geschenke die Reziprozitätsregel an, derzufolge man sich für Gefälligkeiten, Geschenke, Einladungen und dergleichen zu revanchieren hat (s.a. "Warum uneingeschränkte Transparenz in Interessenregistern und Ablehnung jedes Vorteils ein Muss für die ärztliche Profession ist").
Ein Aufsatz und ein Buch geben tiefe Einblicke in die Vorgehensweisen der Pharmavertreter:
Fugh-Berman A, Ahari S. Following the Script: How Drug Reps Make Friends and Influence Doctors. PLoS Medicine 2007;4(4):e150}
Williams J. Insider's Guide to the World of Pharmaceutical Sales, 9th Edition. 9th ed: Principle Publications, 2008. Dieses Buch wurde vor kurzem im Deutschen Ärzteblatt besprochen. Downnload
Die Ergebnisse der Überzeugungsbemühungen der pharmazeutischen Industrie sind nirgendwo besser dokumentiert als in den Umsatzzahlen.
So darf es sich die Industrie als "Erfolg" anrechnen, dass sich unter den 15 umsatzstärksten Medikamenten in Deutschland im Jahr 2007 nur 2 befinden, die nach Bewertung des Pharma-unabhängigen arznei-telegramm als Mittel der Wahl für das jeweilige Krankheitsbild darstellen. Unter den übrigen 13 sind 6 Varianten ohne besonderen Stellenwert (Scheininnovationen / Me-too-Präparate), 5 Medikament mit umstrittenem Therapieprinzip sowie 2 Medikamente die als Mittel der Reserve gelten.
Viele Ärzte verlieren offensichtlich unter dem Einfluss der Pharmavertreter die Fähigkeit zur medizinisch rationalen Verschreibung von Arzneimitteln.
Einen wahren Triumph des Marketings stellt der von der Firma Pfizer vertriebene Blutfettsenker LIPITOR® (in Deutschland SORTIS®) dar, das mit 13,3 Mrd. Dollar im Jahr 2009 weltweit umsatzstärkste Medikament (Quelle: IMS Health). Die Substanz Atorvastatin weist keinerlei Vorteile auf im Vergleich zur Standardsubstanz Simvastatin, ist jedoch in Deutschland um den Faktor 3 bis 4 teurer.
Wie Pfizer Patienten in den USA Lipitor® durch Werbung schmackhaft macht, zeigt diese Website www.lipitor.com ebenso wie die in den USA zulässige Direktwerbung im Fernsehen. Auf www.youtube.com wird man bei Eingabe von Lipitor fündig, hier ein Beispiel und hier noch eins.
Lieb K, Brandtönies S. Eine Befragung niedergelassener Fachärzte zum Umgang mit Pharmavertretern. Dtsch Arztebl 2010;107(22):392-8. Download
David Klemperer, 4.6.10
Unabhängige Arzneimittelforschung in Italien
 Die Erforschung von Arzneimitteln erfolgt überwiegend durch die pharmazeutische Industrie. Die Forschungsfragen der Industrie stehen weitgehend im Zusammenhang Gewinnerwartungen (siehe Beitrag im Forum).
Die Erforschung von Arzneimitteln erfolgt überwiegend durch die pharmazeutische Industrie. Die Forschungsfragen der Industrie stehen weitgehend im Zusammenhang Gewinnerwartungen (siehe Beitrag im Forum).
Öffentliche Förderung für nicht-kommerzielle Fragestellungen erfolgt bisher nicht annähernd im erforderlichen Umfang. Italien zeigt, dass es auch anders geht. Dort wurde die unabhängige Arzneimittelforschung im Jahr 2004 gesetzlich geregelt. Die Federführung hat die Arzneimittelbehörde Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) erhalten.
Das im Jahr 2005 gestartete unabhängige Arzneimittelforschungsprogramm (Website des Programms) wird das Programm durch einen Beitrag der pharmazeutischen Industrie finanziert. Alle Firmen zahlen 5% ihrer jährlichen Ausgaben für Werbung in einen nationalen Fonds. Zugrunde gelegt werden Werbemaßnahmen wie Geschenke, Anzeigen, Werbematerialien, Seminare, Kongresse, nicht jedoch die Gehälter der Pharmavertreter. Auf diese Weise flossen in den ersten drei Jahren (2005 bis 2007) jeweils etwa 45 Mio. Euro in den Fonds. Die Hälfte des Betrages dient der unabhängigen Forschung, mit der anderen Hälfte werden Arzneimittel zur Behandlung seltener Krankheiten (orphan drugs) finanziert.
Es erfolgt eine jährliche Ausschreibung für drei Bereiche:
•Arzneimittel für seltene Krankheiten
•vergleichende Studien (Head-to-head-Studien) - z.B. Untersuchung des Nutzen-Schaden-Profils von Arzneimitteln im direkten Vergleich in randomisierten kontrollierten Studien
•Angemessenheit des Gebrauchs, Pharmakovigilanz und Outcome-Forschung - Post Marketing Studien, Patientenedukation, systematische Übersichtsarbeiten (seit 2007)
Folgende Bedingungen gelten für die Förderung:
•Die Forscher müssen vollständige Kontrolle über das Studiendesign und die Durchführung der Studie haben (z.B. Studienprotokoll, Datenanalyse, Berichten der Ergebnisse).
•Die Ergebnisse müssen vollständig veröffentlicht werden.
•Die Studie darf nicht Teil des Zulassungsverfahrens sein.
Von 2005 bis 2007 wurden 1217 Anträge gestellt. Die Auswahl trifft eine international besetzte Kommission.
Letztlich wurden 151 Studien mit insgesamt 78 Mio. Euro gefördert:
•Experimentelle klinische Studien (114; 75%)
•Beobachtungsstudien (19, 13%)
•Edukative Interventionen (13, 9%)
•Systematische Übersichtsarbeiten (5; 3% - seit 2007)
Im frei zugänglichen Volltext des Aufsatzes werden eine Reihe geförderter Studien beschrieben.
Ihre Erfahrungen zusammenfassend stellen die Autoren fest, dass Geld eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für unabhängige, an patientenrelevanten Fragestellungen ausgerichtete Forschung ist. Dies zeige sich in der geringen Zahl von Anträgen in einigen Fachgebieten - erwähnt werden hier Orthopädie und Anästhesie - und der teil unzureichenden Qualität von Anträgen. Erforderlich sei es, die unabhängige Arzneimittelforschung quantitativ und qualitativ zu verbessern. Gemeinschaftliche Anstrengungen auf europäischer Ebene seien wünschenswert.
Das Büro für Technikfolgenagschätzung hat die Rahmenbedingungen für unabhängige Arzneimittelforschung in einem Bericht für den Bundestag aufgearbeitet, der im Moment vom Bundestag bewertet wird und dann veröffentlicht werden soll.
Italian Medicines Agency Research & Development Working Group. Feasibility and challenges of independent research on drugs: the Italian Medicines Agency (AIFA) experience. Eur J Clin Invest 2010;40(1):69-6 Download Volltext
Biomedizinische Forschung überwiegend von finanziellen Gewinnerwartungen motiviert. Beitrag im Forum Gesundheitspolitik vom 12.2.2010 über die Studie von Dorsey et al. Funding of US Biomedical Research, 2003-2008. JAMA 2010;303(2):137-1. Abstract der Studie
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB).
Klinische Forschungen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung nichtkommerzieller Studien. Website
David Klemperer, 13.5.10
Transparenz ist notwendig, damit die Industrie nicht auch in den nächsten drei Jahrzehnten manipuliert
 Die Versuchung durch Manipulation Studienergebnisse zu schönen, scheint übermächtig zu sein. Dies ist nachvollziehbar - vom Ausgang einer Arzneimittelstudie kann es abhängen, ob die untersuchte Substanz Milliardenumsätze erzielt oder auf dem Müllhaufen landet.
Die Versuchung durch Manipulation Studienergebnisse zu schönen, scheint übermächtig zu sein. Dies ist nachvollziehbar - vom Ausgang einer Arzneimittelstudie kann es abhängen, ob die untersuchte Substanz Milliardenumsätze erzielt oder auf dem Müllhaufen landet.
Eine kürzlich im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit von Gisela Schott und weiteren Mitgliedern der Arzneimittelkommission der Deutsche Ärzteschaft belegt, dass die Industrie auch in der jüngeren Vergangenheit nicht widerstehen konnte. Erfasst und zusammengefasst wurden Studien von November 2002 bis Dezember 2009. Die Autoren knüpfen an die gleichartige systematische Übersichtsarbeit von Bekelman et al., die den Zeitraum von 1980 bis 2002 untersuchte und zu vergleichbaren Ergebnissen gelangte.
Somit ist festzustellen, dass seit 1980 bis heute Arzneimittelstudien, die von der Industrie finanziert werden oder bei denen ein Autor finanzielle Interessenkonflikte hat, durch Manipulationen häufiger zu positiven Ergebnisse gelangen, als anderweitig finanzierte Studien. Erwähnenswert ist der Sachverhalt, dass die Studie von Schott et al. von der Bundesärztekammer finanziert wurde.
In einem Editorial ("Arzneimittelforschung: Marketing vor Evidenz, Umsatz vor Sicherheit") im Deutschen Ärzteblatt stellt der Autor dieses Beitrags fest, dass sich die Arzneimittelforschung in einer Schieflage befinde. Pharmazeutische Firmen ließen Ärzte und Patienten häufig im Unklaren über die wahren Wirkungen ihrer Produkte - die Wissensgrundlage und Patienten Behandlungsentscheidungen treffen sei häufig verfälscht. Große pharmazeutische Firmen hätten in zahlreichen, durch interne Dokumente und Unterlagen gut dokumentierten Fällen die Evidenz verbogen, bis sie für das Marketing tauglich war.
Die Methoden, mit denen Studien manipuliert werden können, sind bekannt. In unserer Rubrik "Einflussnahme der Pharmaindustrie" berichten wir fortlaufend darüber. In jeder Phase der Untersuchung kann manipulativ auf das Ergebnis Einfluss genommen werden. Die Ergebnisse sind u.a. abhängig von der Fragestellung, der Studienpopulation, der Art und der Dosierung der Vergleichssubstanz, der Studiendauer. Häufig werden die Erfolgskriterien im Nachhinein verändert. Studien mit unpassenden Ergebnissen werden gar nicht veröffentlicht oder unpassende Ergebnisse innerhalb von Studien nicht veröffentlicht oder als positiv uminterpretiert. Der Zynismus, mit dem manche Industrievertreter hier vorgehen, ist durch die zwangsweise Veröffentlichung interner Dokumente im Rahmen von Gerichtsverfahren gut dokumentiert. Als Lektüre sei hier die Arbeit von Spielmans und Parry empfohlen.
Bislang müssen die Unterlagen, die zur Beurteilung einer Studie notwendig sind, nicht veröffentlicht werden. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für Manipulationen. Studienregister sind zwar ein wichtiges Mittel gegen die Nicht-Veröffentlichung von Studien. Weitergehende Informationen, die erst eine umfassende Beurteilung einer Studie erlauben, sind im Studienplan und im Studienprotokoll enthalten. Deren frühzeitige Veröffentlichung - noch vor Beginn der Studie - würde die Betrugsmöglichkeiten entscheidend mindern. Uneingeschränkte Transparenz ist daher - das probate Gegenmittel und die an die Politik zu stellende Forderung. Darüber hinaus ist eine vermehrte öffentliche Studienfinanzierung erforderlich, schon allein weil die Industrie viele wichtige Fragen nicht untersucht. Hier ein Bericht über das italienische Modell der unabhängigen Studienfinanzierung.
Deutsches Ärzteblatt
Systematische Übersichtsarbeit zur Finanzierung von Arzneimittelstudien durch pharmazeutische Unternehmen
23.4.2010 Teil 1
Qualitative systematische Literaturübersicht zum Einfluss auf Studienergebnisse, -protokoll und -qualität
30.4.2010 Teil 2
Qualitative systematische Literaturübersicht zum Einfluss auf Autorschaft, Zugang zu Studiendaten sowie auf Studienregistrierung und Publikation
23.4.2010
Editorial. Arzneimittelforschung: Marketing vor Evidenz, Umsatz vor Sicherheit
Reaktionen auf die Studie von Schott et al. und das Editorial im Blog sozmad
Bekelman JE, Li Y, Gross CP. Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research: A Systematic Review. Journal of the American Medical Association 2003;289(4):454-65. Download
Spielmans G, Parry P. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: Evidence from Internal Industry Documents. Journal of Bioethical Inquiry 2010;7(1):13-29. Download, Beitrag im Forum Gesundheitspolitik.
David Klemperer, 11.5.10
Therapietreue - vorrangiges Ziel von Gesundheitsreformen
 Mit einem bedenkenswerten Leitartikel wendete die medizinische Fachzeitung New England Journal of Medicine - NEJM das Augenmerk auf ein Thema, das in der gesundheits- und reformpolitischen Debatte allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. Mangelhafte Therapietreue gilt unter Fachleuten als eins der großen Hindernisse auf dem Weg zu besseren Ergebnissen vor allem bei der zunehmenden Zahl chronisch kranker Menschen. Doch in der gesundheitspolitischen Debatte dominieren Fragen der Finanzierbarkeit und Versuche, die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen einzudämmen, anstatt Bedarf mit nachweislichem Nutzen zu befriedigen. Der Aufhänger zu diesem Leitartikel ist denn auch - unschwer zu erkennen - die aktuelle Debatte über eine Reform des Gesundheitswesens in den USA, aber grundsätzlich lassen sich ihre Einschätzungen auch auf andere Industrieländer übertragen.
Mit einem bedenkenswerten Leitartikel wendete die medizinische Fachzeitung New England Journal of Medicine - NEJM das Augenmerk auf ein Thema, das in der gesundheits- und reformpolitischen Debatte allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. Mangelhafte Therapietreue gilt unter Fachleuten als eins der großen Hindernisse auf dem Weg zu besseren Ergebnissen vor allem bei der zunehmenden Zahl chronisch kranker Menschen. Doch in der gesundheitspolitischen Debatte dominieren Fragen der Finanzierbarkeit und Versuche, die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen einzudämmen, anstatt Bedarf mit nachweislichem Nutzen zu befriedigen. Der Aufhänger zu diesem Leitartikel ist denn auch - unschwer zu erkennen - die aktuelle Debatte über eine Reform des Gesundheitswesens in den USA, aber grundsätzlich lassen sich ihre Einschätzungen auch auf andere Industrieländer übertragen.
Die Autoren David Cutler und Wendy Everett aus Harvard verweisen in ihrem Editorial auf einschlägige Forschungsergebnisse aus anerkannten Medizinerjournals, darunter ein bereits vor fünf Jahren erschienenes Review über zur Frage der Arzneimittel-Adherence, das ebenfalls im NEJM erschienen war und von dem für Nicht-Abonnenten nur das Extract kostenfrei zur Verfügung steht. Darim kamen Cutler und Everett zu der Erkenntnis: "Poor adherence to medication regimens is common, contributing to substantial worsening of disease, death, and increased health care costs. Practitioners should always look for poor adherence and can enhance adherence by emphasizing the value of a patient's regimen, making the regimen simple, and customizing the regimen to the patient's lifestyle. Asking patients nonjudgmentally about medication-taking behavior is a practical strategy for identifying poor adherence."
Für die Bedeutung der Therapietreue für den Gesundheitszustand und die Komplikationsrate bei chronischen Erkrankungen ist eine Untersuchung von besonderer Relevanz, die David Cutler gemeinsam mit Genia Long, Ernst Berndt, Jimmy Royer, Andrée-Anne Fournier, Alicia Sasser und Pierre Cremieux bereits 2007 in der us-amerikanischen Zeitschrift Health Affairs publiziert hatte. Durch den Vergleich von Survey-Daten ohne effiziente Blutdrucktherapie mit aktuellen Daten aus einer Längsschnittskohortenstudie ermittelten sie in einem dreistufigen Verfahren die Auswirkung des Blutdrucks auf die beiden Endpunkte Tod und kardiovaskuläre Ereignisse. Zunächst verglichen sie unter Berücksichtigung wesentlicher gesundheitsrelevanter Faktoren wie Body-Maß-Index, Alter, Geschlecht, Ethnie, Ernährungsgewohnheiten und dem Vorliegen von Stoffwechselerkrankungen die Daten aus dem National Health Examination Survey (NHES) 1959-62 mit denen des National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2000, um den Blutdruck ohne effiziente Therapie zu abzuschätzen. Aus Längsschnittsdaten der Framingham-Heart Study ermittelten die Forscher die Auswirkungen effizienter Blutdruckbehandlung auf die Lebenserwartung, das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko sowie stationäre Behandlungen. Und schließlich rechneten sie die behandlungsbedingten Verbesserungen der Gesamtlebenserwartung auf der Grundlage von Literaturangaben in geldwerte Kosten um verglichen diese mit den Durchschnittsausgaben für Antihypertensiva.
Aufgrund ihrer Hochrechnungen kommen die Autoren zu der Einschätzung, dass im Jahr 2001 in den USA ohne antihypertensive Behandlung der durchschnittliche systolische und diastolische Blutdruck bei über 40-Jährigen 10 bzw. 13 % höher gelegen hätte und insgesamt etwa 86.000 zusätzliche vorzeitige Todesfälle aus kardiovaskulärer Ursache aufgetreten wären (37.295 bis 62.473 bei Männern und 25.876 bis 46.553 bei Frauen). Des Weiteren ermittelten die Forscher, dass im Verlauf des Jahres 2002 ohne effektive Blutdruckbehandlung zusätzlich 572.000 Patienten wegen Schlaganfällen (162.000 Männer, 410.000 Frauen) und 261.000 wegen Herzinfarkten (87.000 Männer, 174.000 Frauen) in stationäre Behandlung gekommen wären. Dies entspricht einer Senkung der Schlaganfall bedingten Krankenhausaufnahmen um 38 % und der Myokardinfarkt bedingten stationären Behandlungen um 25 % im Vergleich zu Hochrechnungen unter den Bedingungen unterlassener Hochdruckbehandlung.
Unter der Annahme, dass alle HypertonikerInnen wirksame Medikamente in richtiger Dosierung und Häufigkeit einnähmen, wären im gleichen Zeitraum in den USA weitere 89.000 vorzeitige kardiovaskuläre Todesfälle zu vermeiden gewesen. Konsequente antihypertensive Behandlung reduzierte die Gesamtsterblichkeit bei über 40-jährigen US-AmerikanerInnen um 4 % und die kardiovaskuläre Mortalität sogar um 9 %; die durchschnittliche Lebenserwartung für die Gesamtbevölkerung wäre ohne Blutdrucktherapie bei Männern 0,5 und bei Frauen 0,4 Jahre niedriger ausgefallen. Unter der Prämisse, dass ein zusätzliches gesundes Lebensjahr eines US-Bügers einen Wert von 90.000 Dollar hat, ergibt dies abzüglich der Behandlungskosten bei Männern einen "Gewinn" von 5.117 US-$ und bei Frauen von 3.454 US$. Die Kosten-Nutzen-Relation liegt demnach für Männer bei 10 zu 1 und für Frauen bei 6 zu 1. Bezieht man die vermiedenen stationären und anderen medizinischen Behandlungen auf Grund der geringeren Häufigkeit von Schlaganfällen und Herzinfarkten bei effektiv behandelten HypertonikerInnen in die Kalkulation ein, die sich für 2002 auf 10,7 bzw. 5,8 Milliarden US$ belaufen, fällt die Kosten-Nutzen-Analyse effektiver Blutdruckbehandlung noch positiver aus. Hier steht der Beitrag von David Cutler und Kollegen The value of antihypertensive drugs: a perspective on medical innovation aus Health Affairs kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Doch nicht nur objektivierbare Verbesserungen klinischer Verläufe und geringere Sterblichkeit untermauern die große Bedeutung der Therapietreue vor allem bei chronisch Kranken. David Mosen, Julie Schmittdiel, Judith Hibbard, David Sobel, Carol Remmers, und Jim Bellows (2007) untersuchten die Auswirkungen von patientenseitigen Aktivierungsmaßnahmen (Patient Activating Measures -PAM) auf Therapieprozess und Adherence auf der einen sowie klinischem Verlauf und Patientenzufriedenheit auf der anderen Seite. Dieses federführend von der Professorin für Gesundheitspolitik an der Universität Oregon, Judith Hibbard, entwickelte 22- bzw. 13-teilige Messinstrument dient der Erfassung des Wissens, der Fähigkeiten und der Zuverlässigkeit des Selbstmanagements von Patienten. Nach Untersuchungen ihrer Arbeitsgruppe weist dieses Instrument geeignete psychometrische Eigenschaften auf, die eine Anwendung auf individueller Patientenebene zur Anpassung von Interventionen und Erfassung von Veränderungen erlauben. Zwei Artikel zu Patient Activating Measures erschienen unter anderem 2004 und 2005in Health Services Research); hier finden Sie die Abstracts der Beiträge Development of the Patient Activation Measure (PAM): Conceptualizing and Measuring Activation in Patients and Consumers und Development and Testing of a Short Form of the Patient Activation Measure.
Die Patientenbefragung mit 61,2-prozentigem Rücklauf zeigte, dass Patienten mit hohem Aktivierungsniveau nicht nur signifikant häufiger Verhaltensweisen im Sinne eines Selbstmanagements, sondern auch eine bessere Therapietreue an den Tag legten. Bei PatientInnen mit hohem PAM-Score lag die Adherence - definiert als maximal eine ausgelassene Tagesdosis pro Woche - bei 93.5 % und damit deutlich über den Vergleichswerten von Personen, die weniger auf Aktivierungsmaßnahmen reagierten. Die Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung war bei "aktivierbaren" PatientInnen mit 69,3 % dreimal so hoch wie bei solchen mit dem niedrigsten PAM-Score 22,5" und der Anteil mit hoher subjektiver Lebensqualität mit 78,4 % mehr als doppelt so groß wie unter den schwer aktivierbaren Patienten (38,0 %). Damit waren die Wahrscheinlichkeit hoher Patientenzufriedenheit bei Personen mit hohem PAM-Wert zehn Mal und die hoher Lebensqualitätswerte 5 Mal so hoch wie bei Patienten mit niedrigem Aktivierungsniveau. Außerdem schätzten Personen mit hohem PAM-Wert ihre physische und mentale Leistungsfähigkeit signifikant höher ein.
Auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse ziehen Cutler und Everett vier Schlussfolgerungen, die auch für das deutsche und wohl die allermeisten anderen Gesundheitssysteme zutreffend sind, die Gesundheitsreformen aber regelmäßig entweder außer Acht lassen oder gar konterkarieren: Erstens gehört der Abbau finanzieller Zugangsbarrieren und insbesondere von Zuzahlungen zu den unabdingbaren Maßnahmen zur Verbesserung der Adherence; anderer herum können finanzielle Anreize oder Belohnungen sogar die Therapiereue fördern. Zweitens ist es erforderlich, die Möglichkeiten der Informationstechnologie im Gesundheitswesen vorrangig zur Verbesserung der Therapietreue anzuwenden, und zwar durch bessere Datenvernetzung und möglicherweise elektronische Erinnerungssysteme. Bemerkenswerterweise geht Cutler an dritter Stelle auf ein Thema ein, dessen Zusammenhang zur Adherence in manchen Augen überraschend erscheinen mag und in Teilen der niedergelassenen Ärzteschaft in Deutschland sicherlich auf Widerspruch stoßen wird, nämlich den Einfluss der Bezahlung der Behandler: Honorierungssysteme, die Leistungserbringer nicht ausschließlich nach erbrachten Leistungen, sondern auch entsprechend den Behandlungsergebnissen bezahlen und koordinierte Behandlungswege fördern, können entscheidend zur Verbesserung der Therapietreue beitragen; allerdings sollten die Performance-Indikatoren auch explizite Adherence-Ziele beinhalten. Und viertens empfiehlt David Cutler auf individueller Patientenseite die systematische Erfassung von Faktoren wie Depression oder Selbstmanagement-Problemen, um bei PatientInnen mit höherer Tendenz zur Nicht-Einhaltung von Therapievereinbarungen gezielte Maßnahmen zur Adherence-Verbesserung anzuwenden. "… these findings suggest that improved adherence will require changes in health care delivery, particularly in the area of primary care, along with continued investment in information-technology systems and new health plan designs that focus on achieving improved health outcomes."
Den Leitartikel Thinking Outside the Pillbox - Medication Adherence as a Priority for Health Care Reform aus dem New England Journal of Medicine 362 (17), S. 1533-1555, können Sie hier kostenfrei herunterladen.
Jens Holst, 11.5.10
Studie zu Risiken und Nebenwirkungen von Zuzahlungen in Deutschland
 Welchen Einfluss haben Medikamenten-Zuzahlungen auf die Befolgung ärztlicher Einnahmevorschriften? Werden durch niedrigere Zuzahlungen möglicherweise sogar Therapieerfolge verbessert und damit Kosten im Gesundheitswesen gesenkt? Im Ausland gibt es hierzu bereits etliche Untersuchungen, für Deutschland untersucht diese Fragen jetzt das Bremer Forschungsinstitut "BIAG" in Kooperation mit der Versandapotheke Sanicare.
Welchen Einfluss haben Medikamenten-Zuzahlungen auf die Befolgung ärztlicher Einnahmevorschriften? Werden durch niedrigere Zuzahlungen möglicherweise sogar Therapieerfolge verbessert und damit Kosten im Gesundheitswesen gesenkt? Im Ausland gibt es hierzu bereits etliche Untersuchungen, für Deutschland untersucht diese Fragen jetzt das Bremer Forschungsinstitut "BIAG" in Kooperation mit der Versandapotheke Sanicare.
Arzneimittel-Zuzahlungen sollen nicht nur zur Finanzierung des Gesundheitssystems beitragen, sondern auch Patienten dazu bringen, ausschließlich medizinisch notwendige Leistungen in Anspruch zu nehmen und Arzneimittel im Sinne von "Adherence" oder "Therapietreue" verordnungsgemäß einzunehmen. In den letzten 40 Jahren ist das Volumen der Zuzahlungen in Deutschland von 8 auf 13 Prozent der gesamten GKV-Ausgaben gestiegen. Nach Schätzungen der BKK leisteten GKV-Versicherte 2006 Medikamenten-Zuzahlungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro.
Eigenbeteiligungen in der Gesundheitsversorgung waren schon mehrfach Thema im Forum Gesundheitspolitik, beispielsweise mit den Beiträgen Alte und neueste Ergebnisse der Forschung über erwünschte und unerwünschte Wirkungen von Zuzahlungen im Gesundheitsbereich und Selbstbeteiligungen und kein Ende: Was lange währt, ist keineswegs immer gut. Sinn und Zweck von Patientenzuzahlungen sind indes seit Langem umstritten. Kritiker verweisen darauf, dass Zuzahlungen häufig auch sinnvolle und medizinisch notwendige Leistungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen verhindern, wobei dies insbesondere Angehörige unterer Sozialschichten trifft und letztlich höhere Folgekosten statt Ersparnisse bewirkt. Wegen dieser empirisch belegten unerwünschten Effekte sind in den Niederlanden Ende der 1990er Jahre und jüngst in Irland Zuzahlungen abgeschafft worden.
Ein weiterer bisher eher vernachlässigter unerwünschter Effekt von Zuzahlungen, ist die mangelnde Therapietreue. Häufig reagieren Patienten auf Zuzahlungen, indem sie die Dosis verringern, um länger mit Medikamentenpackungen auszukommen, oder indem sie die Therapie ganz abbrechen. Dadurch werden im Gesundheitssystem nicht nur Gelder verschwendet, sondern auch zusätzliche Gesundheitsrisiken hervorgerufen durch Verschleppung und Chronifizierung von Krankheiten.
Eine Reihe von Studien in den USA zeigt nun eine überraschende Lösung für dieses Problem auf: Spürbare Senkung der Zuzahlungen! Wie beispielsweise in dem Artikel Impact Of Decreasing Copayments On Medication Adherence Within A Disease Management Environment, nachzulesen ist, der Anfang 2008 in Health Affairs erschien, ließ sich im Rahmen von Chronikerprogrammen ("Active Health Management") die Häufigkeit mangelnder Therapietreue im Bereich von fünf Medikamentengruppen für chronisch Kranke (z.B. Antidiabetika, Antihypertonika) ganz erheblich um 7 bis 14 Prozent verringern. In einer anderen Studie für DiabetikerInnen, in der man die Folgen einer Senkung der Arzneimittelzuzahlung beim großen Frankiermaschinen-Hersteller Pitney Bowes überprüfte, verbesserte sich nicht nur das Einnahmeverhalten wesentlich, sondern zugleich gingen die Zahl der Patienten, die eine Notfallstation aufsuchen mussten, um 26 Prozent und die durchschnittlichen Gesamtausgaben für Antidiabetika um 7 Prozent zurück, wie im Milliman Client Report 2008 nachzulesen ist. Zahlen über verbessertes Einnahmeverhalten und verringerte Gesundheitsausgaben in Folge der großzügigeren Kostenübernahme bei Diabetes-Medikamenten für Pitney-Bpowes-MitarbeiterInnen liefert auch ein Artikel von John Mahoney, der bereits im August 2005 im American Journal of Managed Care und kostenfrei unter dem Titel Reducing Patient Drug Acquisition Costs Can Lower Diabetes Health Claims zur Verfügung steht.
Ob derartige Wirkungen auch im deutschen Gesundheitswesen zu beobachten sind und damit Änderungen der Zuzahlungspolitik und -erwartungen notwendig sind, lässt die größte deutsche Versandapotheke Sanicare von Gesundheitswissenschaftlern aus Bremen und Berlin in einer breit angelegten Studie untersuchen. Bei über 6.000 Kunden der Versandapotheke, die regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen müssen, wird im Rahmen mehrerer Befragungen erfasst, ob sich die Therapietreue verändert, wenn diese Patienten die Hälfte der Zuzahlungen erstattet bekommen. In einem 24-seitigen Fragebogen mit über 50 Fragen geben diese mehrfach befragten Studienteilnehmer nicht nur Auskunft über ihre Medikamenten-Einnahme, sondern auch über viele andere Faktoren, die das Einnahmeverhalten mit beeinflussen. Ergänzend dazu erfolgt eine Aufarbeitung des internationalen Wissensstands über die positive Wirkung einer verbesserten Therapietreue auf die Behandlungserfolge und Kosten aufgearbeitet.
Einen Überblick über die bisher vorliegenden empirischen Erfahrungen und die Studienlage sowie über die Zielsetzung der Untersuchung geben die beteiligten Wissenschaftler in einem ausführlichen Artikel, der in der März-Ausgabe der Zeitschrift Die Ersatzkasse der Ersatzkassenverbands VDEK erschien. NutzerInnen des Forum Gesundheitspolitik steht der Artikel von Bernard Braun, Gerd Glaeske, Jens Holst und Gerd Marstedt aus "Die Ersatzkasse" (3/2010) kostenlos zum Download zur Verfügung: Steigerung der Therapietreue - Arzneimittelzuzahlungen sind eher Problem als Lösung.
Leider ist die zugehörige Literaturliste in diesem PDF-Dokument nicht korrekt verlinkt. Sie können die ausführlichen Literaturangaben zu dem Artikel aber hier direkt herunterladen.
Jens Holst, 28.4.10
Innenleben der "Zwei-Klassen-Medizin: Arzneimittel und PKV=wirtschaftlich, innovativ, wirksam, qualitativ hochwertig? Eher nicht!
 Auch wenn manche PatientInnen über "Zweiklassen-Medizin" klagen, die wochenlang auf einen Facharzttermin warten oder stundenlang im Wartezimmer privatversicherte Mitleidende an sich vorbeiziehen sehen, zeigte bereits eine vor kurzem erschienene Studie, dass es sowohl bei der Wirtschaftlichkeit als auch bei der Versorgungsqualität in der PKV Schattenseiten gibt.
Auch wenn manche PatientInnen über "Zweiklassen-Medizin" klagen, die wochenlang auf einen Facharzttermin warten oder stundenlang im Wartezimmer privatversicherte Mitleidende an sich vorbeiziehen sehen, zeigte bereits eine vor kurzem erschienene Studie, dass es sowohl bei der Wirtschaftlichkeit als auch bei der Versorgungsqualität in der PKV Schattenseiten gibt.
Dieser Eindruck wird durch eine im Februar 2010 erschienene Analyse über die Arzneimittelversorgung der PKV-Versicherten aus dem "Wissenschaftlichen Institut des PKV-Verbandes (WIP)" mehrfach illustriert.
Ihre wesentlichen, empirisch gut belegten Ergebnisse lauten nämlich folgendermaßen:
• Obwohl die Arzneimittelausgaben schon in der GKV trotz einer schier endlosen Liste von Regulierungsansätzen und -versuchen zu den Dauer-Problembereichen gehören, sieht es in der PKV schlechter aus: "Die Arzneimittelausgaben in der PKV weisen jährlich nicht nur höhere Steigerungsraten als in der GKV auf, sondern steigen regelmäßig auch stärker im Vergleich zu anderen Leistungsbereichen" der PKV.
• Auch wenn GKV-Versicherte und Arzneimittelhersteller einstimmig der Meinung sind oder die Wahrnehmung haben, PKV-Versicherte erhielten die "moderneren" und angeblich "besseren" bzw. wirksameren Mittel verordnet, zeigt der PKV-Bericht ein quantitativ und qualitativ anderes oder differenzierteres Bild des Verordnungsgeschehens. Die "gesamtmarktbezogene Innovationsquote ohne Berücksichtigung von OTC-Präparaten" betrug danach 2008 in der PKV 28,89% und in der GKV trotz einiger Berechnungsproblemen rund 24%. Neue Medikamente hatten 2008 in der PKV einen Anteil am Gesamtumsatz der Medikamente von 7%, in der GKV 6%. Bei allen Werten war der Unterschied noch 2007 größer. Er verringerte sich hauptsächlich durch Veränderungsprozesse in der PKV. Die Zusammenfassung der Vergleiche von PKV- und GKV-Zahlen lautet: "Die Berechnung einer gesamtmarktbezogenen und indikationsbezogenen Innovationsquote erbrachte, dass Privatversicherte anteilig etwas häufiger neue Medikamente erhalten als GKV-Versicherte."
• Ein Teil der Arzneimittel-Ausgabenprobleme in der PKV ergibt sich durch die sehr niedrige so genannte Generikaquote: "Für die 100 umsatzstärksten generikafähigen Wirkstoffe konnte bei der PKV für das Jahr 2008 eine Generikaquote (nach Verordnungen) von 51,4 % berechnet werden. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (46,4 %). Die GKV weist eine erheblich größere Quote auf. Auf hohem Niveau konnte hier sogar noch ein weiterer Anstieg von 86,1 % auf 89,7 % erreicht werden. Bei generikafähigen Wirkstoffen erhalten Kassenpatienten damit nur noch in einem von zehn Fällen das Originalpräparat."
• Was in der PKV aber offensichtlich eine im Vergleich mit der GKV wesentlich größere oder überhaupt eine Rolle spielt, ist die Verordnung und Bezahlung von nichtverschreibungspflichtigen Medikamenten. "Bei mehr als einem Drittel aller eingereichten Arzneimittelverordnungen (36,6 %) handelt es sich um ein nicht-verschreibungspflichtiges Medikament."
• Dass dies nicht nur ein Finanzierungsproblem, sondern vor allem ein qualitatives Problem darstellt, zeigt der Blick auf die Liste der so verordneten Präparate. Das 2008 umsatzstärkste OTC-Präparat war Tebonin (bei der Anzahl der Verordnungen lag Aspirin vorne). Tebonin lag 2008 in der Liste der Umsatzanteile aller abgerechneter Arzneimittel in der PKV auf Platz 9 und in der GKV auf Platz 599.
• Dies wäre u.U. sogar hinzunehmen, wenn durch die Einnahme von Tebonin wirklich die Aktivität von Milliarden Gehirnzellen aktiviert würde, Tinnitusprobleme verschwinden und prädementielle Prozesse gestoppt oder erheblich verzögert würden (Wer es vergessen hat: So lauten eine Reihe der gut platzierten Werbebehauptungen). Die letzte Veröffentlichung der "Stiftung Warentest (4/2010) hegt genau dazu aber erhebliche Zweifel: "Wenig geeignet bei Demenzerkrankungen und Hirnleistungsstörungen. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen. Aufgrund einiger positiver Studienergebnisse scheint ein Behandlungsversuch allerdings gerechtfertigt, wenn besser beurteilte Mittel nicht eingesetzt werden können." Und: "Wenig geeignet bei peripheren arteriellen Durchblutungsstörungen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist." Der Pharmakologe Kay Brune, Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, bemerkte bereits vor längerem: "Dieser Wirkstoff, oder dieses Produkt - denn ein Wirkstoff ist nicht bekannt - ist in allen mir bekannten Studien wenig erfolgreich gewesen, in den drei wesentlichen Studien total unerfolgreich. Man kann also davon ausgehen, dass Ginkgo bei Demenzstörungen oder bei kognitiven Störungen keine therapeutische Wirksamkeit aufweist." Und da damit der Wirkstoff von Tebonin und einer Reihe ähnlich als wirksam beworbenen Präparaten angesprochen wurde, gibt der anerkannte Pharmakologe Peter Schönhöfer in Würdigung einer nicht ganz einhelligen Forschungs- und Bewertungslage folgendes zu bedenken: "In dieser Studie, an dieser großen Zahl von Patienten zeigt sich, dass keine Verhinderung von dementieller Entwicklung stattfindet. Im Gegenteil: die Patienten die Ginkgo bekommen haben, haben eine höhere Tendenz eine Demenz zu entwickeln als die Patienten die es nicht bekommen". Dies gelte zumindest für Patienten mit einer Vorerkrankung der Herzgefäße.
• Dabei geht es um die mit 3.069 TeilnehmerInnen über 6,1 Jahre durchgeführte aktuellste und umfangreichste Studie "Ginkgo biloba for Preventing Cognitive Decline in Older Adults" von Snitz et al., deren ERgebnisse in der renommierten Medizinzeitschrift JAMA (JAMA 2009;302[24]:2663-2670) erschienen und diskutiert worden sind. Wesentliches Ergebnis: "Compared with placebo, the use of G biloba, 120 mg twice daily, did not result in less cognitive decline in older adults with normal cognition or with mild cognitive impairment."
Ohne die Wirksamkeit von Gingko generell und abschließend bewerten zu können und unter Berücksichtigung einer zum Teil positive Bewertung der Wirksamkeit von Gingko durch das IQWiG, sei die Erkenntnislage so zusammengefasst: Im "Spiel" Wirksamkeit gegen Unwirksamkeit von Tebonin steht es im Moment und aus Sicht unabhängiger "Schiedsrichter" 1:4. Ob dieser "Spielstand" die Verordnungs- und Abrechnungshäufigkeit und vor allem die Einnahme von Tebonin durch die PKV-Versicherten rechtfertigt, müssen letztlich diese entscheiden.
Die auch über das Zitierte hinaus lesenswerte und materialreiche 92-seitige Studie "Arzneimittelversorgung der Privatversicherten 2008. Zahlen, Analysen, PKV-GKV-Vergleich" von Frank Wild ist im Februar 2010 als Diskussionspapier des "Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP)" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.4.10
Lehrstück "Rosiglitazone und Herzinfarktrisiko" zum Zweiten - Assoziation von finanziellen Interessenskonflikten und Bewertung.
 Über das lange vom Hersteller GlaxoSmithKline (GSK) totgeschwiegene aber schließlich doch öffentlich gewordene gesundheitliche Risiko (Herzinfarkt) des zur Behandlung von Diabeteskranken eingesetzten Wirkstoffs Rosiglitazone wurde hier bereits ausführlich berichtet. Wie dieses Verschweigen oder auch die Umdeutung von Wirklichkeiten abläuft und wer neben dem Hersteller mit welchen Methoden der Verbreitung der Wahrheit aktiv im Wege steht, dokumentiert jetzt ein systematischer Querschnitts-Review über mögliche Zusammenhänge zwischen finanziellen Interessen von publizierenden Wissenschaftlern und ihrer Position zu der Assoziation des Risikos eines Herzinfarkts und der Einnahme von Rosiglitazone im renommierten "British Medical Journal (BMJ)".
Über das lange vom Hersteller GlaxoSmithKline (GSK) totgeschwiegene aber schließlich doch öffentlich gewordene gesundheitliche Risiko (Herzinfarkt) des zur Behandlung von Diabeteskranken eingesetzten Wirkstoffs Rosiglitazone wurde hier bereits ausführlich berichtet. Wie dieses Verschweigen oder auch die Umdeutung von Wirklichkeiten abläuft und wer neben dem Hersteller mit welchen Methoden der Verbreitung der Wahrheit aktiv im Wege steht, dokumentiert jetzt ein systematischer Querschnitts-Review über mögliche Zusammenhänge zwischen finanziellen Interessen von publizierenden Wissenschaftlern und ihrer Position zu der Assoziation des Risikos eines Herzinfarkts und der Einnahme von Rosiglitazone im renommierten "British Medical Journal (BMJ)".
Die 202 Artikel, die sich bis zum April 2009 mit diesem Zusammenhang befassten, wurden danach klassifiziert, ob sie ausdrücklich und entschieden kein Risiko sahen (17% con 180 einzelnen AutorInnen), sich neutral verhielten (47% von den 180) oder dieses Risiko eindeutig benannten (36% von den 180). Jedem Aufsatz wurden alle veröffentlichten Kenntnisse über finanzielle Interessen der AutorInnen hinzugefügt, die sie selber in diesem und vorherigen Aufsätzen angegeben hatten. Die Reviewer, welche die Aufsätze klassifizierten wussten nichts von den AutorInnen oder ihren finanziellen Interessen.
Die Ergebnisse waren eindeutig und unerfreulich:
• Zunächst gab es lediglich in 53% der Aufsätze (108 Autoren) eine Erklärung über mögliche Interessenkonflikte. Nach der bisherigen Erkenntnisse über Interessenkonflikte müsste eigentlich jeder Autor daran interessiert sein, den Verdacht, etwas zu verschweigen, durch derartige Angaben zu entkräften - sofern dies möglich ist!!
• 90 Autoren oder 45% aller AutorInnen hatten nach ihren eigenen Angaben einen finanziellen Konflikt, d.h. z.B. von der Firma GSK oder einer anderen Pharmafirma Geld erhalten. 69% gaben dies bei dem speziellen Aufsatz an und beim Rest konnte dies nur durch weitere Recherchen in Erfahrung gebracht werden. Dies bedeutet, dass nur 18 AutorInnen, die Angaben machten, positiv sagten, sie hätten keine finanziellen Konflikte. Etwas spitzer formuliert könnte man aber auch sagen, dass nur rund 9% aller zum Thema Rosiglitazone publizierenden AutorInnen nach ihren eigenen Angaben ausdrücklich keine finanziellen Konflikte haben, die sich möglicherweise auf ihre Ergebnisse und Bewertungen auswirken könnten.
• Die Chance (Wahrscheinlichkeit), dass AutorInnen kein Risiko eines Herzinfarkts "feststellten" oder erwarteten war bei denjenigen von ihnen, die finanzielle Interessenkonflikte durch Beziehungen zu einem Hersteller von blutzuckersenkenden Arzneimitteln angaben, 3,4fach so hoch wie bei Autoren, die diese Konflikte nicht angaben. Hatten die Verfasser finanziellen Kontakt zu einem Hersteller des Wirkstoffs Rosiglitazone war die Chance eines "favourable view" auf die Wirkung sogar 4,3fach höher. Auch die Chance, die Arzneimittel mit diesem Wirkstoff sogar ausdrücklich zu empfehlen, war bei den AutorInnen mit finanziellen Konflikten der genannten Art um knapp das 4,7fache erhöht. Diese Tendenz verstärkte sich sogar noch in Meinungsartikeln (6,29fache) und in Artikeln, die sich gezielt auf die Kontroverse konzentrierten (6,5fache). Selbst als die us-amerikanische "Food and Drug Administration (FDA)" die ersten Sicherheitswarnungen zu Rosiglitazone veröffentlichte, sahen AutorInnen mit finanziellen Konflikten Rosiglitazone um das 3- bis 4fache positiver als ihre KollegInnen ohne derartige Konflikte.
• Wenn der Analyse nicht Autoren, sondern Aufsätze zugrundegelegt wurden, waren 86% der Artikel, die kein Risiko sahen, von AutorInnen geschrieben, die einen finanziellen Kontakt oder Konflikt mit GSK angegeben hatten. Dies war nur bei den AutorInnen von 18% aller Aufsätze der Fall, in denen das genannte Risiko für gesichert hielten.
Die Methodik des Reviews erlaubt zwar nicht, von einem kausalen Zusammenhang von finanziellen Interessen und Konflikten und der Bewertung des Nebenwirkungsrisikos von Rosiglitazone zu sprechen. Trotzdem ist den Verfassern zuzustimmen, dass sowohl der Anteil der AutorInnen, die keinerlei Angaben zu möglichen Interessenskonflikten machen, drastisch gesenkt werden muss als auch eine formelle Datenbasis für Interessenskonflikte geschaffen werden sollte. Nicht jedem Interessierten ist schließlich eine aufwändige Recherche in PubMed, Scopus oder Google zuzumuten.
Vielleicht ist es auch notwendig, deutlicher als bisher der Seriosität und Interessenkonfliktfreiheit von Ergebnissen aus Veröffentlichungen zu misstrauen, wenn keine Angabe zu möglichen Interessenkonflikten gemacht werden!?
Der Aufsatz "Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review von
Amy T Wang, Christopher P McCoy, Mohammad Hassan Murad und Victor M Montori ist am 18.3.2010 online im "British Medical Journal" (BMJ 2010;340:c1344) veröffentlicht worden und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.4.10
Sturzprävention: Benzodiazepinkonsum älterer Menschen durch einmalige Beratungsveranstaltung signifikant und dauerhaft senkbar.
 Die Einnahme psychotropischer bzw. wesensverändernder Arzneimittel ist bei älteren Menschen weit verbreitet. In einer finnischen Studie mit 75 Jahre alten und älteren Personen, die in ihren eigenen vier Wänden wohnten, nahmen 37% mindestens eine derartiges Medikament ein, 12% sogar zwei und mehr. Jeder Dritte nutzte Schlafmittel oder angstlösende Arzneimittel, deren Hauptwirkstoff Benzodiazepin oder ein ähnlicher Stoff war. Benzodiazepine werden in der Regel über längere Zeit und regelmäßig eingenommen.
Die Einnahme psychotropischer bzw. wesensverändernder Arzneimittel ist bei älteren Menschen weit verbreitet. In einer finnischen Studie mit 75 Jahre alten und älteren Personen, die in ihren eigenen vier Wänden wohnten, nahmen 37% mindestens eine derartiges Medikament ein, 12% sogar zwei und mehr. Jeder Dritte nutzte Schlafmittel oder angstlösende Arzneimittel, deren Hauptwirkstoff Benzodiazepin oder ein ähnlicher Stoff war. Benzodiazepine werden in der Regel über längere Zeit und regelmäßig eingenommen.
Alle psychotropische Arzneimittel erhöhen bei älteren Menschen das Risiko von Stürzen und Knochenbrüchen. Dem steht speziell bei Schlafstörungen ein marginaler Nutzen gegenüber und das Risiko unerwünschter Effekte wie beispielsweise der von Abhängigkeit oder behandlungsabhängiger Depressionen ist hoch.
Daher verwundert es nicht, dass in einer prospektiven randomisierten kontrollierten Studie mit 528 freiwilligen und rüstigen TeilnehmerInnen im 65+-Alter untersucht wurde, ob und wodurch die langfristige Einnahme von Benzodiazepinen und vergleichbarer Arzneimittel dauerhaft verringert werden kann.
Die präventive Intervention bestand zu Beginn der Studie in einer mündlichen Bestandsaufnahme der gesamten Medikation der TeilnehmerInnen durch einen Geriater, was auch die Beratung über die Zweckmäßigkeit der Einnahme von Benzodiazepinen und ggfls. auch die Verordnung anderer, für notwendig gehaltenen Arzneimittel umschloss. Im weiteren Verlauf der Studie erhielten die Angehörigen der Interventionsgruppe eine einstündige Informationsveranstaltung über die Benzodiazepine und ihre unerwünschten Wirkungen sowie über weitere Möglichkeiten der Sturzprävention angeboten. Deren erklärtes Ziel war die Beendigung, die Reduktion oder der Wechsel der Einnahme von Benzodiazepine. In der Kontrollgruppe wurde die vorherige Verordnung und Einnahme derartiger Medikamente fortgesetzt.
Die Wirkung der Intervention in der Zeit wurde auch noch durch ein 12-Monate-Follow up gemessen. Frühere Studien hatten im Übrigen schon gezeigt, dass auch ein einfacher Brief des Hausarztes zur Benzodiazepineinnahme bereits Wirkungen erzielen kann.
Die Ergebnisse lauten:
• Die Anzahl der regelmäßigen NutzerInnen von Benzodiazepinen und verwandter Wirkstoffe sank in der Interventionsgruppe signifikant (p=0,012) um 35%. In der Kontrollgruppe stieg sie dagegen um 4%.
• Die größten präventiven Wirkungen wurden bei "jüngeren" Alten und Frauen erzielt.
• Die Intervention reduzierte auch die Anzahl der Personen, die Benzodiazepine nur unregelmäßig einnahmen. In dieser Gruppe trat zusätzlich der auch in anderen kleinräumigen Interventionsstudien beobachtete Effekt auf, dass auch die Anzahl der Angehörigen der Kontrollgruppe, die Benzodiazepine einnahmen, signifikant abnahm. Erklärbar ist dies durch die engen sozialen Kontakte der StudienteilnehmerInnen in der Kommune oder auch durch die Medienberichterstattung über die Hintergründe der Studie.
So eindrucksvoll die immerhin über 12 Monate anhaltende Wirkung der relativ unaufwändigen Intervention auch ist, so bedauerlich ist, dass die Studie an keiner Stelle untersucht, ob die Reduktion der Einnahme psychotroper Arzneimttel auch noch etwas an der Häufigkeit von Stürzen ändert. Selbst wenn es dort keine signifikanten Veränderungen gäbe, rechtfertigte der mit der Nichteinnahme verbundene Gewinn an Lebensqualität und Nebenwirkungsfreiheit die Intervention.
Von dem in der renommierten Fachzeitschrift "Age and Ageing" (2010 39(3):313-319; doi:10.1093/ageing/afp255) erschienenen siebenseitigen Aufsatz "One-time counselling decreases the use of benzodiazepines and related drugs among community-dwelling older persons" von Maritta Salonoja, Marika Salminen, Pertti Aarnio, Tero Vahlberg und Sirkka-Liisa Kivelä gibt es kostenlos sowohl ein Abstract als auch die komplette Fassung.
Bernard Braun, 14.4.10
Täuschen, leugnen, desinformieren und einschüchtern - Strategien von GlaxoSmithKline zur Vermarktung ihres Diabetes-Blockbusters
 In seinem am 26. März 2010 publizierten programmatischen Papier "Eckpunkte zur Umsetzung des Koalitionsvertrags für die Arzneimittelversorgung" spielen Studien und Nutzenbewertungen, welche die Pharmaunternehmen vorlegen müssen, wenn sie ein Medikament mit hohem Preis oder angeblichen hohen Zusatznutzen auf den Markt bringen wollen, eine wichtige Rolle. Deren Ergebnisse können, so das Bundesgesundheitsministerium, vom Gemeinsamen Bundesausschuss und dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen überprüft werden und innerhalb eines Zeitraums zwischen drei Monaten und maximal drei Jahren zu praktischen Entscheidungen über den Nutzen und den Preis des Arzneimittels führen.
In seinem am 26. März 2010 publizierten programmatischen Papier "Eckpunkte zur Umsetzung des Koalitionsvertrags für die Arzneimittelversorgung" spielen Studien und Nutzenbewertungen, welche die Pharmaunternehmen vorlegen müssen, wenn sie ein Medikament mit hohem Preis oder angeblichen hohen Zusatznutzen auf den Markt bringen wollen, eine wichtige Rolle. Deren Ergebnisse können, so das Bundesgesundheitsministerium, vom Gemeinsamen Bundesausschuss und dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen überprüft werden und innerhalb eines Zeitraums zwischen drei Monaten und maximal drei Jahren zu praktischen Entscheidungen über den Nutzen und den Preis des Arzneimittels führen.
Der Gesundheitsökonom, Mediziner und SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hat zu diesem Verfahren festgestellt: "Das wäre so als ob Öko-Test die Energieeffizienz eines Autos auf Basis eines Herstellerberichts bewerten müsste."
Auch wenn Lauterbach hier etwas zu flott und angreifbar den G-BA- und IQWIG-Teil der BMG-Überlegungen unter den Tisch fallen lässt, ist die Vorstellung, die Pharmahersteller würden lammfromm entweder wahrheitsgemäße und vollständige oder verfälschte und tendenziöse, aber leicht als solche durchschaubare Studienergebnisse auf den Tisch des GKV-Spitzenverbands legen, im besten Fall naiv.
Mit welchen Methoden es eine solche "naive" Arzneimittelpolitik wirklich zu tun bekommt, zeigt ein Bericht eines Ausschusses des us-amerikanischen Kongresses über das Verhalten eines der weltgrößten Pharmakonzerne, GlaxoSmithKline (GSK), im Falle des von ihm produzierten Medikaments Avandia mit seinem Wirkstoff Rosiglitazon.
Zu diesem Wirkstoff gibt das Wikipedia-Stichwort zu "Rosiglitazon" folgende Auskünfte:
"Rosiglitazon ist ein Antidiabetikum aus der Gruppe der Insulin-Sensitizer. Es wird bei Diabetes mellitus Typ 2 in Form von Tabletten eingesetzt. Das Wirkprinzip ist eine Erhöhung der Empfindlichkeit des Gewebes auf Insulin. Das körpereigene Insulin ist folglich wieder effektiver in der Lage, erhöhte Blutzuckerspiegel zu senken."
So weit, so gut. Wie es aussieht, wenn man allzu blind den Aussagen der Hersteller und eines Teils der eigentlich zur Kontrolle der Wahrheit ihrer Aussagen gegründeten Experteninstitutionen folgt, zeigt der weitere Wikipediatext zu der aktuell (abgerufen am 28. März 2010) kommunizierten Wirkung: "Bei einer Auswertung von 42 Studien, die im Juni 2007 im New England Journal of Medicine (Nissen/Wolski: Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction and death from cardiovascular causes. In: N Engl J Med. 2007 Jun 14;356(24):2457-71. Epub 2007 May 21.) veröffentlicht wurde, wurde ein um 43% erhöhtes Herzinfarktrisiko beobachtet. Der Hersteller des Medikamentes sowie die Europäische Arzneimittelagentur zweifeln die Aussagekraft der Metastudie jedoch an."
Der in den USA unter dem Markennamen Avandia verkaufte Wirkstoff war mit rund 3 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz einer der so genannten "Blockbuster" von GSK.
Der im Januar 2010 veröffentlichte "Staff Report on GlaxoSmithKline and the Diabetes Drug Avandia" gibt auf 342 Seiten einen tiefen Einblick in so ziemlich alle, immer wieder berichteten Mittel der Ignoranz und Nichtweiterverbreitung von Erkenntnissen über eindeutig schädigende oder nutzlose Wirkungen eines Medikaments und die Bereitschaft, zur Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung strategisch und systematisch sämtliche legalen, illegalen und unseriösen Mittel anzuwenden. Mit der Lektüre des Berichts und seiner Fülle an dokumentarischen Belegen und Verweisen aus Anhörungen der beteiligten Wissenschaftler und Firmenvertretern, veröffentlichten und bisher unveröffentlichten Firmendokumenten sowie einiger Gespräche mit anonymen "whistleblowers", kann man sich die Lektüre einer Vielzahl anderer Berichte über einzelne der branchenüblichen Methoden ersparen oder wesentlich abkürzen.
Im "executive summary" des US-Kongress-Reports steht in wenigen nüchternen Sätzen, die von Pharmakritikern nicht hätten besser formuliert werden können, die volle Breite dessen was dann danach den Leser erwartet:
"This staff report was developed over the last 2 years by U.S. Senate Committee on Finance investigators who reviewed over 250,000 pages of documents provided by GlaxoSmithKline (GSK/the Company), the Food and Drug Administration (FDA), the University of North Carolina, and others. Committee investigators also conducted numerous interviews and phone calls with GSK, the FDA, and anonymous whistleblowers. Committee staff began this investigation in May 2007 after a study was published in the New England Journal of Medicine, showing a link between the diabetes drug Avandia (rosiglitazone) and heart attacks. However, the reviewed evidence suggests that GSK knew for several years prior to this study that there were possible cardiac risks associated with Avandia. As a result, it can be argued that GSK had a duty to warn patients and the FDA of the Company's concerns. Instead, GSK executives attempted to intimidate independent physicians, focused on strategies to minimize or misrepresent findings that Avandia may increase cardiovascular risk, and sought ways to downplay findings that a competing drug might reduce cardiovascular risk. When an independent scientist sought to publish a study in 2007 pointing out the cardiovascular risk of Avandia, GSK acquired a leaked copy of that study from one of its consultants prior to the study being published. The company's own experts analyzed the study, found it to be statistically reliable, and then attacked the soundness of that study in press releases and public comments. GSK also sought to counter the study's findings by quickly releasing preliminary results from its own study on Avandia, even though the company's internal communications established that its study was not primarily designed to answer questions about cardiovascular risk."
Wer immer noch glaubt, hier handle es sich um einige Ausrutscher von ein paar "schwarzen Schafen" im unteren Management von GSK oder um die unglückliche und zufällige Koinzidenz von für sich betrachtet harmlosen Aktivitäten (so einige der immer wieder zu hörenden Entlastungsargumente) oder wer wenig Zeit hat, der braucht sich eigentlich nur die synoptische "Visual Timeline of public and internal (der Firma GSK) information" für den Zeitraum 2003 bis Mitte 2007 auf der Seite 25 des Reports durchzulesen.
Wer aber auch noch lesen will, dass die Firma aus eigenen Studien bereits im Herbst 2005 und im Sommer 2006 wusste, dass das Risiko einer Herzerkrankung bei Personen, die Avandia einnahmen, signifikant um 29% bzw. 31% über dem der Nichteinnehmer lag, muss die insgesamt nur 15 Seiten Text lesen und von Fall zu Fall in den mehrhundertseitigen Quellenanhang schauen.
Den nun bereits gewonnenen Eindruck kann man mit der Lektüre zweier Beiträge in der Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift JAMA vom 24. März 2010 abrunden. Darunter ein Editorial, das sich u.a. mit der Frage beschäftigt, was getan werden muss, um nicht selber Aufsätze zu veröffentlichen, in denen mit kräftiger Unterstützung oder Billigung durch die Arzneimittelhersteller die Unwahrheit oder zumindest nicht die ganze Wahrheit verbreitet wird.
Anlässlich der Veröffentlichung des zitierten Kongress-Reports und weiterer kritischer Analysen zu den Umständen und Methoden, wurde auch öffentlich, zu welchen Methoden auch in einer von GSK finanzierten Studie (RECORD = Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes) gegriffen wurde. Der aktuelle und kostenlos erhältliche Beitrag "Setting the RECORD Straight" von St. Nissen in JAMA (2010;303(12): 1194-1195) enthält einige exemplarische Einblicke.
Und das bereits erwähnte Editorial von Ch. DeAngelis und Ph. Fontanarosa vermittelt einen noch breiteren Überblick über die Reihe weiterer erlaubter und unerlaubter Methoden der Beeinflussung der (Fach-)Öffentlichkeit zu Lasten der Diabetespatienten und die Möglichkeiten, dies zu verhindern.
Praktisch schlägt der Beitrag vor, dass dann, wenn die Ergebnisse einer von Herstellern gesponsorten Studie in einer der renommierten und handlungssteuernden Fachzeitschriften zur Veröffentlichung eingereicht werden, mindestens ein völlig unabhängiger Wissenschaftler Einblick in die Originaldaten der Studie hatte und deren Korrektheit vor dem Start der üblichen Reviewrunden bestätigt. Die statistischen Analysen der Studien sollten ebenfalls von Statistikern gemacht werden, die in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Industrie-Sponsor stehen.
Ob auch diese Ideen noch zu blauäugig sind, steht dahin. Dass die Vorstellungen des BMG angesichts der hier durch mehrere unabhängige Untersucher und ForscherInnen hochaktuell belegten Machenschaften und Winkelzüge eines der größten Arzneimittelhersteller der Welt erschütternd naiv oder ohnmächtig sind, steht aber fest.
Der komplette "Staff Report on GlaxoSmithKline and the Diabetes Drug Avandia. Prepared by the staff of the Committee on Finance, United States Senate, Max Baucus, Chairman, Chuck Grassley, Ranking Member. steht kostenlos im etwas luftigen Original-Layout zur Verfügung.
Auch von dem Aufsatz "Ensuring Integrity in Industry-Sponsored Research. Primum Non Nocere, Revisited" von Catherine D. DeAngelis und Phil B. Fontanarosa aus der JAMA-Ausgabe vom 24. März 2010 (JAMA. 2010;303(12): 1196-1198) ist entweder das Abstract oder auch die komplette Fassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.3.10
Interne Dokumente der Pharma-Industrie: Marketing vor Wissenschaft
 Forschung sei die beste Medizin, propagiert der vfa (Wirtschaftsverband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland). Erkenntnisse aus internen Dokumenten der Industrie, die im Rahmen von Strafverfahren gegen pharmazeutische Unternehmen in den USA öffentlich geworden geben diesem Werbeslogan eine fast zynische Note.
Forschung sei die beste Medizin, propagiert der vfa (Wirtschaftsverband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland). Erkenntnisse aus internen Dokumenten der Industrie, die im Rahmen von Strafverfahren gegen pharmazeutische Unternehmen in den USA öffentlich geworden geben diesem Werbeslogan eine fast zynische Note.
Glen Spielmans und Peter Parry haben interne Dokumente der Firmen AstraZeneca, Pfizer, Smith Kline Beecham (heute GlaxoSmithKline) und Eli Lilly untersucht, die sich auf Studien zu Arzneimitteln gegen Depressionen und Psychosen und ihre Vermarktung beziehen. In den dargestellten Beispielen nutzen die pharmazeutischen Unternehmen die wissenschaftlichen Daten fĂĽr das Marketing, indem sie die Daten aus Studien marketinggerecht selektieren und interpretieren, ĂĽber Publikationsfirmen in die entsprechende Form bringen lassen und in hochrangigen Fachzeitschriften platzieren.
Ein Beispiel ist die antipsychotische Substanz Quetiapin, die von AstraZeneca als Seroquel® vermarktet wird. Unter der Standardsubstanz Haloperidol war bei Patienten mit Psychose in der Vorgeschichte, die zu Beginn der Studie symptomfrei waren, nach einem Jahr die Bewertung der psychotischen Symptome günstiger und das Risiko für erneute Psychosen geringer als unter Quetiapin. In den entscheidenden Endpunkten schnitt Haldol somit besser ab als Quetiapin. Einige Maße der kognitiven Funktion waren jedoch unter Quietapin günstiger. In einer Veröffentlichung stellte die Autoren die Verbesserung der kognitiven Funktion in den Mittelpunkt und ließen die antipsychotischen Endpunkte unter den Tisch fallen.
Ein weiteres Beispiel ist das Antidepressivum Paroxetin (Paxil®) der Firma GlaxoSmithKline, das für die Behandlung der Depression bei Jugendlichen als wirksam und gut verträglich beworben wurde. Tatsächlich hatten aber Studien für 2 primäre und 6 sekundäre Endpunkte negative Ergebnisse erbracht, d.h. die Substanz wirkte für keinen der 8 Parameter besser als Plazebo. In der veröffentlichten Studie berichteten die Autoren von 8 Ergebnismaßen, von denen 4 günstig dargestellt wurden - all diese Ergebnismaße waren jedoch im Studienprotokoll nicht erwähnt - ein klassischer Fall von "data fishing". Gravierende unerwünschte Wirkungen, wie vermehrte Suizidgedanken, vermehrte vorsätzliche Selbstschädigung sowie feindseliges Verhalten wurden nicht erwähnt. Somit hat GlaxoSmithKline eine Substanz ohne positive Effekte mit gravierenden negativen Effekten in einer Veröffentlichung in einer namhaften Fachzeitschrift als effektiv und gut verträglich bezeichnet.
Weitere Beispiele und Zitate belegen, dass große pharmazeutische Firmen den Anschein der evidenzbasierten Medizin in verfälschender Form für das Marketing ihrer Arzneimittel einsetzen. Dafür nutzen sie die großen Fachzeitschriften, deren Informationen viele Aerzte am meisten Vertrauen schenken.
Schon die wegweisende Studie von Turner et al. hatte offengelegt, dass das Verfälschen und Unterdrücken von Daten eine unter pharmazeutischen Firmen verbreitete Praxis ist und nicht etwa die Verfehlung weniger schwarzer Schafe: für jedes der 12 untersuchten Antidepressiva hat das jeweilige Unternehmen Daten geschönt oder unterdrückt, wenn sie nicht in das Marketingkonzept passten (wir berichteten).
Die Studie von Spielmans und Parry ist im Volltext abrufbar:
Spielmans, G. and P. Parry (2010). "From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: Evidence from Internal Industry Documents." Journal of Bioethical Inquiry. Download
Einige der internen Dokumente der Industrie sowie Powerpoint-Präsentationen dazu auf folgender Website:
HealthyScepticism
David Klemperer, 14.3.10
Zuzahlungen und Praxisgebühr führen zur eingeschränkten Inanspruchnahme auch medizinisch notwendiger Leistungen bei Überschuldeten
 Anders als in internationalen Studien gab es bisher in Deutschland keinen empirischen Hinweis, dass die seit Jahrzehnten für mittlerweile 75 % der GKV-Leistungen existierenden Zuzahlungen oder die jüngere Praxisgebühr dauerhaft zu unerwünschten Unter- und folgeschweren Fehl-Inanspruchnahmen gesundheitlicher Leistungen insbesondere bei sozial Schwachen führen.
Anders als in internationalen Studien gab es bisher in Deutschland keinen empirischen Hinweis, dass die seit Jahrzehnten für mittlerweile 75 % der GKV-Leistungen existierenden Zuzahlungen oder die jüngere Praxisgebühr dauerhaft zu unerwünschten Unter- und folgeschweren Fehl-Inanspruchnahmen gesundheitlicher Leistungen insbesondere bei sozial Schwachen führen.
Dies stellt sich seit der jüngsten Untersuchung der Reaktion überschuldeter Personen aus Rheinland-Pfalz auf die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen mit Zuzahlungen deutlich anders dar.
Die ForscherInnen aus Mainz und Erlangen-Nürnberg beschäftigen sich seit einiger Zeit mit der stetig ansteigenden Gruppe überschuldeter Privathaushalte, die derzeit auf 3,13 Millionen geschätzt werden. Ob und wie die 666 TeilnehmerInnen im Alter von 18 bis 79 Jahren an dieser 2006/2007 in Rheinland Pfalz durchgeführten Studie aufgrund ihrer eindeutig feststehenden finanziellen Not nicht zum Arzt gingen oder verschriebene Medikamente nicht in der Apotheke abholten, wurde hier erstmalig untersucht.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• 65,2% der TeilnehmerInnen der Studie gab an, in den letzten 12 Monaten aus Geldmangel vom Arzt verschriebene Medikamente nicht gekauft zu haben und
• 60,8 % unterließen aufgrund ihrer Schuldensituation und der 10-Euro-Selbstbeteiligung einen Arztbesuch.
• Multivariat betrachtet haben Jüngere, Personen mit Kindern, Personen im Privatinsolvenzverfahren, mit vorhandenen gesundheitlichen Beschwerden und mit einer geringeren Aufmerksamkeit gegenüber der eigenen Gesundheit ein signifikant höheres Risiko einer reduzierten Inanspruchnahme medizinischer Leistungen.
Das hier nachgewiesene Risiko für zumindest aktuell und faktisch zu den unteren sozialen Schichten gehörenden Personen, ist u.a. deshalb ein Problem, weil diese Personen meist höhere Krankheitsprävalenzen haben und bei ihnen "die Verminderung der Inanspruchnahme von Arztbesuchen kontraproduktiv zur Gesundheitspflege und Behandlung von Erkrankungen sein (kann)."
Insgesamt stützen die Ergebnisse der Studie, die These, dass auch notwendige medizinische Behandlungen von überschuldeten Privatpersonen unterlassen werden könnten."
Das häufig an dieser Stelle in die Debatte geworfene Argument, die betreffenden Personen könnten die existierenden gesetzlichen Härtefallbefreiungen nutzen und gar keine oder nur geringe Zuzahlungen zahlen, läuft auch hier faktisch überwiegend ins Leere. Ähnlich wie bei früheren Überprüfungen der Befreiungswirklichkeit (z.B. hatten in einer AOK-Stichprobe im Jahr 2000 60% berechtigte Versicherte mangels Information keine Befreiung beantragt), wurde auch von den TeilnehmerInnen dieser Studie die Befreiungsmöglichkeit "nicht umfassend in Anspruch genommen, was vorrangig auf den mangelnden Bekanntheitsgrad, das Rückerstattungsprinzip und das bürokratische Antragsverfahren zurückzuführen sein kann."
Unabhängig von der Forderung mehr über die Wirkungen von Zuzahlungen und Befreiungsregelungen zu erforschen und dazu auch Studien durchzuführen, welche anders als Querschnittsstudien einen zeitlichen Zusammenhang von Einflussfaktor und Zielgröße nachzuweisen erlauben, sollten nach Ansicht der Autoren "aus sozialmedizinischer Sicht Zuzahlungen für Armutsgruppen und insbesondere für solche mit chronischen Erkrankungen und Beschwerden in Deutschland gestrichen werden."
Leider ist von dem interessanten und möglicherweise wegweisenden Aufsatz "Überschuldung und Zuzahlungen im deutschen Gesundheitssystem - Benachteiligung bei Ausgabenarmut" von Münster, Rüger, Ochsmann, Alsmann und Letzel in der Zeitschrift "Gesundheitswesen" (2010; 72: 67-76) kostenlos nur ein Abstract erhältlich.
Warum die Verlage der meisten deutschen Fachzeitschriften, hier der Thieme Verlag, nicht langsam dem Vorbild noch renommierterer Journals folgen und mehr Aufsätze zu Open Access-Beiträgen erklären, ist unverständlich, da ja auch die hier wesentlich liberaleren Verlage Gewinninteressen haben und realisieren.
Bernard Braun, 2.3.10
Nichts wissen, nichts sagen, lieber schweigen: Wie ahnungslos ist das Bundesgesundheitsministerium über den Pharmamarkt!?
 Manchmal bliebe man als Bürgerin oder Bürger um eine Illusion reicher, wenn Politiker oder ein Ministerium nicht jede Frage beantworten würden. Manchmal ist es aber für interessierte Bürgerinnen und Bürger ein Erkenntnis-Gewinn, wenn ihnen oder ihren Vertretern zwar nichts gesagt wird, aber dies in Antwortform geschieht.
Manchmal bliebe man als Bürgerin oder Bürger um eine Illusion reicher, wenn Politiker oder ein Ministerium nicht jede Frage beantworten würden. Manchmal ist es aber für interessierte Bürgerinnen und Bürger ein Erkenntnis-Gewinn, wenn ihnen oder ihren Vertretern zwar nichts gesagt wird, aber dies in Antwortform geschieht.
Ein Paradebeispiel für diese Art von Nullkommunikation ist die handschriftlich auf den 24. Februar 2010 datierte Antwort des BMG-Staatssekretärs Stefan Kapferer auf eine Kleine Anfrage einiger Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE zum Thema "Nationale und internationale Regelungen zur Arzneimittelpreisbildung" (BT-Drucksache 17/689). Dessen Minister, Herr Rösler, hat immer wieder die Wichtigkeit des Arzneimittelmarkts und dortiger entschiedener Reformen betont und daher hatten die Parlamentarier auch substanzielle Antworten auf entsprechende Fragen erwartet.
So fragten sie z.B. nach den durchschnittlichen Arzneipreisen in der OECD, welche Länder z.B. Arzneimittel-Positiv- oder Negativlisten haben, wo es noch unbegrenzte Herstellerabgabepreise gibt, in welchen Ländern Preisverhandlungen zu Arzneimitteln stattfinden und ob die Bundesregierung plant, Regularien einzuführen, die Einfluss auf den offiziellen Herstellerabgabepreis haben.
Die meisten Antworten bestanden aus der lapidaren Formulierung: "Siehe Antwort auf Frage 2". Und als ob diese Fragen nicht bereits seit Jahrzehnten gesundheitspolitischer Zündstoff wären (z.B. fragen sich nach jedem Auslandsurlaub Millionen von Urlaubern, warum dort Arzneimittelpreise niedriger sind) antwortet das BMG in seiner Antwort auf Frage 2 ebenso knapp wie absichtsvoll unhilfreich: "Die Bundesregierung führt kein Register über Preisregulierungen und Erstattungsregelungen in anderen Ländern und verweist auf entsprechende Fachveröffentlichungen."
Nur für eine wichtige und weltweit nahezu einmalige Bedingung des deutschen Arzneimittelmarktes verweist das BMG die Abgeordneten nicht in Lesesäle von Uni-Bibliotheken oder ins Internet, sondern weiß umfassend Bescheid: "Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, in denen pharmazeutische Unternehmer ohne vorherige staatliche Preisregulierung Arzneimittel in den Markt einführen können. Zudem kann in Deutschland jedes Unternehmen die Preise für seine Arzneimittel frei festsetzen." Und auch nach allen Gesundheitsreformgesetzen der letzten Jahre: "Die Bildung der Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmen bleibt frei."
Und als ob die akuten Finanzierungsprobleme der Arzneimittelversorgung nicht trotz der weit über 20 Instrumente zur Regulierung des deutschen GKV-Arzneimittelmarktes existierten, beharrt das BMG darauf, dass "dem Grunde nach für alle Arzneimittel die Höhe der Erstattung der Preise begrenzt werden" könne. Die Mittel im SGB V dazu wären festsetzbare Festbeträge und Erstattungshöchstbeträge sowie aushandelbare Preisnachlässe.
Welches die dem BMG scheinbar trotzdem notwendigen und in ihm gerade bearbeiteten "Vorschläge für die Umstrukturierung des Arzneimittelmarktes" bestehen, wird zwar nicht ausführlich gesagt. Dass dabei aber ausschließlich "Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Herstellern erörtert" werden, deutet kein Ende der Probleme an.
Die Kleine Anfrage 17/689 der Fraktion DIE LINKE ist kostenlos als Bundestagsdrucksache erhältlich. Das von der stellvertretenden Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags, Kathrin Vogler, veröffentlichte Antwortschreiben des BMG ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.3.10
Biomedizinische Forschung überwiegend von finanziellen Gewinnerwartungen motiviert
 In den USA wurden im Jahr 2007 105,6 Mrd. Dollar in die biomedizinische Forschung investiert. Da die Geldgeber darüber bestimmen, welche Fragen untersucht werden und welche nicht, ist die Frage nach den Finanzierungsquellen von großer Bedeutung. Unterschieden wird beispielsweise zwischen "Investigator-Driven Clinical Trials" und "Industry-driven trials", also zwischen Studien, die entweder in erster Linie der wissenschaftlichen Neugier oder aber den Gewinnerwartungen der Industrie entspringen. Im Jahr 2009 hatten sich die European Medical Research Councils in einem Bericht für eine Stärkung der Industrie-unabhängigen Forschung, also der "Investigator-Driven Clinical Trials" ausgesprochen (wir berichteten).
In den USA wurden im Jahr 2007 105,6 Mrd. Dollar in die biomedizinische Forschung investiert. Da die Geldgeber darüber bestimmen, welche Fragen untersucht werden und welche nicht, ist die Frage nach den Finanzierungsquellen von großer Bedeutung. Unterschieden wird beispielsweise zwischen "Investigator-Driven Clinical Trials" und "Industry-driven trials", also zwischen Studien, die entweder in erster Linie der wissenschaftlichen Neugier oder aber den Gewinnerwartungen der Industrie entspringen. Im Jahr 2009 hatten sich die European Medical Research Councils in einem Bericht für eine Stärkung der Industrie-unabhängigen Forschung, also der "Investigator-Driven Clinical Trials" ausgesprochen (wir berichteten).
70 bis 80 % der weltweiten biomedizinischen Forschungsleistungen werden in den USA erbracht. Die Trends in der Finanzierung sind das Thema einer kürzlich im Journal of the American Medical Association erschienen Untersuchung.
Die wesentlichen Geldgeber sind
• die amerikanische Regierung
• die Bundesstaaten
• private gemeinnützige Einrichtungen einschließlich Stiftungen
• die Industrie.
Auf Seiten der Industrie sind zu unterscheiden:
• die pharmazeutische Industrie
• Biotechnologiefirmen
• Hersteller medizinischer Geräte.
Die Gesamtsumme für biomedizinische Forschung stiegt von 75,5 Mrd. Dollar im Jahr 2003 auf $101,1 Mrd. Dollar im Jahr 2007. Inflationsbereinigt beträgt der Anstieg 14%, und ist damit etwas stärker als der Anstieg des Bruttosozialproduktes, das im selben Zeitraum um 12% stieg. Die jährliche Wachstumsrate hatte zwischen 1994 und 2003 noch durchschnittlich 7,8% betragen, zwischen 2003 und 2007 nur noch 3,4%. Die neuesten Zahlen aus dem Jahr 2008 weisen sogar auf eine Abnahme der Forschungsgelder hin.
Die National Institutes of Health (NIH) trugen im Jahr 2007 27% der Forschungsausgaben und damit den größten Teil (84%) der öffentlichen Ausgaben. Inflationsbereinigt nahm der absolute Betrag wie auch der Anteil an den Gesamtausgaben seit 2003 ab.
Größter Geldgeber war die Industrie mit 58,6 Mrd. Dollar im Jahr 2007, entsprechend einem Anteil von 58% der Gesamtausgaben. Im Jahr 2003 waren es noch 40 Mrd. gewesen, der Zuwachs bis 2007 beträgt inflationsbereinigt 25%. Die pharmazeutische Industrie stellt den größten Anteil der Ausgaben, gefolgt von den Biotechnologiefirmen und der Geräteindustrie. Die Stärke des Wachstums von 2003 auf 2007 verläuft umgekehrt - hier liegt die Geräteindustrie mit 59% vor den biotechnologischen Firmen (41%) und den pharmazeutischen Firmen (15%).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
• weiterhin mit hohem finanziellem Aufwand neue medizinische Technologien erforscht werden,
• in den letzten Jahren eine Dämpfung des Anstiegs der Zuwachsraten zu verzeichnen ist,
• sich die Anteile der Förderung weiter zuungunsten der öffentlichen Förderung in den Bereich der Industrie verschieben,
• die größten Hoffnungen der Anleger derzeit auf den Geräteherstellern und den Biotechnologiefirmen ruhen.
Vergleichsweise niedrig sind die Forschungsanstrengungen, wenn es darum geht, die Funktionalität der Gesundheitsversorgung und den Stellenwert neuer Technologien zu ergründen ("Health Policy
and Health Services Research"). Im Jahr 2008 stellten die amerikanische Regierung und private Einrichtungen dafür 2,2 Mrd. Dollar zur Verfügung. Die NIH waren mit 1,0 Mrd. Dollar beteiligt, die Agency for Healthcare Research and Quality mit 335 Mrd. Dollar und die Robert-Wood-Johnson-Foundation mit 523 Mrd. Dollar. Der Anteil für Forschung im Bereich Health Policy and Health Services an den Gesamtgesundheitsausgaben beträgt kärgliche 0,1 %. In die biomedizinische Forschung investieren die USA hingegen 4,5 %, ein Wert, der höher ist als in jedem anderen Land der Welt.
Dorsey ER, de Roulet J, Thompson JP, Reminick JI, Thai A, White-Stellato Z, et al. Funding of US Biomedical Research, 2003-2008. JAMA 2010;303(2):137-1. Abstract der Studie
Volltext der Vorläuferstudie Moses H, III, Dorsey ER, Matheson DHM, Thier SO. Financial Anatomy of Biomedical Research. JAMA 2005;294(11):1333-1342.
David Klemperer, 12.2.10
"An aspirin per day keeps ..." oder Lehrstück über den fragwürdigen Beitrag von Bayer Healthcare zur Gefäß-Primärprävention!
 "Heute wird Aspirin … fast allen Patienten gegeben, die bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten. Darüber hinaus wird Aspirin bei Patienten mit Durchblutungsstörungen an den Herzkranzgefäßen, nach Herzoperationen und bei Patienten, die erste Symptome von Mangeldurchblutungen im Gehirn hatten, eingesetzt. Viele Ärzte empfehlen auch anderen Patienten die Einnahme von Aspirin protect. Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, ob eine regelmäßige Einnahme … für Sie sinnvoll ist." (aktuell vertriebene Praxisbroschüre "Rund ums Herz. Aspirin protect" der Firma Bayer Healthcare)
"Heute wird Aspirin … fast allen Patienten gegeben, die bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten. Darüber hinaus wird Aspirin bei Patienten mit Durchblutungsstörungen an den Herzkranzgefäßen, nach Herzoperationen und bei Patienten, die erste Symptome von Mangeldurchblutungen im Gehirn hatten, eingesetzt. Viele Ärzte empfehlen auch anderen Patienten die Einnahme von Aspirin protect. Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, ob eine regelmäßige Einnahme … für Sie sinnvoll ist." (aktuell vertriebene Praxisbroschüre "Rund ums Herz. Aspirin protect" der Firma Bayer Healthcare)
Und wenn ein Arzt oder Apotheker sagen, dies sei sinnvoll, dann folgen viele herz-/kreislaufgesunde Menschen der Devise "an aspirin per day keeps conditions away" und die Firma "Bayer Healthcare" kann im Ernstfall immer sagen, sie habe niemals direkt eine tägliche Einnahme für Menschen ohne Vorerkrankung empfohlen oder gar einen primärpräventiven Nutzen versprochen.
Ist Bayer Healthcare also ein "ehrenwerter" Hersteller? Oder spricht dagegen nicht das Verschweigen der zahlreichen seit Mitte der 1990er Jahren immer wieder und zuletzt Mitte 2009 bestätigten Erkenntnisse über den vor allem bei der Primärprävention von schweren Herzkreislauf- oder anderen Gefäßerkrankungen geringen oder sogar mit unterschiedlich starken unerwünschten Effekten erkauften Nutzen von Aspirin in der zitierten, gezielt an Patienten gerichteten Broschüre?
Eine kleine aber relevante Auswahl der hier gemeinten und fast durchweg in renommierten peer-reviewten Fachzeitschriften erschienenen studienbasierten Erkenntnisse kann bei der Beantwortung hilfreich sein und zeigt u.a.:
• Personen, die ohne eine Herzerkrankungs-Vorgeschichte Aspirin mit primärpräventivem Ziel einnahmen, erhöhten nach einer Studie aus dem Jahr 2000 ("Consumption of NSAIDs and the development of congestive heart failure in elderly patients: an underrecognized public health problem" von Page J, Henry D. in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2000;160:777-784) ihr Risiko für eine Herzgefäßerkrankung um 60%. Diejenigen Personen, die spezifisch vorerkrankt waren, erhöhten mit der Aspirineinnahme ihr Risiko einer Herzdurchblutungsstörung um das 10,5fache. Gesamtbewertung: "Assuming these relationships are causal, NSAIDs were responsible for approximately 19% of hospital admissions with CHF."
• Selbst wenn in der 2002 im "Archive for Internal Medicine" (2002;162:265-270) veröffentlichten und kostenlos erhältlichen "Rotterdam Study" ("Association of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs With First Occurrence of Heart Failure and With Relapsing Heart Failure. The Rotterdam Study" von Johan Feenstra, Eibert R. Heerdink, Diederick E. Grobbee und Bruno H. Ch. Stricker kein Anstieg der Inzidenz von gefäßbedingtem Herzversagen nach Einnahme von Aspirin und pharmakologisch ähnlichen Wirkstoffen festgestellt werden konnte, trug das mit der regelmäßigen Einnahme solcher Arzneimittel assoziierte erheblich erhöhte Risiko von bereits am Herzen erkrankten Personen, einen Rückfall zu bekommen, nicht dazu bei, diese Wirkstoffe für hilfreich oder uneingeschränkt unschädlich erklären zu können.
• Auch das Risiko an anderen Krankheiten zu erkranken, war unter den Aspirin-EinnehmerInnen zum Teil erhöht. Das Risiko für Brustkrebs erhöhte sich beispielsweise nach der in der Fachzeitschrift "Journal of the National Cancer Institute (2005 97(11): 805-812) veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2005 ("Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use and Breast Cancer Risk by Stage and Hormone Receptor Status" von Sarah F. Marshall, Leslie Bernstein, Hoda Anton-Culver, Dennis Deapen, Pamela L. Horn-Ross, Harvey Mohrenweiser, David Peel, Rich Pinder, David M. Purdie, Peggy Reynolds, Dan Stram, Dee West, William E. Wright, Argyrios Ziogas und Ronald K. Ross um 50%. Selbst wenn die AutorInnen einschränkend feststellen, hier handle es sich um keinen nachweisbar kausalen Zusammenhang, kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, Aspirin wäre völlig harmlos und es sei überhaupt keine Zurückhaltung oder weitere Forschung angebracht.
• Bereits 1998 stellte ein im Medizinjournal "JAMA" (1998;280: 1930-1935) veröffentlichter Review mit Metaanalysen mehrerer RCTs ("Aspirin and Risk of Hemorrhagic Stroke: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials" von Jiang He; Paul K. Whelton; Brian V. und Michael J. Klag ein um 84% höheres Schlaganfallrisiko bei Personen fest, die täglich Aspirin einnahmen.
• 1998 quantifizierten die Verfasser einer Studie die schweren, unerwünschten Nebenwirkungen und das zusätzliche Mortalitätsrisiko der Einnahme so genannter nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAR) und nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAP) bzw. NSAID (non steroidal anti inflammatory drugs), zu deren häufigstem Wirkstoff Aspirin gehört, so: "Conservative calculations estimate that approximately 107,000 patients are hospitalized annually for nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID)-related gastrointestinal (GI) complications and at least 16,500 NSAID-related deaths occur each year among arthritis patients alone." (Singh Gurkirpal [1998]: "Recent Considerations in Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Gastropathy" in: The American Journal of Medicine, July 27, 1998: 31S). Über den Aufsatz gibt es kostenlos nur das Abstract.
• Ein Jahr später charakterisierten andere WissenschaftlerInnen zusammen mit Singh im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (17. Juni 1999, Vol. 340, No. 24: 1888-1889) dieselben Nebenwirkungen der regelmäßigen Einnahme von Aspirin als eine "geräuschlose Epidemie". 75% der Menschen, die regelmäßig Aspirin einnehmen, kennen nach derselben Studie nicht die Gefahren des Gebrauchs dieses Schmerzmittels - und wahrscheinlich auch der anderer Analgetika. Zum Geschehen selber fassten sie ihre Ergebnisse so zusammen: "It has been estimated conservatively that 16,500 NSAID-related deaths occur among patients with rheumatoid arthritis or osteoarthritis every year in the United States. This figure is similar to the number of deaths from the acquired immunodeficiency syndrome and considerably greater than the number of deaths from multiple myeloma, asthma, cervical cancer, or Hodgkin's disease. If deaths from gastrointestinal toxic effects from NSAIDs were tabulated separately in the National Vital Statistics reports, these effects would constitute the 15th most common cause of death in the United States. … Furthermore the mortality statistics do not include deaths ascribed to the use of over-the-counter NSAIDS." (Wolfe M., Lichtenstein D.und Singh Gurkirpal [1999]: "Gastrointestinal Toxicity of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. Dass es sich dabei nur um die empirischen Effekte der verordneten Arzneimittel mit Wirkstoffen wie Acetylsalicylsäure (ASS) handelt, ist angesichts der Tatsache, dass weltweit der überwiegende Anteil der ASS-haltige Arzneimittel frei in der Apotheke gekauft wird, von hoher Brisanz. Von dem Aufsatz gibt es kostenlos leider nur einen Kurztext.
• 2005 veröffentlicht das private und bis in die jüngste Zeit hinein auch für das "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" gutachtende "Institut für evidenzbasierte Medizin" in Köln (dass es wegen dieser Unteraufträge an das u.a. der Frau von IQWIG-Leiter Sawicki gehörende Institut Debatten gab, ändert nichts an seiner fachlichen Qualität), also praktisch in Rufweite zum Bayer-Stammwerk in Leverkusen und in deutscher Sprache die kostenlos erhältliche, 27 Seiten umfassende Review-Studie "Acetylsalicylsäure in der Primärprophylaxe kardiovaskulärer Erkrankungen". Die Verfasser, Andreas Waltering, Lars Hemkens und Christiane Florack, untersuchen dazu die zum damaligen Zeitpunkt größten und qualitativ hochwertigen veröffentlichten Studien: British Male Doctors trial, Physicians´ Health Study, Thrombosis Prevention Trial, Hypertension Optimal Treatment Trial, Primary Prevention Project und Women s Health Study. Die im Einzelnen ebenfalls lesenswerten Ergebnisse fassen die Autoren u.a. so zusammen: "Die Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen mittels Acetylsalicylsäure führt zu keiner Senkung der kardiovaskulären Mortalität oder der Gesamtmortalität. … Unter Therapie mit Acetylsalicylsäure treten signifikant häufiger schwere, vor allem gastrointestinale, Blutungsereignisse auf. Es muss von ca. 0,7 zusätzlichen ernsten Ereignissen pro 1000 Patientenjahre ausgegangen werden, … Eindeutige Subgruppen bezüglich kardiovaskulärer Risikofaktoren, die einen besonderen Nutzen durch eine Primärprophylaxe haben, lassen sich bis dato nicht identifizieren. Auch die Definition einer Risikoschwelle, ab der ein Patient in stärkerem Maße von einer Primärprophylaxe profitieren würde, ist anhand der vorliegenden Studien nicht möglich. Lediglich für Frauen im Alter von 65 Jahren scheint ein Nutzen auch bezüglich der Reduktion kardialer Ereignisse zu bestehen."
• Der 2008 im "European Journal of Heart Failure" (2008 10 (11): 1102-110) veröffentlichte Aufsatz "Non-steroidal anti-inflammatory drugs and cardiac failure: meta-analyses of observational studies and randomised controlled trials" von Paul A Scott, Gabrielle H. Kingsley und David L Scott, kommt nach der Analyse bzw. Metaanalyse der Ergebnisse von 5 Fall-Kontrollstudien, zwei Kohortenstudien, sechs placebo-kontrollierten Studien und sechs randomisierten kontrollierten Studien u.a. zu folgender Bewertung: "Observational studies and RCTs all show that NSAIDs (darunter wieder sehr häufig Aspirin bzw. sein Wirkstoff) increase the risk of cardiac failure. … Pre-existing cardiac failure increases risk." Auch wenn die Erhöhung des absoluten Risikos nicht so groß ist, empfehlen die ForscherInnen uneingeschränkt mehr Vorsicht bei der Einnahme derartiger Wirkstoffe.
Und am aktuellsten kam die international besetzte Wissenschaftlergruppe von Collins et al. in ihrem 2009 im britischen Fachjournal "The Lancet" (30. Mai 2009; 373 [9678]: 1849-60) veröffentlichten Aufsatz "Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials." auf der Basis von Metaanalysen mit Daten von sechs primärpräventiven und 16 sekundärpräventiven Studien mit Tausenden von Teilnehmern zu folgenden Schlussfolgerungen:
• Niedrige, regelmäßig und über lange Zeit eingenommene Dosen von Aspirin haben für viele Personen mit spezifischen Gefäßverschlusserkrankungen einen eindeutigen und bedeutenden sekundärpräventiven Nettonutzen. Die Einnahme kann spezifische Erkrankungs- bzw. Wiedererkrankungsrisiken maximal um ein Fünftel reduzieren.
• Auch in den primärpräventiven Studien wurde nach Collins et al. die Häufigkeit aller ernsthaften Gefäss-Erkrankungsereignisse unter den EinnehmerInnen von Aspirin hochsignifikant um 12% reduziert (jährlich 0,51% in der Aspirin- und 0,57% in der Kontrollgruppe; p=0,0001). Hierbei spielte aber die Verminderung der Häufigkeit nichttödlicher Herzinfarkte um rund 20% die größte Rolle.
• Der Nettoeffekt der Aspirineinnahme auf das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, war so gering, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Aspirin- und Kontrollgruppe gab.
• Die Sterblichkeit durch Gefäßerkrankungen unterschied sich zwischen beiden Gruppen ebenfalls nicht signifikant (0,10% versus 0,19% pro Jahr; p=0,7).
• Dem Allem steht das statistisch signifikant höhere Risiko schwerer Magen-Darm-Blutungen oder anderer Blutungen außerhalb des Schädels bei den meisten Angehörigen der Aspiringruppe gegenüber.
Sobald aber, wie bei der primärpräventiven regelmäßigen Einnahme von Aspirin, dem geringen oder gar fehlenden Nutzen eine deutliche Zunahme solch schwerer und wiederum folgenreicher Ereignisse wie innerer Blutungen gegenüber steht, muss dies sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Für Collins et al. kommt dabei zurückhaltend formuliert ein "uncertain net value" heraus, der gegen eine primärpräventive Einnahme spräche.
Angesichts dieser langjährigen Fülle von oftmals hochwertigen Reviews und Metaanalysen von RCTs über die unerwünschten und gefährlichen Folgen insbesondere der primärpräventiven Einnahme von Aspirin und verwandter Wirkstoffe durch herz-/kreislaufgesunde Personen ist das Verschanzen der Firma Bayer Healthcare hinter den "viele(n) Ärzte(n)", die genau dies angeblich auch empfehlen, kein Kavaliersdelikt mehr.
Dies umso weniger als die Firma im Ausland bereits mehrmals negative Erfahrungen mit Werbekampagnen gemacht hat, in denen sie die Wirkung von Aspirin aktiv übertrieben oder durch Verschweigen wichtiger Details den Eindruck erweckte, Aspirin sei ein "Wunder-" und Prophylaxemittel. Dies wurde ihr u.a. im Jahr 2000 in den USA und Mitte 2009 in Brasilien durch Regierungseinrichtungen verboten.
Obwohl eine ihr öffentlich "verordnete" Informationskampagne über die Risiken einer Dauereinnahme von Aspirin für Gesunde die Firma in den USA Millionen US-Dollar gekostet hat, hindert dies Bayer nicht daran, erneut und aktuell ein "Informations"-Angebot wie die Bayer/Aspirin-Website www.WonderDrug.com zu betreiben.
Auf ihr verschweigt oder verharmlost Bayer unter dem Motto "Expect Wonders" ("erwarte Wunder") erneut fast durchweg die bekannten spezifischen Nebenwirkungen des Präparats. So folgt der Ankündigung "Aspirin for the Heart. Aspirin has many uses and has been known as the miracle drug that works wonders" eine lange Aufzählung von tatsächlichen oder möglicherweise positiven Wirkungen bei allen möglichen Durchblutungserkrankungen. Der Sachstand zu den Grenzen und Risiken des Präparats wird keineswegs ergänzt, sondern lediglich mit dem Satz angedeutet: "Aspirin is not appropriate for everyone, so be sure to talk to your doctor before you begin an aspirin regimen." Und wenn der Arzt dann, warum auch immer, eine "Empfehlung" z.B. für den primärpräventiven Gebrauch gibt, schließt sich der profitable aber für Patienten riskante Kreis.
Ein wichtiger Nachtrag: Wohlwissend, dass der Aspirinwirkstoff ASS zu inneren Blutungen führt, verweist Bayer beruhigend auf sein Produkt "Aspirin protect", das es seit den 1990er Jahren auf dem Markt gibt. Diese Tabletten, so die Patientenbroschüre "lösen sich nicht im Magen, sondern erst im Dünndarm auf" und schonten damit wahrscheinlich die empfindliche Magenschleimhaut. Weniger zutreffend und vor allem nicht unumstritten ist der daraus gezogene Schluss "Aspirin protect" sei "auf Dauer gut verträglich" und könne also sorgenfrei eingenommen werden.
Ohne dies hier und vor allem mangels neuerer und hochwertiger Studien entscheiden zu können, sei der Hinweis erlaubt, dass das Nebenwirkungspotenzial von "Aspirin protect" seit Mitte der 1990er Jahre unterschiedlich bis offen kontrovers beurteilt wird:
• Eine 1996 in der Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlichte Multicenter-Fallkontrollstudie "Risk of aspirin-associated major upper-gastrointestinal bleeding with enteric-coated or buffered product" von Kelly et. al. (348: 1413-1416) (komplett kostenlos erhältlich wenn man sich als Nutzer kostenlos und unaufwändig einträgt) kommen nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse im "Deutschen Ärzteblatt" (94, Heft 43 vom 24. Oktober 1997, A-2834) zu dem unerwartet kritischen Ergebnis, dass "die als wesentlich nebenwirkungsärmer propagierten dünndarmlöslichen oder gepufferten Aspirinpräparationen nicht besser abschneiden als normales Aspirin, aber um das bis zu 20fache teurer sind." Verordnende Ärzte sollten sich also in Sachen Blutungen "nicht in einer falschen Sicherheit wiegen".
• Anders stellt dies ein im März 1998 wiederum im "Deutschen Ärzteblatt" (95, Heft 10, 6. März, A-551) redaktioneller Beitrag dar. Danach handle es sich nach Ansicht des Mathematikers Joachim Braun aus Königswinter bei den Ergebnissen von Kelly et al. um "statistische Artefakte". Außerdem belegten klinische Beobachtungsstudien "positive klinische Erfahrungen" mit Aspirin protect.
• 2006 veröffentlicht der Berliner Kliniker Harald Darius in der "Pharmazeutischen Zeitung" vom 22. August ausführlich Ergebnisse einer zweijährigen prospektiven Beobachtungsstudie, deren Kern bereits in der Überschrift verdeutlicht wird: "Anwendungsbeobachtung dokumentiert gute Verträglichkeit".
• Angesichts dieser gegensätzlichen Erkenntnissen aus mehr oder weniger aufwändig angelegten aber durchweg methodisch schwachen Fallkontroll- oder Kohortenstudien, gilt u.E. nachwievor eine 2001 im unabhängigen "arznei-telegramm" (Jg. 32, Nr.8: 81) gezogene Zwischenbilanz der Forschung: "Randomisierte Therapiestudien, die eine Senkung des Risikos peptischer Geschwüre, Blutungen oder Perforationen durch Aspirin protect insbesondere auch bei gefährdeten Patienten belegen, gibt es nicht. Nach Fallkontroll- und Kohortenstudien ist die Zubereitung nicht weniger riskant als übliche, bis zu 70% billigere ASS-Tabletten."
Wie man trotz dieses mittlerweile in so unterschiedlichen Publikationen wie dem "Arzneimittel-Kursbuch" der Stiftung Warentest oder einer Information zur "Optimierung der Pharmakotherapie" der Kassenärztlichen Vereinigung Westfallen-Lippe aus dem Jahr 2007 veröffentlichten Erkenntnis-Zwischenstands undifferenziert und Zuversicht verbreitend ein "auf Dauer gut verträglich" versprechen kann, ist wohl nur mit dem ökonomischen Interesse der Firma Bayer Healthcare zu erklären.
Bernard Braun, 6.2.10
Womit können Therapietreue und Wirtschaftlichkeit verbessert werden?: "Weniger Zuzahlungen verbessern die Therapietreue!"
 Die regelmäßig provozierten und dann mit entsprechender öffentlichen Resonanz geführten Debatten über "Rationierung" bzw. die atmosphärisch angenehmere "Priorisierung" werden in vielfacher Hinsicht unseriös, einseitig und unter Vernachlässigung wichtiger Aspekte geführt. Dies fängt dort an, wo explizit oder implizit der Eindruck erweckt wird, "Rationierung" sei der Wegfall jeglicher, d.h. auch für die Gesundheit völlig unnötiger Leistung und nicht nur der medizinisch notwendigen.
Die regelmäßig provozierten und dann mit entsprechender öffentlichen Resonanz geführten Debatten über "Rationierung" bzw. die atmosphärisch angenehmere "Priorisierung" werden in vielfacher Hinsicht unseriös, einseitig und unter Vernachlässigung wichtiger Aspekte geführt. Dies fängt dort an, wo explizit oder implizit der Eindruck erweckt wird, "Rationierung" sei der Wegfall jeglicher, d.h. auch für die Gesundheit völlig unnötiger Leistung und nicht nur der medizinisch notwendigen.
Es endet dort, wo nicht ernsthaft die Verschwendung und Ineffizienz bilanziert und in Rechnung gestellt werden, die durch die medizinisch unnötige und ungerechtfertigte Über- oder Fehlversorgung mit medizinischen Leistungen und fehlerhafte Behandlungen entstehen. Rein monetäre Schätzungen reichen z.B. für die USA im Jahr 2007 (siehe dazu den Bericht "Waste and inefficiency in the health care system - Clinical care: A comprehensive Analysis in support of system-wide improvements" des Non-Profit-"New England Healthcare Institute") bis zu einem Drittel der laufenden Gesundheitsausgaben.
Ignoriert oder unterbewertet werden aber auch die gesundheitlichen und finanziellen Folgen der weit verbreiteten fehlenden oder mangelnden Therapietreue, Compliance oder Adherence zahlreicher PatientInnen.
In den USA nehmen nach aktuellen Schätzungen zwischen einem Drittel und der Hälfte der PatientInnen Arzneimittel so ein, wie es ihnen ihr Arzt empfohlen hat. Unabhängig von der Frage, warum sie dies machen, ob ihnen vom Arzt also ausreichend oder verständlich genug die Art und Umstände der Therapie erklärt wurden oder sie sich nach Lektüre von Beipackzetteln und Gesprächen mit anderen PatientInnen gegen die Einnahme eines Medikaments entschlossen haben, führt solches Verhalten im Arzneimittelbereich dazu, dass rund 13% aller Gesundheitsausgaben zum Teil buchstäblich in den Müll geworfen werden.
Mit welchen Strategien und Mitteln die Therapietreue bei gesundheitlich notwendigen Leistungen erreicht werden könnte und damit erst wirksame Leistungen finanziert würden, untersuchte nun das bereits erwähnte "New England Healthcare Institute". In der knappen Literaturübersicht "Thinking Outside the Pillbox" fasst das Institut die wesentlichen Erkenntnisse so zusammen:
• Es gibt keine einfachen Lösungen, da für die Therapietreue oder -untreue eine Menge von Faktoren und Bedingungen verantwortlich sind. Dazu zählen u.v.a. die Kosten, der Umfang der Einnahme von Medikamenten, das Krankheitsverständnis der Patienten, ihre Vergesslichkeit und kognitiven Fähigkeiten, kulturelle Einstellungen, mangelhafte Einnahmeregeln.
• Viele der empfohlenen oder praktizierten Mitteln zur Verbesserung der Therapietreue haben keinen wissenschaftlich seriösen Wirksamkeitsnachweis.
• Zu den Mitteln, deren Wirksamkeit bzw. Evidenz in randomisierten, kontrollierten Studie nachgewiesen wurden, zählen: technisch verbesserte Einnahmeregeln und -hilfen, eine hochwertige und mehrdimensionele Information und Weiterbildung für Patienten, die Integration von Adherence in Case Management-Systeme, eine stärkere Orientierung am Gesamtverhaltenstyp und den Präferenzen des individuellen Patienten, eine verbesserte Übersicht des Arztes über die Gesamtbehandlung seiner Patienten, vermehrter Einsatz von Erinnerungs- und Monitoringtechniken. Für die empirische Wirkung dieser Interventionen finden sich in der Übersicht einige Belege.
• Einen nachweisbar hohen und von den bisher genannten Faktoren weitgehend unabhängigen Einfluss haben die von den PatientInnen zu zahlenden Zuzahlungen. Hier gehen einige Ökonomen in den USA davon aus, dass höhere Kosten die Therapietreue verschlechtern und im Umkehrschluss, eine Senkung der z.B. durch Zuzahlungen entstehenden Kosten die Therapietreue verbessere und damit wirtschaftlich und gesundheitlich günstiger ist - ein insbesondere für die Kenner der gesundheitsökononomischen Erwartungen deutscher Experten und Politiker an die Steuerbarkeit der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch Zuzahlungen verblüffendes Argument. Und dass es sich dabei nicht um theoretische Spekulationen über die Preiselastizität der Nachfrage handelt, zeigt die Zusammenfassung der wenigen praktischen Versuche, diese Annahme zu verifizieren: "Many corporations are now seeking to improve adherence and reduce unnecessary medical spending by employing value based insurance design (VBID) plans that lower employee contributions and out-of-pocket costs for cost effective medications for chronic disease. Experts suggest that lowering medication co-payments for specific chronic conditions can be linked to improved medication possession ratios."
Einige Beispiele, dass mit diesem Mittel tatsächlich Verbesserungen der Adherence z.B. zwischen 7 und 14% erreichbar sind, findet sich in der 2008 in der Zeitschrift "Health Affairs" (Health Affairs, 27, no. 1 (2008): 103-112) veröffentlichten Studie "Impact Of Decreasing Copayments On Medication Adherence Within A Disease Management Environment" von Chernew et al. Von diesem Aufsatz gibt es allerdings kostenlos und für Nichtabonnenten der Zeitschrift nur ein Abstract. Für die Behandlung des Diabetes und einiger anderer chronischer Krankheiten stellt die u.a. durch ein Pharmaunternehmen gesponserte und komplett kostenlos erhältliche Studie "Value-Based Insurance Designs for Diabetes Drug Therapy" weitere empirische Ergebnisse vor.
Zum Kontext dieser Untersuchungen zum Zusammenhang von Zuzahlungen, Therapietreue und Behandlungsnutzen eignet sich auch der Forumsbeitrag "Selbstbeteiligungen und kein Ende: Was lange währt, ist keineswegs immer gut" sehr gut.
Der Literaturreview über die Herausforderungen und Mittel, die Therapietreue zu verbessern mit dem Titel "Thinking Outside the Pillbox. A System-wide Approach to Improving Patient Medication Adherence for Chronic Disease" ist im August 2009 als NEHI-Research erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.11.09
Auch deutsche Klinikärzte setzen gelegentlich Placebos ein - und sind von der Wirkung voll überzeugt
 Zwei im Jahre 2008 veröffentlichte Studien aus den USA über die ärztliche Verwendung von Placebos hatten bereits deutlich gemacht, dass Ärzte sehr viel häufiger solche Placebos einsetzen als vermutet. Hier war in Befragungen von Rheumatologen und Internisten bzw. Ärzten, die an Universitätskliniken in der Medizinerausbildung tätig sind deutlich geworden, dass etwa die Hälfte der befragten Mediziner schon einmal Patienten mit einem Placebo-Heilmittel bedient hat.
Zwei im Jahre 2008 veröffentlichte Studien aus den USA über die ärztliche Verwendung von Placebos hatten bereits deutlich gemacht, dass Ärzte sehr viel häufiger solche Placebos einsetzen als vermutet. Hier war in Befragungen von Rheumatologen und Internisten bzw. Ärzten, die an Universitätskliniken in der Medizinerausbildung tätig sind deutlich geworden, dass etwa die Hälfte der befragten Mediziner schon einmal Patienten mit einem Placebo-Heilmittel bedient hat.
Die Auswertung einer anonymen schriftliche Umfrage an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat nun gezeigt, dass ein großer Teil auch deutscher Ärzte - in diesem Fall Ärzte aus unterschiedlichen Abteilungen einer Klinik der Maximalversorgung - zumindest gelegentlich, teilweise auch häufig Placebos einsetzt. Und mehr als jeder vierte Arzt (28%) ist überzeugt, dass die verwendeten Mittel immer oder oft wirksam sind, weitere 44% meinen, dass sie zumindest manchmal wirken.
An der Studie beteiligt waren 71 Ärztinnen und Ärzte sowie 107 Pfleger/innen, die Beteiligungsquote an der Befragung lag mit 79 Prozent sehr hoch. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• 47% der Ärzte/innen haben noch nie Placebos verwendet, 53% verwenden sie in unterschiedlicher Häufigkeit: 40% zumindest 1-2mal im Jahr, 9% ein- bis zweimal monatlich und 4% ein- bis zweimal wöchentlich.
• Bei Pflegern/innen liegen die Quoten höher: 88% setzen die Mittel ein, darunter: 45% zumindest 1-2mal im Jahr, 33% ein- bis zweimal monatlich und 9% ein- bis zweimal wöchentlich.
• Schmerzen wurden am häufigsten als Grund für eine Placebogabe angeben, danach folgen: Schlaflosigkeit, depressive Verstimmung, Verdauungsstörungen.
• Etwa 44% aller Placebos wurden den Patienten mit der Angabe, "Das ist eine Medizin", überreicht und etwa der gleiche Anteil mit der Aussage "Das hilft Ihnen". Dabei gibt Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Ärzte sagen als Erklärung am häufigsten "Das hilft Ihnen", Pfleger/innen "Das ist eine Medizin".
• Pfleger/innen sind überaus stark von der Wirkung überzeigt. 64% von ihnen meinen, diese würden immer oder oft wirken, weitere 39% sagen "manchmal".
• Bei Ärzten haben diese starke Überzeugung 29%, die meisten Ärzte/innen (44%) meinen aber, die Mittelchen würden zumindest manchmal wirken.
• Bei der Frage nach dem unmittelbaren Anlass der Placebogabe erklärten Ärzte/innen wie Pfleger/innen am häufigsten (57% bzw. 66%), "Der Patient hat ein Medikament verlangt". Zweithäufigste Angabe (35% bzw. 38%) war "Zur Beruhigung eines ängstlichen Patienten".
Fazit der Autoren: "Die erfolgreiche Verwendung medikamentöser Placebos ist offensichtlich fester Bestandteil des Therapierepertoires an einem Krankenhaus der Maximalversorgung. In einer stärkeren Betrachtung von Placeboeffekten liegen hohe Potenziale. Während der Einsatz medikamentöser Placebos im klinischen Alltag ethische Probleme aufwirft, können die Optimierung der Therapeuten-Patienten-Interaktion und die Verwendung positiver Suggestionen eine ideale Ergänzung aktiver Therapieformen darstellen."
Die Studie ist kostenlos hier im Volltext verfügbar: M. Bernateck et al: Placebotherapie - Analyse von Umfang und Erwartung in einer Klinik der Maximalversorgung (Der Schmerz, DOI 10.1007/s00482-008-0733-x)
Gerd Marstedt, 6.7.09
Vorsicht vor Hinweisen auf "Studien"! Häufige Diskrepanz zwischen Werbeaussagen und "Studien"-Ergebnissen in Arzneimittelanzeigen
 Auch Arzneimittelhersteller wissen, dass PatientInnen wie ÄrztInnen Aussagen zu ihren Produkten eher glauben, wenn sie mit Hinweisen auf wissenschaftliche Studien versehen sind, welche die Wirksamkeit der Produkte nachweisen sollen. Wem hier angesichts der zahlreichen nachgewiesenen Manipulationen oder Fälschungen von Arzneimittelstudien durch die Pharmaindustrie der Gedanke an Falschinformationen durch den Kopf geht, ist nicht voreingenommen, sondern liegt ziemlich richtig. Dies trifft auch für die zu, die der Wirkkraft allgemein gehaltener und wenig sanktionierter gesetzlicher Verpflichtungen zum seriösen und wahrheitsgemäßen Marketing skeptisch gegenüber stehen. Konkret geht es um die Schweiz, in der 2002 explizite gesetzliche Bestimmungen für korrektes Marketingverhalten eingeführt wurde.
Auch Arzneimittelhersteller wissen, dass PatientInnen wie ÄrztInnen Aussagen zu ihren Produkten eher glauben, wenn sie mit Hinweisen auf wissenschaftliche Studien versehen sind, welche die Wirksamkeit der Produkte nachweisen sollen. Wem hier angesichts der zahlreichen nachgewiesenen Manipulationen oder Fälschungen von Arzneimittelstudien durch die Pharmaindustrie der Gedanke an Falschinformationen durch den Kopf geht, ist nicht voreingenommen, sondern liegt ziemlich richtig. Dies trifft auch für die zu, die der Wirkkraft allgemein gehaltener und wenig sanktionierter gesetzlicher Verpflichtungen zum seriösen und wahrheitsgemäßen Marketing skeptisch gegenüber stehen. Konkret geht es um die Schweiz, in der 2002 explizite gesetzliche Bestimmungen für korrektes Marketingverhalten eingeführt wurde.
Die mehrfache Skepsis stützt sich auf das Ergebnis einer Untersuchung von 577 Arzneimittelanzeigen für Arzneimittel gegen Schmerzen, Magen-Darm-Erkrankungen und psychische Erkrankungen, die 2005 in sechs großen schweizerischen medizinischen Fachzeitschriften erschienen sind. Der Anteil dieser Anzeigen an allen Arzneimittelanzeigen belief sich immerhin auf 28% (n=2.068), was gegen den möglichen Einwand spricht, bei den Ergebnissen handle es sich um absolute Randphänomene. In allen Anzeigen wurde mehr oder weniger umfangreich auf vorhandene wissenschaftliche Studien und Publikationen verwiesen, die die Werbeaussage stützen sollten.
Das Ergebnis sieht deutlich anders aus:
• In 56% (n=323) der 577 Anzeigen fand sich mindestens ein Literatur- oder Studienhinweis. Nachdem doppelte Anzeigen und Anzeigen mit letztlich völlig uninformativen Verweisen (trotzdem wurde aber zum Teil der Anschein erweckt, die Werbeaussage sei wissenschaftlich abgesichert) aussortiert wurden, blieben noch 29 Anzeigen mit 78 ausdrücklich durch Verweise abgesicherte Sachbehauptungen für die weitere Untersuchung übrig.
• In weniger als der Hälfte der Anzeigen bzw. der 78 Sachbehauptungen, nämlich 47% (n=37), stimmte die Werbeaussage mit den Inhalten der erwähnten Studien überein.
• Bei 21% der werblichen Sachbehauptungen (n=16) war die Aussage eindeutig falsch bzw. wurden die Leser unter der Annahme, dass die Verfasser die Literatur auf die sie verweisen gelesen haben, bewusst falsch informiert.
• Bei 32% (n=25) fördert der Vergleich von Werbeaussage und angegebener Literatur "einige Zweifel" an der Richtigkeit des Anzeigenversprechens. Dies lag hauptsächlich daran, dass in der Anzeige nur auf das Abstract der Studie verwiesen wurde bzw. nur die Zusammenfassung zitiert wurde. Dabei fielen dann auch Hinweise auf mögliche Verzerrungen oder extrem schwache Unterschiede zwischen dem untersuchten Arzneimittel und Kontrollpräparaten unter den Tisch. Außerdem wurde nur unzureichend über die Methodik der Studie berichtet, denn neben (methodisch fundierten) randomisierten Kontrollstudien finden sich auch einfache und wesentlich beweisschwächere Beobachtungs- oder Praxisstudien.
• Nach allem bisher Gesagten kann es nicht verwundern, dass Referenzstudien, in denen von den beteiligten Wissenschaftlern Interessenskonflikte genannt wurden oder die von Pharmaherstellern finanziert wurden, wesentlich häufiger die Werbeaussage unterstützten als Studien ohne diese beiden Charakteristika (RR 1.52, 95% CI 1.07-2.17 and RR 1.50, 95% CI 0.98-2.28).
Die Schweizer Autoren lassen in der Zusammenfassung ihrer Ergebnisse an praktischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Following the introduction of new regulations for drug advertisement in Switzerland, 53% of all assessed pharmaceutical claims published in major medical journals are not supported by the cited referenced studies or based on potentially biased study information. In light of the discrepancy between the new legislation and the endorsement of these regulations, physicians should not trust drug advertisement claims even when they seem to refer to scientific studies."
Die neunseitige Studie "Accuracy of drug advertisements in medical journals under new law regulating the marketing of pharmaceutical products in Switzerland" von Macarena Gonzalez Santiago, Heiner C Bucher und Alain J Nordmann, alles Mitarbeiter des "Instituts für klinische Epidemiologie und Biostatistik Basel (BICE)" in Basel, ist bereits 2008 in der Zeitschrift "BMC Medical Informatics and Decision Making 2008, 8:61 doi:10.1186/1472-6947-8-61" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Geradezu mustergültig ist bei dem Aufsatz über die Studie die lückenlose Dokumentation der Begutachtung des zuerst eingereichten Textes durch namentlich genannte Fachgutachter, der zustimmenden oder ablehnenden Kommentare der Forscher bis hin zu der dann veröffentlichten Variante.
Auch diese so genannte "Pre-publication history" erhält man komplett und kostenlos auf einer Website.
Bernard Braun, 30.6.09
Antibiotika-Niedrigverbrauchsregion Ostdeutschland: Woran liegt es?
 Die schnelle bei vielen banalen bakteriellen Infekten nicht notwendige und bei viralen Infekten wenig hilfreiche Verordnung von Antibiotika und die damit verbundene wachsende Resistenz wirklich gefährlicher Erreger gegen Antibiotika stellen einen nicht geringen Teil des Bergs der Über- und Fehlversorgung in Gesundheitssystemen dar.
Die schnelle bei vielen banalen bakteriellen Infekten nicht notwendige und bei viralen Infekten wenig hilfreiche Verordnung von Antibiotika und die damit verbundene wachsende Resistenz wirklich gefährlicher Erreger gegen Antibiotika stellen einen nicht geringen Teil des Bergs der Über- und Fehlversorgung in Gesundheitssystemen dar.
Nach der langjährigen Debatte über diese Themen erschien im Oktober 2008 der aktuellste und einzige Bericht, der näherungsweise die Verordnungshäufigkeit von Antibiotika in Deutschland im human- und tiermedizinischen Bereich im internationalen Vergleich und die Intensität der Resistenzen zusammenstellte.
Der auf Initiative des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) von der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V. und der Infektiologie an der Universität Freiburg erstellte Bericht beruht auf Daten über den Antibiotikaverbrauch im ambulanten Bereich aus Untersuchungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), während die dargestellten Verbrauchsdaten für den stationären Bereich aus den Freiburger Surveillance-Projekten MABUSE-Netzwerk (Medical Antibiotic Use Surveillance and Evaluation) und SARI (Surveillance der Antibiotikaanwendung und der bakteriellen Resistenzen auf Intensivstationen) stammen. Das Datenmaterial zur Bestimmung der Resistenzsituation stammt zum Großteil aus der Resistenzstudie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie, den Erhebungen des German Network for Antimicrobial Resistance Surveillance (GENARS), dem SARI-Projekt sowie aus dem European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Weiterhin wurden die bei den nationalen Referenzzentren zur Überwachung wichtiger Infektionserreger verfügbaren Resistenzdaten analysiert.
Auf dieser Datenbasis fanden sich die folgenden Ergebnisse:
• Der aktuelle (2007) Antibiotikaverbrauch in der Humanmedizin lässt sich auf insgesamt 250 - 300 t pro Jahr schätzen. Dabei entfallen rund 85 % der Verordnungen auf den ambulanten Bereich. Im Jahr 2007 entsprach dies einem Verbrauch von 363 Mio. definierten Tagesdosen (DDD) oder knapp 15 DDD pro 1.000 Versicherte und Tag.
• Im Vergleich der europäischen Länder nimmt Deutschland mit seinem Antibiotikaverbrauch im ambulanten Bereich eine Position im unteren Drittel ein: zusammen mit den Niederlanden, Österreich, den skandinavischen Ländern, Slowenien, Russland und der Schweiz. Die Spitzengruppe bilden Griechenland, Zypern, Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg. In diesen Ländern ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Antibiotika z. T. mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Dabei haben sich die Größenordnungen in den letzten Jahren nur geringfügig geändert.
• Vor dem Hintergrund der verfügbaren Daten hat sich die Resistenzlage bei den meisten Erregern ambulant erworbener Infektionen während der letzten 10 - 15 Jahren wenig verändert, wobei hier nur sehr wenig zuverlässige und für den ambulanten Bereich repräsentative Informationen vorliegen.
Zu einer der wichtigsten und offensichtlich zeitstabilen Erkenntnisse dieses Reports gehört die innerhalb Deutschlands zwischen West und Ost ungleiche Häufigkeit der Antibiotikaverordnungen:
• Größere regionale Unterschiede im Antibiotikaverbrauch wurden für Deutschland erstmals 2001 beschrieben. Ärzte im Westen (alte Bundesländer) verordneten deutlich häufiger Antibiotika als Ärzte im Osten (neue Bundesländer). Dieser Unterschied war auch in den darauffolgenden Jahren zu beobachten. Im Jahr 2007 variierte die Verordnungsdichte in den südlichen und westlichen Bundesländern zwischen 13,1 DDD pro 1.000 Versicherten und Tag (DDD/1.000) (Baden-Württemberg) und 17 DDD/1.000 (Saarland). Diese Werte lagen deutlich über dem Verbrauch in den neuen Bundesländern (9,7 bis 11,5 DDD/1.000). Je GKV-Versichertem und Jahr streute der Antibiotikaverbrauch von 3,6 bis 6,4 DDD, d. h. im Jahr 2007 war der Pro-Kopf-Verbrauch in dem Bundesland mit dem höchsten Verbrauch um den Faktor 1,8 höher als in dem Bundesland mit dem niedrigsten Verbrauch.
Da sich der Bericht nur am Rande mit den möglichen Ursachen des Ost-Westgefälles gut 1 ˝ Jahrzehnte nach dem Ende der DDR befasste, gab es nach seiner Veröffentlichung einige Interpretationsversuche in Massenmedien. Dazu gehört der eines WidO-Mitarbeiters, der in der Illustrierten "Stern" vom 3. November 2008 sinngemäß anmerkte, dabei handle es sich um unterschiedliche "Verbrauchsmentalitäten" in den beiden deutschen Staaten, um den Ausdruck der Mangelwirtschaft in der ehemaligen DDR und den dortigen bürokratischen Hemmnissen beim Einsatz von Antibiotika. Mit den Ergebnissen des Berichts und dieser Art von Interpretationsversuch befasste sich nun aktuell ein Aufsatz von Christian Tauchnitz im Heft 6/2009 des "Ärzteblatt Sachsens".
Der Aufsatz kam u.a. zu folgenden Erkenntnissen und Schlussfolgerungen:
• Für richtig wird im Allgemeinen die Aussage gehalten, die Wurzeln für das bessere Abschneiden der neuen Bundesländer wären bereits in DDR-Zeiten gelegt worden.
• Als irrig gilt dagegen die Erklärung durch Mangelwirtschaft. Obwohl diese zweifelsfrei existierte, "gab es damals keine bürokratischen Hemmnisse bei der ambulanten Antibiotika-Verordnung."
• Vielmehr handelt es sich nach Meinung des Ärzeblatt-Autoren um das Ergebnis aktiver Bemühungen während der letzten Jahre vor der politischen Wende. Einige ärztliche Antibiotika- Spezialisten und Pharmazeuten forderten demnach völlig ideologiefrei eine kritische Indikationsstellung für Antibiotika und Verzicht bei erwiesener Unwirksamkeit.
• Interessant für die Beurteilung der Qualitätssicherungspolitik im Gesundheitssystem der DDR und auch für die im vereinten Deutschland ist die Bemerkung, dass es schon damals bekannt war, dass ausschließlich fachliche Informationen für den kritischen Umgang mit Antibiotika nicht ausreichend sind.
• Von zentraler Bedeutung für die Überzeugungskraft der gegenüber der Verordnung von Antibiotika zurückhaltenden Therapieorientierung und deren Wirkung bis zum heutigen Tag waren demnach die in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Leipziger Bezirksarzt von einer Arbeitsgruppe erstellten bezirksärztlichen Richtlinien für den Umgang mit Antibiotika. Sie besaßen eine gewisse behördliche Autorität, und zwar dadurch, dass sie für verbindlich erklärt und Kontrollen angekündigt wurden. Im Einzelnen handelt es sich um allgemeine Grundsätze (1983), bakterielle Harnwegsinfektionen (1983), unspezifische Infektionen der tieferen Atemwege (1984), die Therapie von Gallenwegsinfektionen (1985) und die perioperative Ein-Dosis-Prophylaxe (1987). Allein durch die letztgenannte Richtlinie gingen in drei großen orthopädischen Kliniken im Bezirk Leipzig die Wundinfektionsraten nach alloplastischem Hüftgelenksersatz von 8 Prozent auf weniger als 1 Prozent zurück.
• Offensichtlich waren die Richtlinien so gut akzeptiert und führten zu so guten Erfahrungen, dass die Verordnungsgewohnheiten nach der politischen Wende bis mindestens 2007 beibehalten wurden und sogar an die nachrückenden Ärzte weitergegeben wurden.
Angesichts der Wichtigkeit eines zurückhaltenderen Verbrauchs von Antibiotika und trotz der aktuell eher wirkungslosen Versuche, den Verbrauch durch Leitlinien und Therapieempfehlungen zu senken, zeigen die hier vorgestellten Daten seine offensichtlich mögliche Beeinflussung durch eine Kombination von Maßnahmen. Die im "Ärzteblatt Sachsen" versuchte Erklärung sollte unabhängig davon, ob man ihr komplett folgt, Anlass für eine genauere Untersuchung der Beweggründe sein.
Die Schlussfrage des sächsischen Autoren, ob man angesichts der sicherlich auch kostenmindernden Verordnungsweise der sächsischen/ostdeutschen Ärzte nicht "als Gegenleistung ... wenigstens auf Arzneimittelregresse gegen sächsische Ärzte verzichten" solle, scheint allerdings wieder in den merkantilen Alltag der (west-)deutschen Ärzteschaft zurückzuführen.
Der 159 Seiten umfassende Bericht "GERMAP 2008. Antibiotika-Resistenz und -Verbrauch Bericht über den Antibiotikaverbrauch und die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der Human- und Veterinärmedizin in Deutschland" ist komplett kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für den zweiseitigen Aufsatz "Antibiotika-Verordnungen. Zu den Ursachen der großen regionalen Unterschiede von Antibiotika-Verordnungen durch Arztpraxen in Deutschland" von Christian Tauchnitz im "Ärzteblatt Sachsen 6/2009: 263-264".
Bernard Braun, 14.6.09
Arzneimittelhersteller behindert die bestmögliche Behandlung von Patienten mit Depression
 Mehr als andere findet das Pharmaunternehmen Pfizer immer mal wieder den Weg in die Öffentlichkeit, und meistens sprechen die Schlagzeilen nicht für das US-Unternehmen. Im jüngsten Fall geht es um das Antidepressivum Reboxetin mit dem Handelsnamen Edronax®. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) mit Sitz in Köln wirft dem Pharmahersteller vor, Informationen und Daten über die Wirkung dieses Medikaments zu verschweigen. Nach Angaben des IQWIG, das im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusse (g-BA) vom 22. Februar 2005 die Wirksamkeit dreier neuer Antidepressiva bewerten sollte, weigerte sich Pfizer trotz wiederholter Bitte, eine vollständige Aufstellung sämtlicher veröffentlichter und unveröffentlichter Studien zu Reboxetin zur Verfügung zu stellen. Nach Recherchen des IQWIG erfolgte die Testung dieses in Deutschland zugelassenen Arzneimittels in mindestens 16 Studien an etwa 4600 PatientInnen, die an Depressionen leiden. Allerdings fehlen von 9 dieser 16 Studien Schlüsselinformationen zur Beurteilung von Reboxetin, und dem IQWIG stehen bisher nur Daten von ca. 1.600 ProbandInnen zur Verfügung.
Mehr als andere findet das Pharmaunternehmen Pfizer immer mal wieder den Weg in die Öffentlichkeit, und meistens sprechen die Schlagzeilen nicht für das US-Unternehmen. Im jüngsten Fall geht es um das Antidepressivum Reboxetin mit dem Handelsnamen Edronax®. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) mit Sitz in Köln wirft dem Pharmahersteller vor, Informationen und Daten über die Wirkung dieses Medikaments zu verschweigen. Nach Angaben des IQWIG, das im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusse (g-BA) vom 22. Februar 2005 die Wirksamkeit dreier neuer Antidepressiva bewerten sollte, weigerte sich Pfizer trotz wiederholter Bitte, eine vollständige Aufstellung sämtlicher veröffentlichter und unveröffentlichter Studien zu Reboxetin zur Verfügung zu stellen. Nach Recherchen des IQWIG erfolgte die Testung dieses in Deutschland zugelassenen Arzneimittels in mindestens 16 Studien an etwa 4600 PatientInnen, die an Depressionen leiden. Allerdings fehlen von 9 dieser 16 Studien Schlüsselinformationen zur Beurteilung von Reboxetin, und dem IQWIG stehen bisher nur Daten von ca. 1.600 ProbandInnen zur Verfügung.
Ohne Einbeziehung der unveröffentlichten Daten ist keine zuverlässige Einschätzung der Studienlage möglich und es besteht die große Gefahr, den Nutzen und Schaden des Medikaments falsch einzuschätzen. Pfizer hat dem IQWiG keinerlei Begründung für die Weigerung genannt, die Studien offen zu legen. "Durch das Verschweigen von Studiendaten nimmt der Hersteller Patienten und Ärzten die Möglichkeit, sich informiert zwischen verschiedenen Therapieoptionen zu entscheiden", sagt Peter Sawicki, Leiter des IQWiG, und kritisiert die Behinderung Arbeit seines und anderer unabhängiger Institutionen. Das IQWIG, dessen Ziel es ist, verlässliche Aussagen über Vor- und Nachteile von Arzneimitteln zu treffen, sieht aufgrund dieser Situation vorläufig keinen Hinweis auf einen Nutzen einer Behandlung mit Reboxetin.
Zu diesem Fall wandte sich das IQWIG mit dem Vorwurf Pfizer hält Studien unter Verschluss mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Von dem Instituts-Vorbericht über die Nutzenbewertung einer Behandlung mit Bupropion, Mirtazapin oder Reboxetin bei der Behandlung der akuten Phase der Depression, bei der Erhaltungstherapie (Rückfallprävention) und bei der Rezidivprophylaxe ist auch eine vorab veröffentlichte Kurzfassung im Netz verfügbar. Die Auseinandersetzung zwischen dem IQWIG und Pfizer stieß in der deutschen Fach- und Laienpresse auf großes Interesse. So berichten das Deutsche Ärzteblatt und die Berliner Zeitung ausführlich und an prominenter Stelle über den Vorfall.
Dieses jüngste Beispiel ist allem Anschein nach ein weiterer Beleg für den lange bekannten Publikations-Bias in der medizinischen und pharmakologischen Fachliteratur. Insbesondere so genannte negative Studien, die nicht die erwünschte Wirksamkeit oder Überlegenheit eines Arzneimittels belegen können, haben erheblich größere Hürden zu überwinden, um in renommierten Journals zu erscheinen. Da eine Veröffentlichung vielfach erst mit großer Verzögerung oder gar nicht erfolgt, erhalten ÄrztInnen und PatientInnen ein geschöntes Bild. Immer wieder zeigt sich, dass publizierte Literatur die Wirkungen von Medikamenten zu überschätzen pflegt, und für einige Wirkstoffe ist sogar jedweder Nutzen fraglich.
Auch der 112. Ärztetag vom 19.-22. Mai 2009 in Mainz machte sich die Forderung nach industrie-unabhängiger Forschung zu eigen, wie das Deutsche Ärzteblatt in seiner Ausgabe vom 29.5.2009 berichtet. Dankenswerterweise stellt der in dieser Sache engagierte Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) auf seiner Homepage auch einen einschlägigen Untersuchungsbericht der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft zum Der Einfluss der pharmazeutischen Industrie auf die wissenschaftlichen Ergebnisse und die Publikation von Arzneimittelstudien kostenlos zum Download zur Verfügung. Darin kommt der federführende Autor, der Mainzer Ordinarius Professor Klaus Lieb, zu einem ernüchternden Fazit: "Zurzeit besteht also die inakzeptable Situation, dass Publikationen von Studienergebnissen, bei denen die pharmazeutische Industrie beteiligt war, den Leser den therapeutischen Nutzen eines Arzneimittels überschätzen lassen. Diese Fehleinschätzung beschränkt sich nicht auf den einzelnen Arzt, da auch Leitlinien, z. B. von medizinischen Fachgesellschaften, auf der Basis von veröffentlichten Studienergebnissen erarbeitet werden und die verzerrte Wahrnehmung der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit eines Arzneimittels zu fehlerhaften Empfehlungen führen kann. Dies wirkt sich auf die Versorgung des einzelnen Patienten und über eine verzerrte Einschätzung von Kosten und Nutzen auf das gesamte Gesundheitswesen aus."
Die Ursache dieser verbreiteten Problematik liegt zu einem nicht unerheblichen Teil daran, dass heutzutage die meisten medizinisch-pharmazeutische Studien nicht in unabhängigen Institutionen, sondern auf Veranlassung und vor allem mit Finanzierung der Hersteller möglich sind. Eine im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte, Untersuchung über die selektive Publikation von Studienergebnissen über Antidepressiva bestätigt insbesondere für Industrie-gesponserte Untersuchungen einen unübersehbaren Hang zur Veröffentlichung positiver, also erwarteter Studienergebnisse. Bei der Beurteilung der Ursachen führen die Autoren mehrere Gründe an, bei den Konsequenzen ist ihr Fazit aber eindeutig: "We cannot determine whether the bias observed resulted from a failure to submit manuscripts on the part of authors and sponsors, from decisions by journal editors and reviewers not to publish, or both. Selective reporting of clinical trial results may have adverse consequences for researchers, study participants, health care professionals, and patients." Löblicherweise steht die sehr lesenswerte Studie Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on Apparent Efficacy kostenlos als Volltext auf der Website des NEJM zum Download zur Verfügung.
Erschwerend kommen wirtschaftliche Verflechtungen wichtiger Verlagshäuser mit interessierten Kreisen der Gesundheitswirtschaft hinzu. Eine erkleckliche Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen stammt aus der Feder von Marketingfirmen. Das Forum Gesundheitspolitik hatte bereits Anfang Oktober 2007 auf das Thema des Ghost Management" der Pharmaindustrie hingewiesen. In ihrer Ausgabe vom 5. Mai macht die Fachzeitschrift Annals of Internal Medicine auf die vielfach unzureichende Qualität von Presseinformationen wissenschaftlicher Institutionen aufmerksam. Erwähnenswert und aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch eine Untersuchung über die Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlicher Institutionen, die oftmals von ebenso unübersehbarem wie unkritischen Eigeninteresse geleitet ist und an Objektivität zu wünschen übrig lässt. Der Artikel Press Releases by Academic Medical Centers: Not So Academic, der als Volltext kostenfrei im Internet zur Verfügung steht, verweist auf die unzureichende Qualität und Verständlichkeit der Verlautbarungen von Wissenschaftlern. Ihre Fazit ist ernüchternd: "Press releases issued by 20 academic medical centers frequently promoted preliminary research or inherently limited human studies without providing basic details or cautions needed to judge the meaning, relevance, or validity of the science."
Nicht nur die pharmazeutische Industrie versucht sich üblicherweise durch Selbstverpflichtungen von allzu starkem gesellschaftlichem Druck zu befreien. So hatte auch das IQWiG bereits 2005 mit dem Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA) eine grundsätzliche Einigung zur Übergabe aller zur Bewertung erforderlichen Daten vereinbart und die internationalen Verbände der pharmazeutischen Industrie hatten sich im Januar 2005 zur Offenlegung von Informationen zu klinischen Studien verpflichtet. Nicht nur das jüngste Beispiel von Pfizer und seinem Antidepressivum Reboxetin zeigt, dass freiwillige Lösungen nicht ausreichen. Auch andere Firmen lehnten es in den letzten Jahren wiederholt ab, dem IQWIG Studienunterlagen zur Verfügung zu stellen, die es für die Nutzenbewertung von Arzneimitteln benötigte. Diese Daten sind zudem vielfach gar nicht in den Studienregistern enthalten, deren Aufbau in den letzten Jahren den Überblick über laufende Untersuchungen erleichtern und das Verschweigen erschweren sollte.
Der Fall Pfizer ist ebenso wie viele andere im Übrigen auch eine Angelegenheit für VerbraucherschützerInnen und PatientenvertreterInnen. Mit dem Verschweigen und Vorenthalten von Studiendaten und -ergebnissen verstoßen die Hersteller nämlich auch gegen Absprachen mit den StudienteilnehmerInnen. Schließlich stellen sich die ProbandInnen freiwillig und uneigennützig mit dem Ziel zur Verfügung, durch ihre Teilnahme und die Veröffentlichung der Ergebnisse anderen Erkrankten zu helfen.
Hier finden die LeserInnen des Forum Gesundheitspolitik den ausführlichen Vorbericht des IQWIG.
Jens Holst, 12.6.09
Interessenkonflikte sind in der Krebsforschung weit verbreitet
 Ein erheblicher Anteil der Studien über Krebs wird von der Industrie finanziert. Diese Studien gelangen häufiger zu Ergebnissen, die für die Industrie positiv sind, als Industrie-unabhängige Studien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse aller Krebsstudien, die im Jahr 2006 in acht renommierten Fachzeitschriften erschienen sind. Die Arbeit erscheint am 15. Juni in CANCER, einer führenden Fachzeitschrift im Bereich Krebs.
Ein erheblicher Anteil der Studien über Krebs wird von der Industrie finanziert. Diese Studien gelangen häufiger zu Ergebnissen, die für die Industrie positiv sind, als Industrie-unabhängige Studien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse aller Krebsstudien, die im Jahr 2006 in acht renommierten Fachzeitschriften erschienen sind. Die Arbeit erscheint am 15. Juni in CANCER, einer führenden Fachzeitschrift im Bereich Krebs.
Die Autoren durchsuchten folgende Journale nach Arbeiten zum Thema Krebs: New England Journal of Medicine; JAMA; the Lancet; the Journal of Clinical Oncology; the Journal of the National Cancer Institute; Lancet Oncology; Clinical Cancer Research; und CANCER. Dabei fanden sie 1.534 Studien. In 29% dieser Studien waren Interessenkonflikte angegeben (Industriefinanzierung; Beratungshonorare für Autoren; Mitverfasser, der Angestellter eines pharmazeutischen Unternehmens ist; u.a.). In 17% wurde eine Finanzierung durch die Industrie angegeben.
Die Studien deckten unterschiedliche Herkunftsregionen und ein breites Themenspektrum ab. Der Anteil der Arbeiten mit Interessenkonflikten und Industriefinanzierung war dabei unterschiedlich.
Interessenkonflikte wurden angegeben bei Studien
• aus der klinisch-medizinischen Onkologie in 45%, aus der diagnostischen Radiologie in 4%
• aus den USA in 33%, aus Europa in 27%, aus Asien in 5%;
• mit männlichen Erstautoren in 37%, mit weiblichen Erstautorinnen in 20%
Randomisierte kontrollierte Studien zur Frage der Lebensverlängerung, bei denen ein Interessenkonflikt angegeben war, gelangten häufiger zu positiven Ergebnissen (29%), als unabhängige Studien (14%). Dies ist von besonderer Bedeutung, weil von diesen Studien die Zulassung zur Anwendung in der Krebsbehandlung abhängt.
Die meisten Industrie-finanzierten Studien befassten sich mit der Behandlung (62%). Die Inudtrie-unabhängigen Studien befassten sich häufiger mit Fragen der Prävention, der Risikofaktoren und der Epidemiologie.
Das Fazit dieser Studie lautet, dass die Industrie einen wesentlichen finanziellen Beitrag zur onkologischen Forschung leistet, dabei die Fragestellungen untersuchen lässt, die für ihre Zwecke bedeutsam sind (Behandlung, nicht Prävention) und häufiger die Ergebnisse erhält, die für sie nützlich sind als dies bei Industrie-unabhängigen Studien der Fall ist. Da die Studie auf den veröffentlichten Selbstangaben der Autoren beruht, wird der Einfluss der Industrie vermutlich unterschätzt, denn nicht jede Zeitschrift veröffentlicht alle Angaben der Autoren und nicht jeder Autor gibt seine Interessenkonflikte an.
Die Frage, warum die Ergebnisse häufiger als bei unabhängigen Studien im Industrieinteresse sind, wurde hier nicht untersucht. Aus anderen Studien ist bekannt, dass negative Studien zurückgehalten werden (publication bias) oder der Studienplan von vornherein so gestaltet wurde, dass positive Ergebnisse wahrscheinlicher wurden oder negative Ergebnisse positiv interpretiert wurden (s.a. Geschöntes Bild neuer Medikamente in medizinischen Fachzeitschriften). Auch Betrug kommt vor (siehe Lug und Trug in der Wissenschaft).
Diese Studie weist - wie mittlerweile zahlreich andere Studien - auf die Notwendigkeit eines größeren Abstands zwischen medizinischem Forschungsbetrieb und Industrie hin. Derzeit werden in großem Umfang Forschungsergebnisse generiert, denen nicht vertraut werden kann.
Jagsi R, Nathan Sheets, Aleksandra Jankovic, Amy R. Motomura, Sudha Amarnath, Ubel PA. Frequency, nature, effects, and correlates of conflicts of interest in published clinical cancer research. CANCER. Abstract der Studie
Diese folgende wegweisene Studie aus dem Jahr 2003 untersuchte die Frage der Interessenkonflikte für den gesamten Bereich der medizinischen Forschung:
Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research. Bekelman JE, Li Y, Gross CP. Journal of the American Medical Association. Volltext
David Klemperer, 6.6.09
USA: Institute of Medicine fordert offensiven Umgang mit Interessenkonflikten im Gesundheitswesen
 Ende April hat das US-amerikanische Institute of Medicine (IOM) einen Bericht über Interessenkonflikte in der Medizin veröffentlicht. Der Bericht wurde von einem 17-köpfigen Komitee verfasst und richtet sich an die wissenschaftliche und medizinische Öffentlichkeit, an die Industrie, die Nutzer, die Medien und and die Politik. Die Autoren beschreiben das Problem der Interessenkonflikte umfassend und bieten Lösungen an.
Ende April hat das US-amerikanische Institute of Medicine (IOM) einen Bericht über Interessenkonflikte in der Medizin veröffentlicht. Der Bericht wurde von einem 17-köpfigen Komitee verfasst und richtet sich an die wissenschaftliche und medizinische Öffentlichkeit, an die Industrie, die Nutzer, die Medien und and die Politik. Die Autoren beschreiben das Problem der Interessenkonflikte umfassend und bieten Lösungen an.
Auf den 355 Seiten geht es um
• eine Definition von Interessenkonflikt
• Grundsätze zum Erkennen und zur Bewertung von Interessenkonflikten
• Regelungen zu Interessenkonflikten
• Interessenkonflikte in der biomedizinischen Forschung
• Interessenkonflikte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung
• Interessenkonflikte in der medizinischen Praxis
• Interessenkonflikte und Entwicklung von Leitlinien
• Institutionelle Interessenkonflikte
• die Rolle von unterstützenden Organisationen
Die Definition des IOM lautet: "Conflicts of interest are defined as circumstances that create a risk that professional judgments or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest." Interessenkonflikte werden also als Sachverhalte definiert, die einen Konflikt zwischen primären und sekundären Interessen verursachen, wobei die Gefahr darin besteht, dass Urteilsvermögen und Handlungen unangemessen beeinflusst werden. So ist das primäre Interesse ärztlichen Handelns das Wohl des Patienten und die dafür erforderliche bestmögliche Behandlung. Ein sekundäres Interesse mit unangemessener Wirkung auf das Patientenwohl können finanzielle Anreize sein, die dem Arzt eine Behandlung attraktiv erscheinen lassen, welche nicht die bestmögliche ist. Eine detaillierte Darlegung und Analyse dieses von Dennis Thompson entwickelten Konzepts von Interessenkonflikt findet sich in dem Schwerpunktheft "Interessenkonflikte und Beeinflussung" der Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen. Thompson ist Mitglied des IOM-Komitees.
Das Komitee nennt einige übergeordnete Schlussfolgerungen seiner Untersuchung (Summary S. 4):
1. Das Ziel von Regelungen zu Interessenkonflikten ist es, die Integrität der professionellen Urteilsfähigkeit zu schützen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu bewahren und nicht erst dann aktiv zu werden, wenn Probleme aufgetreten sind.
2. Die Offenlegung individueller und institutioneller Interessenkonflikte ist ein notwendiger aber nicht ausreichender erster Schritt im Prozess des Erkennens von Interessenkonflikten und im Umgang damit.
3. Regelungen und Bestimmungen zu Interessenkonflikte sind wirksamer, wenn die Betroffenen an ihrer Entwicklung beteiligt sind.
4. Die betroffenen Institutionen und Organisationen können gemeinsam Anreize schaffen, Regelungen für Interessenkonflikte einzuführen, die den Empfehlungen des IOM-Komitees folgen.
5. Forschung ist erforderlich, um mehr Evidenz über die Wirksamkeit von Regelungen zu Interessenkonflikte zu generieren.
6. Die medizinischen Institutionen und Organisationen sollten freiwillig handeln, ansonsten ist zu erwarten, dass der Staat tätig wird.
Hier ein Auszug aus den 16 Empfehlungen (Summary S12-S17):
• Alle Einrichtungen, die mit medizinscher Forschung, Aus-, Fort- und Weiterbildung oder Leitlinienentwicklung befasst sind, sollten Regelungen schaffen, die mit den Grundsätzen des IOM-Berichts übereinstimmen. (Empfehlung 3.1)
•Interessenkonflikte sollten spezifisch und umfassend offengelegt werden, es sollte keine Untergrenze für Zuwendungen festgelegt werden. (Empfehlung 3.2)
• Es sollte ein Standard für Inhalt, Format und Vorgehensweisen bezüglich finanzieller Interessenkonflikte in Verbindung mit der Industrie im Rahmen einer Konsensfindung auf nationaler Ebene festgelegt werden. (Empfehlung 3.3)
• Der Gesetzgeber sollte die Industrie dazu verpflichten, alle Zahlungen an Ärzte, Wissenschaftler, Fachgesellschaften, Selbsthilfegruppen, Patientengruppen und Anbietern von Fortbildung öffentlich zu machen. (Empfehlung 3.4)
• Forschungseinrichtungen sollten Wissenschaftler von der Forschung am Menschen grundsätzlich ausschließen, die bedeutsame finanzielle Interessen an einem Produkt haben, das erforscht wird. (Empfehlung 4.1)
• Ärzte, Medizinstudenten und Ausbildungseinrichtungen sollten keinerlei Geschenke von der Industrie annehmen, auch keine kleinen Geschenke wie Kugelschreiber und Schreibblöcke. (Empfehlung 5.1, 6.1) Die Industrie sollte keine Geschenke anbieten. (Empfehlung 6.2)
• Ein neues System der Finanzierung von Fortbildung sollte geschaffen werden, das frei ist vom Einfluss der Industrie. (Empfehlung 5.3)
• Gruppen, die Leitlinien erarbeiten, sollten grundsätzlich die Mitgliedschaft von Personen mit Interessenkonflikten ausschließen. Es sollte keine finanzielle Unterstützung der Industrie angenommen werden. Ist die Beteiligung eines Experten mit Interessenkonflikte wegen dessen Expertise unvermeidbar, sollten Restriktionen gelten (Vorsitzender ohne Interessenkonflikte, Mitglieder mit Interessenkonflikte müssen Minderheit bilden, Ausschluss von der Beratung, der Abfassung und der Beschlussfassung zu Empfehlungen). (Empfehlung 7.1)
• Das Gesundheitsministerium sollte ein Forschungsprogramm entwickeln und fördern, um die Auswirkungen von Interessenkonflikte auf die Qualität medizinscher Forschung, auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung, auf die Praxis der Medizin und auf die Leitlinienentwicklung zu erfassen und um die Effekte von Interessenkonflikt-Regelungen auf diese Bereiche zu untersuchen. (Empfehlung 9.2)
Der Bericht ist inhaltlich und politisch umfassend und wegweisend und anregend für die in Deutschland langsam an Schwung gewinnende Befassung mit dem Thema. Offen ist, inwieweit die angesprochenen Institutionen und Personen seine Empfehlungen aufgreifen und umsetzen.
Institute of Medicine. Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Pracice.
• Executive Summary Download
• Volltext: Download als PDF seit Mai 2011 kostenlos nach einer unkomplizierten Registrierung Website
Derek Thompson. The Challenge of Conflict of Interest in Medicine ZEFQ, Heft 3, Mai 2009. Dieser Aufsatz ist ein Update seiner grundlegenden Definition aus dem Jahr 1993.
Schwerpunktheft Interessenkonflikte und Beeinflussung. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen, Mai 2009. Editorial.
Website zum Thema Interessenkonflikte
David Klemperer, 17.5.09
Marketing für Medikamente wirkt - selbst in subtiler Dosis
 Als starke Marke etablierte Produkte sind stärker im Bewusstsein verankert und den Käufern gegenwärtiger als konkurrierende Produkte. Bei der Wahl zwischen zwei oder mehr Produkten kann sich dies unbewusst auf die Kaufentscheidung auswirken. In einer amerikanischen Studie wurde jetzt untersucht, ob sich dieses Prinzip auf den Medikamentenbereich übertragen lässt.
Als starke Marke etablierte Produkte sind stärker im Bewusstsein verankert und den Käufern gegenwärtiger als konkurrierende Produkte. Bei der Wahl zwischen zwei oder mehr Produkten kann sich dies unbewusst auf die Kaufentscheidung auswirken. In einer amerikanischen Studie wurde jetzt untersucht, ob sich dieses Prinzip auf den Medikamentenbereich übertragen lässt.
Die Hypothesen der Forscher lauteten:
1. Medizinstudenten, die einem Objekt ausgesetzt sind, das Werbung für eine Marke trägt, zeigen eine positivere Haltung gegenüber dem Produkt durch die Bahnung positiver Assoziationen als Medizinstudenten einer Vergleichsgruppe.
2. Die restriktive Politik einer Universität in Bezug auf pharmazeutisches Marketing mindert diesen Effekt durch die erhöhte Sensibilität für die Beeinflussungstaktiken.
Zur Beantwortung dieser Frage führten die Forscher eine randomisierte kontrollierte Studie durch. 352 Medizinstudenten im 3. und 4 Studienjahr aus zwei Universitäten wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt. Eine der Universitäten (University of Pennsylvania School of Medicine) verfolgt einen restriktiven Umgang mit Pharmavertretern. Geschenke, Mahlzeiten und Medikamentenmuster sind verboten. Die andere Universität (University of Miami Miller School of Medicine) lässt diese Marketingbemühungen zu.
Die Studenten kannten den eigentlichen Zweck der Studie nicht, sie wussten nur, dass es um klinische Entscheidungsfindung ging.
Alle Studenten mussten einige schriftliche Angaben auf einem Notizbogen machen und anschließend den Implicit Association Test (s.u.) am Computer durchführen. Die Exposition bestand darin, dass auf dem Notizbogen einer der beiden Gruppen der Name und das Logo des Blutfettsenker Lipitor® (in Deutschland Sortis®, Substanz: Atorvastatin) angebracht war, ebenso auf dem Klemmbrett, auf dem der Notizbogen befestigt war. In der Kontrollgruppe waren Klemmbrett und Notizpapier neutral.
In dem Test ging es um den Vergleich von Lipitor® mit dem Konkurrenzprodukt Zocor® (Substanz: Simvastatin) einem medizinisch zumindest gleichwertigen Blutfettsenker.
Der Implicit Association Test (IAT) misst unbewusste Haltungen und Bewertungen. Der IAT ist in der psychologischen Forschung und im Marketing weit verbreitet. Aufgabe des Probanden ist es, Objekten Merkmale zuzuordnen, ohne dabei Bedenkzeit zu haben. Der Vergleich der Reaktionszeiten bei der Zuordnung von Merkmalen zu zwei zu vergleichenden Objekten erlaubt Rückschlüsse über die implizite Haltung des Probanden. Beispiele für den IAT finden sich auf einer Website der Harvard University.
Die explizite Haltung der Studenten wurde mit einem Fragebogen erfasst, auf dem sie Lipitor® und Zocor® nach mehreren Dimensionen bewerteten
Die Tests zeigten, dass alle Studenten Lipitor® positiver bewerteten als Zocor®, also auch die Studenten der Kontrollgruppe. Unterschiede ergaben sich zwischen den beiden Universitäten. In Miami (wenig restriktiv bezüglich Pharma-Marketing) zeigten die exponierten Studenten eine stärkere Bevorzugung von Lipitor als die Kontrollen. In Penn (restriktiv bezüglich Pharma-Marketing ) hingegen zeigten die exponierten Studenten eine geringere Bevorzugung als die Kontrollstudenten.
Die Studie zeigt, dass bereits eine subtile Werbung für ein Medikament wirksam ist. In einem Umfeld, dass die gängigen Methoden des Pharmamarketings zulässt, wird die positive Bewertung eines Medikaments verstärkt. Sind Geschenke und gesponserte Mahlzeiten verboten, kehrt sich der Effekt um - die positive Bewertung wird abgeschwächt.
Die Rahmenbedingungen wirken sich offensichtlich stark darauf aus, wie Studenten das Marketing der Industrie einschätzen. In Miami (nicht restriktiv) halten 86% der Studenten Industrie-gesponserte Veranstaltungen für hilfreich und fortbildend, in Penn (restriktiv) 52%. In Miami verneinen 67%, dass Geschenke sie bei der Verschreibung von Medikamenten zugunsten des Produkts der schenkenden Firma beeinflussen könnten, in Penn 29%.
Diese Studie bestätigt und erweitert das vorhandene Wissen darum, wie Ärzte von der Industrie beeinflusst werden. Das Besondere an dieser Studie ist die Untersuchung einer eher schwachen Exposition (Anblick des Namens und Logos eines Medikaments) und der Nachweis der Auswirkung auf die implizite, also eher unbewusste Bewertung. Weiterhin ist hervorzuheben, dass die Auswirkung der Exposition gegensätzlich war, je nach Umfeld. Ein Pharmamarketing-freundliches Umfeld verbessert und ein kritisches Umfeld verschlechtert die Bewertung eines Medikaments.
Fazit aus dieser Studie sollte sein, werbende Einflüsse auf Ärzte so weit wie möglich zu unterbinden, damit sie ihren Patienten die besten und nicht die am stärksten beworbenen Medikamente verordnen. Ein Blick auf die umsatzstärksten Medikamente in Deutschland zeigt, dass Ärzte häufig stark beworbene Medikamente verordnen, auch wenn gleichwertige, teils sogar überlegene Medikamente zur Verfügung stehen, die stets preiswerter sind. Unter den 15 umsatzstärksten Medikamenten befinden sich 6 Präparate, die als Variante ohne besonderen Stellenwert und 5 Präparate, die als umstrittene Mittel bewertet werden.
GRANDE, D., FROSCH, D. L., PERKINS, A. W. & KAHN, B. E. (2009) Effect of Exposure to Small Pharmaceutical Promotional Items on Treatment Preferences. Arch Intern Med, 169, 887-893. Abstract der Studie
ARZNEI-TELEGRAMM (2008) 1997 und 2007 im Vergleich - die umsatzstärksten Arzneimittel. Arznei-telegramm, 39, 65-66. Tabelle
David Klemperer, 14.5.09
Malaria in den Zeiten von Vogel- und Schweinegrippe. Wer oder was entscheidet über die Wichtigkeit von Krankheiten?
 Frühlings- und Sommerzeit sind in Mitteleuropa oder Nordamerika auch die Monate der Fliegen- und Mücken"plage", Fliegenklatschen, Mückensprays, "harmlosen" Chrysanthemenextrakt-Plättchen und Fliegenfallen. Und wenn man doch gestochen wird oder vor lauter Mückengesirre nicht einschlafen kann, helfen kühlende Gels, Ohrenstöpsel und die jährlichen Innovationen der Hersteller einschlägiger Anti-Mückenmittel weiter.
Frühlings- und Sommerzeit sind in Mitteleuropa oder Nordamerika auch die Monate der Fliegen- und Mücken"plage", Fliegenklatschen, Mückensprays, "harmlosen" Chrysanthemenextrakt-Plättchen und Fliegenfallen. Und wenn man doch gestochen wird oder vor lauter Mückengesirre nicht einschlafen kann, helfen kühlende Gels, Ohrenstöpsel und die jährlichen Innovationen der Hersteller einschlägiger Anti-Mückenmittel weiter.
In diesem alljährlichen "Kampf" wird allzu gern vernachlässigt, dass Hunderte Millionen Menschen in großen Teilen der wärmeren Gefilde der Erde gerne unsere Probleme hätten, d.h. gerne auf die dort drohenden Krankheits- und Todesfolgen des Stichs einer bestimmten Mückensorte verzichten würden.
Es handelt sich um Malaria, d.h. einer durch den Stich der Anophelesmücken-Weibchen übertragenen Infektionskrankeit mit den Erregern Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi und Plasmodium semiovale. Von diesen führt besonders der erste Erreger häufig zu einem tödlichen Ausgang der ansonsten vor allem mit hohem und schubweisem Fieber und Krämpfen einhergehenden Akuterkrankung führt.
Sie ist mit rund 515 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr die mit Abstand weltweit häufigste parasitäre Infektionserkrankung. Die Anzahl der jährlich an Malaria sterbenden Menschen beträgt mehr als 3 Millionen Personen, darunter 850.000 Kinder.
Malariaerkrankungen und -todesfälle konzentrieren sich auf die tropischen Regionen Afrikas, Asiens, Süd- und Mittelamerikas, die Karibik und Teile des Pazifiks. Die gefährlichste Variante mit dem Erreger Plasmodium Falciparum tritt besonders stark im Subsaharabereich Afrikas auf. Dort wird aber auch deutlich, dass die Gefährlichkeit der Malaria sich nicht nur aus der Existenz des Anopheles-Moskito ergibt, sondern auch unangemessene Malariakontroll- und -präventionsdienste wesentlich zur Erkrankungshäufigkeit und den unerwünschtesten Folgen beitragen.
Da es angesichts der Fülle sozialer und kollektiver Probleme offensichtlich nicht mehr anders möglich ist, vergeht mittlerweile fast kein Tag (wen ein Überblick über diese Art von Tagen interessiert schaue in den "Stadtplan Gesundheit") ohne eines offiziellen Gedenkens an HIV, Behinderte, Wasserknappheit oder einer untergehenden Tierart als kulturellem Ritual das jeweilige Problem zu thematisieren. Der 25. April jeden Jahres ist daher der "Weltmalariatag".
Das internationale, von der Weltbank gegründete und u.a. von der WHO und der Gates-Stiftung unterstützte "Disease Control Priorities Project (DCPP)" hat dies zum Anlass genommen, auf einige seiner Standarddokumente (z.B. das 20 Seiten umfassende Kapitel "Conquering Malaria" eines umfangreicheren Handbuchs) zu den Themen Ursachen, Prävention und Behandlung von Malaria hinzuweisen und unter der Überschrift "WORLD MALARIA DAY 2009. Elimination of Deadly Parasitic Disease is Possible" eine Fülle weiterer wichtiger epidemiologischer, medizinischer und gesundheitsökonomischer Informationsquellen zusammenzustellen und zum Teil per Link zugänglich zu machen.
Die Themenschwerpunkte sind u.a.:
• Malaria and its Impact on Maternal, Perinatal, and Child Health
• New evidence for conquering malaria: Operations, Costs and Cost-Effectiveness
• Defining and Defeating the Intolerable Burden of Malaria
• Undernutrition as an underlying cause of malaria morbidity and mortality
• The Public Health Burden of Plasmodium falciparum Malaria in Africa: Deriving the Numbers
• New Perspectives on the Causes and Potential Costs of Malaria: The Growth and Development of Children. What Should We be Measuring and How Should We be Measuring It?
• Do Malaria Control Interventions Reach the Poor?: A View Through the Equity Lens
• The economic burden of illness for households: A review of cost of illness and coping strategy studies focusing on malaria, tuberculosis and HIV/AIDS
• The Intolerable Burden Of Malaria: What's New, What's Needed
Bevor sich unsere Aufmerksamkeit dem heutigen Tag des geistigen Eigentums und dem AKW-Unfall in Tschernobyl oder dem Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am 28.4. zuwendet, lohnt sich vielleicht das kurze Nachdenken darüber, warum Malaria fast schon wieder vergessen, das neueste Risiko einer "weltweit drohenden" Schweinegrippe aber wahrscheinlich noch monatelang die erkrankten Menschen, Staaten, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Hunderte Millionen Zeitungsleser und TV-Zuschauer beschäftigen wird. Nachdem der "Vorgänger" der jetzt angeblich drohenden Epidemie, nämlich die Vogelgrippe-Pandemie erfreulicherweise "irgendwo" steckengeblieben ist, scheint die Schweinegrippe der willkommene Nachfolger für schlagzeilengierige Berichterstatter und die Hersteller von Medikamenten mit dem Wirkstoff Oseltamivir darunter vor allem der Marktführer Roche mit dem Marken- und Blockbusterpräparat Tamiflu zu sein. Die WHO meint immerhin schon sagen zu können, dass die in Mexiko und in einigen Südstaaten der USA untersuchten Viren "have been sensitive to oseltamivir, but resistant to both amantadine and rimantadine".
Ein Blick auf die pharmakologische und sehr begrenzte Bedeutung oder Wirkung des Wirkstoffs Oseltamivir und der pharmako-politischen Hintergründe seiner "Erfolgsgeschichte" und Verbreitung und der Ereignisse im Kontext der Vogelgrippe, liefert eine Reihe von ernsthaften Anhaltspunkten, die in der wahrscheinlich bevorstehenden Schweinegrippeepidemie-Zeit beachtet, hinterfragt und zum Inhalt gesundheitswissenschaftlicher Kommunikation des Risikos gemacht werden sollten.
Die genannten Dokumente und Studien über Malaria findet man der DCCP-"Presseerklärung vom 24.4.2009".
Bernard Braun, 26.4.09
Erfundene Daten, hohe Umsätze. Wissenschaftler fordern industrieunabhängige Studien
 "Er war einer der profiliertesten Forscher im Bereich der Behandlung von postoperativem Schmerz. Sein Betrug wirft uns in unserem Wissen enorm zurück." So äußerte sich der Herausgeber der amerikanischen Fachzeitschrift Anesthesia & Analgesia in der New York Times vom 11.3.2009, nachdem bekannt geworden war, dass der Anästhesist und Schmerzforscher Scott S. Reuben die Daten für mindestens 21 Veröffentlichungen seit 1996 frei erfunden hat. Die Verlässlichkeit weiterer 52 Publikationen ist ungewiss. Reuben erhielt u.a. in den Jahren 2002 bis 2007 Zuwendungen von pharmazeutischen Firma Pfizer für die Untersuchung der Substanzen Celecoxib (Celebrex®) und Pregabalin (Lyrica®).
"Er war einer der profiliertesten Forscher im Bereich der Behandlung von postoperativem Schmerz. Sein Betrug wirft uns in unserem Wissen enorm zurück." So äußerte sich der Herausgeber der amerikanischen Fachzeitschrift Anesthesia & Analgesia in der New York Times vom 11.3.2009, nachdem bekannt geworden war, dass der Anästhesist und Schmerzforscher Scott S. Reuben die Daten für mindestens 21 Veröffentlichungen seit 1996 frei erfunden hat. Die Verlässlichkeit weiterer 52 Publikationen ist ungewiss. Reuben erhielt u.a. in den Jahren 2002 bis 2007 Zuwendungen von pharmazeutischen Firma Pfizer für die Untersuchung der Substanzen Celecoxib (Celebrex®) und Pregabalin (Lyrica®).
Mit seinen Veröffentlichungen hat er wesentlich zum positiven Erscheinungsbild nicht nur dieser beiden Medikamente beigetragen. Auch dürfte der Beitrag seiner gefälschten Studien für das erfolgreiche Marketing dieser Medikamente bedeutsam sein. Offensichtlich ist hier ein Wissenschaftler der Versuchung erlegen, im Hinblick auf eigenen Vorteil seinem Auftraggeber günstige Ergebnisse abzuliefern.
Der Betrug kam durch eine Untersuchung an seinem Arbeitsplatz im Baystate Medical Center in Springfield, Mass. zutage, nachdem aufgefallen war, dass Reuben für 2 neue Studien keine Genehmigung hatte.
Wenig ermutigend ist es, dass die meisten Betrugsfälle unentdeckt bleiben dürften, wie Richard Smith vergangenes Jahr im British Medical Journal berichtete. Eine Schätzung auf Grundlage einer Befragung von Wissenschaftlern (veröffentlicht in der renommierten Zeitschrift Nature, wir berichteten) kommt zum Ergebnis, dass nur etwa ein Prozent der Fälle von schweren Vergehen aufgedeckt wird.
Über fragwürdige Praktiken in der Publikation von Studien hatten wir zuletzt mehrfach berichtet, so über "Fehlinformation und Manipulation am Beispiel des Medikamentes Gabapentin", über die sachlich nicht haltbare, aber für Marketingzwecke förderliche Begriffsbildung "Neuroleptika der 2. Generation" und darüber, wie die Autoren neue Medikamenten in Fachzeitschriften sehr viel positiver darstellen als sie in den Unterlagen für die behördliche Zulassung erscheinen ("Geschöntes Bild neuer Medikamente in medizinischen Fachzeitschriften").
Eine Stärkung einer an den Bedürfnissen der Patienten orientierten Forschung haben die European Medical Research Councils in einem am 12.3.2009 veröffentlichten Bericht gefordert. Der Bericht trägt den Titel "Investigator-Driven Clinical Trials", womit Studien gemeint sind, die von Wissenschaftlern initiiert werden und nicht von der Industrie. Das Gremium, in dem auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft vertreten ist, stellt fest, dass es einen Mangel an Forschung zu medizinischen Fragen gibt, die nicht mit kommerziellen Interessen verbunden sind oder diesen gar zuwiderlaufen. Diesen Mangel sehen die Autoren z.B. bei der Behandlung seltenen Krankheiten, bei der Prüfung, welches von zwei oder mehreren Medikamente das bessere ist, bei der langfristigen Sicherheit von Medikamente, bei Behandlungsergebnissen, die für den Patienten bedeutsam sind, bei Teilgruppen der Bevölkerung wie Kindern und Alten (S.7). In erster Linie Regierungen aber auch wohltätige Stiftungen sollen zur Finanzierung beitragen.
New York Times 9.3.2009. Doctor Admits Pain Studies Were Frauds, Hospital Says Download
European Medical Research Councils. Looking Foward. Investigator-Driven Clinical Trials. Download
David Klemperer, 21.3.09
Verhindert Antibiotikaeinsatz bei Mittelohrentzündungen Folgeerkrankung oder fördert er fast nur Antibiotikaresistenz?
 Im Forum wurde bereits die Über- oder Fehlversorgung von Mittelohrentzündungen (Otitis media) mit Antibiotika angesprochen und auf deren Beitrag zur gesundheitlich immer problematischer werdenden Antibiotikaresistenz vieler Erreger hingewiesen. Diejenigen ÄrztInnen, die ihr Handeln zu rechtfertigen versuchen, geben häufig zu bedenken, sie befänden sich in einer klassischen Scylla-und-Charybdis-Situation, und müssten zwischen den möglichen mittel- bis langfristig unerwünschten Folgen der Antibiotika-Therapie und einer kurzfristig drohenden Folgeerkrankung der unbehandelten Mittelohrentzündung abwägen.
Im Forum wurde bereits die Über- oder Fehlversorgung von Mittelohrentzündungen (Otitis media) mit Antibiotika angesprochen und auf deren Beitrag zur gesundheitlich immer problematischer werdenden Antibiotikaresistenz vieler Erreger hingewiesen. Diejenigen ÄrztInnen, die ihr Handeln zu rechtfertigen versuchen, geben häufig zu bedenken, sie befänden sich in einer klassischen Scylla-und-Charybdis-Situation, und müssten zwischen den möglichen mittel- bis langfristig unerwünschten Folgen der Antibiotika-Therapie und einer kurzfristig drohenden Folgeerkrankung der unbehandelten Mittelohrentzündung abwägen.
Bei der Mittelohrentzündung wird vor allem eine so genannte Mastoiditis befürchtet, d.h. eine entzündliche Einschmelzung des knöchernen Warzenfortsatzes im Bereich des Mittelohrs, die ihrerseits wiederum das Risiko von noch schwereren Folgeerkrankungen (z. B. Gesichtsnervenlähmung, Schläfenbeinosteomyelitis, Gehirnhautentzündung, Schläfenlappen- oder Kleinhirnabszess sowie Blutvergiftung) in sich birgt oder eine Entfernung des Warzenfortsatzes erfordert. Die Informationsplattform "Gesundheitspro.de" drückt den Zusammenhang exemplarisch so aus: "Die Mastoiditis ist in der Regel (!!!) eine Komplikation einer unbehandelten oder nicht ausreichend behandelten akuten Mittelohrentzündung. Sie entwickelt sich ungefähr zwei bis vier Wochen nach einer Mittelohrentzündung. … Um einer Mastoiditis vorzubeugen, ist die fachärztliche Behandlung einer Mittelohrentzündung mit Antibiotika … nötig."
Die seit einiger Zeit bei der Mittelohrentzündung von Kindern alternativ gewählte Behandlungsweise ist der so genannte "watch-and-wait"-Ansatz. Weder die beobachtenden und abwartenden Ärzte noch die mit Antibiotika intervenierenden Ärzte konnten aber bisher eindeutig nachweisen, ob ihr Verhalten die Mastoiditis-Inzidenz erhöhte oder verhinderte. Diesen für weite Bereiche der medizinischen Versorgung typischen Wissensmangel beendet jetzt für den Komplex der Mittelohrentzündung eine britische Studie, die für den Zeitraum 1990 bis 2006 für 2.622.348 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 15 Jahren auf der Grundlage der "General Practice Reseaech Database" die Trends der akuten Otitis media und der Mastoiditis und der als regelhaft unterstellten Zusammenhänge untersuchte.
Die Wirklichkeit sieht etwas komplexer aus und irritiert die Rechtfertigung des Antibiotikaeinsatzes erheblich:
• In den 16 untersuchten Jahren blieb die Inzidenz von Mastoiditis mit durchschnittlich rund 1,2 Fällen pro 10.000 Kinderjahren stabil.
• Anders sieht es bei der Mittelohrentzündung aus, deren Inzidenz im selben Zeitraum um 34 % abnahm.
• Von den 854 Kindern, bei denen eine Mastoiditis diagnostiziert wurde, hatten in den jeweils vorangegangenen drei Monaten lediglich 36 % eine diagnostizierte Mittelohrentzündung gehabt.
• Der Anteil der Kinder, die an einer Mittelohrentzündung erkrankt und mit Antibiotika behandelt worden waren, sank von 77 % auf 58 %. Dies liegt in Großbritannien in den hier untersuchten Jahren überwiegend an der Verbreitung des "watch-and-wait"-Ansatz.
• Die je nach Behandlung einer Mittelohrentzündung Inzidenz von Mastoiditis lag in der Gruppe der mit Antibiotika therapierten Kindern bei 1,8 Fällen bei 10.000 Episoden (139 von 792.623). Erhielten Kinder mit Otitis media kein Antibiotikum erhöhte sich ihre Mastoiditisrate auf 3,8 Fälle pro 10.000 Episoden (149 von 389.649). Das Folgerisiko der antibiotisch behandelten Kinder lag also um 53 % unter dem der Kinder, deren Entwicklung zunächst einmal beobachtet und abgewartet wurde.
• Wie in vielen anderen Fällen relativiert sich der Eindruck und der Handlungsdruck des halbierten Risikos, wenn man sich die bisher bekannten Größenordnungen vergegenwärtigt und die Schätzung der Autoren zur NNT- bzw. NNH-Rate ("numbers needed to treat" oder "number needed to harm") mitberücksichtigt, dass 4.831 Kinder bzw. Entzündungsepisoden mit Otitis media mit Antibiotika behandelt werden müssen, um ein Kind vor einer Mastoiditis zu bewahren. 4.830 Kindern hilft also die Antibiotikatherapie zumindest nicht gegen die befürchtete Folgeerkrankung, fördert aber das Resistenzbildungsrisiko und mögliche andere unerwünschten Wirkungen dieses Arzneimittels. Noch anders ausgedrückt: Wenn bei Mittelohrentzündungen gar keine Antibiotika mehr verordnet worden wären, hätte es 255 Fälle von Mastoiditis bei den Kindern gegeben, aber es hätte in Großbritannien auch 738.775 weniger Antibiotikaverordnungen pro Jahr gegeben.
WissenschaftlerInnen nennen als eine Ursache eines möglichen Rückgangs von Mittelohrentzündungen und Mastoiditis die Impfung gegen das Bakterium Streptococcus pneumoniae und verweisen dazu auf Beobachtungen in den USA. Die Inzidenz von Otitis media und Mastoiditis und der unerwünschten Wechselwirkung dürfte also in Ländern mit derartigem Impfangebot noch niedriger sein als in der britischen Studie.
Von dem Aufsatz "Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: A retrospective cohort study using the United Kingdom General Practice Research Database" von Paula Louise Thompson et al. in der Februarausgabe 2009 der Fachzeitschrift "Pediatrics" Jahrgang 123: 424) gibt es kostenfrei nur ein Abstract.
Bernard Braun, 18.3.09
Früher aber nicht notwendiger Einsatz von Antibiotika bei Kindern - Kein Nutzen der Antibiotikaprophylaxe bei Harnwegsinfekten
 Die Über- oder Fehlversorgung von BürgerInnen aller Altersgruppen mit Antibiotika und das damit sogar verbundene Risiko, systematisch multiresistente Erreger heranzuzüchten, wird allenthalben als großes ökonomisches und gesundheitliches Problem kommuniziert.
Die Über- oder Fehlversorgung von BürgerInnen aller Altersgruppen mit Antibiotika und das damit sogar verbundene Risiko, systematisch multiresistente Erreger heranzuzüchten, wird allenthalben als großes ökonomisches und gesundheitliches Problem kommuniziert.
Der Einstieg in Antibiotikatherapien erfolgt häufig bereits bei kleinen Kindern und gewinnt zum Teil hier ihr positives Image als Waffe gegen wiederkehrende Erkrankungen und einige ihrer fürs Leben erworbenen physiologischen Folgen. Dies gilt - neben der Mittelohrentzündung - auch für die häufig wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, die nicht nur schmerzhaft sind, sondern auch durch die mögliche Vernarbung des Nierengewebes bleibende Spuren mit wiederum möglichen unerwünschten Folgewirkungen hinterlassen.
Die Intervention gegen eine erstmalige Erkrankung an Harnwegsinfektionen galt auch bereits bei sehr jungen Kindern als geeignetes Mittel, Rezidive und Vernarbungen zu verhindern.
Ob dies wirklich zutrifft und ob daher möglicherweise das Resistenzbildungsrisiko geringer wiegt, wurde aber erst jetzt in einer randomisierten kontrollierten Studie mit 338 Kindern im Alter von 7 Monaten bis zu 7 Jahren untersucht, die erstmalig an einem fiebrigen Harnwegsinfekt erkrankt waren, der mit einer nicht-schweren Form der Umkehr der Fließrichtung des Harns (vesikoureteralem Reflux [VUR; Grad I-III]) verbunden war oder nichts davon aufwies.
In einer multizentrischen, randomisierten, kontrollierten, einseitigen Äquivalenzstudie erhielt ein Teil dieser Kinder ein Jahr lang eine Antibiotikaprophylaxe (n=127) , der andere (n=211) nicht. Bei 309 dieser Kinder wurde eine Nierenbeckenentzündung nachgewiesen und 27 Kinder litten neben einer Nierenbeckenentündung auch an Problemen des Harnabflusses (Reflux).
Die beiden Studienziele waren die Rezidivrate des fiebrigem Harnwegsinfekt und die durch diese wiederkehrenden Entzündungen verursachten Vernarbungen des Nierengewebes zu untersuchen.
Die so genannte "Intention-to treat"-Analyse ergab weder für den primären Endpunkt der Rezidivrate noch die Vernarbung des Nierengewebes einen signifikanten Unterschied zwischen der Antibiotika- und Nicht-Antibiotika-Gruppe:
• Mit Prophlaxe erkrankten 9,45 % der Kinder mit Antibiotikaeinnahme erneut und 7,11 % waren es in der Gruppe ohne Antibiotikabehandlung. In der Untergruppe mit vesikoureteralem Reflux erkrankten 12,1 % der behandelten und 19,6 % der nicht behandelten Kinder erneut an einem Harnwegsinfekt.
• 1,9 % der Kinder ohne Prophylaxe zeigten eine Vernarbung des Nierengewebes und 1,1 % der Kinder mit Prophylaxe.
- Zu keinem Lebenszeitpunkt erwies sich die fehlende Prophylaxe als ein Risikofaktor.
• In einer multivariaten Analyse erwies sich ein schwererer Grad der Fließumkehr des Harns als der entscheidende Risikofaktor für wiederkehrende fiebrige Harnwegsinfekte. Protektiv wirkte ein höheres Alter
Zumindest für die Fälle in denen es zu keiner oder einer leichten bis mittelschweren Form des Refluxes kommt, sehen daher die Wissenschaftler keinen Nutzen für die Antibiotikaprophlaxe. Damit sollten deren potenziellen mittel- bis langfristigen Nachteile und auch ihre Kosten Anlass sein, auf eine solche Therapie zu verzichten.
Von dem Aufsatz "Prophylaxis after first febrile urinary tract infection in children? A multicenter, randomized, controlled, noninferiority trial" von Montini G. et al. in der Zeitschrift Pediatrics (Vol. 122 No. 5 November 2008, pp. 1064-1071) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 1.3.09
Nutzen und geringe Nebenwirkungen sprechen für Prävention mit Preiselbeerextrakt bei Harnwegsinfekten älterer Frauen
 "Omas Heilmittel" aus dem "Garten der Natur" fehlt häufig ein genereller wissenschaftlicher Nachweis ihres Nutzens, sie haben zum Teil auch massive Nebenwirkungen oder gefährden die Wirkung von Arzneimitteln (z.B. im Falle von Grapefruitsaft und Johanniskraut) und schließlich gibt es häufig keine vergleichenden Untersuchungen der Wirkungen von Naturheilmitteln gegenüber der von "künstlichen" Arzneimitteln. Dies alles kann auch von Anhängern einer sanfteren Therapie nicht ignoriert werden, vor allem, wenn sie bei anderen Therapeutika vollkommen zu Recht einen Evidenznachweis verlangen.
"Omas Heilmittel" aus dem "Garten der Natur" fehlt häufig ein genereller wissenschaftlicher Nachweis ihres Nutzens, sie haben zum Teil auch massive Nebenwirkungen oder gefährden die Wirkung von Arzneimitteln (z.B. im Falle von Grapefruitsaft und Johanniskraut) und schließlich gibt es häufig keine vergleichenden Untersuchungen der Wirkungen von Naturheilmitteln gegenüber der von "künstlichen" Arzneimitteln. Dies alles kann auch von Anhängern einer sanfteren Therapie nicht ignoriert werden, vor allem, wenn sie bei anderen Therapeutika vollkommen zu Recht einen Evidenznachweis verlangen.
Nach Lektüre der gerade im Fach-"Journal of Antimicrobial Chemotherapy" [(2009) 63, 389-395] unter der Überschrift "Cranberry or trimethoprim for the prevention of recurrent urinary tract infections? A randomized controlled trial in older women" veröffentlichten Studie von Marion E. T. McMurdo, Ishbel Argo, Gabby Phillips, Fergus Daly und Peter Davey, gibt es nach Ansicht der AutorInnen zumindest beim wissenschaftlich fundierten Vergleich der präventiven Wirkung von Preiselbeerextrakt und des Antibiotikum-Wirkstoff Trimethoprim auf wiederkehrende Harnwegsinfekte von älteren Frauen einen klaren Gesamtvorteil für das Naturprodukt.
In die randomisierte kontrollierte Studie wurden 137 über 45 Jahre alten Frauen aufgenommen, die in den 12 Monaten vor Studienbeginn mindestens zwei ärztlich bestätigte und mit Antibiotika behandelte wiederkehrende Harnwegsinfektionen gehabt hatten. Diese Frauen wurden per Zufall einer Gruppe zugewiesen, die als Intervention über 6 Monate hinweg täglich entweder 500 mg Preiselbeerextrakt in Kapselform (n=69) oder 100 mg des Trimethoprims (n=68) einnahmen.
Die Ergebnisse des Kopf-zu-Kopf-Doppelblind-Vergleichs sahen so aus:
• Von den 137 Frauen erkrankten in der Studienzeit 39 erneut an einem Harnwegsinfekt und zwar 25 in der Preiselbeer- und 14 in der Antibiotika-Gruppe. Der 60%-Unterschied zu Gunsten des Antibiotikums war aber statistisch nicht signifikant.
• Die Zeit bis zur ersten erneuten Infektion unterschied sich zwischen den Gruppen wenig (85,5 Tage in der Preiselbeergruppe zu 91 Tagen in der Antibiotikumgruppe).
• 9 % der Teilnehmer an der Preiselbeer-Gruppe brachen die Intervention ab und 16 % in der Antibiotika-Gruppe.
• Bei unmittelbaren adversen Effekten gab es keinen Unterschied zwischen den Gruppen.
Die schottischen Wissenschaftler bewerten die vorhandenen Vorteile der Behandlung mit dem Antibiotikum als "a very limited advantage" und schlagen daher Frauen mit einem derartigem Erkrankungsbild vor, die begrenzten Vorteile gegen den höheren Preis und vor allem das höhere Risiko genereller adverser Effekte des Antibiotikums (Mitwirkung an der Bildung resistenter bakterieller Erreger und die Gefahr einer Superinfektion) zusammen mit ihrem Arzt abzuwägen.
Auch wenn die statistische Power dieser Studie formal-quantitativ für belastbare Ergebnisse ausreicht, liegt die Anzahl der StudienteilnehmerInnen nur knapp über der notwendigen Mindestanzahl. Einige Ergebnisse und Schlussfolgerungen könnten also auch etwas mit dieser methodischen Schwäche zu tun haben. So ist z.B. eine statistische Signifikanz in kleinen Gruppen nur schwer zu erreichen.
Der 7-Seiten-Aufsatz "Cranberry or trimethoprim for the prevention of recurrent urinary tract infections? A randomized controlled trial in older women" ist komplett und kostenlos erhältlich. Dies gilt natürlich auch für das Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 26.2.09
US-Studie bei Darmkrebs-Patienten zeigt: Der "informierte" Patient verlangt besonders teure Medikamente
 Die endgültige Entscheidung über die Zulassung direkter Informationen für Patienten über rezeptpflichtige Medikamente ist noch nicht gefallen, auch wenn die EU-Kommissare im Dezember 2008 dazu einen Richtlinien-Vorschlag verabschiedet haben. (vgl. EU-Parlament muss über Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel entscheiden) Insbesondere Günter Verheugen, für Unternehmens- und Industriepolitik zuständiger Vizepräsident der EU-Kommission, hatte sich für eine Erlaubnis stark gemacht, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Pharmaindustrie zu fördern. Eine Studie aus den USA, wo Direktwerbung auch für rezeptpflichtige Medikamente erlaubt ist, hat nun gezeigt, dass diese Art der Information möglicherweise eine Stärkung der Pharma-Umsätze bewirkt. Aber sie kann auch dazu führen, dass Patienten nach den teuersten Arzneimittel verlangen und sie auch verschrieben bekommen, obwohl diese nicht unbedingt optimal für ihre Therapie sind. Eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit der Pharma-Industrie in der EU würde dann zugleich eine finanzielle Schwächung der nationalen Gesundheitssysteme mit sich bringen.
Die endgültige Entscheidung über die Zulassung direkter Informationen für Patienten über rezeptpflichtige Medikamente ist noch nicht gefallen, auch wenn die EU-Kommissare im Dezember 2008 dazu einen Richtlinien-Vorschlag verabschiedet haben. (vgl. EU-Parlament muss über Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel entscheiden) Insbesondere Günter Verheugen, für Unternehmens- und Industriepolitik zuständiger Vizepräsident der EU-Kommission, hatte sich für eine Erlaubnis stark gemacht, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Pharmaindustrie zu fördern. Eine Studie aus den USA, wo Direktwerbung auch für rezeptpflichtige Medikamente erlaubt ist, hat nun gezeigt, dass diese Art der Information möglicherweise eine Stärkung der Pharma-Umsätze bewirkt. Aber sie kann auch dazu führen, dass Patienten nach den teuersten Arzneimittel verlangen und sie auch verschrieben bekommen, obwohl diese nicht unbedingt optimal für ihre Therapie sind. Eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit der Pharma-Industrie in der EU würde dann zugleich eine finanzielle Schwächung der nationalen Gesundheitssysteme mit sich bringen.
Was hat das Forschungsteam aus Boston und Philadelphia herausgefunden? In einem Satz zusammengefasst heißt die Erkenntnis ihrer Studie, die jetzt in der Zeitschrift "Cancer" online vorab veröffentlicht wurde: Patienten mit Darmkrebs, die sich besonders gut und umfassend über ihre Krankheit informieren, nehmen sehr viel häufiger als andere, gesundheitlich weniger interessierte Darmkrebs-Patienten solche Medikamente ein, die zwar überdurchschnittlich teuer sind, aber für ihre spezifische Art der Erkrankung nicht unbedingt die beste Therapie darstellen.
Die Wissenschaftler hatten insgesamt 633 Patienten mit Darmkrebs näher untersucht und nach ihren Informationsgewohnheiten zu gesundheitlichen Fragen und ihrer Erkrankung befragt. Je nachdem, wie viele verschiedene Informationsquellen sie benutzt hatten (Ärzte, Internet, Selbsthilfegruppen, Zeitschriften usw.) wurde ihr Suchverhalten als stark oder schwach ausgeprägt eingestuft. Darüber hinaus wurden sie befragt, ob sie schon von bestimmten Medikamenten gehört hätten oder diese sogar einnehmen würden. Dabei handelte es sich um zwei Medikamente (Wirkstoff Bevacizumab, US-Handelsname "Avastin" und Wirkstoff Cetuximab, US-Handelsname "Erbitux") die nach den Leitlinien der amerikanischen Zulassungsbehörde U.S. Food and Drug Administration für Darmkrebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium empfohlen werden, für Tumore in einem frühen Stadium jedoch nicht die Arzneimittel erster Wahl sind. Zwar sind sie gesundheitlich nicht unbedingt problematisch, aber ihre Kosten liegen weit über dem Durchschnitt anderer Medikamente.
In der Analyse der erfragten Daten fanden die Wissenschaftler dann heraus: Patienten, die besonders detailliert über ihre Krankheit informiert sind, also viele Informations-Quellen genutzt haben, kennen die beiden teuren Medikamente 2,8mal so oft wie andere Patienten und nehmen sie 3,3mal so oft ein. Die beiden Medikamente werden empfohlen in fortgeschrittenem Stadium der Erkrankung, wenn sich Metastasen auch außerhalb des Darms gebildet haben. Bei der großen Mehrheit der Untersuchungsgruppe (84%) war dies allerdings nicht der Fall. Würde man nur Bevacizumab zur Therapie von Darmkrebs verwenden, so schreiben die Wissenschaftler in ihrem Artikel, so würde dies allein jährliche Kosten in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar verursachen, die im Gesundheitssystem für andere Aufgaben verloren gehen.
Die Forscher beschäftigen sich in der Diskussion ihrer Befunde nicht mit der Frage der Direktwerbung für rezeptpflichtige Medikamente ("direct to consumer advertising" DTCA), die außer in den USA derzeit nur in Neuseeland erlaubt ist. Deutlich wird jedoch auch so aus ihrer Studie: Die an Patienten gerichtete Arzneimittelwerbung oder Arzneimittelinformation für rezeptpflichtige Medikamente durch Pharma-Unternehmen bringt ein Umsatzplus nicht unbedingt für die besten, sondern für die teuersten und gewinnträchtigsten Produkte.
Abstract der Studie: Stacy W. Gray u.a.: Colon cancer patient information seeking and the adoption of targeted therapy for on-label and off-label indications (Cancer, Early Online: 23 Feb 2009, doi 10.1002/cncr.24186)
Gerd Marstedt, 24.2.09
Wie verbessert man kurz- und langfristig das Arzneimittel-Einnahmeverhalten von Patienten?
 Zu den zahlreichen anbieterinduzierten Problemen finanzieller und gesundheitlicher Art bei der Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln kommt noch das Einnahmeverhalten der Patienten hinzu. Studien zeigen, dass keine kontinuierliche Einnahme erfolgt und Patienten häufig nicht die angezeigte Dosis des Medikaments einnehmen - so etwa die US-Amerikaner, sie "typically take less than half the prescribed doses". Dies kann im besseren Fall Heilung und Linderung verzögern und im schlimmsten Fall zu unerwünschten Verläufen der nicht korrekt behandelten Erkrankung führen.
Zu den zahlreichen anbieterinduzierten Problemen finanzieller und gesundheitlicher Art bei der Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln kommt noch das Einnahmeverhalten der Patienten hinzu. Studien zeigen, dass keine kontinuierliche Einnahme erfolgt und Patienten häufig nicht die angezeigte Dosis des Medikaments einnehmen - so etwa die US-Amerikaner, sie "typically take less than half the prescribed doses". Dies kann im besseren Fall Heilung und Linderung verzögern und im schlimmsten Fall zu unerwünschten Verläufen der nicht korrekt behandelten Erkrankung führen.
Die so genannte Compliance oder auch Adhärenz zu sichern, stellt daher einen unbedingt notwendige, Bestandteil einer Arzneimittelbehandlung dar.
Wenn man den Glauben in die Wirksamkeit einfacher Appelle von Ärzten verloren hat, drängen sich eine Fülle von mehr oder weniger aufwändigen Alternativen auf. Dazu zählen insbesondere Beratungsgespräche, schriftliche Informationen und persönliche Telefonanrufe, Erinnerungsanrufe und zahlreiche weitere Formen der Supervision und Aufmerksamkeit, die häufig zumindest kurzfristigen Erfolg versprechen.
Ob diese Aktivitäten wirklich hilfreich sind, untersuchte eine Gruppe von ForscherInnen im Rahmen eines systematischen Cochrane-Reviews und veröffentlichte ihre Ergebnisse im Jahr 2008. Für kurz dauernde Arzneimittelbehandlungen scheinen einige der genannten Mittel hilfreich zu sein. Vier von 10 Interventionen aus 9 RCTs zeigten einen Effekt auf Adhärenz und wenigstens bei einem klinischen Ergebnis.
Für längerfristigere Behandlungen gibt es keine einfache und wirksame Intervention und auch nur einige der komplexeren Konzepte führen zu Verbesserungen bei den gesundheitlichen Ergebnisse der Behandlung. Sogar mit den wirksamsten Methoden für langfristige Behandlungen waren die Verbesserungen beim Gebrauch von Arzneimitteln oder der Gesundheit nicht groß. Gerade einmal 36 von 83 unterschiedlichen Interventionen aus 70 RCT's trugen zu Verbesserungen der Adhärenz bei. Am Ende waren es aber nur noch 25 dieser Interventionen, die mindestens ein Behandlungsergebnis verbesserten.
Mehrere der reviewten randomisierten kontrollierten Studien zeigten aber auch, dass die mündliche Konfrontation von Patienten mit unerwünschten Wirkungen ihrer Medikamente bzw. ihrer ungenügenden Adhärenz nicht ihren problematischen Umgang mit ihren Arzneimitteln berührt.
Beinahe alle der Interventionen, die für langfristige Versorgung wirksam waren, waren komplexer Natur. Sogar die wirksamsten Interventionen führten aber nicht zu großen Verbesserungen bei der Adhärenz und den Behandlungserfolgen.
Von dem Cochrane-Review "Interventions for enhancing medication adherence von Haynes RB, Ackloo E, Sahota N, McDonald HP, Yao X (Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD000011) gibt es kostenlos ein umfangreiches Abstract aber auch den 165 Seiten umfassenden Volltext.
Bernard Braun, 17.2.09
Fehlinformation und Manipulation - tiefe Einblicke in Marketingstrategien für Medikamente am Beispiel Gabapentin
 Behandlungsentscheidungen sollten zutreffende Informationen zugrundliegen. Verzerrte Informationen gefährden die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten. Am Beispiel der Substanz Gabapentin (auch als Neurontin bekannt) lässt sich eine umfassende Marketingstrategie auf Grundlage von Zeugenaussagen und firmeninternen Unterlagen nachvollziehen. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens musste die Firma Parke-Davis (Pfizer) über 8.000 Seiten interner Dokumente öffentlich zugänglich machen. Diese befinden sich in einer durchsuchbaren Datenbank im Drug Industry Document Archive der University of California, San Francisco. Das Gerichtsverfahren war auf Grund der Aussagen des Biologen David P. Franklin zustande gekommen, der im Jahr 1996 für 4 Monate für die Firma arbeitete. Die Zusammenfassung seiner gerichtlichen Zeugenaussage steht als Download zur Verfügung.
Behandlungsentscheidungen sollten zutreffende Informationen zugrundliegen. Verzerrte Informationen gefährden die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten. Am Beispiel der Substanz Gabapentin (auch als Neurontin bekannt) lässt sich eine umfassende Marketingstrategie auf Grundlage von Zeugenaussagen und firmeninternen Unterlagen nachvollziehen. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens musste die Firma Parke-Davis (Pfizer) über 8.000 Seiten interner Dokumente öffentlich zugänglich machen. Diese befinden sich in einer durchsuchbaren Datenbank im Drug Industry Document Archive der University of California, San Francisco. Das Gerichtsverfahren war auf Grund der Aussagen des Biologen David P. Franklin zustande gekommen, der im Jahr 1996 für 4 Monate für die Firma arbeitete. Die Zusammenfassung seiner gerichtlichen Zeugenaussage steht als Download zur Verfügung.
Gabapentin war im Jahr 1993 für die Behandlung einer bestimmten Art epileptischer Anfälle in den USA zugelassen worden. Der Umsatz stieg von 98 Millionen Dollar im Jahr 1995 auf fast 3 Milliarden Dollar im Jahr 2004. Den Anstieg erreichte die Firma durch erfolgreiches Marketing von Gabapentin für nicht zugelassene Indikationen (off-label-Gebrauch) wie Schmerz, Migräne und psychiatrische Diagnosen. Im Jahr 2004 bekannte sich Pfizer illegaler Marketingmethoden schuldig und bezahlte 430 Millionen Dollar Strafe.
Bereits 2006 hatten Steinman und Kollegen das hohe Maß an Systematik beschrieben, das Parke-Davis im Marketing von Gabapentin Mitte bis Ende der 1990er Jahre entwickelt hatte. Forschung, Veröffentlichungen und als unabhängig bezeichnete Fortbildungsprogramme wurden eingesetzt, angereichert mit den Aktivitäten von bezahlten Meinungsführern und Ärzten vor Ort (siehe Abbildung). Bei den meisten Bestandteilen der Kampagne blieb der werbende Charakter verborgen. Die Grenzen zwischen Forschung, Fortbildung und Werbung seien mehr als porös, stellten die Autoren damals fest.
In einem kürzlich erschienen Beitrag im New England Journal of Medicine fassen Landefeld und Steinman die Lehren aus dem Fall der Gabapentin-zusammen:
• Pharmazeutisches Marketing ist umfassend und strategisch, finanziell gut ausgestattet, als Fortbildung oder Forschung verkleidet, einflussreich, effektiv und unauffällig.
• Viele Personen und Institutionen haben die ethischen und gesetzlichen Probleme nicht beachtet - Mitarbeiter der Firma, Ärzte, Krankenhäuser und Fachgesellschaften und Aufsichtsbehörden. Offensichtlich wurde die illegalen Marketingmethoden für normal erachtet.
• Drastische Maßnahmen sind notwendig, um die Integrität der medizinischen Wissenschaft und Praxis zu bewahren und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Öffentliche Förderung pharmazeutischer Forschung.
Die Autoren weisen darauf hin, dass die Marketingmethoden für Gabapentin in den USA in erster deshalb strafbar waren, weil es sich um den off-label-Gebrauch handelte - für zugelassene Indikationen sind sie legal und weit verbreitet.
Landefeld CS, Steinman MA. The Neurontin Legacy - Marketing through Misinformation and Manipulation. N Engl J Med 2009;360:103-106. Auszug
Drug Industry Document Archive der University of California, San Francisco.
Aussage David P. Franklin
Steinman MA, Bero LA, Chren M-M, Landefeld CS. Narrative Review: The Promotion of Gabapentin: An Analysis of Internal Industry Documents. Ann Intern Med 2006;145(4):284-293. Volltext.
David Klemperer, 14.2.09
Leitliniengerechte Behandlung von Herzinsuffizienz: Ärzte benachteiligen Frauen, Ärztinnen aber Männer nicht!
 Wer Genderaspekte oder geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten für unmöglich oder eine etwas überzogene Wichtigtuerei von Frauenbeauftragten gehalten hat, wird in einer gerade veröffentlichten Studie über die Behandlung von Männern und Frauen, die an Herzinsuffizienz litten, durch Ärzte und Ärztinnen eines Besseren belehrt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob die Behandlung den Leitlinien der "European Society of Cardiology" entsprach. Nach diesen Leitlinien sollte bei manifester Herzinsuffizienz mit ACE-Hemmern, Angiotensinrezeptorblockern (ARB) oder Betablocker behandelt werden.
Wer Genderaspekte oder geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten für unmöglich oder eine etwas überzogene Wichtigtuerei von Frauenbeauftragten gehalten hat, wird in einer gerade veröffentlichten Studie über die Behandlung von Männern und Frauen, die an Herzinsuffizienz litten, durch Ärzte und Ärztinnen eines Besseren belehrt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob die Behandlung den Leitlinien der "European Society of Cardiology" entsprach. Nach diesen Leitlinien sollte bei manifester Herzinsuffizienz mit ACE-Hemmern, Angiotensinrezeptorblockern (ARB) oder Betablocker behandelt werden.
Bei der Untersuchung der Behandlung von 1.857 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz im Jahr 2006 durch 829 Ärzte von denen 65 % Allgemeinärzte, 27 % Internisten und 7 % Kardiologen waren, durch eine Forschergruppe an der Universität Homburg/Saar, gab es folgende relevante Ergebnisse:
• Erstens wurde auch in Behandlungseinrichtungen in städtischen Ballungszentren Ostdeutschlands eine bereits mehrmals erkannte Benachteiligung von Frauen bei der Diagnostik und Therapie von kardiologischen Erkrankungen nachgewiesen. Die Frauen in der untersuchten Gruppe erhielten bei vergleichbarer Krankheitssituation weniger der empfohlenen Medikamente und die Mittel, die sie verordnet bekamen, waren dann niedriger dosiert als bei Männern.
• Neu war, dass dies umso ausgeprägter ist, wenn der verordnende Arzt ein Mann war. ACE-Hemmer oder Angiotensinrezeptorblocker wurden signifikant seltener verordnet, wenn eine weibliche Patientin von einem männlichen Arzt behandelt wurde. Völlig anders und erheblich leitlinienkonformer fielen die Verordnungen aus, wenn ein männlicher Patient von einer Ärztin behandelt wurde. Dann waren auch die verordneten Dosen am höchsten.
• In einer multivariaten Analyse der die medikamentöse Behandlung von Herzinsuffizienz-PatientInnen beeinflussenden Krankheitsfaktoren und soziodemografischen Charakteristika waren das Geschlecht der Patienten und das der Ärzte die stärksten und jeweils statistisch höchst signifikanten Risikofaktoren.
• Zum widerholten Male erwiesen sich Ärztinnen in dieser Studie nicht nur als kommunikativer (vgl. dazu bereits die Untersuchung "Phycisian gender effects in medical communication" von Roter et al in JAMA 2002: 288: 756-764) aus dem Jahr 2002, die komplett kostenlos erhältlich ist) oder mehr an psychosozialen Problemen ihrer PatientInnen interessiert, sondern es konnte das erste Mal nachgewiesen werden, auch eine medikamentöse Behandlung "is more complete when female phycisians are taking care of patients." Weder bei der Verordnung noch der Dosierung behandelten Ärztinnen ihre Patienten bei ACE-Hemmern und ARBs nach Geschlecht unterschiedlich - ganz im Gegensatz zu ihren Kollegen.
Trotz einiger selbst eingeräumter methodischer Schwächen (z.B. Selektion "guter" Ärzte und Patienten, Beobachtungsstudie) sollte in weiteren Studien nach Erklärungen für diesen Zusammenhang von Geschlecht beider Akteursgruppen und Behandlungsqualität gesucht werden. Der Hinweis, Ärztinnen würden häufiger in Teilzeit arbeiten und dadurch produktiver arbeiten und eine höhere Zufriedenheit ihrer Patienten auslösen, weisen möglicherweise in die richtige Richtung, sind aber noch bei weitem zu eindimensional.
Der Aufsatz "Influence of gender of physicians and patients on guideline-recommended treatment of chronic heart failure in a cross-sectional study" von Magnus Baumhäkel, Ulrike Müller und Michael Böhm wurde am 21. Januar 2009 im Onlineteil des "European Journal of Heart Failure" veröffentlicht. Den interessierten LeserInnen steht ein Abstract oder der komplett fünfseitige Aufsatz in einer PDF-Version kostenlos zur Verfügung.
Bernard Braun, 31.1.09
§ 73 Abs. 8 SGB V: Umfassende Arzneimittel-Informationspflichten von Kassenärztlichen Vereinigungen und GKV gegenüber Ärzten.
 Der § 73 Abs.8 SGB V verpflichtet "die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die Vertragsärzte auch vergleichend über preisgünstige verordnungsfähige Leistungen und Bezugsquellen, einschließlich der jeweiligen Preise und Entgelte zu informieren sowie nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse Hinweise zu Indikation und therapeutischen Nutzen zu geben. ... In den Informationen und Hinweisen sind Handelsbezeichnung, Indikationen und Preise sowie weitere für die Verordnung von Arzneimitteln bedeutsame Angaben insbesondere auf Grund der Richtlinien (des Gemeinsamen Bundesausschuss) nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in einer Weise anzugeben, die unmittelbar einen Vergleich ermöglichen; dafür können Arzneimittel ausgewählt werden, die einen maßgeblichen Anteil an der Versorgung der Versicherten im Indikationsgebiet haben. Die Kosten der Arzneimittel je Tagesdosis sind nach den Angaben der anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikation anzugeben."
Der § 73 Abs.8 SGB V verpflichtet "die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die Vertragsärzte auch vergleichend über preisgünstige verordnungsfähige Leistungen und Bezugsquellen, einschließlich der jeweiligen Preise und Entgelte zu informieren sowie nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse Hinweise zu Indikation und therapeutischen Nutzen zu geben. ... In den Informationen und Hinweisen sind Handelsbezeichnung, Indikationen und Preise sowie weitere für die Verordnung von Arzneimitteln bedeutsame Angaben insbesondere auf Grund der Richtlinien (des Gemeinsamen Bundesausschuss) nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in einer Weise anzugeben, die unmittelbar einen Vergleich ermöglichen; dafür können Arzneimittel ausgewählt werden, die einen maßgeblichen Anteil an der Versorgung der Versicherten im Indikationsgebiet haben. Die Kosten der Arzneimittel je Tagesdosis sind nach den Angaben der anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikation anzugeben."
Nachdem Arzneimittel sowohl einen größeren Teil der Leistungsausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung kosten als die direkten Leistungen der niedergelassenen Ärzte (Anteil Arzneimittel 2007=19,2 % und Leistungen ambulant tätiger Ärzte=16 %) als auch eine Fülle von Wirksamkeitsschwächen oder gar unerwünschten Wirkungen mit sich bringen, ist jeder Beitrag zur kritischen und praxisgeeigneten Transparenz für verordnende Ärzte von großer finanzieller und gesundheitlicher Bedeutung.
Dazu zählt daher auch das im Internet von allen Interessenten nutzbare Angebot "Wirkstoff AKTUELL", das die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Zusammenarbeit mit der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft erstellt. Mit "Wirkstoff AKTUELL" kommt die KBV ihrem "gesetzlichen Auftrag nach, in dem wir Empfehlungen zur wirtschaftlichen Verordnungsweise unter Bewertung des therapeutischen Nutzens des jeweiligen Arzneimittels aussprechen. Unseren Hinweisen liegt eine Bewertung von für das Arzneimittel relevanten Studien und Leitlinien zugrunde."
Diese Hinweise erfolgen in sehr knapper Weise. Dies gilt z.B. auch für die jüngste Wirkstoff-Information zu "Strontiumranelat (Protelos®)", die ihre 2 Seiten mit der folgenden Empfehlung enden lässt: "Für den Wirkstoff Strontiumranelat ist, auch unter Berücksichtigung des anderen Wirkmechanismus, für die Behandlung der kein zusätzlicher Nutzen hinsichtlich der fraktursenkenden Wirkungen im Vergleich zu den Bisphosphonaten belegt."
Angesichts der vielen gleichzeitig in einschlägigen nationalen und internationalen Empfehlungen (hier ist z.B. an die Empfehlungen der "Food and Drug Administration (FDA)" der USA zu denken) enthaltenen Hinweisen auf problematische Wirkstoffe oder Arzneimittel, fällt die bisherige Anzahl von Hinweisen auf der KBV-Seite recht karg aus, ohne dass dafür eine Erklärung gegeben wird. Dies birgt das Risiko in sich, dass informationssuchende Ärzte "für alle Fälle" auch noch in drei, vier anderen Quellen recherchieren müssen, um das Gefühl zu erhalten halbwegs den Überblick über potenziell problematische Verordnungen zu besitzen. Es birgt aber auch das Risiko in sich, dass Ärzte angesichts ihrer knappen Zeitressourcen in gar keiner Infoquelle mehr systematisch und regelmäßig suchen.
Über die Home-Seite von "Wirkstoff AKTUELL" gelangt man leicht zu den chronologisch geordneten und kostenlosen Einzelbeiträgen wie etwa dem über den bei postmenopausaler Osteoporose nicht zusätzlich nützlichen Wirkstoff Strontiumranelat.
Bernard Braun, 27.1.09
Trugbilder der Wirklichkeit für Marketingzwecke - das Beispiel der "Neuroleptika der zweiten Generation"
 Medikamente zur Behandlung der Schizophrenie werden als Neuroleptika oder auch als Antipsychotika bezeichnet. Sie werden nach chemischer Struktur und Wirkstärke (pharmakologische Potenz) unterteilt sowie nach Substanzen der ersten und zweiten Generation, wobei erstere auch als "typische" und letztere als "atypische" Neuroleptika bezeichnet werden. Ihre Wirksamkeit entfalten sie über die Beeinflussung von Botenstoffen im Gehirn, hauptsächlich Dopamin. Psychotische Symptome wie Wahn, Halluzinationen, Verfolgungsängste und Erregungszustände können gebessert werden. Dem stehen eine Reihe unerwünschter Wirkungen gegenüber, wie z.B. Bewegungsstörungen(extrapyramidale Störungen und Dyskinesien) und Gewichtszunahme.
Medikamente zur Behandlung der Schizophrenie werden als Neuroleptika oder auch als Antipsychotika bezeichnet. Sie werden nach chemischer Struktur und Wirkstärke (pharmakologische Potenz) unterteilt sowie nach Substanzen der ersten und zweiten Generation, wobei erstere auch als "typische" und letztere als "atypische" Neuroleptika bezeichnet werden. Ihre Wirksamkeit entfalten sie über die Beeinflussung von Botenstoffen im Gehirn, hauptsächlich Dopamin. Psychotische Symptome wie Wahn, Halluzinationen, Verfolgungsängste und Erregungszustände können gebessert werden. Dem stehen eine Reihe unerwünschter Wirkungen gegenüber, wie z.B. Bewegungsstörungen(extrapyramidale Störungen und Dyskinesien) und Gewichtszunahme.
Die erste Generation der Neuroleptika wurde in den 1950-er-Jahren entwickelt, wie z.B. Chlorpromazin, Perphenazin und Haloperidol. Ab den 1970-er Jahren wurden neu entwickelte Substanzen als zweite Generation von Neuroleptika eingeführt mit dem Versprechen zusätzlicher positiver und weniger unerwünschter Wirkungen, wie z.B. Clozapin, Amisulprid, Olanzapin und Risperidon.
Seit 2005 werden die Medikamente der zweiten Generation in Deutschland häufiger verordnet als die hochpotenten Neuroleptika der ersten Generation (Arzneiverordnungsreport 2008, S. 795).
Eine internationale Arbeitsgruppe ist jetzt in einer Meta-Analyse der Frage der Überlegenheit der Neuroleptika der zweiten Generation nachgegangen mit folgendem Ergebnis:
• Es existiert kein gemeinsames Merkmal, in dem sich die Substanzen der zweiten von der ersten Generation unterscheiden. Der Begriff "atypische Neuroleptika" entbehrt damit einer sachlichen Grundlage.
• Als Gruppe haben die Medikamente der zweiten Generation kein günstigeres Profil von erwünschten und unerwünschten Wirkungen. Insbesondere wirken sie nicht besser auf die negativen Symptome.
• Einzelne Substanzen sind bezüglich einzelner Zielparameter günstiger als andere, so z.B. das Doxepin bezüglich einer bestimmten Form von Bewegungsstörungen.
Für die Meta-Analyse wurden neun Substanzen der zweiten mit Substanzen der ersten Generation verglichen, zumeist mit Haloperidol und Perphenazin. Dafür wurden 150 doppelblinde randomisierte kontrollierte Studien mit 21.533 Teilnehmern ausgewertet. Beurteilt wurde die Gesamtwirksamkeit, positive, negative und depressive Symptome, Lebensqualität, extrapyramidale Störungen, Gewichtszunahme und Sedierung.
Die Begriffe "zweite Generation von Neuroleptika" und "atypische Neuroleptika" erweisen sich somit als eine Erfindung, mit der die Industrie ein erfolgreiches Marketing für die neuen und teureren Medikamente betrieb, merken Peter Tyrer und Tim Kendall in einem Kommentar an.
Durch eine Reihe von Tricks wurde von vornherein sichergestellt, dass die neuen Medikamente im Vergleich besser abschnitten. So wurden die neuen Substanzen in meisten Fällen mit Haloperidol verglichen, einem hochpotenten Neuroleptikum der ersten Generation mit vergleichsweise starken unerwünschten Wirkungen. Weiterhin wurden die Substanzen der ersten Generation hoch dosiert, was zu einer höheren Rate unerwünschter Wirkungen führt. Neuroleptika der ersten Generation mit günstigerem Profil wurden erst gar nicht in die Vergleiche einbezogen und Studien mit unerwünschten Ergebnissen wurden nicht veröffentlicht. Es sei nicht schwer zu erkennen - so die Kommentatoren - dass die Studien dem Marketing dienen und nicht der Klärung des tatsächlichen Nutzens für die Patienten.
Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. The Lancet 2009;373:31-41
Zusammenfassung
Tyrer P, Kendall T. The spurious advance of antipsychotic drug therapy. The Lancet 2009;373:4-5
Kommentar, Download kostenpflichtig
David Klemperer, 4.1.09
Reizdarmsyndrom: Flohsamen, Korkholzbaumblätter oder gar Pfefferminzöl als wirksame Mittel?!
 Die Prävalenz von Reizdarmsyndromen liegt in Bevölkerungsstudien zwischen 5 und 20 % und ist als oft chronifizierte und anfallweise wiederkehrende Störung des Verdauungssystems nicht nur unangenehm, sondern auch schmerzhaft und schwer zu behandeln.
Die Prävalenz von Reizdarmsyndromen liegt in Bevölkerungsstudien zwischen 5 und 20 % und ist als oft chronifizierte und anfallweise wiederkehrende Störung des Verdauungssystems nicht nur unangenehm, sondern auch schmerzhaft und schwer zu behandeln.
Zur Behandlung des Reizdarmsyndroms empfehlen die hier meist therapeutisch tätigen Allgemeinmediziner initial die vermehrte Aufnahme von Ballaststoffen, von denen Wirkungen auf die Verdauungszeiten erwartet werden. Sollten die Beschwerden anhalten, gab es bis vor kurzem eine Reihe von meist teuren Arzneimittel, die aber aus Sicherheitsgründen vom Markt zurückgezogen wurden. Daher gab und gibt es einen starken Druck, andere sichere und wirksame Behandlungsalternativen zu finden.
Diese wurden zum Teil bereits seit längerem in drei unterschiedlichen Gruppen von Stoffen gesehen und auch therapeutisch eingesetzt. Wie so oft geschah dies aber ohne hinreichende wissenschaftliche Evidenz über ihre Wirksamkeit bzw. beruhten entsprechende Annahmen und Vermutungen auf älteren, methodisch schwachen Untersuchungen.
Ein systematischer Review bzw. eine Metananalyse von randomisierten kontrollierten Studien, in denen die Wirksamkeit einer bestimmten Pflanzenfaser (12 RCTs), krampfstillender Medikamente (22 RCTs) und von Pfefferminzöl (4 RCTs) gegen jeweilige Placebos oder zum Teil auch gegen keine Behandlung untersucht wurde, liefert jetzt eine Reihe überraschender Ergebnisse.
Auch wenn Pfefferminzöl bisher weder in den Leitlinien des "National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)" noch der "British Society of Gastroenterology" als wirksames Mittel gegen Reizdarmsymptome auftaucht, zeigen die gerade im "British Medical Journal (BMJ)" veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie, dass dieses Öl genauso wirksam ist wie Mittel, die bestimmte Pflanzenfasern (hier besonders Ispaghula oder Flohsamen, der die Samenhülle der indischen Ispaghula-Pflanze enthält) oder krampfstillende Medikamente (hier in erster Linie der Wirkstoff Hyoscine, der u.a. aus den Blättern von Korkholzbäumen [Duboisia] gewonnen wird).
Alle diese Stoffe senken das relative Risiko eines anhaltenden Reizdarmsyndroms beträchtlich: Es betrug bei allen Flohsamenpräparaten zusammen 0.87 mit einem 95% Konfidenzintervall zwischen 0.76 und 1.00 (bei Ispaghula 0,78), bei allen krampfstillenden Medikamenten 0.68 (0.57 to 0.81) (das Risiko schwankte je nach Mittel zwischen 0,55 und 0,68) und bei Pfefferminzöl 0.43 (0.32 to 0.59).
Für die Beurteilung der Wirksamkeit ist aber auch die so genannte "number needed to treat", d.h. die Anzahl von Menschen, die man behandeln muss, um einem Menschen helfen zu können, wichtig. Sie ist bei allen hier untersuchten Mitteln relativ niedrig, schwankt aber zwischen 11 bei Flohsamenpräparaten, 5 bei krampfstillenden Arzneimitteln und 2,5 bei Pfefferminzöl.
Egal was die weitere Pharmaforschung noch an neuen und dann auch möglicherweise sichereren Arzneimitteln bescheren wird, sollten, so die AutorInnen der aktuellen Studie, die drei traditionellen und meist verschreibungsfrei erhältlichen Mittel als gesichert wirksam und im Fall des Pfefferminzöls überhaupt in die nationalen Leitlinien zum Reizdarmsyndrom aufgenommen werden.
Auch wenn möglicherweise konkurrierende Interessen in dieser Studie nach Wahrnehmung des Autors dieses Textes keine Rolle gespielt haben, zeigt die Lektüre der Angaben zu den "Competing interests" der Auoren dieses Aufsatzes die weltweit engen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Pharmaherstellern und einigen -forscherinnen in aller Ausführlichkeit: "NJT (Autoreninitialen - siehe unten) has received consultancy fees from Procter and Gamble, Lexicon Genetics, Astellas Pharma US, Pharma Frontiers, Callisto Pharmaceuticals, AstraZeneca, Addex Pharma, Ferring Pharma, Salix, M GI Pharma, McNeil Consumer,Microbia, Dynogen, Conexus, Novartis, and Metabolic Pharmaceuticals, and has received research support from Novartis, Takeda, GlaxoSmithKline, Dynogen, and Tioga. EMMQ has received consultant's and speaker's bureau fees from Nycomed, Boehringer Ingelheim, Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, and Prometheus, and holds equity in Alimentary Health. PM holds a chair at McMaster University partly funded by an unrestricted donation by AstraZeneca, and has received consultant's and speaker's bureau fees from AstraZeneca, AxCan Pharma, Nycomed, and Johnson and Johnson."
Dass die Therapie des Reizdarmsyndroms für die Pharmaindustrie zumindest nicht uninteressant war (!) zeigen spezielle Aufklärungskampagnen, die vor einigen Jahren insbesondere "down under" Furore machten: Wie das pharmakritische "Arznei-Telegramm" bereits 2002 (a-t 7/2002; 33: 71-2) berichtete, gehörte zu Beginn dieses Jahrzehnt das Reizdarmsyndrom zu einem der Anwendungsfelder für das so genannte "disease mongering" (Handeln mit Krankheiten). Konkret wurde damals ein dreijähriges Schulungsprogramm in Australien bekannt, das dieses Syndrom als eine anerkannte Erkrankung etablieren sollte und damit die Markteinführung von wirkidentischen Medikamenten der Firmen GlaxoSmithKline und Novartis systematisch und durch die Beeinflussung von Ärzten, Selbsthilfeorganisationen (insbesondere in den USA) und Patienten fördern sollte. Das Medikament Alosetron wurde aber zur Behandlung von Reizdarmsyndromen bereits 2000 in den USA wegen schwerer Nebenwirkungen vom Markt genommen.
Der komplette 12 Seiten lange Aufsatz "Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis." von Alexander C Ford, Nicholas J Talley (NJT), Brennan M R Spiegel, Amy E Foxx-Orenstein, Lawrence Schiller, Eamonn M M Quigley (EMMQ) und Paul Moayyedi (PM) ist im BMJ am 18. November 2008 erschienen und frei erhältlich.
Bernard Braun, 21.12.08
Abnehmen durch Einwerfen!? Gewichtsreduktion mit Medikamenten zwischen Euphorie, schweren Nebenwirkungen und Verbot.
 Während einer der seit Jahren wegen erheblicher Nebenwirkungen kritisierten Appetithemmer, nämlich der anfänglich euphorisch zum bequemen Ersatz für Verhaltensänderungen gegen schweres Übergewicht erkorene Cannabis-Antagonist Rimonabant (Acomplia®) im Oktober 2008 wegen starker psychiatrischer Nebenwirkungen vom Markt genommen werden musste und auch der Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Sibutramin (Reductil®) aufgrund unerwünschter Wirkungen (wie Blutdruckanstieg, kardiovaskuläre Komplikationen) von der Markteinführung in den USA an schon immer umstritten war - vgl. dazu eine Zusammenfassung im "Arznei-Telegramm" im September 2003, steht der nächste Wunderstoff - ebenfalls ein Hemmer der Wiederaufnahme von bestimmten körpereigenen Boten- und Regulierungsmitteln - vor der Tür.
Während einer der seit Jahren wegen erheblicher Nebenwirkungen kritisierten Appetithemmer, nämlich der anfänglich euphorisch zum bequemen Ersatz für Verhaltensänderungen gegen schweres Übergewicht erkorene Cannabis-Antagonist Rimonabant (Acomplia®) im Oktober 2008 wegen starker psychiatrischer Nebenwirkungen vom Markt genommen werden musste und auch der Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Sibutramin (Reductil®) aufgrund unerwünschter Wirkungen (wie Blutdruckanstieg, kardiovaskuläre Komplikationen) von der Markteinführung in den USA an schon immer umstritten war - vgl. dazu eine Zusammenfassung im "Arznei-Telegramm" im September 2003, steht der nächste Wunderstoff - ebenfalls ein Hemmer der Wiederaufnahme von bestimmten körpereigenen Boten- und Regulierungsmitteln - vor der Tür.
Noch nicht als Arzneimittel zugelassen, d.h. noch vor der gesetzlich vorgeschriebenen Phase III der klinischen Versuche vor einer Zulassungsentscheidung, beflügeln die ersten seiner im wissenschaftlich anerkannten britischen Medizinjournal "The Lancet" veröffentlichten Wirksamkeitsdaten aus Dänemark die diversen Begehrlichkeiten.
Nach den Ergebnissen des Studienaufsatzes "Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial" von Arne Astrup, Sten Madsbad, Leif Breum, Thomas J Jensen, Jens Peter Kroustrupund Thomas Meinert Larsen (The Lancet, Volume 372, Issue 9653: 1906 - 1913, 29. November 2008) soll der Wirkstoff Tesofensin bei Übergewichtigen mit einem Body Mass Index (BMI) zwischen 30 und 40 einen doppelt so hohen Gewichtsverlust verursachen wie die bisherigen Appetitzügler.
In einer randomisierten, doppelt-blinden und placebo-kontrollierten Phase-II-Studie in fünf dänischen Adipositas-Management-Zentren wurde der Wirkstoff bei zu Beginn 203 und am Ende noch 161 teilnehmenden schwer übergewichtigen Personen 24 Wochen lang gegen Placebos getestet. Außerdem variierte noch die Menge des Wirkstoffs. Alle TeilnehmerInnen erhielten schließlich nach einer zweiwöchigen Vorbereitungsphase eine kalorienreduzierte Diät. Nach den 24 Wochen hatten die Patienten, die Tesofensin erhielten, nicht nur doppelt so viel Gewicht abgebaut wie die Einnehmer von Sibutramin (Reductil) und Rimonabant (Acomplia). Je mehr vom neuen Wirkstoff eingenommen wurde desto höher waren außerdem die Gewichtsverluste: Ľ mg des Wirkstoffs führte zu einem Verlust von 6,7 kg und 1 mg zu einem von 12,8 kg Körpergewicht.
In der Studiengruppe, die lediglich die kalorienreduzierte Diät und ein Placebo erhielt, verringerte sich das Gewicht nach 24 Wochen zwar auch, aber "nur" um 2 %.
Abgesehen davon, dass vor einer möglichen Zulassung noch Phase-III-Studien durchgeführt werden müssen, gibt es aber auch in den bisherigen Ergebnissen eine Reihe frühzeitiger Hinweise auf Schattenseiten auch dieses Ersatzmittels für unbequemere und individuell aufwändigere Methoden, Fettsüchtigkeit zu reduzieren.
So werden in dem Aufsatz als unerwünschte Nebenwirkungen trockener Mund, Übelkeit, Obstipation, harte Stuhlgänge, Durchfall und Schlaflosigkeit berichtet. In einer Kombination erhöhte sich auch die Anzahl der Herzschläge. Über Langzeit-Nebenwirkungen und deren Folgeeffekte lassen sich nach der kurzen Untersuchungszeit keine belastbaren Angaben gewinnen. Unklar bleibt auch, warum 21 % der ursprünglichen TeilnehmerInnen die Studie bereits innerhalb des Zeitraums von 24 Wochen verlassen haben. Wichtig wird außerdem noch sein, ob sich der vergleichsweise hohe Gewichtsverlust auch über mehr als 6 Monate hält, ein Jo-Jo-Effekt einen Teil der Wunderwirkungen zurückholt oder gar weitere Nebenwirkungen auftreten.
Ob gegen alle diese euphoriebremsenden Hinweise schließlich doch die Einstellung gewinnt, man müsse gegen die "Volksseuche Übergewicht" auch medikamentös vorgehen, kann jedermann durch die aufmerksame Lektüre von Fachjournalen aber vor allem auch der publikumswirksamen und werbeeinnahmenabhängigen Gesundheits-Yellow-Press-Blätter selbst ab sofort erkunden.
Von dem Aufsatz "Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial" gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 15.12.08
Warum kostet ein Medikament in Heraklion nur ein Viertel so viel wie in Husum? 27 Arznei-Preis- und Erstattungssysteme in der EU!
 Zu den geläufigsten ersten aber auch meist letzten Sätzen von Debatten über Arzneimittelpreise und -ausgaben in Deutschland gehört die Feststellung "man habe das Mittel X im letzten Kretaurlaub für ein Viertel des hiesigen Preises" erhalten. Befinden sich Apotheker oder Pharmareferenten im Raum, gibt es sofort jede Menge rechtfertigende Hinweise auf die in Deutschland kostspielige Versorgungsdichte, die bessere Qualitätssicherung, die höhere Steuerbelastung und last not least die Forschungsaufwände, die es ja schließlich zu refinanzieren gälte.
Zu den geläufigsten ersten aber auch meist letzten Sätzen von Debatten über Arzneimittelpreise und -ausgaben in Deutschland gehört die Feststellung "man habe das Mittel X im letzten Kretaurlaub für ein Viertel des hiesigen Preises" erhalten. Befinden sich Apotheker oder Pharmareferenten im Raum, gibt es sofort jede Menge rechtfertigende Hinweise auf die in Deutschland kostspielige Versorgungsdichte, die bessere Qualitätssicherung, die höhere Steuerbelastung und last not least die Forschungsaufwände, die es ja schließlich zu refinanzieren gälte.
Aber nicht nur die Preise von Arzneimitteln variieren allein schon zwischen den EU-Mitgliedsstaaten beträchtlich, sondern auch schon die Abläufe und Kriterien, mit und nach denen Arzneimittelpreise und die Erstattung dieser Ausgaben festgelegt und geregelt werden, weisen erhebliche Unterschiede auf.
Hinzu kommt, dass die Ausgaben für Arzneimittel respektive deren Bändigung oder gar Senkung zu den Kernelementen aller Gesundheitsreformen in Deutschland aber auch anderen Ländern gehört.
Kein Wunder, wenn z.B. in der Gesetzlichen Krankenversicherung seit einigen Jahren der Anteil der Ausgaben für Arzneimittel über denen für die gesamte ambulante ärztliche Behandlung liegt und der Medikamentenbereich zu den wenigen Leistungsbereichen mit scheinbar unaufhaltsamen Aufwärtstendenzen gehört. Entsprechend rasch ändern sich auch die jeweiligen Patentrezepte und -mittel und so kennen die meisten BürgerInnen weder Festbeträge, Rabattverträge, Arzneimittelrichtlinien, Positiv- oder Negativlisten, 4. Phase, aut idem und Generika im DEtail noch können sie diese und noch wesentlich mehr Instrumente und Methoden verstehen oder gar bewerten.
Wem dieser Zustand ein Graus ist, wer einen Teil der Hintergründe von Preisunterschieden zwischen Heraklion und Husum wirklich verstehen will, wer etwas Zeit hat und englisch kann, findet in dem im Mai 2008 veröffentlichten 187 Seiten umfassenden "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)"-Report und seinen diversen Anhängen und Anlagen die entsprechenden Informationen.
Es handelt sich um die Ergebnisse eines von der EU-Kommission geförderten Netzwerks von 52 Institutionen - Behörden und weitere wichtige Institutionen im Arzneimittelbereich - aus 31 Ländern der gesamten EU und darüber hinaus.
Das Projektmanagement erfolgte durch die Gesundheit Österreich GmbH, Geschäftsbereich Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen / Austrian Health Institute (GÖG/ÖBIG) und das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die TeilnehmerInnen schufen mit detaillierten Länderberichten (»PPRI Pharma Profiles«) die Basis für eine vergleichende Analyse der Systembesonderheiten und für einen Austausch über die Erfahrungen mit länderspezifischen Maßnahmen.
Der PPRI-Report stellt vergleichend umfangreiche Informationen zu folgenden Aspekten der Arzneimittelversorgung vor:
• Gesundheitssystemtypen, demographische und ökonomische Entwicklung als Hintergrundsbedingungen
• Grundzüge des pharmazeutischen Systems (Organisation, Erhältlichkeit von Arzneimitteln, Ausgabenstrukturen, "market players")
• Systeme der Preisfindung/-bildung
• Systeme der Erstattung von Arzneimittelaufwändungen (reimbursement)
• Systeme zum rationalen Gebrauch von Arzneimitteln (z.B. Budgets, Verordnungsleitlinien, Patienteninformation).
Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit den aus diesen Vergleichen gelernten Lektionen. Darunter befinden sich beispielsweise folgende:
• In 27 verglichenen Ländern gibt es 27 verschiedene Preis- und Erstattungssysteme.
• Länderspezifische Bedingungen erfordern offensichtlich primär länderspezifische Lösungen.
• Auch wenn in allen Ländern höchstes Interesse besteht, mehr über andere Länder zu lernen, existieren massive Verständnis-, Verstehens- und damit Verständigungsprobleme.
• Die wechselseitige Transparenz sollte verstetigt werden. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil kein Jahr ohne eine mehr oder weniger gravierendere Veränderung im Arzneimittelpolitikbereich vergangen ist und vergehen wird.
• Einigen Ländern, z.B. Schweden und den Niederländen, gelang es in diesem Jahrzehnt sogar, das Wachstum der Arznbeimittelausgaben unter 5 % pro Jahr zu halten.
• Eine erfolgreiche Kostendämpfungspolitik bei den Arzneimitteln muss nicht notwendigerweise zulasten der Patienten (z.B. durch Privatisierung der Ausgaben für die aus der Kassenerstattung genommenen Arzneimitteln) gehen.
• Ebenso ist es möglich, gleichzeitig Kosten zu senken und Qualität zu sichern.
• Eine verbreitete Inkompatibilität der nationalen Daten und Indikatoren machen internationale Vergleiche immer noch schwierig.
• Um den so genannten "pendulum effect" zu vermeiden, was meint, dass einzelne oder alle Beteiligten nach dem Wirksamwerden eines neuen Instrument mehr oder weniger schnell Schlupflöcher gegen das Gesetz entdecken, muss das Monitoring in kürzeren Abständen durchgeführt und inhaltlich stetig verfeinert werden.
• Mit der folgenden Lehre kommen wir zum Einstieg dieses Textes und einem wirklichen aber meistens ignorierten oder unterschätzten Grunddilemma gerade einer besonders aktiven Arzneimittelpolitik zurück: "Adjoint consensual policy environment tends to have a positive impact on the acceptance of decisions. The best reform is likely to fail if there is insecurity and lack of understanding among key stakeholders (in particular patients, prescribers, pharmacists and pharmaceutical industry) who consequently either ignore the measures or oppose them."
Der komplette "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)"-Report" ist kostenlos erhältlich. Die ebenfalls umfangreichen und ähnlich gegliederten Länderberichte, die so genannten "Pharma Profiles" können ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden. Dazu gehören natürlich auch 74 Seiten Deutschland-Pharma Profiles.
Bernard Braun, 14.12.08
Vitamine C und E, Selen und vermutlich viele antioxidative Stoffe ohne präventive Wirkung bei Prostatakrebs. PSA-Testprobleme!
 Männer, die Sorge haben, an einer der häufigsten Krebsarten bei Männern, dem Prostatakrebs zu erkranken und glauben, eine drohende Erkrankung durch den so genannten PSA-Test frühstmöglich entdecken zu können oder gar aktiv etwas mit Nahrungsergänzungsmitteln tun zu können, um ihr Risiko zu vermindern, haben es in diesen Tagen schwer. Unabhängig von den Details dreier dafür verantwortlichen Studien zeigen sich bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Dilemmata seriöser Versorgungsforschung.
Männer, die Sorge haben, an einer der häufigsten Krebsarten bei Männern, dem Prostatakrebs zu erkranken und glauben, eine drohende Erkrankung durch den so genannten PSA-Test frühstmöglich entdecken zu können oder gar aktiv etwas mit Nahrungsergänzungsmitteln tun zu können, um ihr Risiko zu vermindern, haben es in diesen Tagen schwer. Unabhängig von den Details dreier dafür verantwortlichen Studien zeigen sich bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Dilemmata seriöser Versorgungsforschung.
Zum einen geht es um die seit einiger Zeit in die Öffentlichkeit gelangenden Ergebnisse der zur Zeit weltweit größten Prostatakrebs-Studie "SELECT" (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), an der in den USA, Puerto Rico und Kanada 35.534 55-jährige und ältere Männer (unter den rund 15 % der Gruppe umfassenden afroamerikanischen Teilnehmern waren auch schon 50-Jährige, da das Prostatarisiko in dieser Subgruppe früher und häufiger auftritt) teilnehmen. Ausgangspunkt der Studie und daher auch der Namensgeber und die Ausgangspunkte für das Akronym, waren zwei Studien aus 1998 und 1996, die zeigten, dass mit der gezielten Ein- oder Aufnahme der beiden Ernährungsergänzungsmittel Selen und Vitamin E das Risiko, an Prostatkrebs zu erkranken um bis zu 32 oder gar sagenhafte 52 % Prozent gesenkt werden konnte.
Diese Ergebnisse wurden so ernst genommen, dass sie in einer seit 2001 wesentlich größeren und gezielt (in der 1998 in Finnland durchgeführten Studie bei 29.133 männlichen Rauchern sollte eigentlich nach der Präventivkraft von Vitamin E gegen Lungenkrebs geforscht werden; heraus kam u.a. die 32%-Reduktion von Prostatakrebs) gebildeten Studiengruppe und mit besserer Methodik im Rahmen der SELECT-Studie überprüft werden sollten. Diese Studie ist im Wesentlichen vom National Cancer Institute (NCI), einem der U.S. National Institutes of Health finanziert und wird von der international vernetzten Forschungsgruppe Southwest Oncology Group (SWOG) durchgeführt.
Das erste (Zwischen-)Ergebnis der Wirkungskontrolle der beiden einzeln oder kombiniert aufgenommenen Stoffe gegen verschiedene Placebogruppen gleicht daher einer sehr harten Landung auf dem Boden der Wirklichkeit. Es lautet: Für keinen der Stoffe gibt es im Vergleich mit Placebos einen nachweisbaren bzw. statistisch signifikanten Nutzen. Da es zusätzlich statistisch ebenfalls nicht signifikante Hinweise auf möglicherweise unerwünschte Effekte gibt, empfehlen die SELECT-Verantwortlichen ihren Teilnehmern, künftig auf den systematischen Verzehr dieser Stoffe zu verzichten. Zu den allerdings bisher durchweg nicht statistisch signifikanten unerwünschten Wirkungen zählt eine leichte Erhöhung des Prostatakrebsrisikos bei den Personen, die ausschließlich Vitamin E einnahmen und eine ebenfalls leichte Erhöhung eines neu auftretenden Diabetesrisikos in der nur Selen einnehmenden Teilnehmergruppe.
Die Wissenschaftler versandten darauf deutlich vor dem geplanten Ende der Studie eine schriftliche Mitteilung an die Studienteilnehmer, in der sie diese Ergebnisse erläuterten, ihnen rieten die Einnahme von Selen und Vitamin E zu stoppen und ihnen trotzdem die Teilnahme an weiteren Prostatauntersuchungen und PSA-Tests anboten.
Einer der Studienleiter, Eric Klein, fasste den nunmehr neu fokussierten Nutzen des Fortgangs der Studie so zusammen: "As we continue to monitor the health of these 35.000 men, this information may help us understand why two nutrients that showed strong initial evidence to be able to prevent prostate cancer did not do so."
In zwei großen peer-reviewten Publikationen in der neuesten Ausgabe des Medizinjournals JAMA vom 9. Dezember 2008 werden diese Ergebnisse zum einen voll bestätigt und inhaltlich noch beträchtlich erweitert.
Das kostenlos erhältliche Abstract des Aufsatzes "Effect of Selenium and Vitamin E on Risk of Prostate Cancer and Other Cancers: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)" von Scott M. Lippman; Eric A. Klein; Phyllis J. Goodman; M. Scott Lucia; Ian M. Thompson; Leslie G. Ford; Howard L. Parnes; Lori M. Minasian; J. Michael Gaziano; Jo Ann Hartline; J. Kellogg Parsons; James D. Bearden III; E. David Crawford; Gary E. Goodman; Jaime Claudio; Eric Winquist; Elise D. Cook; Daniel D. Karp; Philip Walther; Michael M. Lieber; Alan R. Kristal; Amy K. Darke; Kathryn B. Arnold; Patricia A. Ganz; Regina M. Santella; Demetrius Albanes; Philip R. Taylor; Jeffrey L. Probstfield; T. J. Jagpal; John J. Crowley; Frank L. Meyskens Jr; Laurence H. Baker und Charles A. Coltman Jr. endet eindeutig: "Selenium or vitamin E, alone or in combination at the doses and formulations used, did not prevent prostate cancer in this population of relatively healthy men."
Zusätzlich zum Ende eines vermuteteten Nutzens von Selen und Vitamin E erweisen sich aber auch weitere antioxidative und damit als präventiv wirkend anmutende und beworbene Vitamine als nutzlos für die Prävention von Prostatakrebs. Dies ist jedenfalls das ebenso klare wie eindeutige Ergebnisse einer Untersuchung im Rahmen einer der großen Mänbnergesundheitsuntersuchungen in den USA, der Phycisian Health Study II" zur präventiven Wirkung der Vitamine E und C.
Die Schlussfolgerung des ebenfalls kostenlosen Abstracts zum Aufsatz "Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total Cancer in Men: The Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial" von J. Michael Gaziano; Robert J. Glynn; William G. Christen; Tobias Kurth; Charlene Belanger; Jean MacFadyen; Vadim Bubes; JoAnn E. Manson; Howard D. Sesso und Julie E. Buring lautet unmissverständlich: "In this large, long-term trial of male physicians, neither vitamin E nor C supplementation reduced the risk of prostate or total cancer. These data provide no support for the use of these supplements for the prevention of cancer in middle-aged and older men."
In einem Kommentat der JAMA-Herausgeber heißt es zusammenfassend daher auch "physicians should not recommend selenium or vitamin E — or any other antioxidant supplements — to their patients for preventing prostate cancer."
Da in der Frühdiagnose der gut- oder bösartigen Veränderungen von Prostatakrebs die Messung des PSA-Wertes (Prostate specific antigen) eine große Rolle spielt und ein Screening mit dieser Messung immer wieder gefordert wird, sind die im Oktober 2008 im "Journal of the National Cancer Institute" der USA veröffentlichten Ergebnissen einer Beobachtungsstudie über die Effekte der Einnahme von Statinen auf die PSA-Werte geeignet, die auch schon zuvor im Forum-Gesundheitspolitik dokumentierten Zweifel an der Aussagefähigkeit und Sicherheit des PSA-Tests noch mehr zu schüren und entsprechende Verhaltensunsicherheiten zu fördern.
In dieser Studie wurden die PSA-Werte von rund 1.214 Männern, die alle in einem Gesundheitszentrum der Veteranen-Krankenversicherung in North Carolina behandelt wurden, und eine gesunde Prostata hatten, in den zwei Jahren vor der Verordnung von Statinen und ein Jahr nach nach dem Beginn der Einnahme dieses omnipotenten Wirkstoffs zur Reduktion von Herzkreiserkrankungen, Schlaganfällen, Lungenentzündungen, Thrombosen und Alzheimer ("the world's top-selling drugs") gemessen. Der PSA-Wert sank nach Beginn der Statineinnahme um rund 4%. Bevor nun Statine zum neuesten Wundermittel auch gegen das Risiko von Prostatakrebs erkoren werden, wiesen die Forscher darauf hin, dass ihr Ergebnis nicht kläre, ob Statine eine präventive oder therapeutische Wirkung auf dieses Risiko besäßen oder nur einfach auf unbekannte aber folgenreiche Weise den PSA-Wert beeinflussten.
Eines der mit diesem Ergebnis verbundenen praktischen Risiken fasste einer der Wissenschaftler so zusammen: "In a good proportion of these men, the PSA levels declined sufficiently to a point where physicians might not recommend a biopsy (dient zur Bestätigung des durch den PSA-Wert indizierten Krebsverdachts), so it's really important that we understand what's at work here, so we can be sure we're not missing cancers because of deceptively low PSA levels."
Erst eine randomisierte kontrollierte Studie mit histologischen Endpunkten könne klären, welche Zusammenhänge wirklich bestünden. Trotzdem müssen sich Männer, die Statine einnehmen und gleichzeitig einen PSA-Test durchführen fragen, was ihnen und ihrem behandelnden Arzt ein bestimmter PSA-Wert nun wirklich zu ihrem Prostatakrebsrisiko sagen.
Ausführliche Fragen und Antworten zur SELECT-Studie gibt es kostenlos auf der Projekt-Homepage.
Die aktuellen Ergebnisse der Studie finden sich in der NCI-Meldung "Review of Prostate Cancer Prevention Study Shows No Benefit for Use of Selenium and Vitamin E Supplements", die kostenfrei erhältlich ist.
Eine komplette Version des 13-Seiten-JAMA-Aufsatzes "Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total Cancer in Men. The Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial ist auch kostenlos erhältlich.
Die komplette Version des 14-seitigen JAMA-Aufsatzes "Effect of Selenium and Vitamin E on Risk of Prostate Cancer and Other Cancers. The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)" ist genauso wie das umfangreiche Editorial "Randomized Trials of Antioxidant Supplementation for Cancer Prevention First Bias, Now Chance—Next, Cause" zu den beiden Aufsätzen kostenlos zu erhalten
Über die ungeklärten Effekte der Einnahme von Statinen auf den Prostatakrebs-Risikowert PSA gibt es kostenfrei lediglich ein Abstract des Aufsatzes von Robert J. Hamilton, Kenneth C. Goldberg, Elizabeth A. Platz und Stephen J. Freedland The Influence of Statin Medications on Prostate-specific Antigen Levels im "Journal of the National Cancer Institute"
Bernard Braun, 10.12.08
"Eine Woche mit und sieben Tage ohne Behandlung!" Mit Antibiotikatherapie ein bißchen längere "Erinnerung" an Erkältungen.
 Auch heute erfolgen "für alle Fälle"noch Antibiotika-Verordnungen bei gewöhnlichen Erkältungskrankheiten und auch sonst werden immer noch viel zu schnell und ohne wirkliche Indikation bzw. auch bei Viruserkrankungen, die allein gegen Bakterien wirksamen Mittel eingesetzt.
Auch heute erfolgen "für alle Fälle"noch Antibiotika-Verordnungen bei gewöhnlichen Erkältungskrankheiten und auch sonst werden immer noch viel zu schnell und ohne wirkliche Indikation bzw. auch bei Viruserkrankungen, die allein gegen Bakterien wirksamen Mittel eingesetzt.
Eine der gesundheitlich wirklich ernsthaften Folgen ist die damit geförderte Existenz von multiresistenten Erregern.
Aber auch schon davor gibt es nun Hinweise auf unerwünschte und möglicherweise gesundheitsbeeinträchtigenden Wirkungen von Antibiotika auf die Funktionsfähigkeit des menschlichen Organismus und damit auch letztlich die menschliche Gesundheit.
Ein gerade in der Open Access-Zeitschrift "PLoS Biology" erschienener Aufsatz hat hierfür folgende Spuren zusammengetragen:
• Die Behandlung mit Antibiotika (hier Ciprofloxacin) verändert auch bei sonstiger Nichtwirkung in etwa ein Drittel aller in der Untersuchung gentechnisch unterschiedenen 3.300 bis 5.700 Darmbakterienarten und damit einen Teil des natürlichen menschlichen Immungeschehens.
• Die Wiederansiedlung der meisten Bakterien und damit die Wiederherstellung der ex-ante-Verhältnisse dauert bis zu vier Wochen.
• Einige wichtigen Bakterien finden sich aber erst sechs Monate nach dem Ende der Antibiotikatherapie wieder funktionsfähig im Darm.
• Auch wenn darüber genau genommen noch keine gesicherten Erkenntnisse existieren, könnten Erkrankungen nach Ansicht der ForscherInnen auch durch die sich nach Antibiotikaeinnahme vorübergehend verändernde Zusammensetzung der Bakterienarten gefördert werden. Einfluss hat die Wirkdauer der antibiotischen Behandlung aber sicherlich auch auf die Umstände der Ernährung und der Beseitigung von Krankheitserregern im Darm.
An dem an der US-Universität Stanford durchgeführten Versuche nahmen drei Personen teil, denen das genannte Antibiotikum fünf Tage verabreicht wurde. Ausnahmsweise könnte bei dieser Untersuchung die geringe Zahl von TeilnehmerInnen nichts ausmachen, da es sich bei dem untersuchten Geschehen um etwas handelt, was keine große Varianz aufweisen dürfte.
Der achtzehnseitige am 18. November 2008 veröffentlichte recht experimentell-naturwissenschaftlich argumentierende Aufsatz "The Pervasive Effects of an Antibiotic on the Human Gut Microbiota, as Revealed by Deep 16S rRNA Sequencing"
von Dethlefsen L, Huse S, Sogin ML und Relman DA (PLoS Biology Vol. 6, No. 11, e280) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.12.08
Geschöntes Bild neuer Medikamente in medizinischen Fachzeitschriften
 Über die Zulassung eines neuen Medikamentes entscheidet die Zulassungsbehörde - in Deutschland das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), in den USA die Food and Drug Administration (FDA). Voraussetzung für die Zulassung ist der Nachweis von Wirksamkeit und Sicherheit. In Deutschland sind die Anforderungen im Arzneimittelgesetz geregelt. Das US-amerikanische Zulassungsverfahren wird auf einer Website der FDA näher beschrieben.
Über die Zulassung eines neuen Medikamentes entscheidet die Zulassungsbehörde - in Deutschland das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), in den USA die Food and Drug Administration (FDA). Voraussetzung für die Zulassung ist der Nachweis von Wirksamkeit und Sicherheit. In Deutschland sind die Anforderungen im Arzneimittelgesetz geregelt. Das US-amerikanische Zulassungsverfahren wird auf einer Website der FDA näher beschrieben.
Die Wirksamkeitsstudien, welche die Zulassungsbehörden erhalten, sind der Öffentlichkeit nicht in vollem Umfang zugänglich. Die Fachöffentlichkeit wird über medizinische Fachzeitschriften informiert, in denen die Forscher die entsprechenden klinischen Studien zu einem neuen Medikament veröffentlichen. Ergebnisse werden also in zwei Formen veröffentlicht - als Wirksamkeitsstudie für die Zulassungsbehörde und als Studie in einer medizinischen Fachzeitschrift. Wissenschaftler der University of California überprüften jetzt, inwieweit die Wirksamkeitsstudien über neue Wirkstoffe (new chemical entities) mit den Veröffentlichungen in Fachzeitschriften übereinstimmen.
Grundlage für die Untersuchung waren 33 in den Jahren 2001 und 2002 von der FDA neu zugelassene neue Wirkstoffe und die von den antragstellenden pharmazeutischen Unternehmen vorgelegten 164 Wirksamkeitsstudien.
Die Ergebnisse belegen, dass die Informationen, welche die Öffentlichkeit erhält, unvollständig und verzerrt sind.
•Nur 128 der 164 Wirksamkeitsstudien (78%) waren 5 Jahre nach der Zulassung in Fachzeitschriften veröffentlicht.
•Die Wahrscheinlichkeit der Veröffentlichung war höher für Wirksamkeitsstudien mit positivem Ergebnis.
•Die Zahl der Publikationen pro neue Substanz lag zwischen 1 und 14.
•Die Wirksamkeitsstudien enthielten 179 primäre Outcomes (Behandlungsergebnisse).
•155 Outcomes wurden sowohl in den Wirksamkeitsstudien als auch in den Fachzeitschriften genannt.
•41 Outcomes der Wirksamkeitsstudien wurden in den Fachzeitschriften ausgelassen.
•15 positive Outcomes erschienen zusätzlich in den Fachzeitschriften. Die Fachzeitschriften enthielten somit mehr positive Outcomes als die Wirksamkeitsstudien.
•Die Wirksamkeitsstudien enthielten 43 Outcomes, die für das jeweilige Medikament ungünstig waren. 20 dieser negative Ergebnisse (47%) wurden nicht in Fachzeitschriften veröffentlicht.
•4 der übrigen 23 negativen Outcomes erschienen in den Fachzeitschriften positiv und zwar durch Veränderung der statistischen Signifikanz (ein statistisches Maß für die Zuverlässigkeit von Studienergebnissen).
•Von den 99 Schlussfolgerungen der Wirksamkeitsstudien wurden 9 für die Fachzeitschriften verändert, alle zugunsten der Substanz.
Warum, wie, durch wen und an welcher Stelle die Veränderungen entstanden, war nicht Gegenstand der Untersuchung.
Die nahe liegende Schlussfolgerung lautet jedoch, dass die Firmen und Autoren durch selektives Veröffentlichen bzw. Nicht-Veröffentlichen ganzer Studien, durch Auslassung negativer und Zufügung positiver Ergebnisse sowie durch Umwandlung negativer in positive Ergebnisse neue Medikamente für die Öffentlichkeit günstiger darstellen als sie sind.
Diese Ergebnisse sind von weitreichender Bedeutung. Medizinische Behandlung soll mehr Nutzen stiften als Schaden anrichten. Behandlungsentscheidungen auf Grundlage positiv verzerrter Informationen gefährden jedoch die Gesundheit von Patienten. Da es sich dabei stets um neue, patentgeschützte und somit teure Medikamente handelt, wird für diese Art der Patientengefährdung auch noch viel Geld ausgegeben.
Originalarbeit, Volltext: Rising K, Bacchetti P, Bero L.
Reporting Bias in Drug Trials Submitted to the Food and Drug Administration: Review of Publication and Presentation. PLoS Medicine 2008;5(11):e217
Kommentar: Chan AW. Bias, Spin, and Misreporting: Time for Full Access to Trial Protocols and Results
David Klemperer, 6.12.08
"Kein Problem mit null Bock im Bett" oder gute Argumente gegen eine geschlechterübergreifende Viagraisierung des Sexuallebens.
 Die zitierte griffige Schlagzeile der "Ärztezeitung" vom 3.12.2008 bereitet auf die Ergebnisse einer großen us-amerikanischen Studie unter 31.581 Frauen im Alter über 18 Jahren aus 50.002 Haushalten vor, die für die Gesamtheit der US-Frauen repräsentativ ist. In der Untersuchung kamen Standardinstrumente zum Einsatz: Der "Changes in Sexual Functioning Questionnaire" mit 14 Abfragepunkten und die "Female Sexual Distress Scale" mit über zwölf Punkte wenn es um die Messung von Schuld, Frust oder Ärger ging.
Die zitierte griffige Schlagzeile der "Ärztezeitung" vom 3.12.2008 bereitet auf die Ergebnisse einer großen us-amerikanischen Studie unter 31.581 Frauen im Alter über 18 Jahren aus 50.002 Haushalten vor, die für die Gesamtheit der US-Frauen repräsentativ ist. In der Untersuchung kamen Standardinstrumente zum Einsatz: Der "Changes in Sexual Functioning Questionnaire" mit 14 Abfragepunkten und die "Female Sexual Distress Scale" mit über zwölf Punkte wenn es um die Messung von Schuld, Frust oder Ärger ging.
Angesichts der Tatsache, dass die Hersteller von Viagra oder Cialis nach ihrem Siegeszug bei den Männern nun auch den Frauen mit Lustproblemen Hilfe anzubieten beabsichtigen, enthalten die Ergebnisse auch eine Menge Zündstoff gegen das in die intimsten zwischenmenschlichen Bereiche vordringende Leistungsdenken und die dabei hilfreiche Medikalisierung menschlicher Schwächen.
Als erstes zeigte sich, dass altersadjustiert rund 44 % der dazu befragten Frauen über Libidoprobleme von sexueller Unlust bis zu Erregungs- und Orgasmusproblemen berichteten. Erwartungsgemäß nahmen diese Erscheinungen mit steigendem Alter zu. 27 % der Frauen im Alter von 18 bis 44 Jahren, 45 % der 45- bis 64-Jährigen und 80 % der älteren Frauen nannten derartige sexuelle Probleme.
Ob es sich aber wirklich um ein Problem handelte, war eines der zentralen Erkenntnisziele der Studie. Um dem näherzukommen wurden die Frauen, die eines der sexuellen Probleme für sich angaben, gebeten, auf einem anderen Fragebogen zu sagen, ob ihnen dies Kummer bereitet.
Dies taten deutlich weniger als die 44 %, nämlich noch 12 % der Frauen, mit ebenfalls beträchtlichen Altersgruppen-Unterschieden. Am meisten, nämlich 15 %, litten mittelaltrige Frauen unter ihren sexuellen Problemen, am zweitintensivsten jüngere zu 11 % und am wenigsten ältere Frauen mit 9 %.
Die AutorInnen der Studie heben hervor, dass diese Erscheinungen relativ neu zu beobachten sind, aber auch in Europa identifiziert werden konnten.
Nicht alle Frauen mit Sexualproblemen machen sich daraus aber kein oder lediglich ein kleines Problem: Bei verheirateten Frauen traten die Probleme und harter Leidensdruck doppelt so häufig auf wie bei Singles. Ebenfalls schwer haben es Frauen ohne Partner und Frauen mit Depressionen. Frauen, die an Schilddrüsenstörungen erkrankt sind, die Angst hatten, ein niedriges Bildungsniveau hatten, an Harninkontinenz litten und generell ihren Gesundheitszustand als schlecht bezeichneten, hatten ebenfalls einen höheren Leidensdruck. Andere Erkrankungen, wie etwa Bluthochdruck oder Diabetes hatten dagegen keinen Einfluss auf den Leidensdruck bei sexuellen Problemen.
Bevor also von der Existenz eines flächendeckenden Leidensdrucks wegen Libidoschwächen ausgegangen wird und nach den chemischen Helfern gerufen wird, lohnt sich die Frage nach dem tatsächlichen Leidensniveau, das Suchen nach niedrigschwelligeren Lösungsmitteln und die Konzentration auf Personen, die massiv unter den genannten Sexualproblemen leiden.
Ein Abstract des Aufsatzes "Sexual Problems and Distress in United States Women Prevalence and Correlates" von Jan L. Shifren, Brigitta U. Monz, Patricia A. Russo, Anthony Segreti, und Catherine B. Johannes aus der Zeitschrift "Obstetrics & Gynecology" (2008;112: 970-978) gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 4.12.08
Forschung von 25 Jahren: Die mangelnde klinische Gleichwertigkeit von Generika und Original ist oft ein gut gepflegtes Phantom.
 Gegen die Verordnung und Einnahme von sogenannten Generika, d.h. Arzneimitteln, die nach Beendigung des Patentschutzes eines Originalpräparats, meist preisgünstiger "nachgebaut" werden und aus Kostengründen auch immer häufiger verordnet werden sollen oder müssen, wurden und werden von Originalherstellern und ihnen nahe stehenden Kopflangern Sicherheitsbedenken und Warnungen vor möglichen unerwünschten gesundheitlichen Wirkungen geäußert. Diese machen sich an der Bioäquivalenz, d.h. einer qualitativ gleichwertigen Zusammensetzung und Wirkung der Generika fest. Hier könnten, so die Warner vor allzu intensiver Verordnung von Generika, kleine Unterschiede erhebliche negative Einflüsse auf die erwünschte gesundheitliche Wirkung darstewllen.
Gegen die Verordnung und Einnahme von sogenannten Generika, d.h. Arzneimitteln, die nach Beendigung des Patentschutzes eines Originalpräparats, meist preisgünstiger "nachgebaut" werden und aus Kostengründen auch immer häufiger verordnet werden sollen oder müssen, wurden und werden von Originalherstellern und ihnen nahe stehenden Kopflangern Sicherheitsbedenken und Warnungen vor möglichen unerwünschten gesundheitlichen Wirkungen geäußert. Diese machen sich an der Bioäquivalenz, d.h. einer qualitativ gleichwertigen Zusammensetzung und Wirkung der Generika fest. Hier könnten, so die Warner vor allzu intensiver Verordnung von Generika, kleine Unterschiede erhebliche negative Einflüsse auf die erwünschte gesundheitliche Wirkung darstewllen.
Dagegen gerichtet gab es schon immer bei einzelnen besonders umstrittenen Generika - meist bei denen für die der Markt relativ groß war - schlüssige Gegenargumente und Belege für eine hinreichend gleiche Bioäquivalenz von Original und Generika.
Für eine der quantitativ und qualitativ bedeutendsten Arzneimittelgruppen, die der vielfältigen Mittel gegen kardiovaskuläre Risikofaktoren, Beschwerden und Erkrankungen (z.B. Betablocker oder Diuretika) erschien nun in der neuesten Ausgabe des US-Medizinjournals JAMA (JAMA 3.12.2008;300(21): 2514-2526) ein systematischer Review der in den letzten 25 Jahren durchgeführten und publizierten 47 Studien (darunter 38 randomisierte kontrollierte Untersuchungen [RCT]) zur Bioäquivalenz bzw. klinischen Gleichwertigkeit der dort existierenden Original- und Generika-Mittel.
Die Quintessenz der Reviewer lautet kurz und knapp: "No evidence of superiority" der klinischen Gleichwertigkeit ("clinical equivalence") der Originalpräparate gegenüber ihren jeweiligen Generika. Dabei stand im Mittelpunkt des Interesses der klinische Outcome der Behandlung mit Arzneimitteln aus 9 Unterklassen dieser Medikamentengruppe. Zum Outcome wurden das Auftreten unerwünschter Wirkungen, Laborwerte und eine Reihe von behandlungsassoziierten Vitalzeichen. Nur bei 2 der 9 untersuchten Untergruppen wurde die klinische Gleichwertigkeit nicht in allen reviewten Studien festgestellt. Aber auch dort stellten 91 bzw. 71 % der Studien sie fest.
Die in den reviewten Studien gefundenen Ergebnisse rechtfertigen, so die Autoren des Review "that it is reasonable for physicians and patients to rely on FDA bioequivalence rating as a proxy for clinical equivalence among a number of important cardiovascular drugs."
Wie hartnäckig sich Vorurteile selbst dort halten wo ausdrücklich keinerlei Beleg für eine Minderwertigkeit von Generika gefunden wurde, zeigen die in 43 der 47 Studien-Zeitschriften veröffentlichten Editorials: In 23 Fällen äußerten sich die jeweiligen Herausgeber gegen die Ergebnisse ihrer Autoren negativ darüber, Originalarzneimittel durch Generika zu ersetzen. Es ist zu befürchten, dass angesichts des ökonomischen Potenzials des Arzneimittelmarktes auch weiterhin Ärzte, Apotheker und vor allem auch Patienten mit Vorsatz erschreckt werden und sich für eine nur für die Hersteller ökonomisch vorteilhaftere Behandlung mit Originalpräparaten entscheiden.
Hier findet sich das kostenlose Abstract des Aufsatzes "Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease A Systematic Review and Meta-analysis" von Aaron S. Kesselheim, Alexander S. Misono, Joy L. Lee, Margaret R. Stedman, M. Alan Brookhart, Niteesh K. Choudhry und William H. Shrank.
Bernard Braun, 3.12.08
Rund die Hälfte us-amerikanischer Internisten und Rheumatologen führt ohne ethische Bedenken Placebo-Behandlungen durch
 Dass Placebos (Placebo lat. "ich werde gefallen") im Alltag der medizinischen Behandlung von Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen, ist ein immer wieder bestätigtes Ergebnis vieler kontrollierter Studien. Dass sich Ärzte der Placebos in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen aktiv bedienen und wie häufig sie mit Vorsatz zu Placebos greifen, ist dagegen bisher nicht bekannt.
Dass Placebos (Placebo lat. "ich werde gefallen") im Alltag der medizinischen Behandlung von Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen, ist ein immer wieder bestätigtes Ergebnis vieler kontrollierter Studien. Dass sich Ärzte der Placebos in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen aktiv bedienen und wie häufig sie mit Vorsatz zu Placebos greifen, ist dagegen bisher nicht bekannt.
Die Ergebnisse einer landesweiten Befragung von 1.200 praktizierenden us-amerikanischen Internisten und Rheumatologen nach der Rolle, die Placebos für ihr ärztliches Selbstverständnis und Handeln spielen, bringen mehr Licht in dieses Dunkel.
Die Behandlung mit Placebos wurde in dieser postalischen Einmal-Befragung definiert als "a treatment whose benefits derive from positive patient expectations and not from the physiological mechanism of the treatment itself". Sie folgen einem weiteren Verständnis von Placebos. Eigentlich Im engeren Sinne handelt es sich bei einem Placebo um ein medizinisches Präparat, das keinen pharmazeutischen Wirkstoff enthält und damit auch keine spezifische pharmazeutische Wirkung verursachen kann. In der hier dargestellten Studie gelten aber auch therapeutische Mittel mit einem bekannten spezifischen Wirkstoff als Placebo bezeichnet, von denen ohne naturwissenschaftlichen Nachweis einer spezifischen Wirkung für das damit behandelte medizinische Problem trotzdem eine positive Reaktion erwartet wird.
Gefragt wurden die Ärzte nach ihrem praktischem Verhalten und ihren Einstellungen zu Placebos, wie oft sie eine "Placebo-Behandlung" durchführten und was diese umfasste, die ethische Bewertung ihrer Praxis und wie sie typischerweise mit ihren Patienten über ihre Behandlungspraxis kommunizierten.
Die 679 Ärzte, die den Fragebogen beantworteten (57 %), machten folgende Angaben:
• 46 bis 58 % der Befragten - abhängig von der konkreten Formulierung - führten im Jahr vor der Befragung Placebo-Behandlungen durch.
• Die meisten Ärzte (399 = 62 %) hielten diese Praxis als ethisch zulässig bzw. unbedenklich.
• Nur wenige der Ärzte gaben an, Salz- oder Zuckerpillen als Placebos eingesetzt zu haben. Wesentlich mehr, nämlich 267 und 243 setzten frei verkäufliche Schmerzmittel oder Vitamine zur Placebo-Behandlung ein. Immerhin 86 = 13 % der Internisten und Rheumatologen setzten aber auch Antibiotika und sedierende Arzneimittel als Placebos ein.
• Auf die ausdrückliche Frage, ob sie die von ihnen gewählten Placebostoffe gegenüber dem Patienten als potenziell nützliche Medizin oder Behandlung beschrieben, die typischerweise nicht für die Behandlung deren Erkrankungen eingesetzt würden, antworteten 241 = 68 %, sie hätten dies so vermittelt. Nur 18 Befragte (5 %) beschrieben sie gegenüber ihren Patienten explizit als Placebos.
Da es keine Hinweise gibt, dass andere Arztgruppen wesentlich andere Einstellungen zu Placebos haben und sich anders verhalten, handelt es sich beim Einsatz von Placebos hochwahrscheinlich um ein alltägliches und weit verbreitetes Geschehen bzw. eine nicht zu vernachlässigende Stütze der medizinischen Versorgung, des ärztlichen Handelns und seiner Wirksamkeit. Interessant wäre zu wissen, ob und wie diese Placebo-Behandlung für die Patienten aus deren Sicht von Nutzen waren und ob das Wissen oder Nichtwissen über den Charakter der Behandlung etwas an dem subjektiv wahrgenommenen Nutzen der Behandlung ändert.
Der in der Ausgabe des "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ 2008;337:a1938) vom 23. Oktober 2008 erschienene Aufsatz "Prescribing "placebo treatments": results of national survey of US internists and rheumatologists" von Jon C Tilburt, Ezekiel J Emanuel, Ted J Kaptchuk, Farr A Curlin und Franklin G Miller ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.10.08
Schlankheitsmittel Acomplia: Übergewicht von Schaden im Vergleich zum Nutzen
 Sanofi Aventis (Leitspruch: "Denn das wichtigste ist die Gesundheit") hat das Schlankheitsmittel Acomplia vom Markt genommen, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMEA) festgestellt hat, dass neue Studien zu einer neuen Bewertung von Nutzen und Schaden gelangen ließen. In einer Pressemitteilung vom 23.10.2008 heißt es, neue Studien würden darauf hinweisen, dass die unerwünschten Wirkungen (neurologische Störungen und Depressionen) stärker und die erwünschten Wirkungen (Gewichtsabnahme) geringer seien als im Juni 2006 angenommen.
Sanofi Aventis (Leitspruch: "Denn das wichtigste ist die Gesundheit") hat das Schlankheitsmittel Acomplia vom Markt genommen, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMEA) festgestellt hat, dass neue Studien zu einer neuen Bewertung von Nutzen und Schaden gelangen ließen. In einer Pressemitteilung vom 23.10.2008 heißt es, neue Studien würden darauf hinweisen, dass die unerwünschten Wirkungen (neurologische Störungen und Depressionen) stärker und die erwünschten Wirkungen (Gewichtsabnahme) geringer seien als im Juni 2006 angenommen.
Die Zulassung von Acomplia (Substanz: Rimonabant) war von Anfang an kritisiert worden. Der SPIEGEL hatte das Medikament am 3.7.2006 noch unkritisch und im Sinne der Herstellerfirma als "Wunderpille" angepriesen: "Raus aus der Todeszone" . Das Arzneitelegramm hatte bereits am 8.9.2006 auf das ungeklärte Schaden-Nutzen-Verhältnis und das erhöhte Risiko für Depressionen hingewiesen, die Zulassung kritisiert und von der Verordnung abgeraten. Zu einer gleich lautenden Bewertung kam die an Laien gerichtete Zeitschrift Gute-Pillen - Schlechte Pillen in einem Beitrag in der Ausgabe Mai 2007.
Acomplia ist ein weiteres Beispiel für die unzureichende bzw. unangemessen optimistische Bewertung von Sicherheitsaspekten im Zulassungsverfahren von Arzneimitteln. Als "Optimism-Bias" (Verzerrung durch Optimismus) wird der Sachverhalt beschrieben, dass erste Studien häufig zu günstigen Ergebnissen gelangen, die durch nachfolgende Studien relativiert oder widerlegt werden.
Ioannidis JPA. Contradicted and Initially Stronger Effects in Highly Cited Clinical Research. JAMA 2005;294:218-228. Abstract
David Klemperer, 25.10.08
Medizinischer Fortschritt und erhebliche Reduktion der Sterblichkeit für HIV-Infizierte - zumindest in reichen Ländern!
 Die vor wenigen Jahren noch fast unaufhaltsam tödlich endende Infektion mit dem "Human immunodeficiency virus (HIV)" hat in Ländern mit einem guten, d.h. finanzierbaren Zugang zu den aktuell wirksamsten Behandlungsmöglichkeiten einen erheblichen Teil ihres Schreckens verloren. Die Sterblichkeit in der HIV-infizierten Personen liegt nach neuesten epidemiologischen Analysen sehr nahe an der der nichtinfizierten Bevölkerung.
Die vor wenigen Jahren noch fast unaufhaltsam tödlich endende Infektion mit dem "Human immunodeficiency virus (HIV)" hat in Ländern mit einem guten, d.h. finanzierbaren Zugang zu den aktuell wirksamsten Behandlungsmöglichkeiten einen erheblichen Teil ihres Schreckens verloren. Die Sterblichkeit in der HIV-infizierten Personen liegt nach neuesten epidemiologischen Analysen sehr nahe an der der nichtinfizierten Bevölkerung.
Nach einer Analyse des Erkrankungsverlaufs und der übermäßigen Sterblichkeit in einer Gruppe von 16.534 Personen innerhalb des Zeitraums von 1981-2006 (durchschnittliche Beobachtungsdauer 6,3 Jahre) zeigte sich Folgendes:
• Insgesamt starben im Untersuchungszeitraum 2.571 HIV-Infizierte, also wesentlich mehr als in einer nichtinfizierten Vergleichsgruppe mit 235 Toten.
• Die Frühsterblichkeitsrate sank aber von 40,8 Tote pro 1.000 Personenjahre vor dem Einsatz aktiver antiretroviraler Therapie auf 6,1 Tote/1.000 Personenjahren im Zeitraum 2004-2006.
• Obwohl auf lange Sicht auch nach dem Einsatz dieser Therapie eine erhöhte Wahrscheinlichkeit frühzeitiger Sterblichkeit existiert, konnte zwischen 2004 und 2006 keine erhöhte Sterblichkeit innerhalb eines 5-Jahreszeitraums nach der Entdeckung der HIV-Infektion festgestellt werden.
Von dem gerade im Fach-Journal "Journal of American Medical Association (JAMA)" erschienenen (JAMA. 2008 Jul 2;300(1):51-9) Aufsatz "Changes in the risk of death after HIV seroconversion compared with mortality in the general population" von Bhaskaran K, et al. gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 14.7.2008
Antikörpertherapie gegen Asthma mit Omalizumab - und die Grenzen des medizinischen Fortschritts
 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in einem Beschluss die Verwendung des therapeutischen Antikörpers Omalizumab (z.B. Xolair®) eng begrenzt. Er bleibt damit unter den Anwendungsempfehlungen des Herstellers Novartis. Das Mittel fängt körpereigene Antikörper ab, die für eine allergische Asthmareaktion verantwortlich sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in einem Beschluss die Verwendung des therapeutischen Antikörpers Omalizumab (z.B. Xolair®) eng begrenzt. Er bleibt damit unter den Anwendungsempfehlungen des Herstellers Novartis. Das Mittel fängt körpereigene Antikörper ab, die für eine allergische Asthmareaktion verantwortlich sind.
Anwendung
Laut Novartis kommen für die Xolair-Injektionen alle Personen in Frage,
• die 12 Jahre und älter sind,
• die mäßiges bis schweres anhaltendes Asthma haben,
• deren Asthma durch ganzjährige Allergene verursacht wird
• und die Symptome zeigen, obwohl sie Steroide inhalieren.
Ursprünglich hatte der Hersteller beantragt, auch Kinder ab sechs Jahren und Patienten mit saisonalem Heuschnupfen und Asthma behandeln zu dürfen. Dies wies die europäische Zulassungsbehörde zurück, worauf der Hersteller den Antrag fallen ließ.
Für den G-BA ist die Verordnung von Omalizumab nur für Patienten wirtschaftlich,
• die älter als 12 Jahre sind,
• die nicht rauchen,
• deren Körpergewicht zwischen 20 kg und 150 kg liegt,
• die schweres persistierendes allergisches Asthma, sowie
• eine reduzierte Lungenfunktion haben,
• deren Asthma durch ganzjährige Allergene verursacht wird, die der Patienten nicht vermeiden kann,
• deren Asthma IgE-vermittelt ist und die IgE-Werte zwischen > 76 und < 700 I.E./ml vor Beginn der Behandlung liegen,
• bei denen häufige dokumentierte Symptome während des Tages oder nächtliches Erwachen auftreten,
• die eine tägliche Therapie mit hoch dosierten inhalativen Steroiden und mindestens einem lang wirkenden inhalativen Beta-2-Agonisten als Controller erhalten,
• die in den letzten zwölf Monaten mindestens zwei unabhängige, dokumentierte schwere Asthmaschübe hatten, die mit systemischen Corticosteroiden behandelt wurden, oder
• bei denen ein Schub auftrat, der eine systemische Corticosteroidgabe notwendig machte und zur Krankenhausaufnahme bzw. Notfallbehandlung führte.
Der G-BA fordert außerdem, dass Omalizumab nur dann weiter verordnet werden soll, wenn der Patient tatsächlich Verbesserungen registriert. Dazu zählt etwa, dass er die Notfallmedizin reduzieren oder Tätigkeiten des Alltags wieder aufnehmen kann, was er in einem Tagebuch festhalten soll.
Nutzen
Novartis verbreitet auf der Xolair-Homepage, es sei klinisch nachgewiesen, dass das Mittel in Verbindung mit inhalierbaren Steroiden "helfen kann, die Anzahl der Asthmaanfälle zu reduzieren". Immerhin wird eingeräumt, dass es möglicherweise nicht bei allen Patienten wirkt.
Obwohl der G-BA einer Behandlung in den genannten Grenzen zustimmt, ist seiner Ansicht nach "der generelle Nutzen des Arzneimittels zu hinterfragen". Die einzige doppelblind randomisierte Studie ergab laut G-BA keine signifikante Überlegenheit für die Rate an Asthmaanfällen als den primären Endpunkt. Auch die Notfallmedikation ging nicht statistisch signifikant zurück. Sekundäre Endpunkte sowie die asthmabedingte Lebensqualität zeigten dagegen statistisch signifikante, wenn auch geringe Verbesserungen.
Nebenwirkungen
Novartis warnt vor anaphylaxischen Reaktionen, die "in einigen Patienten" aufgetreten seien. Auch sei die Rate an Tumoren in der Behandlungsgruppe mit 0,5% höher als in der Placebogruppe mit 0,2%. Weniger schwere Nebenwirkungen, die in der Behandlungs- wie in der Placebogruppe "etwa gleich häufig auftraten", sind laut Novartis u.a.:
• Reaktionen an der Einstichstelle (45%),
• Vireninfektionen (23%),
• Atemwegsinfekte (20%),
• Nasennebenhöhleninfektionen (16%),
• Kopfschmerzen (15%),
• Halsentzündung (11%)
Laut G-BA traten nach einer FDA-Information bei 0,2% der Patienten anaphylaktische Reaktionen auf, von denen 15% im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zu 39% der Reaktionen kam es bereits nach der ersten Injektion, in einem Fall aber erst nach der 39. Injektion. Die Tumorhäufigkeit gibt der G-BA wie Novartis mit 0,5% vs. 0,18% an.
Kosten
Die Behandlung mit Omalizumab kostet je nach Behandlungsintervall, IgE-Spiegel und Körpergewicht zwischen 6.000 und bis zu 36.000 Euro pro Person und Jahr.
Persönlicher Kommentar
Omalizumab steht beispielhaft für einen medizinischen Fortschritt, bei dem ein geringer, teils unbelegter Nutzen mit erheblichen Nebenwirkungen und hohen Kosten einhergeht. Der 111. Deutsche Ärztetag wäre eine gute Gelegenheit gewesen, zu hinterfragen, ob diese Art Fortschritt wirklich sinnvoll ist, indem er einen höheren Wert für die Gesellschaft darstellt, wie etwa Angebote aus den Bereichen Bildung und Kultur. Statt jedoch die Grenzen des Fortschritts zu diskutieren, beklagte etwa der Präsident der Bundesärztekammer Jörg-Dietrich Hoppe: "Die Unterfinanzierung unseres Gesundheitssystems ist chronisch und verschlimmert sich von Jahr zu Jahr". Zum Abschluss forderte der Ärztetag die Bundesregierung auf, "nachhaltige und ausreichende Finanzierungsmodelle für eine zukunftsfeste Gesundheitsversorgung der Bevölkerung vorzulegen". Wie das Beispiel Omalizumab zeigt, darf "zukunftsfest" nicht bedeuten, dass jede Art von Fortschritt von der Gemeinschaft getragen wird. Die Anwendungseinschränkungen des G-BA sind hier ein Schritt in die richtige Richtung.
Christian Weymayr, 23.5.2008
Geschäftsmodell Blockbuster-Medikament in der Krise?
 Das traditionelle Geschäftsmodell der Pharmazeutischen Industrie - das Prinzip Blockbuster - habe sein Verfallsdatum längst überschritten, die Industrie müsse sich radikal verändern, wenn sie überleben will, schrieb Peter Mansell im Februarheft der PharmaTimes. Seine Kritik bezieht sich u.a. darauf, dass neue, heftig beworbene Medikamente häufig keine wirklichen Verbesserungen bringen würden. Als Blockbuster werden Medikamente mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar pro Jahr bezeichnet.
Das traditionelle Geschäftsmodell der Pharmazeutischen Industrie - das Prinzip Blockbuster - habe sein Verfallsdatum längst überschritten, die Industrie müsse sich radikal verändern, wenn sie überleben will, schrieb Peter Mansell im Februarheft der PharmaTimes. Seine Kritik bezieht sich u.a. darauf, dass neue, heftig beworbene Medikamente häufig keine wirklichen Verbesserungen bringen würden. Als Blockbuster werden Medikamente mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar pro Jahr bezeichnet.
Ähnliche Skepsis hatte vergangenes Jahr David Cutler im New England Journal of Medicine geäußert.
94 Medikamente überschritten im Jahr 2005 diese Schwelle und machten 36 Prozent des weltweiten Umsatzes aus, im Jahr 2000 waren es erst 17 Medikamente gewesen. Der "Megablockbuster" ist Lipitor® (in Deutschland Sortis®, Substanz Atorvastatin), ein Medikament zur Senkung des Blutfettspiegels, mit 13 Milliarden Dollar Umsatz weltweit - ohne jegliche belastbare Evidenz für Verbesserung im Vergleich zum weniger teuren Standardtherapeutikum (Simvastatin).
Welche Risiken auf Seiten der Industrie bestehen zeigen jüngere Ereignisse. BusinessWeek meldete am 31.3.2008, dass die Aktien der Firmen Schering-Plough und Merck an diesem Tag um 26 Prozent bzw. 14,7 Prozent fielen, entsprechend einer Summe von 22 Milliarden Dollar. Dem war die Veröffentlichung der ENHANCE-Studie über das Kombinationsmedikament Vytorin® (in Deutschland Inegy®: im Jahr 2006 680.000 Verordnungen, Umsatz 118.686,6 EURO lt Arzneiverordnungs-Report 2007) am 30.3.2008 im New England Journal of Medicine vorausgegangen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Zusatz des neuen Wirkstoffs Ezetimib zum Standard Simvastatin zwar die Blutfette verbessert, jedoch keine Wirkung auf die Gefäßveränderungen hat, die zu Schlaganfall bzw. Herzinfarkt führen. Merck ist durch das Medikament ZETIA® (In Deutschland Ezetrol®) betroffen, welches Ezetimib als Monosubstanz enthält.)
Dem Einbruch der Aktienkurse folgen bei Schering-Plough Pläne für Stellenkürzungen mit Einsparungen von jährlich 500 Millionen Dollar.
Vytorin® bzw. Inegy® waren mit einem - wie Businessweek schreibt - "überagressivem Marketing" lanciert worden. Die American Heart Association erhielt beispielsweise mehr als 2 Millionen Dollar jährlich vom Vytorin®-Hersteller, davon 350.000 US-Dollar für eine Internet-Seite über Cholesterin mit direktem Link zur Vytorin-Website (aerzteblatt-online 28.1.2008).
Rethinking big pharma PharmaTimes, Februar 2008 (Volltext)
The Demise of the Blockbuster? NEJM 29.3.2007 (Auszug)
A Weak Prognosis for Vytorin and Zetia. 31.3.2008 Business Week 31.3.2008 (Volltext)
Simvastatin with or without Ezetimibe in Familial Hypercholesterolemia NEJM 3.4.2008 (Volltext)
Schering-Plough plant Entlassungen. Schering-Plough Launches Productivity Transformation Program To Confront New Challenges Website Schering-Plough, 2.4.2008
Erste Nachwehen der ENHANCE-Studie - Zweifel an Cholesterinhypothese - US-Fachverbände in der Kritik Deutsches Ärzteblatt online, 28.1.2008
David Klemperer, 6.4.2008
Teure Placebo-Pillen werden im Experiment weitaus besser bewertet als billige
 Arzneimittel werden - ganz ähnlich wie auch andere Konsumgüter - von Verbrauchern und Patienten im Unterbewusstsein stets auch nach ihrem Preis bewertet: Billige Medikamente gelten daher als weniger wirksam im Vergleich zu eher teuren. Dieses Ergebnis hat sich jetzt in einem Experiment gezeigt, bei dem Versuchspersonen ein Placebo-Schmerzmittel bekamen, also Pillen ohne medizinisch wirksamen Inhalt. Allerdings erhielten die 82 Versuchsteilnehmer unterschiedliche Informationen über den Preis des angeblich neuen Schmerz-Medikaments: Einmal kostete eine einzelne Pille 2,50 Dollar, einer zweiten Gruppe wurde ein Preis von nur 10 Cent mitgeteilt. Exakt diese unterschiedliche Information war dann jedoch maßgeblich für die Bewertung der schmerzlindernden Wirkung des Placebos.
Arzneimittel werden - ganz ähnlich wie auch andere Konsumgüter - von Verbrauchern und Patienten im Unterbewusstsein stets auch nach ihrem Preis bewertet: Billige Medikamente gelten daher als weniger wirksam im Vergleich zu eher teuren. Dieses Ergebnis hat sich jetzt in einem Experiment gezeigt, bei dem Versuchspersonen ein Placebo-Schmerzmittel bekamen, also Pillen ohne medizinisch wirksamen Inhalt. Allerdings erhielten die 82 Versuchsteilnehmer unterschiedliche Informationen über den Preis des angeblich neuen Schmerz-Medikaments: Einmal kostete eine einzelne Pille 2,50 Dollar, einer zweiten Gruppe wurde ein Preis von nur 10 Cent mitgeteilt. Exakt diese unterschiedliche Information war dann jedoch maßgeblich für die Bewertung der schmerzlindernden Wirkung des Placebos.
Insgesamt 82 Teilnehmer folgten im Jahr 2006 in Boston, Massachusetts (USA) einer Zeitungsannonce, in der Freiwillige für ein harmloses Experiment gesucht wurden - gegen eine Teilnahme-Prämie von 30 Dollar. Allen wurde in einer Broschüre mitgeteilt, dass man ein neu entwickeltes Schmerzmittel testen wolle. Tatsächlich wurde jedoch später allen Teilnehmern lediglich ein Placebo ausgehändigt. Mitgeteilt wurde allerdings der einen Hälfte der Versuchsteilnehmer, das Schmerzmittel würde 2,50 Dollar kosten, der anderen Hälfte wurde ein Preis von nur 10 Cent mitgeteilt.
Zur Beurteilung, wie wirksam das Schmerzmittel ist, bekamen die Teilnehmer dann leichte Stromschläge am Handgelenk verabreicht und mussten diese dann auf einer Skala zwischen zwei Polen einstufen, zwischen "keinerlei Schmerzen" und "die schlimmsten nur vorstellbaren Schmerzen". Die leichten Stromschläge und die Schmerzeinstufung erfolgte einmal ohne Schmerztablette bzw. Placebo und einmal nach Einnahme der Pille. Als Ergebnis zeigte sich dann: 85 Prozent der Teilnehmer, die eine vermeintlich teure Schmerztablette bekommen hatten, aber nur 61% derjenigen mit dem billigen Placebo gaben an, dass sie nach Einnahme der Pille eine deutliche Senkung der Schmerzen gespürt hätten. Ähnlich zeigte sich auch, dass bei Betrachtung unterschiedlicher Schmerz-Intensitäten (verursacht durch unterschiedliche Stromspannung von 10-80 Volt) in 26 von 29 Fällen die Bewertung der schmerzlindernden Wirkung der teuren Placebos besser ausfiel.
Ein kurzer Bericht über das Experiment ist als Brief in der Zeitschrift JAMA veröffentlicht: Commercial Features of Placebo and Therapeutic Efficacy (JAMA; Vol. 299 No. 9, March 5, 2008)
Die Ergebnisse des Experiments sind von erheblicher praktischer Bedeutung, da eine Vielzahl von Patienten preisgünstige Generika im Vergleich zu erheblich teureren Original-Präparaten deutlich schlechter in der Wirksamkeit bewertet und möglicherweise so auch Ärzte dazu anhält, das teurere Mittel zu verschreiben. Irritationen bei Patienten dürften in diesem Zusammenhang jetzt allerdings häufiger auftauchen, seit Rabattverträge zwischen einzelnen Krankenkassen und Pharma-Herstellern Apotheken dazu verpflichten, dass dem Patienten in bestimmten Fällen (je nach Kassenzugehörigkeit und verschriebenem Wirkstoff) nur noch preisgünstige Generika ausgehändigt werden. vgl.: "Geiz ist geil?" - Bei preisgünstigeren Medikamenten aufgrund von Rabattverträgen haben Versicherte eine andere Meinung
Gerd Marstedt, 5.3.2008
"Geiz ist geil?" - Bei preisgünstigeren Medikamenten aufgrund von Rabattverträgen haben Versicherte eine andere Meinung
 Seit gesetzliche Krankenkassen Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern abgeschlossen haben, kann es passieren, dass Patienten nach einem Arztbesuch und der Verschreibung eines Medikaments beim Gang in die Apotheke eine Überraschung erleben. Möglicherweise erhalten sie ein ganz anderes Medikament als sie bislang bekommen haben, möglicherweise müssen sie auch öfter als früher erleben, dass das Arzneimittel nicht vorrätig ist und sie ein zweites Mal in die Apotheke kommen müssen. In einer Bevölkerungs-Umfrage des NAV-Virchow-Bundes jedenfalls hat sich nun gezeigt, dass fast jeder zweite Patient, der von dieser Regelung zuletzt betroffen war (43%), über Probleme im Rahmen der Umstellung auf ein neues Medikament berichtete. Dass jetzt Krankenkassen über Rabattverträge bei der Medikamentenverordnung das Sagen haben, und dies nur um Kosten im Gesundheitswesen zu sparen, wird von 87% aller gesetzlich Krankenversicherten "als nicht so gut" bewertet.
Seit gesetzliche Krankenkassen Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern abgeschlossen haben, kann es passieren, dass Patienten nach einem Arztbesuch und der Verschreibung eines Medikaments beim Gang in die Apotheke eine Überraschung erleben. Möglicherweise erhalten sie ein ganz anderes Medikament als sie bislang bekommen haben, möglicherweise müssen sie auch öfter als früher erleben, dass das Arzneimittel nicht vorrätig ist und sie ein zweites Mal in die Apotheke kommen müssen. In einer Bevölkerungs-Umfrage des NAV-Virchow-Bundes jedenfalls hat sich nun gezeigt, dass fast jeder zweite Patient, der von dieser Regelung zuletzt betroffen war (43%), über Probleme im Rahmen der Umstellung auf ein neues Medikament berichtete. Dass jetzt Krankenkassen über Rabattverträge bei der Medikamentenverordnung das Sagen haben, und dies nur um Kosten im Gesundheitswesen zu sparen, wird von 87% aller gesetzlich Krankenversicherten "als nicht so gut" bewertet.
Wenn der Arzt bei der Verschreibung eines Medikaments nicht ausdrücklich auf dem Rezept ein Kästchen ankreuzt, das bedeutet "Der Patient soll nur dieses spezielle Arzneimittel erhalten, es soll nicht ersetzt werden durch ein wirkstoffgleiches", dann sind Apotheken jetzt verpflichtet, einem Patienten jenes Mittel auszuhändigen, für das seine Krankenkasse einen Rabattvertrag mit dem Hersteller abgeschlossen hat. In der Regel sind dies preisgünstige Nachahmerprodukte (Generika), die aber denselben Wirkstoff enthalten wie das Originalpräparat.
Im Auftrag des NAV-Virchow-Bundes, einem Interessenverband niedergelassener Ärzte unterschiedlicher Fachrichtung, wurde nun überprüft, ob diese Regelung in der Praxis für Patienten Probleme mit sich bringt. Persönlich befragt wurden von Interviewern im Dezember 2007 rund 2.000 Personen. Dabei zeigte sich:
• 41 Prozent der gesetzlich versicherten Befragungsteilnehmer gaben an, dass sie vom Arzt mehr oder minder regelmäßig ein Medikament verordnet bekämen
• Von diesen wiederum gaben 44% an (N=320), es sei in den letzten Monaten vorgekommen, dass sie ein anderes Medikament als gewohnt bekommen hätten. Bezogen auf alle Versicherten sind dies etwa 16%.
• Aus dieser Teilgruppe von 320 Befragten, gaben die allermeisten (95%) an, sie hätten auch den Grund der Änderung erfahren. Am häufigsten genannt wurde dabei, das neue Medikament sei preisgünstiger oder es sei von den Kassen so vorgeschrieben.
• Dass diese Umstellung auf ein neues Medikament für sie ein Problem darstellt, wird von 43% der 320 Betroffenen berichtet (N=137). 57% sagen, dies sei kein Problem für sie gewesen. Bei den genannten Gründen sind unmittelbare gesundheitliche Negativeffekte (Mittel wirkt nicht, starke Nebenwirkungen) allerdings recht selten, es überwiegen hier Aussagen wie "Neues Medikament war ungewohnt für mich" oder "Neues Medikament hat mich noch nicht überzeugt".
In einer weiteren Frage wird schließlich der Hintergrund der Neuerung angesprochen: "Seit dem 1. April 2007 dürfen Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern sogenannte Rabattverträge schließen. Damit sparen die Krankenkassen beträchtliche Summen. Das bedeutet aber auch, dass es nicht mehr der Arzt ist, der entscheidet, welches Medikament Sie letztlich bekommen, sondern mehr und mehr Ihre Krankenkasse. Was halten Sie davon?" Nur 11% finden diese Regelung gut, 87% lehnen sie ab. Dabei wird am häufigsten gesagt, dass es der Arzt sein sollte, der die Entscheidung hierzu trifft.
Tatsächlich gibt es wohl für eine Reihe von Patienten Probleme mit der Umstellung auf ein neues Arzneimittel: Durch mehrmalige Gänge zur Apotheke, durch Änderungen der Dosierung, zu einem geringen Teil auch durch das Gefühl, das neue Medikament wirke nicht so gut wie das alte oder habe mehr Nebenwirkungen. Die Schlagzeile der Pressemitteilung des NAV-Virchow-Bundes allerdings übertreibt hier und interpretiert die vorliegenden statistischen Daten sehr reißerisch: "Umfrage: Arzneimittelumstellung durch Rabattverträge für knapp die Hälfte aller Patienten problematisch". Nimmt man tatsächlich alle Patienten, also Befragungsteilnehmer als Basis, dann sind es gerade einmal N=137, also knapp 7 Prozent, die über Probleme aufgrund einer neuen Medikamentenverordnung berichten. Solche Probleme wären allerdings in großem Umfang vermeidbar, wenn Ärzte ihre Patienten besser aufklären würden über den wohl weit verbreiteten und von Arzneimittelherstellern genährten Mythos, dass Original-Arzneimittel wirksamer seien und weniger Nebenwirkungen hätten als Generika.
• Hier ist die Pressemitteilung des NAV-Virchow-Bundes
• Hier ist die PDF-Datei mit allen Ergebnissen der Umfrage als Tabellenband: Krankenkassen & Medikamentenverordnung - Eine Untersuchung der GfK Marktforschung
Gerd Marstedt, 8.2.2008
Schlankheitspillen - Bei vielen Patienten zeigen sich nur die Nebenwirkungen, aber das Gewicht bleibt
 In vielen Ländern nehmen Übergewicht und Fettleibigkeit zu. Betroffene haben später häufig mit Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Gelenkschäden oder auch Krebs zu kämpfen. Trotz Sport und Ernährungsumstellung gelingt es vielen Übergewichtigen nicht, ihr Gewicht dauerhaft zu senken. Medikamente, die eine rasche Gewichtsabnahme versprechen, sollen das Vorhaben dann zusätzlich unterstützen. Eine jetzt am Münchener Klinikum rechts der Isar durchgeführte Studie hat nun gezeigt, dass bei einer großen Zahl von Patienten mit einer bestimmten Erbanlage eine Änderung des Lebensstils (Sport und reduzierte Kalorien bei der Ernährung) nachhaltige Gewichtsverbesserungen brachte, während eine andere Gruppe, die zusätzlich eine "Schlankheitspille" bekam, ihr Körpergewicht nicht reduzieren konnte, dafür aber die Nebenwirkungen des Medikaments eindringlich spüren musste.
In vielen Ländern nehmen Übergewicht und Fettleibigkeit zu. Betroffene haben später häufig mit Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Gelenkschäden oder auch Krebs zu kämpfen. Trotz Sport und Ernährungsumstellung gelingt es vielen Übergewichtigen nicht, ihr Gewicht dauerhaft zu senken. Medikamente, die eine rasche Gewichtsabnahme versprechen, sollen das Vorhaben dann zusätzlich unterstützen. Eine jetzt am Münchener Klinikum rechts der Isar durchgeführte Studie hat nun gezeigt, dass bei einer großen Zahl von Patienten mit einer bestimmten Erbanlage eine Änderung des Lebensstils (Sport und reduzierte Kalorien bei der Ernährung) nachhaltige Gewichtsverbesserungen brachte, während eine andere Gruppe, die zusätzlich eine "Schlankheitspille" bekam, ihr Körpergewicht nicht reduzieren konnte, dafür aber die Nebenwirkungen des Medikaments eindringlich spüren musste.
"Wir konnten zeigen, dass abhängig von den Erbanlagen manche Medikamente keinen Nutzen bringen, sondern sogar gefährlich sein können", bringt Prof. Winfried Siffert, einer der Studienleiter und Direktor des Instituts für Pharmakogenetik am UK Essen, das Ergebnis auf den Punkt. In ihren Untersuchungen fanden die Wissenschaftler zum ersten Mal in einem Gen, das an der Fettverbrennung und an der Steuerung der Herzfrequenz beteiligt ist, eine recht häufige, also bei etwa 40 Prozent der Bevölkerung vorkommende Veränderung.
Die Forscher führten daraufhin Genuntersuchungen bei 110 übergewichtigen Patienten durch, die an einer klinischen Studie zur Gewichtsreduktion teilgenommen hatten. In dieser insgesamt ein Jahr dauernden Studie mussten alle Teilnehmer mehr Sport treiben und ihre Kalorienzufuhr einschränken. Die Hälfte der Teilnehmer bekam noch zusätzlich das Medikament Reductil®, die anderen nur ein Scheinmedikament, also Placebo. Reductil® enthält den Wirkstoff Sibutramin, der das Sättigungsgefühl senkt und vermutlich auch die Verbrennung von Fett in Fettzellen anheizt. Allerdings ist dieses Mittel nicht ungefährlich. Es führt zu einem Anstieg des Blutdrucks und zu Herzrasen.
Ziel der Studie war es zu prüfen, ob Reductil® im Vergleich zum Placebo tatsächlich zu einer vermehrten Gewichtsreduktion innerhalb eines Jahres führte. Dabei wurde diese Medikamentenprüfung doppelt blind durchgeführt: Weder Ärzte noch Patienten wussten, ob sie das echte oder ein Scheinmedikament bekamen. Die nachträglichen Genanalysen der Wissenschaftler führten zu einem erstaunlichen Befund: Patienten mit der Genvariante konnten bei Lebensstiländerung im Jahr 7,5 kg abnehmen und die Einnahme von Reductil® führte zu keiner weiteren Gewichtsabnahme. Dafür zeigten diese Patienten einen besonders ausgeprägten Anstieg der Herzfrequenz und des Blutdrucks. Die Patienten mit der normalen Variante hingegen konnten mit Reductil® 9,4 kg statt nur 4,5 kg ohne Medikament abnehmen und sie zeigten zudem weniger Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen.
Die Forscher halten es nun für dringend erforderlich, dass schnellstmöglich weitere Untersuchungen zur Bestätigung dieses Befunds durchgeführt werden. "Wir sehen hier die Pharmaindustrie in der Pflicht, weitere Untersuchungen zu ermöglichen oder selbst durchzuführen, damit die Arzneitherapiesicherheit erhöht wird", so Prof. Siffert. Unabhängig von der speziellen Forschungsfrage "Gewichtssenkung" zeigt die Studie jedoch auch, dass bei der Prüfung und den Zulassungsverfahren für Arzneimittel die Zahl und Zusammensetzung der Studienteilnehmer eine sehr viel größere Rolle spielen sollte.
Hier ist ein Abstract der Studie: Frey, Ulrich H.u.a.: A novel promoter polymorphism in the human gene GNAS affects binding of transcription factor upstream stimulatory factor 1, G[alpha]s protein expression and body weight regulation (Pharmacogenetics & Genomics. 18(2):141-151, February 2008)
Gerd Marstedt, 19.1.2008
Mehrheitlich Über- und Fehlversorgung mit Antibiotika durch Hausärzte bei Nasennebenhöhlenentzündungen
 Für die Diskussion und Entscheidungen über den Nutzen, Sinn und die gesundheitlich unerwünschten Fernfolgen eines gesundheitlich nicht notwendigen Einsatzes von Antibiotika (Stichwort: multiresistente Erreger) liefern die gerade im US-Medizinerjournal "JAMA" veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie über die Wirkungen des Einsatzes von Antibiotika und bestimmten Nasensprays bei akuter Sinusitis im Vergleich mit Placebos wichtige Hinweise.
Für die Diskussion und Entscheidungen über den Nutzen, Sinn und die gesundheitlich unerwünschten Fernfolgen eines gesundheitlich nicht notwendigen Einsatzes von Antibiotika (Stichwort: multiresistente Erreger) liefern die gerade im US-Medizinerjournal "JAMA" veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie über die Wirkungen des Einsatzes von Antibiotika und bestimmten Nasensprays bei akuter Sinusitis im Vergleich mit Placebos wichtige Hinweise.
In der allgemeinärztlichen Praxis gehört die Behandlung der mit lokalen Schmerzen und manchmal eitrigem Ausfluss aus der Nase einhergehenden Erkrankung zu den häufigsten Einsatzfeldern von antibiotischen Arzneimitteln. Die norwegischen Hausärzte reagieren zu 67%, ihre holländischen KollegInnen zu 80% und ihre US-amerikanischen KollegInnen mit bis zu 98% auf diese Weise.
In der Untersuchung wurden unter Einsatz einer Reihe von defensiven diagnostischen Kriterien (z. B. ohne Einsatz der lange Zeit vorherrschenden Röntgenuntersuchung des Oberkiefers) 240 Personen im Alter über 15 Jahren und aus 58 Hausarztpraxen in Großbritannien mit akuter und nicht wiederholter Sinusitis identifiziert und zufallsgesteuert in eine Interventions- und eine Kontroll-/Placebogruppe aufgeteilt. Die Interventionsgruppe wurde mit dem Antibiotika-Klassiker Amoxicillin, in Deutschland als Mittel der Wahl betrachtet, und zusätzlich zur Symptomlinderung mit einem als lindernd betrachteten Nasenspray behandelt. In der Kontrollgruppe waren Antibiotikamittel und Spray jeweils Placebos.
Das Ergebnis war nach dem langjährig "erprobten" und weit verbreiteten Einsatz von Antibiotika und Spray unerwartet, ein bisschen unfassbar aber eindeutig: Beide Therapien wirkten nicht.
Unter der Antibiotikatherapie hatten nach 10 Tagen noch 29% der Patienten Beschwerden. Unter Placebo waren es 33,6%, ein statistisch nicht signifikanter geringfügiger Unterschied (Odds Ratio 0,99; 95-Prozent-Konfidenzintervall 0,57-1,73). Auch das Nasenspray hatte keinen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung: Mit oder ohne es waren nach 10 Tagen noch 32% der Patienten symptomatisch. Nur in einer Subgruppe von Patienten mit vergleichsweise geringen Beschwerden, also einer eigentlich am wenigsten behandlungsbedürftigen Patientengruppe, waren die Nasenspray-Steroide dem Placebo überlegen.
Andersherum betrachtet waren aber 40% der PatientInnen in allen Gruppen nach einer Woche geheilt - eine komplette Dublette der berühmten Volksmund-Bewertung für Husten, Schnupfen, Heiserheit: Heilung mit Medikamenten nach einer Woche, ohne nach 7 Tagen.
Insgesamt könnte man also nach Meinung der Herausgeber von JAMA bei den meisten PatientInnen auf die Verordnung und Einnahme von Antibiotika und Nasensprays verzichten. Hilfreich ist ihr Einsatz lediglich bei PatientInnen mit hartnäckigen Infektionen. Da diese aber nicht von vornherein erkennbar sind, könnten Ärzte trotz dieser wissenschaftlich eindeutigen Erkenntnisse "für alle Fälle" Antibiotika verordnen und auch ihre sofortige Einnahme empfehlen. Um trotz dieses Dilemma den Zeitpunkt des Einsatzes von Antibiotika so weit wie möglich hinauszuzögern und erst im wirklichen Bedarfsfall einnehmen zu lassen, empfehlen die Wissenschaftler die Ausstellung von Eventualrezepten, die erst dann eingelöst werden sollten, wenn der Ausfluss und die Schmerzen nach einigen Tagen nicht besser geworden sind.
Die PDF-Komplettversion des Aufsatzes "Antibiotics and Topical Nasal Steroid for Treatment of Acute Maxillary Sinusitis A Randomized Controlled Trial" (JAMA, December 5, 2007—Vol 298, No. 21: 2487-2496) gibt es kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 5.12.2007
Pharmaindustrie und 3. Welt: Vernachlässigung ihrer Krankheiten und Kranken sowie ihre Entdeckung als lukrativer Markt
 Während in Deutschland und vergleichbaren Ländern Europas und Nordamerikas heftige Debatten um die Anzahl und Aufgaben der "Apotheken um die Ecke" und die Anteile der Internetapotheken geführt werden und ein zähes Ringen um die Zulassung innovativer oder scheininnovativer Medikamente gegen alle möglichen Zivilisationskrankheiten stattfindet, scheitert eine Basisversorgung mit Arzneimitteln bereits wenige Flugstunden in südlicher oder südöstlicher Richtung an einer systematischen Vernachlässigung der Entwicklung von Arzneimitteln für die dort weit verbreiteten Krankheiten und an der, wenn überhaupt, nur auf äußersten staatlichen und öffentlichen Druck abgemilderten Hochpreispolitik.
Während in Deutschland und vergleichbaren Ländern Europas und Nordamerikas heftige Debatten um die Anzahl und Aufgaben der "Apotheken um die Ecke" und die Anteile der Internetapotheken geführt werden und ein zähes Ringen um die Zulassung innovativer oder scheininnovativer Medikamente gegen alle möglichen Zivilisationskrankheiten stattfindet, scheitert eine Basisversorgung mit Arzneimitteln bereits wenige Flugstunden in südlicher oder südöstlicher Richtung an einer systematischen Vernachlässigung der Entwicklung von Arzneimitteln für die dort weit verbreiteten Krankheiten und an der, wenn überhaupt, nur auf äußersten staatlichen und öffentlichen Druck abgemilderten Hochpreispolitik.
Die in Hochglanzprospekten vieler Pharmahersteller immer wieder propagierte besondere Verantwortung und Ethik der Arzneimittelhersteller verhindert in Afrika oder Lateinamerika nicht, dass es entweder gar keine oder nur veraltete Mittel gegen die dort weitverbreiteten Erkrankungen gibt oder vorhandene Arzneimittelmittel um ein Vielfaches zu teuer sind.
Die bereits seit 1942 in Großbritannien existierende und heute international operierende Nichtregierungsorganisation "Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief)" hatte bereits 2002 zusammen mit anderen Organisationen den Bericht "Beyond Philanthropy" (K. Bluestone, A. Heaton, and C. Lewis (2002) 'Beyond Philanthropy: The Pharmaceutical industry, corporate social responsibility and the developing world’, Oxfam, Save the Children UK, and VSO) veröffentlicht, in dem die Pharmaindustrie aufgefordert wurde, zu einer besseren Gesundheitsversorgung in den Entwicklungsländern qualitativ und finanziell beizutragen.
Die damals genannten 5 Schwerpunkte waren die Preispolitik, der Umgang mit Patenten, die Mitarbeit in öffentlich-privaten Initiativen, Forschung und Entwicklung spezifischer Medikamente und die Vermittlung des angemessenen Umgangs mit Medikamenten. Wie der Titel des Reports andeutet, ging es bereits damals nicht nur um Menschenfreundlichkeit, sondern durchaus auch um die längerfristigen wirtschaftlichen Interessen der Arzneimittelhersteller an diesen Märkten. 100.000 zum Jahrespreis von 2.000 Euro verkaufte Packungen erbringen weniger Umsatz und Gewinn als 1.000.000 zum Preis von 1.000 Euro verkaufte Packungen desselben Medikaments.
Das jüngste, am 27. November 2007 veröffentlichte "Briefing Paper 109" von Oxfam, kommt unter der Überschrift "Investing for life. Meeting poor people’s needs for access to medicines through responsible business practices" und auf 56 Seiten zu nicht erheblich anderen Beschreibungen der Pharmaindustrie-Strategien in der Dritten Welt als 5 Jahre zuvor.
Bei der Vorstellung des Berichts brachte die deutsche Koordinatorin des Medikamenten-Schwerpunkts von Oxfam, Corinna Heineke, den Sachstand auf folgende Nenner:
• Mehr als 85 % der Menschen weltweit haben keinen oder keinen ausreichenden Zugang zu Medikamenten. Noch immer konsumieren heute die reichsten 15 Prozent der Welt über 90 Prozent aller Medikamente, während in Armut lebende Menschen in Entwicklungsländern keinen Zugang zu bezahlbaren Medikamenten haben.
• Laut Oxfams Bericht investieren die Pharmaunternehmen nicht ausreichend in Forschung und Entwicklung für Medikamente, die vor allem Entwicklungsländer benötigen. Zwischen 1999 und 2004 kamen nur drei innovative Arzneien auf den Markt, die Krankheiten in Entwicklungsländern behandeln - von insgesamt 163 neu vermarkteten Medikamenten. "Zum Beispiel ist das neueste Medikament gegen Tuberkulose 30 Jahre alt. Dabei sterben jedes Jahr zwei Millionen Menschen an TBC", so Heineke.
• Neben dem Mangel an neuen Medikamenten sind auch die von den Pharmaunternehmen geforderten Preise zu hoch. Zwar bieten dem Oxfam-Bericht zufolge einige Unternehmen gestufte Preise an, dies aber nur in sehr begrenztem Umfang und nur für viel diskutierte Krankheiten wie HIV/Aids und Malaria. Die Preisstufen gelten zudem meist nicht weltweit und sind für arme Menschen in Entwicklungsländern oft immer noch zu teuer. Oft bedarf es für Preissenkungen aber erst erheblichen öffentlichen Drucks und langwieriger patentrechtlicher Auseinandersetzungen.
• Beispielsweise verkaufte der Pharmakonzern Abbott sein AIDS-Medikament Kaletra in Ländern geringen bis mittleren Einkommens wie Guatemala für 2.200 US-Dollar pro Patient und Jahr. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in dem zentralamerikanischen Land liegt bei nur 2.400 US-Dollar jährlich. Erst nachdem Thailand eine Zwangslizenz erteilt hatte, um den Preis für Kaletra auf 1.000 US-Dollar zu senken, reduzierte Abbott die Kosten weltweit auf 1.000 US-Dollar pro Patient und Jahr. Ein weiteres Beispiel ist die Preispolitik, die der französische Pharmamulti Sanofi-Aventis bei seinem Herz-Kreislauf-Medikament Plavix verfolgte: Es wurde zu einem 60-mal höheren Preis verkauft als die generische Version des indischen Herstellers Emcure. Im März 2007 reagierte das Unternehmen auf eine thailändische Zwangslizenz, indem es den Preis um 70 Prozent reduzierte.
• Erneut weisen die Berichterstatter darauf hin, dass sich die Pharmaunternehmen mit dieser Strategie sogar selber und auch ihren an wirtschaftlich leistungsfähigen Entwicklungsländern interessierten Herkunftsländern kurz-, mittel- und langfristig ökonomisch schaden.
Dass dieses Argument sehr ambivalent ist, zeigt eine im neuesten "Pharma-Brief", dem Rundbrief der BUKO Pharma-Kampagne" (Nr. 8, November 2007) (siehe Näheres weiter unten) zu findende Kurzbesprechung der von "Consumers International" (mit 220 Mitgliedsorganisationen in 115 Ländern die weltweit größte unabhängige Konsumentenorganisation) veröffentlichten Studie "Drugs, Doctors and Dinners. How drug companies influence health in the developing world".
Dort wird auf 44 Seiten zuerst beschrieben, dass und wie parallel zu den von Oxfam berichteten Strategien die Schwellen- und Entwicklungsländer einen immer größeren Beitrag zum globalen Umsatzwachstum der Pharmaindustrie liefern. Der Bericht liefert dann zahlreiche konkrete Beispiele aus verschiedenen Entwicklungsländern mit welchen Mitteln die Industrie die dortigen Ärztinnen und Ärzte "im großen Maßstab beeinflusst, manipuliert und mit Geschenken besticht" (BUKO).
Die Oxfam-Studie "Investing for Life" untersucht die Geschäftspolitik der zwölf größten internationalen Pharma-Konzerne hinsichtlich Preisgestaltung, Forschung und Entwicklung von Medikamenten, die insbesondere armen Ländern zugute kommen, und in Hinsicht auf geistige Eigentumsrechte. Der 56 Seiten umfassende Bericht ist hier herunterladbar.
Regelmäßige sachkundige Berichte u.a. über die Strategien der Pharmaunternehmen in den Ländern der Dritten Welt aber auch in der Ersten Welt finden Interessierte im übrigen auch im 10mal jährlich mit jeweils 8 Seiten Umfang erscheinenden Informationsdienst "Pharma-Brief. Rundbrief der BUKO Pharma-Kampagne".
Der komplette Brief kann als PDF-Datei kostenlos auf der Homepage der BUKO Pharma-Kampagne heruntergeladen werden oder gegen eine geringe Gebühr in schriftlicher Form bestellt werden. Auf der BUKO-Website finden sich häufig auch noch weitere aktuellen oder archivierten Materialien aus dem Bereich der unabhängigen Arzneimittel- und Pharmaberichterstattung bis zurück ins Jahr 1996
Bernard Braun, 26.11.2007
EVITA - Die Antwort der Krankenkassen auf Scheininnovationen bei Arzneimitteln
 EVITA ist ein neues Instrument zur "Evaluation Innovativer Therapeutischer Alternativen", das im Auftrag der Spitzenverbände der Krankenkassen von einem internationalen Expertenteam entwickelt wurde und eine schnelle Bewertung neu eingeführter Arzneimittel auf Grundlage der verfügbaren Literatur ermöglicht. Mit der Evaluation sollen Erkenntnisse zum therapeutischen Stellenwert (Innovationsgrad) bereit gestellt werden und auch zu der Frage, ob die in der Regel massive Produktwerbung, die eine Markteinführung stets begleitet, mit den Studienergebnissen in Einklang steht. EVITA ist für die Spitzenverbände eine Entscheidungshilfe, welches der zahlreichen Steuerungsinstrumente (z. B. Therapiehinweis, Zweitmeinungsverfahren, Festlegung von Erstattungshöchstgrenzen) für das bewertete Produkt am besten geeignet erscheint. Dabei ist EVITA keine Konkurrenz zu den Bewertungsverfahren des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), sondern erlaubt den Spitzenverbänden im Gemeinsamen Bundesausschuss, ggf. Aufträge an das IQWiG schneller und präziser als bisher zu fassen.
EVITA ist ein neues Instrument zur "Evaluation Innovativer Therapeutischer Alternativen", das im Auftrag der Spitzenverbände der Krankenkassen von einem internationalen Expertenteam entwickelt wurde und eine schnelle Bewertung neu eingeführter Arzneimittel auf Grundlage der verfügbaren Literatur ermöglicht. Mit der Evaluation sollen Erkenntnisse zum therapeutischen Stellenwert (Innovationsgrad) bereit gestellt werden und auch zu der Frage, ob die in der Regel massive Produktwerbung, die eine Markteinführung stets begleitet, mit den Studienergebnissen in Einklang steht. EVITA ist für die Spitzenverbände eine Entscheidungshilfe, welches der zahlreichen Steuerungsinstrumente (z. B. Therapiehinweis, Zweitmeinungsverfahren, Festlegung von Erstattungshöchstgrenzen) für das bewertete Produkt am besten geeignet erscheint. Dabei ist EVITA keine Konkurrenz zu den Bewertungsverfahren des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), sondern erlaubt den Spitzenverbänden im Gemeinsamen Bundesausschuss, ggf. Aufträge an das IQWiG schneller und präziser als bisher zu fassen.
Neu zugelassene Arzneimittel müssen die Kriterien von Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit erfüllen. Diesen Nachweis erbringen die Hersteller durch klinische Studien, in denen der neue Wirkstoff in der Regel nur gegen Placebo (ein Scheinpräparat ohne spezifische Wirkung) getestet wurde. Die Laufzeit dieser Studien beträgt meist nur wenige Wochen bis Monate und die Zahl der in den Studien behandelten Patienten ist relativ klein. Mit Hilfe der Zulassungsstudien wird somit nur selten der zusätzliche Nutzen neuer Arzneimittel gegenüber der bisherigen Standardtherapie belegt. Hierzu sind vergleichende klinische Studien erforderlich, die über einen ausreichenden Zeitraum die für die Patienten relevanten Ziele untersuchen.
Angesichts des Mangels an hochwertigen Studien zum Zeitpunkt des Markteintritts werden neue Arzneimittel in Deutschland häufig primär nach pharmakologischen Kriterien eingeordnet (z. B. Klassifikationsschema "Fricke und Klaus" des jährlich erscheinenden Arzneiverordnungs-Reports). Das neue Bewertungssystem EVITA geht demgegenüber davon aus, dass von einer Innovation im Arzneimittelsektor nur gesprochen werden darf, wenn durch qualitativ gute klinische Studien eine Überlegenheit gegenüber dem bestehenden Behandlungsstandard belegt worden ist oder bisher keine Behandlungsmöglichkeit besteht. Entscheidendes Kriterium ist der klinisch bedeutsame Fortschritt, der sich aus der gemeinsamen Betrachtung des Erreichens gesetzter Behandlungsziele und des Ausmaßes unerwünschter Wirkungen zusammensetzt.
EVITA vergibt nach Sichtung der wissenschaftlichen Literatur im Sinne eines Punktesystems positive Bewertungspunkte, die ein Medikament durch einen therapeutischen Nutzen erreichen kann und negative Bewertungspunkte aufgrund seines Profils unerwünschter Wirkungen. Entscheidende Kriterien für die Punktevergabe sind
• die methodische Qualität der vorliegenden Studie
• die Art der verwendeten Studienziele (Beeinflussung von Sterblichkeit und Krankheitsfolgen versus Korrektur von Surrogaten (z. B. Laborwerte)
• die Testung gegen einen vorhandenen Standard
- das Ausmaß unerwünschter Wirkungen
Am Ende des Bewertungsprozesses wird der Punkte-Score des EVITA-Instruments mit den getroffenen Bewertungen sowie einer Auflistung sämtlicher zugrunde gelegter Quellen in eine Internet-Plattform eingestellt. Diese Plattform wird im Laufe des kommenden Jahren online gestellt und ist dann für jedermann einsehbar. EVITA soll auf diesem Weg zu einem transparenten dialogischen Instrument der Nutzenbewertung neuer Arzneimittel werden. Der Bewertungsprozess kann jederzeit wieder aufgenommen werden, sobald neue Studien vorliegen und insoweit sehr schnell festgestellt werden, ob sie das Gesamtergebnis beeinflussen können. Gesundheitsökonomische Überlegungen sind in EVITA nicht enthalten. EVITA ist kein Sparinstrument, sondern dient der fachlichen Bewertung der vorhandenen Evidenz und dreht sich um die Kernfrage: Gibt es für ein neues Arzneimittel gute Argumente, die für einen klinisch bedeutsamen therapeutischen Fortschritt sprechen? Um eine Innovation handelt es sich nur dann, wenn auch belegt ist, dass ein neues Arzneimittel dem Kranken auch unter Berücksichtigung der Nebenwirkungen tatsächlich besser hilft als der bisherige Therapiestandard. Es geht also stets darum, den zusätzlichen Nutzen zu bewerten.
Auf der Website der Spitzenverbände der Krankenkassen sind mehrere PDF-Dateien mit Referaten der beteiligten Wissenschaftler (Prof. Dr. Lars Nilsson, Prof. Dr. Arne Melander , Prof. Dr. Bernd Mühlbauer, Isabel Püntmann, Prof. Dr. Norbert Schmacke) einsehbar: Innovation oder Schein-Innovation? Spitzenverbände der Krankenkassen setzen auf neuartige Analyse- und Bewertungsmethode für Arzneimittel
Gerd Marstedt, 21.11.2007
Abnehmen mit Appetitzüglern - Wenig Wirkung, unklarer Nutzen aber schwere Nebenwirkungen
 Egal wie man es dreht und wendet, die Wahrscheinlichkeit die Probleme von Übergewicht und Fettsucht einfach, in kurzer Zeit und vor allem allein mit medizinischen oder pharmakologischen Interventionen "in den Griff" zu bekommen oder gar lösen zu können, ist denkbar gering. Hinzu kommen die in diesen "Lösungen" sichtbar werdenden unerwünschten gesundheitlichen Risiken.
Egal wie man es dreht und wendet, die Wahrscheinlichkeit die Probleme von Übergewicht und Fettsucht einfach, in kurzer Zeit und vor allem allein mit medizinischen oder pharmakologischen Interventionen "in den Griff" zu bekommen oder gar lösen zu können, ist denkbar gering. Hinzu kommen die in diesen "Lösungen" sichtbar werdenden unerwünschten gesundheitlichen Risiken.
Dies bestätigen mehrere in den letzten Tagen in internationalen Fachzeitschriften erschienene Auswertungen teilweise langjähriger Studien über pharmakologische Interventionen.
In einer Metaanalyse von vier randomisierten kontrollierten 4.105 Patienten umfassenden Doppelblind-Studien, die eine Behandlung mit täglich 20 Milligram des weit verbreiteten Appetitzügler-Präparats "Rimonabant®" gegenüber einem Placebo verglichen, kommen die dänischen Forscher um Arne Astrup vom Department of Human Nutrition der Faculty of Life Sciences an der Universität von Kopenhagen zu einer Reihe bemerkenswerten Ergebnissen über Wirkungen dieser "Einwerfversion" des Abnehmens von Übergewicht:
• Als erstes reduziert das Medikament das Ausgangsgewicht um durchschnittlich 4,7 kg.
• Als zweites hatten jedoch die NutzerInnen von Rimonabant ein um 40% höheres Risiko nachteiliger oder auch schwerwiegender Zwischenfälle. Die mit diesem Mittel behandelte Patienten brachen die Therapie auf Grund depressiver Störungen zweieinhalb mal häufiger ab als die Placebo-Gruppe, und dreimal so oft beendeten sie die Behandlung auf Grund von Angstzuständen. Das Auftreten solch schwerer psychischer Störungen wie einer Depression ist insofern nicht ernst genug zu nehmen, weil die in diese Studien aufgenommenen Übergewichtigen und Fettsüchtigen ausdrücklich nicht depressiv sein durften bzw. das Vorliegen einer solchen Erkrankung ein Ausschlussgrund gewesen wäre. Als Ursache oder Auslöser dieser unerwünschten Wirkungen wird vermutet, dass Rimonabant, was einen Wirkstoff enthält, der auf die Cannabinoid-Rezeptoren vom Typ 1 hemmend wirkt, bei der Blockade dieser Rezeptoren für körpereigene Cannabinoide deren stimmungsaufhellender Effekt ebenfalls unterdrückt und dadurch die negativen Gefühlszustände auftreten.
• Drittens weisen die Metaanalytiker noch auf ein auch hier beobachtbares und weit verbreitetes methodisches Manko von Übergewichts- und Abnehmstudien hin, nämlich dem Fehlen von Nachuntersuchungen nach Ende der aktiven Therapie und der Unmöglichkeit etwaige Gewichtszuwächse bewerten zu können.
Unabhängig davon, ob dies mit Vorsatz oder unbeabsichtigt eintritt, skizzieren die Forscher in diesem Zusammenhang folgendes Szenario der medikamentösen Intervention: "Wie bei anderen Appetitzüglern auch wird nach dem Beenden der Therapie ein Rückfall erwartet. Um ein dauerhaftes Gewicht und die Verbesserung der Risikofaktoren für das Herz-Kreislaufsystem und Diabetes beizubehalten, müssen die Medikamente lebenslang eingenommen werden." 2005 betrug der weltweite Umsatz mit Appetitzügler immerhin 1,2 Millarden US-Dollar.
Die Schlussfolgerungen der Wissenschaftler, die auch noch andere, in den USA laufende Debatten berücksichtigen, sind eindeutig: "Taken together with the recent US Food and Drug Administration finding of increased risk of suicide during treatment with rimonabant, we recommend increased alertness by physicians to these potentially severe psychiatric adverse reactions."
Die Ergebnisse des Aufsatzes "Efficacy and safety of the weight-loss drug rimonabant: a meta-analysis of randomised trials" von Robin Christensen, Pernelle Kruse Kristensen, Else Marie Bartels, Prof Henning Bliddal und Prof Arne Astrup (The Lancet 2007; 370:1706-1713) finden sich in einem Abstract.
Zusätzlich werden die Ergebnisse noch unter der Überschrift "Depression and anxiety with rimonabant" von Ph. Mitchell und M. Morris kommentiert (The Lancet 2007; 370:1671-1672).
Die jetzt veröffentlichten Erkenntnisse zu unerwünschten schweren Nebenwirkungen von Appetitzügler relativieren auch etwas optimistischere Ergebnisse, die ebenfalls in diesem Jahr in früheren Ausgaben des "Lancet" publiziert worden waren.
In dem Aufsatz "Drug treatments for obesity: orlistat, sibutramine, and rimonabant" von Padwal und Majumdar (The Lancet 2007; 369:71-77), für den es nur ein Abstract gibt, empfahlen die Autoren zwar einerseits "antiobesity treatment … for selected patients in whom lifestyle modification is unsuccessful." Andererseits verbanden sie dies mit einigen, wie wir jetzt wissen, nicht substanzlosen Warnungen: "In light of the lack of successful weight-loss treatments and the public-health implications of the obesity pandemic, the development of safe and effective drugs should be a priority. However, as new drugs are developed we suggest that the assessment processes should include both surrogate endpoints (ie, weight loss) and clinical outcomes (ie, major obesity-related morbidity and mortality). Only then can patients and their physicians be confident that the putative benefits of such drugs outweigh their risks and costs."
Parallel zu diesem Ergebnis veröffentlichten kanadische Forscher im "British Medical Journal (BMJ)" ihre Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Rimonabant und zwei weiteren Appetitzüglern, Orlistat und Sibutramine.
Dazu reviewten sie die Ergebnisse von 30 doppelblinden, placebo-kontrollierten Studien, in denen fast 20.000 übergewichtige bzw. fettsüchtige Personen im Alter über 18 Jahren und mit einem Durchschnittsgewicht von 100 Kilogramm und einem Body Mass Index (BMI) von 35-36 Punkten eines der drei Medikamente mindestens ein Jahr einnahmen.
Am Ende der Interventionsphase waren die Orlistat-Patienten durchschnittlich 2,9 kg leichter, die Persionen, die Sibutramine einnahmen, waren 4,2 kg und die Rimonabant-Einnehmer sogar 4,7 kg leichter.
Alle Personen, die eines der drei Mittel einnahmen hatten auch eine höhere Wahrscheinlichkeit eine Gewichtsabnahme von 5-10% zu schaffen als die Personen, die ein Placebo einnahmen.
Dem standen in mehreren der reviewten Studien spezifische unerwünschte Effekte gegenüber und vor allem beendeten 30-40% der anfänglichen StudienteilnehmerInnen ihre Teilnahme vorzeitig. Solch hohen Drop-out-Raten sind zwar nicht selten, aber machen es noch schwerer, den Nutzen der medikamentösen Intervention tatsächlich zu bewerten.
Insgesamt blieb in den Studien auch ungeklärt, ob der Gewichtszuverlust stark genug war, um einen großen Gesundheits- und Lebenserwartungs-Nutzen damit zu realisieren. Teilweise untersuchten die Studien aber auch gar nicht den Effekt auf die Sterblichkeit oder das Neuauftreten (Inzidenz) spezifischer Erkrankungen.
Die Ergebnisse des Aufsatzes "Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis" von Diana Rucker, Raj Padwal, Stephanie K Li, Cintia Curioni und David C W Lau (BMJ Online vom 15 November 2007) kann man sich als Abstract und als komplette 11-seitige PDF-Version als BMJ-Online-Veröffentlichung herunterladen.
Unter Berücksichtigung der kanadischen und dänischen Forschungsergebnisse weist der britische Mediziner Gareth Williams schließlich noch auf die besondere aktuelle Problematik der in den USA laufenden Zulassung einiger Anti-Obesity-Medikamente zum freien Verkauf ohne Verordnung hin: "Selling anti-obesity drugs over the counter will perpetuate the myth that obesity can be fixed simply by popping a pill and could further undermine the efforts to promote healthy living, which ist he only long term escape from obesity."
Bernard Braun, 19.11.2007
Mangelnde Beratung über Empfängnisverhütung bei Verordnung fruchtschädigender Arzneimittel für gebärfähige Frauen
 Die Erkenntnis, dass die Verordnung und Einnahme jeglicher Medikamente bei aktuell oder möglicherweise in naher Zukunft schwangeren Frauen ein besonderes Risiko in sich bergen und daher auch von einer Beratung über Methoden der Empfängnisverhütung begleitet werden müssen, scheint weitverbreitet und Standard zu sein. Dies gilt noch mehr für Medikamente, von denen ein erhöhtes Risiko der Fruchtschädigung wissenschaftlich und "amtlich" bekannt ist und durch eine entsprechende Klassifikation klar und eindeutig signalisiert wird.
Die Erkenntnis, dass die Verordnung und Einnahme jeglicher Medikamente bei aktuell oder möglicherweise in naher Zukunft schwangeren Frauen ein besonderes Risiko in sich bergen und daher auch von einer Beratung über Methoden der Empfängnisverhütung begleitet werden müssen, scheint weitverbreitet und Standard zu sein. Dies gilt noch mehr für Medikamente, von denen ein erhöhtes Risiko der Fruchtschädigung wissenschaftlich und "amtlich" bekannt ist und durch eine entsprechende Klassifikation klar und eindeutig signalisiert wird.
Ernüchternd ist insofern eine Studie, die in den USA auf Basis der Verordnungsdaten von 488.175 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren für das Jahr 2001 gemacht wurde, die bei einer HMO in Nordkalifornien krankenversichert waren.
Diese sich durchweg im gebärfähigen Alter befindlichen Frauen erhielten in diesem Jahr 1.011.658 Arzneimittelverordnungen der Klassifikation A, B, D oder X. Von den Medikamenten vom amtlich zugewiesenen Typ D oder X ist ihre Fähigkeit Missbildung zu erzeugen oder ihre so genannte Teratogenität bekannt, die Klassen A und B sind hier sicherer.
Untersucht wurden nun die Verordnungshäufigkeit der teratogenen Präparate, die mit ihrer Verordnung verbundene Beratung über Empfängnisverhütung als eine Vorsichtsmaßnahme bei der wahrscheinlich zeitlich begrenzten Notwendigkeit, solche Medikamente einzunehmen und die Häufigkeit von Schwangerschaften innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt eines solchen Medikaments.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Ein Sechstel aller Frauen, die überhaupt eine Arzneimittelverordnung erhielten, erhielt ein Klasse D oder X-Präparat.
• Frauen, die ein solches Medikament verordnet bekamen, wurden keineswegs häufiger über das Risiko und die Möglichkeiten von prophylaktischer Empfängnisverhütung beraten (48 %) als Frauen mit Typ A und B-Präparaten (51 %). Dies umfasst auch die Verordnung von empfängnisverhütenden Mitteln.
• Mit einer Ausnahme (Verordnung von Isotretinoin zur Behandlung schwerer Formen von Akne)galt diese Nichtberatung für alle Typ D oder X-Medikamente.
• Frauen mit verordneten potenziell missbildungsverursachenden Medikamenten wurden nur geringfügig weniger innerhalb der 3-Monatsfrist nach Beginn einer Arzneimitteltherapie dieser Art schwanger als Frauen mit A oder B-Medikamenten (1 % versus 1,4 %). Soweit in den Daten ersichtlich war, trat keine der möglichen Missbildungen auf.
Auch wenn man aufgrund der Daten möglicherweise den Mangel an Empfängnisverhütungs-Beratung und die Medikation etwas überschätzt, kommt man nicht darum herum, dass zumindest diesen kalifornischen Frauen häufig potenziell fruchtschädigende Medikamente ohne jegliche Beratung zur vorbeugenden Empfängnisverhütung verordnet worden sind.
Was man mit den Daten nur schlecht untersuchen kann ist die noch weitergehende Frage, ob die Verordnung dieser Art von Medikamenten wirklich medizinisch notwendig war oder nicht hier bereits ein massives Qualitätsproblem bzw. ein gering entwickeltes Problembewusstsein bei den verordnenden Ärzten vorliegt.
Zum Aufsatz "Documentation of Contraception and Pregnancy When Prescribing Potentially Teratogenic Medications for Reproductive-Age Women" von Schwarz, Postlethwaite, Hung und Armstrong in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (18 September 2007, Volume 147 Issue 6: 370-376) gibt es ein kostenfreies Abstract.
Bernard Braun, 18.9.2007
Niederlage für Novartis: Kein Patent für Glivec in Indien
 Der Versuch des schweizerischen Pharma-Unternehmens Novartis, in dem asiatischen Land ein Patent für sein Leukämiemedikament Glivec® (Imatinib) zu bekommen, ist vorerst gescheitert. Für den Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten fällte das Hohe Gericht der Stadt Chennai am 6. August ein wichtiges Urteil: Glivec® ist keine entscheidende Innovation in der Arzneimittelversorgung. Gemäß der indischen Patentgesetzgebung können geringfügige Variationen existierender Medikamente kein neues Patent begründen. Einen kurzen Überblick über die Hintergründe lieferte das Deutsche Ärzteblatt in seiner Ausgabe vom 30.1.2007.
Der Versuch des schweizerischen Pharma-Unternehmens Novartis, in dem asiatischen Land ein Patent für sein Leukämiemedikament Glivec® (Imatinib) zu bekommen, ist vorerst gescheitert. Für den Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten fällte das Hohe Gericht der Stadt Chennai am 6. August ein wichtiges Urteil: Glivec® ist keine entscheidende Innovation in der Arzneimittelversorgung. Gemäß der indischen Patentgesetzgebung können geringfügige Variationen existierender Medikamente kein neues Patent begründen. Einen kurzen Überblick über die Hintergründe lieferte das Deutsche Ärzteblatt in seiner Ausgabe vom 30.1.2007.
Damit ist der Versuch des Schweizer Multis gescheitert, hohe Preise für sein Medikament durchzusetzen. Weltweit war das Urteil mit Spannung erwartet worden, hätte es doch einen Präzedenzfall für zahlreiche weitere Verfahren gebildet. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen sind die meisten der ungefähr 9000 Patentanträge für Medikamente in Indien ähnlich gelagert: Firmen versuchen durch geringfügige Veränderungen ein neues Patent zu bekommen. Indien ist derzeit mit Abstand der wichtigste Lieferant für preiswerte Medikamente für arme Länder. Eine Monopolisierungsstrategie hätte drastische Folgen für die Arzneimittelpreise.
Die Rolle Indiens als Apotheke für die Armen der Welt scheint zunächst gesichert zu sein. Doch der Erfinder des Wirkstoffs will das nicht einsehen: Novartis hat entgegen eigenen Ankündigungen, "wahrscheinlich keine Berufung" gegen das Urteil einzulegen, nochmals nachgelegt, wie aus einem Schreiben des "Head of Global Public Affairs" von Novartis an UnterzeichnerInnen der OXFAM trade fair Unterschriftenaktion 10.8.2007 im Internetforum e-drug vom 10.8.2007 hervorgeht. Vor dem Hohen Gericht von Madras beantragte die Firma, einen Beteiligten an der Entscheidung gegen das Patent wegen Befangenheit abzulehnen. Eine Stellungnahme von Médecins sans Frontičres -MSF vom selben Tag kritisiert die das Vorgehen von Novartis ebenfallsals Hemmschuh für die Verbesserung zur Gesundheitsversorgung in der Welt. Die Position des Schweizer Pharma-Multis ist ebenfalls in e-drug nachzulesen.
Gäbe das Gericht dem Ansinnen statt, müsste der Fall nochmals neu aufgerollt werden, meldete die indische Tageszeitung Hindu am selben Tag. Mittlerweile hat der Konzern den Ausbau seiner Forschungsaktivitäten in Indien als Reaktion auf die Nichterteilung des Patents gestoppt, wie die Frankfurter Rundschau in ihrer Ausgabe vom 23.8.2007 meldete. In einer Stellungnahme von Novartis behauptet das Unternehmen, eine Verbesserung des Patentrechts in Indien käme letztlich den Patienten und der Gesellschaft zu Gute. Wie fast immer in solchen Fällen begründet Novartis dies damit, dass nur ausreichender Patentschutz hinreichende Anreiz für Unternehmen biete, in "Innovationen und damit pharmazeutischen Fortschritt" zu investieren. Novartis-Forschungschef Paul Herrling droht ganz unverhohlen: "Es steht außer Frage, dass die Unzulänglichkeiten des indischen Patentgesetzes negative Konsequenzen für die Patienten und die öffentliche Gesundheit in Indien haben werden". Wie in solchen Fällen übergehen Vertreter der Pharma-Multis sang- und klanglos die wesentliche Rolle der öffentlichen Hand für die Pharmaforschung.
Brian Duker, der wichtigste Forscher bei der Entwicklung von Imatinib, hat kein Verständnis für die Haltung von Novartis: "Viele WissenschaftlerInnen, wenn nicht die meisten mit denen ich [..] zusammengearbeitet habe, machen Forschung in der Suche nach Wissen als einem Mittel PatientInnen zu helfen. Viele dieser WissenschaftlerInnen sind deshalb sehr besorgt, dass die Ergebnisse ihrer Bemühungen die PatientInnen nicht erreichen und kein Leben retten können, wegen Preisstrategien und Patentpolitik wie das "patent evergreening" (kleine Veränderungen an bekannten Molekülen zum Zweck der Verlängerung des Patentmonopols), die Partner weiter am Ende des Entwicklungsprozesses betreiben. [...] Der Preis, für den Novartis Imatinib weltweit zum Verkauf anbietet, hat in mir erhebliches Unbehagen ausgelöst. Pharmafirmen, die in die Entwicklung von Medikamenten Geld gesteckt haben, sollten ihre Investitionen wieder hereinholen können. Dazu gehört nicht der Missbrauch dieser Exklusivrechte durch exorbitante Preise und der Versuch, über minimale Veränderungen die Zeit für Monopolpreise auszudehnen. Das widerspricht dem Geist des Patentsystems und ist angesichts der entscheidenden jahrzehntelangen Investitionen der öffentlichen Hand, ohne die es gar nicht zur Entdeckung dieser Medikamente gekommen wäre, nicht gerechtfertigt."
Eine aktuelle Übersicht über Novartis Rolle in Indien ist kostenfrei herunterzuladen mit dem Pharma-Brief 6/2007
Jens Holst, 7.9.2007
Big Pharma's Data Collectors versus Maine, Vermont and New Hampshire - Wie viel dürfen Pharmafirmen über Ärzte wissen?
 Weltweit sammeln darauf spezialisierte Firmen Daten über die konkret von Ärzten verordneten Medikamente und verkaufen diese Informationen mit genauen Angaben zum Arzt an die Hersteller dieser Medikamente. Diese Informationen werden dann für gezielte Marketingaktivitäten bei diesen Ärzten benutzt.
Weltweit sammeln darauf spezialisierte Firmen Daten über die konkret von Ärzten verordneten Medikamente und verkaufen diese Informationen mit genauen Angaben zum Arzt an die Hersteller dieser Medikamente. Diese Informationen werden dann für gezielte Marketingaktivitäten bei diesen Ärzten benutzt.
Die Ärzte, die ein bestimmtes Medikament der Firma X nicht oder wenig verordnen, werden gezielt von entsprechend munitionierten Pharmavertretern besucht und über die vermeintlichen Vorteile einer häufigeren Verordnung des Medikaments informiert. Dass dabei auch ein Bündel von Werbeanreize eine Rolle spielen kann, ist hinlänglich bekannt. So genannte A-Ärzte, d.h. Ärzte, die ein bestimmtes Präparat der Firma X schon häufig verordnen, werden weniger besucht, dafür kann dort der Kollege der Firma Y aufgrund von Hinweisen aus demselben Datenfundus auftauchen.
Wer in etwas lockerer Form hören will, wie diese Praxis und auch alle weiteren Marketingaktivitäten der Pharmaindustrie bei Ärzten ablaufen, kann jetzt die von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und der AOK Hessen produzierte und schon an alle 8.000 hessischen Ärzte versandte CD "Pharmamarketing" auch als Nichtarzt und außerhalb Hessens im Handel erhalten (ISBN 978-3-00-021057-0).
Über die Zulässigkeit dieser systematischen und nicht-anonymisierten Datensammlung haben sich die Politiker in den US-Bundesstaaten Maine und Vermont über eine Informations-CD hinaus so viel Gedanken gemacht, dass sie beide Gesetze (so genannte "Physician Prescription Confidentiality Laws") verabschiedeten, die diese Praxis im Prinzip unterbinden und am 1. Januar 2008 in Kraft treten sollen.
Drei der teilweise auch in Deutschland auf diesem Feld aktiven Firmen, IMS Health, Wolters Kluwer Health und Verispan, haben jetzt mit dem Ziel, ihr Inkrafttreten zu verhindern, vor einem Bundesgericht Klagen bzw. Rechtsbeschwerden gegen diese Gesetze und die Bundesstaaten erhoben.
Die Beschwerdeführer sind der Überzeugung, dass diese Gesetze wie ein ähnliches im Bundesstaat New Hampshire verfassungswidrig sind, und vor allem gegen das "First Amendment" der US-Verfassung verstoßen, indem sie die Weitergabe legal erlangter Information verböten und außerdem gegen das "14th Amendment" verstoßen, indem sie den interstaatlichen Handel erschwerten.
Ohne die Möglichkeit Daten zu haben, die einem identifizierbaren Verordner zugewiesen werden könnten, würde die Gesellschaft ein mächtiges Instrument verlieren, um einen Überblick über die Sicherheit neuer Arzneimittel zu bekommen und sicher sein zu können, dass Patienten, die Arzneimittel einnehmen nicht davon geschädigt würden - so die drei Datensammler und -vermarkter.
Gegen das Gesetz in New Hampshire war bereits im Frühjahr 2007 erfolgreich von denselben Interessenten geklagt und ein erster Sieg errungen worden: Ein Bundesrichter sah das Verfassungsrecht auf freie Rede gefährdet und gab den Klägern recht. Das durch New Hampshire beantragte Berufungsverfahren ist noch nicht entschieden.
In Vermont erzeugte aber der erste Richterspruch immerhin den Effekt, dass dort trotz des Gesetzes solche Daten gesammelt und den Arzneimittelfirmen weiterverkauft werden dürfen, wenn es der einzelne Arzt erlaubt.
Trotz der Klageeinreichung der drei Pharmadatenhändler hält der geschäftsführende Direktor der "Vermont Medical Society", Paul Harrington, am Gesetz mit folgenden Argumenten fest: "We feel the laws are appropriate in that they keep the physicians' prescribing information out of the hands of the drug company marketers and curtail the drug companies being able to effectively go into the physicians' offices, having the prescribing information and tailoring their marketing, knowing what the physician is prescribing."
Wen die Legitimität des weitgehend unbekannten aber legalen Treiben dieser Firmen auch in Deutschland interessiert und stört, findet sicherlich in den kommenden Verfahren gegen die drei Bundesstaaten eine Menge Pro- und Contra-Argumente zum bisher offenherzigen Umgang mit individuellen Daten in dem ansonsten beispielsweise für eine umfassende Versorgungsforschung strikt anonym gehaltenen Gesundheitswesen Deutschlands. Ob das Grundgesetz, das SGB V und weitere Gesundheitsgesetze diese extrem interessengebundene Art von Datensammlung und -handel gegen jegliche Änderungsabsicht immunisieren, sollte dabei auch mal geprüft werden!?
Auf der Website der "Kaiser Family Foundation" findet sich mit Stand vom 31. August 2007 ein Überblick zu dem Komplex und der inneramerikanischen Berichterstattung "Prescription Drugs - Medical Data Collection Firms File Suits in Maine, Vermont over Physician Prescription Confidentiality Laws".
Wer sich für die O-Töne der drei Beschwerdeführer interessiert, findet hier die Gemeinsame Presserklärung von IMS Health, Wolters Kluwer Health and Verispan "Challenge State Laws Restricting Access to Critical Healthcare Information Prescribing Information Vital to Improving Healthcare Quality and Patient Safety; Similar Law in New Hampshire Ruled Unconstitutional". In dieser Erklärung finden sich noch einige Daten über die drei klagenden Firmen und ihre Tätigkeit.
Bernard Braun, 1.9.2007
Pro und Contra zu Nutzen und Implementation der HPV-Impfung: Schwerpunkt-Thema im Canadian Medical Association Journal
 Mit der Wirksamkeit und möglichen Alternativen zu der von einer Allianz aus Impfstoffherstellern, Ärzten und Krankenkassen zum "Durchbruch in der Krebsprävention" hochstilisierten Impfung gegen den Humanen Papillom Virus (HPV) als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat sich das Forum bereits umfangreich und kritisch beschäftigt.
Mit der Wirksamkeit und möglichen Alternativen zu der von einer Allianz aus Impfstoffherstellern, Ärzten und Krankenkassen zum "Durchbruch in der Krebsprävention" hochstilisierten Impfung gegen den Humanen Papillom Virus (HPV) als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat sich das Forum bereits umfangreich und kritisch beschäftigt.
Mittlerweile bezahlen praktisch alle gesetzlichen Krankenkassen aus Wettbewerbsgründen ihren jungen weiblichen Mitgliedern die Impfung und auch die Gynäkologen bieten bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Impfung an und dies ohne weitere Abwägung der z. B. bei älteren jungen Frauen mit langjährigem Geschlechtsleben möglichen Unwirksamkeit oder wesentlich geringeren Wirksamkeit der Impfung - so jedenfalls persönliche Berichte.
Trotzdem geht die kritische Debatte im In- und Ausland weiter.
Ein ausländisches Beispiel findet sich in mehreren Pro- und Contra-Aufsätzen und Kommentaren einer Schwerpunktnummer der neuesten Ausgabe (28 August 2007; Vol. 177, No. 5) des "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" zur HPV-Impfung, die sämtliche kostenfrei zugänglich sind.
In dem Editorial (CMAJ 2007;177 433) "Human papillomavirus vaccine: waiting for a miracle" weisen Noni MacDonald und Paul C. Hébert neben der Anerkennung, dass Forscher und Industrie ein derartiges Impfprodukt entwickelt haben (in der Tat gelten Impfstoffe in der Pharmaindustrie nicht unbedingt als so genannte "blockbusters" und werden daher vielfach vernachlässigt), auf die Vielzahl der erst zu klärenden Fragen hin: "There is still a lot to do. Despite a great beginning, there are many unanswered questions pertaining to long-term efficacy, optimal dosing, overall effectiveness against HPV in the real world and optimal delivery modalities in high-risk and impoverished populations."
In ihrem Aufsatz (CMAJ 2007;177 464-468) "Estimating the number needed to vaccinate to prevent diseases and death related to human papillomavirus infection" schätzen Marc Brisson; Nicolas Van de Velde, Philippe De Wals und Marie-Claude Boily die Anzahl von Frauen, die geimpft werden müssen (number needed to vaccinate) , um einige der erwarteten Erfolge erreichen zu können.
Es sind 8, um eine Episode mit Genitalwarzen zu verhindern und 324 um einen Fall von Zervikalkrebs zu verhindern. Ob diese Anzahl nun hoch oder niedrig ist, hängt von der tatsächlichen Wirkungsdauer der Impfung und weiteren Trends ab, die noch lange nicht geklärt sind.
Brisson et al. formulieren dies so: "When vaccine protection is assumed to be lifelong, the predicted numbers needed to vaccinate are low. This prediction reflects the high efficacy of prophylactic HPV vaccination reported in the clinical trials and the fact that the annual incidence of HPV-related diseases remains high in Canada despite current screening programs. However, if the mean duration of protection conferred by HPV vaccination is less than 30 years, the efficacy of the vaccine at preventing cervical cancer is predicted to be limited, unless booster doses are given."
Und abschließend: "However, the benefits (particularly in terms of cervical cancer reduction) are highly dependent on the duration of vaccine protection, on which evidence is currently limited. Recommendations regarding HPV vaccination should take into account the uncertainty regarding long-term vaccine efficacy. If mass HPV vaccination is implemented, cervical cancer screening must continue among vaccinated women, and careful long-term post-vaccination surveillance of vaccine fficacy will be essential."
In einem weiteren Aufsatz (CMAJ 2007;177 469-479) "Prophylactic vaccination against human papillomavirus infection and disease in women: a systematic review of randomized controlled trials" zeigen Lisa Rambout, Laura Hopkins, Brian Hutton und Dean Fergusson, dass eine prophylaktische HPV-Impfung hochwirksam zur Prävention impfstoffspezifischer HPV-Infektionen und Gebärmutterhalserkrankungen beiträgt.
In der Interpretation der von ihnen reviewten RCT-Studien zur HPV-Impfung formulieren sie aber mehrere Einschränkungen und Vorbedingungen für diese hohe Wirksamkeit: "Among women aged 15-25 years not previously infected with vaccine-type HPV strains, prophylactic HPV vaccination appears to be highly efficacious in preventing HPV infection and precancerous cervical disease. Long-term follow-up is needed to substantiate reductions in cervical cancer incidence and mortality" und "In summary, our systematic review demonstrates that prophylactic HPV vaccination is highly efficacious in preventing vaccine type-specific HPV infection and precancerous cervical disease, particularly among women aged 15-25 years with no prior abnormal results from Pap screening and no more than 6 lifetime sexual partners."
In dem Kommentar (CMAJ 2007;177 484-487) "Human papillomavirus, vaccines and women's health: questions and cautions" stellen Abby Lippman, Ryan Melnychuk, Carolyn Shimmin und Madeline Boscoe einige generelle Fragen und erheben Warnungen gegen ein überstürztes flächendeckendes Angebot derartiger Impfungen.
Dabei betonen sie, dass es im Moment keine Zervixkarzinom-Epidemie oder eine bedrohliche Situation gäbe, die es notwendig machen würde, ein Massen-Impfprogramm aufzubauen: "There is no epidemic of cervical cancer in Canada to warrant the sense of urgency for a vaccination program initiated by the federal finance minister's announcement. According to 2006 Canadian cancer statistics,4 cervical cancer is the 11th most frequent cancer affecting Canadian women and the 13th most common cause of cancer-related deaths, accounting for approximately 400 deaths per year. Both the incidence and mortality of cervical cancer have been declining in Canada, as in other resource-rich countries, although recently at a somewhat slower rate than has been observed in previous decades."
Die Autorinnen weisen auf erhebliche Erkenntnislücken - zwar nur in Kanada, aber ist das in Deutschland besser!? - über die Prävalenz des HPV bei Kindern und jungen Frauen hin. In Kanada fehlt auch noch jegliche Verständigung über die konkreten Ziele, die man mit der Impfung erreichen will. Je nachdem, ob man die Ausrottung des Virus erreichen will oder die Anzahl der mit Gebärmutterhalskrebs gestorbenen Frauen senken, muss ein Programm anders aussehen.
Ihre Kritik an der öffentlichen Debatte und an anderen Autoren dieser Ausgabe gipfelt in mehreren Feststellung, die wegen ihrer Bedeutung und Hintergründigkeit ausnahmsweise sehr ausführlich im Original zitiert werden: "Information about the efficacy of Gardasil (einer der Impfstoffe auf dem kanadischen Markt) remains uncertain. Its real-world effectiveness is even less clear. To date, only a handful of randomized controlled trials of sufficient quality to qualify for systematic review have been reported. Interestingly, each of the reported HPV vaccine trials, whether of Gardasil or its potential competitor Cervarix, was funded in whole or in part by the vaccine's manufacturer."
Der nächste Satz ist der Auftakt zu einem Hinweis, der tiefe Einblicke in die Vermarktungsstrategie dieses Impfstoffs zulässt. Er lautet: "Furthermore, we lack data on the effectiveness of the HPV vaccine when co-administered with other immunizations, as may occur in real practice. As well, will such factors as a person's nourishment, smoking status and general health (e.g., comorbidities) influence the safety or usefulness of the HPV vaccine? Perhaps more importantly, might misunderstandings about what the vaccine does and does not do lead to reductions in safer sex practices and Pap screening rates?"
Der angekündigte Einblick gelingt, wenn man der Bemerkung von Lippman et al. Glauben schenkt, dass diese Fragen in Kanada bereits "at the Research Priorities Workshop in Quebec City in November 2005," gestellt worden sind. Aber: "they remain pertinent — and unanswered."
Drei weitere Aufsätze runden das interessante Informations- und Analysenangebot dieser CMAJ-Ausgabe ab: Es handelt sich um den Aufsatz "Feasibility of self-collection of specimens for human papillomavirus testing in hard-to-reach women" von Gina Ogilvie et al. (CMAJ 2007;177 480-483) , der zeigt, dass es möglich ist an die hoch gefährdete Gruppe sozial randständiger Frauen mit dem Ziel heranzukommen, sie dazu zu bringen, selbst Proben für HPV-Tests einzusammeln.
Außerdem wird ein Informationsblatt für PatientInnen vorgestellt: "Patient information about HPV and the HPV vaccine" von Tave van Zyl et al. (CMAJ 2007;177 462) . In diesem Blatt findet sich im übrigen eine sehr zurückhaltend geschätzte Schutzdauer durch die Impfung von 5,5 Jahren.
In dem Aufsatz (CMAJ 2007;177 456-461) "Human papillomavirus vaccines launch a new era in cervical cancer prevention" stellen die Autoren um Meenakshi Dawar zum einen auch eine Vielzahl von "knowledge gaps" besonders über die langfristige Wirksamkeit fest, halten dies aber jedem neuen Impfprogramm für üblich. Ihr Fazit: "We strongly recommend a universal publicly funded vaccination program aimed at immunizing adolescent females before they are at risk of HPV infection."
Bernard Braun, 29.8.2007
Beispiel Statine: Ärzte ignorieren und verschweigen oft Beschwerden von Patienten über Arzneimittel-Nebenwirkungen
 Die im August 2007 in der US-Fachzeitschrift "Drug Safety" veröffentlichten Ergebnisse einer von Beatrice Golomb et al. von der Universität von Kalifornien in San Diego durchgeführten Studie mit 650 knapp über 60 Jahre alten und in den USA lebenden Patienten unterstreichen oder belegen diese zugespitzten Formulierungen so nachdrücklich, dass es unmöglich ist, von Defiziten "weniger schwarzer Schafe" oder von Informationsschwächen oder Desinteresse bei exotischen Medikamenten zu sprechen.
Die im August 2007 in der US-Fachzeitschrift "Drug Safety" veröffentlichten Ergebnisse einer von Beatrice Golomb et al. von der Universität von Kalifornien in San Diego durchgeführten Studie mit 650 knapp über 60 Jahre alten und in den USA lebenden Patienten unterstreichen oder belegen diese zugespitzten Formulierungen so nachdrücklich, dass es unmöglich ist, von Defiziten "weniger schwarzer Schafe" oder von Informationsschwächen oder Desinteresse bei exotischen Medikamenten zu sprechen.
Dies fängt damit an, dass es in der Studie um mögliche Nebenwirkungen von Statinen geht, also hochpotenten und weltweit häufig verordneten Arzneimitteln über deren Wirkungen und Nebenwirkungen praktisch in jedem wissenschaftlichen oder auch standespolitischen Journal sowie in der guten Tagespresse ausführlich berichtet wurde und wird.
Ein erklärtes Ziel der Studie war es im übrigen, zu prüfen, ob Wahrnehmungen von Patienten über so genannte "adverse drug reactions (ADR)" nicht ergänzend zu Herstellerinformationen und Hinweisen anderer Institutionen und Expertenkreise zur Risikoberichterstattung herangezogen werden können. Dafür wäre aber die Weitergabe durch Ärzte die zentrale logistische Voraussetzung.
Die meisten der Studienteilnehmer nahmen Statine ein und 78 % der 650 PatientInnen beschwerten sich bei ihrem Arzt über Muskelschmerzen, Gedächtnisverluste, Taubheit in Händen und Füßen oder andere mögliche ADRs der Statine bzw. sprachen ihren Arzt darauf an und baten um (Er-)Klärung. Zu diesen Nebenwirkungen und der Kommunikation und Interaktion mit ihrem Arzt, befragten die kalifonischen ForscherInnen die Patienten dann nochmals ausführlich.
Dabei kamen zwei bemerkenswerte Charakteristika des Umgangs von Ärzten mit Patientenmitteilungen über Nebenwirkungen an die Öffentlichkeit:
• Bei nahezu allen Nebenwirkungskomplexen waren die Patienten und nicht die Ärzte initiativ zu klären, ob ihre Symptome etwas mit den verordneten Statinen zu tun haben könnten. 98 % der Gespräche über Wahrnehmungsproblemen wurden von Patienten und 2 % von Ärzten initiiert, 96 % zu 4 % sah das Verhältnis bei neuropathischen Problemen aus und 86 % zu 14 % bei Muskelproblemen.
• Die meisten der Patienten berichteten ferner, dass ihre Ärzte fast durchweg einen Zusammenhang oder die Möglichkeit eines Zusammenhangs der Probleme mit dem Arzneimittel ignorierten oder ins Reich der Phantasie verwiesen bzw. sie stattdessen dem Alter der Patienten anlasteten. Dies traf sogar auf Symptome zu, die in der gesamten Literatur als hochgradig mit der Einnahme von Statinen assoziiert gelten oder wo andere Umstände einen Zusammenhang individuell hochevident machte. Erstaunt fasste der Leiter der Studie dieses Geschehen so zusammen: "Person after person spontaneously (told) us that their doctors told them that symptoms like muscle pain couldn't have come from the drug. We were surprised at how prevalent that experience was."
Da die Forscher keinen Grund sehen, dass sich die Patient-Arzt-Interaktion über ADRs in den USA bei anderen Medikamenten und anderen Symptomen besser gestaltet, halten sie konsequent die Ärzte als Lieferant für eine korrekte Schätzung des Umfangs von ADR für grundsätzlich ungeeignet: Die Studie belege "that doctor reports on side effects [are] a very unreliable means of learning about the true extent of problems." Wer sich auf Arztberichte an die staatlichen Arzneimittelkontrolleinrichtungen (in den USA die "Food and Drug Administration (FDA)") verlasse unterschätze die Probleme erheblich und andere Ärzte und Patienten bekämen einen sichereren Eindruck über das Arzneimittel als er in Wirklichkeit berechtigt ist. Andere Experten wie Jerry Avorn, Professor an der Harvard Medical School, schätzen, dass 90 bis 99 % der ernsten Nebenwirkungen von den Ärzten nicht weiterberichtet werden.
Da sich Patienten prinzipiell als wichtige und verlässliche Informationsquelle für alltägliche Nebenwirkungen erwiesen hätten, müsse nach anderen Methoden und Wegen gesucht werden als dem über die Ärzte, dieses Erfahrungswissen der Sicherheitsbewertung zugänglich zu machen.
Da es keine zwingenden Hinweis darauf gibt, dass deutsche Ärzte prinzipiell anders reagieren oder solange dies nicht sauber geklärt wird, ist zu fürchten, dass dieses Verhalten auch in Deutschland verbreitet ist und zu einer Unterschätzung von Arzneimittelrisiken beiträgt.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie und einiger Berichte in US-Zeitungen liefert der immer wieder generell uneingeschränkt empfehlenswerte tägliche Informationsdienst der "Kaiser Family Foundation".
Das Abstract des Aufsatzes "Physician Response to Patient Reports of Adverse Drug Effects: Implications For Patient-Targeted Adverse Effect Surveillance. Short Communication" von Golomb, Beatrice; McGraw, John; Evans, Marcella und Dimsdale, Joel in "Drug Safety" (30(8):669-675, 2007) erhält man hier kostenfrei.
Bernard Braun, 29.8.2007
Erhöhte Schwangerschafts- und Geburtsrisiken durch früheren medikamentösen Schwangerschaftsabbruch? Fehlanzeige!
 Mit der Zulassung der so genannten "Pille danach", Mifepristone oder RU-486, durch die Arzneimittelzulassungsbehörden (in den USA erfolgte dies 2000 durch die FDA), stieg auch der Anteil von Schwangerschaftsunterbrechungen mit diesem Arzneimittel.
Mit der Zulassung der so genannten "Pille danach", Mifepristone oder RU-486, durch die Arzneimittelzulassungsbehörden (in den USA erfolgte dies 2000 durch die FDA), stieg auch der Anteil von Schwangerschaftsunterbrechungen mit diesem Arzneimittel.
Zu der damaligen Pro- und Contradebatte gehörten neben den moralischen Argumenten und der Furcht davor, dass mit diesem Medikament wichtige Hürden vor einem Schwangerschaftsabbruch zu niedrig würden, auch Vermutungen und Prognosen über die spezifischen Risiken dieser Abbruchmethode für eine spätere Schwangerschaft und Geburt eines Kindes.
Neben der sowieso bereits weit verbreiteten Medikalisierung und Risikoanreicherung normaler Schwangerschaften und Geburten schienen den Frauen nach einer Schwangerschaftsunterbrechung mit der "Pille dannach" noch weit häufiger spontane Fehlgeburten, Geburten mit diversen Fehllagen, vorzeitige Geburten (vor der 37. Schwangerschafts-Woche) und ein niedriges Geburtsgewicht (unter 2.500 Gramm) des Kindes zu drohen. Ihnen jedenfalls häufiger als den Frauen, die eine operative Unterbrechung bevorzugt hatten.
Ob diese Prognosen und Befürchtungen stimmen, untersuchte ein überwiegend aus dänischen GesundheitsforscherInnen bestehendes Team nun mit Daten von 11.814 dänischen Frauen, die in der Vergangenheit eine medikamentöse (2.710 Frauen) oder chirurgische Schwangerschaftsunterbrechung (9.104 Frauen) im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft durchführten und später noch eine mit der Geburt eines Kindes abgeschlossene Schwangerschaft hatten. Die von Virk, Zhang und Olsen durchgeführte Studie ist im August 2007 unter dem Titel "Medical Abortion and the Risk of Subsequent Adverse Pregnancy Outcomes" im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (volume 357, 7: 648-653) erschienen.
Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig:
• Nach einer sorgfältigen Standardisierung und Gewichtung solcher Einflussfaktoren wie dem Alter der Mutter, den Abständen zwischen den Schwangerschaften oder auch ob sie in der Stadt oder auf dem Lande wohnten, waren verschiedene prognostizierten Risiken für Frauen mit einem medikamentösen Abbruch gegenüber denjenigen mit einem operativen Abbruch "not associated with a significantly increased risk".
• Das relative Risiko für eine spontane Fehlgeburt lag bei 0,87 (95% CI [Confidence Intervall], 0.72 to 1.05), das für Fehllagenschwangerschaften bei 1,04 (95% CI, 0.76 to 1.41), für eine Frühgeburt bei 0.88 (95% CI, 0.66 to 1.18) oder ein niedriges Geburtsgewicht bei 0.82 (95% CI, 0.61 to 1.11).
• Auch der Zeitpunkt der Entwicklung der Schwangerschaft zu dem der Abbruch erfolgte, war nicht statistisch signifikant mit irgendeinem der hier erwähnten unerwünschten Folgewirkungen assoziiert.
• Erwähnenswert sind abschließend die errechneten Inzidenzraten der unerwünschten Ereignisse beider Abbruchsvarianten: Fehllagenschwangerschaft 2,4 % (medikamentös) und 2,3 % (operativ), spontane Fehlgeburt 12,2 % und 12,7 %, Frühgeburt 5,4 % und 6,7 % und niedriges Geburtsgewicht 4 % und 5,1 %.
Das Abstract zu dem NEJM-Beitrag ist hier nachzulesen: "Medical Abortion and the Risk of Subsequent Adverse Pregnancy Outcomes" von Jasveer Virk; Jun Zhang; und Jřrn Olsen.
Bernard Braun, 17.8.2007
Therapie des "Zappelphilipp-Syndroms": Kinder geschiedener Eltern bekommen häufiger Medikamente verordnet
 Wenn Eltern sich scheiden lassen und das Kind danach Symptome des sogenannten "Zappelphilipp-Syndroms" zeigt (Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitäts - Syndrom - ADHS), dann besteht ein doppelt so großes Risiko wie bei zusammen lebenden und verheirateten Eltern, dass dieses Kind ein Medikament wie Ritalin verschrieben bekommt, um die Verhaltensauffälligkeiten zu behandeln. Dies ist das Ergebnis einer kanadischen Längsschnittstudie, die jetzt in der Zeitschrift "Canadian Medical Association Journal" veröffentlicht wurde.
Wenn Eltern sich scheiden lassen und das Kind danach Symptome des sogenannten "Zappelphilipp-Syndroms" zeigt (Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitäts - Syndrom - ADHS), dann besteht ein doppelt so großes Risiko wie bei zusammen lebenden und verheirateten Eltern, dass dieses Kind ein Medikament wie Ritalin verschrieben bekommt, um die Verhaltensauffälligkeiten zu behandeln. Dies ist das Ergebnis einer kanadischen Längsschnittstudie, die jetzt in der Zeitschrift "Canadian Medical Association Journal" veröffentlicht wurde.
Erst im vergangenen Jahr hatte eine Studie gezeigt, dass durch Aggressivität oder "Hyperaktivität" verhaltensauffällige Kinder, die bei nur einem Elternteil leben, doppelt so oft mit Medikamenten (mit dem Wirkstoff Methylphenidat) behandelt werden wie wenn sie in der Obhut von zwei Elternteilen sind. vgl. Correlates of Methylphenidate Use in Canadian Children: A Cross-Sectional Study (Can J Psychiatry, Vol 51, No 1, January 2006). Auch für Kinder, die bei Stiefeltern leben, hatten sich ähnliche Ergebnisse gezeigt.
Eine neuere Studie hat jetzt angedeutet, dass möglicherweise nicht das Fehlen eines Elternteils der eigentliche Risikofaktor ist, sondern der durch die Scheidung bei Eltern wie Kindern gleichermaßen ausgelöste Stress. Basis der Studie war die "National Longitudinal Survey of Children and Youth", die in Kanada zwischen 1994 und 2000 durchgeführt wurde. Die Wissenschaftlerin Lisa A. Strohschein beschränkte ihre Analysen auf rund 5.000 Kinder, die am Anfang der Untersuchung in einem Haushalt mit zwei Elternteilen lebten, die auch in biologischer Hinsicht Vater und Mutter waren.
Im Zeitraum 1994-2000 mussten 633 Kinder (13%) erleben , dass ihre Eltern sich scheiden ließen. Kontrolliert wurde ferner anhand von Interviewdaten, die mit den Eltern durchgeführt worden waren, ob fas Kind jemals ein Methylphenidat-haltiges Arzneimittel wie Ritalin verschrieben bekommen und eingenommen hatte. Es zeigte sich dann: 3,3% der Kinder in stabilen Familienverhältnissen hatten das Medikament bekommen, aber doppelt so viele (6,1%) bei geschiedenen Eltern. Auch nach Kontrolle einiger anderer Faktoren (Alter der Mutter, des Kindes, Geschlecht) blieb dieser Befund so bestehen.
Die Wissenschaftlerin bietet in ihrer Diskussion der Untersuchungsergebnisse mehrere Interpretationsmöglichkeiten an. Zum einen könnte es sein, dass durch die Stresserfahrungen im Zusammenhang der Scheidung Kinder gravierende Symptome psychischer Störungen entwickeln, die dann - wie sie sagt, medizinisch zu Recht - medikamentös behandelt werden. Zum anderen ist aber auch denkbar, dass die Eltern selbst durch die Scheidung so starken psychischen Belastungen ausgesetzt sind, dass sie sich von Problemen und Verhaltensweisen ihres Kindes sehr viel stärker "genervt" fühlen als normal. Entweder tragen sie dann beim Arzt direkt einen Wunsch nach dem (in Kanada und USA mehr als bei uns bekannten und gebräuchlichen) Medikament vor oder der Arzt liest ihnen diesen Wunsch aufgrund der Kenntnis der Familiensituation von den Lippen ab. Im letzteren Fall, so Strohschein, wäre dies eine völlig unangebrachte medikamentöse Therapie.
Die Veröffentlichung zur Studie ist hier kostenlos im Volltext nachzulesen: Lisa A. Strohschein: Prevalence of methylphenidate use among Canadian children following parental divorce (CMAJ, June 5, 2007; 176 (12). doi:10.1503/cmaj.061458)
Vgl. zu ADHS auch: Forum Gesundheitspolitik: Der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung "hyperaktiver" Kinder hat sich weltweit verdreifacht
Gerd Marstedt, 2.8.2007
Neue und teurere orale Antidiabetika nicht wirksamer und nützlicher als "alte"! - Review über die Situation in den USA.
 Zu einem der umstrittensten Themen im Arzneimittelmarkt gehört die kontinuierliche Einführung neuer Arzneimittel, die meist teurer sind, aber mit dem Versprechen einhergangen, eine höhere Wirksamkeit sowie einen größeren Komfort zu bieten als die meist auch weiter dem Markt befindlichen "alten" Mittel. Gegen diese natürlich meist von den Herstellern dieser Neuangebote gepflegte Argumentationskulisse wenden unabhängige Arzneimittelexperten oft ein, es handle sich dabei häufig um Scheininnovationen oder "Me-too"-Präparate, die keinen zusätzlichen Nutzen für die Patienten böten aber den Umsatz und Gewinn der Hersteller erhöhten. Um die damit auch häufig verbundene Umgehung von Festbeträgen und anderen regulativen Eingriffen in die Kostenentwicklung der Medikamentenversorgung zu unterbinden, werden von den Skeptikern auch zusätzliche Nachweise des erhöhten Nutzen oder der verbesserten Wirksamkeit verlangt.
Zu einem der umstrittensten Themen im Arzneimittelmarkt gehört die kontinuierliche Einführung neuer Arzneimittel, die meist teurer sind, aber mit dem Versprechen einhergangen, eine höhere Wirksamkeit sowie einen größeren Komfort zu bieten als die meist auch weiter dem Markt befindlichen "alten" Mittel. Gegen diese natürlich meist von den Herstellern dieser Neuangebote gepflegte Argumentationskulisse wenden unabhängige Arzneimittelexperten oft ein, es handle sich dabei häufig um Scheininnovationen oder "Me-too"-Präparate, die keinen zusätzlichen Nutzen für die Patienten böten aber den Umsatz und Gewinn der Hersteller erhöhten. Um die damit auch häufig verbundene Umgehung von Festbeträgen und anderen regulativen Eingriffen in die Kostenentwicklung der Medikamentenversorgung zu unterbinden, werden von den Skeptikern auch zusätzliche Nachweise des erhöhten Nutzen oder der verbesserten Wirksamkeit verlangt.
Für einen Teilmarkt, nämlich der medikamentösen Versorgung von Diabetikern, also einer der größten Gruppen chronisch Kranker, haben jetzt ForscherInnen der Johns Hopkins University in Balimore (USA) einen Überblick zu den Ergebnissen vergleichender Forschung zu den Effekten "alter" und neuer Antidiabetika zu erstellt.
Das Ergebnis des Reviews von 216 kontrollierten und Kohorten-Studien und zwei anderen systematischen Reviews, die den Nutzen und die Probleme der oralen Diabetesmittel, die in den USA erhältlich sind untersucht hatten, liegt jetzt unter dem Titel "Systematic Review: Comparative Effectiveness and Safety of Oral Medications for Type 2 Diabetes Mellitus" als Aufsatz von Bolen et al. zunächst als Online-Dokument und dann am 18. September 2007 gedruckt in den "Annals of Internal Medicine" (Volume 147, Issue 6) vor.
Die wichtigsten Erkenntnisse lauten:
• In den meisten Studien werden bei der Untersuchung des Nutzens nicht die großen klinischen Endpunkte untersucht wie z. B. die Herz-/Kreislaufsterblichkeit, sondern meist nur die Beeinflussung von Endpunkten bzw. Parametern mittlerer Reichweite und Bedeutung ("intermediate end points").
• Die Nutzenindikatoren sind dann der Blutzuckerspiegel, verschiedene Blutfettwerte und das Gewicht, also teilweise nur Surrogatparameter.
• Beim Vergleich der neuen und teureren Wirkstoffen Thiazolidinedione ("Glitazone"), Alpha-Glukosidasehemmer und Meglitinide mit den "alten" Wirkstoffen Sulfonylharnstoffe der zweiten Generation und Metformin war die Wirkung der "alten" Wirkstoffe auf den Blutzuckerspiegel, die Blutfettwerte und andere "intermediate end points" gleich hoch oder sogar höher und besser als bei den Neupräparaten.
• Die ForscherInnen fordern allerdings abschließend trotzdem, es müssten große und langfristige vergleichende Studien über die Wirkung der oralen Antidiabetika auf harte klinische Endpunkte (z.B. Infarktsterblichkeit) durchgeführt werden.
Die Komplettfassung ist als Nicht-PDF-Version im Moment hier kostenlos erhältlich.
Das Abstract des bisher nur online vor-veröffentlichten Aufsatzes von Bolen, Feldman, Vassy, Wilson, Yeh, Marinopoulos, Wiley, Selvin, Wilson, Bass und Brancati "Systematic Review: Comparative Effectiveness and Safety of Oral Medications for Type 2 Diabetes Mellitus" ist kostenlos hier erhältlich.
Bernard Braun, 18.7.2007
"Taking Vioxx for a year is much more risky than a year travel, swimming, or being a firefighter"
 Mit der provokativen Frage "What’s More Dangerous, Your Aspirin Or Your Car? Thinking Rationally About Drug Risks (And Benefits)" startet in der neuesten Ausgabe der renommierten Public-Health-Zeitschrift "Health Affairs" (2007. Volume 26, Number 3: 636-646) ein ungewöhnlicher Vergleich, der verblüffende Ergebnisse zutage fördert.
Mit der provokativen Frage "What’s More Dangerous, Your Aspirin Or Your Car? Thinking Rationally About Drug Risks (And Benefits)" startet in der neuesten Ausgabe der renommierten Public-Health-Zeitschrift "Health Affairs" (2007. Volume 26, Number 3: 636-646) ein ungewöhnlicher Vergleich, der verblüffende Ergebnisse zutage fördert.
Die Autoren, Joshua Cohen und Peter J. Neumann, beide Mediziner an der Tufts-Universität in Massachussetts, wollen die weltweit geführte Debatte über die gesundheitlichen und ökonomischen Risiken von Arzneimitteln ergänzen oder anreichern. Dies wollen sie durch einen Vergleich der Mortalitätsrisiken anstellen, die mit ganz normalen Arzneimittel und mit anderen Lebensbereichen oder Produkten verbunden sind, mit denen Menschen heute zu tun haben, wie der Arbeitswelt, dem Transport oder Verkehr und dem Freizeit- und Erholungsbereich.
Wichtig sind den Autoren solche Vergleiche u.a. für die inner-amerikanische Debatte über die Kontrolle von Medikamentenrisiken durch die dafür zuständige US-Behörde "Federal Food and Drug Administration (FDA)". Nachdem zwischen 1975 und 1999 56 von 548 der von der FDA zugelassenen Arzneimittel wegen unerwünschten Wirkungen zurückgezogen oder mit "black box"-Warnungen versehen werden mussten und hierzu nach 2000 noch die großen Probleme mit weiteren wichtigen Arzneimitteln wie Vioxx oder Tysabri kamen, bekundeten in einer 2006 durchgeführten Umfrage des Instituts "Harris Interactive" 60 % der Erwachsenen eine negative Wahrnehmung der Fähigkeiten der FDA, die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln zu gewährleisten.
Unter Nutzung zahlreicher Statistiken und des ausgewählten ("useful starting point"), also keineswegs einzig möglichen Indikators "fatality risk / annual risk per 100.000 person-years" zeigen sich interessante Risikobilder:
• Zunächst einmal variiert das hier betrachtete Risiko innerhalb der betrachteten Risikobereiche erheblich: Bei den Medikamenten zwischen 0,07 für die Pockenschutzimpfung und 76 bei der Einnahme von Vioxx, wobei Aspirin mit 10,4 einen Mittelplatz einnimmt; Beschäftigungsrisiken schwanken zwischen 0,4 für Bürotätigkeiten und 357,6 von Holzfällern, mit Feuerwehrleuten mit 10,6 auf einem Mittelplatz; Bahnfahrten haben mit 0,11 tödlichen Ereignissen pro 100.000 Personenjahren das geringste Sterblichkeitsrisiko, Motorradfahren mit 450 das höchste und hier liegt das Risiko des Telefonierens (ohne Freisprecheinrichtung) während der Autofahrt mit 1,3 zwischen den Extremwerten; den maximalen Unterschied des Sterblichkeitsrisikos gibt es bei den "recreation"-Tätigkeiten, bei denen "Football"-spielen in der Highschool mit 0,058 am unteren und Bergsteigen im Himalaya mit 13.000 am oberen Ende der Skala liegen. Normales Felsklettern hat ein Risiko von 36 und Radfahren eines von 2,1.
• Die Arzneimittelrisiken liegen meist gleichauf mit den Verkehrsrisiken oder übersteigen sie sogar. Nur Motorradfahren ist risikoträchtiger als alle hier ausgewählten Arzneimittel (Pockenimpfstoff, Aspirin, erste Generation von Antihistaminen, Clozapine zur Behandlung von Schizophrenie, Tysabri zur Behandlung von multipler Sklerose und Vioxx zur Behandlung von arthritischen Schmerzen).
• Die Einnahme der Medikamente ist im Schnitt vergleichbar mit dem Sterblichkeitsrisiko von Feuerwehrleuten.
• Die meisten Freizeitaktivitäten haben ein deutlich geringeres Sterblichkeitsrisiko als die Einnahme der ausgewählten Medikamente.
Da die Bezugsgröße oder der Nenner der Berechnung beim Berufs-, Transport- und Erholungs/Freizeit-Risiko jeweils die Personen sind, die sich den verschiedenen Risiken exponieren, also z. B. Motorradfahren aber bei den Arzneimitteln die gesamte US-Bevölkerung, unterschätzen die Berechnungen mit Sicherheit das Risiko der Arzneimittel. Auf weitere Schwierigkeiten der Indikatorenbildung wird in dem Aufsatz eingegangen.
Nach diesem ersten Versuch eines etwas ungewöhnlichen Risikovergleichs sind die Autoren überzeugt, dass seine Ergebnisse auch die gesundheitspolitische Diskussion stimulieren und beflügeln kann: "The finding that taking Vioxx for a year is much more risky than a year travel, swimming, or being a firefighter suggests that greater scrutiny of drug risks may be warranted."
Eine wichtige wissenschaftliche Aufgabe ist ihres Erachtens die Weiterarbeit an den Problemen der Indikatorenbildung und die Entwicklung besserer Tools zur Risiko- und Nutzenmessung.
Der FDA schlagen sie vor, künftig bei der Bewertung der Sicherheit von Medikamenten Nutzen und Risiken systematischer darzustellen und zu vergleichen.
Ein Abstract des Aufsatzes von Cohen und Neumann "What’s More Dangerous, Your Aspirin Or Your Car? Thinking Rationally About Drug Risks (And Benefits)" finden Sie hier.
Zumindest der Zugang zu den Volltexten der teils kritischen elektronischen Leserbriefe ist über die Abstract-Seite möglich.
Der Volltext des Artikels ist leider nicht kostenlos zugänglich. Wer ihn aber haben will, kann sich hier online einen 24-Stundenzugang zu ihm für 12.95 US-$ kaufen.
Wem dies zu teuer erscheint und gleichzeitig weiß, dass er öfter auf diese Weise einen Artikel aus dieser Zeitschrift erstehen will oder muss, sollte sich überlegen, ob er als "individual subscriber" nicht bedeutend besser fährt. Ein Jahresabonnement für die gedruckte und die Online-Fassung von "Health Affairs" kostet für diese Art des Abonnenten nämlich im Moment mit 165 US-$ vielleicht weniger als mancher Interessent intuitiv befürchtet. Damit verbunden ist natürlich u.a. auch der Zugang zu dem umfangreichen Archiv der Zeitschriftenbeiträge.
Bernard Braun, 30.6.2007
Vorab-Erhalt der "Pille danach" hilft ungewünschte Schwangerschaft ohne "unerwünschte Nebenwirkungen" zu vermeiden
 Wenn es zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr kommt und eine ungewünschte Empfängnis befürchtet wird, besteht die Möglichkeit mittels einer deutlich erhöhten Dosierung der Hormone, die sich in normalen Verhütungspillen befinden, eine Art Notfall- oder Danach-Verhütung zu betreiben. Das Problem ist, dass dies schnell nach dem Geschlechtsverkehr geschehen muss, eine entsprechende Verordnung aber sowohl schwierig und oft nur zeitaufwändig zu erhalten ist. Dies könnte vermieden werden, wenn Frauen diese "Pille danach"im Vorhinein bekommen könnten und sie im Ernstfall zur Hand hätten. Damit wäre die "Notfallhektik danach" vermeidbar.
Wenn es zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr kommt und eine ungewünschte Empfängnis befürchtet wird, besteht die Möglichkeit mittels einer deutlich erhöhten Dosierung der Hormone, die sich in normalen Verhütungspillen befinden, eine Art Notfall- oder Danach-Verhütung zu betreiben. Das Problem ist, dass dies schnell nach dem Geschlechtsverkehr geschehen muss, eine entsprechende Verordnung aber sowohl schwierig und oft nur zeitaufwändig zu erhalten ist. Dies könnte vermieden werden, wenn Frauen diese "Pille danach"im Vorhinein bekommen könnten und sie im Ernstfall zur Hand hätten. Damit wäre die "Notfallhektik danach" vermeidbar.
Gegen diese Form der Liberalisierung und Handlungssicherheit gab und gibt es explizit und implizit eine Reihe gesundheitlicher, demografischer aber auch moralischer Einwände.
So besteht die Befürchtung, dass die Schwangerschaftshäufigkeit bei Frauen, welche die "Pille danach" besitzen, dramatisch sinkt. Es wird eine Veränderung des Sexualverhaltens befürchtet, das das Risiko von beim Geschlechtsverkehr erworbenen Infektionen spürbar erhöhe und dazu beitrage, andere Formen der Verhütung zu vernachlässigen. Hinter vielen der sachlich gehaltenen Argumente verbirgt sich wohl auch die Angst vor sexueller "Zügellosigkeit" und Libertinage.
Ob und was an den genannten Befürchtungen und Sorgen gegen die präventive Versorgung mit der "Pille danach" zutrifft oder moralisch "heiße Luft" ist, hat jetzt eine Reviewergruppe (Polis/Schaffer/Blanchard/Glasier/Harper und Grimes) der renommierten Cochrane Collaboration durch einen Vergleich der Ergebnisse wissenschaftlicher Studien mit Frauen geklärt, die entweder eine derartige Verordnung erhielten oder nicht erhielten.
Der gerade unter der Überschrift "Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention" erschienene Review (Cochrane Database Systematic Review. 2007. 18. April; 2:CD005497) enthält wissenschaftlich gesicherte und klare Daten zum tatsächlichen Effekt der präventiv vorhandenen "Pille danach" aus acht randomisierten kontrollierten Studien bei 6.389 Frauen in den USA, China und Indien und gibt eindeutige Empfehlungen.
Die wichtigsten Ergebnissen lauten:
• Der präventive Erhalt und Besitz der "Pille danach" führt nicht zu einer Senkung der Gesamt-Schwangerschaftshäufigkeit in den untersuchten Bevölkerungen. Noch eindeutiger fassen es die Cochrane-Reviewer so zusammen: "Studies showed that the chance of pregnancy was similar regardless of whether or not women have emergency contraception on hand before unprotected sex."
• Trotzdem greifen diese Frauen nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr häufiger und früher zu dem verordneten Mittel.
- Der Besitz der "Pille danach" und die Möglichkeit einer raschen Nutzung änderten nichts an der Nutzung anderer Verhütungsmittel und änderten auch nichts am Sexualverhalten der entsprechenden Frauen.
• Bei den Frauen mit dem präventiven Besitz der "Pille danach" war also weder eine Zunahme der Geschlechtskrankheiten zu beobachten noch stieg die Häufigkeit ungeschützter Sexualkontakte an oder änderte sich der Einsatz anderer Verhütungsmittel. Frauen mit der "Pille danach" bestanden praktisch gleich häufig auf der Nutzung von Kondomen wie die Frauen, die vor dem Geschlechtsverkehr keine "Pille danach" zur Verfügung hatten.
• Da die präventiv erhältliche "Pille danach" "does not negatively impact sexual and reproductive health behaviors and outcomes", ist die Empfehlung der Cochrane-Forscher eindeutig: "Women should have easy access to emergency contraception, because it can decrease the chance of pregnancy", sofern sie ungewünscht ist.
Ein kostenloses Abstract des Reviews findet sich auf der PubMed-Seite und der Startseite der Cochrane Library.
Wer Zugang zur "Cochrane Library" hat oder eine entsprechende Gebühr bezahlt, kann sich ebenfalls auf der Website der Cochrane Library die PDF-Version des kompletten Reviewtextes herunterladen.
Bernard Braun, 2.5.2007
Fakten und Zahlen zur Medikamentenabhängigkeit in Deutschland
 Verständlicher, kompakter und pluralistischer kann man das Problem der Medikamentenabhängigkeit in Deutschland kaum darstellen als es die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), der Bundesverband der Betriebskrankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in einem Faktenblatt zur Vorbereitung einer von ihnen am 23. April 2007 gemeinsam veranstalteten Fachtagung "Medikamentenabhängigkeit: gemeinsam handeln!" gemacht haben.
Verständlicher, kompakter und pluralistischer kann man das Problem der Medikamentenabhängigkeit in Deutschland kaum darstellen als es die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), der Bundesverband der Betriebskrankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in einem Faktenblatt zur Vorbereitung einer von ihnen am 23. April 2007 gemeinsam veranstalteten Fachtagung "Medikamentenabhängigkeit: gemeinsam handeln!" gemacht haben.
Danach ist das Geschehen durch folgende Aspekte gekennzeichnet, die durch zahlreiche Studien der letzten Jahre kontinuierlich belegt werden, also zumindest den ärztlichen und sonstigen hauptamtlichen Akteuren im Gesundheitswesen seit einiger Zeit bekannt sein müssen:
• Mindestens 1,4 Millionen Menschen in Deutschland medikamentenabhängig. Schätzungen sprechen sogar von bis zu 1,9 Millionen Menschen. Etwa 80 Prozent der Betroffenen sind abhängig von Schlaf- und Beruhigungsmitteln.
• Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen aller Altersgruppen. Ältere Menschen sind ebenfalls stark betroffen. Bei fast jedem neunten der 50- bis 59-Jährigen liegt ein problematischer Medikamentengebrauch vor.
• Jeder sechste Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren nimmt mindestens einmal pro Woche psychoaktive Arzneimittel ein.
• Ursachen für Medikamentenabhängigkeit ist oft ein Zusammenspiel von medizinischen, beruflichen, sozialen und psychischen Komponenten.
• Für Außenstehende ist die Abgrenzung zwischen sachgerechtem Gebrauch und einem dauerhaften, schädlichen und/oder abhängigen Gebrauch oft schwierig.
• Das weit verbreitete Phänomen der "Niedrig-Dosis-Abhängigkeit" durch Benzodiazepine ist meist jahrelang unauffällig. Charakteristische Folgesymptome: Einschränkung der geistigen Fähigkeiten, des Gefühlslebens und der körperlichen Leistungsfähigkeit.
• Laut offizieller Statistik beliefen sich die GKV-Ausgaben für Arzneimittel 2006 auf 25,87 Milliarden Euro.
• Etwa 4 bis 5 Prozent aller durch Ärzte meist über längere Zeit verordneten Arzneimittel besitzen ein Abhängigkeitspotenzial, vor allem die Schlaf- und Beruhigungsmittel aus der Familie der Benzodiazepine. Rund ein Drittel dieser Mittel werden nicht wegen akut medizinischer Probleme, sondern langfristig zur Suchtunterhaltung und zur Vermeidung von Entzugserscheinungen verordnet.
• Ein Missbrauchs- bzw. Abhängigkeitspotenzial weisen auch Schmerzmittel und Stimulanzien auf. Psychopharmaka wie Antidepressiva und Neuroleptika dagegen besitzen kein eigenständiges Abhängigkeitspotenzial.
• Die volkswirtschaftlichen Folgekosten der Medikamentenabhängigkeit werden derzeit auf ca. 14 Milliarden Euro geschätzt (Extrapolierung der Bundesärztekammer).
• Auch die direkten Krankheitskosten infolge des Gebrauchs von Substanzen mit Suchtpotenzial (u. a. Medikamente, Alkohol, Drogen) sind groß: 2004 betrugen sie laut Statistischem Bundesamt 2,6 Milliarden Euro.
• Eine stationäre Entwöhnung kostet in der Regel zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Patient.
Hier sind diese Fakten als Materialanhang zu einer Presseerklärung der drei Vereine bzw. Körperschaften im Original einsehbar.
Bernard Braun, 1.5.2007
Versicherungsschutz für Arzneimittel allein hat weniger gesundheitliche Wirkungen als erwartet.
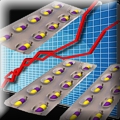 Zu den Versorgungsproblemen des us-amerikanischen Gesundheitssystems gehörte lange, dass die in der staatlichen Krankenversicherung Medicare versicherten RentnerInnen nicht von Beginn dieser Versicherung an, also seit 1965, einen vergleichbar breiten Zugang zur Verordnung von Arzneimitteln hatten, wie z.B. die privat Krankenversicherten. Erst 2003 wurde mit dem "Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA)" ein etwa gleicher Zugang geschaffen.
Zu den Versorgungsproblemen des us-amerikanischen Gesundheitssystems gehörte lange, dass die in der staatlichen Krankenversicherung Medicare versicherten RentnerInnen nicht von Beginn dieser Versicherung an, also seit 1965, einen vergleichbar breiten Zugang zur Verordnung von Arzneimitteln hatten, wie z.B. die privat Krankenversicherten. Erst 2003 wurde mit dem "Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA)" ein etwa gleicher Zugang geschaffen.
Dem MMA lagen die Erwartungen zugrunde, dass damit die Nutzung der Verordnungsmöglichkeit erhöht, die Versorgung mit Arzneimitteln wachsen und die Gesundheit der Senioren verbessert würde. Immerhin hatten Studien vor Inkrafttreten des MMA gezeigt, dass vielfach ärztliche Verordnungen aus Kostengründen nicht eingelöst oder Dosierungen nicht eingehalten wurden, was beispielsweise mehr als die Hälfte der Diabetes- und Herzkranken ohne Arzneimittelversicherung betraf.
Ob es aber tatsächlich systematische Unterschiede bei der Einnahme verordneter Arzneimittel gab, ob sich die betroffenen Patienten stattdessen stationär behandeln ließen und ob die Absicherung der Arzneimittel Einfluss auf die Gesundheit hat, wurde interessanterweise erst in den letzten Jahren genauer untersucht. Als Datenbasis dienten die "Medicare Current Beneficiary Data" für die Jahre 1992 bis 2000. Dieser nationale Survey ist repräsentativ, verfolgt die Befragten noch vier Jahre weiter in ihrer Entwicklung und verknüpft subjektive Befragungsdaten mit Routinedaten.
Die Ergebnisse ihrer Analysen fassten die Autoren Khan, Kaestner und Lin in einem gerade erschienenen Working Paper (Nr. 12848) des "National Bureau of Economic Research (NBER)" der USA unter dem Titel "Prescription Drug Insurance and ist Effect on Utilization and Health of the Elderly" zusammen.
Danach gibt es beim Vorhandensein einer Medikamentenversicherung gegenüber Personen ohne Versicherungsschutz
• keinen signifikanten Anstieg der Wahrscheinlichkeit einer Medikamentenverordnung und zwar unabhängig von der Form der Versicherung (öffentlich, HMO etc.),
• keinerlei Evidenz für die Vermeidung oder ein besseres Management von Krankenhausaufenthalten und
• eine nur geringe Evidenz dafür, dass ein Versicherungsschutz für Medikamente den selbst bewerteten Gesundheitszustand oder die "Activities of daily Living (ADL)" verbessert.
Für die zusätzliche Annahme, dass die Effekte zumindest bei ökonomisch benachteiligten Personen aufträten, gab es ebenfalls keine empirischen Anhaltspunkte.
Für den Mangel an Effekten auf die Gesundheit schlagen die Autoren mehrere Gründe vor:
• Ein steigender Medikamentenkonsum könnte auch eine größere Anzahl von Nebenwirkungen und unerwünschten Ereignissen bedeuten.
• Eine zweite Möglichkeit wäre, die dass eine Arzneimittel unangemessen verordnet wurden oder die verordnete Therapie keine Compliance bei den Patienten fand.
Die Gesundheitsökonomen kommen zu dem Schluss, dass allein ein verbesserter Arzneimittel-Versicherungsschutz keineswegs zu einer gesundheitlichen Verbesserung führen muss. Verbessert werden müssen u.a. auch noch die Verordnungsweisen und -qualität sowie die Vermittlung des Sinns der Medikation an die Patienten.
Eine etwas längere Zusammenfassung der Arbeit von Nasreen Khan, Robert Kaestner und Swu Jane Lin "Prescription Drug Insurance and ist Effect on Utilization and Health of the Elderly" findet sich kostenlos in der "Winter 2007"-Ausgabe (Nr. 18) des kostenlos abonnierbaren "Bulletin on Aging and Health" des NBER.
Für 5 US-Dollar kann der komplette Text auch als PDF-Datei heruntergeladen werden und wer Zugang zu den Literaturdatenbanken einiger Universitäten (z.B. Tübingen, Fernuni Hagen) hat, erhält diesen Text dort auch kostenfrei.
Bernard Braun, 24.4.2007
Neue Studien zeigen: Milliardenausgaben im Gesundheitswesen durch nicht eingenommene Medikamente
 Das Problem ist schon länger bekannt, mehrere Studien haben jedoch erneut darauf aufmerksam gemacht: Patienten mit einer chronischen Erkrankung, denen dauerhaft oder zumindest für einen längeren Zeitraum Medikamente verschrieben wurden, nehmen diese Medikamente nach einiger Zeit nicht mehr ein, und zwar ohne ärztliche Rücksprache. Rund 20-30% aller Patienten mit einer längerfristigen Arzneimittel-Verordnung, so schätzt man, setzen das Medikament vorzeitig ab. Diese fehlende "Compliance" oder "Adherence", wie neuerdings die mangelhafte Therapietreue und unzureichende Befolgung ärztlicher Therapie-Anweisungen genannt wird, gefährdet in vielen Fällen nicht nur den Behandlungserfolg. Darüber hinaus werden damit Milliardensummen im Gesundheitswesen völlig unsinnig ausgegeben.
Das Problem ist schon länger bekannt, mehrere Studien haben jedoch erneut darauf aufmerksam gemacht: Patienten mit einer chronischen Erkrankung, denen dauerhaft oder zumindest für einen längeren Zeitraum Medikamente verschrieben wurden, nehmen diese Medikamente nach einiger Zeit nicht mehr ein, und zwar ohne ärztliche Rücksprache. Rund 20-30% aller Patienten mit einer längerfristigen Arzneimittel-Verordnung, so schätzt man, setzen das Medikament vorzeitig ab. Diese fehlende "Compliance" oder "Adherence", wie neuerdings die mangelhafte Therapietreue und unzureichende Befolgung ärztlicher Therapie-Anweisungen genannt wird, gefährdet in vielen Fällen nicht nur den Behandlungserfolg. Darüber hinaus werden damit Milliardensummen im Gesundheitswesen völlig unsinnig ausgegeben.
Das Medikament Tamoxifen, das bei Brustkrebs-Patientinnen häufig Anwendung findet, wird von fast jeder vierten Frau (22%) schon nach etwa einem Jahr wieder abgesetzt, obwohl es fünf Jahre lang eingenommen werden soll. Dies hat jetzt eine große irische Studie mit über 2.800 Frauen in den Jahren 2001-2004 gezeigt, die jetzt in der Zeitschrift "Cancer" veröffentlicht wurde. Nach einem Zeitraum von dreieinhalb Jahren waren es bereits 35 Prozent der Studienteilnehmerinnen, die das Medikament gar nicht mehr einnahmen. Dabei zeigten vor allem die jüngsten und die ältesten Frauen die höchsten "Verweigerungs"-Quoten. Bei den älteren Frauen, so erklärten die Wissenschaftler, lässt sich dies noch relativ plausibel erklären durch fehlende soziale Unterstützung und unzureichende Erinnerungshilfen: Die Ehegatten der Frauen sind in vielen Fällen bereits verstorben. Auch kann hier altersbedingte Vergesslichkeit eine Rolle spielen. Bei jüngeren Frauen fanden die Forscher bislang keine völlig überzeugende Erklärung. Sie vermuten jedoch, dass jüngere Frauen möglicherweise in vielen Fällen die ärztliche Diagnose anzweifeln oder aufgrund von Ängsten verdrängen.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Early Discontinuation of Tamoxifen (Cancer Volume 109, Issue 5 , Pages 832 - 839, Published Online: 22 Jan 2007)
In einer zweiten Studie, die im Januar 2007 in der Zeitschrift "Drugs & Aging" veröffentlicht wurde, fanden Wissenschaftler ein ähnliches Ergebnis bei Patienten, denen aufgrund von Osteoporose (übermäßiger Abbau der Knochensubstanz und -struktur und erhöhte Anfälligkeit für Brüche) Medikamente für einen längeren Zeitraum verschrieben wurden. Etwa 20-30 Prozent der Patienten, die täglich oder wöchentlich Medikamente einnehmen sollten, folgten dieser Verordnung nach 6-12 Monaten nicht mehr. Die Wissenschaftler vermuten als Gründe dahinter tatsächlich verspürte Nebenwirkungen oder Ängste davor. Auch psychische Probleme sind für sie ein Erklärungsfaktor: Vergesslichkeit, Depressionen und Anforderungen zu genauen Planungen, um mehrere verschriebene Medikamente zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlicher Dosierung einzunehmen.
Ein Abstract dieser Studie ist hier nachzulesen: Patient Adherence to Osteoporosis Medications: Problems, Consequences and Management Strategies (Drugs & Aging, Volume 24, Number 1, 2007, pp. 37-55(19) )
In einem Artikel in der Zeitschrift USA Today "Doctors baffled by patients not taking prescriptions" wird auch noch eine Studie referiert, die bei Patienten mit Bluthochdruck ein ähnliches Verhaltensmuster fand. Hier zeigten sich insbesondere Patienten mit hohem Einkommen und Bildungsniveau als besonders widerspenstig gegenüber ärztlichen Anordnungen und setzen ihr Medikament oft schon einen Monat nach ihrer Krankenhaus-Behandlung ab.
Die jährlichen Kosten der Non-Compliance werden in Deutschland auf über 5-10 Milliarden Euro geschätzt, man nimmt an, dass zusätzlich noch einmal Folgekosten in derselben Höhe entstehen, unter anderem durch eine Chronifizierung von Krankheitssymptomen. (vgl. Managed Care 4/2004: "Franz Petermann: Non-Compliance: Merkmale, Kosten und Konsequenzen")
Die Studien haben wieder einmal eine Problematik aufgezeigt, für die nach wie vor keine Lösung vorliegt, ob wohl andere Untersuchungen erfolgversprechende Ansatzpunkte aufgezeigt haben. Denn Non-Compliance ist kein irrationales Fehlverhalten von Patienten, sondern beruht in vielen Fällen auf Informationsdefiziten durch unzureichende Hinweise von Ärzten über die Einnahmehäufigkeit und Dauer, furchteinflößende oder unverständliche Medikamentenbeipackzettel, Informationsmängel, die die Angst vor Medikamenten-Nebenwirkungen reduzieren könnten.
Gerd Marstedt, 3.4.2007
US-Verbraucher: Das Vertrauen in die Pharmaindustrie ist im Keller
 Die Pharmaindustrie hat aus einer Vielzahl von Gründen in den letzten Jahren zunehmend das Vertrauen von Patienten, Versicherungen und Ärzten verloren. In einer aktuellen Studie für den US-Pharmamarkt stellt die Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) die Gründe für diesen Vertrauensverlust dar und will für Unternehmen der Branche Möglichkeiten zur Umkehr dieses Trends aufzeigen. Auch wenn die Ergebnisse der US-Studie wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht 1:1 auf den deutschen und europäischen Markt übertragbar sind, zeigen die Kernaussagen ein grundsätzliches Problem der Pharmaindustrie auf. Es gelingt der Branche offensichtlich nicht, Konsumenten vom Nutzen der Pharmaforschung und neuer Präparate im Verhältnis zu den hiermit verbundenen Kosten zu überzeugen. Auch wird ein allgemeines Misstrauen deutlich gegenüber Informationsstrategien der Pharmabranche und ihren Konzepten zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit.
Die Pharmaindustrie hat aus einer Vielzahl von Gründen in den letzten Jahren zunehmend das Vertrauen von Patienten, Versicherungen und Ärzten verloren. In einer aktuellen Studie für den US-Pharmamarkt stellt die Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) die Gründe für diesen Vertrauensverlust dar und will für Unternehmen der Branche Möglichkeiten zur Umkehr dieses Trends aufzeigen. Auch wenn die Ergebnisse der US-Studie wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht 1:1 auf den deutschen und europäischen Markt übertragbar sind, zeigen die Kernaussagen ein grundsätzliches Problem der Pharmaindustrie auf. Es gelingt der Branche offensichtlich nicht, Konsumenten vom Nutzen der Pharmaforschung und neuer Präparate im Verhältnis zu den hiermit verbundenen Kosten zu überzeugen. Auch wird ein allgemeines Misstrauen deutlich gegenüber Informationsstrategien der Pharmabranche und ihren Konzepten zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit.
Für die Studie befragte PwC in den USA über 500 Konsumenten und mehr als 150 Branchenexperten, darunter Ärzte, Krankenhausmanager, ehemalige gesundheitspolitische Entscheidungsträger und Wissenschaftler. Außerdem wurden die Antworten von 15 nach einem Zufallsverfahren ausgewählten Managern verschiedener Pharma- und Biotech-Unternehmen ausgewertet. Als Ergebnis zeigte sich:
• 55% der Verbraucher sind der Meinung, dass Medikamenten-Forschung und Entwicklung sich nicht am tatsächlichen medizinischen Bedarf orientiert. Bei den befragten Experten sind sogar über 70% dieser Ansicht.
• Etwa die Hälfte der Verbraucher und wiederum noch mehr Experten bezweifeln, dass die Pharma-Industrie über ausreichende Konzepte verfügt, um die Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten.
• Die Mehrheit der befragten Experten bezweifelt den korrekten Umgang der Pharmaindustrie mit Medikamentenstudien. So sind über 60 Prozent der Ansicht, dass die Arzneimittelhersteller häufig negative klinische Testergebnisse unterdrücken oder sogar manipulieren.
• Die verstärkten Werbeausgaben im US-Pharmamarkt tragen kaum zu einer Imageverbesserung bei. Nur 10 Prozent der Konsumenten fühlen sich durch die Arzneimittelwerbung sinnvoll und ausreichend informiert. Im Gegenteil, 94 Prozent sind sogar davon überzeugt, dass die Pharmaindustrie zu aggressiv für nicht zugelassene Anwendungsindikationen ihrer Produkte wirbt.
• Überraschend ist, dass sogar eine Mehrheit der Pharma-Manager am Informationsgehalt der direkt auf den Konsumenten ausgerichteten Werbung zweifelt. Besonders ausgeprägt ist die Kritik an den Werbebudgets unter den Branchenexperten. Über 90 Prozent halten den Marketingaufwand insgesamt für zu hoch, und über 70 Prozent sind der Ansicht, dass die Markenhersteller zu viel Geld für die Abwehr von konkurrierenden Generika ausgeben.
• Das Misstrauen beruht zum Teil auch auf Informationsdefiziten. So schätzen die meisten Verbraucher den Anteil der Medikamentenausgaben an den Gesundheitskosten viel zu hoch ein. Knapp 64 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass 40 bis 80 Prozent des amerikanischen Gesundheitsbudgets für Arzneimittel ausgegeben werden, weitere elf Prozent schätzen den Budgetanteil sogar auf mehr als 80 Prozent. Tatsächlich entfielen im Jahr 2004 nur 10 Prozent der Gesundheitsausgaben in den USA auf verschreibungspflichtige Medikamente.
Die Studie ist hier verfügbar (PDF, 32 Seiten): Recapturing the Vision: Restoring Trust in the Pharmaceutical Industry by Translating Expectations into Actions
Hier sind einige Grafiken mit Befragungsergebnissen in deutscher Sprache
Gerd Marstedt, 15.3.2007
Der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung "hyperaktiver" Kinder hat sich weltweit verdreifacht
 Der Einsatz von Medikamenten zur Therapie von Kindern mit einem sogenannten "Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts- Syndrom" (ADHS) hat sich seit dem Jahre 1993 weltweit etwa verdreifacht (+274%). Gleichzeitig sind die Ausgaben für diese Arzneimittel um 900% gestiegen, allein in den USA wurden dafür im Jahr 2003 umgerechnet etwa 1.5 Milliarden Euro ausgegeben. In Deutschland hat sich der Einsatz von Medikamenten für die Erkrankung von 1993 bis 2003 etwa verdoppelt.
Der Einsatz von Medikamenten zur Therapie von Kindern mit einem sogenannten "Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts- Syndrom" (ADHS) hat sich seit dem Jahre 1993 weltweit etwa verdreifacht (+274%). Gleichzeitig sind die Ausgaben für diese Arzneimittel um 900% gestiegen, allein in den USA wurden dafür im Jahr 2003 umgerechnet etwa 1.5 Milliarden Euro ausgegeben. In Deutschland hat sich der Einsatz von Medikamenten für die Erkrankung von 1993 bis 2003 etwa verdoppelt.
Die jetzt von Wissenschaftlern der University of Berkeley (USA) in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlichte Studie hat für alle OECD-Staaten (auf der Basis der IMS Health MIDAS Database) untersucht, wie sich in den Jahren 1993-2003 der Einsatz bestimmter Arzneiwirkstoffe, die typischerweise bei einer Diagnose von ADHS verordnet werden, verändert hat. Dazu zählen Medikamente wie insbesondere Ritalin. Die USA sind danach weltweit führend, was die medikamentöse Behandlung der psychischen Erkrankung anbetrifft. Im Vergleich zu Deutschland wird dort 5-19jährigen Kindern etwa achtmal so oft ein Medikament gegen ADHS verschrieben.
Allerdings wurde die führende Rolle der USA in den letzten Jahren gebremst. Während ADHS-Medikamente im Jahr 1993 lediglich in 31 Ländern eingesetzt wurden, sind dies zehn Jahre später bereits 55 Länder. Die Wissenschaftler fanden bei der Auswertung der Daten auch ein "Wohlstandsgefälle": Je höher das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung ausfällt, desto häufiger werden Kinder mit ADHS medikamentös behandelt. Führend sind hier Länder wie USA, Kanada, Australien und Norwegen.
ADHS ist eine im Kindesalter beginnende psychische Erkrankung, die sich durch leichte Ablenkbarkeit und Konzentrationsstörungen, geringes Durchhaltevermögen, sowie gesteigerte Aktivität und Impulsivität auszeichnet. Die Ursachen der Erkrankung sind nicht restlos geklärt, man vermutet eine Kombination aus angeborenen und umwelt- bzw. sozialisationsbedingten Faktoren.
Problematisch erscheint den Verfassern der Studie der rasante Anstieg der medikamentösen Therapie, da weder die Ursachen der Krankheit bislang hinreichend geklärt sind noch die langfristigen Folgen einer Dauerbehandlung mit Psycho-Stimulantien, die den Dopamin-Stoffwechsel im Gehirn beeinflussen, untersucht sind.
Hier findet man das (sehr kurze) Abstract der Studie: The Global Market For ADHD Medications (Health Affairs, 26, no. 2 (2007): 450-457)
Hier ist eine etwas längere Pressmitteilung der University of Berkeley mit den wichtigsten Befunden: Use of ADHD medication soars worldwide
Andere Wissenschaftler formulieren eine schärfere Kritik und befürchten, dass viele Kinder dauerhaft mit Arzneimitteln behandelt werden, bei denen zwar problematische Verhaltensauffälligkeiten wie Unkonzentriertheit oder Aggressivität auftreten, ohne dass jedoch tatsächlich eine Erkrankung vorliegt. Auch würden alternative psychotherapeutische Behandlungsmethoden zu wenig in Erwägung gezogen. So hat unlängst eine Frankfurter Studie gezeigt, dass sich aggressives oder störendes Verhalten von Kindern, und damit auch die Gewaltbereitschaft der Jüngsten, mit präventiven erzieherischen Maßnahmen und ohne Medikamente verändern lässt.
(vgl. den Artikel in Forum Gesundheitspolitik Agression im Kindergartenalter - Eine Studie zeigt: Es geht auch ohne Medikamente)
Kritisiert wird vielfach auch die bisweilen marktschreierische Werbung von Pharmaunternehmen für ihre Medikamente zur Therapie von ADHS. Viele Eltern, die mit der Aggressivität und den Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder nicht mehr zurecht kommen, würden so dazu gedrängt, ihre Kinder beim Arzt vorzustellen und eine Medikamentenverschreibung zu erbitten. In einem Sonderheft der Zeitschrift "Public Library of Science" wird beschrieben, wie in US-amerikanischen Schulen Lehrer von Pharma-Unternehmen eingebunden werden, um den Absatz ihrer ADHS-Medikamente zu erhöhen: Medicine Goes to School: Teachers as Sickness Brokers for ADHD. In diesem Sonderheft (4.4 MB, 47 Seiten) "The Fight against Disease Mongering" (Das Geschäft mit der Krankheit) finden sich noch einige weitere Aufsätze zu Medikalisierungs-Strategien der Pharma-Industrie.
Gerd Marstedt, 8.3.2007
Privatversicherte bekommen öfter neuere und teurere Medikamente verschrieben als Kassenpatienten
 Eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der privaten Krankenversicherung hat jetzt gezeigt, dass Versicherte in der Privaten Krankenversicherung (PKV) häufiger neu auf den Markt gekommene Medikamente verschrieben bekommen als Kassenpatienten. In der PKV machen neue herausgebrachte Medikamente einen Umsatzanteil von 7,3% innerhalb der jeweiligen Verordnungsgruppe aus, innerhalb der Gesetzlichen Krankenkassen nur 5,3%.
Eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der privaten Krankenversicherung hat jetzt gezeigt, dass Versicherte in der Privaten Krankenversicherung (PKV) häufiger neu auf den Markt gekommene Medikamente verschrieben bekommen als Kassenpatienten. In der PKV machen neue herausgebrachte Medikamente einen Umsatzanteil von 7,3% innerhalb der jeweiligen Verordnungsgruppe aus, innerhalb der Gesetzlichen Krankenkassen nur 5,3%.
Die Studie basiert auf Abrechnungsunterlagen der Ärzte für Medikamentenverordnungen von vier privaten Krankenkassen im Jahre 2005. Insgesamt handelt es sich um Datensätze mit 3,6 Millionen Verordnungen. Einbezogen wurden darüber hinaus Daten des "Arzneiverordnungsreport", um Umsatz- und Verordnungszahlen der GKV damit vergleichen zu können.
Die höhere Verordnung von neu auf dem Arzneimittelmarkt zugelassenen Mitteln wird vom Autor der Studie keineswegs so interpretiert, dass nun privat Versicherte eine bessere Versorgung bekommen. Denn nur wenige neue Medikamente sind tatsächlich therapeutisch besser als ältere. Bisweilen unterscheiden sich die Innovationen von älteren Arzneimitteln nur dadurch, dass sie besser verträglich sind. Und eine nicht unerhebliche Zahl von ihnen lässt sich als "Schein-Innovation" kennzeichnen, sie sind lediglich teurer, aber weder wirksamer noch verträglicher.
Der Autor der Studie, Dr. Frank Wild, zieht dieses Fazit: "Es ist zu vermuten, dass Ärzte im Rahmen ihres Budgets bei GKV-Versicherten eher auf preisgünstigere Medikamente zurückgreifen, statt neue und oftmals teuere Präparate zu verordnen. (...) Die höhere Innovationsquote bei Privatversicherten offenbart bei einigen Wirkstoffen, die als Scheininnovationen gesehen werden können, erhebliche Mehrkosten für die private Assekuranz. Höheren Ausgaben steht hier ein geringerer Zusatznutzen gegenüber. Andere Medikamente, die Privatpatienten häufiger verordnet bekommen, zeichnen sich durch eine bessere Wirksamkeit und geringere Nebenwirkungen als die Standardarzneien aus. In diesem Falle profitiert der Privatversicherte von seinem privatrechtlichen Versicherungsvertrag." (S. 21f)
Hier ist das Gutachten von Dr. Frank Wild (PDF, 22 Seiten): Arzneimittelversorgung von Privatversicherten: Die Verordnung von neuen Wirkstoffen
Dass die Verordnung neuer Medikamente oftmals für die Kassen nur teurer ist, aber keine bessere Versorgungsqualität mit sich bringt, hat unlängst eine englische Studie bei Patienten mit Bluthochdruck oder ungünstigen Cholesterinwerten gezeigt. Bei rund 9.000 Patienten war überprüft worden, ob sich der Umstieg von teuren Analog-Arzneimitteln auf preiswertere Generika (Nachahmer-Präparate für Original-Medikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist) gesundheitlich negativ auswirkt. Es zeigte sich: Die therapeutische Wirkung war genau so gut, nur die Kosten lagen erheblich niedriger.
vgl. Artikel in dieser Rubrik "Arzneimittel-Umstieg auf Generika würde Milliarden-Ersparnisse ohne Einbußen an Versorgungsqualität ermöglichen".
Gerd Marstedt, 7.3.2007
Medikamentenmissbrauch übersteigt jetzt weltweit den Gebrauch illegaler Drogen
 Der illegale Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten und ihr Missbrauch, also Einsatz als Droge ohne gesundheitliche Notwendigkeit, übersteigt in einigen Ländern der Welt heute bereits den Gebrauch illegaler Drogen wie Kokain und Heroin. Die Zahl der dadurch verursachten Todesfälle ist bedenklich angestiegen. Dies ist die Kernbotschaft des Jahresberichtes 2006 der Internationalen Behörde zur Kontrolle von Betäubungsmitteln, International Narcotics Control Board (INCB).
Der illegale Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten und ihr Missbrauch, also Einsatz als Droge ohne gesundheitliche Notwendigkeit, übersteigt in einigen Ländern der Welt heute bereits den Gebrauch illegaler Drogen wie Kokain und Heroin. Die Zahl der dadurch verursachten Todesfälle ist bedenklich angestiegen. Dies ist die Kernbotschaft des Jahresberichtes 2006 der Internationalen Behörde zur Kontrolle von Betäubungsmitteln, International Narcotics Control Board (INCB).
Der jetzt veröffentlichte 120seitige Bericht beschäftigt sich mit Betäubungsmitteln und Psychopharmaka, aber auch Drogen wie Heroin, Cannabis und Heroin und sammelt weltweit Daten über deren Produktion, illegalen Handel und Konsum. Hervorgehoben wird in der Veröffentlichung, dass Betäubungsmittel und Psychopharmaka inzwischen bei vielen Endkonsumenten nicht mehr nur als Ersatzmittel dienen, sondern die "Droge erster Wahl" sind, da sie bei erhöhter Dosis ähnliche Rausch- und Bewusstseinzustände hervorrufen und genau so "high" machen wie illegale Drogen.
Mittlerweile hat der Konsum der rezeptpflichtigen Medikamente in einigen Ländern schon die Einnahme der traditionellen Drogen wie Heroin und Kokain übertroffen. So ist zum Beispiel für die USA feststellbar, dass der Medikamentenmissbrauch einschl. der Einnahme von Schmerzmitteln, Anregungs- und Beruhigungsmitteln die Einnahme der verbotenen Drogen übertroffen hat. Die Zahl der US-Amerikaner, die verschreibungspflichtige Medikamente ohne medizinische Indikation einnehmen, hat sich im Zeitraum von 1992 bis 2003 fast verdoppelt und ist von 7,8 Millionen auf 15,1 Millionen angestiegen. Bei einem besonders stark gefragten Schmerzmittel (Oxycodone / Oxycontin) ist der regelmäßige Gebrauch in den letzten Jahren bei Studenten in ihrem letzten College-Jahr auf fast 6%, bei einem anderen Mittel (Hydrocodone / Vicodin) auf fast 8% angestiegen.
Leider stellt der Bericht recht wenig Überlegungen an zu den Hintergründen. Zwar wird auf Mechanismen verwiesen, die den Zugang zu den Medikamenten heute erleichtern: Das steigende Angebot an gefälschten Präparaten, die von kriminellen Vereinigungen produziert und auf den Markt gebracht werden, oder auch im Internet verfügbare Anleitungen, mit denen solche Drogen selbst hergestellt werden können. Warum indes in vielen Ländern der Erde die Nachfrage steigt, bleibt eine von der Behörde unbeantwortete Frage.
Hier ist eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Ergebnissen des Berichts:
Annual Report: Abuse Of Prescription Drugs To Surpass Illicit Drug Abuse, Says INCB
Der Bericht selbst (PDF, 120 Seiten) ist hier verfügbar:
Report of the International Narcotics Control Board for 2006
Gerd Marstedt, 1.3.2007
Altes und Neues von der gefährlichen Dauer-Fehlversorgung von Erwachsenen und Kindern mit Antibiotika
 Es gibt nur wenig Versorgungssituationen über deren potenziell gefährlichen Folgen mehr Klarheit besteht und bei denen immer wieder an ein anderes Verhalten von Ärzten und Patienten appelliert wird, als die unnötige aber folgenträchtige Verordnung von Antibiotika insbesondere an Kinder.
Es gibt nur wenig Versorgungssituationen über deren potenziell gefährlichen Folgen mehr Klarheit besteht und bei denen immer wieder an ein anderes Verhalten von Ärzten und Patienten appelliert wird, als die unnötige aber folgenträchtige Verordnung von Antibiotika insbesondere an Kinder.
In einer 2003 vom "Wissenschaftlichen Institut der Ortskrankenkassen (WidO)" zusammen mit Wissenschaftlern des Universitätsklinikums Freiburg erarbeiteten Studie "Solange sie noch wirken... Analysen und Kommentare zum Antibiotikaverbrauch in Deutschland" wurde dringend auf die Gefahr der "Produktion" multiresistenter Bakterien durch den medizinisch und pharmakologisch oft ungerechtfertigten Einsatz von Antibiotika hingewiesen. Die Forderung der Autoren nach einem "verantwortungsvolleren Umgang mit Antibiotika" bezog sich damals auf den in der Studie mit Verordnungsdaten aus dem Jahr 2001 belegten Einsatz dieser Medikamente in 80 % aller Fälle von Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege, die ebenfalls zu rund 80 % Viruserkrankungen sind. Gegen diese helfen Antibiotika aber nicht. "Das weist darauf hin, dass es bei Ärzten und Patienten Wissensdefizite gibt", so der Forschungsleiter des WidO, Helmut Schröder, und forderte: "Eine spezielle Fortbildung und Schulung der Ärzte sowie die intensivere Aufklärung von Patienten könnte den Einsatz von Antibiotika bei Erkältungen senken." Der Leiter der Infektiologie der Universität Freiburg, Winfried Kern, forderte aus den gleichen Gründen einen "intelligenten" Antibiotika-Einsatz.
Ausführlichere Darstellungen finden sich in einem von den Autoren geschriebenen Zeitschriftenaufsatz aus dem Jahr 2003 oder z.B. in einem kostenlos erhältlichen Mediendienst des AOK-Bundesverbandes.
Eine 2005/2006 durchgeführte und veröffentlichte zweite Studie derselben Forschungsgruppe (Helmut Schröder et al. "Antibiotika: Solange sie noch wirken...Revistited: 2001 - 2004 kommt als Fazit der auf 36 Seiten zusammengestellten neueren empirischen Analysen zu einer nicht wesentlich anderen Feststellung: "Es ist zu vermuten, dass auch in Deutschland 2004 noch immer nicht der 'goldenen' Regel in der Antibiotikatherapie gefolgt wird, die besagt: So wenig wie nötig, aber so gezielt wie möglich."
In renommierten medizinwissenschaftlichen Zeitschriften wie etwa dem "British Medical Journal" erschienen in letzter Zeit mehrere Studien über die Fragwürdigkeit von routinemäßigen Antibiotikaverordnungen etwa bei kindlichen Mittelohrentzündungen, und führten zur Entwicklung eines speziellen antibiotika-defensiven Managements.
Dieses wird in einer Schweizer pädiatrischen Veröffentlichung ("Akute Otitis media: Vorschlag für ein neues Management" von Berger und Michel so zusammengefasst: "Das Ziel des vorgeschlagenen Managements besteht darin, nur die Kinder antibiotisch zu behandeln, bei denen keine Spontanheilung eintritt sowie Komplikationen zu verhindern. Im klinischen Alltag ist es schwierig, zwischen einer akuten Otitis media und einem Tubenmittelohrkatarrh mit z.B. gleichzeitig bestehendem grippalem Infekt zu unterscheiden. Weil zu Beginn nicht unterschieden werden kann, welches Kind von Antibiotika profitiert, empfiehlt sich von wenigen Ausnahmen abgesehen ein stufenweises Vorgehen, bei welchem immer Analgetika aber primär keine Antibiotika gegeben werden. Kinder jünger als 2 Jahre waren in den genannten Studien nur teilweise berücksichtigt und die Otitis soll bei diesen schwerer verlaufen. Wie kürzlich gezeigt, beeinflusst die Antibiotikatherapie aber auch in dieser Altersgruppe die günstige Ausheilung nicht und kann die Symptomatik lediglich bei einem von 8 Kindern um einen Tag verkürzen. Somit ist die primäre Behandlung mit Antibiotika nicht sinnvoll, sofern eine Reevaluation in dieser Altersgruppe innert 24 Stunden möglich ist. Alle Kinder mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe und Komplikationen müssen von Anfang an mit Antibiotika therapiert werden. Dies gilt für Kinder mit beidseitiger Otitis, eitriger Otorrhoe, rezidivierender Otitis, nur einem hörendem Ohr, anatomischen Fehlbildungen und Immunschwäche."
Eine der vielen erwähnten Studien ("Review: antibiotics are moderately effective for acute otitis media in children" von Glasziou et al. in: Evidence-Based Nursing 2004; 7:74) kommt außerdem zu dem ungünstigen Schluss einer so genannten "number needed to treat" von 15 Kindern, die nutzlos aber mit der Nebenwirkung der Erzeugung resistenter Erreger mit Antibiotika als Schmerzhemmer behandelt werden müssen, um einem Kind die Schmerzen zu reduzieren.
Trotz aller dieser und noch zahlreicher anderer breit und weltweit publizierten problematisierenden Hinweise zur Verordnung von Antibiotika, berichtet die Februarausgabe 2007 der "Arzneimittelmarkt News" des WidO auf 2 Seiten über den aktuellsten Stand des Antibiotikaverbrauchs allgemein und speziell bei Kindern: "Der Antibiotikaverbrauch hat im Jahr 2005 sein höchstes Niveau seit 1998 erreicht. Besonders hoch ist der Verbrauch bei Kindern. Sie bekommen 20 % bis 50 % mehr Antibiotika verordnet als Erwachsene. Auch die Steigerungsrate ist erheblich höher als bei Erwachsenen. Bei AOKversicherten Kindern ist der Verbrauch 2005 im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 % gestiegen. Erwachsene AOK-Versicherte verzeichnen im selben Zeitraum eine Steigerung um 8,3 %. Erste Analysen des Jahres 2006 zeigen, dass das hohe Niveau von 2005 gehalten wird." Auch 2005 unterscheiden sich die Anlässe der Antibiotikatherapie bei Kindern kaum von früheren und auch die alternativen Strategien sind die längst bekannten: "Die Antibiotika werden üblicherweise bei Atemwegsinfektionen, Keuchhusten und Infektionen des Gehörgangs angewandt. Die Infektionen der Atemwege gehören zu den häufigsten Erkrankungen, deretwegen Kinderarztpraxen aufgesucht werden. Eine sofortige Therapie mit Antibiotika ist hier jedoch nicht angebracht, da es keine ausreichenden Belege für die Wirksamkeit von Antibiotika bei einer Infektion der oberen Atemwege bei Kindern oder auch bei Erwachsenen gibt: Mit oder ohne Antibiotika dauert der Husten gleich lang. Erst wenn sich die Symptomatik nach wenigen Tagen nicht bessert, ist eine Antibiotikatherapie angebracht."
Bernard Braun, 23.2.2007
MEZIS (Mein Essen zahle ich selbst) - Initiative unbestechlicher und unabhängiger Ärzte gegründet
 Das Marketing von Pharmaunternehmen für ihre im Vergleich zu Generika oft teureren Medikamente ist ihnen ein Dorn im Auge, insbesondere aber die Tätigkeit der rund 15.000 Pharma-Referenten in Deutschland, die täglich ärztliche Praxen besuchen und direkt oder indirekt versuchen, auf das Verschreibungsverhalten der Ärzte Einfluss zu nehmen. Die Initiative MEZIS wurde jetzt von Medizinern gegründet, die sich schon zuvor gegen die Abhängigkeit der Ärzteschaft von der Pharmaindustrie engagiert hatten, innerhalb der Organisation Transparency International Deutschland oder der BUKO-Pharmakampagne. Bislang sind es nur wenige Mitglieder, die Gründer hoffen jedoch, eines Tages dreistellige Mitgliederzahlen vorweisen zu können.
Das Marketing von Pharmaunternehmen für ihre im Vergleich zu Generika oft teureren Medikamente ist ihnen ein Dorn im Auge, insbesondere aber die Tätigkeit der rund 15.000 Pharma-Referenten in Deutschland, die täglich ärztliche Praxen besuchen und direkt oder indirekt versuchen, auf das Verschreibungsverhalten der Ärzte Einfluss zu nehmen. Die Initiative MEZIS wurde jetzt von Medizinern gegründet, die sich schon zuvor gegen die Abhängigkeit der Ärzteschaft von der Pharmaindustrie engagiert hatten, innerhalb der Organisation Transparency International Deutschland oder der BUKO-Pharmakampagne. Bislang sind es nur wenige Mitglieder, die Gründer hoffen jedoch, eines Tages dreistellige Mitgliederzahlen vorweisen zu können.
Die Ziele der Initiative sind recht ehrgeizig, man will auf das Verordnungsverhalten der Ärzte Einfluss nehmen, aber auch Forschungsbemühungen unterstützen, die mehr Licht werfen auf die Marketingstrategien der Pharmaindustrie. In einem Interview in der Tageszeitung "Neues Deutschland" (ND) erklärte Dr. med. Christine Fischer, Gründungsmitglied von MEZIS dazu: "Ärztinnen und Ärzte sollen sich selbst verpflichten, unabhängig und unbestechlich zu agieren, sich nicht von einer Pseudoinformation der Pharmaindustrie abhängig zu machen, sondern ihr Verschreibeverhalten entsprechend den Methoden einer rationalen Arzneimittelpolitik zu gestalten. Neben dem Aufbau einer Internet-Plattform will Mezis noch in diesem Jahr in Workshops die Erarbeitung eines Kodex für Ärztinnen und Ärzte anstoßen, die interessiert sind, ihr Verordnungsverhalten ausschließlich am Wohl ihrer Patientinnen und Patienten auszurichten, und bereit sind, auf die Zuwendungen von Arzneimittel-Herstellern zu verzichten. Schließlich soll auch die wissenschaftliche Untersuchung der Auswirkungen des Pharmamarketings auf das ärztliche Verordnungsverhalten gefördert werden, die im deutschen Sprachraum bisher kaum Beachtung gefunden hat."
Beklagt wird von der Initiative, dass Pharmareferenten (vgl. unseren Artikel "Pharmareferenten: Die meisten Ärzte würden ihr Fehlen vermissen") Ärzten die Verschreibung teurerer Medikamente nahezulegen versuchen und damit im Gesundheitssystem unnötige Kosten entstehen, die zu Einsparungen wichtiger Therapiemöglichkeiten an anderer Stelle führen. Fischer im Interview im ND: "Ein Beispiel. Für einen Patienten mit einem Magengeschwür oder einer Magenschleimhautentzündung gibt es ein Mittel mit echtem therapeutischen Fortschritt, Omeprazol. Als das Patent für dieses Mittel abgelaufen war, wurden neue Mittel mit neuem Patent auf den Markt gebracht, beispielsweise Esomeprazol. Das ist im Durchschnitt ein Drittel teurer, bringt aber keinen zusätzlichen Nutzen. (...) Doch Tausende Pharmavertreter versuchen Ärzte zu überzeugen, die teureren Mittel zu verschreiben. Das Geld fehlt aber woanders, so bekommen Patienten nach einem Schlaganfall keine Physio- oder Ergotherapie."
MEZIS hat einige durchaus prominente Gründungsmitglieder. "Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern unterstützt diese wichtige Initiative als Gründungsmitglied", sagt deren Vorsitzender Dr. med. Axel Munte, der sich schon seit längerem für eine unabhängige Pharmaberatung der Ärzteschaft engagiert. In einem Bericht der Frankfurter Rundschau wird seine Position so zusammengefasst: "Wir haben recherchiert, dass Ärzte, die keine Pharmareferenten empfangen, wesentlich kostensparender und auch effektiver behandeln, erklärt der KVB-Chef. Allein in Bayern seien nach Berechnungen seiner Organisation Einsparungen von 130 Millionen Euro jährlich möglich, wenn Scheininnovationen konsequent durch günstigere Alternativen ersetzt würden. Sein Fazit: Die Pharmareferenten müssen raus aus den Praxen." (vgl.: KVB-Impuls (2/2006) "Plädoyer für mehr soziale Verantwortung der Pharmaindustrie", S. 4)
Bei MEZIS mit dabei ist weiter Prof. Dr. med. Bruno Müller-Oerlinghausen, bis vor kurzem Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, der betont, "dass den einseitigen Werbeanstrengungen der Arzneimittelhersteller etwas entgegengesetzt werden muss". Neben dem Aufbau einer Internet-Plattform will MEZIS noch in diesem Jahr in Workshops die Erarbeitung eines Kodex für Ärztinnen und Ärzte anstoßen, die interessiert sind, ihr Verordnungsverhalten ausschließlich am Wohl ihrer Patienten auszurichten und bereit sind, auf Zuwendungen von Arzneimittel-Herstellern zu verzichten. "Ein besonderes Augenmerk wird dabei darauf liegen, auch die medizinischen Fachverbände und Universitätskliniken mit einzubeziehen", sagt Prof. Dr. med. Klaus Lieb, zukünftiger Ordinarius für Psychiatrie der Universität Mainz und weiteres Gründungsmitglied von MEZIS.
Die Initiative "Mein Essen zahle ich selbst" lehnt sich auch vom Namen her an Vorbilder im Ausland an. In Italien, Großbritannien und den USA arbeiten Initiativen unter dem Motto und dem Namen "No Free Lunch" bereits überaus erfolgreich.
Hier finden Sie die Website von MEZIS - "Mein Essen zahle ich selbst"
Gerd Marstedt, 7.2.2007
"Weltmeister aus der Tube" oder das problematische Verständnis von Verantwortung eines Medikamentenherstellers
 Unter die vielen begeisterten Gratulanten der deutschen Weltmeister-Handballmannschaft mischte sich am 6.2.2007 auch "Novartis Consumer Health", der Hersteller des schmerz- und entzündungshemmenden Mittels "Voltaren". Den Originaltext dieser selbstbewussten Presseerklärung wollen wir ausnahmsweise ohne jede Kürzung zugänglich machen:
Unter die vielen begeisterten Gratulanten der deutschen Weltmeister-Handballmannschaft mischte sich am 6.2.2007 auch "Novartis Consumer Health", der Hersteller des schmerz- und entzündungshemmenden Mittels "Voltaren". Den Originaltext dieser selbstbewussten Presseerklärung wollen wir ausnahmsweise ohne jede Kürzung zugänglich machen:
"Weshalb unsere Handballer auch "(Be-) Sieger der Schmerzen" sind
"Zähne zusammenbeißen und noch einmal alle Kräfte mobilisieren" - so lautete das Motto unserer Handballnationalmannschaft vor dem Finale gegen Polen am Sonntag. Gesagt, getan: Rund 19.000 Zuschauer wurden in Köln Zeuge, dass wir doch Weltmeister im eigenen Land werden können - wenn alle an einem Strang ziehen, die Vorbereitung und die medizinische Betreuung stimmen. So ein Sieg, insbesondere ein Weltmeistertitel, ist immer das Ergebnis einer langen, zähen, oftmals sogar sehr schmerzhaften Vorbereitung.
Dass fast alle Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor den Spielen deshalb zum "Wasser-Voltaren-Mix" greifen, verriet der reaktivierte Christian "Blacky" Schwarzer nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Frankreich der Tageszeitung DIE WELT. Ohne die Unterstützung aus der Apotheke ist eine Dauerbelastung wie bei der Weltmeisterschaft - zehn Spiele in knapp zwei Wochen - kaum möglich. Auch, weil viele der Spieler noch aus vorangegangenen Bundesliga- und Europapokalspielen angeschlagen waren.
"Seit über 30 Jahren ist Voltaren die Basistherapie bei Schmerzen durch Überlastung und Abnutzung. Voltaren ist ein ausgezeichnetes und gut wirksames Präparat, kein Wunder, dass unsere Jungs darauf schwören.", erklärt der Orthopäde Dr. Dr. med. Franz Szabad aus Bad Neustadt. Voltaren wirkt sowohl schmerzstillend als auch entzündungshemmend. Zusätzlich reichert sich der enthaltene Wirkstoff Diclofenac aber genau dort an, wo der Schmerz sitzt. Noch ein Tipp: Voltaren hilft übrigens nicht nur Leistungssportlern bei Stauchungen und Zerrungen. Auch bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen bietet Voltaren als Schmerzgel oder Tablette schnelle Hilfe. Für Handballprofis und solche, die es jetzt gerne werden wollen."
Übrigens: Ein schon im Herbst 2006 veröffentlichter Review und die Metaanalyse vorhandener randomisierter kontrollierter Studien über unerwünschte Wirkungen der in derartigen Arzneimitteln enthaltenen Wirkstoffe, stellte für den in Voltaren enthaltenen Wirkstoff Diclofenac folgendes fest: "Among older nonselective drugs, diclofenac had the highest risk with a summary relative risk of 1.40 (95% CI, 1.16-1.70)....This review confirms the findings from randomized trials regarding the risk of cardiovascular events ...and raises serious questions about the safety of diclofenac, an older drug." ("Cardiovascular Risk and Inhibition of Cyclooxygenase. A Systematic Review of the Observational Studies of Selective and Nonselective Inhibitors of Cyclooxygenase 2 von Patricia McGettigan et al. in: JAMA 2006;296:1633-1644. Published online September 12, 2006"). Für Nicht-Epidemiologen: Ein relatives Risiko von 1.40 bedeutet ein um 40 % erhöhtes Herzinfarktrisiko gegenüber jemand, der kein Diclofenac-haltiges Arzneimittel einnimmt.
Und noch etwas: Behandeln sie weder ihren Hund noch ihren Geier mit Diclofenac-haltigem Gel: Laut des insgesamt interessanten und verständlichen "Diclofenac"-Artikels bei "Wikipedia" gilt dies nämlich bei Hunden als "einer der häufigsten (human-)iatrogenen Notfälle".
Und zum Schluss: Natürlich haben Voltaren und ähnliche Mittel auch einen Nutzen. Problematisch wird es nur dann, wenn nach dem Motto "schmier Dich zum Weltmeister" ein letztlich ungehemmter Einsatz nahegelegt oder positiv dargestellt wird.
Hier findet sich die Presseerklärung im Original.
Bernard Braun, 6.2.2007
Arzneimittel-Umstieg auf Generika würde Milliarden-Ersparnisse ohne Einbußen an Versorgungsqualität ermöglichen
 Ein anderes Verschreibungsverhalten von Ärzten bei Patienten mit Bluthochdruck oder ungünstigen Cholesterinwerten könnte Milliarden-Einsparungen im Gesundheitswesen bewirken, ohne dass dies zu Lasten der Versorgungsqualität für die betroffenen Patienten geht. Dies ist das Fazit einer Studie in England, die jetzt im International Journal of Clinical Practice veröffentlicht wurde. Ein Forschungsteam hatte bei insgesamt 185 Patienten einer Allgemeinarzt-Praxis in Hertfordshire, die aufgrund bestimmter Diagnosen und Untersuchungswerte aus 9.000 Patienten ausgewählt wurden, überprüft, ob sich der Umstieg von teuren Analog-Arzneimitteln auf preiswertere Generika (Nachahmer-Präparate für Original-Medikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist) gesundheitlich negativ auswirkt.
Ein anderes Verschreibungsverhalten von Ärzten bei Patienten mit Bluthochdruck oder ungünstigen Cholesterinwerten könnte Milliarden-Einsparungen im Gesundheitswesen bewirken, ohne dass dies zu Lasten der Versorgungsqualität für die betroffenen Patienten geht. Dies ist das Fazit einer Studie in England, die jetzt im International Journal of Clinical Practice veröffentlicht wurde. Ein Forschungsteam hatte bei insgesamt 185 Patienten einer Allgemeinarzt-Praxis in Hertfordshire, die aufgrund bestimmter Diagnosen und Untersuchungswerte aus 9.000 Patienten ausgewählt wurden, überprüft, ob sich der Umstieg von teuren Analog-Arzneimitteln auf preiswertere Generika (Nachahmer-Präparate für Original-Medikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist) gesundheitlich negativ auswirkt.
Bei den Patienten wurde von Ärzten und Pharmakologen zuvor sorgfältig überprüft, ob ein Medikamentenwechsel medizinisch ohne Risiko ist und die Teilnahme an der Studie war für alle nach einer ausführlicheren Erläuterung des Vorgehens freiwillig. Die klinischen Untersuchungsergebnisse etwa 10 Monate nach dem Wechsel des Präparats zeigten dann, dass in keinem Fall zu einem signifikanten Anstieg des Cholesterinspiegels gekommen war und dass sich bei den Bluthochdruck-Patienten keine einzige neue Diagnose einer Herz- oder Hirndurchblutungserkrankung ereignet hatte oder es zu anderen negativen Krankheitsereignissen gekommen war. Der ganz überwiegende Teil der Patienten (70%) blieb auch nach dem Wechsel dauerhaft bei dem neuen Medikament. Die Wissenschaftler hoben allerdings heraus, dass eine sorgfältige Auswahl der in Frage kommenden Patienten überaus wichtig ist und dass sie keinesfalls einen pauschalen Umstieg für alle Patienten einer Praxis empfehlen würden.
In finanzieller Hinsicht zeigte die Studie enorme Einsparpotentiale: Die teilnehmende Arztpraxis konnte ihre Medikamentenausgaben für die betroffene Gruppe um etwa 26.000 Pfund in einem Jahr reduzieren (knapp 40.000 Euro). Hochgerechnet auf das gesamte Land und alle in Frage kommenden Patienten wären damit Milliardeneinsparungen möglich. Für einen Staat wie die USA errechneten die Wissenschaftler mögliche Kosteneinsparungen von 8,2 Milliarden Dollar.
Die Studie ist hier im Volltext zu lesen: Evaluation of the cost savings and clinical outcomes of switching patients from atorvastatin to simvastatin and losartan to candesartan in a Primary Care setting (International Journal of Clinical Practice, Volume 61 Issue 1 Page 15 - January 2007)
Gerd Marstedt, 21.1.2007
Fehl- und Überversorgung: Röntgenuntersuchung und Antibiotika bei einfachen Entzündungen der Nasennebenhöhlen
 Häufig gehören Röntgenaufnahmen der Nasennebenhöhlen und der Einsatz von Antibiotika zum Grundrepertoire oder sind ein Basispaket des Umgangs mit Patienten, die mit Symptomen einer Rhinosinusitis oder Entzündung der Nasennebenhöhlen beim Arzt auftauchen.
Häufig gehören Röntgenaufnahmen der Nasennebenhöhlen und der Einsatz von Antibiotika zum Grundrepertoire oder sind ein Basispaket des Umgangs mit Patienten, die mit Symptomen einer Rhinosinusitis oder Entzündung der Nasennebenhöhlen beim Arzt auftauchen.
Die in der Fachzeitschrift "Annals of Family Medicine" veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten placebokontrollierten Studie aus Belgien über den Einsatz eines Antibiotika bei mindestens 12 Jahre alten PatientInnen mit klassischen Symptomen dieser Erkrankung, zeigen zweierlei:
• Die Röntgenaufnahmen lieferten keinerlei Informationen über die Prognose bzw. den Verlauf der Erkrankung und
• das eingesetzte Antibiotika Amoxicillin beeinflusste den Verlauf der Erkrankung nicht.
Die Schlussfolgerung der Autoren lautete daher auch: "The best policy for patients with suspected rhinosinusitis - but without signs of complications or severe infection (high fever and bad pain) - is to wait for spontaneous recovery. If necessary, bothersome symptoms, such as pain or nasal obstruction, can be suppressed with treatment aimed at the symptoms. Our study did not find evidence that any signs or symptoms warrant antibiotic treatment or that radiography has added value in this setting."
Hier finden Sie die PDF-Datei des Aufsatzes "Predicting Prognosis and Effect of Antibiotic Treatment in Rhinosinusitis".
Bernard Braun, 11.12.2006
Medikamenten-Abhängigkeit erreicht vergleichbares Ausmaß wie bei Alkohol
 Medikamentenabhängigkeit ist in Deutschland mit 1,4 Millionen Betroffener ähnlich stark verbreitet wie die Abhängigkeit von Alkohol. Besonders häufig sind Frauen und ältere Menschen betroffen. Nach den jetzt vorgelegten Erkenntnissen einer Studie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) werden Medikamentenabhängige aber insbesondere durch die Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe kaum erreicht und es ist weitgehend ungewiss, ob und wenn ja wo Medikamentenabhängige Hilfe finden können. Vor diesem Hintergrund untersucht der Bericht Defizite und Möglichkeiten der Erreichbarkeit von Personen mit Medikamentenmissbrauch bzw. -abhängigkeit unter besonderer Berücksichtigung der als Risikogruppen einzuordnenden sozial benachteiligten Frauen und Menschen höheren oder hohen Alters.
Medikamentenabhängigkeit ist in Deutschland mit 1,4 Millionen Betroffener ähnlich stark verbreitet wie die Abhängigkeit von Alkohol. Besonders häufig sind Frauen und ältere Menschen betroffen. Nach den jetzt vorgelegten Erkenntnissen einer Studie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) werden Medikamentenabhängige aber insbesondere durch die Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe kaum erreicht und es ist weitgehend ungewiss, ob und wenn ja wo Medikamentenabhängige Hilfe finden können. Vor diesem Hintergrund untersucht der Bericht Defizite und Möglichkeiten der Erreichbarkeit von Personen mit Medikamentenmissbrauch bzw. -abhängigkeit unter besonderer Berücksichtigung der als Risikogruppen einzuordnenden sozial benachteiligten Frauen und Menschen höheren oder hohen Alters.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es geschätzte 1,4 bis 1,9 Mio. Medikamentenabhängige in Deutschland gibt. Die größte Gruppe der Betroffenen, über 1 Million Menschen, ist abhängig von Schlaf- und Beruhigungsmitteln aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine. Nach der Studie der DHS sind vor allem Frauen, insbesondere in höherem Alter, von der Sucht betroffen. Sie bekommen mehr problematische Medikamente verordnet und gebrauchen diese auch häufiger. Gerade in höherem Alter können die Beruhigungsmittel jedoch wegen ihrer muskelentspannenden Wirkung auch zu schweren und komplikationsreichen Stürzen führen. Viele Frauen benutzen Schlaf- und Beruhigungsmittel, um die alltäglichen Belastungen in Familie, Partnerschaft und Beruf besser bewältigen zu können. Dabei gelingt es ihnen oftmals über lange Zeit, ihre Krankheit verborgen zu halten und im Alltag den Schein der Normalität aufrecht zu erhalten. Laut Studie ist es auch deshalb besonders schwierig, die betroffenen Menschen über die Gefahren des Langzeitkonsums durch gezielte Aufklärungsmaßnahmen zu erreichen.
Die Studie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) ist als PDF-Datei verfügbar (143 Seiten): Möglichkeiten und Defizite in der Erreichbarkeit ausgewählter Zielgruppen (sozial benachteiligte Frauen und ältere Menschen) durch Maßnahmen und Materialien zur Reduzierung von Medikamentenmissbrauch und -abhängigkeit
Gerd Marstedt, 19.11.2006
Interventionen zur Verbesserung der Disziplin bei der Einnahme von Medikamenten aufwändig und wenig wirksam
 Ob und wie PatientInnen die Einnahme der ihnen verordneten Medikamenten selbst organisieren und z.B. die Einnahmehinweise befolgen, wird häufig skeptisch bewertet. Eine Gruppe von Forschern untersuchte gerade im Rahmen eines Reviews der bis 2004 dazu veröffentlichten randomisierten kontrollierten Studien (RCT) für die Cochrane Library, mit welchen Mitteln und Interventionen die Einnahme von Arzneimitteln zu verbessern versucht wurde (Haynes RB, Yao X, Degani A, Kripalani S, Garg A, McDonald HP. Interventions to enhance medication adherence. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD000011. DOI: 10.1002/14651858.CD000011.pub2). Dabei nahmen sie an, dass typischerweise weniger als die Hälfte der PatientInnen die verordneten Dosen einnehmen. Sie nahmen ferner an, dass dann, wenn es gelingt die Patienten zu einer besseren Einnahmedisziplin zu bringen, der Nutzen der verordneten Arzneimittel verbessert wird, aber auch die negativen Effekte zunehmen könnten.
Ob und wie PatientInnen die Einnahme der ihnen verordneten Medikamenten selbst organisieren und z.B. die Einnahmehinweise befolgen, wird häufig skeptisch bewertet. Eine Gruppe von Forschern untersuchte gerade im Rahmen eines Reviews der bis 2004 dazu veröffentlichten randomisierten kontrollierten Studien (RCT) für die Cochrane Library, mit welchen Mitteln und Interventionen die Einnahme von Arzneimitteln zu verbessern versucht wurde (Haynes RB, Yao X, Degani A, Kripalani S, Garg A, McDonald HP. Interventions to enhance medication adherence. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD000011. DOI: 10.1002/14651858.CD000011.pub2). Dabei nahmen sie an, dass typischerweise weniger als die Hälfte der PatientInnen die verordneten Dosen einnehmen. Sie nahmen ferner an, dass dann, wenn es gelingt die Patienten zu einer besseren Einnahmedisziplin zu bringen, der Nutzen der verordneten Arzneimittel verbessert wird, aber auch die negativen Effekte zunehmen könnten.
Der Review von rund 50 RCTs förderte differenzierte und eher pessimistische Ergebnisse zu Tage:
• Bei kurzen Behandlungen führten 4 von 9 Interventionen dazu, dass Verordnungshinweise besser befolgt wurden und zumindest ein klinisch gewünschtes Behandlungsergebnis eintrat. Diese Erfolge wurden mit einer Fülle von einfachen Interventionen erreicht.
• Bei langdauernden Behandlungen verbesserten allerdings nur 26 von 58 verschiedenen Interventionen die Verordnungsdisziplin und lediglich 18 Interventionen führten zu der Verbesserung von mindestens einem Behandlungsergebnis.
• Nahezu alle wirksamen Interventionen innerhalb der Behandlung eines chronischen Gesundheitsproblems waren komplex, d.h. sie umschlossen eine Kombination von insgesamt bequemeren Behandlung, Informationen, Erinnerungsaktionen, gezielte Beratung während der Behandlung und Medikamenteneinnahme, Einbeziehung der Familie, Krisenintervention und anderer Unterstützungsaktivitäten.
• Selbst bei einem solchen Aufwand führten aber auch die wirksamen Interventionen nicht zu großen Verbesserungen bei der Befolgung von Verordnungshinweisen und den Behandlungs-Outcomes.
• 6 Studien zeigten schließlich, dass Schilderungen von möglichen negativen Wirkungen eines Medikaments nicht zu einer besseren Einnahmedisziplin führten.
Ein kostenloses Abstract (Ganztexte von Cochrane-Reviews gibt es leider nicht kostenlos) finden Sie hier
Bernard Braun, 27.11.2005
USA: Fast 50 Prozent der Senioren haben Probleme mit der Einnahme von Arzneimitteln
 Auch wenn sich das Gesundheitssystem in den USA speziell im Bereich der Versorgung mit Arzneimittel deutlich von den Verhältnissen in Deutschland unterscheidet, weisen die Ergebnisse eines speziellen Surveys über die Versorgung und die Einnahme oder Nichteinnahme von Arzneimitteln durch ältere Menschen auf die Existenz und die Dimensionen einiger Probleme bei der Verordnungs- und Einnahmequalität hin, die auch im GKV-System vorkommen dürften.
Auch wenn sich das Gesundheitssystem in den USA speziell im Bereich der Versorgung mit Arzneimittel deutlich von den Verhältnissen in Deutschland unterscheidet, weisen die Ergebnisse eines speziellen Surveys über die Versorgung und die Einnahme oder Nichteinnahme von Arzneimitteln durch ältere Menschen auf die Existenz und die Dimensionen einiger Probleme bei der Verordnungs- und Einnahmequalität hin, die auch im GKV-System vorkommen dürften.
In einem in der Web Exclusive-Ausgabe der Zeitschrift "Health Affairs" im April 2005 veröffentlichten Aufsatz über "Prescription Drug Coverage and Seniors: Findings from a 2003 National Survey" (Autoren: Safran, D.; Neuman, T.; Schoen, C.: Kitchman, M. et al.) wurden detaillierte Daten über den Arzneimittel-Versicherungsschutz und die Einnahme von Arzneimitteln von 17.685 Medicare-Versicherten zusammengestellt.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
• 27 Prozent aller Senioren und ein Drittel der armen Senioren hatten keinen oder nur einen mangelhaften Versicherungsschutz für verschreibungspflichtige Medikamente,
• fast 45 Prozent der Befragten berichteten, sie bekämen mindestens 5 Medikamente verordnet,
• 54 Prozent hatten mehr als einen verschreibenden Arzt und
• 36 Prozent besuchten mehr als eine Apotheke,
• fast ein Drittel der befragten älteren Personen gaben mindestens 100 US-$ für Zuzahlungen bei Medikamenten aus,
• mehr als ein Viertel der Befragten verschob die Einlösung des Rezepts aus Kostengründen,
• ebenfalls ein Viertel nahm aufgrund schlechter vergangener oder aktueller Erfahrung und Wirkung der Medikamente die verordneten Arzneimittel nicht ein oder reduzierte die Dosis. Dieser Anteil betrug bei den Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen sogar 34 Prozent und
• 15 Prozent hielten sich nicht an die verordnete Menge der Arzneimittel, weil sie dachten, das sei zu viel oder sei nicht notwendig.
Insgesamt hielten sich damit 40 Prozent der befragten SeniorInnen aus verschiedenen Gründen nicht an den verordneten Umfang und die Art der Medikamentenverordnung. Dieser Anteil belief sich bei armen Alten auf 48 Prozent und bei Personen mit 3 und mehr chronischen Erkrankungen sogar auf 52 Prozent.
Sieht man von den speziellen Defiziten des Versicherungsschutzes in den USA ab, existieren offensichtlich bei älteren Menschen als einer der Bevölkerungsgruppen mit großen Bedarf an Medikamenten zahlreiche Schwierigkeiten mit deren Einnahme. Diese teilweise gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen erfordern eine deutliche Verbesserung der Arzt-Patient-Kommunikation und -Interaktion über Arzneimittel.
Hier finden Sie eine 2-seitige Zusammenfassung des Health Affairs-Aufsatzes
Bernard Braun, 9.10.2005