



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Websites"
International: Gesundheits- und Sozialstatistik |
Alle Artikel aus:
Websites
International: Gesundheits- und Sozialstatistik
Internationale Studie: Sommerliche Temperaturen werden COVID-19 nicht verringern, Public Health-Maßnahmen dagegen schon.
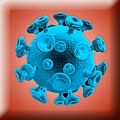 Wer vielleicht doch noch auf steigende Temperaturen oder darauf gehofft hat, dass geographisch südlichere Breitengrade die Verbreitung von COVID-19 natürlich bremsen würde, muss diese Hoffnung aufgeben und stattdessen über andere, vor allem Public Health-Methoden nachdenken.
Wer vielleicht doch noch auf steigende Temperaturen oder darauf gehofft hat, dass geographisch südlichere Breitengrade die Verbreitung von COVID-19 natürlich bremsen würde, muss diese Hoffnung aufgeben und stattdessen über andere, vor allem Public Health-Methoden nachdenken.
Zu diesem Schluss kommt eine gerade im Fachjournal "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichte Studie kanadischer Wissenschaftler. Diese hatten die Entwicklung der COVID-19-Infektionen (insgesamt 375.609), die dagegen gerichteten Maßnahmen und die jeweiligen klimatischen Bedingungen in 144 geopolitischen Räumen in Australien, Kanada und den USA und in anderen Teilen der Erde für den März 2020 zusammengeführt und auf Zusammenhänge untersucht. China, Südkorea, Iran und Italien wurden wegen ihrer Sonderbedingungen nicht berücksichtigt. Die möglichen Einflussfaktoren waren der Breitengrad, die Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Schulschließungen, Einschränkungen von Großveranstaltungen und soziale bzw. physikalische Distanzierung.
Die Ergebnisse:
• Zwischen dem geographischen Breitengrad, der Lufttemperatur und der Entwicklung von COVID-.19 gibt es keine oder nur eine sehr kleine Assoziation.
• Eine schwache Assoziation gibt es zwischen der Luftfeuchtigkeit und COVID-19.
• Richtig einflussreich und wirksam waren dagegen die Public Health-Maßnahmen.
Die Autoren weisen aber auch auf zahlreiche Limitationen derartiger internationaler Vergleiche hin. Dazu gehören je nach Land andere Testpraktiken, die Schwierigkeiten bei der Messung der COVID-19-Prävalenz und die unterschiedliche Compliance mit sozialer Distanzierung.
Und dass beim Umgang mit COVID-19 nicht nur einzelne Messwerte und Maßnahmen zu beachten sind und dies ihn weltweit aufwändig macht, fassen die Autoren so zusammen: "When deciding how to lift restrictions, governments and public health authorities should carefully weigh the impact of these measures against potential economic and mental health harms and benefits."
Die Studie Impact of climate and public health interventions on the COVID-19 pandemic: A prospective cohort study von Peter Jüni, Martina Rothenbühler, Pavlos Bobos, Kevin E. Thorpe, Bruno R. da Costa, David N. Fisman, Arthur S. Slutsky und Dionne Gesink ist am 8. Mai in der Zeitschrift CMAJ erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.5.20
Wie selten sind eigentlich seltene Krankheiten und wann gilt eine Krankheit als selten? Es betrifft um die 4% der Weltbevölkerung!
 Auch wenn seltene Krankheiten mit entsprechenden selten oder nie gelesenen "exotischen" Bezeichnungen seit einiger Zeit intensiver öffentlich diskutiert werden, fehlt ein Gesamtbild und wird allein wegen der vermuteten geringen Betroffenheit gar nicht versucht es zu erarbeiten.
Auch wenn seltene Krankheiten mit entsprechenden selten oder nie gelesenen "exotischen" Bezeichnungen seit einiger Zeit intensiver öffentlich diskutiert werden, fehlt ein Gesamtbild und wird allein wegen der vermuteten geringen Betroffenheit gar nicht versucht es zu erarbeiten.
Eine gerade veröffentlichte Analyse der in der speziellen Datenbank Orphanet gesammelten Daten aus weltweit erstellten Studien über 6.172 seltene Krankheiten (für 5.304 gab es Angaben zur Prävalenz), macht diesem Nichtstun und der Geringschätzung bzw. der Unterschätzung ein Ende.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt:
• 71,9% sind genetischer Natur, und 69,9% treten bereits im Kindesalter auf.
• 84,5% der Krankheiten mit Prävalenzangaben hatten eine Punktprävalenz, die kleiner als 1 Fall pro 1.000.000 Personen ist - waren also wirklich selten.
• 77,3% bis 80,7% der durch seltene Krankheiten verursachten Erkrankungslast der Bevölkerung resultieren aus den 4,2% oder 149 seltenen Krankheiten, deren Prävalenz zwischen einem und fünf Fällen pro 10.000 Personen beträgt.
• An Stelle der weit verbreiteten Definition der Seltenheit von Krankheiten zwischen 5 und 80 Fällen pro 100.000 Personen orientieren sich die ForscherInnen an der europäischen Definition von weniger als 5 Fällen pro 10.000 Personen. Ausgeschlossen werden aus der Analyse seltene Krebsarten, Infektionserkrankungen und Vergiftungen.
• Die ForscherInnen gehen auf ihrer Datenbasis davon aus, dass zwischen 3,5% und 5,9% der Weltbevölkerung an seltenen Krankheiten leiden. Dies entspricht einer Anzahl von 253 bis 446 Millionen Personen.
Der 9-seitige Aufsatz Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. von den am französischen "Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)" forschenden Stéphanie Nguengang Wakap, Deborah M. Lambert, Annie Olry, Charlotte Rodwell, Charlotte Gueydan, Valérie Lanneau, Daniel Murphy, Yann Le Cam und Ana Rath ist am 24.10.2019 online veröffentlicht worden und wird im "European Journal of Human Genetics" erscheinen. Der Text ist als Open Access-Text komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.10.19
Deutschland mal wieder Weltmeister: Geburt eines Kindes verschlechtert erheblich und nachhaltig das Einkommensniveau von Frauen
 Über die systematische soziale und ökonomische Benachteiligung von erwerbstätigen Frauen gegenüber Männern auch und gerade in entwickelten Ländern oder Wohlfahrtsstaaten (diverse gender gaps) und die dadurch auch für Sozialversicherungsträger, deren Beiträge auf der Basis von Erwerbseinkommen erhoben werden, entstehenden Nachteile wurde in diesem Forum bereits mehrere Male berichtet.
Über die systematische soziale und ökonomische Benachteiligung von erwerbstätigen Frauen gegenüber Männern auch und gerade in entwickelten Ländern oder Wohlfahrtsstaaten (diverse gender gaps) und die dadurch auch für Sozialversicherungsträger, deren Beiträge auf der Basis von Erwerbseinkommen erhoben werden, entstehenden Nachteile wurde in diesem Forum bereits mehrere Male berichtet.
Eine Anfang 2019 erschienene international vergleichende empirische Studie von WissenschaftlerInnen aus den USA, Großbritannien und der Schweiz über so genannte "child penalties" (Strafe für oder Nachteil durch ein Kind) in Dänemark und Schweden, Österreich und Deutschland sowie Großbritannien und den USA weist auf eine besonders gravierende und vor allem langfristig-dauerhaft folgenreiche Variante hin.
Untersucht wurde in den sechs Ländern mit unterschiedlichen längsschnittlichen Daten (in Deutschland z.B. mit den Daten des Sozioökonomischen Panels) die Entwicklung der Einkommen von Männern und Frauen von vor der Geburt des ersten Kindes bis zum zehnten Jahr nach dieser Geburt. Auch wenn bereits vor dieser Studie bekannt war, dass Frauen auch in Ehen oder festen Partnerschaften immer noch (nach einer aktuellen Studie der Konrad-Adenauer Stiftung gibt es sogar auf dem sowieso nicht hohen Niveau der Männer/Väterbeteiligung an der Kindererziehung eine Art Roll-Back der Lastenverteilung zu Ungunsten der Frauen/Mütter im Verlauf einer Ehe oder Partnerschaft) die Hauptarbeit mit der Kinderbetreuung und deren Folgen haben und damit auch Einkommenseinbußen erleiden, war die Intensität und Dauerhaftigkeit der "Strafe" für Frauen noch nicht so klar.
Das generelle Ergebnis ist, dass in allen Ländern Männer/Väter gar keine oder höchstens kleine und schnell vorübergehende Einkommenseinbußen erfuhren, Frauen/Mütter dagegen unmittelbar nach der Geburt beträchtliche Einbußen, die sich auch 10 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes lediglich auf einem immer noch deutlich unter dem Einkommensniveau im Jahr vor der Geburt einpendelte. Die "Kindergebärstrafe" verstetigte sich also wahrscheinlich für den größten Teil des Erwerbslebens, wenn nicht sogar für die gesamte Erwerbseinkommenzeit. Dabei gibt es aber zwischen den und innerhalb der Ländergruppen erhebliche Unterschiede was die Intensität der Einkommensverluste von Frauen mit Kindern angeht.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie lauten:
— Die so genannte "long-run penalty" für die Frauen nach Geburt ihres ersten KIndes pendelte sich in Dänemark und Schweden auf 21% und 27% ein. Im ersten Jahr nach der Geburt war die "Strafe" in Schweden (rund minus 62%) unerwartet deutlich größer als in Dänemark (rund minus 33%)
— Die "long-run penalty" betrug in Großbritannien 44% und in den USA 31%. Die Verringerung des Einkommens der Frauen unmittelbar nach der Geburt ihres ersten Kindes war weniger groß als in den skandinavischen Ländern. Während dort die Einkommen der Männer nach der Geburt ihres ersten Kindes kaum zurückgingen und sogar im 10-Jahres-Beobachtungszeitraum anstiegen, nahmen sie in den angelsächsischen Ländern ab, allerdings bei weitem nicht so stark wie bei Frauen.
— In den beiden deutschsprachigen Ländern gleicht die Verringerung der Einkommen der Frauen einem Absturz und zwar um knapp unter (Deutschland) und über 80% (Österreich). Die "long-run penalty" betrug dann in Österreich 51% und in Deutschland 61% - was dann auch der Spitzenwert der Untersuchung war.
— Langfristig war also der Einkommensverlust von Frauen mit Kind in Deutschland fast dreimal so hoch wie der der skandinavischen Frauen.
So klar die Ergebnisse sind, so unsicher fallen die Erklärungsversuche aus. Als erstes wird der mögliche Einfluss der unterschiedlichen staatlichen Kinderpolitiken (z.B. Dauer des Mutterschaftsurlaubs, Steuervergünstigungen) untersucht. Obwohl sie einige "short-run effects" sehen, kommen die AutorInnen zu dem Schluss, "that child penalties are not driven primarily by public policies". Als Erklärungsalternative verweisen sie dann auf "gender norms and culture" in der Gesellschaft und in Familien. Ein Ergebnis der "correlation between child penalties and gender norms" lautet dann auch: "The countries that feature larger child penalties are also characterized by much more gener conservative views". Da es sich bei der Studie aber um eine Beobachtungsstudie handelt, schränken die AutorInnen selber ihre Erklärungsergebnisse mit dem Hinweis ein, dass kausale Schlüsse unzulässig sind und in die Irre führen können. Hier besteht also weiterhin dringender Forschungsbedarf.
Egal welche Erklärung letztlich zutrifft oder eben nur eine Mischung verschiedener Erklärungen hilft, verschlechtern derartige Einkommensverluste einerseits spürbar die laufende materielle Lebensqualität der Frauen, mindern andererseits kurz- bis langfristig bei gleichen Leistungsansprüchen die Einnahmen der Sozialversicherungsträger und wirken sich langfristig negativ auf die materielle Situation von Frauen im Rentenalter aus. Gründe genug um noch wesentlich genauer hinzuschauen, warum die unerwünschten Folgewirkungen von Geburten insbesondere in Skandinavien deutlich geringer sind.
Die Studie Child Penalties Across Countries: Evidence and explanations von Henrik Kleven, Camille Landais, Johanna Posch, Andreas Steinhauer und Josef Zweimüller ist im Januar 2019 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.1.19
MigrantInnen und öffentliche Gesundheit: "…und Krankheiten schleppen die Migranten auch noch ein!"
 Die ausgerechnet im traditionellen Einwanderungsland Deutschland zuletzt bei der Diskussion über den UN-Migrationspakt mehr oder weniger (rechts)-radikal geäußerte Sorge um die drohende Einwanderung von Millionen MigrantInnen "in die Sozialsysteme" ist nicht das einzige Stereotyp wenn es darum geht, wenn derzeit über die weltweit fast eine Milliarde MigrantInnen ("on the move") gesprochen wird.
Die ausgerechnet im traditionellen Einwanderungsland Deutschland zuletzt bei der Diskussion über den UN-Migrationspakt mehr oder weniger (rechts)-radikal geäußerte Sorge um die drohende Einwanderung von Millionen MigrantInnen "in die Sozialsysteme" ist nicht das einzige Stereotyp wenn es darum geht, wenn derzeit über die weltweit fast eine Milliarde MigrantInnen ("on the move") gesprochen wird.
Dazu gehört auch die Behauptung, dass MigrantInnen in vielerlei Hinsicht eine Gefahr für die öffentliche und individuelle Gesundheit in europäischen oder nordamerikanischen Ländern darstellen.
Ob es dafür wissenschaftliche Belege gibt, hat nun die aus 20 führenden Public Health-ExpertInnen aus 13 Ländern bestehende "UCL-Lancet Commission on Migration and Health" in einem zweijährigen Projekt auf der Basis internationaler Daten untersucht und in einem Bericht auf der UN-Konferenz zum Migrationspakt in Marrakesch vorgestellt. Die wichtigsten Ergebnisse sind auch in der aktuellen Ausgabe der auf international vergleichende Gesundheitsanalysen spezialisierten Medizin-Zeitschrift "The Lancet" veröffentlicht.
Aus der Fülle der dort ausführlich belegten Ergebnisse sind folgende für die eingangs erwähnte Debatte beachtenswert:
• Rund 75% der MigrantInnen sind Binnen-MigrantInnen, überschreiten also keine internationalen Grenzen. 258 Millionen Menschen sind internationale MigrantInnen. Deren Anteil an der Weltbevölkerung hat sich zwischen 1990 und 2017 lediglich geringfügig, nämlich von 2,9% auf 3,4% erhöht. 65% von ihnen sind ArbeitsmigrantInnen, d.h. der kleinere Teil sind Flüchtlinge oder Asylsuchende. Dies sind zwar immer noch viele Millionen zu viel, rechtfertigt aber nicht das Stereotyp der gar noch wachsenden "Überflutung" reicher Länder.
• Der zwischen 1990 und 2017 in Ländern mit hohem Einkommen von 7,6% auf 13,4% angestiegene Anteil der internationalen MigrantInnen beinhaltet u.a. auch die wachsende Zahl von StudentInnen oder eben Arbeitsmigrantinnen aus ärmeren Ländern.
• Die Behauptung, Flüchtlinge versuchten überwiegend in die reichen Länder zu kommen, hält einer empirischen Überprüfung nicht stand: Der Anteil von Flüchtlingen ist in Ländern mit niedrigem Einkommen mit 0,7% höher als in Ländern mit hohem Einkommen mit 0,2%.
• Bisher gibt es auch keine Anzeichen, dass MigrantInnen die ökonomische Situation der Aufnahmeländer schädigt, im Gegenteil. Mit jedem Anstieg des Anteil von MigrantInnen an der erwachsenen Bevölkerung um 1% wächst das Bruttosozialprodukt um bis zu 2%.
• Sind MigrantInnen kränker und stellen damit eine besondere Belastung "unserer" bzw. der Gesundheitssysteme der Gastländer dar? Ein aktueller systematischer Review samt Meta-Analyse der Gesundheitsdaten von 15,2 Millionen MigrantInnen aus 92 Ländern stellt fest, dass MigrantInnen in reichen Ländern bei den meisten Erkrankungen (z.B. Herzkreislauferkrankungen, Krebs, psychische Erkrankungen und Verletzungen) im Vergleich mit der Stammbevölkerung in ihren Aufnahmeländern eine geringere Mortalität und damit auch Morbidität samt Behandlung aufweisen. Nur für Infektionen (z.B. Tuberkulose) und externe Ursachen wie körperliche Angriffe sieht dies anders aus. Aber selbst z.B. bei Tuberkulose gibt es Erkenntnisse, dass daran vor allem die Mit-MigrantInnen und nicht die Gastbevölkerung erkranken.
• Diese Erkenntnisse werden durch spezielle Studien u.a. über die Gesundheitsverhältnisse in Großbritannien und den USA vertieft.
• Das Gegenteil ohne Beleg oder wider besseres Wissen zu behaupten, dient der systematischen Ignoranz gegenüber den Migrationsursachen und der Diskriminierung bzw. der Verweigerung oder Erschwernis der Integration. Die Verweigerung von Bildung und anderer sozialer Leistungen sind aber negative Bedingungen für die Gesundheit.
Zusammenfassend stellen die ForscherInnen fest: "Myths about migration and health not supported by the available evidence".
Wer mehr wissen will kann die folgenden Aufsätze, die alle am 5. Dezember 2018 in der Zeitschrift "Lancet" erschienen sind, alle kostenlos herunterladen.
• The UCL-Lancet Commission on Migration and Health: the health of a world on the move von Ibrahim Abubakar et al. (nach einer knappen Anmeldung)
• Global patterns of mortality in international migrants: a systematic review and meta-analysis. von Robert W Aldridge et al.
• Do migrants have a mortality advantage? von Anjali Borhade und Subhojit Dey
• Health impacts of parental migration on left-behind children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. von Gracia Fellmeth et al.
• Forgotten needs of children left behind by migration. von Sian M Griffiths, Dong Dong und Roger Yat-nork Chung.
Bernard Braun, 10.12.18
Wird die Weltbank grün? Nein, nur realistisch, wenn es um die gesundheitlichen und ökonomischen Folgen der Luftverschmutzung geht!
 Wer partout den Umweltverbänden und den "Grünen" nicht glauben will, kann sich über die gesundheitlichen Risiken der Umweltverschmutzung in einem gerade veröffentlichten Bericht der Weltbank und des "Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)" informieren.
Wer partout den Umweltverbänden und den "Grünen" nicht glauben will, kann sich über die gesundheitlichen Risiken der Umweltverschmutzung in einem gerade veröffentlichten Bericht der Weltbank und des "Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)" informieren.
Dort findet man u.a. diese Informationen über die weltweiten und regionalen gesundheitlichen und ökonomischen Auswirkungen der Luftverschmutzung:
• Zu einem von 10 Todesfällen trägt weltweit die Exposition gegenüber Luftverschmutzung bei. Dabei handelt es sich sowohl um häusliche Luftverschmutzung durch offene Feuerstellen mit ungeeigneten Brennstoffe als um außerhäusliche Verschmutzung durch den Straßenverkehr oder Industrieanlagen.
• Zu den gefährlichsten Inhaltsstoffen von Luftverschmutzung gehört Feinstaub.
• 2013 ereigneten sich rund 93% aller Sterbefälle und schweren Erkrankungen, die der Luftverschmutzung zuzurechnen waren, in Entwicklungsländern wo 90% der Bevölkerung einem gefährlichen Niveau von Luftverschmutzung ausgesetzt sind.
• Luftverschmutzung ist daher nach Ernährungsrisiken oder Tabakkonsum der viertgrößte Sterblichkeits-Risikofaktor.
• Mehr als sechsmal so viel Personen wie an Malaria sterben durch Luftverschmutzung.
• 87% der Weltbevölkerung leben in Gegenden, in denen die Luftqualitätswerte der WHO von 2013 überschritten werden.
• Durch den frühzeitigen Tod von erwerbsfähigen Personen durch Luftverschmutzung entgingen ihren Ländern 2013 rund 225 Milliarden US-Dollar an Arbeitseinkommen.
Trotz einiger Reduktionen von Luftschadstoffen (z.B. durch den Einsatz geschlossener und damit raucharmen Verbrennungsöfen) und anderer Verbesserungen stellt die Weltbankstudie fest: "Furthermore, the growing challenge of ambient air pollution and persistence of household air pollution impacts despite improvements in health services suggest that incremental progress to improve air quality will not be sufficient and that achieving real reductions in the cost of pollution will require more ambitious action." Um welche anspruchsvolleren Aktionen es sich handeln könnte, wird aber nicht mehr ausführlich dargestellt.
Der 122 Seiten umfassende Worldbank-Report The Cost of Air Pollution: Strengthening the Economic Case for Action ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.9.16
USA und Deutschland: Länger leben - "krank" oder "gesund"? Neues zur Empirie der "compression of morbidity".
 Für die seit Jahrzehnten laufende epidemiologische und sozialpolitische Debatte darüber, ob eine längere Lebenserwartung mehr gesunde oder kranke bzw. behinderte Jahre mit sich bringt, liegen für die USA aktuelle Daten über die Entwicklung der Lebenserwartung und der "kranken" oder "gesunden" Lebensjahre von Männern und Frauen zwischen den Jahren 1970 und 2010 vor.
Für die seit Jahrzehnten laufende epidemiologische und sozialpolitische Debatte darüber, ob eine längere Lebenserwartung mehr gesunde oder kranke bzw. behinderte Jahre mit sich bringt, liegen für die USA aktuelle Daten über die Entwicklung der Lebenserwartung und der "kranken" oder "gesunden" Lebensjahre von Männern und Frauen zwischen den Jahren 1970 und 2010 vor.
Mit den Ergebnissen lässt sich die optimistische Hypothese, nämlich die über eine so genannte "compression of morbidity", nicht bzw. nur mit Einschränkungen bestätigen und finden sich einige empirische Belege für die eher pessimistische "Medikalisierungs"-Hypothese.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Die Lebenserwartung bei der Geburt stieg im Untersuchungszeitraum bei Männern um 9,2 und bei Frauen um 6,4 Jahre.
• Die Anzahl der behinderungs-/erkrankungsfreien ("disability-free") Jahre stieg bei den Männern um 4,5 Jahre und die der Jahre mit Behinderungen/Erkrankungen um fast den denselben Zeitraum, nämlich 4,7 Jahre.
• Bei den Frauen stieg der Anteil der "gesunden" Lebensjahre um 2,7 und der der "kranken" Jahre um deutlich mehr, nämlich 3,6 Jahre.
• Untersucht man den weiteren Gesundheitsverlauf der 65-Jährigen und älteren Personen war bei diesen aber der Anteil der "gesunden" Jahre mehr angestiegen und damit höher als der der "kranken" Jahre.
• Das andere Bild bei den jüngeren Personen ist angesichts des Gesamtergebnisses zwingend. Für das Anwachsen der "kranken" Jahre von Angehörigen dieser Altersgruppe sind besonders die größere Bedeutung der psychischen Gesundheit, die steigende Häufigkeit von autistischen Störungen und Aufgmerksamkeitsstörungen und die Veränderungen des Gebrauchs von Drogen verantwortlich.
Auch wenn die Daten nicht den Schluss zulassen, dass längeres Leben komplett "gesundes" Leben bedeutet, weisen die AutorInnen darauf hin, dass das Augenmerk einer präventiven Gesundheitspolitik auf dem Erkrankungsgeschehen der jüngeren Bevölkerung und den dort zu beobachtenden Chronifizierungsprozessen liegen müsste.
Zu den Limitationen dieser Studie gehört, dass die Angaben zum Gesundheitszustand des größten Teils der Bevölkerung aus dem "National Health Interview Survey" stammen. Veränderungen in der Prävalenz wichtiger Krankheitsarten (z.B. psychische Erkrankungen) könnten also nicht die tatsächliche Zunahme ihrer Häufigkeit anzeigen, sondern auf deren offeneren Kommunikation beruhen.
Die naheliegende Frage wie das Verhältnis von "gesunden" zu "kranken" Lebensjahren in der deutschen Bevölkerung aussieht, gibt es in zwei Publikationen der OECD aus den letzten beiden Jahren (Health at a Glance 2014 - komplett kostenlos erhältlich - und OECD-Wirtschaftsberichte: Deutschland 2016 - nur Abstract kostenlos erhältlich, einzelne Kapitel aber online lesbar) Hinweise.
Mit den üblichen Einschränkungen zur Vergleichbarkeit von unterschiedlich erhobenen Daten, sieht die Situation in Deutschland so aus: Die weitere Lebenserwartung einer deutschen 65-jährigen Person betrug 2012 19,8 Jahre (EU: 18,8). Davon verbrachten diese Personen noch knapp 7 Jahre "gesund" (EU: 8,6). Nur in drei Ländern (Estland, Slowakei, Ungarn) war der Umfang "gesunder" Lebensjahre geringer. In Schweden lebten z.B. 65-Jährige durchschnittlich noch 19,9 Jahre, wovon 14,7 Jahre "gesunde" Jahre waren. In beiden Berichten wird außerdem auf die erheblichen Unterschiede zwischen sozial unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen hingewiesen.
Von der zunächst elektronischen Fassung des im "American Journal of Public Health" erschienenen Aufsatzes Trends Over 4 Decades in Disability-Free Life Expectancy in the United States von Eileen M. Crimmins, Yuan Zhang und Yasuhiko Saito ist nur ein Abstract kostenlos erhältlich.
Wer sich noch einen relativ aktuellen und kostenlosen Überblick über die Hypothese der "compression of morbidity" verschaffen will, kann dies mit folgendem Aufsatz machen: Compression of Morbidity 1980-2011: A Focused Review of Paradigms and Progress. Autoren sind James F. Fries (der Protagonist dieser Hypothese), Bonnie Bruce und Eliza Chakravarty. Erschienen ist der Aufsatz 2011 im "Journal of Aging Research".
Bernard Braun, 18.4.16
Unterversorgung mit chirurgischen Behandlungen in armen und mittelarmen Ländern am größten = fast 17 Millionen vermeidbare Tote
 Wer hierzulande darüber klagt, dass er möglicherweise demnächst mit einem Beinbruch oder einer akuten Blinddarmentzündung in ein etwas weiter hinter der nächsten Ecke liegendes Krankenhaus gehen oder transportiert werden wird, sollte sich einmal über das Niveau seiner Klagen Gedanken machen.
Wer hierzulande darüber klagt, dass er möglicherweise demnächst mit einem Beinbruch oder einer akuten Blinddarmentzündung in ein etwas weiter hinter der nächsten Ecke liegendes Krankenhaus gehen oder transportiert werden wird, sollte sich einmal über das Niveau seiner Klagen Gedanken machen.
Viele Anregungen enthält ein am 26. April 2015 online veröffentlichter 56-seitiger Report einer 25-köpfigen internationalen Wissenschaftlergruppe über den weltweiten Zustand und die Erhältlichkeit chirurgischer Behandlung bei entsprechenden Erkrankungen - in der Vergangenheit, Gegenwart und im Jahr 2030.
Der Report kommt zu folgenden zentralen Feststellungen:
• 32,9% aller weltweiten Todesfälle beruhen auf Krankheiten (z.B. Blinddarmentzündungen, Knochenbrüche oder Geburtskomplikationen), die mit Operationen behandelbar sind. Dies entspricht 16,9 Millionen Toten.
• 5 Milliarden Angehörige der Weltbevölkerung haben im Bedarfsfall keinen Zugang zu sicheren und finanziell leistbaren Operationen samt angemessener Anästhesie.
• Dies trifft besonders die Einwohner von Ländern mit geringem und mittleren Einkommen, wo fast 90% von ihnen keinen Zugang zu einer chirurgischen Basisversorgung haben.
• Von den 313 Millionen Operationen, die jährlich weltweit stattfinden, entfallen lediglich 6% auf die Einwohner armer Länder, die allerdings ein Drittel der Weltbevölkerung stellen, und dann auch noch mit großen Erkrankungsrisiken zu tun haben.
• Allein um Leben zu retten und Behinderungen zu vermeiden sind in den armen und mittelarmen Ländern 143 Millionen zusätzlicher Operationen notwendig.
• 33 Millionen Personen haben wegen der Kosten für Operationen und Anästhesie mit für sie katastrophalen Behandlungsausgaben zu kämpfen. 48 Millionen weitere sind zusätzlich wegen der nichtmedizinischen Kosten des Zugangs zu operativen Leistungen in ökonomischen Schwierigkeiten.
• Um an diesen Zuständen in armen und mittelarmen Ländern bis 2030 etwas zu ändern, also ein akzeptables Minimum von 5.000 chirurgischen Eingriffen pro 100.000 Einwohner zu erreichen, bedarf es einer Investition von 420 Milliarden US-Dollar. Passiert nichts, häufen sich in diesen Ländern zwischen 2015 und 2030 finanzielle Verluste von insgesamt 12,3 Trillionen US-Dollar (in Kaufkraftparitäten des Jahres 2010) an. Obwohl also die Investitionskosten hoch sind, sind in den Worten des Leiters der Wissenschaftlergruppe "the costs of inaction … higher, and will accumulate progressively with delay".
Wer glaubt, dass er Westafrika nach der viel zu spät angelaufenen aber letztlich für den Augenblick erfolgreichen Bekämpfung der dortigen Ebola-Epidemie, samt seinen insgesamt miserablen Gesundheitssystemen wieder vergessen kann oder höchstens eine "Weißhelmtruppe" zu stationieren braucht, irrt sich mit Ansage gewaltig.
Der enorm materialreiche Aufsatz Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development von John G. Meara et al. ist am 27. April 2015 online in dem Fachjournal "Lancet" erschienen und nach einer kurzen Anmeldung als Nutzer komplett kostenlos erhältlich. Hilfreich ist auch die über 300 Titel umfassende Literaturliste und per Link erreichbare Methodikübersichten.
Generell erneut der Hinweis, dass an komplett kostenlosen Beiträgen des Lancet interessierte Personen sich für einen freien Zugang zu einer respektablen Anzahl von Texten einfach anmelden können und sich nach Erfahrung des Autors nicht vor unerwünschten Zusendungen etc. fürchten müssen.
Bernard Braun, 29.4.15
"Sozialstandort Deutschland" schrumpfend und im OECD-Vergleich deutlich unterhalb der Medaillenränge
 Für den aktuell relativ unaufgeregten, aber bei jeder Gelegenheit reaktivierbaren Krisendiskurs über den durch "zu hohe" Sozialausgaben gefährdeten "Wirtschaftsstandort Deutschland" liefert ein Blick in den neuesten OECD-Survey zur ökonomischen Situation Frankreichs ein paar interessante Details.
Für den aktuell relativ unaufgeregten, aber bei jeder Gelegenheit reaktivierbaren Krisendiskurs über den durch "zu hohe" Sozialausgaben gefährdeten "Wirtschaftsstandort Deutschland" liefert ein Blick in den neuesten OECD-Survey zur ökonomischen Situation Frankreichs ein paar interessante Details.
Beim Vergleich des Anteils der Sozialausgaben für Gesundheit, Alter, Beschäftigung etc. am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Jahren 2000 und 2014 ergibt sich folgendes Bild:
• Dieser Anteil steigt in der gesamten OECD von 18,6% auf 21,62%.
• Entgegen dieses Trends, wenngleich auf höherem Niveau, fiel dieser Anteil in Deutschland von 26,21% auf 25,8%.
• Dieser Anteil war 2014 in Frankreich, Italien, Österreich, Schweden und Spanien - also einigen für den "Wirtschaftsstandort Deutschland" wichtigen Länder - höher als in Deutschland und war seit 2000 auch in all diesen Ländern zum Teil stark gestiegen.
• Bei den Ländern, in denen 2014 der Anteil der Sozialausgaben am BIP prozentual niedriger war, wie z.B. in den USA oder der Schweiz, stieg er in der Untersuchungszeit durchweg an. In den USA z.B. von 14,17% auf 19,23%.
Selbst wenn man die Kritik an den absoluten Zahlen in OECD-Statistiken Ernst nimmt (z.B. wegen der Schwierigkeiten, nationale Berechnungsbesonderheiten richtig zu bewerten), ändert dies nichts an den relativen Aussagen bzw. den aufgezeigten Entwicklungstrends.
Der Bericht - auf Seite 28 die Übersicht 10 zu den Sozialaufwendungen - OECD Economic Survey: France 2015: Assessment and recommendations ist kostenlos herunterzuladen. Separat erhält man auch die Liste der Anteile für alle OECD-Länder.
Bernard Braun, 11.4.15
Leben Rumänen kürzer als Franzosen und was wird dort gegen Alkoholismus gemacht? ECHI, HLY, EAHF und IDB via Heidi geben Auskunft!
 Nein, mit Johanna Spyris "Heidi"-Romanen hat dies nichts zu tun und auch nichts mit dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz. Es geht um eine der Quellen aus denen Gesundheitsinformationen und -daten aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) gewonnen werden können.
Nein, mit Johanna Spyris "Heidi"-Romanen hat dies nichts zu tun und auch nichts mit dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz. Es geht um eine der Quellen aus denen Gesundheitsinformationen und -daten aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) gewonnen werden können.
Auf Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface) finden Interessenten Daten und Informationen zu den gestellten und noch wesentlich mehr Fragen. Dazu gehören derzeit:
• Die enorme Fülle der "European Core Health Indicators (ECHI)", gut aufbereitete Daten über die gesundheitliche Lage, gesundheitsbezogenes Verhalten, Krankheiten und Gesundheitssystemmerkmale, die durch methodische Anpassungen Vergleiche und Benchmarkberechnungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten ermöglichen.
• Auf Befragungen beruhende "Healthy Life Years (HLY)-Daten zum Umfang der zu bestimmten Lebensaltern zu erwartenden weiteren Lebensjahre in gesunder Verfassung.
• Über 300 einzelne Statements, Beschlüsse, Selbstverpflichtungen und Konzepte von staatlichen, öffentlichen und privaten Einrichtungen und Akteuren zur Prävention alkoholbedingter Erkrankungen in dem "European Alcohol and Health Forum (EAHF)".
• Die Daten der europaweiten "Injury Data Base (IDB)".
• Und eine Reihe von Daten, Beschlüsse und Pläne im Rahmen der "Cancer Partnership" der EU-Kommission.
Da die EU noch über zahlreiche weitere Daten verfügt, diese aber auf vielen Websites verteilt sind, ist beabsichtigt, den Zugang zu ihnen auch über Heidi zu erleichtern. Regelmäßige Besuche bei Heidi werden hoffentlich fündig.
Der Zugang zu Heidi ist kostenlos.
Bernard Braun, 26.11.14
Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder wie entwickelt sich das Gesundheitsverhalten von jungen Menschen in den USA seit 1991?
 Der am 13. Juni 2014 veröffentlichte 172-seitige "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" mit den Ergebnissen des "Youth Risk Behavior Surveillance Report" lieferte eine Reihe interessanter Ergebnisse zum aktuellen Gesundheitsverhalten bzw. riskanten Gesundheitsverhalten der High-School-Generation und vor allem auch zu seiner Entwicklung seit Beginn dieser Art von Survey zu Beginn der 1990er Jahre. Die Ergebnisse zeigen außerdem die inhaltliche Relevanz von Längsschnittanalysen zur Fundierung der vielen Debatten über die vermeintlich schlechter werdende Gesundheit oder das nachlässigere Gesundheitsverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Der am 13. Juni 2014 veröffentlichte 172-seitige "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" mit den Ergebnissen des "Youth Risk Behavior Surveillance Report" lieferte eine Reihe interessanter Ergebnisse zum aktuellen Gesundheitsverhalten bzw. riskanten Gesundheitsverhalten der High-School-Generation und vor allem auch zu seiner Entwicklung seit Beginn dieser Art von Survey zu Beginn der 1990er Jahre. Die Ergebnisse zeigen außerdem die inhaltliche Relevanz von Längsschnittanalysen zur Fundierung der vielen Debatten über die vermeintlich schlechter werdende Gesundheit oder das nachlässigere Gesundheitsverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
In dem zweijährig durchgeführten Survey werden repräsentativ für die gesamte USA und zusätzlich für 42 Bundesstaaten und 21 große städtische Schulbezirke Antworten auf Fragen nach 104 gesundheitsriskanten Verhaltensweisen, dem Sexualverhalten, dem Übergewicht und Adipositas sowie zum Auftreten von Asthma veröffentlicht.
Zur Fülle der Ergebnisse gehörten 2013/14 u.a. folgende Daten:
• In den 30 Tagen vor der Befragung schrieben 41,4% der Befragten, die ein Fahrzeug führten während der Fahrt eine Mail oder andere Texte,
• 34,9% hatten im selben Zeitraum Alkohol getrunken,
• 15,7% hatten Tabakwaren geraucht und 8,8% rauchlosen Tabak konsumiert,
• 23,4% nahmen Marijuana zu sich,
• 14,8% wurden elektronisch belästigt,
• von den sexuell aktiven SchülerInnen benutzten 59,1% ein Kondom,
• 88% der jungen RadfahrerInnen trugen nie oder nur sehr selten einen Helm,
• in den 7 Tagen vor der Befragung hatten 5% der High-School-BesucherInnen weder Obst gegessen noch Fruchtsäfte getrunken und 6,6% hatten kein Gemüse gegessen.
Was erste Kommentatoren des Surveys titeln ließen "the good news and the bad" waren die unterschiedlichen Ergebnisse des Vergleichs der Prävalenz verschiedener dieser Verhaltensweisen in den Jahren 1991 und 2013. Dieser Vergleich zeigte u.a. folgende zum Teil unerwartete Veränderungen:
• Der Anteil der tabakrauchenden Teens sank von 28% auf 16%
• Der Anteil AlkoholtrinkerInnen nahm von 51% auf 35% ab
• Der Anteil der Teens, der in Prügeleien oder körperliche Kämpfe verwickelt war, sank von 43% auf 25%
• Nahezu die Hälfte der Befragten versuchten 2013 Gewicht abzunehmen oder hatten versucht, das Rauchen aufzugeben
• Trotz all dieser Verbesserungen stieg der Anteil der sich nach dem öffentlichen Verständnis ungesund verhaltenden MarijuananutzerInnen im betrachteten Zeitraum von 15% auf 23%.
Was an den auch hier hierzulande meist elanvoll vertretenen pessimistisch gestimmten Annahmen über die Tendenz des Gesundheitsverhalten der jüngeren und restlichen deutschen Bevölkerung dran ist, lässt sich wegen der umgekehrt proportionalen Vernachlässigung von Längsschnittsanalysen leider nicht sagen. Dass es sich völlig anders entwickelt haben sollte als in den USA, ist aber eher unwahrscheinlich.
Der komplette Bericht Youth Risk Behavior Surveillance - United States, 2013 von Laura Kann et al. (Surveillance Summaries, Vol. 63, No. 4) ist am 13. Juni 2014 erschienen und kostenlos erhältlich. Er enthält u.a. 100 Seiten Tabellen mit Angaben zur regionalen, geschlechtsspezifischen und ethnischen Häufigkeit des Gesundheitsverhaltens.
Mehr zu dem diesem Report zugrundeliegenden "Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)" erfährt man auf der Website der für dieses System und den Report verantwortlichen staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention".
Bernard Braun, 15.6.14
Wer viel Zeit hat, stellt sich Zeitreihen selber zusammen, wer weniger, schaut in "histat" nach.
 Wie viele Krankenhäuser gab es vor 1918 im deutschen Kaiserreich, wie entwickelte sich die Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeit nach 1883 mit dem gesetzlichen Start der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), wie entwickelt sich die Anzahl der Hauptschulabsolventen oder die der Nicht-Krankenversicherten seit Gründung der BRD - und vieles auch noch im internationalen Vergleich? Solche und noch jede Menge weiterer Fragen nach der zeitlichen Entwicklung sozial-, bildungs- oder wirtschaftspolitischer Kennzahlen hat man immer wieder und findet Antworten häufig nur nach zeitraubenden Recherchen in jeder Menge Originalliteratur.
Wie viele Krankenhäuser gab es vor 1918 im deutschen Kaiserreich, wie entwickelte sich die Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeit nach 1883 mit dem gesetzlichen Start der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), wie entwickelt sich die Anzahl der Hauptschulabsolventen oder die der Nicht-Krankenversicherten seit Gründung der BRD - und vieles auch noch im internationalen Vergleich? Solche und noch jede Menge weiterer Fragen nach der zeitlichen Entwicklung sozial-, bildungs- oder wirtschaftspolitischer Kennzahlen hat man immer wieder und findet Antworten häufig nur nach zeitraubenden Recherchen in jeder Menge Originalliteratur.
Seit 2004 und grundlegend überarbeitet seit 2012 gibt es zur Beantwortung solcher Fragen die Online-Datenbank "histat". Sie enthält zu den Schwerpunkten Bildung, Arbeit, Bevölkerung, Sozialstaat und vielen weiteren Themenbereichen auch zahlreiche Zeitreihen zum Bereich Gesundheit - darunter 3.001 Zeitreihen zum Heilpersonal und Krankenhauswesen 1950-1985 oder 1.205 Zeitreihen über die Basisdaten zur Entwicklung der Gesundheitsverhältnisse in Deutschland in den Jahren 1816 bis 2010. Insgesamt finden die derzeit rund 3.000 registrierten NutzerInnen 308.564 Zeitreihen mit 6.347.027 Werten, die aus über 360 einzelnen Studien zusammengestellt wurden.
Auf einige für eigene Recherchen und Datennutzung wichtigen Besonderheiten weisen deren Organisatoren aus dem Leibnizinstitut für Sozialwissenschaften "gesis" so hin: "histat bietet zu jeder Studie, aus der Daten angeboten werden, umfangreiche "Metainformationen" an: neben einer ausführlichen Studienbeschreibung auch detaillierte Hinweise zu den in der Studie verwendeten Quellen, zum Untersuchungsgebiet sowie weitere Anmerkungen. Diese Metadaten sind das Ergebnis vieler Jahre Arbeit des Teams Datenservice Historische Studien. Sämtliche Metadaten stehen allen Nutzerinnen und Nutzern mit einer komfortablen Suchfunktion kostenfrei und ohne Registrierung zur Verfügung. Da wir die Daten von unseren Datengeberinnen und Datengebern, oftmals schon vor vielen Jahren, unter bestimmten Weitergabe-Bedingungen erhalten haben, sind wir verpflichtet, die Nutzung dieser Daten zu belegen. Aus diesem Grund hatten wir mit dem Beginn der Bereitstellung der Daten 2004 eine Registrierung vorgesehen. Im Zeitalter von "open data" sollten Daten offen angeboten werden, wenn dem weder Datenschutz- noch Copyright-Probleme im Wege stehen. Wir werden daher sukzessive in den nächsten Monaten solche Daten frei anbieten, bei denen das unserer Ansicht nach unzweifelhaft möglich ist. Sie erkennen diese Studien daran, dass der Zugang zu den Daten nicht über ein orangenes, sondern über ein grünes Feld erfolgt. Der download solcher Daten wird ab sofort auch ohne vorherige Registrierung und Anmeldung möglich sein."
Wie aus dem Zitat hervorgeht, ist die Nutzung der Datenschätze zwar kostenlos, erfordert aber auf der Startseite von histat für den größten Teil eine persönliche Registrierung, die keine erkennbaren Nachteile (z.B. Werbesendungen) hat.
Bernard Braun, 12.6.14
Weltgesundheitsbericht 2013: Research for universal health coverage
 Im August legte die Weltgesundheits-organisation(WHO ihren neuesten Jahresbericht vor, der sich diesmal dem Thema Forschung für universelle Absicherung im Krankheitsfall widmet. Damit knüpft die WHO an ihren letzten Bericht von 2010 an, der die Bedeutung geeigneter Gesundheitsfinanzierungssysteme zum Erreichen universeller Sicherung aufgezeigt hatte. Der Bericht Weltgesundheitsbericht 2010 der WHO: Der Weg zu universeller Sicherung im Forum Gesundheitspolitik stellte den Weltgesundheitsbericht 2010 vor.
Im August legte die Weltgesundheits-organisation(WHO ihren neuesten Jahresbericht vor, der sich diesmal dem Thema Forschung für universelle Absicherung im Krankheitsfall widmet. Damit knüpft die WHO an ihren letzten Bericht von 2010 an, der die Bedeutung geeigneter Gesundheitsfinanzierungssysteme zum Erreichen universeller Sicherung aufgezeigt hatte. Der Bericht Weltgesundheitsbericht 2010 der WHO: Der Weg zu universeller Sicherung im Forum Gesundheitspolitik stellte den Weltgesundheitsbericht 2010 vor.
Die meisten Entwicklungs- und Schwellenländer stehen vor der Herausforderung, mit den jeweils verfügbaren Mitteln der gesamten Bevölkerung Zugang zu erforderlichen Gesundheitsleistungen zu ermöglichen. Trotz der wachsenden weltweiten Bedeutung von universeller sozialer Absicherung im Krankheitsfall, die zu einem der dominierenden Themen der Entwicklungszusammenarbeit geworden ist, bestehen in den Ländern viele offene Fragen, wie die angemessenen Absicherung aller zu bewerkstelligen ist. Mit ihrem diesjährigen Bericht will die WHO auf den großen Forschungsbedarf hinweisen, der für eine weltweite Umsetzung von universeller Absicherung im Krankheitsfall erforderlich ist. Derzeit würde zwar viel in neue Ideen und Techniken investiert, aber vorhandenes Erfahrungswissen nicht hinreichend genutzt und in die Praxis umgesetzt.
Aber, so erklärt die Weltgesundheitsorganisation ihr Anliegen, universelle soziale Absicherung im Krankheitsfall lasse sich nicht ohne wissenschaftliche Evidenz und Untermauerung erreichen: "Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung erfährt vergleichsweise geringe Unterstützung und wenig Aufmerksamkeit", meint die WHO in ihrem Jahresbericht 2013, und erkennt einen "besonderen Bedarf, die Kluft zwischen bestehendem Wissen und dem Vorgehen zu überwinden". Zwar erfordern grundsätzliche Fragen universeller Absicherung wie die Struktur des Gesundheitswesens, Angebots- und Nachfrageverhalten und Zielvorgaben lokale Antworten, darüber hinaus bestehe aber in allen Ländern erheblicher Bedarf an systematischer Aufarbeitung und Umsetzung von Erfahrungswissen:
Der Weltgesundheitsbericht führt etliche Beispiele dafür auf, wie evidenzbasierte Erkenntnisse gesundheitspolitische Maßnahmen bestärken können:
• Evaluierungsergebnisse aus 22 afrikanischen Ländern belegen, dass insektizid-behandelte Moskitonetze die Kindersterblichkeit um 13-31 % reduzieren
• Die Auswertung von Studien aus sechs Ländern zeigen, dass konditionierte Transferzahlungen an arme Haushalte, die an die Inanspruchnahme bestimmter Gesundheitsleistungen gekoppelt sind, bei Kindern die Häufigkeit der Nutzung von Gesundheitszentren um 11-20 % und bei Vorsorgeleistungen sogar um 23-33 % erhöhte
• Studienergebnisse aus fünf europäischen Ländern belegen, dass die alterungsbedingte Ausgabensteigerung zwischen 2010 und 2060 nicht über 1 % pro Jahr liegt und sogar sinkende Tendenz aufweist.
Niemand wird die Bedeutung derartiger Ergebnisse für die Politik- und Entwicklungsberatung bezweifeln; insbesondere solche Erkenntnisse, die gängige gesundheitspolitische Mythen entkräften, sind überaus begrüßenswert. Aber so begrüßenswert wissenschaftliche Erkenntnisse zur Untermauerung politischer Entscheidungen auch sind, der Ansatz des WHO-Jahresberichts erweist sich letztlich doch als arg technokratisch und selbstreferenziell. Denn es fehlt eine systematische Analyse, welche Daten und wissenschaftlichen Erkenntnisse am wichtigsten sind, wie diese Erkenntnisse letztlich zur Verbesserung der Gesundheit beitragen können und wie sie sich in einen Systemansatz integrieren lassen.
Der Bericht betont in seinem Hauptteil, dass gesundheitsbezogene Forschung weltweit zunimmt und an Bedeutung gewinnt, und liefert 12 Beispiele von Studien, die beweisen, "wie wissenschaftliche Forschung einige der wesentlichen Fragen aufgreifen kann, wie universelle Absicherung zu erreichen ist". Die angekündigten Beispiele reichen von der Prävention und Kontrolle spezieller Erkrankungen bis hin zu funktionierenden Gesundheitssystemen. Allerdings verbleibt der Bericht auf rein programmatischer Ebene, greift keine Studie auf, die eine systemische Perspektive einnimmt oder Interaktionen verschiedener Akteure und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Interventionen einbezieht.
Das ist bemerkenswert, schließlich hatte die WHO nur vier Jahre zuvor ihren Bericht Systems thinking for health systems strengthening veröffentlicht, in dem sie Gesundheitssysteme als komplexe, anpassungsfähige Systeme beschreibt. Die WHO fordert und befördert Systemdenken als "einen wesentlichen Ansatz zur Stärkung von Gesundheitssystemen". Und vor einem Jahr veröffentlichte die WHO einen 474-Bericht mit dem Titel Health policy and systems research - a methodological reader, der umfagngreiche Ratschläge enthält, wie man die Evidenzgrundlage für Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemstärkung verbessern könnte.
Nicht minder überraschend ist die eher beiläufige Betrachtung der sozialen Determinanten von Gesundheit. Dabei hatte die WHO diesem Thema doch zwei Jahre zuvor eine globale Konferenz in Rio de Janeiro gewidmet, auf der es zur Verabschiedung der Rio Political Declaration on Social Determinants of Health kam. Und erst im Mai dieses Jahres hatte die 66. Weltgesundheitsversammlung den entsprechenden Sekretariats-Bericht Social determinants of health - Report by the Secretariat angenommen.
Der Weltgesundheitsbericht 2013 nimmt nur ansatzweise Bezug auf soziale Determinanten und deren immense Bedeutung für Forschung im Dienste einer universelle Absicherung im Krankheitsfall. Auf Seite 94 des WHO-Jahresberichts heißt es: "Many of the determinants of health and disease lie outside the health system so research needs to investigate the impact of policies for "health in all sectors". Research will add to the evidence on how human activities affect health, for example through agricultural practices and changes to the natural environment". Das ist zwar nicht falsch, aber trotz des Bezugs auf den großen Bereich der indirekten Gesundheitspolitik jenseits des Krankenversorgungswesens doch zu stark auf einzelne soziale Determinanten eingeengt, um den Eindruck einer ausgeprägten Krankheitsperspektive zerstreuen zu können.
Der Bericht bleibt bei der gesellschaftspolitischen Analyse weitgehend an der Oberfläche und lässt insgesamt deutlich erkennen, dass er ein Kompromisspapier zwischen sehr heterogenen staatlichen und nicht-staatlichen Interessensgruppen und darstellt. Gesellschafts- und verteilungspolitische Fragen räumt die WHO nicht die Rolle ein, die ihr gebührt, wenn das Ziel wirklich Universalität, d.h. die Absicherung aller Menschen mit allen notwendigen Leistungen und möglichst ohne direkte Beteiligung an den Behandlungskosten. Ohnehin stellt sich die Frage, ob selbst die solidesten und reliabelsten Daten und wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich ausreichen, bestehende Ungleichheiten zu reduzieren und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Evidenzbasierte Politik ist ein Wunschtraum aller Wissenschaftler, in der Praxis aber allenfalls rudimentär messbar. Gerade die Gesundheitspolitik ist zudem ein Feld, wo nicht nur unterschiedliche, sondern vielfach sogar widersprüchliche Evidenz aufeinander trifft.
Insgesamt lässt die WHO in ihrem Jahresbericht 2013 wieder einen eher technokratischen Ansatz erkennen, der hinter früheren Verlautbarungen und Veröffentlichungen zurückbleibt. Ihr Dilemma, letztlich nur gesundheitsbezogene Forschung fördern und betreiben zu können, bestärkt einen Forschungsansatz, der sich auf möglichst messbare, konkrete und auf Einzelphänomene fokussierte Fragestellungen konzentriert. In Zeiten unübersehbarer Dominanz von Marktinteressen und des wachsenden Einflusses transnationaler Konzerne auch in der WHO eine nicht unbedenkliche Entwicklung.
Auch wenn der WHO-Bericht 2013 die Themen Ungleichheit und Health-in-All hier und dort benennt und die Notwendigkeit erkennt, das gesundheitsfördernde Potenzial sektorübergreifender Politikansätze intensiver zu erforschen, betrachtet er diese und vergleichbare Aspekte als zusätzliche, komplementäre Herausforderung, die in Anbetracht der Vielzahl anderer offener Fragen keine besondere Priorität genießen können. Das ist nachvollziehbar - denn im Mittelpunkt des WHO-Forschungsansatzes im Dienste universeller Sicherung steht nicht der Mensch, sondern Erkrankungen und Erkrankungsrisiken. Der derzeitige internationale Boom um universal health coverage (UHC), also universelle Absicherung im Krankheitsfall einschließlich universellen Zugangs zu Versorgungsleistungen, könnte dasselbe Schicksal ereilen wie vor gut 30 Jahren die Primary Health Care (PHC) Bewegung, die mit der Erklärung von Alma Ata einen Aufbruch weg von der Medikalisierung und hin zu einem stärker gesellschaftlich bestimmten Gesundheitsverständnis einleitete. Unter der Führung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) stutzen wichtige entwicklungspolitische Akteure das ursprünglich umfassende PHC-Konzept auf eine selektive primäre Gesundheitsversorgung zurecht, wo die exogen bestimmte Bezahlbarkeit anstelle des realen Bedarfs zum Maß der Möglichkeiten wurde. Mit Ihrem Jahresbericht 2013 hat die WHO möglicherweise dazu beigetragen, dass der UHC-Bewegung dasselbe Schicksal widerfährt und zu einer selektiven "universellen" Absicherung degeneriert.
Auf der Website der Weltgesundheitsorganisation WHO steht der Weltgesundheitsbericht 2013 kostenfrei in voller Länge zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 10.11.13
Lebenserwartung und Anzahl der gesunden Lebensjahre nehmen von 1990 bis 2010 zu - mit Unterschieden und Anregungen zum Nachdenken
 500 ForscherInnen aus 300 Forschungseinrichtungen in 50 Ländern berichten u.a. über 291 Krankheiten in 21 weltweiten Regionen, in 20 Altersgruppen, bewerten 67 Risikofaktoren und vergleichen mit dafür geeigneten Indikatoren, Maßen und Instrumenten die Verhältnisse im Jahr 2010 mit denen des Jahres 1990. Alles zusammen genommen ist dies die "Global Burden Disease (GBD) Study" 2010.
500 ForscherInnen aus 300 Forschungseinrichtungen in 50 Ländern berichten u.a. über 291 Krankheiten in 21 weltweiten Regionen, in 20 Altersgruppen, bewerten 67 Risikofaktoren und vergleichen mit dafür geeigneten Indikatoren, Maßen und Instrumenten die Verhältnisse im Jahr 2010 mit denen des Jahres 1990. Alles zusammen genommen ist dies die "Global Burden Disease (GBD) Study" 2010.
Wer sich über die Geschichte der GBD noch etwas ausführlicher informieren will, kann dies in dem "Lancet"-Aufsatz "The story of GBD 2010: a "super-human" effort" (Volume 380, issue 9859: 2067-2070) kostenlos tun.
Ansonsten ist in der Ausgabe des renommierten Medizinjournals "The Lancet" vom 15. Dezember 2012 eine Vielzahl von Ergebnissen veröffentlicht worden. Dazu zählen folgende Aufsätze: "Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the Global Burden of Disease Study 2010", "Healthy life expectancy for 187 countries, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010", "Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010" und "A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010."
Die Ergebnisse zu der Anzahl von Lebensjahren in Gesundheit bei steigender Lebenserwartung ("healthy life expectancy (HALE)"), einer der Dreh- und Angelpunkte der Demografiedebatte, sollen hier etwas ausführlicher vorgestellt werden:
• Mit einer aufwändigen und einheitlichen Methodik (dies schließt unterschiedliche Datenqualität nicht aus)legen die Autoren für 187 Länder Daten zur Verlängerung der Lebenserwartung und zum Umfang der gesunden Lebensjahre in den Jahren 1990 und 2010 vor. Sie schätzen dabei den Einfluss der in den letzten 20 Jahren geänderten Kinder- und Erwachsenensterblichkeit und von Behinderung auf die Gesamtveränderung der Bevölkerungsgesundheit.
• Die Anzahl der bei der Geburt zu erwartenden gesunden Lebensjahre betrug für alle Männer weltweit 1990 54,4 Jahre und stieg 2010 auf 58,3 Jahre. Bei Frauen waren es 57,8 und 61,8 Jahre. Ein 60-jähriger Mann hatte noch 12,3 bzw. 13,4 gesunde Jahre vor sich. Bei Frauen waren es 14,1 und 15,2 Jahre.
• In Deutschland stieg nach den GBD-Daten die Lebenserwartung der Männer zwischen 1990 und 2010 bei Geburt von 71,9 auf 77,5 Jahre. Die Anzahl der gesunden Lebensjahre stieg von 62,3 auf 65,8 Jahre.
• Einem Jahr zusätzlicher Lebenszeit ab Geburt steht 2010 für Männer im Durchschnitt aller Länder ein Zuwachs gesunder Lebenszeit von 0,84 Jahren gegenüber (für Frauen 0,81 Jahre). Die Lücke zwischen der künftigen Lebenserwartung und den noch bevorstehenden gesunden Lebensjahren wird mit steigendem Lebensalter größer. Ein Jahr längeres Leben führt bei 50-jährigen Männern zu 0,62 gesunden Jahren (bei Frauen sind dies 0,56 Jahre). Obwohl also gewonnene Lebensjahre keineswegs komplett in Krankheit verbrachte Lebensjahre sind, Altern zum größten Teil in "Gesundheit altern" bedeutet, wird ein Teil der gewonnenen Lebensjahre in Krankheit und Behinderung verbracht bzw. führt zu einer Zunahme von Morbidität. Zu der Anzahl der in Krankheit oder Behinderung verbrachten Lebensjahre ("years lived with disability (YLD)") tragen insbesondere psychische und verhaltensbezogene Erkrankungen wie Depressionen, Angst oder die Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch bei.
• Für die Debatte darüber, ob es bei einer Verlängerung der Lebenserwartung eine Expansion oder eine Kompression von Morbidität gibt, bedeutet dies zweierlei: Es gibt sowohl Evidenz für eine leichte bis moderate Zunahme von Morbidität in Gestalt der krank oder behindert verbrachten Lebensjahre bei hinausgeschobener Mortalität als auch dafür, dass der Großteil der gewonnenen Lebensjahre in Gesundheit gelebt werden können, potenzielle altersassoziierte Morbidität also ins höhere Lebensalter verschoben wird. Die mit den Daten möglichen internationalen Vergleiche zeigen aber auch, dass es sich hierbei keineswegs um ein rein naturbedingtes, sondern um ein stark sozial bedingtes und damit im Prinzip auch um ein durch Prävention oder Sozialkapital beeinflussbares Geschehen handelt. Die Autoren der GBD-Studie fassen dies so zusammen: "Although we report clear evidence of expansion of morbidity, we also show substantial variation among countries in age-specific YLD per person. For people aged younger than 1 year, the highest levels exceed the lowest by 4,9 to 12,4. Even in people aged older than 50 years, for whom disability rates are higher, YLD per person vary by a factor of 1,6 to 2,2 among countries. Although we might expect that addition of marginal years of life through reduction of mortality will be associated with more years lost because of morbidity and disability, there is clearly scope for healthier ageing. To achieve real compression of the total disability in a population, healthy life expectancy would need to increase faster than life expectancy at birth. Although this goal is ambitious, enormous potential exists for making substantial progress. If all countries could achieve the disability rates similar to countries such as Japan, healthy life expectancy would increase substantially and would probably be accompanied by reductions in costs of managing disease and injury sequelae. The potential for healthier ageing, and for reduction of YLD, is supported by several studies of socioeconomic variations in healthy life expectancy in high-income countries."
• Die gerade angesprochenen Länderunterschiede sind enorm: Während 2010 japanische Männer 68,8 und japanische Frauen ab Geburt 71,7 gesunde Lebensjahre zu erwarten haben, und damit weltweit Platz 1 einnehmen, betragen die entsprechenden Werte in Haiti 27,9 und 37,1 Jahre, was den Schluss-Platz 187 bedeutet. Entsprechend haben 2010 Männer in Haiti aber auch nur eine durchschnittliche Lebenserwartung von 32,5 und Frauen von 37,1 Jahren, also Werte, die es in Europa seit Jahrhunderten nicht mehr gibt.
• Deutschland befindet sich im Übrigen weder 1990 noch 2010 unter den 10 Ländern mit der höchsten Anzahl gesunder Lebensjahre.
Der Aufsatz schließt mit einer Reihe (selbst-)kritischer Anmerkungen zur Güte und Messbarkeit der Indikatoren in unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Die Autoren erklären außerdem die Absicht regelmäßiger und häufiger Analysen zur weltweiten Lebenserwartung und zur Erwartung gesunder Lebensjahre vorzulegen. Außerdem beabsichtigen sie, zusätzliche Analysen über die Einflussfaktoren auf das Krankheitsgeschehen und die Veränderungen der gesunden Lebensjahre zu erstellen.
Eine Übersicht über den Inhalt dieses "Lancet"-Themenheftes mit Links zu den Abstracts der einzelnen Aufsätze steht kostenlos zur Verfügung.
Zu dem materialreichen Aufsatz "Healthy life expectancy for 187 countries, 1990—2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010" von Joshua A Salomon, Haidong Wang, Michael K Freeman, Theo Vos, Abraham D Flaxman, Alan D Lopez, Christopher JL Murray (The Lancet, Volume 380, Issue 9859, Pages 2144 - 2162) gibt es ohne zusätzlichen Aufwand leider nur ein Abstract kostenlos. Durch eine kostenlose und auch hinsichtlich unerwünschter Werbung folgenlose Anmeldung als User auf der Lancet-Website bekommt man aber für diesen und manch anderen Aufsatz im "Lancet" kostenlosen Zugang zum gesamten Text.
Bernard Braun, 18.12.12
ECHI, EUHI, HEIDI - Public Health-Daten für Europa-31 besser erhältlich als geunkt oder "gefühlt".
 Zu den Standardhinweisen nationaler aber vor allem auch international vergleichender gesundheitswissenschaftlichen oder -politischen Debatten gehört der Mangel an Daten. "Gefühlt" schneidet Deutschland dabei oft relativ schlecht ab. Schaut man dann genau hin, erweist sich dies oft als falsch oder als Ausdruck von unterentwickelter Freude an oder Fähigkeiten zur unkonventionellen Datenexplorationen.
Zu den Standardhinweisen nationaler aber vor allem auch international vergleichender gesundheitswissenschaftlichen oder -politischen Debatten gehört der Mangel an Daten. "Gefühlt" schneidet Deutschland dabei oft relativ schlecht ab. Schaut man dann genau hin, erweist sich dies oft als falsch oder als Ausdruck von unterentwickelter Freude an oder Fähigkeiten zur unkonventionellen Datenexplorationen.
Ein am 31. Januar 2012 veröffentlichter Überblick über die Verfügbarkeit der "European Community Health Indicators (ECHI)", eines zwischen 31 europäischen Ländern abgestimmten Satzes von zur Zeit 88 Indikatoren zum Zwecke des "public health monitoring", zeichnet zwar ein suboptimales Bild, aber kein mutlos stimmendes.
Im Jahr 2008, dem Jahr der Feldforschung der AutorInnen des Überblicks, waren zunächst 11 der 88 Indikatoren in keinem Land verfügbar. Nach dem Verzicht auf die nähere Untersuchung der mit Sicherheit überall verfügbaren soziodemografischen Basisindikatoren schrumpfte die Liste der untersuchten Indikatoren auf 68 Indikatoren. Diese Indikatoren deckten u.a. die Bereiche Sterblichkeit, Morbidität, Gesundheitsdeterminanten, Qualität der Krankheitsbehandlung und Gesundheitsförderung ab.
Die Verfügbarkeit sah im Einzelnen so aus:
• Indikatoren zu den Interventionen in der Gesundheitsvorsorge (z.B. Impfen), Sterblichkeit, Morbidität und Gesundheitsdeterminanten waren in über 80% der Länder verfügbar.
• Indikatoren zur Bezahlung und Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung und zu Verletzungen waren in gut zwei Dritteln der Länder verfügbar.
• In rund 50% der Länder gab es Daten zur Versorgungsqualität und
• in etwas mehr als einem Fünftel der Länder waren Indikatoren zur Gesundheitsförderung erhältlich.
• Im Europa-31-Raum waren im Durchschnitt 76% der Indikatoren erhältlich. Der Wert schwankte allerdings zwischen 56% in der Türkei und 84% in Dänemark und Finnland. Deutschland liegt mit über 80% erhältlicher Indikatoren noch in der Spitzengruppe.
• Kein Land war in der Lage sämtliche Indikatoren zu liefern.
Natürlich gibt es zahlreiche Initiativen, bessere und vergleichbarere Definitionen von Indikatoren zu finden, diese noch viel differenzierter abzufragen und aufzubereiten, neue interaktive Datenaufbereitungstechniken einzuführen sowie eine Online-Berichtserstellung anzubieten. Dafür stehen u.a. die Kürzel EUHI und HEIDI. Auch wenn diese Veränderungen sicherlich die Quantität und Qualität verfügbarer Daten erhöht und möglicherweise auch neue Nutzerkreise für den Zugriff auf die Daten motiviert, muss man dabei den Eindruck zu vermneiden suchen, alles sei noch so "in progress", dass eigentlich noch keine Daten wirklich verfüg- und nutzbar sind. Und: Enzyklopädischer Perfektionismus und kommunikationstechnologische Megaperformance allein haben noch selten die erwarteten Wirkungen erzielt.
Wer noch etwas mehr über ECHI et al. erfahren will oder muss, kann dies mittels der Projektpräsentation "From ECHI Database to HEIDI Data Tool State of Play von J. Thelen vom RKI vom 17. März 2011.
Mehr zu HEIDI (Health in Europe: Information and Data Interface), einem internetgestützten Wiki bzw. einer Art Suchmaschine für europaweite Gesundheitsinformationen, gibt es in dem aktuell erschienenen Aufsatz HEIDI health wiki. Sharing, comparing and developing health information across Europe von Tuuli-Maria Mattila und auf der offiziellen Projekt-Website.
Der Aufsatz "Health indicators in Europe: availability and data needs" von Katri Kilpelainen et al. ist am 31. Januar 2012 Online in der Zeitschrift "European Journal of Publiv Health" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Eine genauere Liste der ECHI-Indikatoren findet sich kostenlos auf der Website "Gesundheitsberichterstattung des Bundes".
Bernard Braun, 3.2.12
12 "Leading Health Indicators" für die Gesundheitsberichterstattung der USA bis 2020
 Seit 1979 gibt es in den USA die so genannte "Healthy People"-Initiative, die maßgeblich durch das "Department of Health and Human Services (HHS)", also das Bundesgesundheitsministerium der USA getragen wird. Im Kern dieser Initiative stehen eine Fülle von gesundheitsbezogenen Indikatoren, die jeweils für ein Jahrzehnt quantitative gesundheitspolitische Ziele vorgeben, deren Erreichen oder Nichterreichen am Ende des Jahrzehnts bilanziert wird. Die aktuelle Version des Programms, "Healthy People 2020", enthält fast 600 Indikatoren oder Sachbereiche, die von der Anzahl von Morden, über die Neuerkrankungen an Diabetes bis zu der Zahl von Rauchern reicht, die versuchen, das Rauchen aufzugeben. Die Einzelthemen lassen sich zu 42 Themenbereichen (z.B. Gesundheitsverhalten, Teilnahme an Screening oder Inanspruchnahme von "primary care") zusammenfassen. Insgesamt werden 1.200 einzelne Maßzahlen und Statistiken aufbereitet.
Seit 1979 gibt es in den USA die so genannte "Healthy People"-Initiative, die maßgeblich durch das "Department of Health and Human Services (HHS)", also das Bundesgesundheitsministerium der USA getragen wird. Im Kern dieser Initiative stehen eine Fülle von gesundheitsbezogenen Indikatoren, die jeweils für ein Jahrzehnt quantitative gesundheitspolitische Ziele vorgeben, deren Erreichen oder Nichterreichen am Ende des Jahrzehnts bilanziert wird. Die aktuelle Version des Programms, "Healthy People 2020", enthält fast 600 Indikatoren oder Sachbereiche, die von der Anzahl von Morden, über die Neuerkrankungen an Diabetes bis zu der Zahl von Rauchern reicht, die versuchen, das Rauchen aufzugeben. Die Einzelthemen lassen sich zu 42 Themenbereichen (z.B. Gesundheitsverhalten, Teilnahme an Screening oder Inanspruchnahme von "primary care") zusammenfassen. Insgesamt werden 1.200 einzelne Maßzahlen und Statistiken aufbereitet.
Darüber, ob die Festlegung auf das Erreichen spezifizierter und quantitifizierter Gesundheitsziele von Nutzen ist, und ob die Ziele erreicht wurden oder nicht, gibt es z.B. über das Erreichen der Zielgrößen des "Healthy People 2010" unterschiedliche Bewertungen. Während das HHS meint, 71% aller Ziele seiren erreicht worden, bemängeln Kritiker, dass dies auch daran liege, dass das Erreichen der Ziele oft nur ein minimaler oder marginaler Fortschritt bedeutete.
Um die Bedeutung der "Healthy People"-Initiative mehr zu popularisieren und übersichtlicher zu machen, hat das HHS jetzt einen Katalog von 12 gesundheitsrelevanten sozialen Sachverhalten mit insgesamt 26 Indikatoren, so genannte "Leading Health Indicators" vorgestellt, deren Entwicklung bis 2020 regelmäßig ermittelt und veröffentlicht werden soll. Zu den 12 Sachverhalten zählen der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, die Präventionsangebote, die Umweltqualität, das Thema Verletzungen und Gewalt, Mütter- und Kindergesundheit, psychische Gesundheit, Ernährung, körperliche Aktivität und Fettleibigkeit, reproduktive und sexuelle Gesundheit, Abusus mit legalen und illegalen Drogen und das Tabakrauchen. Eine Innovation stellt für die Gesundheitsberichterstattung der USA die Aufnahme der Zahngesundheit und der sozialen Determinanten dar.
Bevor man zu diskutieren beginnt, ob z.B. das Problemfeld der sozialen Determinanten von Gesundheit allein durch die Anzahl der Studenten angezeigt werden kann, die mindestens 4 Jahre studiert haben und dies mit einem Diplom abgeschliossen haben, sollte abgewartet werden, wie die angekündigten Zwischenberichte aussehen und was die übersichtlichere Zahl von Indikatoren politisch und gesellschaftlich bewegt.
Mehr über die Inhalte und Methodik der "Leading Health Indicators" ist auf der entsprechenden Website zu erfahren.
Bernard Braun, 1.11.11
24% aller Todesfälle bei den mit weniger als 75 Jahren Verstorbenen in 16 Ländern wären vermeidbar gewesen!
 Die gute Nachricht einer Untersuchung über Todesfälle bei den unter 75-Jährigen in 16 mehr oder weniger wohlhabenden Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens (Australien, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Großbritannien, die USA und Deutschland), die durch rechtzeitige und wirksame gesundheitliche Versorgung vermeidbar gewesen wären (Konzept der "amenable mortality"),lautet: Die Häufigkeit sank in 10 der 16 Länder zwischen 1997-1998 und 2006-2007 um 30% und mehr. Am stärksten sank die Rate der vermeidbaren Todesfälle mit rund 42% in Irland, am schwächsten mit 20,5% in den USA.
Die gute Nachricht einer Untersuchung über Todesfälle bei den unter 75-Jährigen in 16 mehr oder weniger wohlhabenden Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens (Australien, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Großbritannien, die USA und Deutschland), die durch rechtzeitige und wirksame gesundheitliche Versorgung vermeidbar gewesen wären (Konzept der "amenable mortality"),lautet: Die Häufigkeit sank in 10 der 16 Länder zwischen 1997-1998 und 2006-2007 um 30% und mehr. Am stärksten sank die Rate der vermeidbaren Todesfälle mit rund 42% in Irland, am schwächsten mit 20,5% in den USA.
Die für die Bevölkerung in einigen dieser Länder weniger guten Nachrichten lauten aber:
• 2006/2007 waren 24% der Todesfälle bei den unter 75-Jährigen in den 16 Ländern vermeidbar.
• Die Rate der vermeidbaren Todesfälle war mit 55 Todesfällen pro 100.000 Personen in Frankreich am niedrigsten und in den USA mit 95,5 Todesfällen/100.000 Personen am höchsten. Niedrig war diese Rate auch noch in Australien und Italien, hoch in Großbritannien und Dänemark.
• Deutschland lag wie in den meisten international vergleichenden Studien im Mittelfeld: 1997/98=106 und 2006/07=78 vermeidbare Todesfälle/100.000 Personen.
• Was die Ratenunterschiede wirklich bedeuten, machen die AutorInnen an einem Beispiel deutlich: Wenn die USA es geschafft hätten, das Niveau der drei besten Länder Frankreich, Australien und Italien zu erreichen, wären dort 2006/2007 84.300 weniger Personen unter 75 Jahren gestorben.
Die AutorInnen schauten sich für diese Untersuchung im Auftrag des Commonwealth Fund die Mortalitätsdaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die dokumentierten Todesursachen im Zusammenhang mit ausgewählten Infektionserkrankungen von Kindern, Krebs, Diabetes, Schlaganfall, Bluthochdruck, ischämischen Herzerkrankungen und Komplikationen bei üblichen Operationen an.
Von dem am 12. September online veröffentlichten Aufsatz "Variations in Amenable Mortality—Trends in 16 High-Income Nations" von E. Nolte und M. McKee in der Fachzeitschrift "Health Policy" gibt es keine kostenlose Version. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse gibt es aber kostenlos in der "In the Literature"-Reihe des Commonwealth Fund.
Bereits im August 2011 waren Ergebnisse einer Untersuchung über die Häufigkeit der durch Versorgungsangebote vermeidbaren Todesfälle in den USA veröffentlicht worden. Sie zeigten, dass es zusätzlich unabhängig vom Niveau innerhalb von Ländern erhebliche Unterschiede gibt. Auch vom Aufsatz Mortality Amenable to Health Care in the United States: The Roles of Demographics and Health Systems Perfor-mance von S. C. Schoenbaum, C. Schoen, J. L. Nicholson und J. C. Cantor, am 25. August 2011 online im "Journal of Public Health Policy" veröffentlicht, gibt es eine Zusammenfassung in der Reihe "In the Literature" des Commonwealth Fund.
Bernard Braun, 28.9.11
Kenia: Zwischen Armut, Hungerkatastrophe, Flüchtlingselend und Open data-Government 2.0
 Selbst nicht ohne interne Konflikte u.a. durch die spekulativ explodierenden Grundnahrungsmittelpreise und die vielfältigen Probleme einer armen Bevölkerung, beherbergt Kenia im Moment mit knapp 500.000 Hungerflüchtlingen vor allem aus Somalia das größte Hungerflüchtlingslager der Welt - alles in allem "eben typisch Afrika".
Selbst nicht ohne interne Konflikte u.a. durch die spekulativ explodierenden Grundnahrungsmittelpreise und die vielfältigen Probleme einer armen Bevölkerung, beherbergt Kenia im Moment mit knapp 500.000 Hungerflüchtlingen vor allem aus Somalia das größte Hungerflüchtlingslager der Welt - alles in allem "eben typisch Afrika".
Dass in Kenia mit dem "Kenyan Open Government Data Portal" oder "Kenya open data" auch ein vorbildliches, frei zugängliches Informationsportal mit einer Vielzahl von Volksbefragungs- und anderen, amtlichen oder halbamtlichen politischen, ökonomischen, sozialen und demografischen Daten existiert bzw. am Entstehen ist, ist leider weitgehend unbekannt. Das Niveau und die Performance der damit geschaffenen Transparenz oder des dadurch erhofften und möglichen "decision making" wird daher auch nicht inhaltlich oder gestalterisch als Vorbild für den Aufbau von "open data"-Infrastrukturen in Ländern wie Deutschland diskutiert.
Im Moment finden sich auf der Website mit unterschiedlichem regionalen und soziodemografischen Differenzierungsgrad über 160 Datensätze. Dazu gehören die Ergebnisse der kompletten 2009 durchgeführten Volksbefragung, Staatshaushaltsdaten, Übersichten zu den öffentlichen Ausgaben, Informationen über die Gesundheitsversorgung und über die schulischen Angebote, Armutsraten, Statistiken zur Wasserversorgung und den sanitären Verhältnissen, Entwicklungsindikatoren aber auch z.B. ein Vergleich der Anzahl der Kinder, die in einem Bett mit Mückennetz schlafen und dem Anteil der im selben Landkreis an Malaria erkrankten Personen. Bei der Aufbereitung der Daten gibt es für jedwede Gewohnheit sich Daten anzueignen ein oft interaktives Angebot: Dies reicht von Landkarten, über Faktenblätter für jeden Landkreis bis zu Tabellen und Grafiken.
Wer noch mehr analysieren will und eigene Darstellungsformen von Ergebnissen präferiert, kann dies auch mit herunterladbare Originaldatensätzen angehen. Der Hinweis, die vorliegenden Informationsangebote seien "just a taste of what's to come", läßt noch viel auf dem selbst erklärten Weg zur "Government 2.0 inKenya" erwarten.
Viel erwarten sich die Verantwortlichen der Website dazu von einer interessanten und nachahmenswerten Erweiterung des "open data"-Systems um "Public health"-Potenzial und soziale Netzwerkkommunikation. Für jeden der NutzerInnen besteht nämlich die Möglichkeit, gesuchte und nicht gefundene Informationen zur Aufnahme in das System vorzuschlagen. Der Wunsch wird öffentlich gemacht und kann weiter kommentiert werden. Der weitere Umgang mit den Vorschlägen wird differenziert dokumentiert. Es werden von den Statistikexperten zurückgewiesene, offene und anerkannte Vorschläge unterschieden. Beispielsweise schlägt am 8.Juli 2011 ein Nutzer des Informationssystems vor, Details der Landregistrierung und die registrierten Namen unter Berücksichtigung der Veränderungen im Laufe der Zeit zu veröffentlichen. Neben einem zustimmenden Kommentar eines Bürgers, wies ein bei der Weltbank in Kenia beschäftigter Experte am 14. August 2011 darauf hin, dass im Moment die gewünschten Unterlagen im zuständigen Ministerium digitalisiert würden und so schnell wie möglich öffentlich zugänglich sein werden.
Die Website "Kenya open data" ist kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 17.8.11
Finanzkrise 2008 ff. und Gesundheit: Anstieg der Arbeitslosigkeit erhöht die Anzahl der Selbsttötungen
 Eine internationale Forschergruppe fand 2009 für den Zeitraum von 1970 bis 2007 einen signifikanten Zusammenhang von wachsender Arbeitslosigkeit, Selbstmorden und Verkehrsunfällen in der Bevölkereung von 26 EU-Ländern heraus: Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 1% führte bei den meisten Altersgruppen von 0 bis 65 Jahren zu einem Anstieg der Selbstmorde um 0,79%. Betrug die Steigerungsrate 3% wuchs die Anzahl der Selbstmorde um 4,45%. Die Anzahl der Verkehrsunfalltoten nahm wegen der geringeren Mobilität - so die Erklärung der Forscher - ab. Einen weiteren engen Zusammenhang sah die Forschungsgruppe zwischen der Existenz und Intervention sozialer Sicherungssysteme und der Selbstmordhäufigkeit. So dämpfte etwa die Investition von 10 US-Dollar in aktive Arbeitsmarktpolitik den Effekt von Arbeitslosigkeit auf die Selbstmordhäufigkeit um 0,038%.
Eine internationale Forschergruppe fand 2009 für den Zeitraum von 1970 bis 2007 einen signifikanten Zusammenhang von wachsender Arbeitslosigkeit, Selbstmorden und Verkehrsunfällen in der Bevölkereung von 26 EU-Ländern heraus: Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 1% führte bei den meisten Altersgruppen von 0 bis 65 Jahren zu einem Anstieg der Selbstmorde um 0,79%. Betrug die Steigerungsrate 3% wuchs die Anzahl der Selbstmorde um 4,45%. Die Anzahl der Verkehrsunfalltoten nahm wegen der geringeren Mobilität - so die Erklärung der Forscher - ab. Einen weiteren engen Zusammenhang sah die Forschungsgruppe zwischen der Existenz und Intervention sozialer Sicherungssysteme und der Selbstmordhäufigkeit. So dämpfte etwa die Investition von 10 US-Dollar in aktive Arbeitsmarktpolitik den Effekt von Arbeitslosigkeit auf die Selbstmordhäufigkeit um 0,038%.
In dieser Analyse wagten die Wissenschaftler die Vorhersage, dass die internationale Finanzkrise des Jahres ähnliche messbare Effekte haben würde, und zwar sehr rasch und kurzfristig.
Eine erste, am 9. Juli 2011 im Medizin-Journal Lancet veröffentlichte Analyse der Entwicklungen der Selbstmordhäufigkeit in 6 alten (z.B. Österreich, Finnland, Großbritannien) und 4 neuen (z.B. Ungarn, Litauen) EU-Ländern von 2007 bis 2009, bestätigte jetzt die Vorhersage und lieferte ein paar zusätzliche Einblicke in die Dynamik der Zusammenhänge.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Der ständige Rückgang der Selbstmorde bis 2007 hörte 2008 schlagartig auf.
• In den neuen EU-Ländern stieg die Selbstmordrate weniger als 1% an, in den alten EU-Ländern dagegen um beinahe 7%. In beiden Ländergruppen setzte sich der Anstieg 2009 fort.
• In den Ländern, die bis zum heutigen Tag die Krisenschlagzeilen bestimmen, also Griechenland, Irland und das ebenfalls knapp dem Staatsbankrott entkommene Litauen, lag der Anstieg der Selbstmorde bei 17%, 13% und mehr als 17%.
• In 2009 betrug der Anstieg gegenüber 2007 in fast allen Ländern 5%. Einzige Ausnahme ist Österreich, wo es 2009 5% weniger Selbstmorde gab als 2007.
• Auch 2008 und 2009 sank die Todesrate durch Verkehrsunfälle.
• Sowohl in der 30-Jahresuntersuchung als in der Finanzkrisen-Analyse zeigte sich kein evidenter Einfluss der Arbeitslosigkeitstrends auf die Gesamtsterblichkeit.
• Der Versuch, die relativ positive Entwicklung in Österreich mit dem dortigen stabilen sozialen Netzwerk zu erklären, steht auf wackeligen Beinen. Finnland, ebenfalls ein Land mit einem hoch entwickelten und wirksamen sozialen Sicherheitssystem, nahmen Selbstmorde um rund 5% zu.
Auf die angekündigten weiteren Analysen der Wissenschaftlergruppe mit Daten aus weiteren Ländern und weiteren Detailuntersuchungen der Art des Zusammenhangs von sozialen Sicherheitssystemen, Arbeitslosigkeit und Sterblichkeit darf man gespannt sein.
Wünschenswert sind zusätzlich weitere aktuelle Analysen der möglichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auch auf die Morbidität.
Von der 2009 erschienen Studie "The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis" von David Stuckler, Sanjay Basu, Marc Suhrcke, Adam Coutts und Martin McKee, erschienen in "The Lancet" (Volume 374, Issue 9686, Pages 315 - 323) gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Komplett kostenlos erhält man dagegen die knappe "Correspondence" Effects of the 2008 recession on health: a first look at European data von Stuckler et al. in "The Lancet" (Volume 378, Issue 9786, Pages 124 - 125).
Bernard Braun, 17.7.11
Das Nebeneinander von Hungersterblichkeit und des Verderbens eines Drittels aller weltweit produzierten Nahrungsmittel
 Das, was vom üppigen Inhalt der Supermarkt-Nahrungsmittelregale in den meisten europäischen und nordamerikanischen Ländern jährlich in den Müll wandert (222 Millionen Tonnen) entspricht in etwa der kompletten Nettoproduktion an Nahrungsmitteln in der Sub-Sahararegion (230 Millionen Tonnen), in der wegen des Mangels an Nahrungsmitteln eine überdurchschnittliche Hungersterblichkeit von Müttern, Neugeborenen und Kindern existiert.
Das, was vom üppigen Inhalt der Supermarkt-Nahrungsmittelregale in den meisten europäischen und nordamerikanischen Ländern jährlich in den Müll wandert (222 Millionen Tonnen) entspricht in etwa der kompletten Nettoproduktion an Nahrungsmitteln in der Sub-Sahararegion (230 Millionen Tonnen), in der wegen des Mangels an Nahrungsmitteln eine überdurchschnittliche Hungersterblichkeit von Müttern, Neugeborenen und Kindern existiert.
Ein Drittel aller in der Welt produzierten Nahrungsmittel mit einem Gewicht von 1,3 Milliarden Tonnen geht vom Anbau, die Ernte über die Weiterverarbeitung und die Distribution bis zum häuslichen Kühlschrank verloren oder verdirbt unkonsumiert. Den 670 Millionen Tonnen verdorbener Nahrungsmittel in der so genannten entwickelten Welt stehen in den Entwicklungsländern absolut immerhin 630 Millionen Tonnen gegenüber.
Pro Kopf sind aber die Europäer und Nordamerikaner auch bei der Vernichtung von Nahrungsmitteln "Weltmeister": Bei ihnen verderben jährlich und pro Kopf 95 bis 115 Kilogramm, während es in der Sub-Sahararegion und Südostasien "nur" 6 bis 11 Kilogramm pro Kopf und Jahr sind. Während in Europa und Nordamerika der Schwerpunkt auf dem Verderben nach Ernte, Kauf und ordentlicher Lagerung liegt, verderben Nahrungsmittel in Entwicklungsländern aber häufig bereits vor der Ernte, auf dem Transport oder wegen der schlechten Lagerung beim Konsumenten.
Zusätzlich zu dem Problem des Nebeneinanders einer Überproduktion von verdorbenen Nahrungsmittel und der weltweit ungleich verteilten Hungersterblichkeit, weisen die AutorInnen des Berichts auf die sinnlose Zerstörung der enormen Ressourcen hin, die zur Nahrungsmittelproduktion eingesetzt werden und außerdem auf die "Sinnlosigkeit" der dadurch erzeugten Treibhausgase.
Dies alles sind Ergebnisse des gerade erschienenen Reports "Global Food Losses and Food Waste" der Welternährungsorganisation FAO der UN.
Angesichts der Nahrungsmittelverluste geben die VerfasserInnen zu bedenken, dass alle Anstrengungen das Verderben von Nahrungsmitteln zu verhindern sinnvoller sind und Vorrang gegenüber den Bemühungen haben sollten, noch mehr Nahrungsmittel zu produzieren.
Den 38-Seiten-Bericht "Global Food Losses and Food Waste. extent, causes and prevention" von Jenny Gustavsson, Christel Cederberg und Ulf Sonesson vom "Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK)" und Robert van Otterdijk sowie Alexandre Meybeck von der FAO gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 21.5.11
Gesundheitsversorgung und Krankenversicherungsschutz für Frauen in den USA - bedarfsfern, unsozial und unwirtschaftlich.
 Frauen haben größere und auch andere gesundheitliche Bedürfnisse als Männer und spielen bei der nicht institutionalisierten gesundheitlichen Versorgung von Familien mitgliedern eine bedeutendere Rolle als männliche Haushaltsmitglieder. Wenn man den wenigen Analysen folgt, die den Anteil der so genannten morbiden Episoden in Familien, die nie beim Arzt landen, auf ca. 70% schätzt, wird die Bedeutung der Frauen für die Gesundheit weiter Teile der Bevölkerung und ihre ökonomische Bedeutung klar.
Frauen haben größere und auch andere gesundheitliche Bedürfnisse als Männer und spielen bei der nicht institutionalisierten gesundheitlichen Versorgung von Familien mitgliedern eine bedeutendere Rolle als männliche Haushaltsmitglieder. Wenn man den wenigen Analysen folgt, die den Anteil der so genannten morbiden Episoden in Familien, die nie beim Arzt landen, auf ca. 70% schätzt, wird die Bedeutung der Frauen für die Gesundheit weiter Teile der Bevölkerung und ihre ökonomische Bedeutung klar.
Deshalb ist der selbst im ansonsten für jede Ungerechtigkeit guten us-amerikanischen Gesundheitssystem drastisch hohe Anteil von Frauen in den Reihen der Nichtkrankenversicherten ein gravierendes Beispiel für die bedarfsferne, sehr oft nicht an Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit interessierten Praxis privatwirtschaftlicher Krankenversicherungssysteme.
Die jetzt dazu veröffentlichten Ergebnisse des "2010 Biennial Health Insurance Survey" (2010 wurden dazu 4.005 Erwachsene im Alter von 19 und mehr Jahren) des "Commonwealth Fund" konkretisieren dies so:
• 27 Millionen Frauen zwischen 19 und 64 Jahren waren im gesamten Jahr 2010 oder in Teilen des Jahres nicht krankenversichert.
• Rund die Hälfte der gesamten Frauen in diesem Alter, ob versichert oder nicht, nahmen zahlreiche gesundheitliche Leistungen nicht in Anspruch ("bypassed medical care") weil sie sich deren Bezahlung nicht leisten konnten.
• Der Anteil der Frauen, die aus wirtschaftlichen Gründen Rezepte nicht einlösten oder Tests, Behandlungen und Folge-Arztbesuche absagten, stieg von 34% im Jahr 2001 auf 48% im Jahr 2010.
• Über 33% der Frauen mussten 2010 mehr als 10% ihres Einkommens für Behandlungskosten aufwenden. 2001 waren dies erst 25%.
• Nur 46% der Frauen hatten 2010 die empfohlenen präventiven Leistungen in Anspruch genommen. Von den nicht krankenversicherten Frauen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren ließen beispielsweise nur 31% in den letzten beiden Jahren eine Mammographie durchführen. Dieser Anteil betrug bei den Frauen mit Krankenversicherung 79%.
Die VerfasserInnen merken zusammenfassend an, dass fast alle der 27 Millionen Frauen ohne Versicherungsschutz unter den Bedingungen des "Affordable Care Act", also der großen aber immer noch heftig um- und bekämpften Gesundheitsreform, Zugang zu den notwendigen Leistungen haben würden.
Den Zugang zu mehreren Darstellungsformen ("Issue brief" und Chartpack) der Commonwealth Fund-Studie Women at Risk: Why Increasing Numbers of Women Are Failing to Get the Health Care They Need and How the Affordable Care Act Will Help von R. Robertson und S. R. Collins erhält man kostenlos über eine Sammel-Website.
Wer sich noch etwas ausführlicher über den gesamten Stand der Gesundheitsversorgung von Frauen in den USA informieren will, kann dies mit den aktuell von der "Kaiser Family Foundation" veröffentlichten Ergebnissen des zuletzt im Jahr 2008 durchgeführten "Kaiser Women's Health Survey" tun.
Den 48-Seiten Report Women's Health Care Chartbook. Key Findings from the 2011Kaiser Women's Health Survey von Usha Ranji und M.S.Alina Salganico stehen kostenlos zur Verfügung.
Bernard Braun, 18.5.11
100 Jahre Internationaler Frauentag: Für viele Mädchen und Frauen in unterentwickelten Ländern (noch) kein Grund zu feiern.
 Pünktlich zum einhundersten Jahrestag des Internationalen Frauentag legte das US-amerikanische "Population Reference Bureau" eine Datenübersicht zur Lage der Mädchen und Frauen in aller Welt vor. Das "data sheet" umfasst Daten und Fakten zur Demografie, reproduktiven Gesundheit, Ausbildung sowie Arbeit und der Position im öffentlichen Leben. Hinzu kommen Informationen über die Gleichstellung von Männern und Frauen, die Einschränkung der Entwicklungschancen von Frauen durch frühe Verheiratung etc. oder auch die Gewalt gegen Frauen.
Pünktlich zum einhundersten Jahrestag des Internationalen Frauentag legte das US-amerikanische "Population Reference Bureau" eine Datenübersicht zur Lage der Mädchen und Frauen in aller Welt vor. Das "data sheet" umfasst Daten und Fakten zur Demografie, reproduktiven Gesundheit, Ausbildung sowie Arbeit und der Position im öffentlichen Leben. Hinzu kommen Informationen über die Gleichstellung von Männern und Frauen, die Einschränkung der Entwicklungschancen von Frauen durch frühe Verheiratung etc. oder auch die Gewalt gegen Frauen.
Zur gesundheitlichen Lage im engeren Sinne und meist für die letzten Jahre belegt die Sammlung u.a. folgende Zustände:
• Durch eine frühe und oft erzwungene Heirat und die meist damit einhergehenden Schwangerschaften entstehen für Mädchen große gesundheitliche Risiken. Die Müttersterblichkeit ist höher als bei Frauen, die ihre Kinder im Erwachsenenalter bekommen, und Komplikationen bei der Geburt sind bei Frauen unter 18 Jahren deutlich häufiger.
• Ob sich Frauen selber um ihre gesundheitliche Versorgung kümmern dürfen, ist weltweit sehr unterschiedlich: In Ländern wie Malawi und Senegal machen dies zu rund 70 % die Männer, was meistens zum Nachteil der Frauen ausgeht. In Kolumbien machen dies nur 9 % der Männer.
• Zudem verlassen Frauen, die jung heiraten, die Schule in der Regel früher und haben damit meist weniger Möglichkeiten, ein unabhängiges Einkommen zu erwerben. In Mali, Niger und Tschad etwa heiraten 70 Prozent der Mädchen, bevor sie 18 Jahre alt sind - diese Länder rangieren alle am untersten Ende des UN-Entwicklungsindex.
• Wäöhrend 2008 in Ägypten 58 % der Frauen aus der untersten sozialen Schicht Geburtshilfe durch eine qualifizierte Person erhalten, sind dies in Bangladesh nur 9 %. Dort erhalten selbst nur 57 % der Gebärenden aus der obersten sozialen Schicht eine derartige Hilfe. Im Weltdurchschnitt sind es 67 %.
• Die gesundheitliche Integrität wird häufig auch immer noch durch die körperliche Gewalt gegen Frauen gefährdet. Dies ist in vielen Ländern noch an der Tagesordnung und makabrerweise halten dies die Frauen sogar häufig und zum Teil häufiger für legitim als Männer. In Indien stimmten 30 Prozent der Frauen und 26 Prozent der Männer der Aussage zu, es sei in Ordnung, eine Frau zu schlagen, wenn sie ihrem Mann widerspricht. In Uganda halten es 31 Prozent der Frauen und 19 Prozent der Männer für legitim, eine Frau zu schlagen, wenn sie sich weigert, mit ihrem Mann zu schlafen. Hier sieht man, welch mächtigen Einfluss kulturelle Einstellungen und Prägungen haben können, deren Folgen bei weitem nicht allein durch Appelle an Männer verhindert werden können.
• Immer noch werden in vielen Ländern oder Kulturen Söhne gegenüber Töchtern bevorzugt. So gibt es in Ländern wie China oder Indien geschlechtsspezifische Abtreibungen und in der Folge ein quantitativ unnatürliches Verhältnis von Männern und Frauen. Sofern aber geboren, bekommen häufig Jungen mehr zu essen als Mädchen oder werden häufiger oder früher geimpft - mit Folgen für ihre Gesundheit und Lebenserwartung.
Die kommentarlose überwiegend tabellarische Datensammlung "World's Women and Gilrs 2011 Data Sheet" ist 2011 erschienen, umfasst 15 Seiten und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.3.11
Alte und neue gesundheitliche Ungleichheiten in den USA und kein Ende!
 BürgerInnen der USA haben seit langem bekannte ungleiche gesundheitliche Risiken und Versorgungschancen, ohne dass sich daran etwas ändert. Das ist das Resumee eines 116 Seiten umfassenden "Morbidity and Mortality Report" der staatlichen "Centers of Disease Control and Prevention (CDC)" vom 14. Januar 2011.
BürgerInnen der USA haben seit langem bekannte ungleiche gesundheitliche Risiken und Versorgungschancen, ohne dass sich daran etwas ändert. Das ist das Resumee eines 116 Seiten umfassenden "Morbidity and Mortality Report" der staatlichen "Centers of Disease Control and Prevention (CDC)" vom 14. Januar 2011.
Diese Kernbotschaft wird akribisch u.a. durch folgende Sachverhalte belegt:
• Babies von afroamerikanischen Frauen haben ein anderthalbfach bis dreifach höheres Risiko im Kleinkindaslter zu staerben als Kinder aus allen anderen rassischen oder ethinschen Gruppen.
• Arme BürgerInnen sind im Vergleich mit anderen sozialen Gruppen erheblich häufiger und ernster erkrankt.
• Angehörige der ethnischen Gruppen der amerikanischen Indianer und der Ureinwohner Alaskas sterben doppelt so häufig durch Autounfälle als alle anderen US-Amerikaner.
• Waren die bisherigen Ungleichheiten längst bekannt, galt dies beispielsweise nicht für das dramatisch höhere HIV/AIDS-Risiko der Adroamerikaner in den USA: 2008 belief sich deren Prävalenz auf 73,7 Fälle pro 100.000 Einwohner, die der weißen Bevölkerung auf 8,2 Fälle/100.000 Einwohner. Die Prävalent nahm unter den schwarzen Amerikanern im Gegensatz zu den weißen seit 2005 auch Weiter zu.
• Immerhin gibt es auch Gesundheitsrisiken oder gesundheitsriskantes Verhalten, das bei weißen, wohlhabenden und gut gebildeten US-BürgerInnen überdurchschnittlich zu finden ist: Das "Hinunterstürzen" oder "binge drinking" von 5 oder 4 alkoholischen Drinks. Aber auch das machen sozial besser gestellte US-BürgerInnen seltener und hinter der 5/4-Drink-Marke weniger intensiv als ihre sozial schlechter gestellten Mittrinker.
• Männer begehen viermal so häufig Selbstmord wie Frauen 18,4 Fälle/100.000 Männer, 4,8 Fälle/100.000 Frauen).
• Die Rate der durch illegale und legale Drogen verursachten Todesfälle stieg außer bei den Hispano-Amerikanern zwischen 2003 und 2007 weiter an. Die höchste Rate von 15,6 Toten pro 100.000 Einwohnern hatten dabei die nicht-hispanischen Weißen. Bemerkenswert ist dabei, dass verordnete Arzneimittel 2007 den Spitzenplatz der Todesursache von den illegalen Drogen übernommen hat.
• Auf aktuelle Daten zu rassischen, sozialen oder anderweitigen Ungleichheiten bei Morden bzw. Mördern mussten die CDC verzichten.
Der "CDC Health Disparities and Inequalities Report — United States, 2011" steht als MMWR-Supplement (Volume 60) kostenlos zur Verfügung. Auf der Website können auch je nach Interesse einzelne Kapitel heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 23.1.11
USA-Gesundheit aktuell im Spiegel des "National Health Interview Survey 2009"
 Wer sich für die gesundheitliche Lage und die sozialen Umstände des Krankenversicherungsschutzes in den USA interessiert, kommt um die Ergebnisse des "National Health Interview Survey (NHIS)" nicht herum - und kann in Deutschland nur von etwas Vergleichbarem träumen!
Wer sich für die gesundheitliche Lage und die sozialen Umstände des Krankenversicherungsschutzes in den USA interessiert, kommt um die Ergebnisse des "National Health Interview Survey (NHIS)" nicht herum - und kann in Deutschland nur von etwas Vergleichbarem träumen!
Dieser haushaltsbezogene Survey wird jährlich vom U.S. Census Bureau for the Centers for Disease Control and Prevention und vom National Center for Health Statistics durchgeführt.
Für den aktuellen und gerade veröffentlichten Survey für das Jahr 2009 wurden mit 88.446 Personen in 33.856 Haushalten umfangreiche Interviews durchgeführt. Die Antwortrate der Haushalte betrug 82,2 %.
In der Fülle der mit dem NHIS gewonnen Ergebnissen finden sich etwa folgende wichtigen Informationen:
• Die selbstwahrgenommene gesundheitliche Lage, ein immer mehr anerkannter valider und reliabler Indikator, hängt bei den Erwachsenen über 25 Jahre hochsignifikant vom Bildungsabschluss ab: Von den Personen mit einem Bachelor- oder höheren Abschluss gaben mehr als doppelt so viele (74,1 %) an, ihr Gesundheitszustand sehr exzellent oder sehr gut wie die Befragten mit einem Bildungsabschluss unterhalb des High school-Abschlusses (38,3 %). Genau umgekehrt sah es bei denjenigen aus, deren Gesundheitszustand aus eigener Sicht schlecht war.
• 2 % der Befragten, das entspricht 4 Millionen Personen benötigten 2009 im täglichen Leben die Hilfe einer anderen Person.
• Über 7 % aller Kinder erhielten eine gesundheitlich bedingte spezielle Erzielung oder mussten frühinterventive Dienste in Anspruch nehmen.
• Schließlich gaben 18 % aller US-AmerikanerInnen unter 65 Jahren an, aus Kostengründen oder wegen eines Arbeitgeberwechsels ganzjährig oder zeitweise keinen Krankenversicherungsschutz gehabt zu haben.
• Über 30,4 Millionen US-BürgerInnen (10 % der Gesamtbevölkerung) verschleppten 2009 die Suche nach medizinischer Behandlung aus Kostengründen und 20,9 Millionen (7%) erhielten benötigte Behandlungen aus Kostengründen überhaupt nicht.
Alle Ergebnisse liegen differenziert nach Geschlecht, Alter, Rasse/Ethnie, Familieneinkommen, Armutsstatus, Zugang zum Krankenversicherungsschutz, Wohnort und Region vor.
Der 190 Seiten umfassende Report "Vital and Health Statistics Summary Health Statistics for the U. S. Population: National Health Interview Survey, 2009, Series 10: Data From the National Health Interview Survey No. 248" ist kostenlos erhältlich. Im Bericht gibt es eine ZUsammenfassung der wichtigsten ERgebnisse und außerdem interessante Ausführungen zur Methodik des HHIS. Weitere Daten werden mit Sicherheit in Kürze veröffentlicht werden oder sind bereits durch zahlreiche Links im Text zugänglich gemacht.
Bernard Braun, 8.1.11
"Wirtschaftliche Krise gleich sinkende Lebenserwartung - das ist so!" Kontraintuitives aus der Zeit der "Großen Depression"
 Wirtschaftliche Krise oder Depression gleich sinkende Einkommen, steigende Langzeit-Arbeitslosigkeit, Verlust an sozialer Perspektive und gesellschaftlicher Inklusion, anwachsende Morbidität und schließlich eine spürbare Verringerung der Lebenserwartung durch Selbstmord oder sonstige Mortalität so oder so ähnlich sehen Prognosen zu den Folgen heftiger ökonomischer Krisen aus.
Wirtschaftliche Krise oder Depression gleich sinkende Einkommen, steigende Langzeit-Arbeitslosigkeit, Verlust an sozialer Perspektive und gesellschaftlicher Inklusion, anwachsende Morbidität und schließlich eine spürbare Verringerung der Lebenserwartung durch Selbstmord oder sonstige Mortalität so oder so ähnlich sehen Prognosen zu den Folgen heftiger ökonomischer Krisen aus.
Die Finanzkrise der Jahre 2008ff. und die ökonomischen Folgen des "historischen" Renditemaximierungsspiels der europäischen und anderen Banken, Anleger und Spekulanten auf dem Rücken der griechischen aber auch eines Teils der EU-Bevölkerung, könnten also in Kürze große Spuren bei der Morbidität und Mortalität der Bevölkerungen vieler EU-Staaten und Staaten Nordamerikas hinterlassen.
Dass dies stimmt und/oder zwangsläufig so eintritt, lässt sich aber nach einer von zwei us-amerikanischen Sozialökonomen und -epidemiologen im September 2009 online veröffentlichen fundierten Studie über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 1920 und 1940 und dabei besonders der so genannten "Great Depression" in den 1930er Jahren auf die Lebenserwartung der damaligen US-Bevölkerung, bezweifeln.
Zu den wesentlichen Ergebnisse einer für den Zeitraum vom Anfang der 1920er bis zum Ende der 1930er Jahre durchgeführten Zusammenhangsanalyse gehört nämlich:
• "Life expectancy generally increased throughout the period of study. However, it oscillated substantially throughout the 1920s and 1930s with important drops in 1923, 1926, 1928-1929, and 1936 coinciding with strong economic expansions. During the Great Depression, it rose from 57.1 in 1929 to 63.3 years in 1933. The rates of infant mortality and age-specific mortality for all age groups under 20 years generally declined during the 1920s and 1930s. Superimposed on this general declining trend, peaks in both infant mortality and mortality for children aged 1-4, 5-9, 10-14, and 15-19 were observed in the years 1923, 1926, 1928-1929, and 1934-1936. These peaks all coincide with periods of strong economic growth."
• Entgegen allen Erwartungen verschlechterte sich also vor allem die gesundheitliche Situation und das Sterberisiko immer dann, wenn es zu Wirtschaftswachstum kam und verbesserte sich umgekehrt in den Jahren wirtschaftlicher und sozialer Depression.
• Dies gilt mit Ausnahme der Sterblichkeit durch Selbstmord, die während der Zeit der "Großen Depression" zunahm, aber insgesamt "nur" 2 % der Gesamtsterblichkeit umfasst.
• Und noch mal ausdrücklich bezogen auf die Phase der "Großen Depression" zwischen 1930 und 1934: "Population health did not decline and indeed generally improved during the 4 years of the Great Depression, 1930-1933, with mortality decreasing for almost all ages, and life expectancy increasing by several years in males, females, whites, and nonwhites."
• Schließlich:: "Population health did not decline and indeed generally improved during the 4 years of the Great Depression, 1930-1933, with mortality decreasing for almost all ages, and life expectancy increasing by several years in males, females, whites, and nonwhites."
Obwohl also große Rezessionen, und die Krise der Jahre 1930-34 gehört zu den größten, "periods of pessimism, shrinking revenues, and social malaise" sind, erklären sich die Forscher die unerwartete Nichtwirkung all dieser Bedingungen mit anderen sozialen Mechanismen, die mögliche negative Wirkungen von Krisen auf die Gesundheit und die Lebenserwartung (über-)kompensieren und sich umgekehrt in Zeiten wirtschaftlicher Erholung negativ auf die Gesundheit und Lebenserwartung auswirken (z.B. zunehmende Luftverschmutzung, mehr Verkehrsunfälle). Welche Faktoren aber im Einzelnen zu den unerwarteten Wirkungen führen, bleibt ungeklärt.
Eine durchaus naheliegende Erklärung, wirtschaftliche Krisen- und Wachstumsbedingungen wirkten sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf Gesundheitsbedingungen aus, halten die Wissenschaftler für den von ihnen untersuchten Zeitraum nicht für stichhaltig oder nur marginal bedeutsam. So sinkt zwar z.B. im ersten Boomjahr 1936, d.h. vier Jahre nach dem Beginn der "Großen Depression" die Lebenserwartung drastisch, um sich aber 1937 gleich wieder kräftig zu verbessern.
Geht man weiter davon aus, dass wirtschaftliche Krisen einen negativen Einfluss auf die soziale Lebenslage großer Teile der Bevölkerungen und damit auf deren Gesundheit und Lebenserwartung haben, hat die genauere Erforschung der fördernden und hemmenden Bedingungen eine enorme wirtschafts- und sozialpolitische Bedeutung.
Dazu braucht man sich noch nicht einmal mit der Empirie der 1930er Jahre in den USA oder in Deutschland auseinandersetzen (die Qualität mancher damaliger Statistik z.B. über die Arbeitslosigkeit ist schlecht), sondern findet mit der Finanzkrise der letzten drei Jahre und ihren Folgen genügend aktuelle Empirie.
Die 6 Seiten der Studie "Life and death during the Great Depression" von Jose´ A. Tapia Granados und Ana V. Diez Roux sind als Beitrag in den renommierten "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)" online veröffentlicht worden (Published online before print September 28, 2009, doi: 10.1073/pnas.0904491106) und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.5.10
Alle Jahre wieder: Ein, zwei, drei und viele Gleichheits-"Lücken" zum Weltfrauentag
 Egal ob man die Initiative des mittlerweile fast weltweit bekannten internationalen Frauen- oder Weltfrauentags auf Klara Zetkin, Alexandra Kollontaj, Wladimir Lenin oder wegen der drohenden sozialistischen Schlagseite lieber auf die Vereinten Nationen zurückführt, und egal ob er seit 1911, 1917 oder Ende der 1960er Jahre gefeiert wird: Das Thema unterschiedlicher Löhne für Frauen und Männer spielt nahezu immer und in jedem Land eine der Hauptrollen und sie anzugleichen war und ist ein handfestes Dauerziel.
Egal ob man die Initiative des mittlerweile fast weltweit bekannten internationalen Frauen- oder Weltfrauentags auf Klara Zetkin, Alexandra Kollontaj, Wladimir Lenin oder wegen der drohenden sozialistischen Schlagseite lieber auf die Vereinten Nationen zurückführt, und egal ob er seit 1911, 1917 oder Ende der 1960er Jahre gefeiert wird: Das Thema unterschiedlicher Löhne für Frauen und Männer spielt nahezu immer und in jedem Land eine der Hauptrollen und sie anzugleichen war und ist ein handfestes Dauerziel.
Amtlich festgestellt hört sich dies für die Bundesrepublik Deutschland in der Pressemitteilung Nr.079 des Statistischen Bundesamtes vom 05.03.2010 so an: "Gender Pay Gap 2008: Deutschland weiterhin eines der Schlusslichter in der EU".
Der Gender Pay Gap wird auf Basis der nationalen Verdienststrukturerhebungen ermittelt. Da es sich bei dieser Datengrundlage um eine in vierjährigen Abständen durchgeführte Erhebung handelt, die zuletzt für das Jahr 2006 stattfand, werden die Ergebnisse für die Jahre zwischen den Erhebungen jeweils mit nationalen Quellen fortgeschätzt. Für Deutschland wird hierzu die Vierteljährliche Verdiensterhebung genutzt.
Nach Feststellung der amtlichen Statistiker lag der so genannte "Gender Pay Gap, das heißt der prozentuale Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen, … in Deutschland mit 23,2% auch im Jahr 2008 deutlich über dem Durchschnitt der Europäischen Union (18,0%)."
Nach einer anderen Mitteilung des Statistischen Bundesamtes aus dem November 2009 bedeutet dies für die deutschen Frauen in Euro: Sie verdienten im Jahr 2008 mit durchschnittlich 14,51 Euro pro Stunde 4,39 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen.
Diese Unterschiede stellen einerseits ein gravierendes Gerechtigkeitsproblem dar, tragen aber zusammen mit vielen anderen bekannten Faktoren (z.B. berichtet das Statistische Bundesamt aktuell über den seit 1949 erstmaligen Rückgang der Bruttoverdienste in Deutschland um 0,4% im Jahr 2009) zu der tendenziell zunehmenden Einnahmeschwäche der immer noch weitgehend über einkommensbezogene Beiträge finanzierten deutschen Sozialversicherungsträger und ist daher z. B. auch ein gesundheitspolitisches Problem.
Zurück zum internationalen Vergleich: Von den 27 Ländern der europäischen Union wiesen lediglich Estland (letzter Wert für 2007: 30,3%), die Tschechische Republik (26,2%), Österreich (25,5%) und die Niederlande (letzter Wert 2007: 23,6%) einen gegenüber Deutschland höheren geschlechtsspezifischen Verdienstabstand auf. Das Land mit den europaweit geringsten Unterschieden im Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen war im Jahr 2008 Italien (4,9%). Auch (oder selbst?) Slowenien (8,5%), Rumänien, Belgien (jeweils 9,0%), Malta und Portugal (jeweils 9,2%) verzeichneten einen eher moderaten Gender Pay Gap.
Das zusätzlich Brisante an dieser Meldung ist, dass sich verglichen mit den Vorjahren kaum Veränderungen feststellen lassen - jedenfalls nicht für die deutschen Frauen! Es gab sogar seit 2006 eine leichte Verschlechterung von 22,7 % auf den aktuellen Wert. Die deutlichen Verbesserungen für die erwerbstätigen Frauen in Zypern und der Slowakei, die im Jahr 2007 noch schlechter bezahlt wurden, zeigen, dass es bei weitem kein "ehernes gender-pay-gap-Gebot" gibt.
Auch nicht zum ersten Mal gießt das Statistische Bundesamt an dieser Stelle aber gewaltig Schweröl auf die möglicherweise aufkommenden Wogen. Denn, so der Stehtext: "Bei der Interpretation der Werte sollte berücksichtigt werden, dass es sich um den unbereinigten Gender Pay Gap handelt. Aussagen zum Unterschied in den Verdiensten von weiblichen und männlichen Beschäftigten mit gleichem Beruf, vergleichbarer Tätigkeit und äquivalentem Bildungsabschluss sind damit nicht möglich."
Wenn dies auch für die beim Statistischen Bundesamt generierten Daten sein mag, so gibt es seit Jahren aber in Gestalt des vom "World Economic Forum" in Davos herausgegebenen und von renommierten Experten verfassten "Global Gender Gap Report" eine Datenquelle, die nicht nur im internationalen Maßstab über die Verdienstlücken der Frauen berichtet, sondern auch eine Fülle weiterer "Gaps" dokumentiert. Die aktuellste Quelle ist der am 27.10.2009 veröffentlichte "Global Gender Gap Report 2009", der von Ricardo Hausmann (Harvard University), Laura D. Tyson (University of California, Berkeley) und Saadia Zahidi (World Economic Forum) verfasst wurde.
Und in diesem Report findet sich für den Verdienstabstand folgender Indikator: "The remuneration gap is captured through a hard data indicator (ratio of estimated female-to-male earned income) and a qualitative variable calculated through the World Economic Forum's Executive Opinion Survey (wage equality for similar work)."
Der Executive Opinion Survey ist die Hauptdatenquelle für den "Global Competitiveness Report" des Forums, der regelmäßig viele nicht anderweitig erfassten Daten durch eine weltweite Befragung von rund 15.000 Ökonomen sowie Experten aus öffentlichen Verwaltungen, internationalen Organisationen und Unternehmen zusammenzutragen versucht. Die Ergebnisse sind daher wie alle qualitativen Daten in mancherlei Hinsicht verzerrt. Angesichts der sozialen Zusammensetzung der Befragten dürften aber ungerechte soziale Verhältnisse eher unterschätzt als übertrieben werden. Und selbst wenn die einzelnen Länderwerte absolut fehlerhaft sein sollten, taugen die Zahlen zumindest noch gut für Vergleiche zwischen Ländern und in der Zeit - vorausgesetzt die Verzerrungen tauchen identisch für jedes Land und jedes Befragungsjahr auf.
Der "gender pay gap"- bzw. "female-to-male ratio"-Wert" für "wage equality for similar work" betrug 2008 nach dem Report für 2009 in Deutschland 0,58. Dieser Wert liegt auf einer Skala von 0,00 für völlige Ungleichheit bis 1,00 für völlige Gleichheit der Einkommen von Frauen und Männern. Damit liegt Deutschland im Vergleich der 134 Länder, die im Report berücksichtigt wurden, auf Platz 101 und damit unter dem Durchschnittswert von 0,66. Dass es besser, aber keineswegs wesentlich gleicher geht, zeigen z.B. die Indikatorwerte für Schweden (0,72) und den Niederlanden (0,63).
Die im "Gender Gap-Report" dokumentierten Unterschiede der Einkommen in Geldeinheiten bestätigen das Niveau und die Tendenz der vom Statistischen Bundesamt gemachten Angaben: Bei dem von den Report-Autoren gewählten Indikator "estimated earned income" mit in US-Dollar umgerechneten Kaufkraftparitäten (PPP) verdienten 2008 deutsche Frauen 24.138 US-$ und deutsche Männer 39.600 US-$. Das Verhältnis beider Einkommen betrug 0,61 zu Ungunsten der Frauen.
Zum Vergleich: Der Durchschnittswert für diesen Indikator betrug 0,52, was angesichts der Fülle von Entwicklungsländern im Report nicht verwundert. In den beiden vergleichbaren Ländern Schweden und Niederlande sah dies schon besser aus: 0,84 waren es in Schweden und immerhin 0,66 in Holland. Entsprechend landen die deutschen Frauen beim Einkommensunterschied zu Männern weltweit auf Platz 49, Schweden auf Platz 1 und Holland auf Platz 33.
Wie bereits angedeutet, gibt es aber weder weltweit noch in Deutschland nur eine erhebliche und für Frauen nachteilige Lücke zu den sozialen Verhältnissen der Männer.
Einige weitere Beispiele aus dem Report 2009 illustrieren dies prägnant:
• Beim "Gender Gap Index" der die bereits genannten und einige weitere wirtschaftlichen Indikatoren zur Arbeitsmarkt- und Berufslage, Angaben zum Bildungsstand, zu Gesundheit und Lebenserwartung sowie zur politischen Partizipation und Repräsentanz zusammenfasst, landet Deutschland 2009 trotz einiger verringerter "gaps" auf Platz 12. Dies war aber gegenüber den Vorjahren eine stetige und deutliche Verschlechterung: 2006 lag Deutschland bereits einmal auf Platz 5, fiel dann 2007 auf den siebten und 2008 auf den elften Platz.
• Fasst man die fünf Einzelindikatoren zur wirtschaftlichen Lage zusammen, landen die deutschen Frauen im internationalen Vergleich auf Rang 37. Bei den Errungenschaften im Bildung- und Qualifikationsbereich reichte es trotz einiger Spitzenwerte insgesamt nur für den 49ten Platz. Bei Gesundheit und Lebenserwartung rutschen die deutschen Frauen auf Platz 60, liegen aber beim "political empowerment" wieder auf Platz 13.
Der Report des "World Economic Forum" enthält eine Fülle weiterer, auch teilweise positiv wie negativ überraschender Detailinformationen zur Lage der Frauen in den 134 Ländern. Die wesentlichen Ergebnisse sind im Querschnitt und bei einigen Indikatoren auch im Längsschnitt seit 2006 für jedes der Länder auf einer einzigen Seite zusammengefasst.
Der 205 Seiten umfassende "The Global Gender Gap Report 2009" ist kostenlos zu erhalten. Dies gilt auch für die vorherigen Berichte ab 2006, die noch auf einer speziellen Website des Davoser Forums erhältlich sind.
Bernard Braun, 7.3.10
Geld für "Bildung statt Banken"!? Welche langfristigen Wachstums-, Produktivitäts- und Sozialeffekte haben 25 PISA-Punkte?
 Zu den Standardphrasen vieler sozial- oder gesundheitspolitischer Debatten gehört die Feststellung, dass "wir" uns künftig das derzeitige soziale und solidarische Niveau nicht mehr leisten könnten. Die demografische Entwicklung und der relative Schwund der Zahl erwerbstätiger BürgerInnen führe zu stagnierender oder gar rückläufiger Reichtumsproduktion und könne auch durch die heutigen Produktivitätszuwächse künftig nicht kompensiert werden. Es gäbe keine Anzeichen für eine zukünftig im Vergleich zu heute höhere Produktivität - eher im Gegenteil. Insofern sollten sich bereits heute möglichst viele Versicherte auf härtere Zeiten einstellen und vor die Wahl gestellt werden, ob sie viele der bisher selbstverständlich solidarisch finanzierten Leistungen aus eigener Tasche finanzieren oder eben auf sie verzichten.
Zu den Standardphrasen vieler sozial- oder gesundheitspolitischer Debatten gehört die Feststellung, dass "wir" uns künftig das derzeitige soziale und solidarische Niveau nicht mehr leisten könnten. Die demografische Entwicklung und der relative Schwund der Zahl erwerbstätiger BürgerInnen führe zu stagnierender oder gar rückläufiger Reichtumsproduktion und könne auch durch die heutigen Produktivitätszuwächse künftig nicht kompensiert werden. Es gäbe keine Anzeichen für eine zukünftig im Vergleich zu heute höhere Produktivität - eher im Gegenteil. Insofern sollten sich bereits heute möglichst viele Versicherte auf härtere Zeiten einstellen und vor die Wahl gestellt werden, ob sie viele der bisher selbstverständlich solidarisch finanzierten Leistungen aus eigener Tasche finanzieren oder eben auf sie verzichten.
An der pessimistischen Beurteilung der künftigen Produktivitätsentwicklung und damit sicherlich auch der Finanzierbarkeit von angemessenen Einkommen und daraus finanzierten Sozialleistungen kratzt jetzt eine am 25. Januar 2010 veröffentlichte Analyse mehrerer Bildungswissenschaftler und -ökonomen im Auftrag der OECD gewaltig.
Die OECD, die u.a. auch seit Jahren das "Programme for International Student Assessment (PISA)" mit seinen zahlreichen international und national vergleichenden Analysen zu Bildungsniveaus und -ressourcen durchführt, wollte von dem an der Universität Stanford arbeitenden Eric H. Hanushek, dem Münchner Bildungsökonom Ludger Wößmann und dem OECD-PISA-Koordinator Andreas Schleicher wissen, welche wirtschaftliche Wirkung Investitionen in eine bessere Bildung haben können. Das Maß für Bildung und damit auch bessere Bildung sind die PISA-Punkte, die für Fähigkeiten in natur- und kulturwissenschaftlichen Fächern oder Leistungsbereichen mit standardisierten Verfahren mittlerweile seit 2000 erhoben werden.
Auf der Basis von Algorithmen verschiedener us-amerikanischer Langzeitstudien, den Daten der verschiedenen PISA-Studien und eines 20 Jahre dauernden Reformprozess-Szenario kommen die Autoren in ihrem Report "The high cost of low educational performance" u.a. zu folgenden Ergebnissen bzw. Prognosen:
• Selbst ein relativ bescheidener Zuwachs von 25 PISA-Punkten (entspricht auf der PISA-Skala etwa dem Lernzuwachs eines halben Schuljahrs) führte weltweit zu einem zusätzlichen Wachstum von 115 Billionen US-Dollar im Leben der 2010 Geborenen. Dem Standardargument gegen solche Szenarios bzw. Anstrengungen, dies wäre "nicht zu schaffen", setzen die Autoren gleich ein besonders in Deutschland provokatives empirisches Datum entgegen: Das Land mit der schnellsten Verbesserung des Bildungssystems, Polen, erhöhte sein PISA-Punktelevel allein zwischen 2000 und 2006 um 29 Punkte. Eckpunkte der Reform war die Einführung einer sechsjährigen Primarschule der sich weitere drei gemeinsame Jahre für alle Schüler in der Sekundarschule anschlossen.
• 25 PISA-Punkte mehr brächten der nächsten Generation in Deutschland bzw. der zukünftigen Wirtschaft und Gesellschaft immerhin 8.000 Milliarden Euro ein.
• Wenn die deutschen Kinder auf das PISA-Spitzenniveau der finnischen Schüler gelangen würden, dann entspräche der Ertrag dem Fünffachen der gesamten derzeitigen Jahreswirtschaftsleitung (10.000 Milliarden Euro) oder einem zusätzlichen jährlichen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 Prozent.
Für die weitere Debatte, die ja in Deutschland auch nicht zum ersten Mal geführt und beendet wird, ist die Schätzung Schleichers wichtig, für die Verbesserung der PISA-Performance seien "Ausgabensteigerungen nur zu einem Viertel verantwortlich." Auch die Schulzeit allein ist nach Meinung der OECD-Forscher ein zu vernachlässigender Faktor für die Bildungswirkungen. Die prognostizierten Effekte kämen also mehrheitlich durch kostenneutrale Faktoren in der Struktur des Bildungsprozesses (z.B. Beseitigung des zu frühen Selektionssystems nach der vierten Grundschulklasse) und der Qualität des Unterrichts zustande. Dass diese Faktoren eine große Rolle spielen und mit ihrer Veränderung auch positive Ergebnisse erzielt werden können, zeigt das bereits genannte Beispiel Polens.
Die bisher finanziell und inhaltlich weitgehend vernachlässigte frühkindliche Bildung spielt in dem Gesamtkonzept der Forschergruppe ebenfalls eine wichtige Rolle. Egal, ob man das Denken in Renditen bei drei- bis fünf-Jährigen mag oder nicht und glücklich findet, ist unbestritten, dass dortige Investitionen mehr für das spätere Bildungsniveau und gegen soziale Benachteiligungen bringen als manche Investition in die Schüler der gymnasialen Oberstufe. Entscheidend ist aber auch hier die Qualität der Bildung, die nicht eine Art Super-Light-Version späterer Bildungs-Curricula sein darf.
Selbst wenn man den genannten absoluten Erträgen für einen mehrere Jahrzehnte umfassenden Zeitraum nicht traut und dafür eine ganze Menge methodischer Argumente geltend machen kann, stellt sich nach dieser Studie die Frage, warum - in den Worten des ZEIT-Autors Reinhard Kahl - "eine Gesellschaft ihr Geld nicht auf diese Bank mit der höchsten, von keiner Inflation oder Finanzkrise bedrohten Rendite" bringt, statt es (ausschließlich) zur Rettung fragwürdigster Bankgeschäfte zu verwenden? Stattdessen sind zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge, die jahrelang für andere Zwecke als unfinanzierbar galten, zum Stopfen von Spekulationslöchern verwendet worden oder könnten darin sogar spurlos verschwinden. Gleichzeitig wird in der Bundesrepublik Deutschland über jeden Zehntel Punkt einer international eher bescheidenen Erhöhung der Bildungsausgaben auf zig Konferenzen seit Monaten gerungen. Noch weniger bewegt sich aber bei den strukturellen und qualitativen Schwachstellen des deutschen Bildungssystems.
Leider stellt sich also die Situation eher so dar: "Stattdessen beginnen nun Politiker schon wieder die Menschen auf Zeiten des Sparens einzuschwören. Sie wollen auch an Lehrern und anderen "Bildungskosten" sparen. Sie sagen, man könne halt jedes Stück des kleiner gewordenen Kuchens nur einmal essen. Denkfehler! Bildung ist nicht Kuchen essen, sondern Kuchen backen! Und natürlich kommt es auf die Zutaten an." (Kahl)
Wie fakten- und reformresistent die Bildungslandschaft, die bildungspolitisch Verantwortlichen aber auch ein Teil der politischen Öffentlichkeit in Deutschland sind, zeigt die Tatsache, dass die OECD-Studie keineswegs allein oder gar erst heute und völlig überraschend auf gewichtige nachteilige Effekte des deutschen Bildungssystems für die wirtschaftliche und auch soziale Zukunft des Landes hinweist. Auch genaue monetäre Angaben gibt es für die möglichen Effekte gründlich reformierter Bildungsstrukturen und -inhalte nicht erst heute und aus dem OECD-Headquarter in Paris.
Zuletzt hat eine im Auftrag der Bertelsmann Stiftung vom Münchner ifo-Institut erstellte und im November 2009 veröffentlichte Studie allein über die Effekte der stillschweigend geduldeten Existenz einer Vielzahl von so genannten "Risikoschülern" folgende Ergebnisse erbracht:
• Zu den unzureichend gebildeten "Risikoschülern" zählen in Deutschland rund 20 Prozent aller 15-Jährigen. Gemäß den PISA-Studien können sie höchstens auf Grundschulniveau lesen und rechnen und haben deshalb beim Eintritt in die Berufstätigkeit und dann wohl auch auf Dauer erhebliche Probleme.
• Dies zieht volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von rund 2,8 Billionen Euro nach sich.
• Gelänge es durch entsprechende strukturelle und qualitative Reformen den Anteil der "Risikoschüler" wesentlich zu reduzieren könnte dies bis zum Jahr 2030 zu einem Ertrag von wiederum maximal 69 Milliarden Euro führen. Der Ertrag überstiege so die jährlichen öffentlichen Bildungsausgaben im Elementar- und allgemeinbildenden Schulbereich. Bis zum Jahr 2074 erreichte das zusätzliche Wachstum die Summe von rund 1,75 Billionen (1.746 Milliarden) Euro und damit in etwa das Niveau unserer heutigen Staatsverschuldung. Im Jahr 2090 schließlich - dem Endpunkt der Langzeitbetrachtung - summieren sich die Erträge auf 2,8 Billionen (2.808 Milliarden) Euro. Das ist mehr als unser heutiges Bruttoinlandsprodukt (BIP) und entspricht etwa dem 28-fachen der jüngsten Konjunkturpakete. Im Jahr 2090 wird das BIP durch die Bildungsreform um über 10 Prozent höher sein, als es ohne die Reform wäre.
Auch bei dieser Studie muss und kann man den absoluten Summen nicht völlig trauen und sollte daher auch nicht lang streiten. Aber selbst wenn man die möglichen dämpfenden Einflüsse berücksichtigt und die eine oder andere Milliarde an Ertrag verliert, sind hektisches Nichtstun oder die Fortdauer folgenloser Sightseeingtouren von Bildungspolitiker in andere Länder das definitiv schlechteste politische Verhalten.
Den 77-Seiten-Bericht "Wirksame Bildungsinvestitionen. Was unzureichende Bildung kostet. Eine Berechnung der Folgekosten durch entgangenes Wirtschaftswachstum" von Ludger Wößmann und Marc Piopiunik gibt es komplett und kostenlos.
Auf der Projektwebsite der Bertelsmann Stiftung gibt es eine Vielzahl von Links zu Zusammenfassungen des Berichts und zu grafischen Darstellungen der wichtigsten Ergebnisse.
Der 52-Seiten-OECD-Bericht "The High Cost of Low Educational Performance. THE LONG-RUN ECONOMIC IMPACT OF IMPROVING PISA OUTCOMES" ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Nachtrag für diejenigen, die noch eine etwas andere Bewegung in die Bachelor-/Masterdebatte bringen wollen: Würde in Deutschland für jeden Studenten jährlich genauso viel wie in der Schweiz ausgegeben, also etwas mehr als 12.000 Euro gegenüber rund 8.000 Euro, benötigt man jährlich etwa 8 Milliarden Euro mehr und könnte damit an Hochschulen z.B. 50.000 neue Dauerstellen schaffen. Orientierte man sich in Deutschland an den Niederlanden, halbierte sich der Effekt in etwa, da dort "nur" 10.000 Euro pro Student und Jahr aufgewandt werden. Auch hier kommt es natürlich letztlich darauf an, was die Inhaber der neuen Stellen inhaltlich machen. Das Rechenexempel verdanken wir einem Artikel von Jeanne Rubner am 30. Dezember 2009 in der "Süddeutschen Zeitung", der allerdings nicht online frei erhältlich ist.
Ob die Kultusminister der Länder dem Rat Rubners gefolgt sind, dies "in den Weihnachtsferien nach(zu)rechnen" weiß man nicht. Vielleicht leiden aber auch sie an der PISA-"Leseschwäche" und brauchen einfach mehrere Erinnerungen!?
Bernard Braun, 27.1.10
"Health: Key tables from OECD" - Zeitreihen und Ländervergleiche ausgewählter Gesundheitsdaten
 Wer sich nicht die jährlich erscheinenden "OECD-Health-Data" leisten kann, muss seit Mitte November 2009 nicht völlig auf die Zeitreihen wichtiger Gesundheits- und Gesundheitssystemindikatoren verzichten.
Wer sich nicht die jährlich erscheinenden "OECD-Health-Data" leisten kann, muss seit Mitte November 2009 nicht völlig auf die Zeitreihen wichtiger Gesundheits- und Gesundheitssystemindikatoren verzichten.
Seitdem beginnt nämlich die OECD auf ihrer Website "Health: Key tables from OECD" die Veröffentlichung ausgewählter Indikatoren für ihre Mitgliedsländer und für den Zeitraum von 2001 bis 2007 oder 2008.
Derzeit sind es 16 Indikatoren, die von den kompletten Gesundheitsausgaben und ihrem Anteil am Bruttoinlandsprodukt, dem Anteil öffentlich finanzierter (Steuer- und Beitragsfinanzierung) Gesundheitsausgaben an allen Gesundheitsausgaben über die die Anzahl praktizierender Ärzte, verschiedene Lebenserwartungsindikatoren, mehrere Mortalitätsindikatoren bis zu den Anteilen übergewichtiger und fettsüchtiger Personen in der Bevölkerung reicht.
Die Daten für jeden Indikator sind im Moment (die OECD spricht von einer "preliminary version") als Webseite, PDF- und Exceldatei erhältlich. Einige Links verweisen in andere Datenbestände der OECD, zu denen der Zugang aber oft nur als zahlender Nutzer möglich ist.
Angesichts der Datenfülle der OECD sind weitere Schlüssel-Tabellen und Zeitreihen zu erwarten. Hinweise auf die oftmals existierenden Schwierigkeiten des Vergleichs unterschiedlich erhobener nationaler Daten findet man aber bisher nur auf anderen Websites der OECD. Bei intensiver Nutzung ist deren Lektüre unbedingt zu empfehlen.
Der Zugang zu den "Health: Key tables from OECD" ist kostenlos.
Bernard Braun, 26.1.10
Gesundheits- und Versorgungsqualitätsindikator Säuglingssterblichkeit: Deutschland im EU-Mittelfeld.
 Die Säuglingssterblichkeit ist ein gern gewählter Indikator, einerseits die gesundheitliche Lage der Bevölkerung eines Landes zu beurteilen und andererseits aber auch um den Grad und die Qualität der medizinischen Versorgung bewerten zu können.
Die Säuglingssterblichkeit ist ein gern gewählter Indikator, einerseits die gesundheitliche Lage der Bevölkerung eines Landes zu beurteilen und andererseits aber auch um den Grad und die Qualität der medizinischen Versorgung bewerten zu können.
Für eine internationale Vergleichbarkeit und die Verlaufsbetrachtung der Säuglingssterblichkeit ist es aber wichtig, den Einfluss der kurz- bis langfristig unterschiedlich hohen Anzahl der pro Land erfolgten Geburten auszublenden
Dazu berechnet man eine Säuglingssterbeziffer, welche die Anzahl der Sterbefälle im ersten Lebensjahr auf die Zahl der Lebendgeborenen bezieht. Der Indikator bildet also die Anzahl der Sterbefälle je 1.000 Lebendgeborene ab.
Auf der Basis der für internationale Vergleiche geeigneten Daten von EUROSTAT, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaft, liegt in einem Beitrag in der Ausgabe 4/2009 von "Bevölkerungsforschung Aktuell", den Mitteilungen aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung eine Darstellung der Säuglingssterblichkeit in allen 27 EU-Ländern für das Jahr 2006 vor.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Insgesamt ging die Säuglingssterblichkeit im Durchschnitt aller EU-27 Staaten im Verlauf der letzten zehn Jahre um 30 % zurück.
• Nachwievor existieren aber deutliche Unterschiede zwischen den Ländern: In einer Spitzengruppe, der Luxemburg, Finnland und Schweden angehören, sterben zwischen 2,5 und 3 Säuglinge, in Bulgarien und Rumänien dagegen zwischen 9 und 14 Säuglingen. Deutschland befindet sich in einer Gruppe mit Malta, Österreich, Griechenland, Irland, Dänemark, Frankreich, Spanien und Belgien mit 3,6 bis 4 gestorbenen Säuglingen je 1.000 Lebendgeborenen. Bei Deutschland ist hervorzuheben, dass die Sterblichkeit noch in den 1960er Jahren schlechter war als in vergleichbaren Ländern.
• Ein hoher Risikofaktor für Neugeborene ist das Geburtsgewicht. Säuglinge mit einem Geburtsgewicht von unter 2.500 Gramm unterliegen einer höheren Sterblichkeit als Kinder mit einem Gewicht von mehr als 2.500 Gramm bei der Geburt.
• Auch die medizinische Betreuung wirkt sich deutlich auf die Höhe der Säuglingssterblichkeit aus. Bei der Anzahl von Personal wie Hebammen und Schwestern beziehungsweise Pfleger, die zur Betreuung von Schwangeren zur Verfügung stehen, gibt es deutliche regionale Unterschiede. Die größte Dichte an Pflegekräften und Hebammen weisen die Länder in Nord- und Westeuropa auf. Hier gibt es mehr als 100 Pflegekräfte und Hebammen je 10.000 Einwohner, in Irland sind es mit 195 die meisten, gefolgt von den Niederlanden mit 146. Deutschland liegt zusammen mit einigen anderen Ländern wie Frankreich, Italien, Finnland aber auch der Tschechischen Republik und Ungarn mit rund 80 Pflegekräften und Hebammen je 10.000 Einwohner im mittleren Versorgungsbereich. In Osteuropa beträgt die Zahl unter 70, in Bulgarien, Rumänien und Griechenland liegt sie sogar unter 50.
Der Beitrag "Vergleich der Säuglingssterblichkeit in den Ländern der Europäischen Union" von Karla Gärtner bzw. die gesamte Ausgabe des Infodienstes "Bevölkerungsforschung Aktuell" sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.11.09
Blick über den Bodensee: Vor- oder Schreckensbild? Daten über das Schweizer Gesundheitssystem.
 Neben den Niederlanden gehört die Schweiz zu den Ländern, deren Gesundheitssystem von vielen Angehörigen aller Reformlager in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten als Vorbild oder zumindest als "Reformsteinbruch" empfohlen wird. Der Empfehlung sich "doch mal in der Schweiz umzuschauen" steht bei Verbreitern wie Empfängern meist relativ wenig tatsächliches Wissen über die wichtigsten Aspekte und Kenngrößen in unserem Nachbarland gegenüber. Die generelle Empfehlung für Anfänger in der vergleichenden Gesundheitsystemanalyse, sich vor dem "learn from" um das "learn about" zu bemühen, kann auch für den einfachen Blick über den Bodensee nur nachdrücklich unterstrichen werden.
Neben den Niederlanden gehört die Schweiz zu den Ländern, deren Gesundheitssystem von vielen Angehörigen aller Reformlager in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten als Vorbild oder zumindest als "Reformsteinbruch" empfohlen wird. Der Empfehlung sich "doch mal in der Schweiz umzuschauen" steht bei Verbreitern wie Empfängern meist relativ wenig tatsächliches Wissen über die wichtigsten Aspekte und Kenngrößen in unserem Nachbarland gegenüber. Die generelle Empfehlung für Anfänger in der vergleichenden Gesundheitsystemanalyse, sich vor dem "learn from" um das "learn about" zu bemühen, kann auch für den einfachen Blick über den Bodensee nur nachdrücklich unterstrichen werden.
Wer dies mit Schweizer Datenquellen versuchen will, sei auf zwei aktuelle Portale hingewiesen:
Zum ersten handelt es sich um das "Schweizerische Gesundheitsobservatorium", dessen aktuelle Indikatorenliste die Bereiche
• Demographie und sozioökonomische Merkmale (z.B. die Höhe der Prämien für die obligatorische Krankenversicherung, die von 1997 bis 2007 durchschnittlich um 5,3% pro Jahr steigen),
• Gesundheitszustand (z.B. die selbst wahrgenommene Gesundheit, mit der international interessanten Erkenntnis, "dass die Schweizer Wohnbevölkerung ihre Gesundheit wesentlich besser einschätzt als andere europäische Bevölkerungen" und alters- und sozialspezifisch differenzierten Auswertungen),
• Determinanten der Gesundheit (z.B. Übersicht zu körperlichen Aktivitäten im Alltag und in der Freizeit),
• Umweltverhältnisse (z.B. Belastungen durch Lärm der Nachbarn),
• Ressourcen des Gesundheitswesens und deren Nutzung (z.B. Bettendichte in allgemeinen Krankenhäusern und Spezialkliniken, ohne Kliniken für Psychiatrie, Rehabilitation und Geriatrie pro 1000 Einwohner oder Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in allgemeinen Krankenhäusern und Spezialkliniken, ohne Kliniken für Psychiatrie, Rehabilitation und Geriatrie (bezogen auf AP-DRG)),
• Inanspruchnahme der Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Hospitalisationsrate in Krankenhäusern und Betreuungsrate in sozialmedizinischen Institutionen oder Anzahl Hausarztkonsultationen pro Einwohner und Jahr),
• Gesundheitsausgaben (z.B. Betriebskosten pro Einwohner in allgemeinen Krankenhäusern und Spezialkliniken, ohne Kliniken für Psychiatrie, Rehabilitation und Geriatrie) und schließlich noch
• Spezialthemen (z.B. Stationäre psychiatrische Behandlungen oder Herzkreislaufkrankheiten) umfasst.
Jeder der Bereiche und seine einzelnen Themen sind verlinkt zu Datenübersichten aus der schweizerischen Gesundheitsstatistik, in denen wiederum Literaturverweise und Links zu weiteren Datenbeständen enthalten sind.
Zusätzlich erhält man über die Website des "Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Zugang zu speziellen Gesundheitsberichten und zu einem "Inventar der Gesundheitsdatenbanken" über das auch der direkte Zugang zu speziellen Datenbanken möglich ist.
Dabei handelt es sich etwa um eine Datenbank zum "Gesundheitsverhalten von Schulkindern - eine international vergleichende Trendstudie (Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC)", die "Schweizerische HIV Kohortenstudie (Swiss HIV Cohort Study, SHCS)" oder "NURSING data (Daten über die Pflege)".
Der Zugang zum "Schweizerischen Gesundheitsobservatorium" ist frei und kostenlos.
Wer sich noch differenzierter für die schweizerische obligatorische Krankenversicherung interessiert, findet entsprechende statistische Übersichten zur Kostenentwicklung in der Form langer Reihen beim "Bundesamt für Gesundheit" der Schweiz. Die Übersichten sind in der Regel bis hin zu Ausgabenarten, nach Kantonen und nach absoluten Beträgen und Veränderungsraten differenziert. Ihre Nutzung ist ebenfalls kostenlos möglich.
Wer schließlich nicht allzu tiefschürfende und differenzierte Interessen an Wissen hat, kann sich einen groben Überblick auch mit der achtseitigen und jährlich erscheinenden (aktuell Ausgabe 2009) "Gesundheitsstatistik" des "Bundesamts für Statistik" der Schweiz verschaffen, die ebenfalls kostenlos erhältlich ist.
Ein schon etwas älteres, kostenlos als PDF-Datei erhältliches Arbeitspapier von Thomas Gerlinger (früher WZB, aktuell Universität Frankfurt) über "Das Schweizer Modell der Krankenversicherung. Zu den Auswirkungen der Reform von 1996" (WZB-Arbeitspapier Bestell-Nr. SP I 2003-301) aus dem Jahr 2003 zeigt, welche Erkenntnisse man u.a. durch die gründliche Lektüre offizieller Statistiken gewinnen kann. Ein Vergleich mit den wichtigsten aktuellen Trends bestätigt außerdem die Stimmigkeit der Darstellungen und Schlussfolgerungen Gerlingers u.a. über die "Schattenseiten" des Schweizer Finanzierungssystem.
Bernard Braun, 21.5.09
Kostenlose Grafiken und Tabellen über das US-Gesundheitssystem im Präsentationsformat - Das Angebot "Kaiser slides".
 Das immer wieder für Interessenten an wichtigen Fragen des us-amerikanischen Gesundheitswesens und seiner Reformen empfehlenswerte Informationsangebot der liberalen "Kaiser Family Foundation (KFF)" enthält mit "Kaiser slides" auch ein umfangreiches Angebot von inhaltlich gehaltvollen und professionell erstellten Powerpoint-Abbildungen, Tabellen und Grafiken zu einer Reihe der wichtigsten Themenbereiche.
Das immer wieder für Interessenten an wichtigen Fragen des us-amerikanischen Gesundheitswesens und seiner Reformen empfehlenswerte Informationsangebot der liberalen "Kaiser Family Foundation (KFF)" enthält mit "Kaiser slides" auch ein umfangreiches Angebot von inhaltlich gehaltvollen und professionell erstellten Powerpoint-Abbildungen, Tabellen und Grafiken zu einer Reihe der wichtigsten Themenbereiche.
Die durchweg herunterladbaren und in eigene Präsentationen bzw. "slideshows" einfügbaren Abbildungen etc. befassen sich mit Medicaid/CHIP, Medicare, Costs/Insurance, Uninsured/coverage, Public opinion und Umfrageergebnisse zu Gesundheitsfragen, HIV/AIDS, minority health, women's health policy, media and health und global health-Fragen. Für jeden dieser Bereiche liefert die KFF-Seite bis an die 30 Abbildungen auf der Basis eigener und von anderen seriösen Akteuren durchgeführten wissenschaftlichen Surveys oder Studien nach denen auch einzeln thematisch über ein Suchfenster gesucht werden kann.
Über die Slides-Seite erhält man auch direkt Zugang zu weiteren bei der Information über die Strukturen des und das Geschehen im US-Gesundheitswesen hilfreichen Datentools. Dies ist zum einen der Zugang zu einem Chartbook über "Health Insurance Coverage in America, 2007" und dann Kurzinformationen und Links zu so genannten
• "Quick Takes", die z.B. Informationen des folgenden Typs enthalten: The top 1% of the U.S. population was responsible for 21% of health care spending in 2006 und 45 million nonelderly Americans were uninsured in 2007, and eight in ten were in families with at least one worker.
• "Key fact sheets" vom Typ "Women's Health Insurance Coverage" und
• "Online Data Tools" wie beispielsweise dem "wiederum äußerst materialreichen "Health poll search". Was dieser für den daran Interessierten bietet umreißen dessen Verwalter so: "Health Poll Search is a searchable archive of public opinion questions on health issues that allows users to know what Americans think about health issues, as well as what Americans have thought about health issues over time." Die Datenbasis geht zurück bis ins Jahr 1935.
Den Zugang zu den "Kaiser slides" der Kaiser Family Foundation und deren Nutzung ist kostenlos.
Bernard Braun, 28.4.09
Warum kostet ein Medikament in Heraklion nur ein Viertel so viel wie in Husum? 27 Arznei-Preis- und Erstattungssysteme in der EU!
 Zu den geläufigsten ersten aber auch meist letzten Sätzen von Debatten über Arzneimittelpreise und -ausgaben in Deutschland gehört die Feststellung "man habe das Mittel X im letzten Kretaurlaub für ein Viertel des hiesigen Preises" erhalten. Befinden sich Apotheker oder Pharmareferenten im Raum, gibt es sofort jede Menge rechtfertigende Hinweise auf die in Deutschland kostspielige Versorgungsdichte, die bessere Qualitätssicherung, die höhere Steuerbelastung und last not least die Forschungsaufwände, die es ja schließlich zu refinanzieren gälte.
Zu den geläufigsten ersten aber auch meist letzten Sätzen von Debatten über Arzneimittelpreise und -ausgaben in Deutschland gehört die Feststellung "man habe das Mittel X im letzten Kretaurlaub für ein Viertel des hiesigen Preises" erhalten. Befinden sich Apotheker oder Pharmareferenten im Raum, gibt es sofort jede Menge rechtfertigende Hinweise auf die in Deutschland kostspielige Versorgungsdichte, die bessere Qualitätssicherung, die höhere Steuerbelastung und last not least die Forschungsaufwände, die es ja schließlich zu refinanzieren gälte.
Aber nicht nur die Preise von Arzneimitteln variieren allein schon zwischen den EU-Mitgliedsstaaten beträchtlich, sondern auch schon die Abläufe und Kriterien, mit und nach denen Arzneimittelpreise und die Erstattung dieser Ausgaben festgelegt und geregelt werden, weisen erhebliche Unterschiede auf.
Hinzu kommt, dass die Ausgaben für Arzneimittel respektive deren Bändigung oder gar Senkung zu den Kernelementen aller Gesundheitsreformen in Deutschland aber auch anderen Ländern gehört.
Kein Wunder, wenn z.B. in der Gesetzlichen Krankenversicherung seit einigen Jahren der Anteil der Ausgaben für Arzneimittel über denen für die gesamte ambulante ärztliche Behandlung liegt und der Medikamentenbereich zu den wenigen Leistungsbereichen mit scheinbar unaufhaltsamen Aufwärtstendenzen gehört. Entsprechend rasch ändern sich auch die jeweiligen Patentrezepte und -mittel und so kennen die meisten BürgerInnen weder Festbeträge, Rabattverträge, Arzneimittelrichtlinien, Positiv- oder Negativlisten, 4. Phase, aut idem und Generika im DEtail noch können sie diese und noch wesentlich mehr Instrumente und Methoden verstehen oder gar bewerten.
Wem dieser Zustand ein Graus ist, wer einen Teil der Hintergründe von Preisunterschieden zwischen Heraklion und Husum wirklich verstehen will, wer etwas Zeit hat und englisch kann, findet in dem im Mai 2008 veröffentlichten 187 Seiten umfassenden "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)"-Report und seinen diversen Anhängen und Anlagen die entsprechenden Informationen.
Es handelt sich um die Ergebnisse eines von der EU-Kommission geförderten Netzwerks von 52 Institutionen - Behörden und weitere wichtige Institutionen im Arzneimittelbereich - aus 31 Ländern der gesamten EU und darüber hinaus.
Das Projektmanagement erfolgte durch die Gesundheit Österreich GmbH, Geschäftsbereich Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen / Austrian Health Institute (GÖG/ÖBIG) und das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die TeilnehmerInnen schufen mit detaillierten Länderberichten (»PPRI Pharma Profiles«) die Basis für eine vergleichende Analyse der Systembesonderheiten und für einen Austausch über die Erfahrungen mit länderspezifischen Maßnahmen.
Der PPRI-Report stellt vergleichend umfangreiche Informationen zu folgenden Aspekten der Arzneimittelversorgung vor:
• Gesundheitssystemtypen, demographische und ökonomische Entwicklung als Hintergrundsbedingungen
• Grundzüge des pharmazeutischen Systems (Organisation, Erhältlichkeit von Arzneimitteln, Ausgabenstrukturen, "market players")
• Systeme der Preisfindung/-bildung
• Systeme der Erstattung von Arzneimittelaufwändungen (reimbursement)
• Systeme zum rationalen Gebrauch von Arzneimitteln (z.B. Budgets, Verordnungsleitlinien, Patienteninformation).
Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit den aus diesen Vergleichen gelernten Lektionen. Darunter befinden sich beispielsweise folgende:
• In 27 verglichenen Ländern gibt es 27 verschiedene Preis- und Erstattungssysteme.
• Länderspezifische Bedingungen erfordern offensichtlich primär länderspezifische Lösungen.
• Auch wenn in allen Ländern höchstes Interesse besteht, mehr über andere Länder zu lernen, existieren massive Verständnis-, Verstehens- und damit Verständigungsprobleme.
• Die wechselseitige Transparenz sollte verstetigt werden. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil kein Jahr ohne eine mehr oder weniger gravierendere Veränderung im Arzneimittelpolitikbereich vergangen ist und vergehen wird.
• Einigen Ländern, z.B. Schweden und den Niederländen, gelang es in diesem Jahrzehnt sogar, das Wachstum der Arznbeimittelausgaben unter 5 % pro Jahr zu halten.
• Eine erfolgreiche Kostendämpfungspolitik bei den Arzneimitteln muss nicht notwendigerweise zulasten der Patienten (z.B. durch Privatisierung der Ausgaben für die aus der Kassenerstattung genommenen Arzneimitteln) gehen.
• Ebenso ist es möglich, gleichzeitig Kosten zu senken und Qualität zu sichern.
• Eine verbreitete Inkompatibilität der nationalen Daten und Indikatoren machen internationale Vergleiche immer noch schwierig.
• Um den so genannten "pendulum effect" zu vermeiden, was meint, dass einzelne oder alle Beteiligten nach dem Wirksamwerden eines neuen Instrument mehr oder weniger schnell Schlupflöcher gegen das Gesetz entdecken, muss das Monitoring in kürzeren Abständen durchgeführt und inhaltlich stetig verfeinert werden.
• Mit der folgenden Lehre kommen wir zum Einstieg dieses Textes und einem wirklichen aber meistens ignorierten oder unterschätzten Grunddilemma gerade einer besonders aktiven Arzneimittelpolitik zurück: "Adjoint consensual policy environment tends to have a positive impact on the acceptance of decisions. The best reform is likely to fail if there is insecurity and lack of understanding among key stakeholders (in particular patients, prescribers, pharmacists and pharmaceutical industry) who consequently either ignore the measures or oppose them."
Der komplette "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)"-Report" ist kostenlos erhältlich. Die ebenfalls umfangreichen und ähnlich gegliederten Länderberichte, die so genannten "Pharma Profiles" können ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden. Dazu gehören natürlich auch 74 Seiten Deutschland-Pharma Profiles.
Bernard Braun, 14.12.08
OECD Gesundheits-Statistik 2007: Die Zahl der Fachärzte hat sich seit 1990 um 50% erhöht
 Die OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) hat jetzt eine Neuauflage von Statistiken zu Gesundheitsthemen herausgegeben, die in den 30 Mitgliedsstaaten gesammelt wurden. "OECD Health Data 2007" ist eine überaus umfangreiche und differenzierte Datensammlung, die als Buch, auf CD-ROM oder per Internetzugang verfügbar ist. In einer Pressemitteilung wird auch auf einige länderübergreifende Trends hingewiesen, die sich bei Auswertung der Daten gezeigt haben. So wurde deutlich:
Die OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) hat jetzt eine Neuauflage von Statistiken zu Gesundheitsthemen herausgegeben, die in den 30 Mitgliedsstaaten gesammelt wurden. "OECD Health Data 2007" ist eine überaus umfangreiche und differenzierte Datensammlung, die als Buch, auf CD-ROM oder per Internetzugang verfügbar ist. In einer Pressemitteilung wird auch auf einige länderübergreifende Trends hingewiesen, die sich bei Auswertung der Daten gezeigt haben. So wurde deutlich:
• Die Zahl der Ärzte ist in den OECD-Ländern in den letzten 15 Jahren um gut ein Drittel gestiegen. In den meisten Ländern war dies vor allem bedingt durch eine Zunahme der Fachärzte. Deren Zahl hat sich seit 1990 um etwa 50% erhöht, während der Zuwachs bei Allgemeinärzten mit 20% wesentlich bescheidener ausfiel.
• Das Einkommensniveau der Ärzte variiert ganz erheblich zwischen den einzelnen Ländern. Durchweg feststellbar ist aber, dass die Einkommen der Fachärzte deutlich über denen von Allgemeinärzten liegen. Ein besonders hohes Verdienstniveau haben Fachärzte in den Niederlanden, Belgien und den USA. Allgemeinärzte verdienen vergleichsweise sehr gut in den USA und im United Kingdom. Deutschland liegt hier im Mittelfeld, allerdings weisen die OECD-Daten zu diesem Thema relativ viele Leerstellen auf.
• Die Zahl der Medizinstudenten ist seit 1990 in einigen Ländern deutlich zurückgegangen, vor allem in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Spanien und der Schweiz.
• Ein steigender Anteil der öffentlichen wie privaten Ausgaben geht in den OECD-Ländern in den Gesundheitssektor. Zwischen 1990 und 2005 stieg dieser Anteil der Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit um etwa 80%. Die vier Länder mit den höchsten Gesundheitsausgaben (als prozentualer Anteil am Bruttosozialprodukt) im Jahr 2005 sind die USA (15.3%), Schweiz (11.6%), Frankreich (11.1%) und Deutschland (10.7%).
• Betrachtet man nicht die Gesundheitsausgaben als Anteil am BSP, sondern die Pro-Kopf-Ausgaben, dann liegt Deutschland mit 3.628€ deutlich hinter anderen Ländern (auf Platz 10), wie insbesondere den USA (6.401€) oder auch Norwegen und der Schweiz mit über 5.600€.
Die Pressemitteilung der OECD ist hier nachzulesen: OECD Health Data: specialists outnumber GPs in most OECD countries. Dort finden sich auch Hinweise zum Bezug der sehr umfangreichen Datensammlung als Buch, CD-ROM oder Online-Zugang.
Die komplette Datensammlung ist kostenpflichtig. Eine Excel-Datei mit Statistiken zu knapp 30 Indikatoren ist allerdings kostenlos zugänglich: OECD Health Data 2007 - Frequently Requested Data
Gerd Marstedt, 26.7.2007
Arbeitskosten, Lohnquoten, Leiharbeiter - Aktuelle Daten zu den Treibsätzen der nächsten GKV-Beitragserhöhung
 Das fast schon vergessene "GKV-Modernisierungsgesetz" vom 1. Januar 2004 hin und das seit 1. April 2007 teilweise in Kraft getretene jüngste Gesundheitsreformgesetz, das "Wettbewerbsstärkungsgesetz", her: Die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen werden 2008 voraussichtlich wieder steigen - so jedenfalls eine aktuelle Schätzung aus Expertenkreisen.
Das fast schon vergessene "GKV-Modernisierungsgesetz" vom 1. Januar 2004 hin und das seit 1. April 2007 teilweise in Kraft getretene jüngste Gesundheitsreformgesetz, das "Wettbewerbsstärkungsgesetz", her: Die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen werden 2008 voraussichtlich wieder steigen - so jedenfalls eine aktuelle Schätzung aus Expertenkreisen.
Sollte dies eintreffen wird wie immer eine dramatische Debatte über die Gründe ausbrechen. Befürchtungen, die "Kostenexplosion" und die steigenden Lohnnebenkosten könnten die gerade so gut funktionierende Konjunktur abwürgen werden schnell anwachsen und Forderungen nach wirksamer Kostendämpfung durch mehr Selbstbeteiligung und Abbau solidarisch finanzierter Leistungen werden wie Pilze aus dem Boden schießen.
Wer Fakten und Argumente für die wirklichen und seit längerem strukturellen Hintergründe des skizzierten Standard-Szenarios der deutschen Gesundheitspolitik sucht, findet mehrere in einer einzigen aktuellen Quelle. Die Quelle ist der "Rundbrief Nr. 28" des Herausgebers des "Informationsportals Deutschland & Globalisierung". Dieses Portal wird seit mittlerweile zwei Jahren von dem pensionierten ehemaligen Außenwirtschaftsexperten im Bundeswirtschaftsministerium (Ministerialdirigent) und Vorstandsmitglied u.a. in der "Europäischen Bank für Wiederaufbau", Joachim Jahnke, mit mittlerweile Hunderten von globalisierungskritischen und sich sachkundig mit der Flut neoliberaler wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Argumente auseinandersetzenden Beiträgen gestaltet. Die Rundbriefe und weitere kurze Texte sind materialreich und hervorragend illustriert und stützen sich auf nationale und internationale Veröffentlichungen und Statistiken u.a. aus statistischen Ämtern, der EU-Kommission oder internationalen Organisationen.
Die für eine ernsthafte Debatte um die vergangene und künftige Entwicklung des Beitragssatzes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gewichtigen Daten und Analysen sind folgende:
• Das Schreckgespenst der wettbewerbsschädlichen Kostenlasten ist auch aktuell nicht existent oder geringer als suggeriert: Nach dem aktuell für das 1. Quartal 2007 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Arbeitskostenindex stehen zwei Entwicklungen fest: Dieser Index ist in der Industrie sind in den ersten drei Monaten 2007 lediglich um 0,4 % gestiegen. Der Zuwachs nahm seit 2000 im jeweiligen Vorjahresvergleich ständig ab, nämlich von 3,1 % in 2000, über 2,2 % in 2003, 0,8 % in 2004, 0,2 % in 2005 und 0,9 % im gesamten Jahr 2006 gegenüber 2005.
• Bei den Arbeitskosten aus absoluten Beiträgen von Bruttolöhnen und Lohnnebenkosten in Euro pro Stunde berechnet liegt Deutschland mit 28,70 Euro/Stunde im europäischen Mittelfeld. Dieser Betrag ist in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweden und Dänemark höher (Spitzenreiter Dänemark mit 33,80 Euro/Stunde), in den Niederlanden, Österreich oder Griechenland niedriger (Schlusslicht Griechenland mit 16,70 Euro/Stunde).
• Bei der prozentualen Veränderung der absoluten Arbeitskosten pro Stunde von 2005 auf 2006 liegt Deutschland mit +1,1 % auf dem letzten Platz und Griechenland mit +7,8 % an der Spitze.
• Die Anzahl der meist unterdurchschnittlich entlohnten Zeitarbeiter nimmt seit Anfang des Jahrzehnts stetig zu (nach Italien und den Niederlanden gibt es hier zu Lande den stärksten Zuwachs) und mit eigenen Tarifverträgen der Zeitarbeitsfirmen ausgestattete Leiharbeitsverhältnisse treten immer häufiger an die Stelle von regulären betrieblichen Arbeitsverhältnissen.
• Diese Entwicklungsdynamik führt zu direkten und indirekten Belastungen der Einnahmesituation der GKV: Direkt ist der "Topf" der Bruttolöhne aus dem die GKV über einen prozentualen Beitragssatz ihre Einnahmen bezieht nicht so voll wie bei regulären Arbeitsverhältnissen. Indirekt schaukeln sich nachteilige Effekte der Leiharbeit mittel- bis langfristig auf. Eine Analyse des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit aus dem September 2006 zeigte nämlich für 2003, dass der Anteil der "Ketten-Leiharbeiter" entgegen der Propaganda vom vorübergehenden Zustand aktuell zunimmt (Anteil 1980-84: 15,4 % und 2003: 25,5 %) und der Anteil dieser Art von Arbeitern, die anschließend arbeitslos werden, deutlich höher ist als in der Vergangenheit (18,6 % und 33,8 %). Entsprechend schrumpft dann auch der Anteil der Leiharbeiter, die in eine anderweitige, möglicherweise besser bezahlte und stabilere Beschäftigung übergehen (32,6 % zu 21,2 %).
• Was in Deutschland seit 1979, von damals etwas über 73 %, auf zuletzt im 1. Quartal 2007 (saisonbereinigt) mit einigen Auf und Abs auf unter 65 % abnimmt, und seit 2001 geradezu abstürzt, ist die Lohnquote als Anteil am Volkseinkommen. Diesem Absturz steht ein enormer Anstieg des Anteils der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am Volkseinkommen gegenüber, was insgesamt zu einer enormen Zunahme der Spreizung der sozialen Verhältnisse führt. Neben vielen anderen Auswirkungen dieser Spreizung, verbirgt sich hier bei Beibehaltung der lohneinkommensbezogenen Finanzierung der Sozialversicherungssysteme der stärkste Treibsatz der zwingenden Beitragssatzerhöhungen.
Weitere Einzelheiten können dem "Rundbrief 28" des "Informationsportals Deutschland & Globalisierung", der hier heruntergeladen werden kann entnommen werden.
Wer sich auch noch für den einen oder anderen interessanten, häufig international vergleichenden sozialpolitischen Beitrag (z. B. jüngst eine genauere empirische Analyse der Leistungen der skandinavischen Sozialsysteme) oder Materialien zur Globalisierungsdebatte interessiert, kann hier die "Rundbriefe" abonnieren und damit Zugang zu allen bisher veröffentlichten Materialien erhalten.
Bernard Braun, 10.6.2007
Weltweite Herausforderung: Absicherung gegen finanzielle Krankheitsfolgen
 Lange Jahre galten soziale Sicherungssysteme als Luxus reicher Industrieländer, den sich Entwicklungsländer nicht leisten könnten. Das Credo der Weltbank und anderer internationaler Organisationen lautete: Erst Wirtschaftswachstum, dann soziale Sicherung. Die Folgen dieser Politik sind bekannt und spätestens seit Festlegung der Millenium-Entwicklungsziele auch als große Herausforderung erkannt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind jährlich fast 180 Millionen Menschen weltweit mit der Bezahlung von Behandlungskosten überfordert und mehr als 100 Millionen fallen darüber in Armut. Fehlende soziale Absicherung gegen Krankheitsfolgen verursacht nicht nur individuelles Leid für die Betroffenen, sondern beeinträchtigt auch die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Landstriche und Staaten.
Lange Jahre galten soziale Sicherungssysteme als Luxus reicher Industrieländer, den sich Entwicklungsländer nicht leisten könnten. Das Credo der Weltbank und anderer internationaler Organisationen lautete: Erst Wirtschaftswachstum, dann soziale Sicherung. Die Folgen dieser Politik sind bekannt und spätestens seit Festlegung der Millenium-Entwicklungsziele auch als große Herausforderung erkannt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind jährlich fast 180 Millionen Menschen weltweit mit der Bezahlung von Behandlungskosten überfordert und mehr als 100 Millionen fallen darüber in Armut. Fehlende soziale Absicherung gegen Krankheitsfolgen verursacht nicht nur individuelles Leid für die Betroffenen, sondern beeinträchtigt auch die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Landstriche und Staaten.
Der Reader Extending Social Protection in Health. Developing Countries’ Experiences, Lessons Learnt and Recommendations bietet eine Art Panoptikum, das ebenso spannenden wie fundierten Einblick in die Bemühungen so verschiedener Länder wie China, Costa Rica, Korea, Thailand, Ghana oder Senegal um die soziale Absicherung der Bevölkerung vermittelt. Dieses Potpouri weltweiter sozialpolitischer Erfahrungen ergänzen etliche Beiträge mit regionalem Bezug sowie Hintergrundanalysen und ein beachtlicher Serviceteil mit umfangreicher Bibliografie und anderen Hinweisen.
Das gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), der Internationalen Arbeitsbehörde (ILO) und der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegebene Werk belegt nachdrücklich, dass trotz sehr unterschiedlicher Ausgangsbedingungen soziale Sicherung kein Privileg der Industrieländer ist, sondern weltweit auf der Tagesordnung nationaler Regierungen und der internationalen Entwicklungszusammenarbeit steht. Und es legt überzeugend dar, warum es keinen "Goldstandard" auf dem Weg zu funktionierenden, nachhaltigen und sozial gerechten Gesundheitssystemen gibt. Vielmehr zeichnet sich eine Kombination von Steuerfinanzierung, Sozialsystemen und unterschiedlichen Formen anderen Krankenversicherungen als Erfolg versprechender Weg zur universellen Absicherung der Bevölkerung ab, den Thailand ebenso wie die Philippinen, Ghana und Mexiko mit unterschiedlichen Gewichtungen eingeschlagen haben.
Wer mehr über den aktuellen Kampf gegen soziale Unsicherheit und den Ausschluss großer Bevölkerungsteile von jeglichem Sozialschutz erfahren will, findet in dem Konferenz-Reader viele interessante und informationsreiche Beiträge namhafter internationaler Expertinnen und Experten.
Das Sammelwerk ist erschienen im VAS-Verlag in Frankfurt/Main und unter folgender Anschrift zu beziehen: VAS-Verlag, Wielandstraße 10, 60318 FRANKFURT, mail: info@vas-verlag.de, Tel.: 069-779366, Fax: 069-7073967.
Hier können Sie eine digitale Vorabversion des Readers mit zwei ausgewählten Beiträgen herunterladen: Konferenz-Reader
Jens Holst, 21.4.2007
OECD Gesundheitsdaten 2006 veröffentlicht
 Die OECD hat die neueste Ausgabe ihrer Gesundheitsstatistiken veröffentlicht. Aufgeführt sind dort etwa 1200 Indikatoren aus unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens: Gesundheitszustand und Erkrankungen, Gesundheitseinrichtungen und medizinische Versorgung, Inanspruchnahme von Leistungen, Kosten und Ausgaben für Gesundheit, Soziale Sicherung, Medikamente, nicht-medizinische Einflussfaktoren für die Gesundheit, demographische Merkmale. Zur Verfügung gestellt werden Daten aus allen 30 Ländern der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) als Zeitreihen. Die statistischen Kennzahlen sind als interaktive Datenbank mit Tabellen und Diagrammen auf CD-ROM zu beziehen (Preis 80 Euro).
Die OECD hat die neueste Ausgabe ihrer Gesundheitsstatistiken veröffentlicht. Aufgeführt sind dort etwa 1200 Indikatoren aus unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens: Gesundheitszustand und Erkrankungen, Gesundheitseinrichtungen und medizinische Versorgung, Inanspruchnahme von Leistungen, Kosten und Ausgaben für Gesundheit, Soziale Sicherung, Medikamente, nicht-medizinische Einflussfaktoren für die Gesundheit, demographische Merkmale. Zur Verfügung gestellt werden Daten aus allen 30 Ländern der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) als Zeitreihen. Die statistischen Kennzahlen sind als interaktive Datenbank mit Tabellen und Diagrammen auf CD-ROM zu beziehen (Preis 80 Euro).
Kostenlos im Internet verfügbar sind einige relativ häufig nachgefragte Indikatoren, die komplett als Excel-Tabellen heruntergeladen werden können. Dargestellt sind dort Zeitreihen, die teilweise schon im Jahr 1960, teilweise auch erst später beginnen und bis 2005 reichen.
In den (kostenlosen) Excel-Tabellen sind folgende Indikatoren zu finden:
• Ausgaben für Gesundheit (in Prozent des Bruttosozialprodukts)
• Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit (in US-Dollar)
• Jährliche Wachstumsraten der Gesundheitsausgaben
• Öffentliche Ausgaben für Gesundheit
• Gesamtausgaben für Medikamente
• Zahl der Allgemein- und Fachärzte
• Zahl der Pflegekräfte
• Zahl der Krankenhausbetten
• Zahl der Einrichtungen zur Magnetresonanztomographie
• Lebenserwartung in Jahren bei der Geburt (Männer, Frauen, insgesamt)
• Lebenserwartung im Alter von 65 (Männer, Frauen)
• Säuglingssterblichkeit
• Zerebro-vaskuläre Erkrankungen (Männer, Frauen, insgesamt)
Excel-Tabellen: OECD Health Data 2006
Gerd Marstedt, 2.3.2007
"The Minority Health Archive" der Universität Pittsburgh
 Eines der größten sozialen aber auch volkswirtschaftlichen Probleme des zugleich teuersten Gesundheitssystems der Welt, sind die ungleichen Erkrankungsrisiken und Versorgungschancen der in den USA ja nicht gerade kleinen rassischen oder ethnischen Minoritäten. Auf mehrere aktuelle Forschungsergebnisse hat dieses Forum bereits hingewiesen und wird dies weiter tun. Hinweise erfolgten ebenfalls auf öffentlich zugängliche Informationspools über Ungleichheit im US-Gesundheitssystem wie etwa dem wöchentlich erscheinenden "Disparities-Report" der Kaiser-Family-Foundation.
Eines der größten sozialen aber auch volkswirtschaftlichen Probleme des zugleich teuersten Gesundheitssystems der Welt, sind die ungleichen Erkrankungsrisiken und Versorgungschancen der in den USA ja nicht gerade kleinen rassischen oder ethnischen Minoritäten. Auf mehrere aktuelle Forschungsergebnisse hat dieses Forum bereits hingewiesen und wird dies weiter tun. Hinweise erfolgten ebenfalls auf öffentlich zugängliche Informationspools über Ungleichheit im US-Gesundheitssystem wie etwa dem wöchentlich erscheinenden "Disparities-Report" der Kaiser-Family-Foundation.
Eine weitere kostenlose Fundstelle für wissenschaftliche oder politische Studien, Programme, Bilddokumentationen, Konferenzdokumente und Berichte zur "minority health" in den USA ist das vom "Center for Minority Health" und dem "University Library System" der "University of Pittsburgh" getragene "Minority Health Archive". Das Archiv umfasst Anfang 2007 fast 500 der genannten Dokumente und konzentriert sich auf vier rassische Gruppen, nämlich "Blacks/African Americans, Native Americans, Hispanics/Latinos and Asian Americans/Pacific Islanders".
Zu den editorischen Besonderheiten des Archivs gehört die Möglichkeit, als registrierter Nutzer sachbezogene Texte zur Aufnahme in das Archiv anzubieten, über deren Aufnahme aber die Archiv-Verantwortlichen entscheiden.
Der Zugang zu den Dokumenten des "Minority Health Archive" und den Uploadmöglichkeiten erfolgt hier.
Bernard Braun, 19.1.2007
Eurobarometer: Bevölkerungsumfragen in der EU zum Thema Public Health
 Das "Eurobarometer" ist eine in regelmäßigen zeitlichen Abständen von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene repräsentative Bevölkerungsumfrage in den Ländern der EU. Neben Themen wie Kultur, Informationstechnologie, Umweltschutz, Euro als Währung, Verteidigung, Einstellungen zu Europa und den Institutionen der EU gibt es auch eine Reihe von Meinungsumfragen zum Thema Gesundheit, die interessante Aufschlüsse geben über unterschiedliche Positionen und Erwartungen der Bevölkerung im Norden und Süden der EU, in den neuen und alten Beitrittsländern.
Das "Eurobarometer" ist eine in regelmäßigen zeitlichen Abständen von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene repräsentative Bevölkerungsumfrage in den Ländern der EU. Neben Themen wie Kultur, Informationstechnologie, Umweltschutz, Euro als Währung, Verteidigung, Einstellungen zu Europa und den Institutionen der EU gibt es auch eine Reihe von Meinungsumfragen zum Thema Gesundheit, die interessante Aufschlüsse geben über unterschiedliche Positionen und Erwartungen der Bevölkerung im Norden und Süden der EU, in den neuen und alten Beitrittsländern.
Die letzten Umfragen zum Thema Public Health (in Klammern das Datum der Veröffentlichung und Sprache des Berichts) waren:
• Psychische Gesundheit (Dezember 2006, deutsch)
• Ernährung, körperliche Bewegung und Gesundheit (November 2006, deutsch)
• AIDS-Prävention (Oktober 2006, deutsch)
• Vogelgrippe (Juni 2006, englisch)
• Ökologische und gesundheitliche Risiken (Februar 2006, englisch)
• Ärztliche Kunstfehler (Januar 2006, deutsch)
In den Berichten finden sich Auswertungen nach Ländern, aber auch nach sozialstatistischen Merkmalen (Alter, Soziale Schicht, Geschlecht, Stellung im Beruf usw.) sowie meist auch ein umfassender Tabellenteil.
Download der Berichte von der Seite Eurobarometer Public Health Themen
Gerd Marstedt, 28.12.2006
OECD-Handbuch: Entwicklung und Bewertung von Indikatoren für Gesundheitssysteme
 Internationale Vergleiche der Strukturen und vor allem der Leistungsmerkmale von Gesundheits- und Sozialsystemen durch die WHO, die OECD, die UNO, einzelne Regierungen oder Wissenschaftlerverbünde spielen eine zunehmende Rolle in wissenschaftlichen wie politischen Debatten. Weit im Vordergrund des Interesses stehen dabei die Eignung solcher Vergleiche zum ebenfalls immer mehr in Mode kommenden weltweiten Benchmarking und Ranking der nationalen Gesundheitssysteme. "Nur im Mittelfeld" oder "hinter Italien" zu liegen, bewegt manchmal mehr als jahrelange nationale gesundheitspolitische Expertendebatten. Auf die wichtigsten Reports haben wir seit dem Start dieses Forums immer wieder verwiesen und werden dies auch künftig tun.
Internationale Vergleiche der Strukturen und vor allem der Leistungsmerkmale von Gesundheits- und Sozialsystemen durch die WHO, die OECD, die UNO, einzelne Regierungen oder Wissenschaftlerverbünde spielen eine zunehmende Rolle in wissenschaftlichen wie politischen Debatten. Weit im Vordergrund des Interesses stehen dabei die Eignung solcher Vergleiche zum ebenfalls immer mehr in Mode kommenden weltweiten Benchmarking und Ranking der nationalen Gesundheitssysteme. "Nur im Mittelfeld" oder "hinter Italien" zu liegen, bewegt manchmal mehr als jahrelange nationale gesundheitspolitische Expertendebatten. Auf die wichtigsten Reports haben wir seit dem Start dieses Forums immer wieder verwiesen und werden dies auch künftig tun.
Bei allen internationalen Vergleichen, und zwar egal, ob weltweit oder lediglich zwischen relativ homogenen Industrieländern, gibt es allerdings massive methodische Probleme bei den zum Vergleich genutzten Indikatoren, der Art und Weise ihrer Gewinnung, des Umgangs mit ihnen und ihrer Präsentation. Welche Unterschiede es hier gibt und welchen Einfluss sie auf die Erkenntnisse haben, zeigt u.a. ein im November 2006 von der OECD herausgegebenes "Data and Metadata Reporting and Presentation Handbook". Obwohl es ursprünglich für die Zwecke der internationalen Statistik kurzfristiger ökonomischer Entwicklungen konzipiert wurde, hat es auch für andere jährliche oder strukturelle Statistiken über soziale und demografische Fragen, also auch für Gesundheitsfragen einen Nutzen.
Das über 140-seitige Handbuch enthält dazu auch
• Leitlinien und Empfehlungen zur Zeitreihenberichterstattung,
• zur Berichterstattung und Verbreitung mit und von Metadaten und administrativen Daten und zum
• Einsatz und die Darstellung statistischer Maße.
Geplant ist, das Handbuch in einer dynamischen Web-Version auf der Statistik-Website der OECD künftig aktuell zu halten.
PDF-Version: "Data and Metadata Reporting and Presentation Handbook"
Bernard Braun, 18.12.2006
"Performance Snapshots" des Commonwealth Fund: Eine neue leistungsfähige Informationsquelle für den "eiligen Leser".
 "Tracking the steady stream of research and data about the performance of the health care system can be a daunting task." Mit dieser Feststellung über die Fülle der täglich gewonnenen und erhältlichen Erkenntnisse über die Leistungen und Leistungsfähigkeit der verschiedenen Gesundheitssysteme umschreibt der liberale us-amerikanische "Commonwealth Fund" den Start einer neuen Sparte in seinem auch aus vielen Forumsbeiträgen bekannten breiten gesundheitswissenschaftlichen und sozialpolitischen Informationsprogramm.
"Tracking the steady stream of research and data about the performance of the health care system can be a daunting task." Mit dieser Feststellung über die Fülle der täglich gewonnenen und erhältlichen Erkenntnisse über die Leistungen und Leistungsfähigkeit der verschiedenen Gesundheitssysteme umschreibt der liberale us-amerikanische "Commonwealth Fund" den Start einer neuen Sparte in seinem auch aus vielen Forumsbeiträgen bekannten breiten gesundheitswissenschaftlichen und sozialpolitischen Informationsprogramm.
Gegen die erwähnte furchterregende Aufgabe soll ab sofort die Seite "Performance Snapshots" helfen. Auf ihr werden wichtige Fragen der Performance von Gesundheits- und Versorgungssystemen gestellt und in systematischer Weise theoretisch wie empirisch beantwortet. In der bekannten Systematik der Chartbooks des Fund (eine der für die Snapshot-Sparte verantwortliche Wissenschaftlerin ist die durch ihre Chartbooks bereits bekannte Sheila Leatherman) werden die Ausführungen durch herunterladbare und als PDF- oder Powerpoint-Dateien weiter verwendbare Schaubilder und Grafiken aus den verschiedenen US- und internationalen Surveys ergänzt sowie durch Literatur- und Quellenverweise abgerundet.
Die bisher 84 Snapshots mit rund 180 Schaubildern und Grafiken beschäftigen sich z. B. mit den Themen:
• Wie viele Menschen brauchen medizinische Versorgung wegen Problemen, die durch Arzneimittelverbrauch entstanden sind?
• Wie viele Frauen erhalten Mammografien, um Brustkrebs zu entdecken?
• Wie viele Menschen bekommen Antibiotika bei einfachen Erkältungen?
• Wie oft beraten Ärzte Teenager über gesundes Verhalten?
Das Angebot soll regelmäßig erweitert werden. Der Aufbau der Beantwortung der Fragen folgt auf zwei randvoll mit Fakten gefüllten A 4-Seiten meist dem folgendem Schema: Warum ist die Frage wichtig? Was weiß man darüber? Welche Implikationen hat das reale Geschehen? Was kann tun, um die Situation zu verbessern?
Hierüber erreichen Sie die Performance Snapshots des Commonwealth Fund.
Bernard Braun, 14.12.2006
Materialien über Gesundheit und Bevölkerungsentwicklung weltweit: Population and Health Infoshare
 Eine Reihe von internationalen, hauptsächlich von Nichtregierungsorganisationen unterstützten Initiativen bieten für die Themenfelder Reproduktions- und Kindergesundheit, HIV/AIDS und Bevölkerungsgesundheit die elektronische Bibliothek "Population and Health InfoShare - Sharing Knowledge to Improve Public Health Worldwide" an.
Eine Reihe von internationalen, hauptsächlich von Nichtregierungsorganisationen unterstützten Initiativen bieten für die Themenfelder Reproduktions- und Kindergesundheit, HIV/AIDS und Bevölkerungsgesundheit die elektronische Bibliothek "Population and Health InfoShare - Sharing Knowledge to Improve Public Health Worldwide" an.
Unter dem angebotenen Material befinden sich beispielsweise "Country Profiles for Population an Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2005", eine Studie über "Parents of Persons with AIDS", eine Literaturrecherche zum Thema "Care of the Newborn", zahlreiche Gesundheitsstudien mit dem Schwerpunkt in den Entwicklungsländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens (oft auch in der Originalsprache wie z. B. für Lateinamerika in Spanisch) und schließlich Infodienste wie das "Youth InfoNet".
Hier erreichen Sie die Website "Population and Health Infoshare".
Bernard Braun, 11.12.2006
Worldbank PovertyNet und WEED: Informationsquellen über weltweite Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit
 Wer Materialien zum weltweiten Zusammenhang von Armut, sozialer Ungleichheit und auch Gesundheit sucht und zusätzlich auch etwas mehr über die Aktivitäten der Weltbank zur Armutsbekämpfung aus deren Perspektive erfahren will, dem sei empfohlen, den kostenlosen Newsletter des "World Bank PovertyNet" zu bestellen.
Wer Materialien zum weltweiten Zusammenhang von Armut, sozialer Ungleichheit und auch Gesundheit sucht und zusätzlich auch etwas mehr über die Aktivitäten der Weltbank zur Armutsbekämpfung aus deren Perspektive erfahren will, dem sei empfohlen, den kostenlosen Newsletter des "World Bank PovertyNet" zu bestellen.
Die gerade erschienene Dezember-Ausgabe ist die 96. Ausgabe und enthält u.a. kurze inhaltliche Hinweise auf den neuesten "Human Development Report 2006", den Entwicklungsbeitrag der Überweisungen der im Ausland arbeitenden Arbeiter aus Lateinamerika in ihre Heimatländer, Kurzinfos zur ökonomischen Entwicklung in Ostasien und einen Hinweis auf eine Publikation über effizientes Lernen für die Armen.
Wer im Newsletter weltbankkritische Nachrichten oder Hinweise auf kritische Auseinandersetzungen mit dem Armutsprogramm und anderen Programmen der Weltbank oder gar des "Internationalen Währungsfonds/International Monetary Fund (IWF/IMF)" vermisst, kann sich diese Informationen bei Nichtregierungsorganisationen besorgen. Stellvertretend für mehrere Organisationen kann die seit 15 Jahren arbeitende Initiative "World Economy, Ecology & Development (WEED)" genannt werden.
Hier bestellen Síe u.a. (hier finden sich auch viele andere erhältliche WB-Publikationen) den Newsletter des "PovertyNet" der Weltbank.
Bernard Braun, 1.12.2006
Ungleiche räumliche Verteilungen im US-Gesundheitssystem: Der Dartmouth Atlas
 Zu den bis heute relevanten Public Health-Pionierarbeiten gehören Analysen der ungleichen räumlichen Verteilung von Gesundheitsdiensten und deren unterschiedlichen Nutzung. Diese so genannte "small area analysis" ist untrennbar mit dem Namen John E. Wennberg verbunden, der 1973 mit der Durchführung solcher Studien begann.
Zu den bis heute relevanten Public Health-Pionierarbeiten gehören Analysen der ungleichen räumlichen Verteilung von Gesundheitsdiensten und deren unterschiedlichen Nutzung. Diese so genannte "small area analysis" ist untrennbar mit dem Namen John E. Wennberg verbunden, der 1973 mit der Durchführung solcher Studien begann.
Das Center for the Evaluative Clinical Services (CECS) an der Dartmouth Medical School beschäftigt sich auch heute noch unter Leitung Wennbergs mit dieser Art von "outcomes research". Die zum Teil langjährigen Ergebnisse dieser Forschung sind in einem Informationsinstrument, dem so genannten Dartmouth Atlas, zusammengestellt, das für mehrere Zwecke nützlich ist:
• Erstens liefert es sehr detaillierte Daten über die nationale, regionale und lokale Verteilung von medizinischen Ressourcen (z.B. Anzahl von Ärzten oder Krankenhäuser) und deren Nutzung in den USA. Diese Daten liefern auch Grundlagen für Verbesserungen des Versorgungssystems.
• Zweitens liefert der Atlas eine Menge Anregungen wie und mit welchen erwartbaren Ergebnissen ein solches Projekt auch in Deutschland entwickelt werden könnte. Die Debatten um das Nord-Süd- und seit einiger Zeit auch über das Ost-West-Gefälle in Deutschland zeigen , wie schnell hier Analysen fündig werden können.
Hier finden Sie den Dartmouth-Atlas und Verweise auf Arbeiten über ungleiche räumliche Verteilungen.
Bernard Braun, 15.11.2006
Gesundheitsindikatoren 2005 der OECD-Länder "auf einen Blick"
 Alle zwei Jahre veröffentlicht die OECD ausgewählte statistische Informationen über die wichtigsten Bereiche und Indikatoren des Gesundheitswesens ihrer 30 Mitgliedsländer. Aktuell erschienen ist die 172-seitige Fassung unter dem Titel "Health at a Glance - OECD Indicators 2005" zum Preis von 25 Euro.
Alle zwei Jahre veröffentlicht die OECD ausgewählte statistische Informationen über die wichtigsten Bereiche und Indikatoren des Gesundheitswesens ihrer 30 Mitgliedsländer. Aktuell erschienen ist die 172-seitige Fassung unter dem Titel "Health at a Glance - OECD Indicators 2005" zum Preis von 25 Euro.
Die Inhalte erstrecken sich von verschiedenen Indikatoren des Gesundheitszustands über Daten zu den Versorgungsressourcen und ihrer Nutzung bis hin zu den Gesundheitsausgaben und ihrer Finanzierung sowie zu Daten über die nichtmedizinischen Einflussfaktoren auf Gesundheit (z.B. Tabakkonsum, Übergewicht) und des demografischen und ökonomischen Kontext des Gesundheitswesens. Viele der Datenreihen reichen zurück bis ins Jahr 1960, sind grafisch aufbereitet und mit zahlreichen weiteren statistischen Angaben ergänzt.
Kostenlos erhältlich sind ein etwas ausführlicherer Überblick zu den Indikatoren und ein siebenseitiger Executive summary in englischer und französischer Sprache.
Bernard Braun, 28.11.2005
"Mythbusters" aus Kanada: Weniger Mythen und mehr Evidenz in der Gesundheitspolitik
 Eine gesundheitswissenschaftlich und -politisch hilfreiche und anregende Wissensquelle sprudelt auf der Website der 1997 zur Förderung evidenzbasierter Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen gegründeten "Canadian Health Services Research Foundation": "Mythbusters and Evidence Boost".
Eine gesundheitswissenschaftlich und -politisch hilfreiche und anregende Wissensquelle sprudelt auf der Website der 1997 zur Förderung evidenzbasierter Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen gegründeten "Canadian Health Services Research Foundation": "Mythbusters and Evidence Boost".
Seit dem Jahr 2000 ist dort die wissenschaftliche Evidenz von 16 Mythen oder öffentlich "akzeptierten Weisheiten" in kompakter und verständlicher Weise aufgearbeitet worden. Dabei ging es um spezifisch kanadische aber auch um international verbreitete Mythen. Die Themenpalette reicht entsprechend von "Canada has a communist-style healthcare system" über "Direct-to-consumer advertising is educational for patients", "Doctors do it for money", "Seeing a nurse practitioner instead of a doctor is second-class care" bis zu "The ageing population will overwhelm the healthcare system". Jeder der häufig auch knapp illustrierten Beiträge endet mit Verweisen auf die wichtigsten Forschungsveröffentlichungen.
Die im Jahr 2005 gestartete Serie "Evidence Boost" konzentriert sich auf die Analyse und Darstellung von Versorgungsangeboten und -konzepten, welche die Gesundheitsforschung eindeutig als erste Wahl für die praktische Gestaltung empfiehlt. Unter den bisher 3 Beiträgen findet sich z.B. eine wissenschaftliche Darstellung zu "Interdisciplinary teams in primary healthcare can effectively manage chronic illnesses". Auch hier endet jeder Beitrag mit Hinweisen auf die wichtigste Forschungsliteratur.
Bernard Braun, 12.10.2005
AgeLine: Englischsprachige Forschungsdatenbank zum Thema Alter und Altern
 Die American Association of Retired Persons (AARP), eine Organisation, die sich die Vertretung der Interessen sowie die Information der und über die Menschen ab 50 zur Aufgabe gemacht hat, bietet u.v.a. mit "AgeLine" eine umfangreiche Datenbank mit Abstracts und Volltexten aus der englischsprachigen sozialgerontologischen und anderer alters- und alternsbezogenen psychologischer, sozial- und gesundheitswissenschaftlicher Forschung an.
Die American Association of Retired Persons (AARP), eine Organisation, die sich die Vertretung der Interessen sowie die Information der und über die Menschen ab 50 zur Aufgabe gemacht hat, bietet u.v.a. mit "AgeLine" eine umfangreiche Datenbank mit Abstracts und Volltexten aus der englischsprachigen sozialgerontologischen und anderer alters- und alternsbezogenen psychologischer, sozial- und gesundheitswissenschaftlicher Forschung an.
Das Angebot speist sich aus Aufsätzen, Büchern, Dissertationen, Forschungsberichten und "grauer Literatur". Es richtet sich hauptsächlich an ExpertInnen, die sich beispielsweise intensiver mit dem Wissensstand zur Gesundheit, dem Recht oder der psychischen Gesundheit von älteren Menschen vertraut machen wollen. "AgeLine" beinhaltet aber auch ausgewählte Informationen für Konsumenten. 2005 sind rund 75.000 Einzelbeiträge erfasst, die alle 2 Monate um ca. 800 Einträge anwachsen. Die Beiträge entstammen im Moment rund 600 Journalen und Magazinen, die komplett seit 1978 und zum Teil sogar zurück bis 1966 ausgewertet werden.
Zum besseren Umgang mit "AgeLine" bietet die AARP außerdem einen gerade in der achten Auflage überarbeiteten 272-seitigen "Thesaurus of Aging Terminology" als Buch und kostenlos herunterladbare PDF-Datei an. Der Thesaurus hilft nicht nur bei der Orientierung in der Datenbank, sondern bietet auch prägnante englischsprachige Erklärungen und Umschreibungen der speziellen Alterns-Terminologie für Nicht-Muttersprachler an. Die aktuelle Ausgabe enthält 2.095 Hauptstichworte und fast 1.000 Literaturverweise.
Auf der AARP-Homepage finden sich ferner verschiedene Links auf statistische Quellen über das Altern und die Möglichkeit, einen Newsletter zu abonnieren.
Bernard Braun, 11.10.2005
Gesundheitsberichterstattung in den USA: Fundgrube "National Center for Health Statistics"
 Eine der umfassendsten und komfortabelsten Quellen für allgemeinpolitisch oder wissenschaftlich an detaillierten und mehrjährige Daten über die gesundheitliche Situation und Versorgung der us-amerikanischen Bevölkerung interessiert sind, stellt die Homepage des "National Center for Health Statistics" der USA dar. Dieses Center ist eines der "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) des "Departement of Health and Human Services".
Eine der umfassendsten und komfortabelsten Quellen für allgemeinpolitisch oder wissenschaftlich an detaillierten und mehrjährige Daten über die gesundheitliche Situation und Versorgung der us-amerikanischen Bevölkerung interessiert sind, stellt die Homepage des "National Center for Health Statistics" der USA dar. Dieses Center ist eines der "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) des "Departement of Health and Human Services".
Die Fülle der dort dokumentierten, verlinkten und erhältlichen Informationen ergibt sich grob aus der folgenden Passage der Selbstdarstellung des NCHS: "We use a variety of approaches to efficiently obtain information from the sources most able to provide information. We collect data from birth and death records, medical records, interview surveys, and through direct physical exams and laboratory testing. NCHS is a key element of our national public health infrastructure, providing important surveillance information that helps identify and address critical health problems."
Erhältlich ist an erster Stelle der jährliche, inhaltlich sehr differenzierte Gesundheitsbericht der USA (zuletzt: Health, United States 2004), der eine Fülle von Darstellungsformen (z. B. Chartbooks, interaktive Verknüpfungen, weiter auswertbare Daten-Tabellen) enthält. Wer die PDF-Gesamtdatei kostenlos herunterladen möchte, muss allerdings bei einem Volumen von 14,4 MB über einen schnellen Internetzugang verfügen. Sowohl der Gesundheitsbericht als auch viele andere Surveys sind meist auch für die letzten 5 bis 10 Jahre erhältlich oder es gibt zusammenfassende Auswertungen und Trendanalysen.
Eine ganze "family" von Survey- oder Gesundheitsverwaltungs-Daten verbirgt sich hinter der Bezeichung "National Health Care Survey". Dazu gehören vor allem der "National Ambulatory Medical Care Survey" (NAMCS), ein vergleichbarer Survey für die Krankenhausversorgung (NHAMCS), der "National Nursing Home Survey"(NNHS) oder der "National Employer Health Insurance Survey" (NEHIS).
Für den "National Health Interview Survey" (NHIS), eine seit über einem Jahrzehnt systematisch durchgeführte Bevölkerungsbefragung über alle Aspekte der Absicherung gegen Krankheitsrisiken und der selbstwahrgenommenen gesundheitlichen Situation liegen auch Fragebögen und Datensätze für eigene Auswertungen vor. Die Befragungsdaten sind vielfach als Public-Use Data Files im SPSS- und SAS-Format kostenlos herunterladbar, was aber ebenfalls eine entsprechende technische Kapazität erfordert. Inhaltlich, organisatorisch und finanziell könnten sich hier die Gesundheitsberichterstattungs-Institutionen in Deutschland wichtige Anregungen für gravierende Verbesserungen ihrer eigenen Informations-Angebote holen.
Für eine Fülle weiterer Fragen, zu denen es Daten, Informationen und Berichte gibt, existieren Links. So beispielsweise zum "National Health Interview Survey on Disability", zum für die gerade in den USA intensiv geführte Debatte über Übergewicht äußerst materialreichen "National Health and Nutrition Examination Survey" (NHANES) und schließlich auch zum für die Ausgabenseite des weltweit teuersten Gesundheitswesens interessanten "Medical Expenditure Panel Survey" der "Agency for Healthcare Research and Quality".
Schließlich kommt man über Links auch noch zu den häufig mit jeweils detaillierteren und spezifischeren Informationen bestückten Homepages weiterer staatlicher, professioneller oder verbandlicher Institutionen.
Für einen schnellen Überblick über die Existenz und Hauptergebnisse von Gesundheits-Surveys und einiger Strukturen im us-amerikanischen Gesundheitssystem eignet sich schließlich noch das Angebot so genannter "FASTSTATS A to Z".
Bernard Braun, 9.10.2005
Factline: Fakten zur Ungleichheit bei Gesundheitsrisiken und gesundheitlicher Versorgung in den USA
 Auch wenn der Anlass, die enorm ungleichen Erkrankungs- und Versorgungsrisiken in den USA, unerfreulich ist, so bemerkenswert und nachahmenswert ist die Existenz der von der "National Library of Medicine" und dem "Meharry Medical College" inhaltlich getragenen Website "Factline. Tracking Health in Underserved Communities".
Auch wenn der Anlass, die enorm ungleichen Erkrankungs- und Versorgungsrisiken in den USA, unerfreulich ist, so bemerkenswert und nachahmenswert ist die Existenz der von der "National Library of Medicine" und dem "Meharry Medical College" inhaltlich getragenen Website "Factline. Tracking Health in Underserved Communities".
Die Seite, die sich an Journalisten, Wissenschaftler, Studenten, Politiker, Gesundheitsjuristen und Gesundheitsarbeiter richtet, stellt bislang zu den Schwerpunkten der gesundheitlichen Ungleichheiten im Bereich Frauengesundheit, psychischer Gesundheit, Gesundheit von Minderheiten und dem Zugang zur Gesundheitsversorgung gesicherte und gut verständliche Ergebnisse der Public Health-Forschung und Literaturhinweise zusammen.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine Zeitschrift, die ebenfalls in die inhaltliche Konzeption dieser Homepage eingebunden war und ist: Das an der Johns Hopkins University erscheinende "Journal of Health Care for the Poor and Underserved".
Bernard Braun, 9.10.2005
Commonwealth Fund - Noch eine Fundgrube über das US-Gesundheitssystem
 Eine weitere Fundgrube für gesundheitswissenschaftlich oder -politisch am US-amerikanischen Gesundheitswesen Interessierte ist die Website des philantropisch oder sozialliberal orientierten Commonwealth Fund. Diese Stiftung wurde bereits 1918 von der typisch amerikanischen Stifterfamilie Hackness mit dem Ziel gegründet "to do something for the welfare of mankind." Gestützt auf weitere Familienstiftungen (u.a. 1986 durch die Eigentümerfamilie des gleichnamigen Gesundheitsforschungsinstituts Picker) führt die Stiftung heute in den USA regelmäßig eigene Befragungs-Surveys (z.B. Survey of Older Adults) und Studien zur Situation der gesundheitlichen Versorgung (z.B. das kompakte aber sehr informative Chartbook on Medicare Quality) durch, fördert derartige Studien und verbreitet Forschungsergebnisse und Dokumente von Untersuchungen anderer Einrichtungen, die ins inhaltliche Programm der Stiftung passen.
Eine weitere Fundgrube für gesundheitswissenschaftlich oder -politisch am US-amerikanischen Gesundheitswesen Interessierte ist die Website des philantropisch oder sozialliberal orientierten Commonwealth Fund. Diese Stiftung wurde bereits 1918 von der typisch amerikanischen Stifterfamilie Hackness mit dem Ziel gegründet "to do something for the welfare of mankind." Gestützt auf weitere Familienstiftungen (u.a. 1986 durch die Eigentümerfamilie des gleichnamigen Gesundheitsforschungsinstituts Picker) führt die Stiftung heute in den USA regelmäßig eigene Befragungs-Surveys (z.B. Survey of Older Adults) und Studien zur Situation der gesundheitlichen Versorgung (z.B. das kompakte aber sehr informative Chartbook on Medicare Quality) durch, fördert derartige Studien und verbreitet Forschungsergebnisse und Dokumente von Untersuchungen anderer Einrichtungen, die ins inhaltliche Programm der Stiftung passen.
Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf der Situation der nicht Krankenversicherten in den USA, der Entwicklung von Medicare, der Qualitätsverbesserung, der Gesundheitsversorgung von ethnischen Minderheiten, Alten und Kindern. Dieses Angebot wird durch internationale Vergleiche von Versicherungs- und Versorgungsstrukturen im Gesundheitsbereich (Australien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada) abgerundet.
Neben den meist als PDF-Dateien verfügbaren Forschungsberichten und Chartbooks verschickt der Fund auch einen kostenlosen Newsletter zur Gesundheitspolitikforschung und einen Bericht über die "Washington Health Policy Week in Review".
Hier finden Sie den Zugang zur Website des Commonwealth Fund
Bernard Braun, 8.8.2005
Kaiser Family Foundation - Fundgrube zum Gesundheitswesen der USA
 Egal ob man etwas über die aktuelle gesundheitliche Lage und Versorgung der Indianer, die Anzahl der unzulänglich krankenversicherten Kinder, die Qualität der Krankenhausversorgung oder die Leistungsfähigkeit und Zukunft von Medicare und Medicaid in den USA wissen will: Das Informationsangebot auf der Website der "Henry J. Kaiser Family Foundation (KFF)" hilft garantiert weiter.
Egal ob man etwas über die aktuelle gesundheitliche Lage und Versorgung der Indianer, die Anzahl der unzulänglich krankenversicherten Kinder, die Qualität der Krankenhausversorgung oder die Leistungsfähigkeit und Zukunft von Medicare und Medicaid in den USA wissen will: Das Informationsangebot auf der Website der "Henry J. Kaiser Family Foundation (KFF)" hilft garantiert weiter.
Die Stiftung beschreibt sich selber als "a non-profit, private operating foundation focusing on the major health care issues facing the nation. The Foundation is an independent voice and source of facts and analysis for policymakers, the media, the health care community, and the general public. KFF develops and runs its own research and communications programs, often in partnership with outside organizations. The Foundation contracts with a wide range of outside individuals and organizations through its programs. Through our policy research and communications programs, we work to provide reliable information in a health system in which the issues are increasingly complex and the nation faces difficult challenges and choices. The Foundation is not associated with Kaiser Permanente or Kaiser Industries."
Die Stiftung gehört zu der Handvoll vergleichbarer liberaler oder zivilgesellschaftlicher Einrichtungen (z.B. Commonwealth Fund), die massiv auf die vielfachen Ungleichheiten des us-amerikanischen Sozial- und Gesundheitssystems hinweisen und auf Abhilfe drängen. Dazu gehört auch ihr entschiedenes Plädoyer und ihre vielfältigen Überlegungen, die öffentlichen Gesundheitsprogramme Medicare und Medicaid zu stärken und gegen die vielfältigen Vorstellungen (zuletzt auch der Bush-Administration) zu verteidigen, sie als "sozialistische" Restbestände zu privatisieren.
Über einen der zahlreichen Links, "Kaisernetwork.org", kann man sich z.B. kostenlos täglich erscheinende Nachrichtensammlungen aus Politik und Wissenschaft zur US-Gesundheitspolitik im allgemeinen, zu HIV/Aids oder "Reproductive Health" bestellen. Darüber hinaus werden regelmäßig Videoaufzeichungen wichtiger gesundheitspolitischer Debatten oder deren Transkripte angeboten. Hinzu kommen direkte Zugänge zu demoskopischen Datensammlungen, Surveys (z.B. Woman Health Care, Long-Term Care, Employer Health Benefits Annual Survey) und materialreichen Chartbooks (z.B. Medicare Chartbook).
Hier finden Sie Zugang zur Informations-/Materialwelt der KFF
Bernard Braun, 4.8.2005
Health Policy Monitor: Was passiert gesundheitspolitisch in 20 Ländern?
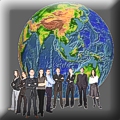 Gesundheitspolitische Konzepte und Modelle in vergleichbaren Ländern inner- und außerhalb Europas spielten und spielen eine gewisse Rolle in der deutschen Gesundheitspolitik. Äußerliches Indiz ist das immer häufigere Auftauchen von Disease und Case Management Programmen, Total Quality-Strategien, DRG-Systemen oder Managed Care-Orientierungen im deutschen Gesundheitswesen. Was das meint, welche Erfahrungen damit in den jeweiligen Herkunftsländern gemacht wurden und werden und welche Reformen im Finanzierungs- und Versorgungsbereich dort sonst noch verfolgt werden, trägt seit 2002 der von der Bertelsmann Stiftung initierte und mitgetragene "Health Policy Monitor (HPM)" für derzeit 20 Länder (u.a. Australien, Finnland, Singapore, Slowenien, United Kingdom, USA) zusammen. Zu finden sind dort u.a. auch die Berichte des WHO-getragenen "European Observatory"-Projekts "Health care systems in transition (HiT) profile" für diese Länder.
Gesundheitspolitische Konzepte und Modelle in vergleichbaren Ländern inner- und außerhalb Europas spielten und spielen eine gewisse Rolle in der deutschen Gesundheitspolitik. Äußerliches Indiz ist das immer häufigere Auftauchen von Disease und Case Management Programmen, Total Quality-Strategien, DRG-Systemen oder Managed Care-Orientierungen im deutschen Gesundheitswesen. Was das meint, welche Erfahrungen damit in den jeweiligen Herkunftsländern gemacht wurden und werden und welche Reformen im Finanzierungs- und Versorgungsbereich dort sonst noch verfolgt werden, trägt seit 2002 der von der Bertelsmann Stiftung initierte und mitgetragene "Health Policy Monitor (HPM)" für derzeit 20 Länder (u.a. Australien, Finnland, Singapore, Slowenien, United Kingdom, USA) zusammen. Zu finden sind dort u.a. auch die Berichte des WHO-getragenen "European Observatory"-Projekts "Health care systems in transition (HiT) profile" für diese Länder.
Das Hauptaugenmerk der online und zum Teil auch in gedruckter Buchform zugänglichen Dokumentationen liegt auf der Darstellung politischer Reformen von der Idee über die Details der Implementation bis zum tatsächlichen Wandel. Dabei wird der Darstellung der verschiedenen politischen Akteuren und ihren Interaktionen, also dem Prozess des "policy making", großer Raum eingeräumt. Anfang 2007 können 500 Berichte heruntergeladen werden.
Interessant sind auch die halbjährlich erscheinenden Reports "Gesundheitspolitik in Industrieländern", die zu einer aufgeklärt kritischen Fundierung der nationalen Gesundheitspolitiken und zur Verbreitung von "models of good practices" beitragen sollen. Der Anfang 2007 zuletzt erschienene 6. deutsche Band beschäftigt sich beispielsweise mit der Evaluationskultur und -praxis in den Monitorländern: "Im Mittelpunkt steht diesmal ein überfälliges, in Deutschland oft immer noch negativ besetztes Thema: Evaluation und Evaluationskultur. Wir wollen deutlich machen, wie es anderswo ganz selbstverständlich gelingt, Evaluation nicht als Kontrolle, sondern als Instrument für Qualitätsverbesserung, Coaching und professionelle Unterstützung durch Dokumentation und Feedback einzusetzen."
Hier findet sich der Zugang zum "Health Policy Monitor".
Bernard Braun, 31.7.2005
European Observatory der WHO: Gesundheitssysteme im Wandel
 Eine wichtige Informationsquelle über die Vielfalt der Gesundheitssystem-Strukturen und die gesundheitspolitischen Veränderungen in zahlreichen überwiegend europäischen Ländern (mit Ausnahmen wie z.B. Neuseeland oder Kasachstan) von Albanien bis Usbekistan stellt der "European Obervatory on Health Systems and Policies" dar. Das vom Regionalbüro für Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO), einer Reihe europäischer Regierungen, der Weltbank, der London School of Economics and Political Science (LSE) und der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) gemeinsam getragene Projekt möchte mit seinen verschiedenen Informationsangeboten und Analysen eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik fördern und unterstützen.
Eine wichtige Informationsquelle über die Vielfalt der Gesundheitssystem-Strukturen und die gesundheitspolitischen Veränderungen in zahlreichen überwiegend europäischen Ländern (mit Ausnahmen wie z.B. Neuseeland oder Kasachstan) von Albanien bis Usbekistan stellt der "European Obervatory on Health Systems and Policies" dar. Das vom Regionalbüro für Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO), einer Reihe europäischer Regierungen, der Weltbank, der London School of Economics and Political Science (LSE) und der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) gemeinsam getragene Projekt möchte mit seinen verschiedenen Informationsangeboten und Analysen eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik fördern und unterstützen.
Dies macht es vor allem durch umfangreiche als PDF-Dateien herunterladbare Analysen (durchweg in englischer Sprache, tlw. aber auch in der Sprache der dargestellten Länder) über die gesundheitspolitischen Veränderungen in den genannten Ländern, den so genannten "Health care systems in transition (HiT)"-Berichten. Hinzu kommt ein umfangreiches Glossar, in dem sich z.B. eine Erklärung finden lässt, was ein "Semashko System" ist oder die Abkürzung "DALY" meint. Darüber hinaus sind diverse WHO-Forschungsberichte z.B. über die jüngere Krankenhausentwicklung in Osteuropa zugänglich.
Hier finden Sie Länderberichte und Glossar
Bernard Braun, 31.7.2005
OECD Gesundheitsdaten
 Zentrale Gesundheits-Indikatoren aus rund 30 OECD-Ländern, von Australien und Kanada bis hin zu Japan, den USA und den meisten europäischen Ländern sind hier in der Datenbank verfügbar, oft in Zeitreihen von 1960 bis heute. Der gesamte Report mit sämtlichen Indikatoren ist kostenpflichtig und wird online nicht angeboten, wohl aber insgesamt 15 Tabellen, die als Excel-Dateien heruntergeladen werden können. Diese Seiten "OECD Health Data 2005 - Frequently Requested Data" bieten Zeitreihen zu folgenden Gesundheits-Indikatoren an:
Zentrale Gesundheits-Indikatoren aus rund 30 OECD-Ländern, von Australien und Kanada bis hin zu Japan, den USA und den meisten europäischen Ländern sind hier in der Datenbank verfügbar, oft in Zeitreihen von 1960 bis heute. Der gesamte Report mit sämtlichen Indikatoren ist kostenpflichtig und wird online nicht angeboten, wohl aber insgesamt 15 Tabellen, die als Excel-Dateien heruntergeladen werden können. Diese Seiten "OECD Health Data 2005 - Frequently Requested Data" bieten Zeitreihen zu folgenden Gesundheits-Indikatoren an:
Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Tabakkonsum, Alkoholkonsum, Übergewicht, Gesundheitsausgaben (in Prozent des BSP), Gesundheitsausgaben pro Kopf, Wachstumsrate der Gesundheitsausgaben, Ausgaben für Medikamente, Öfentliche Gesundheitsausgaben, niedergelassene Ärzte, praktizierende Krankenschwestern, Zahl der Krankenhausbetten in der Akutversorgung, Magnetresonanztomographen (je 1 Mio Einwohner), Computertomographen (je 1 Mio Einwohner).
Hier findet man die OECD Health Data 2009 - Frequently Requested Data
Gerd Marstedt, 24.7.2005