



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Gesundheit und Krankheit in den Medien |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Gesundheit und Krankheit in den Medien
Rund ein Viertel der englischsprachigen You tube-Videos über Covid-19 sind fehlerhaft oder irreführend
 In der Debatte über die komplexen Ursachen, den Verlauf und die Bekämpfung von Covid-19 spielen zunehmend komplett oder teilweise falsche Informationen und/oder Verschwörungstheorien eine gewisse Rolle. Erklärt wird dies häufig pauschal mit Veröffentlichungen in den sozialen Medien. Wie viele der dort veröffentlichten Beiträge nachweisbar fehlerhafte oder tendenzöse Aussagen, Behauptungen etc. enthalten und wie viele Menschen diese überhaupt gelesen oder angesehen haben, erfährt man dann aber eher selten.
In der Debatte über die komplexen Ursachen, den Verlauf und die Bekämpfung von Covid-19 spielen zunehmend komplett oder teilweise falsche Informationen und/oder Verschwörungstheorien eine gewisse Rolle. Erklärt wird dies häufig pauschal mit Veröffentlichungen in den sozialen Medien. Wie viele der dort veröffentlichten Beiträge nachweisbar fehlerhafte oder tendenzöse Aussagen, Behauptungen etc. enthalten und wie viele Menschen diese überhaupt gelesen oder angesehen haben, erfährt man dann aber eher selten.
Eine Studie kanadischer Wissenschaftler*innen beendet diese Unkenntnis nun für einen Teil der Covid-19-bezogenen Beiträge in sozialen Medien.
Untersucht wurden You tube-Videos, in englischer Sprache, die am 21. März 2020 zugänglich waren und nicht länger als eine Stunde dauerten. Nach ein paar Selektionsschritten gingen 69 Beiträge in die qualitative Bewertung ein.
Bewertet wurden sie mit drei bereits in früheren Epidemie- und Pandemiesituationen validierten und erprobten und für diese Studie leicht modifizierten Instrumente und Messwerten (DISCERN, JAMA und "COVID-19 specific score (CSS)"). Das CSS-Instrument identifizierte Aussagen wie, dass Pharmaunternehmen bereits über ein Heilmittel verfügten, sich aber weigerten es zu verkaufen und dass es länderunterschiedliche Viren gäbe. Ferner suchte CSS nach unangemessenen Empfehlungen für die Öffentlichkeit, rassistischen oder diskriminierenden Bemerkungen und nach verschwörungstheoretischen Thesen.
Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse lauten:
• Die 69 Videos wurden bis zum 21. März von 257.804.146 Personen bzw. so oft angesehen (evtl. Mehrfach-Zuschauer).
• 72,5% der Videos enthielten nur sachlich stimmende Informationen.
• 27,5% oder 19 Videos enthielten falsche, unkorrekte oder in die Irre führende Informationen. Angeschaut hatten diese Videos 62.042.609 Personen. Dies sind durchschnittlich bis über drei Millionen Zuschauer pro Video. Nutzer*innenzahlen und damit mögliche Wirkungen von denen Verfasser*innen von Fachartikeln in Printmedien und vieler Fernsehsendungen nur träumen können.
Die Autor*innen verweisen wohl zu recht auf zwei wichtige Schlussfolgerungen für eine sachlich korrekte Risikokommunikation:
• "Many existing marketing strategies are static, in the form of published guidelines, statistical reports and infographics and may not be as appealing or accessible to the general public."
• "YouTube is a powerful, untapped educational tool that should be better mobilised by health professionals."
Auch wenn es keine oder keine bekannte vergleichbare Studie über deutschsprachige You tube-Videos gibt, ist nicht auszuschließen, dass unter ihnen nicht ähnlich viel falsch informierende Beiträge existieren.
Die Studie YouTube as a source of information on COVID-19: a pandemic of misinformation? von Heidi Oi-Yee Li, Adrian Bailey, David Huynh und James Chan ist am 13. Mai 2020 in der Zeitschrift "BMJ Global Health" (5 (5): e002604) erschienen und komplett kostenlos zugänglich. Angaben zu den Kriterien der Scores finden sich in einem ebenfalls frei zugänglichen Anhang zum Aufsatz.
Bernard Braun, 15.5.20
Vorsicht Studie oder wissenschaftliche Standards und Fakten- statt Fake-Berichterstattung im Covid-19-Corona-Ausnahmezustand
 Neben allen gesundheitlichen und gesundheitspolitischen Herausforderungen durch Sars-CoV-2 und Covid-19 ist die aktuelle Pandemie auch eine Herausforderung an die Wissenschaft und den Umgang mit ihren Ergebnissen in den Medien und in der handlungssuchenden und -begründenden öffentlichen Kommunikation. Dabei erzeugt der von der extrem dynamischen Pandemieentwicklung erzeugte Druck zur Abwendung weiterer Gefahren schnellstmöglich über möglichst große Transparenz und realistische wie evidente Lösungsmöglichkeiten zu verfügen einen einmaligen Druck auf Forscher*innen wie mediale Akteur*innen. Die Folge ist eine in diesem Forum Sars-CoV-2 und Covid-19: Anmerkungen zur aktuellen Krise und was lernen wir daraus?! bereits dargestellte ebenfalls exponentiell verlaufende Wissens- und Informations-Pandemie aber auch die rasche Zunahme widersprüchlicher oder methodisch fragwürdiger Forschungsergebnisse und Berichte, die oft eine Halbwertszeit von weniger als einem Tag oder einer Woche haben. Gleichzeitig wird die Kette nicht bearbeiteter Fragen oder schlichtweg fehlender Daten (z.B. immer noch die Anzahl der durchgeführten Tests oder die diversen Dunkelziffern) eher länger.
Neben allen gesundheitlichen und gesundheitspolitischen Herausforderungen durch Sars-CoV-2 und Covid-19 ist die aktuelle Pandemie auch eine Herausforderung an die Wissenschaft und den Umgang mit ihren Ergebnissen in den Medien und in der handlungssuchenden und -begründenden öffentlichen Kommunikation. Dabei erzeugt der von der extrem dynamischen Pandemieentwicklung erzeugte Druck zur Abwendung weiterer Gefahren schnellstmöglich über möglichst große Transparenz und realistische wie evidente Lösungsmöglichkeiten zu verfügen einen einmaligen Druck auf Forscher*innen wie mediale Akteur*innen. Die Folge ist eine in diesem Forum Sars-CoV-2 und Covid-19: Anmerkungen zur aktuellen Krise und was lernen wir daraus?! bereits dargestellte ebenfalls exponentiell verlaufende Wissens- und Informations-Pandemie aber auch die rasche Zunahme widersprüchlicher oder methodisch fragwürdiger Forschungsergebnisse und Berichte, die oft eine Halbwertszeit von weniger als einem Tag oder einer Woche haben. Gleichzeitig wird die Kette nicht bearbeiteter Fragen oder schlichtweg fehlender Daten (z.B. immer noch die Anzahl der durchgeführten Tests oder die diversen Dunkelziffern) eher länger.
Damit, was die Beschleunigung von Wissenschaft oder die anwachsende Flut von Publikationen über so genannte Preprint-Server für die Produktion wissenschaftlich gesicherten Wissens bedeutet beschäftigte sich jetzt systematisch ein Beitrag in der Aprilausgabe 2020 der Fachzeitschrift "Science". Da Wissenschaft und ihre Ergebnisse gerade in der Corona-Krise auch viel mit den Publikationen von Massenmedien zu tun hat, kommentieren diesen Aufsatz auf der Website des "Science Media Center (SMC)" 11 in der Expertendatenbank von SMC eingetragene (weitere Expert*innen zu wichtigen Themen können sich dort melden und eintragen) deutsche und internationale Wissenschaftler*innen unterschiedlichster Fachrichtungen (u.a. Thomas Hartung, Direktor des Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Alena Buyx, Professorin für Medizinethik und Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin, Technische Universität München, Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)). Der Zugang zum am 23.4.2020 veröffentlichten Beitrag Qualität von Forschung und Publikationen zu COVID-19 - wie sichern wir sie? ist kostenlos.
Das SMC "hilft Journalisten bei der Berichterstattung" d. h. beim "Wie und wo schnell verlässliches Fachwissen finden? Woher aussagefähige und aussagewillige Experten für Zitate oder Zusatzinformationen nehmen? Wie zu emotional geführten Debatten rationale Argumente und verifizierte Fakten beisteuern?".
In dem kommentierten Aufsatz lassen die beiden nordamerikanischen Medizinethiker A. London und J. Kimmelman sehr klar erkennen was ihr Anliegen im Zeichen des skizzierten Drucks in der Coronakrise ist. So fordern sie bereits in der Überschrift sich als Forscher*innen gegen den durch die Pandemie erzeugten Ausnahmezustand ("Against pandemic research exceptionalism") zu stemmen. Und ohne viele Worte lautet ihre Kernaussage: "Crises are no excuse for lowering scientific standards." Der Aufsatz Against pandemic research exceptionalism ist am 23. April 2020 in der Wissenschaftszeitschrift "Science" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Die Autoren warnen vor drei Begründungen bzw. Ausreden für die Vernachlässigung wissenschaftlicher Standards: fehlerbehaftete Studien seien besser als gar keine, wissenschaftliche Sorgfalt stünde ärztlichen Pflichten im Weg und Wissenschaft sei gegenüber der Gesellschaft nicht verpflichtet bestimmte Qualitätsstandards zu erfüllen.
Die nicht nur in Krisenzeiten und besonders nicht während einer derartigen Pandemie ihres Erachtens von Wissenschaftlern, Forschungsförderern und Forschungsnutzern zu beachtenden fünf Qualitätsstandards lauten:
• "The first is importance. Trials should address key evidence gaps.
• The second component is rigorous design. Trials should be designed to detect clinically meaningful effects so that both positive and negative results serve the informational needs of clinicians and health systems.
• The third component is analytical integrity. Designs should be prespecified in protocols, prospectively registered, and analyzed in accordance with prespecification.
• Fourth, trials should be reported completely, promptly, and consistently with prespecified analyses.
• The fifth component is feasibility: Studies must have a credible prospect of reaching their recruitment target and be-ing completed within a time frame where the evidence is still actionable."
Die prinzipiell zu begrüßende Situation, dass derzeit zahlreiche wissenschaftliche Publikationen über Sars-CoV-2 und Covid-19 im Rahmen der "open access"-Politik der wichtigsten Verlage und Zeitschriften für alle Interessierten frei zugänglich sind, kommt es noch mehr darauf an, dass dabei nicht das Vertrauen in die Validität wissenschaftlicher Studien verspielt wird.
Wie groß dieses Vertrauen in Deutschland zur Zeit noch ist, zeigen die wesentlichen Ergebnisse einer Corona-Sonderausgabe des Wissenschaftsbarometers der Initiative "Wissenschaft im Dialog".
Sie lauten:
• "Fast drei Viertel der Befragten geben an, eher oder voll und ganz in Wissenschaft und Forschung zu vertrauen. In den vergangenen Jahren erklärte dies rund die Hälfte der Befragten."
• Über 70 Prozent der Befragten sagen sie vertrauten den Aussagen von Wissenschaftlern zu Corona eher oder voll und ganz.
• "89 Prozent sind der Meinung, dass wissenschaftliches Wissen wichtig ist, um die Corona-Pandemie in Deutschland zu verlangsamen. 61 Prozent rechnen damit, dass es Forschenden in absehbarer Zeit gelingen wird, einen Impfstoff oder ein Medikament zu entwickeln.
• Ein gutes Drittel der Befragten ist der Meinung, dass das Coronavirus derzeit von Wissenschaft und Forschung noch gar nicht richtig verstanden wird.
• Politische Entscheidungen im Umgang mit Corona sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen: 81 Prozent der Befragten stimmen dieser Aussage eher oder voll und ganz zu. Bei der Frage, ob Wissenschaftler sich selbst in die Politik einmischen sollten, liefert das Wissenschaftsbarometer Corona Spezial ein gemischtes Stimmungsbild: 39 Prozent sehen dies als Aufgabe der Wissenschaft, 26 Prozent sind unentschieden und 32 Prozent der Befragten sagen, dass sich Wissenschaftler nicht in die Politik einmischen sollten.
• Wichtigste Informationsquelle: die klassischen Medien."
In einer Subgruppenanalyse zeigen sich aber auch eine Reihe von Unterschieden, die evtl. bei der Art und Weise der Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen berücksichtigt werden sollten. So vertrauen beispielsweise 83% der Befragten mit Abitur oder Hochschulabschluss Wissenschaft und Forschung "voll und ganz" oder "eher", während dies "nur" 62% der Befragten mit Volks- und Hauptschulabschluss tun.
Die Ergebnisse stammen aus Mitte April 2020 durchgeführten 1.009 Telefoninterviews mit über 14-jährigen deutschsprachigen Personen aus Privathaushalten.
Nachtrag zur Forschungsfülle: Am 1. Mai 2020 waren im Covid-19-Studienregister der für ihre hohen Qualitätsstandards angesehenen Cochrane Collaboration ("Cochrane's COVID-19 Study Register is a freely-available, continually-updated, annotated reference collection of human studies on COVID-19, including interventional, observational, diagnostic, prognostic, epidemiological, and economic designs. Please note: the register will not include in-vitro study references. Qualitative studies are currently under evaluation. The aim of the register is to support rapid evidence synthesis") 2.903 Studien registriert und mit Links versehen. Tendenz: mehrere hundert neue Studien pro Woche.
Bernard Braun, 1.5.20
Wie die Familie Sackler trotz der Mitverantwortung für 300.000 Tote noch lange als Kultursponsor und Philantrop geschätzt wurde.
 Die selbst in der Vergangenheit extrem medikamenten-und heroinabhängige Künstlerin Nan Goldin und einige andere KünstlerInnen machen seit Anfang 2019 zumindest auf den Feuilletonseiten dadurch Schlagzeilen, dass sie Museen und anderen Kunsteinrichtungen (z.B. dem Guggenheim Museum in New York oder der National Portait Gallery in London) mit Boykott drohen, wenn sie nicht auf die Millionen Dollar oder Pfund schwere Förderung durch die Familie Sackler aus den USA verzichten. Diese Familie gehört seit langem zu den weltweit größten und vielfach gewürdigten Sponsoren zahlreicher Museen und Universitätseinrichtungen, sodass es bis heute u.a. einen Sackler-Flügel im Metropolitan Museum of Art in New York, eine Sackler-Bibliothek an der Universität Oxford und ausgerechnet eine Sackler-Medizinfakultät an der Universität Tel Aviv gibt.
Die selbst in der Vergangenheit extrem medikamenten-und heroinabhängige Künstlerin Nan Goldin und einige andere KünstlerInnen machen seit Anfang 2019 zumindest auf den Feuilletonseiten dadurch Schlagzeilen, dass sie Museen und anderen Kunsteinrichtungen (z.B. dem Guggenheim Museum in New York oder der National Portait Gallery in London) mit Boykott drohen, wenn sie nicht auf die Millionen Dollar oder Pfund schwere Förderung durch die Familie Sackler aus den USA verzichten. Diese Familie gehört seit langem zu den weltweit größten und vielfach gewürdigten Sponsoren zahlreicher Museen und Universitätseinrichtungen, sodass es bis heute u.a. einen Sackler-Flügel im Metropolitan Museum of Art in New York, eine Sackler-Bibliothek an der Universität Oxford und ausgerechnet eine Sackler-Medizinfakultät an der Universität Tel Aviv gibt.
Das Geld, das die überwiegend aus Ärzten bestehende Familie verteilte, stammt nicht aus erfolgreicher hausärztlicher Tätigkeit oder vergleichbaren Tätigkeiten, sondern aus den Milliarden-Gewinnen der dieser Familie mehrheitlich gehörenden US-Pharmafirma Purdue Pharma. Auf den ersten Blick würde aber noch nicht die aktuellen Boykotte rechtfertigen.
Diese stützen sich vielmehr darauf, dass diese Firma und persönlich ihre Eigentümer bewusst und zum Teil vorsätzlich die Herstellung und aktive sowie über die Risiken der Verordnung hinwegtäuschende Vermarktung des morphiumähnlichen Schmerzmedikaments Oxycontin zu verantworten haben. Dabei nahmen sie die Abhängigkeit von Millionen von Menschen und den Tod von zig- oder gar hunderttausenden von Menschen billigend in Kauf und verdienten damit Milliarden von US-Dollars.
Die Geschichte dieses Pharmaskandals hat in zweierlei Hinsicht gesundheitspolitischen und -wissenschaftlichen Lehrstückcharakter:
• Egal, ob es um die Herstellung und den Vertrieb verschleißträchtiger Silikon-Brustimplantate oder nebenwirkungsmächtiger Arzneimittel geht, wird die kritische öffentliche Debatte oft durch das Stereotyp des "grundbösen" profitgierigen Unternehmens oder Unternehmers geprägt. Dies ist eine Art Fortsetzung des in den 60-er und 70-er Jahren weit verbreiteten Bildes vom dickbäuchigen, zigarrerauchenden, melonetragenden kurz völlig unsympathischen Kapitalisten. Undenkbar, dass solche "Typen" gleichzeitig kulturfördernde und weltweit angesehene Philantropen sind. Aber genau dies waren im Lichte der Öffentlichkeit die Mitglieder der Familie Sackler trotz aller langsam bekannt gewordenen Details ihrer Unternehmertätigkeit über viele Jahre. Sie passten einfach nicht in das Bild des "bösen" Unternehmens oder Unternehmers, was u.a. dazu beitrug, dass ihr eigentliches Image von niemand aktiv wahrgenommen wurde und fast niemand störte, also nicht zu Boykotten und anderen Maßnahmen führte. Und dies selbst dann als der US-Präsident Trump bereits im August 2017 wegen der u.a. durch Oxycontin in den USA verursachten Opioid-Epidemie den nationalen Notstand ausrief.
• Die Firma steht mittlerweile wegen der Vermarktung ihres Medikaments vielfach vor Gericht und muss in den USA Strafen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollars bezahlen. Für die Debatte über die Kommunikation gesundheitlich riskanter Mittel und Maßnahmen stellt sich aber die Frage warum es erst 10 bis 20 Jahren nach den ersten wissenschaftlichen Aufsätzen zu den Risiken von Oyxcontin und vergleichbaren Medikamenten (vgl. unter zahlreichen anderen den 2009 erschienenen Aufsatz The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy von Ard van Zee in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" (Februar 2009; 99(2): 221-227 und die dort zitierten weiteren Veröffentlichungen seit Ende der 1990er Jahre) und komplett kostenlos erhältlich), fast zwei Jahre nach Trumps Notstandserklärung (welche wirksamen Maßnahmen diese nach sich zog steht auf einem anderen Blatt), nach schätzungsweise 300.000 durch dieses Medikament mitbewirkten Toten in den USA und vollständiger und verständlicher journalistischer Darstellungen der durch Oxycontin verursachten und befeuerten Gesundheitsgefahren weltweit zu zivilgesellschaftlichen Reaktionen wie den eingangs geschilderten gegen die Hauptverantwortlichen kam. Verglichen mit dem bei wesentlich geringeren gesundheitsbezogenen unerwünschten Ereignissen in Sekundenschnelle aufziehenden Shitstorm in den so genannten sozialen Medien, handelt es sich, wenn es um die Sacklers und Oxycontin geht, höchstens um ein laues Lüftchen. Hinzu kommt in den Worten der Künstlerin Nan Goldin noch das: "Ich würde diese Nachricht (von der ersten kostenträchtigen Verurteilung im US-Bundesstaat Oklahoma - bb) begrüßen, wenn das Geld als Reparationen an die Menschen ginge, deren Leben die Sackler-Familie zerstört hat. 300.000 Menschen in diesem Land sind tot. (Die Familie) sollte in irgendeiner Weise für den Schaden aufkommen, den sie angerichtet hat." Trotz aller Opioid-Krisendebatte gibt es vor allem in den USA auch noch kaum regulative Maßnahmen gegen eine mögliche Wiederholung einer derartig "gelungenen" Vermarktung eines Medikaments.
Wer genauer wissen will, um was es geht und was einer kritischen Öffentlichkeit spätestens seit Herbst 2017 zugänglich war, kann dies mit zwei komplett kostenlos erhältlichen Texten tun.
Dies ist erstens der am 30. Oktober 2017 in der us-amerikanischen Zeitschrift "New Yorker" veröffentlichte brilliant recherchierte und sehr gut wie verständlich verfasste und an keiner Stelle widersprochene Essay The Family That Built an Empire of Pain. The Sackler dynasty's ruthless marketing of painkillers has generated billions of dollars—and millions of addicts. von Patrick Radden Keefe.
Zweitens ist dies der am 8. November 2018 in der britischen Tageszeitung "The Guardian" veröffentlichte Artikel The making of an opioid epidemic. When high doses of painkillers led to widespread addiction, it was called one of the biggest mistakes in modern medicine. But this was no accident. von Chris McGreal. Wer es lieber hören will, kann dies auch mit einem 27-Minuten-Podcast tun.
Bernard Braun, 29.3.19
Wie Massenmedien die Wahrnehmung von Erkrankten verzerren und spezifische Behandlungsangebote behindern - Beispiel Krebs in Irland
 Die Berichterstattung von Massenmedien spielt für die Wahrnehmung von Krankheiten, ja sogar teilweise bei ihrer "Entstehung" (so wurde der Anstieg von Patienten, welche wegen der Symptome der Krankheiten über die am Tag zuvor in dem in den 1960er bis 1980er Jahren populären ZDF-Gesundheitsmagazin Praxis berichtet wurde, nach dem Moderator "Morbus Mohl" genannt) und die Vorstellung von der Art von Erkrankungen und Erkrankten in der Öffentlichkeit eine große Rolle.
Die Berichterstattung von Massenmedien spielt für die Wahrnehmung von Krankheiten, ja sogar teilweise bei ihrer "Entstehung" (so wurde der Anstieg von Patienten, welche wegen der Symptome der Krankheiten über die am Tag zuvor in dem in den 1960er bis 1980er Jahren populären ZDF-Gesundheitsmagazin Praxis berichtet wurde, nach dem Moderator "Morbus Mohl" genannt) und die Vorstellung von der Art von Erkrankungen und Erkrankten in der Öffentlichkeit eine große Rolle.
Dass dies auch zu gravierenden Fehlwahrnehmungen führen kann, zeigt jetzt exemplarisch eine kleine Studie in Irland.
Es geht dabei um die auch in Irland häufigen und zunehmenden Krebserkrankungen. 70% der an Krebs erkrankten Personen sind 65 Jahre und älter. Trotz der damit verbundenen altersspezifischen Versorgungsbedürfnisse mangelt es auf der grünen Insel an speziellen geronto-onkologischen Versorgungsangeboten.
Zwei irische Gesundheitswissenschaftlern vermuteten, dass dies mit der dominanten Medienberichterstattung über Krebs als Erkrankung junger Menschen zusammenhängen könnte.
Um diese Hypothese zu überprüfen analysierten die Wissenschaftler die Berichterstattung zweier großer irischer Printmedien über Krebserkrankungen und -erkrankte im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2014 und Oktober 2015.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• In den insgesamt 167 gefundenen Artikeln gibt es Darstellung von an Krebs erkrankten Personen. Davon spezifizierten 48 das Alter der Patienten.
• Das durchschnittliche Alter der Erkrankten war 44,74 Jahre und das durchschnittliche Alter bei der Diagnose 39,87 Jahre.
• Vergleicht man dies mit dem in der Gesamtheit der Erkrankten bei durchschnittlich 67 Jahren liegenden Alter bei der Diagnose einer Krebserkrankung, sind die Erkrankten über die in den untersuchten Zeitungen berichtet wurde rund 27 Jahre jünger.
Wenn es eine Wirkung medialer Berichterstattung auf die Perzeption von Erkrankungen und Erkrankten gibt, könnte also der Mangel an speziellen geronto-onkologischen Leistungen zumindest teilweise auf dieser Art von verzerrter Darstellung (die Autoren sprechen sogar von "ageism") beruhen.
Ob es solche medialen Verzerrungen mit möglichen Folgen für die Thematisierung von Krankheiten und von spezifischen Angeboten auch z.B. in Deutschland gibt, könnte relativ leicht untersucht werden. Solche Untersuchungen könnten neben dem Merkmal Alter natürlich auch noch andere Inhalte der Berichterstattung miteinbeziehen. So gibt es z.B. Hinweise, dass die künftige Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Erkrankungen in Massenmedien (aber nicht nur dort) eher übertrieben dargestellt und die Rolle möglicher sozialer Einflüsse eher untertrieben oder gar nicht dargestellt wird.
Der Kurzbericht MISSING IN THE MEDIA: CANCER AND OLDER PEOPLE von A Fallon und D O'Neill ist am 16. Mai 2017 in der Zeitschrift "Age Ageing (46 (suppl_1): i1-i22) erschienen.
Bernard Braun, 21.5.17
Wie das ernste Problem der Übergewichtigkeit und Fettleibigkeit zur Epidemie prognostiziert wird. Das Beispiel einer OECD-Studie
 Das Niveau und die weitere Entwicklung der Häufigkeit von Übergewicht oder gar Fettleibigkeit gehören sicherlich zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Herausforderungen. Ob es dazu der alarmistischen Etikettierung als Epidemie oder Pandemie bedarf, kann aus zweierlei Gründen in Frage gestellt werden: Erstens verhindert oder lähmt der damit häufig erzeugte Eindruck der Unausweichlichkeit und die schlichte Problemmasse viele Gegeninitiativen, fördert Fatalismus. Und zweitens verschwinden in dem Epidemie-Diskurs eine Reihe von Erkenntnissen, die viele Grundannahmen differenzieren und auch zu empirisch anderen und weniger dramatischen Ergebnissen kommen. Dies gilt z.B. für eine Reihe von international vergleichenden Längsschnittuntersuchungen, welche keine Hinweise auf eine globale explosionsartige Zunahme von Inzidenz und Prävalenz der Fettleibigkeit gefunden haben, sondern ein sehr differenziertes Bild zeichneten.
Das Niveau und die weitere Entwicklung der Häufigkeit von Übergewicht oder gar Fettleibigkeit gehören sicherlich zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Herausforderungen. Ob es dazu der alarmistischen Etikettierung als Epidemie oder Pandemie bedarf, kann aus zweierlei Gründen in Frage gestellt werden: Erstens verhindert oder lähmt der damit häufig erzeugte Eindruck der Unausweichlichkeit und die schlichte Problemmasse viele Gegeninitiativen, fördert Fatalismus. Und zweitens verschwinden in dem Epidemie-Diskurs eine Reihe von Erkenntnissen, die viele Grundannahmen differenzieren und auch zu empirisch anderen und weniger dramatischen Ergebnissen kommen. Dies gilt z.B. für eine Reihe von international vergleichenden Längsschnittuntersuchungen, welche keine Hinweise auf eine globale explosionsartige Zunahme von Inzidenz und Prävalenz der Fettleibigkeit gefunden haben, sondern ein sehr differenziertes Bild zeichneten.
Wie trotzdem aktuell auch angesehene Institutionen am gegenteiligen Eindruck mitstricken und mit Sicherheit auch auf die öffentliche Diskussion einwirken und sich dabei selber an entscheidenden Punkten mit präsentierten Daten widersprechen, lässt sich exemplarisch am "Obesity Update 2017" der OECD ablesen.
Eine der zentralen Aussagen lautet: "Obesity rates are projected to increase further by 2030, and Korea and Switzerland are the countries where obesity rates are projected to increase at a faster pace."
In zwei Übersichten über die Entwicklung der "overweight (including obesity) rates" von Erwachsenen im Alter von 15 bis 74 Jahren zwischen den Jahren 1972 (USA als einziges OECD-Mitgliedsland mit Daten) bis 2015/16 (Daten von 10 Mitgliedsländern) und zu den "projected rates of obesity" für die 10 Länder bis zum Jahr 2030 liefert die OECD folgende Einblicke in die empirische Situation:
• Als erstes zeigt sich für die Jahre 2015/16 eine regional extrem unterschiedliche Übergewichtsrate, die von rund 30% in Korea bis zu rund 70% in Mexiko reicht. Dazwischen liegen im niedrigeren Bereich z.B. die Schweiz und Italien und im höheren Bereich Ungarn und die USA. Zumindest in bestimmten Ländern rechtfertigen die Zahlen (noch) nicht die Charakterisierung als Epidemie. Ferner weisen diese Unterschiede auch darauf hin, dass Fettleibigkeit in "modernen" Staaten offensichtlich nicht generell oder auf einem gleich hohen Niveau unausweichlich und unvermeidbar ist.
• Hinzu kommt, dass in den meisten der 10 Ländern die Rate in den Jahren ab 2000 nicht mehr nennenswert oder gar epidemisch-explosionsartig zunimmt, ja sogar z.B. in Spanien leicht sinkt oder sich in England oder Italien auf und abbewegt. Trotzdem stellt die OECD unterschiedslos fest, die "obesity epidemic has spread further in the past five years".
• Trotzdem wird sich die künftige Rate von Fettleibigkeit laut OECD in allen 10 Ländern von den Ausgangsjahren 2015/16 an bis 2030 plötzlich voll-kontinuierlich und fast linear auf ein deutlich höheres Niveau entwickeln, das dann die Kennzeichnung als Epidemie rechtfertigt. Die Fettleibigkeitsrate in den USA soll im Jahr 2030 rund fünfmal so hoch sein wie in Korea. Da die von der OECD für die letzten Jahre präsentierten Zahlen nicht zwangsläufig für einen weiteren kräftigen Anstieg sprechen und auch die OECD über Faktoren berichtet, die möglicherweise die Dynamik abbremsen, bleibt unklar worauf ihre Prognose beruht.
• Was an der scheinbar linearen Weiterentwicklung u.a. Zweifel weckt, ist der folgende Hinweis in der OECD-Analyse: "People with a lower level of education or socio-economic status are more likely to be overweight or obese, and the gap is generally larger in women. Women are obese more often than men - however, in the OECD countries for which data are available, obesity has been generally growing fastest in men." Dass Fettleibigkeit in den USA in den letzten Jahren anders als in allen anderen OECD-Mitgliedsländern am schnellsten in der Gruppe der hochgebildeten Personen zugenommen hat, unterstreicht nur zusätzlich die Fragwürdigkeit linearer Prognosen. Der mögliche hemmende Effekt der aus vielen nichtgesundheitlichen Gründen zu erwartenden Verbesserung des künftigen Bildungsniveaus in weiten Teilen der Bevölkerung relativiert oder konterkariert die Darstellung bzw. Prognose, die Fettleibigkeitsrate würde ab sofort linear zunehmen, erheblich. Letzteres ist auch deshalb gewagt und unverständlich, weil die OECD selber auf die Existenz eines Bündels ("comprehensive policy packages") gesundheitspolitischer Maßnahmen hinweist, die eventuell den Trend zur Epidemie abschwächen, wenn nicht sogar verhindern oder umkehren könnten.
Trotz allem ist zu befürchten, dass das Wachstumsszenario der OECD in der öffentlichen Wahrnehmung hängenbleibt und die weitere öffentliche Diskussion mitbestimmen wird.
Der 12-seitige Text Obesity Update 2017der OECD ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.5.17
Gesundheitskommunikation zwischen Statistiken und Geschichtenerzählen: warum gibt es die Debatte über Masern-Impfpflicht?
 Egal, ob man die derzeit auch in Deutschland diskutierte Einführung einer Impfpflicht gegen Masern für richtig, voreilig oder falsch hält, ist die Frage interessant, warum es darüber, anders als bei anderen "Kinderkrankheiten", überhaupt weltweit eine derartige Debatte gibt.
Egal, ob man die derzeit auch in Deutschland diskutierte Einführung einer Impfpflicht gegen Masern für richtig, voreilig oder falsch hält, ist die Frage interessant, warum es darüber, anders als bei anderen "Kinderkrankheiten", überhaupt weltweit eine derartige Debatte gibt.
Eine bereits im Herbst 2014 in den USA erschienene kleine Studie eines Kommunikationswissenschaftlers hält die Art der Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse in und mit einem Laien- oder Nichtexperten-Publikum für einen entscheidenden Grund.
Dabei dominiert in der wissenschaftsbasierten Pro-Masernpflichtdebatte wie in anderen vergleichbaren Diskursen ein Typ wissenschaftlicher Risikokommunikation, der im wesentlichen aus statistischen Indikatoren wie Inzidenz, Prävalenz oder attributives Risiko, Wahrscheinlichkeiten, relative Maße wie tausend mal geringer als das Risiko Y oder abstrakten Begriffen wie dem des Herdenrisiko besteht.
Die Contra-Masernpflichtdebatte wird dagegen vor allem durch sehr konkrete und kasuistische Erzählungen und Geschichten von fünfjährigen Kindern oder 22-jährigen Erwachsenen beherrscht, die an den Folgen einer Masernimpfung bis hin zum Autismus leiden. Diese Art der Risikokommunikation erzielt auch noch dadurch viel Wirkung, dass personalisierte und besonders drastische (Grundmuster: Hund beißt Briefträger ist keine Nachricht, Briefträger beißt Hund schon) Erzählungen zu den tragenden Stilmitteln der Massenmedien und auch der neuen sozialen Medien gehören und diese die alten und neuen Hauptinformationsquellen für die Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Erzählungen stoßen also eher auf offene Ohren bzw. werden gwohnheitsmäßig wahr- und aufgenommen als noch so evidente Statistiken oder korrekte Fachtermini.
Angesichts der praktischen Wirksamkeit des Geschichten- oder auch Anekdotenerzählens und der ihm innewohnenden Kraft, den Einfluss einer auf wissenschaftlich formatierte Daten gestützten Debatte zu verringern oder sogar vollkommen auszuhebeln, plädiert der Autor für eine stärker erzählungsorientierte Kommunikation der Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen gegenüber Laienpublikum. Sein Vorschlag: Beispielsweise ebenfalls am Einzelfall verdeutlichen, was eine Masernerkrankung für ein nicht geimpftes Kind und seine Eltern konkret bedeutet und was plastisch durch Impfen verhindert werden kann.
Die in anderen Studien über die deutsche Versorgungswirklichkeit erkannte überragende Bedeutung von Erzählungen oder auf persönlicher Erfahrung beruhenden Berichten bei der Entscheidung für oder gegen die Nutzung eines Krankenhauses oder eines niedergelassenen Arztes und die demgegenüber deutlich geringere Bedeutung der Lektüre noch so qualitätsgesicherter, statistisch einwandfreier Qualitätsberichte oder anderer datenbasierten Listen zeigt wie weit dieser Typ der gesundheitsbezogenen Tatsachenrezeption und Kommunikation verbreitet ist.
Weitere Einzelheiten mit viel Literaturhinweisen zu den Vor- und Nachteilen von Erzählungen und Geschichten in der Risikokommunikation mit Nichtexperten enthält der Aufsatz Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences von M. F. Dahlstrom, erschienen am 16. September 2014 in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" der USA (2014; 111 Supplement 4: 13614-13620) und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.4.15
Vorsicht Suchmaschinenergebnisse: Qualität und Vollständigkeit von Suchmaschinen-Informationen über Gewichtsabnahme und Bewegung
 So verbreitet auch Zweifel an der Qualität mancher gesundheitsbezogener Suchergebnisse von Google, Bing oder anderen Suchmaschinen sein mögen, quantitative und qualitative Belege dafür gibt es relativ wenig.
So verbreitet auch Zweifel an der Qualität mancher gesundheitsbezogener Suchergebnisse von Google, Bing oder anderen Suchmaschinen sein mögen, quantitative und qualitative Belege dafür gibt es relativ wenig.
Daran ändert eine jetzt veröffentlichte Untersuchung solcher Ergebnisse über die Möglichkeiten Gewicht abzunehmen einiges. 40% der us-amerikanischen NutzerInnen des Internets benutzen zur Suche nach Informationen zum Thema Übergewicht und Bewegung die geläufigen Suchmaschinen.
Durch Vergleiche mit evidenzbasierten Leitlinien zur Bedeutung von Ernährung, Bewegung und Verhaltensstrategien bei Übergewicht bestimmten sie die Qualität der Inhalte von 103 themenspezifische Websites, 21 kommerzielle, 52 von Medien, 14 medizinische, regierungseigene oder universitäre, 7 Blogs und 9 unklassifizierbare.
Auf einer Qualitätsskala, die von 0 bis 16 reichte, lag der Durchschnitt aller Websites bei 3,75. Dabei gab es signifikante (p<0,005) Unterschiede je nach Art und Träger der Website: Blogs hatten mit 6,33 Punkten den besten, medizinische/regierungsamtliche und universitäre Angebote mit 4,82 Punkten den zweitbesten Wert. Kommerzielle und Nachrichten/Medien-Seiten erreichten dagegen mit 2,37 oder 3,52 Punkten die niedrigsten bzw. schlechtesten Qualitätswerte.
Hinzu kam die Beobachtung, dass die umfangreichsten und qualitativ besten Websites erst auf hinteren Plätzen der Suchergebnisse lagen, die Qualität der Informationen auf den ersten und damit der am meisten genutzten Seiten (90% der Klicks erfolgen auf der ersten Seite eines Suchergebnisses) der Suchmaschinenergebnisse also unterdurchschnittlicher Art war. Selbst wenn jemand wirklich noch die fünzigste oder einundneunzigste Seite der Suchergebnisse liest, findet er aber auch dort laut dieser Studie aber immer noch keine Websites, die alle Aspekte des Suchthemas qualitativ hochwertig behandeln.
Von dem im Oktober 2014 in der Fachzeitschrift "American Journal of Public Health" (Vol. 104, No. 10, pp. 1971-1978) verröffentlichten Aufsatz Analysis of the Accuracy of Weight Loss Information Search Engine Results on the Internet von François Modave et al. gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 17.11.14
Neues zu health literacy: Vorsicht "Wissenschaftssignale" oder manchmal ist eine Grafik nur eine Grafik!
 Auch wenn es fast schon eine politisch inkorrekte Gebrauchsanleitung zur besseren und möglicherweise problematischen Vermarktung von (Gesundheits-)Gütern und Dienstleistungen ist, zeigt eine von Wissenschaftlern der kalifornischen Cornell-Universität gerade veröffentlichte Studie, dass die Illustration der Beschreibung eines Medikaments mit einer wissenschaftlich anmutenden Grafik oder einer Formel ohne jegliche Zusatzinformation die Überzeugung von deren Wirksamkeit erheblich erhöht.
Auch wenn es fast schon eine politisch inkorrekte Gebrauchsanleitung zur besseren und möglicherweise problematischen Vermarktung von (Gesundheits-)Gütern und Dienstleistungen ist, zeigt eine von Wissenschaftlern der kalifornischen Cornell-Universität gerade veröffentlichte Studie, dass die Illustration der Beschreibung eines Medikaments mit einer wissenschaftlich anmutenden Grafik oder einer Formel ohne jegliche Zusatzinformation die Überzeugung von deren Wirksamkeit erheblich erhöht.
In einer ersten Online-Studie mit 61 unterschiedlichst gebildeten TeilnehmerInnen glaubten fast 68% der Angehörigen der Gruppe, die einen Text zur Wirksamkeit eines Medikaments lasen, es sei wirksam. Wurde der Text mit einer Grafik ergänzt, die keinerlei Zusatzinformation enthielt, sagten fast 97%, sie hielten das Medikament für wirksam. Mittels eines weiteren Experiments fanden die Autoren eine enge Assoziation zwischen dem Glauben an oder Vertrauen in Wissenschaft ("I believe in science") und einer besseren Bewertung der Wirksamkeit eines Medikaments, wenn dies durch eine Grafik illustriert wurde. In den Worten eines der Wissenschaftler: "In fact, the more people believed in science, the more they were convinced by the graphs."
In einer weiteren Studie mit 57 BesucherInnen eines Einkaufszentrums sollten diese die Wirkungsdauer eines per Text vorgestellten entzündungshemmenden Medikaments bewerten. Die StudienteilnehmerInnen, die nur einen Text mit einem Bild des Medikaments vorgelegt bekamen, meinten, das Mittel würde 3,77 Stunden wirken. Diejenigen, in deren Text noch die chemische Formel des Medikaments abgebildet war, meinten, es wirke 5,91 Stunden.
Dass der Beleg der Möglichkeiten, das Prestige von Wissenschaft manipulativ zu missbrauchen aber noch keineswegs alle Manipulationsmöglichkeiten und -wirklichkeiten umfasst, deutet die Schlussbemerkung der Wissenschaftler an: "Even easily produced, trivial elements that are associated with science, such as graphs, can enhance persuasion. These findings demonstrate that companies can easily abuse the prestige with which science is held. Adding even trivial or peripheral elements that are associated with scientific objectivity can help persuade people of product efficacy. This must be guarded against in a wide variety of different contexts, including advertising, product packaging, web-design, sales visits, and press releases. The fact that elements associated with science can so easily enhance persuasion urges caution in the communication of purportedly scientific claims, and a more critical eye when it comes to assessing claims that are given a scientific veneer."
Und auch den folgenden Ratschlägen ist voll zuzustimmen: "What this means is that when you read claims about new products, whether it's a medication or a new technology, you should ask yourself, 'where does this information come from?', 'what's the basis for the claims being made?' Don't let things that look scientific but don't really tell you much fool you. Sometimes a graph is just a graph!"
Ob die Ergebnisse der geringen Größe der Studiengruppen oder deren qualitativen Zusammensetzung geschuldet sind, bleibt einerseits zu hoffen, müsste aber andererseits erst durch größere Folgestudien belegt werden.
Der Aufsatz Blinded with science: Trivial graphs and formulas increase ad persuasiveness and belief in product efficacy. von A. Tal und B. Wansink ist am 15. Oktober 2014 online in der Zeitschrift "Public Understanding of Science" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.10.14
Warum Ebola keine globale Gesundheitsbedrohung ist und was aus Public Health-Sicht trotzdem dagegen getan werden muss.
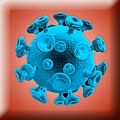 Offensichtlich gehören regelmäßige mediengetragene oder -verstärkte gesundheitsbezogene Schreckensszenarien oder -Hypes zum unvermeidbaren Repertoire der Gesundheits- oder Krankheitskommunikation. Waren es vor Jahren Sars, die Hühner- oder die Schweinegrippe, welche weltweit Hunderte von Public Health-Institutionen, Milliarden von Menschen und milliardenschwere Geldströme bewegten, zeichnet sich dies im Moment bei Ebola ab - und zwar weltweit.
Offensichtlich gehören regelmäßige mediengetragene oder -verstärkte gesundheitsbezogene Schreckensszenarien oder -Hypes zum unvermeidbaren Repertoire der Gesundheits- oder Krankheitskommunikation. Waren es vor Jahren Sars, die Hühner- oder die Schweinegrippe, welche weltweit Hunderte von Public Health-Institutionen, Milliarden von Menschen und milliardenschwere Geldströme bewegten, zeichnet sich dies im Moment bei Ebola ab - und zwar weltweit.
Ohne das damit verbundene im Detail schreckliche Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko der Bevölkerung in mehreren westafrikanischen Staaten verharmlosen zu wollen und ohne die Hunderte von Millionen US-Dollar für unnötig zu halten, die von WHO und Worldbank für "Maßnahmen" zur Verfügung gestellt werden, stellt sich aber auch hier die Frage, ob die Reaktion der wirklichen Situation quantitativ und qualitativ angemessen ist.
Nach Lektüre eines am 30. Juli 2014 in der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Nature" veröffentlichten und auch in deutscher Übersetzung vorliegenden Aufsatzes, sind hier Zweifel berechtigt.
Zu den dafür wesentlichen Argumenten gehören:
• Von vorrangiger Bedeutung ist aus Public Health-Perspektive der qualitative Hinweis auf die spezifischen sozialen und kulturellen Ursachen der Verbreitung der Erkrankung: Dabei geht es um mangelndes Vertrauen der Bevölkerung in ihre Gesundheitsakteure (z.B. gelten Sanitäter als Einschlepper der Infektion und werden am Zutritt in die Dörfer mit Kranken gehindert) und mangelnde Kooperation(sbereitschaft) und besondere Beerdigungsrituale mit direktem Kontakt zu den Leichen. Ohne Einflussnahme auf die soziokulturellen Faktoren könnte die Millionenunterstützung, die für den Aufbau einer Behandlungsinfrastruktur sicherlich notwendig ist, also wirkungslos bleiben. "Ebola 20.0" könnte man dann in den 10-Jahreskalender eintragen.
• Ebola ist eine insgesamt seltene Krankheit, und befällt auch bisher nur relativ kleine Bevölkerungsteile. Seit ihrem erstmaligen Auftreten im Jahr 1976 gab es 19 Ausbrüche mit mehr als 10 Opfern und nur sieben Ausbrüche betrafen mehr als 100 Personen. Insgesamt starben bisher offiziell 2.000 Menschen durch Ebola. Auch wenn der Tod jedes Einzelnen schlimm ist, sollte beachtet werden, dass im Moment weltweit täglich 3.200 Menschen wegen einer Malariainfektion und 4.000 wegen einer Durchfallerkrankung sterben - vielfach vermeidbar.
• Im Moment (27. Juli 2014) gibt es nach WHO-Schätzungen relativ wenige, nämlich 1.323 infizierte Personen, von denen 729 gestorben sind. Dies ist der bisher größte Ausbruch.
• Da das Virus nur durch einen direkten Kontakt von Schleimhäuten oder verletzter Haut mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person übertragen wird, und nicht durch die Luft, ist die Ansteckungsgefahr relativ gering. Auch wenn insbesondere in der US-Öffentlichkeit angesichts von zwei per Flugzeug in die USA gekommenen Erkrankten ein total anderer Eindruck vermittelt wird (eine besondere Mischung bieten z.B. die in der öko-alternativ-konservativen Szene in den USA weit verbreiteten Artikel der "Natural News"-Website Twenty-one questions about Ebola: government propaganda, medical corruption and bioweapons experiments oder Ebola 'dirty bomb' the next big fear: are large cities vulnerable to biological attack?), hält z.B. das "Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC)" das Risiko einer Übertragung durch infizierte Passagiere für "sehr gering".
Unabhängig von den Details der Kommunikation über die Risiken von Ebola und in der sicheren Erwartung des nächsten Krankheits-Hypes sollte endlich das Nachdenken über die Ursachen stattfinden, die zu solchen spezifischen Überschätzungen und Fehldarstellungen und zu einem öffentlichen Diskurs führen, der trotz einer ständigen Verbesserung der gesundheitlichen Situation eine Zunahme der Erkrankungsrisiken für real hält.
Der "Nature"-Artikel Largest ever Ebola outbreak is not a global threat. Although the virus is exerting a heavy toll in West Africa, it does not spread easily von Declan Butler ist in Englisch und deutscher Übersetzung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.8.14
Abgespeckt, entzündungsfrei und atemberaubender Sex dank Heidelbeeren, Zwiebeln und Wassermelonen oder mediale Luftnummern!?
 Zu den auflagenstärkendsten Dauerthemen in vielen Massenmedien gehören "Iss-Dich-Gesund"-Tipps. Wie im Forum-Gesundheitspolitik bereits ausführlich berichtet sind dabei der Phantasie, der Spekulation und dem Zurechtschreiben von Forschungsergebnissen keinerlei Grenzen gesetzt.
Zu den auflagenstärkendsten Dauerthemen in vielen Massenmedien gehören "Iss-Dich-Gesund"-Tipps. Wie im Forum-Gesundheitspolitik bereits ausführlich berichtet sind dabei der Phantasie, der Spekulation und dem Zurechtschreiben von Forschungsergebnissen keinerlei Grenzen gesetzt.
In einem am 4. April 2014 veröffentlichten Beitrag zur Ernährungsforschung wird das Strickmuster dieser Art von "vollmundigen Versprechungen", die sich bei genauerem Hinsehen als "Luftnummern" erweisen, an drei aktuellen Beispielen demonstriert.
Die Schlagzeilen lauten:
• Schon ein hunderttausendstel Gramm des Zwiebel-Wirkstoffs Allicin lindert Entzündungen,
• Studien belegen: Heidelbeeren wirken gezielt gegen Bauchfett und
• Wassermelonen sorgen für atemberaubenden Sex.
Die Wirklichkeit hinter den Schlagzeilen wird durch die genauere Darstellung der Studien verdeutlicht, die ihnen zugrundeliegen und die per Link auch nachlesbar sind. Ergänzt werden die Vergleiche zwischen Forschungsergebnissen und Berichterstattung durch ein Interview mit einer Ernährungswissenschaftlerin der Universität Gießen. Ob die von ihr vertretene Fachdisziplin der Ernährungsökologie die nächsten Schlagzeilen mit ähnlichen Verzerrungen oder Halbwahrheiten verhindert, ist angesichts der "Health sells"-Mentalität vieler Massenmedien zu bezweifeln.
Der kurze Artikel Ernährungsforschung. Ernährungsstudien aufs Korn genommen von Ulrike Gebhardt ist auf der Wissenschafts-Website "spektrum.de" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.4.14
Vorsicht Unstatistik: Verringert Mittelmeer-Diät das Diabetesrisiko um 30% oder 1,9 Prozentpunkte?
 Um diese Frage samt ihrer korrekten und relativ unspektakulären Beantwortung geht es im Januar-2014-Beitrag der von dem Psychologen Gerd Gigerenzer, dem Ökonomen Thomas Bauer und dem Statistiker Walter Krämer seit 2012 publizierten Serie "Unstatistik des Monats". Dort werden sowohl publizierte Zahlen als auch deren Interpretationen hinterfragt. "Die Aktion will so dazu beitragen, mit Daten und Fakten vernünftig umzugehen, in Zahlen gefasste Abbilder der Wirklichkeit korrekt zu interpretieren und eine immer komplexere Welt und Umwelt sinnvoller zu beschreiben."
Um diese Frage samt ihrer korrekten und relativ unspektakulären Beantwortung geht es im Januar-2014-Beitrag der von dem Psychologen Gerd Gigerenzer, dem Ökonomen Thomas Bauer und dem Statistiker Walter Krämer seit 2012 publizierten Serie "Unstatistik des Monats". Dort werden sowohl publizierte Zahlen als auch deren Interpretationen hinterfragt. "Die Aktion will so dazu beitragen, mit Daten und Fakten vernünftig umzugehen, in Zahlen gefasste Abbilder der Wirklichkeit korrekt zu interpretieren und eine immer komplexere Welt und Umwelt sinnvoller zu beschreiben."
Im aktuellen Beitrag stellt Gigerenzer ein typisches Beispiel für eine gerade bei gesundheitsbezogenen Studien weit verbreitete und oft angewandte Verunklarung statistischer Indikatoren oder Maße dar. Je nachdem, ob man die relative Reduktion eines Risikos oder die absolute Reduktion desselben Risikos kommuniziert, sind die Effekte z.B. einer Ernährungsweise oder eines Arzneimittels beeindruckend, schlagzeilenträchtig und nachfragefördernd oder kleiner und unspektakulärer.
Hier geht es um eine randomisierte kontrollierte Studie in deren so genannten Mittelmeer-Diät-Gruppe mit extra-nativem Olivenöl nach vier Jahren 6,9% der Teilnehmer an Diabetes Typ 2 erkranken und in der Kontrollgruppe ohne Olivenöl und Nüsse 8,8%. Die absolute Risikoreduktion zu Gunsten der Mittelmeerdiät betrug also 1,9 Prozentpunkte. Drückt man diesen Unterschied in Prozent aus, beträgt er 21,3%, aus denen "mit ein paar Korrekturen, wie bezüglich Alter und Geschlecht, und gemittelt über Olivenöl und Nüsse" rund 30% werden. Falsch wird diese Prozentzahl dann, wenn man meint, dass von 100 Menschen, die sich mediterran ernähren, 30 weniger an Diabetes erkranken.
Der Unstatistik-Beitrag Olivenöl verhindert Diabetes von G. Gigerenzer ist am 31.1.2014 erschienen und kostenlos erhältlich.
Der zugrundeliegende Aufsatz Prevention of Diabetes With Mediterranean Diets: A Subgroup Analysis of a Randomized Trial von Jordi Salas-Salvadó et al. ist Anfang 2014 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (2014; 160(1): 1-10) erschienen. Sein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Im Archiv finden sich z.B. auch noch folgende durchweg lesenswerte gesundheitsbezogenen Beiträge: Fehlende Informationen zu Nutzen und Schaden des Brustkrebs-Screenings, Frühstück beugt Herztod vor, Gen-Mais tötet, Dick macht doof und depressiv oder Schokolade macht dünn.
Bernard Braun, 3.2.14
Wie viele US-Amerikaner ohne Krankenversicherung nutzen die mit dem "Affordable Care Act" geschaffenen Versicherungsmöglichkeiten?
 Wenn über die us-amerikanische Gesundheitspolitik hierzulande etwas ausführlicher berichtet wurde, dominierten in letzter Zeit Berichte über technisch-organisatorische Pannen und den Streit der Obama-Administration mit den marktradikalen Republikanern. Einzelheiten und eine vollständige Berichterstattung geraten dabei häufig unter die Räder der Schlagzeilenträchtigkeit.
Wenn über die us-amerikanische Gesundheitspolitik hierzulande etwas ausführlicher berichtet wurde, dominierten in letzter Zeit Berichte über technisch-organisatorische Pannen und den Streit der Obama-Administration mit den marktradikalen Republikanern. Einzelheiten und eine vollständige Berichterstattung geraten dabei häufig unter die Räder der Schlagzeilenträchtigkeit.
Dies ist häufig dann zu beobachten, wenn es um die Möglichkeiten des Abschlusses einer Krankenversicherung für zig Millionen US-Amerikaner geht, die bisher keine Krankenversicherung hatten. Sofern dies über die elektronischen Versicherungsplattformen oder -marktplätze stattfinden sollte, wimmelt es in deutschen Medien vor allem von Bemerkungen über den Zusammenbruch der Regierungs-Website und die geringen Zahlen der neuen Versicherungsabschlüsse.
So richtig die Kritik am Versagen von Techniken ist, die in den USA aber auch hierzulande immer als fehlerfrei daherkommen, so unvollständig bis tendenziös ist es, den derzeitigen Stand der Versicherungsabschlüsse bereits als Scheitern des "Affordable Care Act's" zu bewerten.
Wer dazu und zu weiteren Details der Implentierung des Gesetzes laufend Konkreteres und Richtigeres wissen will, kann sich u.a. auf verschiedenen Websites des "Commonwealth Fund" laufend aktualisuiert informieren.
So findet man dort zum aktuellen Stand des "marketplace enrollment" folgende Daten:
• Das "Congressional Budget Office"(CBO) geht von rund 7 Millionen Personen aus, die für einen Versicherungsabschluss über die Versicherungsmarktplätze in Frage kommen. Für eine Versicherung in den staatlichen Krankenversicherungen Medicaid und CHIP (Children's Health Insurance Program" kommen laut CBO sogar noch mehr, nämlich 9 Millionen Personen in Frage. Es gehört zu den Spezialitäten der us-amerikanischen Freiheit, dass diese Personen auch bereits ohne Gesundheitsreform diese Wahlmöglichkeit gehabt hätten.
• Die genannten Wahlmöglichkeiten bestehen bis zum 31. März 2014.
• Bis Ende November 2013 hatten sich nach dem auf Bundesebene durch technische Pannen behinderten Start 2,9% aller für einen "marketplaces"-Abschluss berechtigten und geeigneten Personen für eine der dort angebotenen Versicherungen entschieden. Von den Medicaid und CHIP-Berechtigten wurden 3,8% Versicherte in einer der beiden Versicherungen. In einer Umfrage des "Commonwealth Fund" sagten 37% der Personen, die den elektronischen Versicherungsmarktplatz besucht hatten, sie hätten wegen der technischen Probleme noch keinen Versicherungsabschluss getätigt.
• In den 15 Bundesstaaten (z.B. Kalifornien oder New York), die einen eigenen und überwiegend immer gut funktionierenden Versicherungsmarkt anboten, hatten Ende November fast 46% aller in Frage kommenden Personen eine private Krankenversicherung abgeschlossen.
• Diese Entwicklung und die Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage zum Abschlussverhalten aus dem Oktober 2013, fördern verhalten optimistische Prognosen über die weitere Nutzung der "marketplaces". In dieser Befragung hatten 58% aller Befragten gesagt, sie würden sehr wahrscheinlich (34%) oder mit gewisser Wahrscheinlichkeit (24%) diese Versicherungsmöglichkeiten spätestens bis zum 31. März 2014 nutzen. Interessant ist, dass sowohl von den Befragten mit einem Mittelschichteinkommen von 25.000 bis 50.000 US-Dollar und den Personen, die ihren Gesundheitszustand als gut bewerteten, ein überdurchschnittlicher Anteil (42% und 40%) sehr wahrscheinlich diese Wahlmöglichkeiten nutzen würden. Spürbar unterdurchschnittlich beabsichtigten dies die Persnen mit sehr gutem Gesundheitszustand (31%) und die 19- bis 29-Jährigen (32%).
Die Ende-November-Zahlen mit diversen Links zu anderen Datenquellen sind auf der Commonwealth-Fund-Website Enrollment in the Affordable Care Act's Health Insurance Options: an Update veröffentlicht und frei zugänglich.
Die mehrfach zitierte Befragung Americans' Experiences in the Health Insurance Marketplaces: Results from the First Month von S. R. Collins, P. W. Rasmussen, M. M. Doty, T. Garber, D. Blumenthal ist im November veröffentlicht worden. Eine Kurzdarstellung der Ergebnisse und Folien sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.11.13
Welchen Einfluss haben TV-Serien wie "Grey's Anatomy" oder "In aller Freundschaft" auf den Pflegernachwuchs in Krankenhäusern?
 Ein Teil des gesellschaftlichen Ansehens, Immages, der Bedeutung oder Attraktivität von Personen oder Personengruppen wird über und in Medien wie dem Fernsehen bestimmt. Die unzähligen und nicht endenwollenden Kommissar-, Tatort- oder Kriminalserien zeichnen z.B. ein Bild der im Polizeidienst tätigen Berufsgruppen, das die dortige Arbeit und dortigen Beschäftigten mehr oder weniger stark positiv oder heroisierend verzerrt. Wer einmal in einem asiatischen Land begeistert als Bürger des Landes angesprochen wurde, in dem Kommissar Derrick wirkte (fast im selben Atemzug mit Beckenbauer), weiß, dass selbst Nationalstereotype über Fernsehserien mitbestimmt werden. Und wer glaubt nicht, mit Kommissar Wallander Stimmiges über "die Schweden" zu erfahren?
Ein Teil des gesellschaftlichen Ansehens, Immages, der Bedeutung oder Attraktivität von Personen oder Personengruppen wird über und in Medien wie dem Fernsehen bestimmt. Die unzähligen und nicht endenwollenden Kommissar-, Tatort- oder Kriminalserien zeichnen z.B. ein Bild der im Polizeidienst tätigen Berufsgruppen, das die dortige Arbeit und dortigen Beschäftigten mehr oder weniger stark positiv oder heroisierend verzerrt. Wer einmal in einem asiatischen Land begeistert als Bürger des Landes angesprochen wurde, in dem Kommissar Derrick wirkte (fast im selben Atemzug mit Beckenbauer), weiß, dass selbst Nationalstereotype über Fernsehserien mitbestimmt werden. Und wer glaubt nicht, mit Kommissar Wallander Stimmiges über "die Schweden" zu erfahren?
Zwei aktuell veröffentlichte Studien haben nun untersucht, welches Bild oder welche Stereotypen von männlichen Pflegekräften die seit Jahren ebenfalls weltweit und national boomenden Krankenhausserien erzeugen oder transportieren und damit möglicherweise Einfluss auf die Berufswahl von Männern und die Pflegesituation in Krankenhäusern nehmen.
Eine australische Wissenschaftlergruppe untersuchte dazu die regelmäßig zwischen 2007 und 2010 von verschiedenen Fernsehsendern -auch deutschen - gesendeten Episoden der us-amerikanischen Krankenhaus- und Krankenhauspersonal-Serien Greys Anatomy, Hawthorne, Nercy, Nurse Jackie und Private Practice.
Das wesentliche Ergebnis der im September 2013 veröffentlichten Studie war, dass in der Pflege beschäftigte Männer bzw. Pfleger überwiegend durch ex- und implizite Stereotypen oder Klischees dargestellt wurden: Sie wurden wesentlich häufiger als ihre weiblichen Berufskolleginnen gefragt, ob ihre Tätigkeit eigentlich eine Karriere ermögliche. Auch ihre Männlichkeit und männliche Sexualität wurden häufig in Frage gestellt. Obwohl den Pflegern durchaus Kompetenz zugesprochen wird, wird ihre Rolle gewöhnlich auf die einer Requisite, des Sprechers von Minderheiten oder auf die des Objekts oder auf die der Quelle von Belustigung bzw. Comedy reduziert.
Die hier verbreiteten Stereotypen und Klischees der "männlichen Krankenschwestern" können nach Ansicht der ForscherInnen "potentially discourage men from considerung nursing as a viable profession."
Bereits 2012 hatte der ebenfalls in Australien forschende Wissenschaftler D. Stanley für die Jahre 1900 bis 2007/2010 u.a. mit dem Suchbegriff "male nurse" 36.000 Filmdokumente gefunden und 13 davon inhaltsanalytisch untersucht. 12 von ihnen kamen aus den USA. Die meisten Filme portraitierten Pfleger negativ. Sie entsprachen nicht dem Selbst- und Fremdbild des beherrschenden Mannes, sondern sie waren verweich- oder weiblicht, homosexuell, gemeingefährlich, korrupt oder inkompetent. Nur wenige Darstellungen von Pflegern zeigten sie in ihren traditionellen maskulinen Rollen oder als klinisch kompetente und mit Selbstvertrauen ausgestattete Professionals.
Auch dieser Autor weist auf die medial erzeugte Unattraktivität des Pflegeberufs für Männer und den dadurch möglicherweise miterzeugten Nachwuchsmangel hin. Nachdem sich das Bild der weiblichen Pflegekräfte als gottgefälligen, lieben aber irgendwie unproofessionellen "Schwestern" gerade zu wandeln beginnt, basteln die Drehbuchschreiber der eher noch zunehmenden Anzahl von TV-Serien über das Krankenhaus gerade an genau so heftigen und diskriminierenden Klischees über die männlichen Pflegekräfte.
Selbst wenn es nicht mehr sachliche Argumente gegen diese Art der Typisierung von männlichen Pflegekräften gäbe, sollten sich die Schreiber und Produzenten derartiger Filme oder Serien schon aus Eigennutz überlegen, ob sie im Falle eines Krankenhausaufenthalts wegen des Mangels an Pflegern schlecht gepflegt werden wollen oder in die Hände eines ihren Serien entsprungenen Pfleger-Monsters fallen wollen.
Ohne Anspruch auf eine systematische Analyse entspricht der einzige (jedenfalls im Moment) Krankenpfleger, Hans-Peter Brenner (dessen Darsteller Michael Trischan ist immerhin gelernter Krankenpfleger), in der seit 1998 mit zig Millionen von Zuschauern laufenden deutschen ARD-Serie "In aller Freundschaft" zahlreichen der von den australischen Medienwissenschaftlern in US-Serien entdeckten Stereotypen: übergewichtig, ohne eigenen Willen, "Mamasöhnchen" und vom Typ "Klassenclown" oder "Spaßvogel". Um dies zu erkennen reicht der Konsum einer Folge.
Lohnen würde sich nicht nur eine Replikation der australischen Untersuchungen bei deutschen Krankenhausfilmen, sondern natürlich auch eine durchaus dem Grunde nach vergleichbare Stereotypisierung von Ärzten in deutschen und wiederum us-amerikanischen Serien. Ärzte zwischen dem Gutarzt Dr. Brinkmann, den "Emergency Room"-Hektikern und dem Zyniker Dr. House.
Die Studie mit dem bezeichnenden Titel Celluloid devils: a research study of male nurses in feature films von David Stanley erschien im "Journal of Advanced Nursing" (68, 11: 2526-2537). Ihr Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ebenfalls im "Journal of Advanced Nursing" erschien am 4. September 2013 zuerst online der Aufsatz Men in nursing on television: exposing and reinforcing stereotypes von Roslyn Weaver et al., dessen Abstract ebenfalls kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 31.10.13
Holpriger "Königsweg": Öffentliche Informationskampagnen gegen unnötigen Antibiotika-Einsatz haben gemischte Wirkungen
 Die Einsicht, dass die bisherige Verordnungshäufigkeit von Antibiotika bei vielen Infektionserkrankungen nicht sinnvoll ist und bei anderen Erkrankungen besser mit einer so genannten "watchful waiting"- oder "wait and see"-Behandlung begonnen werden sollte, verbreitet sich zwar immer mehr, verändert die Verordnungspraxis aber bisher relativ wenig. Deshalb stellt sich die Frage, wie man die vorhandene Evidenz und Notwendigkeit für einen wesentlich zurückhaltenderen Einsatz von Antibiotika noch weiter verbreitet.
Die Einsicht, dass die bisherige Verordnungshäufigkeit von Antibiotika bei vielen Infektionserkrankungen nicht sinnvoll ist und bei anderen Erkrankungen besser mit einer so genannten "watchful waiting"- oder "wait and see"-Behandlung begonnen werden sollte, verbreitet sich zwar immer mehr, verändert die Verordnungspraxis aber bisher relativ wenig. Deshalb stellt sich die Frage, wie man die vorhandene Evidenz und Notwendigkeit für einen wesentlich zurückhaltenderen Einsatz von Antibiotika noch weiter verbreitet.
Dass gesetzliche Verbote nicht der Königsweg sind, zeigt im Moment der zähe Versuch den nahezu flächendeckenden Einsatz von Antibiotika in der Tiermast in Deutschland zu regulieren. Umso interessanter sind daher auch Versuche, das Ziel über breite und facettenreiche Informationskampagnen auf lokaler oder regionaler Ebene zu erreichen.
Die Ergebnisse einer nicht-randomisierten aber kontrollierten Informationskampagne, die von November 2011 bis Februar 2012 in den Provinzen Modena und Parma in der norditalienischen Region Emilia Romagna durchgeführt wurde, liefern jetzt die aktuellsten Erkenntnisse über die Machbarkeit und Wirksamkeit solcher Interventionen.
Die Information über die unerwünschten Effekte unnötiger Verordnungen von Antibiotika wurde vor allem über Poster, Broschüren, Anzeigen in örtlichen Medien und einen Newsletter zur örtlichen Resistenzsituation speziell für Ärzte und Apotheker verbreitet und war relativ kostengünstig. Bei der Gestaltung der Botschaften der Kampagne waren die örtlichen Allgemein- und Kinderärzte beteiligt.
Die messbaren Effekte der Kampagne sahen folgendermaßen aus:
• Die Verordnungsrate in der Interventionsprovinz war gegenüber der in der Kontrollprovinz statistisch signifikant um 4,3% gesenkt worden.
• Die Verordnungshäufigkeit unterschied sich je nach der Sorte des Antibiotikums deutlich und folgte dabei zum Teil den Empfehlungen im Informationsmaterial für Ärzte und andere Behandlungsexperten.
• Die beabsichtigte Senkung der Ausgaben für Antibiotika variierte je nach Beobachtungszeitraum zwischen signifikanten und nicht-signifikanten Effekten.
• Das Wissen und die Einstellungen der angesprochenen Bevölkerung über und gegenüber dem korrekten Gebrauch von Antibiotika unterschieden sich zwischen Interventions- und Kontrollgebieten weder vor noch nach der Studiendurchführung nennenswert. Interessant ist, dass das in der Befragung zu Beginn der Studie erhobene Wissen beider Gruppen in teilweise hohem Maße mit den Botschaften der Informationskampagne übereinstimmte, aber offensichtlich keine richtige Wirkung auf die Verordnung und den Einsatz von Antibiotika hatte.
• Beim Wissen und den Einstellungen gibt es mit einer paradoxen Ausnahme keine wesentlichen Verbesserungen nach Beendigung der fünf Monate langen Kampagnenzeit. Paradox ist die signifikante Zunahme falscher Annahmen über den Nutzen von Antibiotika bei Virusinfektionen: Dem Statement "Antibiotika sind gegen Viren wirksam" stimmten vor der Kampagne 47% der Bewohner der Interventionsprovinz und 59% der Kontrollprovinz. Fünf Monate später taten dies 62% und 67%.
Die WissenschaftlerInnen haben zum einen die relativ kostengünstige Machbarkeit einer solchen facettenreichen Aufklärungskampagne nachgewiesen und haben kurzfristige Veränderungen der Verordnungshäufigkeit erzielt. Sie weisen besonders auf die Schwierigkeiten der Bewertung positiver Effekte hin.
Ob sich die positiven Effekte ohne weitere Inputs halten, ist angesichts der geringen Veränderungen beim Wissen und den Einstellungen und sogar einer markanten Verschlechterung, im Bereich des Möglichen. Auch solche Kampagnen sind offensichtlich nicht der ohne Einschränkungen begehbare Königsweg.
Der Aufsatz Feasibility and effectiveness of a low cost campaign on antibiotic prescribing in Italy: Community level, controlled, non-randomised trial. von Formoso G et al. ist ein komplett kostenloser Open Access-Beitrag im "British Medical Journal (BMJ)", der vorab am 12. September 2013 elektronisch veröffentlicht wurde.
Bernard Braun, 24.9.13
"Iss und stirb" oder "Iss Dich gesund" - geht es beim Essen so oder so immer um Krebs!?
 Weihnachten ist auch ein kulinarischer Höhepunkt - quantitativ und qualitativ. Diejenigen, die auch dann daran denken, welches Nahrungsmittel "ungesund" ist oder "gesund macht bzw. hält" und dann auch noch an das Risiko einer Krebserkrankung denken, sollten aber nicht jedem derartigen Hinweis auf der "Gesundheit"-Seite ihrer Tageszeitung oder in den TV-Gesundheitsratgebern uneingeschränkt trauen.
Weihnachten ist auch ein kulinarischer Höhepunkt - quantitativ und qualitativ. Diejenigen, die auch dann daran denken, welches Nahrungsmittel "ungesund" ist oder "gesund macht bzw. hält" und dann auch noch an das Risiko einer Krebserkrankung denken, sollten aber nicht jedem derartigen Hinweis auf der "Gesundheit"-Seite ihrer Tageszeitung oder in den TV-Gesundheitsratgebern uneingeschränkt trauen.
Das ist jedenfalls das Ergebnis einer methodisch wie inhaltlich beispielhaften Untersuchung zweier us-amerikanischen Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftler. Sie stellten zum einen fest, dass der mehr oder weniger dramatische negative oder auch positive Zusammenhang zwischen einer Vielzahl von Nahrungsmitteln und diversen Krebs- und zahllosen anderen Erkrankungen zu den Standardmeldungen in den Massenmedien gehören. Hinter den Meldungen dieser Art stehen dann meistens nicht näher dargestellte "Studien" einer möglichst renommierten Universität oder Firma.
Die beiden Wissenschaftler weisen zu Beginn ihrer eigenen Studie auf die wissenschaftlich geführten Debatten über die methodisch beschränkte Qualität (z.B. überwiegend Beobachtungsstudien und keine randomisiert kontrollierten Studien, keine veröffentlichten Studienprotokolle) und die inhaltlichen Verzerrungen (z.B. falsch positive Ergebnisse, selektive Veröffentlichungen mit der Tendenz, negative Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, Interpretationsfehler) der jährlich zu Tausenden publizierten ernährungsepidemiologischen Studien hin.
Sie selber wollen dann aber systematisch-zufällig untersuchen wie verlässlich der "Studien"-Boden der medialen Berichte über ernährungsassoziierte Krebsrisiken oder aber auch krebspräventive Wirkungen von Nahrungsmitteln ist. Dazu wählen sie zunächst aus dem "The Boston Cooking-School Cook Book" zufallsgesteuert 50 verbreitet beim Kochen benutzte Nahrungs- oder Inhaltsstoffe aus. Danach recherchierten sie, ob es für diese Stoffe Berichte über das Krebsrisiko fördernde oder verhindernde Wirkungen gibt.
Ihre Ergebnisse sehen so aus:
• Zu 40 Stoffen, also 80% aller ausgesuchten Nahrungsmittel, gibt es solche Berichte.
• In 264 Studien aus den Jahren 1976 bis 2011 fanden sich bei 191 (72%) Einzelbewertungen über krebsrisikoerhöhende oder -verhindernde oder -senkende Effekte. 103 Studien nannten risikoerhöhende und 88 risikosenkende Assoziationen.
• Unter allen Studien enthielten 80% Ergebnisse, die gar nicht (Irrtumswahrscheinlichkeit größer als 5%) oder nur schwach (Irrtumswahrscheinlichkeit größer als 0,1%) signifikant waren.
• Von den Studien, die explizit Schätzungen zu einem zunehmenden oder abnehmendem Krebsrisiko bei der Aufnahme des jeweiligen Nahrungsstoffs lieferten, enthielten 75% Ergebnisse, die gar keine oder lediglich eine schwache statistische Signifikanz besaßen.
• In den veröffentlichten Abstracts der Studien fanden sich beim Vergleich mit dem Gesamttext hoch-signifikant mehr signifikante als nicht signifikante Ergebnisse. Viel- und Schnellleser, also wahrscheinlich der große Teil der Journalisten, werden folglich durch die von ihnen oft bevorzugten Abstracts vorsätzlich oder fahrlässig in die Irre geführt.
• Verbreitet sind in solchen Studien auch völlig unterschiedliche Mengenangaben, deren positive oder negative Wirkung untersucht wurde und die dann unzulässigerweise miteinander verglichen wurden.
• Die 36 Metaanalysen waren insgesamt zurückhaltender: Nur 26% berichteten entweder ein zunehmendes (4 Analysen) oder ein abnehmendes Krebsrisiko (9 Analysen), das mit den jeweils näher betrachteten Nahrungsmitteln assoziiert waren. Nur 6 von diesen Metaanalysen konnten sich aber auf eine mehr als schwach signifikante Datenbasis stützen.
• Das durchschnittliche relative Risiko (RR) innerhalb des so genannten Interquartilsabstand, um das sich 50% aller Messwerte befinden, beträgt für die zahlreichen Einzelstudien, die ein zunehmendes Risiko berichten und im Vergleich mit keiner oder einer nur geringen Aufnahme des jeweiligen Nahrungsstoffes 2,20 (1,60 bis 3,44) und für Studien, die ein abnehmendes Risiko angeben 0,52 (0,39 bis 0,66). Derselbe Wert liegt bei den methodisch höherwertigen Metaanalysen im Durchschnitt bei 0,96, d.h. die Wirkungsunterschiede schrumpfen in Richtung Null.
Ein relevanter Teil der Berichterstattung über den Zusammenhang von Nahrungsmitteln, Krebsrisiken und Krebsprävention beruht also auf "Studien"-Ergebnissen, die rein zufällig sein können. Sie präsentiert oft Wirkungsstärken einzelner Studien, die inplausibel überschätzt sind und dies selbst dann, wenn die Evidenz für solche Effekte schwach ist.
Die Studie "Is everything we eat associated with cancer? A systematic cookbook review" von Jonathan D Schoenfeld und John PA Ioannidis ist am 28. November 2012 vorab vor dem Druck im "American Journal of Clinical Nutrition (AJCN)" online veröffentlicht worden und komplett kostenlos erhältlich. Für Vielleser gibt es auch das Abstract kostenlos. Nach den Funden der beiden Autoren ist aber auch hier der Blick in den kompletten Text empfehlenswert.
Zusätzlich lesenswert ist der ebenfalls vor Drucklegung am 5.12.2012 vorab veröffentlichte und kostenlos erhältliche Kommentar "Nutritional epidemiology in practice: learning from data or promulgating beliefs? von Michelle M Bohan Brown, Andrew W Brown und David B Allison in derselben Zeitschrift.
Bernard Braun, 26.12.12
Ein Lehrbeispiel!? Wie in der größten US-for-profit-Krankenhauskette "outbreaks of stents" oder "EBDITA"-Ärzte zum Alltag gehören
 Öffentlich werdende Vorfälle, dass in Krankenhäusern gesundheitlich nicht notwendige oder gerechtfertigte Untersuchungen und Operationen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen stattfinden, werden fast schon routinemäßig als "einmalige Ausrutscher", als Werk eines "schwarzen Schafs" oder als "Ausreißergeschehen" kleiner, unprofessionell geführter Krankenhäuser charakterisiert.
Öffentlich werdende Vorfälle, dass in Krankenhäusern gesundheitlich nicht notwendige oder gerechtfertigte Untersuchungen und Operationen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen stattfinden, werden fast schon routinemäßig als "einmalige Ausrutscher", als Werk eines "schwarzen Schafs" oder als "Ausreißergeschehen" kleiner, unprofessionell geführter Krankenhäuser charakterisiert.
Umso bedeutender sind die zwischen dem Jahr 2000 und 2010/11 rund 1.200 Ereignisse von vermutlich gesundheitlich nicht notwendigen und damit zum Teil auch für die Gesundheit von PatientInnen gefährlichen Untersuchungen in Herzkatheterlabors oder das Einpflanzen von Gefäßstents in mehreren Kliniken der mit 163 Einrichtungen größten for-profit-Krankenhauskette der USA - HCA (Hospital Corporation of America). Mehr als 80% der Kliniken dieser Kette befinden sich nach eigenen Angaben auch unter den 10% der nach dem staatlichen Qualitäts-Ranking besten Krankenhäuser der USA. Blind darauf zu vertrauen, dass auch die restlichen knapp 20% Musterbetriebe sind, wäre aber eindeutig ein Irrtum. Den unerwünschten Ereignissen wird jetzt mit dem Schwerpunkt im Bundesstaat Florida in einer gerichtlichen Untersuchung nachgegangen. Diese Häuser tragen interessanterweise mit über 20% zum Gewinn von HCA bei.
In einem langen fundierten Beitrag in der angesehenen Tageszeitung "New York Times" (NYT), dokumentieren die Autoren die lange Kette dieser Ereignisse. So wurde in einem vertraulichen internen Bericht aus dem Jahr 2010 für ein HCA-Großkrankenhaus z.B. eingeräumt, dass bei rund der Hälfte teurer invasiver diagnostischer Tests mittels eines Katheters, keine signifikante Herzerkrankung vorlag. Im Jahr 2000 untersuchte das Justizministerium, ob HCA nicht der staatlichen Krankenversicherung Medicare rund 1,7 Milliarden US-Dollar zu viel in Rechnung gestellt hatte. Der damals verantwortliche HCA-Vorstand, Rick Scott, musste sich dafür nie rechtlich und faktisch verantworten und ist heute Governeur von Florida. 2004 stellte eine damit von HCA beauftragte externe Gruppe von Qualitätssicherungsexperten vertraulich fest, dass in einem bereits zuvor auffällig gewordenen Krankenhaus 43% der invasiven Öffnungen und Erweiterungen von verkalkten Arterien, so genannte Angioplastien) in keiner Weise anerkannten Standards entsprachen. Andere bei HCA tätigen Kardiologen fälschten diagnostische Daten so, dass sie kardiologisch relevante Gefäßoperationen durchführen konnten. Aus Blutgefäßen, deren zwischen 33% und 53% durch Verkalkung etc. verkleinert waren, wurden Blockaden zwischen 80% und 90%. Wenn Letzteres der Fall ist, ist eine operative Behandlung indiziert. In anderen Kliniken der Krankenhaus-Kette brachen in mehgreren Jahren medizinisch unerklärbare Wellen der Implantation von teuren Gefäß-Stents aus. Und schließlich warb die Krankenhaus-Kette in einem Business Plan aus dem Jahr 2008 mit einem beschäftigten Arzt als "our leading EBDITA MD". Diese Abkürzung bezieht sich nicht auf eine besondere medizinische oder ärztliche Fähigkeit oder Fertigkeit, sondern auf die Fähigkeit "earnings before interest, taxes, depreciation and amortization" zu generieren, also die Fähigkeit des Arztes, den Gewinn des Krankenhauses zu mehren. Wenige Monate zuvor war demselben Arzt intern vorgehalten worden, er führe zu schnell Katheteruntersuchungen durch und untersuche nicht ausreichend, ob die Patienten den invasiven und damit potenziell gesundheitsgefährdenden und teuren Eingriff benötigten oder nicht.
Auch wenn HCA oder die beteiligten Ärzte viele der Vorwürfe letztlich bestätigen mussten, sprechen sie anderen Vorwürfen ihre Berechtigung ab. Angesichts der seit 2010 bekannt gewordenen Über- oder Fehlversorgungsfälle wird HCA laut NYT aber nichts anderes übrigbleiben als "still more reviews" durchzuführen und zu veröffentlichen.
In Deutschland ist natürlich HCA (bisher) nicht tätig, für andere gewinnorientierte Krankenhausketten in den USA fehlen vergleichbare Ereignisketten und so etwas kommt "natürlich" in keinem deutschen Krankenhaus vor. Besser wäre aber trotzdem eine vergleichbare längsschnittliche krankenhausbezogene Transparenz und Berichterstattung über solche und andere unerwünschten Ereignisse in deutschen Krankenhäusern und Tageszeitungen. Dass viele Qualitätsmerkmale der stationären Behandlung im Rahmen der externen bzw. sektorenübergreifenden vergleichenden Qualitätssicherung von BQS und AQUA noch nicht untersucht werden, die Ergebnisse der untersuchten Indikatoren oder die Ergebnisse der strukurierten Dialoge meist nur anonym berichtet werden, ist aber nicht geeignet Ironie zu dämpfen und uneingeschränktes Vertrauen in das Nichtvorkommen solcher Ereignisketten zu fördern.
Der ausführliche Bericht der NYT vom 6.8.2012 "Hospital Chain Inquiry Cited Unnecessary Cardiac Work" von Reed Abelson und Julie Creswell ist komplett kostenlos erhältlich und verschafft einem dank einiger Links einen guten Blick hinter die Kulissen.
Wer aktuell mehr über die systematischen Bemühungen zur Qualitätstransparenz in deutschen Krankenhäusern erfahren will, kann sich z.B. den kostenlos erhältlichen Abschlussbericht 2011 zum Strukturierten Dialog gemäß §15 Abs. 2 QSKH-RL über die Maßnahmen und Ergebnisse der geführten Strukturierten Dialoge anschauen, die im Jahr 2011 auf Basis der Daten des Erfassungsjahres 2010 durchgeführt wurden. Er kann sich auch den Anhang zum Abschlussbericht 2011 anschauen.
Und wer noch mehr über die Realität der eher bundesland- statt auch krankenhausbezogenen Qualitätsberichterstattung mit den BQS/AQUA-Qualitätsindikatoren wissen will, dem ist der "Bericht zur Schnellprüfung und Bewertung der Indikatoren der externen stationären Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Eignung für die einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung" mit Stand Juni 2011 zu empfehlen. Dort erfährt er u.a. dass und warum "von den 316 geprüften Hauptkennzahlen … 48 ohne Einschränkung zur Veröffentlichung empfohlen (wurden). 134 wurden mit Erläuterungen oder leichter Anpassung zur Veröffentlichung empfohlen. Für 108 Indikatoren wurde eine Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Weitere 26 wurden nicht zur Veröffentlichung empfohlen."
Bernard Braun, 28.10.12
Wirkungen von Massenmedien-Kampagnen für körperliche Aktivitäten: Mehrheitlich ohne verhaltensändernde Wirkung, selten evaluiert
 Massenmedienkampagnen, die sowohl über alltagstaugliche gesundheitsförderliche körperliche Aktivitäten informieren als auch Anreize enthalten, mit diesen Aktivitäten praktisch zu beginnen, nehmen international seit mehreren Jahren zu. Dies erklärt sich u.a. durch die potenzielle Reichweite und Beliebtheit (z.B. Fernsehen), die Präsenz im öffentlichen Raum (z.B. Informationsbanner an Nahverkehrsmitteln), die den meisten Massenmedien eigene Verständlichkeit und Attraktivität der Darstellung (z.B. in Illustrierten oder der "yellow press") oder auch durch die Preisgünstigkeit dieser Vermittlungsplattformen.
Massenmedienkampagnen, die sowohl über alltagstaugliche gesundheitsförderliche körperliche Aktivitäten informieren als auch Anreize enthalten, mit diesen Aktivitäten praktisch zu beginnen, nehmen international seit mehreren Jahren zu. Dies erklärt sich u.a. durch die potenzielle Reichweite und Beliebtheit (z.B. Fernsehen), die Präsenz im öffentlichen Raum (z.B. Informationsbanner an Nahverkehrsmitteln), die den meisten Massenmedien eigene Verständlichkeit und Attraktivität der Darstellung (z.B. in Illustrierten oder der "yellow press") oder auch durch die Preisgünstigkeit dieser Vermittlungsplattformen.
Wie bei vielen anderen gesundheitsbezogenen Aktivitäten spielte aber auch hier lange Zeit der empirische Nachweis der erwarteten Wirksamkeit keine, eine lediglich nachgeordnete Rolle oder wurde meist stillschweigend unterstellt.
Eine Untersuchung von 18 solcher auf das Verhalten von erwachsenen Individuen gerichteten Kampagnen, die im englischsprachigen Raum zwischen 2003 und 2010 stattfanden, beendet diesen unbefriedigenden Zustand.
Die zwei wichtigsten Erkenntnisse lauten:
• Die inhaltliche Vorbereitung und Begründung sowie das Design dieser Kampagnen und ihrer Evaluation sind äußerst heterogen. So lag lediglich 9 der 18 Kampagnen ein theo-retisches Konzept über den Inhalt und die Form der Intervention zugrunde, dessen Praxisrelevanz dann untersucht werden konnte. Die Designs schwankten zwischen experimentell und mehrheitlich nichtexperimentell. In drei der 18 evaluierten Kampagnen war grundsätzlich die Möglichkeit ausgeschlossen, die Nutzung der Medienkampagne und die dabei vermittelte Dosis von Informationen und Anreizen quantitativ zu messen. Wenn Messungen möglich waren stattfanden, reichte die Spannbreite von Einmal- bis Mehrfachmessungen und von Messungen nach kurzer oder jahrelanger Kampagnendauer.
• Bei der Wirksamkeit der untersuchten Massenmedienkampagnen unterschieden die Au-torInnen Interessenbekundungen und Absichtserklärungen, künftig körperlich aktiv zu werden von tatsächlichen Veränderungen des körperlich aktiven Verhaltens. Bei der Messung der Rückantworten auf entsprechende Informationsangebote schwankten die Werte erheblich. In den 7 der 18 evaluierten Kampagnen, die überhaupt nach Absichtserklärungen suchten, fanden die ForscherInnen nur bei einer Kampagne einen statistisch signifikanten Anstieg der Absicht, körperlich aktiv zu werden. Bei den anderen Kampagnen war meist der Anteil der teilnehmenden Personen so klein, dass keine signifikanten Aussagen zu gewinnen waren. In der Evaluation von 15 der 18 Kampagnen wurde nach praktischen Veränderungen des körperlichen oder Bewegungsverhaltens gefragt und auch entsprechende Anzeichen gefunden. Diese unterschieden sich aber nur in sieben der 15 Kampagnen statistisch signifikant von Verhaltensänderungen in der jeweiligen Vergleichsgruppe. Vier dieser sieben Kampagnen hatten ein quasi-experimentelles Design, dauerten als Kohortenstudie mehr als 5 Monaten und könnten insofern relativ verlässliche und dauerhaftere Hinweise auf Verhaltensänderungen liefern. Ein Grund, warum insgesamt relativ wenige Daten zur Wirksamkeit der Kampagnen vorliegen, könnte darin liegen, dass viele der nicht-experimentellen Studien nur ein einziges Mal versuchten, ihre Wirksamkeit zu messen.
Um künftige Kampagnen oder Interventionen dieser Art besser bewerten und vergleichen zu können, schlagen die AutorInnen für künftige vergleichbare Kampagnen ein optimales Evaluationsdesign vor, das folgende Elemente enthalten sollte: Überblick zu den theoretischen Grundlagen der gewählten Informationsmodelle, Kampagneninhalte und Evaluationsdesigns, ein Kohortenstudien-Design mit mehreren Datensammlungspunkten, eine ausreichend lange Dauer, valide Messverfahren und ausreichende finanzielle und andere Ressourcen für die Evaluation.
Von dem 2011 veröffentlichten Aufsatz von Justine E. Leavy et al. "Physical activity mass media cam-paigns and their evaluation: a systematic review of the literature 2003-2010", erschienen in der Zeitschrift "Health Education Research" (26 [6]: 1060-1085), gibt es lediglich das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 29.1.12
Welchen Nutzen hat die Berichterstattung über kranke oder sterbende Prominente in den Massenmedien für Public Health?
 Die auf hohem quantitativen Niveau immer noch wachsende Anzahl von "yellow press"-Zeitschriften, Promi-TV-Magazinen aber auch "Promi-Spalten" in seriöseren Publikationsorgane lebt komplett oder teilweise davon, das auch Hollywood-Schauspieler, Politiker, Top-Models, Adlige oder Schriftsteller schwer erkranken oder an einer schweren Erkrankung sterben - und das möglichst in regelmäßigen Abständen.
Die auf hohem quantitativen Niveau immer noch wachsende Anzahl von "yellow press"-Zeitschriften, Promi-TV-Magazinen aber auch "Promi-Spalten" in seriöseren Publikationsorgane lebt komplett oder teilweise davon, das auch Hollywood-Schauspieler, Politiker, Top-Models, Adlige oder Schriftsteller schwer erkranken oder an einer schweren Erkrankung sterben - und das möglichst in regelmäßigen Abständen.
Man kann diese Berichterstattung samt und sonders als ausschließlich einer höheren Auflage oder Quote dienend kritisieren oder ignorieren. Man kann aber auch die Beteuerungen mancher Journalisten ernst nehmen, ihre von Inhalt und Aufmachung sachlichere Berichterstattung diene der gesundheitlichen Aufklärung jener großen Anzahl von BürgerInnen, die nicht "ihren Pschyrembel" oder die "MSD Manual"-DVD zur Hand haben und in- und auswändig kennen. Gerade das Schicksal eines Prominenten berühre und bewege viele Menschen auch mehr als eine inhaltlich identische Erkrankung von Tausenden Lieschen Müller. Dies könne dann Antrieb und Motiv für eigenes präventives Verhalten sein.
Ob und wie das Bewertungsdilemma gelöst werden kann, lässt sich mit den Ergebnissen einer gerade im "Journal of Public Health" veröffentlichten Fallstudie über die mediale Berichterstattung zur Gebärmutterhalskrebserkrankung und des Todes des britischen Fernsehstars Jade Goody im Jahr 2009, etwas genauer klären.
Dazu suchte eine Forschergruppe in allen Artikeln der nationalen britischen Zeitungen in denen der Namen "Jade Goody" und "Krebs" vorkam nach Public Health-Botschaften. Angaben der Google-Suchmaschine wurden genutzt, um die Internetsuche als ein Maß der Suche nach Public Health-Informationen zu diesem speziellen Ereignis zu quantifizieren.
Das Ergebnis der Recherche lautet:
• Insgesamt gab es 1.203 Artikel. Von diesen enthielten 116 bzw. 9,6% eine klare Public Health-Botschaft.
• Die Mehrheit hob die Existenz und Möglichkeit oder die Notwendigkeit von Screeninguntersuchungen hervor. Verschwindend wenige Artikel lieferten Ratschläge zur möglichen Impfung gegen bestimmte Erregertypen des Gebärmutterhalskrebses. Artikel, die sich mit der Anzahl der Sexualpartner, dem Rauchstatus und der Benutzung vcon Kondomen befassten, waren sehr selten.
• Der Tod der Fernsehberühmtheit erhöhte die Anzahl der Internetrecherchen mit den Begriffen "Gebärmutterhalskrebs" und "Abstrich-Test". Die Suche mit dem Wort "HPV" war allerdings nur schwach ausgeprägt.
• Die Berichterstattung über das Gebärmutterkrebs-Screening nahm innerhalb der Untersuchungszeit zu.
Die AutorInnen ziehen insgesamt den Schluss, dass das öffentliche Interesse an der Prävention von Erkrankungen ansteigt, wenn über die Erkrankungen von Prominenten berichtet wird. Obwohl dabei auch Public Health-Informationen verbreitet werden, zielen diese überwiegend auf die Sekundär- und nicht auf die Primärprävention. Ob man ihrer These, der Public Health-Nutzen künftiger Berichterstattung über Prominentenerkrankungen könne noch maximiert werden zustimmt, hängt wohl stark davon ab, ob und wie sich der Quoten- und Auflagendruck und die dadurch erzeugte Sensationshascherei abbauen. Das Gegenteil ist aber vermutlich realistisch. Trotz der kargen Ergebnisse dieser Studie ist dem Interesse an den Massenmedien und ihrer Wichtigkeit als Verbreiter von Public Health-Sichtweisen und -erkenntnissen in der durchschnittlichen Bevölkerung uneingeschränkt zuzustimmen.
Von dem Aufsatz "Media coverage and public reaction to a celebrity cancer diagnosis" von D. Metcalfe et al., der im britischen Fach-Journal of Public Health (201; 33 (1): 80-85) veröffentlicht wurde, gibt es lediglich das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 2.7.11
Mythen zur Gesundheitspolitik: Auch in gebildeten Bevölkerungskreisen weit verbreitet
 Gesundheitspolitische Entscheidungen der letzten Jahrzehnte gingen nicht selten von Annahmen über ökonomische und soziale Verhältnisse aus, die schon seit vielen Jahren als Mythen charakterisiert und kritisiert wurden. Solche Mythen sind keine Hirngespinste, simple Manipulationen oder "hinterlistige" Verschwörungstheorien, sondern Umwandlungen komplexer sozialer oder geschichtlicher Sachverhalte in einfachere Zustände, bei denen immer "einiges unter den Tisch" fällt. Braun u.a. und zuletzt Reiners haben gesundheitspolitische Mythen aufgegriffen und gezeigt, wie stark diese in den Medien verbreitet sind. In einer Befragung des "Gesundheitsmonitor" wurden jetzt 1.520 Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen nach ihrem Kenntnisstand und ihrer Bewertung bekannter Mythen gefragt. Untersucht werden sollte damit, in wie starkem Maße Medien bewusstseinsbildend sind und ob Mythen im Bewusstsein der Versicherten auch gesundheitspolitische und Reformvorschläge beeinflussen.
Gesundheitspolitische Entscheidungen der letzten Jahrzehnte gingen nicht selten von Annahmen über ökonomische und soziale Verhältnisse aus, die schon seit vielen Jahren als Mythen charakterisiert und kritisiert wurden. Solche Mythen sind keine Hirngespinste, simple Manipulationen oder "hinterlistige" Verschwörungstheorien, sondern Umwandlungen komplexer sozialer oder geschichtlicher Sachverhalte in einfachere Zustände, bei denen immer "einiges unter den Tisch" fällt. Braun u.a. und zuletzt Reiners haben gesundheitspolitische Mythen aufgegriffen und gezeigt, wie stark diese in den Medien verbreitet sind. In einer Befragung des "Gesundheitsmonitor" wurden jetzt 1.520 Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen nach ihrem Kenntnisstand und ihrer Bewertung bekannter Mythen gefragt. Untersucht werden sollte damit, in wie starkem Maße Medien bewusstseinsbildend sind und ob Mythen im Bewusstsein der Versicherten auch gesundheitspolitische und Reformvorschläge beeinflussen.
Die jetzt in einem Newsletter veröffentlichte Studie zeigt zunächst einige zentrale gesundheitspolitische Mythen auf:
• Zu den Klassikern gehören die "Kostenexplosion" und die zu hohen "Lohnnebenkosten", was zumeist so dargestellt wird, dass dies entweder das Finanzvolumen für andere wichtige gesellschaftliche Aufgaben verringert oder die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im Ausland und damit Arbeitsplätze gefährdet.
• Der "medizinisch-technische Fortschritt" besetzt in der Gesundheitspolitik oft zusammen mit der "demografischen Entwicklung" eine widersprüchliche Rolle: Einerseits wird durch die scheinbar unvermeidbare Kostenentwicklung der GKV-Beitragssatz in den Jahren 2040 und 2050 angeblich irgendwo zwischen 15 und 40% liegen, andererseits gilt er aber auch als der entscheidende Faktor, der zukünftig maßgeblich zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage beiträgt. Dabei ist allerdings festzustellen, dass ein erheblicher Teil neuer Innovationen keinen nachgewiesenen Nutzen oder keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber bereits vorhandenen Leistungen hat.
Das "nachfragerinduziertes Angebot", die immensen Verwaltungsausgaben der GKV und das Menetekel der demografischen Entwicklung sind weitere Mythen, die dargestellt und deren Unstimmigkeit aufgezeigt wird. Sodann werden Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsumfrage dargestellt. Hervorzuheben sind unter anderem folgende Befunde.
• Eine große Zahl von Mythen ist im Bewusstsein der GKV-Versicherten "angekommen". Schaut man sich genauer an, welche Teilgruppen für Mythen besonders empfänglich oder aber eher immun sind, ergibt sich ein zum Teil unerwartetes und differenziertes Bild. Die Erwartung, dass ein aktives und aufgeklärtes Verhalten im Gesundheitssystem (z.B. Inanspruchnahme von speziellen Programmen oder Nutzung der Kassenwahlfreiheit) die Übernahme von Mythen hemmt, muss zum Teil revidiert werden.
• Dass häufige NutzerInnen einer Vielzahl von Informationsquellen nicht weniger, sondern eher mehr anfällig sind, wirft eine Reihe von Folgefragen auf. Dass das Bildungsniveau keine besonders große Rolle spielt für eine "aufgeklärte" Haltung gegenüber Mythen ist insofern nicht verwunderlich, als gesundheitspolitische und gesundheitswissenschaftliche Themen im Bildungssystem kaum eine Rolle spielen.
Diskutiert werden aber auch praktische Veränderungsmöglichkeiten. Hingewiesen wird darauf, dass es bereits eine "Patienten-Universität" gibt, an der BürgerInnen intensive Kenntnisse erlangen können über das Herz-Kreislauf-System, Erkrankungen der Atemwege und viele andere medizinische Themen. Und eine große Zahl seriöser Einrichtungen, wie zum Beispiel das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) oder Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung bieten im Internet fundierte Informationen über Krankheiten, ihre Prävention und Therapie. Eine fundierte und systematische, nicht von Mythen durchsetzte Informationsquelle über Rahmenbedingungen und Finanzierungsmodalitäten, Akteure und Interessenbindungen im Gesundheitswesen sucht man unseres Wissens jedoch bislang vergeblich, sieht man von partikularen Informationen zu einzelnen Themen in den Medien einmal ab.
Mythen, so argumentieren die Wissenschaftler weiter, sind nicht nur als Denkfiguren bei zahlreichen Versicherten angekommen, sondern beeinflussen ihrerseits eine Reihe von wichtigen gesundheitspolitischen Einstellungen und fördern auch die Zustimmung zu zahlreichen radikalen gesundheitspolitischen Lösungsvorschlägen. Eine aktive Auseinandersetzung mit und Gegenaufklärung zu den am weitesten verbreiteten Mythen ist daher eine wichtige notwendige Voraussetzung für eine rationale und soziale Gesundheitspolitik. Solche Aktivitäten müssten allerdings inhaltlich und in der Form anders aussehen als die Mehrzahl der aktuell am meisten genutzten Informationsangebote.
Konkret könnte dies heißen, dass etwa der GKV-Spitzenverband in Kooperation mit GKV-eigenen (z.B. WidO, WINEG) oder -nahen Instituten eine dem kanadischen Projekt der "Mythbusters" vergleichbares Angebot (z.B. "Vorsicht Mythos") im Internet einrichtet und laufend erweitert. Dessen Inhalte könnten in entsprechenden Rubriken der kasseneigenen Mitgliedszeitschriften weiter verbreitet werden und auch anderen Medien zur Verfügung gestellt werden. Allgemeiner sollten gesetzliche Krankenkassen auch bemüht sein, die Evidenz-Maßstäbe, die sie zunehmend an die Solidität von Vorschlägen und Handlungen von Leistungsanbietern anlegen, bei sich selber anzulegen bzw. systematisch durch Dritte anlegen zu lassen und deren Erkenntnisse auch selbstkritisch zu verbreiten.
Die Studie steht als PDF-Datei kostenlos zur Verfügung: "Mythen zur Gesundheitspolitik: Auch gebildete Bürger irren" (Autoren: Bernard Braun, Gerd Marstedt), Gesundheitsmonitor Newsletter 2/2010,.
Als Buchveröffentlichungen oben genannt:
• Braun Bernard, Kühn Hagen, Reiners Hartmut (1998): Das Märchen von der Kostenexplosion. Frankfurt a.M. (vergriffen)
• Reiners Hartmut (2010): Mythen der Gesundheitspolitik. Bern.
Gerd Marstedt, 4.8.10
US-Massenmedien und Krebs - Nebeneinander von Risiko-Verharmlosung und Schweigen über palliative Angebote
 Krebserkrankungen gehören zu den häufigsten schweren Erkrankungen in allen industrialisierten Gesellschaften und auch zu den tödlichsten. In den USA sterben trotz vieler medizinisch-technischer Fortschritte noch rund die Hälfte der an Krebs erkrankten Personen - nicht selten nach schweren Schmerzen und heftigen Nebenwirkungen von Chemotherapie und anderen aggressiven Therapien.
Krebserkrankungen gehören zu den häufigsten schweren Erkrankungen in allen industrialisierten Gesellschaften und auch zu den tödlichsten. In den USA sterben trotz vieler medizinisch-technischer Fortschritte noch rund die Hälfte der an Krebs erkrankten Personen - nicht selten nach schweren Schmerzen und heftigen Nebenwirkungen von Chemotherapie und anderen aggressiven Therapien.
Entsprechend große Aufmerksamkeit genießen daher die Erkrankungen und ihre Therapien in den Massenmedien. Nur was eigentlich im Mittelpunkt der Berichterstattung der Print-Massenmedien steht und was nicht, ist eigentümlicherweise nicht sehr transparent.
Für die USA ist dieser Zustand jetzt durch eine große Analyse der Krebsberichterstattung in 8 großen und renommierten Tageszeitungen (z.B. New York Times, Chicago Tribune oder Philadelphia Inquirer) und 5 bundesweiten Magazinen (z.B. Newsweek, Time und People) im Zeitraum 2005 bis 2007 beendet. Aus einer Gesamtzahl von 2.228 insgesamt mit über 200 Worten zum Thema veröffentlichten Artikeln und Meldungen suchte die Forschergruppe der Universität von Pennsylvania per Zufall 436 Artikel aus und untersuchte sie inhaltsanalytisch.
Aus der Fülle der Ergebnisse sind die Interessantesten und für die öffentliche Risikokommunikation und -perzeption Wichtigsten:
• Über positive Ergebnisse der Krebsbehandlung und aggressive Behandlungsstrategien wird wesentlich häufiger berichtet als über palliativmedizinische Behandlung und das Sterberisiko. 32,1 % aller Artikel fokussierten auf eine erfolgreiche Behandlung von mindestens einem Patienten, nur 7,6 % aller Berichte beschäftigten sich mit Patienten, die starben oder die zu sterben drohten. Nur 2,2 % aller Berichte in den untersuchten Printmedien handelten ausgewogen von positiven und negativen Behandlungsergebnissen.
• Obwohl rund 50 % aller Krebskranken in den USA an ihrer Erkrankung sterben, überlebten von den 216 krebskranken Personen über die in den untersuchten Massenmedien namentlich berichtet wurde, 78,7 % und nur 21,3 % starben.
• 75 % der Presseberichte befassten sich nur mit den aggressiven Formen der Behandlung, nur 13,1 % gaben aber dabei an, dass solche Behandlungsformen nicht immer zu einem verbesserten Überleben beitragen, sondern auch tödlich enden können. Nur 0, 5 % aller Artikel (insgesamt zwei der 436 Artikel) sprachen die Behandlung und Versorgung am Lebensende an, während wenigstens 2,5 % der Artikel sowohl über aggressive Behandlungen als auch über Palliativversorgung berichteten.
• Dieses Bild wird noch dadurch abgerundet, dass trotz der ernsthaften und sogar gefährlichen Nebenwirkungen, die Krebsbehandlungen haben können, nur 30 % der Artikel die Möglichkeit unerwünschter Wirkungen zumindest erwähnt.
Die AutorInnen weisen darauf hin, dass eine derartig überoptimistische Berichterstattung nicht nur Millionen von Menschen hinters Licht führt und sie überhaupt nicht oder falsch über die unerwünschten Folgen zu aggressiver Behandlung informiert. Sie riskiert außerdem, dass Menschen, die z.B. nur noch eine qualitativ hochwertige Palliativversorgung gegen die häufigen schweren Schmerzen brauchen, gar nichts über die Möglichkeiten moderner Schmerztherapien, die Existenz von wirksamen palliativmedizinischen Hilfen und Hospizen wissen und sie im Leidensfall auch oft nicht mehr "in aller Ruhe" suchen können. So hilfreich im Zusammenhang mit ERkrankungen auch die Devise "think positive" sein mag, so negativ endet dies für die nicht kleine Gruppe der Krebspatienten mit dem ausschließlichen Bedarf an palliativen Hilfen.
Vergleichbare Untersuchungen zur Darstellung der Risiken anderer Krankheiten (z.B. Diabetes oder Demenz) und ihrer Prävention und Therapie in allen (z.B. einschließlich kostenloser Apothekenzeitschriften) in Deutschland verbreiteten Print- wie aber auch elektronischen Medien (z.B. TV und Internetportale) wären wünschenswert. Erste völlig unrepräsentative und oberflächliche Eindrücke lassen vermuten, dass es dabei keine wesentlich besseren, d.h. wirklichkeitsgerechteren Ergebnisse geben wird.
Eine gerade veröffentlichte Untersuchung über die Verbreitung potenter gesundheitspolitischer Mythen (z.B. "Kostenexplosion", "demografische Bedrohung") in der deutschen Bevölkerung, hat im Übrigen gezeigt, dass selbst die intensive Lektüre der zahlreichen Krankenkassenzeitschriften, Apothekenzeitschriften und anderen so genannten Gesundheitsinformationsangeboten nicht verhindert, dass ihre Leser-/ZuschauerInnen vielen der genannten und weiteren Mythen voll aufsitzen und daraus auch falsche gesundheitspolitische Orientierungen gewinnen.
Dies und weitere Daten über das "Ankommen" von Mythen in der Bevölkerung kann man in der neuesten Ausgabe des Newsletters des "Gesundheitsmonitors" nachlesen: "Mythen zur Gesundheitspolitik - Auch gebildete Bürger irren." von Bernard Braun und Gerd Marstedt: Gesundheitsmonitor-Newsletter 2-2010.
Von der Studie "Cancer and the Media. How Does the News Report on Treatment and Outcomes?" von Jessica Fishman, Thomas Ten Have und David Casarett, erschienen in den "Archives of Internal Medicine" (2010;170(6): 515-518) ist kostenlos ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 31.7.10
Krebserkrankungen in US-amerikanischen Medien: Viele Berichte dokumentieren das Überleben, nur wenige das Sterben
 Erst vor kurzem veröffentlichte die "American Cancer Society" einen Bericht, der deutlich machte: Trotz aller Fortschritte in der Therapie ist der Kampf gegen Krebs noch lange nicht gewonnen. Etwa die Hälfte der US-amerikanischen Männer und jede dritte Frau bekommt im Laufe des Lebens eine Krebsdiagnose, mehr als eine halbe Million Amerikaner sterben jedes Jahr an Krebs, etwa jeder zweite Krebspatient stirbt an dieser Krankheit oder einer Folgeerkrankung. Spiegelt sich diese eher deprimierende Bilanz auch in den Medien wider?
Erst vor kurzem veröffentlichte die "American Cancer Society" einen Bericht, der deutlich machte: Trotz aller Fortschritte in der Therapie ist der Kampf gegen Krebs noch lange nicht gewonnen. Etwa die Hälfte der US-amerikanischen Männer und jede dritte Frau bekommt im Laufe des Lebens eine Krebsdiagnose, mehr als eine halbe Million Amerikaner sterben jedes Jahr an Krebs, etwa jeder zweite Krebspatient stirbt an dieser Krankheit oder einer Folgeerkrankung. Spiegelt sich diese eher deprimierende Bilanz auch in den Medien wider?
Ein Forschungsteam aus Philadelphia führte dazu eine Inhaltsanalyse von Medienberichten durch, bei der 436 Artikel über Krebs-Erkrankungen detailliert untersucht wurden. Ihre Studie wurde jetzt in der renommierten Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht. Das Ergebnis ist überraschend: In den Medien dominiert eine positiv-optimistische Darstellung. Etwa jeder dritte Bericht (32%) handelte vom Überleben im Kampf gegen den Krebs, nur jede zwölfte (8%) andererseits fokussierte das Thema Sterben und Tod.
Die Wissenschaftler wählten für ihre Inhaltsanalyse zunächst 5 Magazine (darunter: Newsweek, Time) und 8 Tageszeitungen (darunter: Chicago Tribune, New York Times, Philadelphia Daily News) aus, Medien, die jeweils eine sehr große Leserzahl erreichen. Internet-Seiten und Fernseh-Sendungen als Medien wurden bewusst nicht eingeschlossen, da Umfragen gezeigt haben, dass Print-Medien eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit zuerkannt wird. In den ausgewählten Medien wurden dann 2228 Artikel mit über 200 Wörtern gefunden, die sich mit dem Thema Krebs beschäftigten. Nach dem Zufallsprinzip wurden dann 20 Prozent ausgewählt, so dass die Analyse-Stichprobe aus 436 Artikeln bestand.
Bei jedem dieser Artikel wurde dann geprüft, welches Thema dort behandelt wurde. Dabei beschränkte man sich auf sechs nach Ansicht der Forscher besonders relevante Themen: Überleben bei Krebs, Tod und Sterben, aggressive Krebstherapien, Versagen von Therapien, unerwünschte Nebenwirkungen, palliative Hilfe und Hospiz-Unterbringung. Als Ergebnis dieser Analysen zeigte sich dann:
• Überleben oder Sterben: 32% der Artikel thematisierten das Überleben trotz Krebs, nur 8% berichteten über das Sterben bzw. den Tod von Krebspatienten. Bei 2% der Artikel waren beide Themen zu finden. In einer weiteren Analyse wurde mitberücksichtigt, über wie viele Patienten berichtet wurde. Das Ergebnis fiel hier noch eindeutiger zugunsten optimistischer Berichte aus: 173 Artikel berichteten über 216 Krebspatienten. Bei 79% stand das Überleben im Mittelpunkt, nur bei 21% der Tod.
• Therapie-Versagen und unerwünschte Nebenwirkungen: Nur sehr wenige Artikel (13%) berichteten darüber, dass Therapien versagen oder bestimmte Krebsarten unheilbar sind, weniger als ein Drittel (30%) darüber, dass Krebstherapien sehr unerfreuliche Nebenwirkungen haben (wie Haarausfall, Schmerzen, Übelkeit)
• Aggressive Therapien und Versorgung am Lebensende: Ein sehr großer Teil (57%) der Berichte beschäftigte sich ausschließlich mit näheren Umständen und Effekten aggressiver Krebstherapien. Im Vergleich dazu gab es kaum Berichte (1%), die sich allein mit den Bedingungen palliativer Versorgung (Schmerztherapie) beschäftigten oder dem Thema Sterbehospiz.
In der Diskussion ihrer Befunde veranstalten die Wissenschaftler zwar keine Medien-Schelte, weisen aber schon sehr deutlich darauf hin, dass in den einbezogenen Printmedien eine Berichterstattung überwiegt, die das Thema Krebserkrankungen und Medizin allzu optimistisch und naiv-fortschrittsgläubig darstellt. Das Thema Palliativmedizin und Sterbehospiz wird fast völlig ausgeblendet, andererseits wird sehr umfassend und detailliert über aggressive Chemo- und Strahlentherapien berichtet und auch das Überleben von Krebspatienten steht sehr viel häufiger im Mittelpunkt als ihr Sterben. All dies so die Wissenschaftler, dürfte sehr nachhaltige Effekte haben auch für Patienten-Entscheidungen über ihre medizinische Versorgung nach der Krebsdiagnose.
Hier ist ein Abstract: Jessica Fishman; Thomas Ten Have; David Casarett. Cancer and the Media: How Does the News Report on Treatment and Outcomes? ( Arch Intern Med, 2010; 0 (2010): 2010. 11)
Gerd Marstedt, 17.3.10
Gesundheitsexperten artikulieren massive Kritik am Weihnachtsmann: Ein überaus negatives Vorbild
 Ronald McDonald, eine 1966 ins Leben gerufene Werbefigur von McDonald's, genießt bei amerikanischen Kindern eine noch höhere Wertschätzung als der Präsident oder der Papst. Als Werbefigur also ein Riesenerfolg! In dieser Hinsicht übertroffen wird er nur noch vom Weihnachtsmann, in englischsprachigen Ländern Santa Claus genannt. Und dieser wurde in einer Vielzahl von TV-Spots und Inseraten von unterschiedlichsten Unternehmen, von Coca-Cola über Camel-Zigaretten bis hin zu Keksen und Tageszeitungen, für Werbezwecke funktionalisiert. Das ginge ja noch in Ordnung, erklären Nathan J. Grills und Brendan Halyday in einem Aufsatz, der jetzt im British Medical Journal (BMJ) veröffentlicht wurde. Nicht mehr in Ordnung sei es jedoch, dass der Weihnachtsmann in der Werbung ebenso wie im Volksmund und in Illustrationen nachhaltig gegen eine Vielzahl von Public-Health-Zielen zum Gesundheitsverhalten verstoße.
Ronald McDonald, eine 1966 ins Leben gerufene Werbefigur von McDonald's, genießt bei amerikanischen Kindern eine noch höhere Wertschätzung als der Präsident oder der Papst. Als Werbefigur also ein Riesenerfolg! In dieser Hinsicht übertroffen wird er nur noch vom Weihnachtsmann, in englischsprachigen Ländern Santa Claus genannt. Und dieser wurde in einer Vielzahl von TV-Spots und Inseraten von unterschiedlichsten Unternehmen, von Coca-Cola über Camel-Zigaretten bis hin zu Keksen und Tageszeitungen, für Werbezwecke funktionalisiert. Das ginge ja noch in Ordnung, erklären Nathan J. Grills und Brendan Halyday in einem Aufsatz, der jetzt im British Medical Journal (BMJ) veröffentlicht wurde. Nicht mehr in Ordnung sei es jedoch, dass der Weihnachtsmann in der Werbung ebenso wie im Volksmund und in Illustrationen nachhaltig gegen eine Vielzahl von Public-Health-Zielen zum Gesundheitsverhalten verstoße.
Deutlich machen ließe sich dies in mehrfacher Hinsicht:
• Übergewicht: Epidemiologisch nachweisbar ist zunächst, dass Länder, in denen der Weihnachtsmann verehrt wird, auch höhere Quoten aufweisen, was übergewichtige und adipöse Kinder anbetrifft. Damit sei zwar kein Kausalzusammenhang bewiesen, aber viele Indizien deuten in diese Richtung: Der Weihnachtsmann (selbst schon meist von recht üppiger Leibesfülle) bringt Kindern Kekse und Schokolade, Erwachsenen Schnaps und dick machende Speisen. Mit dieser Tradition, so die Autoren, solle man schleunigst Schluss machen und ebenso sollte die träge Fortbewegungsart des Weihnachtsmanns (von Rentieren auf einem Schlitten gezogen) baldigst geändert werden, indem er beispielsweise auf einem Fahrrad oder joggend seine Geschenke verteilt.
• Rauchen: Zwar ist in vielen Ländern inzwischen die Werbung für Tabakwaren generell verboten, so dass auch der Weihnachtsmann hier nicht mehr für dieses Gesundheitsrisiko werben kann. Auf vielen alten Postkarten und in Büchern sieht man ihn jedoch immer noch vergnügt eine Pfeife oder dicke Zigarre rauchen. Man stelle sich den Kommentar eines 12jähriges Kindes vor, mahnen Grills und Hallyday, das solche Bilder sieht: "Schau mal, Mutti, ist rauchen wirklich so schlimm? Hier der Weihnachtsmann raucht doch auch, und er ist bestimmt 99 Jahre alt und hat keinen Lungenkrebs!"
• Ein schlechtes Vorbild für mancherlei riskante Verhaltensgewohnheiten: In vielerlei Hinsicht, so die Autoren, steht der Weihnachtsmann immer noch für riskante Verhaltensweisen und fungiert damit als sehr schlechtes Vorbild: Er betreibt Extremsportarten wie das Herumrutschen auf Dächern oder das Hineingleiten in Kaminen. Und trotz der horrenden Geschwindigkeit, mit der er sich im Rentierschlitten fortbewegt, hat man ihn noch niemals einen Schutzhelm oder Sicherheitsgurt tragen sehen.
Und nicht zuletzt geht von der Gewohnheit, dem Weihnachtsmann zur Begrüßung einen Kuss zu geben, auch ein gewaltiges Ansteckungsrisiko für unterschiedlichste Infektionskrankheiten aus, wenn man bedenkt, dass er an Weihnachten wohl von einigen Millionen Männern und Frauen bakterielle verunreinigte Küsse bekommt. In Zeiten von Pandemien wie Hühner- und Schweinegrippe sei diese Tradition daher von besonderem Übel und müsse auf der Stelle gestoppt werden. Allerdings, so das Schlusswort der australischen Autoren, sei die Evidenz zu dieser Thematik eher unbefriedigend und weitere Forschungsarbeit unbedingt nötig.
Leider ist nur ein Auszug des Essay kostenlos verfügbar: Nathan J Grills, Brendan Halyday: Christmas 2009: Christmas Fayre. Santa Claus: a public health pariah? (BMJ 2009;339:b5261; Published 16 December 2009, doi:10.1136/bmj.b5261)
Gerd Marstedt, 21.12.09
Ökonomie der Aufmerksamkeit: Täglich 13.000 tote Kinder und Mütter in Afrika und weltweit 6.250 Schweinegrippetote in 7 Monaten
 Während in Deutschland mit dem Tod von 16 Personen (Stand vom 13.11.2009) die Notwendigkeit des mehrere Hundert Millionen Euro schweren Schweinegrippe-Impfprogramms gerechtfertigt oder bestritten wird und der Fall des bisher einzigen Menschens, der nach Inanspruchnahme dieser Impfung mutmaßlich daran gestorben ist, wahrscheinlich erneut erbitterte Debatten über ihren Nutzen und mögliche Alternativen auslöst, sterben in anderen Ländern oder Regionen der Erde eine vielfache Anzahl von Menschen, ohne dass dies auch nur irgendjemand außerhalb dieser Regionen interessiert, aufregt oder über Gegenmaßnahmen nachdenken lässt.
Während in Deutschland mit dem Tod von 16 Personen (Stand vom 13.11.2009) die Notwendigkeit des mehrere Hundert Millionen Euro schweren Schweinegrippe-Impfprogramms gerechtfertigt oder bestritten wird und der Fall des bisher einzigen Menschens, der nach Inanspruchnahme dieser Impfung mutmaßlich daran gestorben ist, wahrscheinlich erneut erbitterte Debatten über ihren Nutzen und mögliche Alternativen auslöst, sterben in anderen Ländern oder Regionen der Erde eine vielfache Anzahl von Menschen, ohne dass dies auch nur irgendjemand außerhalb dieser Regionen interessiert, aufregt oder über Gegenmaßnahmen nachdenken lässt.
Aktuell gemeint ist die Tatsache, dass in der so genannten Sub-Sahara-Zone Afrikas jährlich 265.000 Mütter an Komplikationen während einer Schwangerschaft und einer Geburt sterben, 1.243.000 Babies innerhalb ihres ersten Lebensmonats sterben und 3.157.000 Kinder, die den ersten Lebensmonat überlebt haben, vor ihrem fünften Geburtstag sterben. Dies bedeutet, dass in dieser Region jeden Tag mehr als 13.000 Kinder und Mütter sterben - rund die Hälfte aller weltweit sterbenden Kinder und Mütter. 880.000 totgeborene Kinder wurden dabei noch nicht einmal berücksichtigt.
Nur um noch einen weiteren Einblick in die Ökonomie oder Priorisierung der Aufmerksamkeit gewinnen zu können: In der gesamten WHO-Region Afrika sind nach WHO-Angaben bis Anfang November 2009, also in ca. 7 Monaten Schweinegrippe-Pandemie, 103 Menschen an ihr gestorben.
Die aktuellen Zahlen zur Kinder- und Müttersterblichkeit im ärmsten Teil Afrikas und die Behauptung, das Leben von beinahe 4 Millionen Frauen, Neugeborenen und Kinder in dieser Region könne gerettet werden, wenn eine Reihe wissenschaftlich evidenter, erprobter und finanziell erschwinglicher Gesundheitsinterventionen 90% der Familien erreichen würden, gehören zu den wesentlichen Aussagen eines Reports, den die nationalen wissenschaftlichen Akademien von sieben afrikanischen Ländern am 9. November 2009 auf der jährlichen Konferenz der "African Science Academy Development Initiative" in Accra, Ghana, vorgestellt haben.
Zu den für wirksam gehaltenen Interventionen gehören die Erhältlichkeit von Verhütungsmitteln, gut ausgebildete GeburtshelferInnen, Belebungsprogramme für Neugeborene und insgesamt verbesserte Versorgung von Neugeborenen, ein Fallmanagement für Lungenentzündungen, die Förderung des Stillens, die Malariaprävention und die Durchführung ausgewählter Impfungen. Den enormen maximalen Wirkungsgrad dieser Interventionen berechneten die afrikanischen WissenschaftlerInnen mittels des Analyseprogramms "Lives Saved Tool (LiST)".
Die Einführung dieser Interventionen in den neun für die Berechnungen ausgewählten Ländern der Region (Ghana, Kenia, Senegal, Tansania, Uganda, Kamerun, Südafrika, Nigeria und Äthiopien) würde in zwei Jahren 2 US-$ pro Kopf der Bevölkerung kosten.
Der Bericht enthält über die Anzahl von Toten hinaus zahlreiche statistische Angaben zu den Gesundheitsverhältnissen in dieser Region der Welt, zu den dort existierenden Gesundheitssystemen und auch eine Anzahl von Beispielen für die Machbarkeit und den Erfolg derartiger Programme.
Das Aufwiegen und -rechnen von Toten ist natürlich keine wissenschaftlich und moralisch zulässige Methode. Trotzdem ist dem folgenden Satz aus einem Kommentar zum Nebeneinander der Vernachlässigung der ebenfalls für ein Sechstel der Weltbevölkerung potenziell tödlichen Unternährung und des mit Milliardenaufwand geführten Kampfes gegen die Schweinegrippe im renommierten Medizin-Journal "Lancet" vom 31. Oktober 2009 uneingeschränkt zuzustimmen: "Es ist schwierig, sich eine andere Situation vorzustellen, die gegenwärtig mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung beeinträchtigt. Eine, die durch reichlich vorhandene Hinweise auf negative gesundheitliche Spätfolgen gekennzeichnet ist, und die durch einfache Maßnahmen - nämlich Nahrung - behoben werden könnte, und bei der Vorbeugung elementar ist - ausreichend Nahrung muss verzehrt werden (bevorzugt unverarbeitete Kost, die vor Ort gekocht und zubereitet werden kann). Wäre die Unterernährung eine Krankheit wie H1N1, und wären unverarbeitete Lebensmittel Medikamente oder Impfstoffe, dann genössen beide die volle Aufmerksamkeit der gesamten internationalen Gemeinschaft."
Der 23 Seiten umfassende und trotz seiner Kürze sehr materialreiche Report "SCIENCE IN ACTION. Saving the lives of Africa's mothers, newborns, and children ist kostenlos erhältlich.
Den kompletten Text des Kommentars "The undernutrition epidemic: an urgent health priority" in The Lancet, Volume 374, Issue 9700, Page 1473, 31 October 2009 erhält man komplett und kostenlos nur (also nicht ärgern, dass dieser Link nicht zum kompletten Text führt), wenn man sich ebenfalls kostenlos für den Service für teilweise freien Zugang dieser Zeitschrift anmeldet. Macht man dies braucht man keine Belästigung durch Werbung etc. zu befürchten.
Bernard Braun, 14.11.09
Australische Studie: Kritik an Medienberichten über medizinische Innovationen
 Medizinische Entdeckungen, neue Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie werden in der Öffentlichkeit meist zuerst bekannt über die Massenmedien. Im Bemühen um Auflagenhöhen und Sendequoten werden allerdings nicht selten auch unrealistische Hoffnungen auf Krankheitsheilung erweckt oder Ängste geschürt, was Krankheitsrisiken anbetrifft. Journalisten und Redakteure, die in der Regel nicht über eine medizinische Ausbildung verfügen, sehen sich allerdings oft auch allein gelassen mit medizinischen Fachinformationen und Pressemitteilungen von Pharma-Unternehmen, Ärzte-Verbänden oder auch Forschungseinrichtungen, die damit ein spezifisches Interesse verfolgen. In Australien wurde daher im Jahre 2005 die Internetseite "The Media Doctor" ins Leben gerufen, um Stärken und Schwächen von Medienberichten zu gesundheitlichen und medizinischen Themen zu analysieren und darauf aufbauend Verbesserungsmöglichkeiten zu ersinnen.
Medizinische Entdeckungen, neue Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie werden in der Öffentlichkeit meist zuerst bekannt über die Massenmedien. Im Bemühen um Auflagenhöhen und Sendequoten werden allerdings nicht selten auch unrealistische Hoffnungen auf Krankheitsheilung erweckt oder Ängste geschürt, was Krankheitsrisiken anbetrifft. Journalisten und Redakteure, die in der Regel nicht über eine medizinische Ausbildung verfügen, sehen sich allerdings oft auch allein gelassen mit medizinischen Fachinformationen und Pressemitteilungen von Pharma-Unternehmen, Ärzte-Verbänden oder auch Forschungseinrichtungen, die damit ein spezifisches Interesse verfolgen. In Australien wurde daher im Jahre 2005 die Internetseite "The Media Doctor" ins Leben gerufen, um Stärken und Schwächen von Medienberichten zu gesundheitlichen und medizinischen Themen zu analysieren und darauf aufbauend Verbesserungsmöglichkeiten zu ersinnen.
Die Media Doctor Website berichtet regelmäßig über populäre Medienberichte zu gesundheitlichen Themen und bewertet sie auch hinsichtlich ihres Neuigkeitswerts und der wissenschaftlichen Seriosität mit 1-5 Sternen. Dabei wird ein Katalog mit 10 verschiedenen Bewertungskriterien verwendet und die Berichte werden jeweils eingestuft als zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend oder unzutreffend. Diese Kriterien lauten:
• (1) Erklärung des neuartigen oder innovativen Charakters
• (2) Beschreibung der Zugangsmöglichkeiten für Patienten
• (3) Beschreibung der aktuell verfügbaren unterschiedlichen Diagnose- oder Therapie-Optionen
• (4) Vermeidung des "Disease Mongering", der Geschäftemacherei mit erfundenen Krankheiten
• (5) Beschreibung der Evidenz, der wissenschaftlichen Fundierung
• (6) Auch quantitative Beschreibung der Vorteile
• (7) Beschreibung der Risiken und potentiellen Schäden
• (8) Darstellung der finanziellen Kosten
• (9) Kontrolle des Informationsgehalts durch unabhängige Experten
• (10) Über andere verfügbare Nachrichtentexte hinausgehend
Im Zeitraum 2004 bis 2008 sind auf der Media Doctor Website insgesamt 1230 Berichte erschienen, in denen gesundheitsbezogene Artikel aus unterschiedlichen Medien vorgestellt und bewertet worden sind. In einer Studie, die jetzt in der Open-Access-Zeitschrift "Public Library of Science (PLOS)" veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler die Ergebnisse dieser Rezensionen noch einmal bilanziert. Dabei wurden die berücksichtigten Medien zu vier Gruppen zusammengefasst:
• Boulevard-Zeitungen, eher bild- und unterhaltungs-orientiert, kleines Format, "Tabloids" (z.B. "The Daily Telegraph")
• Nachrichtenblätter, eher text- und informations-orientiert, großes Format, "Broadsheets" (z.B. "The Australian")
• Internet Nachrichten-Seiten (z.B. "ABC Online")
• kommerzielle Nachrichten-Magazine, mit ausführlicheren Berichten und Reportagen (z.B. "A Current Affair")
In der detaillierten Analyse zeigte sich dann:
• 613 (51%) der Berichte befassten sich mit pharmazeutischen Produkten, 121 (10%) mit diagnostischen Verfahren, 98 (8%) mit chirurgischen Methoden, 387 (32%) hatten andere Themen zum Gegenstand.
• Etwa die Hälfte aller Berichte (52%) war "zufriedenstellend".
• Im Vergleich der verschiedenen Medien schnitten Nachrichtenblätter am besten ab (58% zufriedenstellend), gefolgt von Boulevardblättern und Internet-Seiten (jeweils 48%). Am schlechtesten wurden kommerzielle Nachrichtenmagazine im Fernsehen bewertet (nur 33% zufriedenstellend).
• Die größten Schwächen zeigten sich für folgende Bewertungsmerkmale: Hinzuziehung von unabhängigen Experten (nur 39% der Artikel bei diesem Kriterium zufriedenstellend), Information zur Evidenz (37%), quantitativ dargestellte Vorteile (35%), Beschreibung der Kosten (36%), Beschreibung potenzieller Schäden (18%).
Im Vergleich zu einer bereits im Jahre 2005 erstellten vergleichbaren Analyse erkennen die Wissenschaftler minimale Verbesserungen, aber keine grundsätzliche Änderung der Problematik. Sie diskutieren daher abschließend auch Möglichkeiten, um eine ausgewogene, wissenschaftlich fundierte, aber für die Öffentlichkeit noch ansprechende Berichterstattung zu ermöglichen. Eine Option dazu wäre nach ihrer Ansicht die erstellung kritischer Begleitinformationen für Journalisten durch Experten, wobei diese Infos sich am dargestellten Kriterienkatalog orientieren könnten. Eine zentrale Forderung wäre dabei auch, die meist sensationsorientierte Mitteilung relativer Risiken (z.B. "50% höhere Heilungschancen") zumindest zu ergänzen durch eine Darstellung auch der absoluten Risiken für neue Arzneimittel oder Therapien. (vgl. Forum Gesundheitspolitik: Statistische Schaumschlägereien mit Risiken: "Um 40% gesenktes Krankheitsrisiko durch XYZ")
Die Studie ist im Volltext kostenlos verfügbar: Amanda Wilson et al: Media Reporting of Health Interventions: Signs of Improvement, but Major Problems Persist (PLoS
ONE 4(3): e4831. doi:10.1371/journal.pone.0004831)
vgl. zur Medien-Berichterstattung über Gesundheitsthemen auch: "Kaffeetrinker sind im Bett wie aufgedreht" - Eine Dokumentation der journalistischen Berichterstattung über unsere Gesundheit
Gerd Marstedt, 19.4.09
Das Vorurteil der durchweg gewalttätigen "Verrückten" lässt sich anhand empirischer Daten nicht bestätigen
 In Thrillern wie "Das Schweigen der Lämmer" oder "Sieben" erschauern wir im Kino noch ein bisschen mehr, wenn Gewalttäter auch noch "verrückt" sind. Auch in den Medien gehen Gewalttaten und psychische Störungen oft Hand in Hand. Eine deutsche und eine Schweizer Studie haben aufgrund einer Analyse von Tageszeitungs-Artikeln gezeigt, dass psychisch Kranke in der überwiegenden Zahl der Fälle als aggressiv und gewalttätig dargestellt werden (vgl.: Michael Eink: Oh Gott, wieviel Verrückte laufen frei herum?).
In Thrillern wie "Das Schweigen der Lämmer" oder "Sieben" erschauern wir im Kino noch ein bisschen mehr, wenn Gewalttäter auch noch "verrückt" sind. Auch in den Medien gehen Gewalttaten und psychische Störungen oft Hand in Hand. Eine deutsche und eine Schweizer Studie haben aufgrund einer Analyse von Tageszeitungs-Artikeln gezeigt, dass psychisch Kranke in der überwiegenden Zahl der Fälle als aggressiv und gewalttätig dargestellt werden (vgl.: Michael Eink: Oh Gott, wieviel Verrückte laufen frei herum?).
Die epidemiologische Forschung über Zusammenhänge zwischen psychischen Störungen und Gewalttaten kam bislang zu keinen einheitlichen Befunden, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Teilnehmerzahl der jeweiligen Studien eher überschaubar war. Eine neue US-amerikanische Längsschnittuntersuchung mit über 34 Tausend Teilnehmern hat nun neue Befunde erbracht. Die zentrale Erkenntnis der Studie heißt: Psychische Erkrankungen für sich allein genommen zeigen keine signifikanten Effekte für Gewalttätigkeiten, der Schizophrene oder Depressive ist nicht aggressiver oder krimineller als jeder Normalbürger. Dann allerdings, wenn sich bei psychisch Erkrankten zusätzliche, problematische Bedingungen ergeben wie u.a. Drogen- oder Medikamentenmissbrauch, Ehescheidung oder Arbeitsplatzverlust, steigt das Risiko für Gewalttaten.
Die Studie basiert auf einer Längsschnitt-Untersuchung bei 34.653 Teilnehmern ("National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC)"), die primär durchgeführt wurde, um Hintergründe des Alkoholkonsums und Alkoholmissbrauchs zu erfassen. In zwei Erhebungs-Wellen, 2001-2003 und 2004-2005, wurde bei den Teilnehmern eine Vielzahl von Daten erfasst: Sozialer und familiärer Hintergrund, psychische Störungen, Drogen, Gewalttaten und aggressives Verhalten, negative Lebenserfahrungen wie Scheidung oder Arbeitsplatzverlust. Anhand der Informationen aus der ersten Erhebung wurde dann überprüft, ob sich drei oder vier Jahre später in der zweiten Erhebung auffällige Zusammenhänge zu Gewalttaten nachweisen ließen.
Im Rahmen multivariater Analysen, also bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Vielzahl von Einflussfaktoren wurde dann deutlich, dass eine Häufung von Gewalt für die erfassten psychischen Erkrankungen Schizophrenie, Depression und bipolare Störung (früher: "manisch-depressiv") nicht nachweisen ließ. Erst wenn weitere Faktoren bei psychisch erkrankten Untersuchungsteilnehmern hinzukamen, stieg das Risiko von Gewalt. Die dabei bedeutsamsten Hintergrundfaktoren waren: junges Lebensalter, männliches Geschlecht, frühere Gewalttaten, Ehescheidung, als Kind missbraucht, Eltern kriminell, im letzten Jahr arbeitslos oder selbst Opfer von Gewalt geworden, Drogenmissbrauch.
Hier ist ein Abstract der Studie: Eric B. Elbogen, Sally C. Johnson: The Intricate Link Between Violence and Mental Disorder. Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (Arch Gen Psychiatry. 2009;66(2):152-161.)
Gerd Marstedt, 10.2.09
BMJ-Studie entlarvt erneut medizinische Irrtümer: Über das Katerfrühstück, Suizid an den Feiertagen, nächtliche Mahlzeiten
 Bereits zu Weihnachten 2007 beglückten zwei Wissenschaftler aus Indianapolis, Rachel Vreeman und Aaron Carroll, die Leser des British Medical Journal mit einer Reihe von Forschungserkenntnissen, die medizinische Irrtümer und Fehlannahmen von Laien wie Medizinern auch als falsche oder zumindest unbewiesene Annahmen enttarnten. Jetzt in der Weihnachtsausgabe 2008 der renommierten medizinischen Fachzeitschrift gibt es einige neue aufklärerische Geschichten zu lesen, die mit medizinischen Mythen, Irrtümern und Stereotypen aufräumen.
Bereits zu Weihnachten 2007 beglückten zwei Wissenschaftler aus Indianapolis, Rachel Vreeman und Aaron Carroll, die Leser des British Medical Journal mit einer Reihe von Forschungserkenntnissen, die medizinische Irrtümer und Fehlannahmen von Laien wie Medizinern auch als falsche oder zumindest unbewiesene Annahmen enttarnten. Jetzt in der Weihnachtsausgabe 2008 der renommierten medizinischen Fachzeitschrift gibt es einige neue aufklärerische Geschichten zu lesen, die mit medizinischen Mythen, Irrtümern und Stereotypen aufräumen.
Da ist zunächst etwa der Mythos, dass zuviel Süßigkeiten und deren Zucker Kinder hyperaktiv und zum Zappelphilipp macht. Mindestens 12 randomisierte und verblindete Kontrollstudien haben diesen Zusammenhang untersucht. Keine einzige Studie konnte jedoch Verhaltensunterschiede zwischen Kindern finden, die viel Zucker und solchen, die wenig oder keinen Zucker zu sich nahmen. Dies galt ganz unabhängig von der Art des Zuckers.
Ein ähnlicher Mythos wird wieder einmal kurz vor und nach Silvester in vielen Medien zu finden sein: Nämlich todsichere Tipps, um einen alkoholbedingten Kater schnell und wirksam zu bekämpfen. Eine systematische Analyse unterschiedlicher Kontrollstudien konnte jedoch keinen einzigen Beleg dafür finden, dass Getränke oder Nahrungsmittel, Mittel aus der Schul- oder auch Alternativmedizin nun tatsächlich wirksam sind in der schnellen Bekämpfung der Folgen feuchtfröhlicher Trinkgelage. Die einzig sinnvolle Maßnahme ist präventiv und sehr banal: Weniger Alkohol!
Ein weit verbreiteter Irrtum ist auch jener, dass nächtliche Mahlzeiten und Naschereien nun besonders nachhaltig zu einer Gewichtszunahme führen - mehr jedenfalls als eine Ernährung, die sich auf frühere Stunden am Tag konzentriert. Zwar zitieren die Wissenschaftler einige Studien, die Korrelationen gefunden haben zwischen Übergewicht und bevorzugten Tageszeiten der Ernährung. Dass dies jedoch keineswegs einen Kausalzusammenhang belegt, zeigt eine Reihe methodisch besser fundierter Studien.
Die Veröffentlichung im BMJ beschäftigt sich außerdem mit der Frage, ob es gesundheitlich besonders riskant ist, bei Kälte auf eine Kopfbedeckung zu verzichten (nein) und ob die Zahl der Selbstmorde während der Weihnachtsfeiertage tatsächlich höher ist als normal (nein). Fast die gesamte Weihnachtsausgabe der BMJ ist im Übrigen der "fröhlichen Wissenschaft" gewidmet. So gibt es weitere Studien über die gesundheitlichen Risiken der Heavy-Metal-Musik (durch das rhythmische Kopfschütteln und dadurch verursachte schwache Gehirnerschütterungen), über Coca-Cola als (untaugliche) Verhütungsmethode danach (weil Cola zwar die Beweglichkeit von Spermien reduziert, aber nicht genug) und über die größere Befolgung von Screening-Terminen in der Weihnachtszeit und vor eigenen Geburtstagen.
Die Studie ist hier im Volltext kostenlos zu lesen: Rachel C Vreeman, Aaron E Carroll: Christmas 2008: Seasonal Fayre. Festive medical myths (BMJ, Published 17 December 2008, doi:10.1136/bmj.a2769)
Bereits 2007 hatten die beiden Wissenschaftler kurz vor Weihnachten ihr Evidenzpaket im BMJ verschenkt, mit Berichten über
• den Ratschlag mindestens acht Gläser Wasser mit einem Volumen von rund 2,5 Liter täglich zu trinken,
• den Glauben, dass Menschen nur 10% ihres Gehirns nutzen,
• die Annahme, dass Haare und Fingernägel auch nach dem Tod weiterwachsen
• Befürchtungen, dass Lesen bei schwachem Licht die Lesekraft ruiniert
und einiges andere mehr.
Vgl. unseren Bericht "Irren ist ärztlich" oder wo man lieber nicht seinem Arzt glauben sollte: Medizinische Mythen an die sogar Ärzte glauben
Gerd Marstedt, 21.12.08
Massenmedien und Berichterstattung über Gesundheit in den USA: Geringerer Anteil als erwartet und krankheitenlastig.
 Über das Gewicht von Medienberichten über Infektions-Krankheiten lieferte eine im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte Untersuchung bereits beeindruckende Belege. Was häufig in den Schlagzeilen auftaucht, so ihre Kernerkenntnis, wird auch als bedrohlicher eingestuft. Bedeutet dies auch, dass möglicherweise bestimmte und sogar wichtige Meldungen weder in Schlagzeilen noch sonstwo in den Massenmedien vorkommen und damit unbedeutend sind?
Über das Gewicht von Medienberichten über Infektions-Krankheiten lieferte eine im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte Untersuchung bereits beeindruckende Belege. Was häufig in den Schlagzeilen auftaucht, so ihre Kernerkenntnis, wird auch als bedrohlicher eingestuft. Bedeutet dies auch, dass möglicherweise bestimmte und sogar wichtige Meldungen weder in Schlagzeilen noch sonstwo in den Massenmedien vorkommen und damit unbedeutend sind?
Klarheit kann erst eine Analyse der inhaltlichen Schwerpunkte und publizierten Themen zum weiten Themenbereich Gesundheit in allen Medien verschaffen. Für die US-Medien schuf dies gerade eine Analyse der Kaiser Family Foundation und des Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism, die sich alle Massenmedien in den USA zwischen dem Januar 2007 und Juni 2008 hinsichtlich des Umfangs und der Inhalte ihrer Gesundheitsberichterstattung anschaute. In diesen 18 Monaten spielte in den USA das Thema Status quo und Zukunft der Gesundheitsversorgung und des Krankenversicherungssystem eine überdurchschnittliche Rolle in der Öffentlichkeit, da beide politischen Lager eine Reform des Gesundheitswesens im Präsidentschaftswahlkampf sehr intensiv bearbeiteten.
Umso interessanter sind die wesentlichen Ergebnisse dieser Medienanalyse:
• Nachrichten über Gesundheit und Gesundheitsversorgung machen weniger als 4 %, nämlich 3,6 %, aller Nachrichten während dieser 18 Monate aus.
• Dieser Anteil war mit 1,4 % in den Kabelfernsehprogrammen am niedrigsten und erreichten in den Abendnachrichten der großen nationalen Fernsehnetze wie z.B. von CBS mit 8,3 % den höchsten Wert.
• Den größten Raum nahmen mit 42 % Berichte über einzelne Krankheiten oder Gesundheitsprobleme ein. Nur in einzelnen TV-Nachrichtensendungen der großen TV-Netze und in großen Tageszeitungen wurden Gesundheitspolitik und Public Health-Themen mehr behandelt als einzelne Krankheiten. Letztere überwogen in den Kabelfernsehsendungen mit ihren kurzen Nachrichtenformaten.
• 30,9 % der Artikel und Meldungen fokussierten auf Nachrichten zu Gegenständen der öffentlichen Gesundheit, darunter beispielsweise Berichte über potentielle Epidemien (z. B. Vogelgrippe), Lebensmittelvergiftungen und Drogen.
• Das relativ geringste Gewicht unter den größeren Themen hatten mit 27,4 % Berichte über Gesundheitspolitik und das Gesundheitsversorgungssystem.
• Alle anderen Themen teilten sich auf 0,9 % aller Nachrichten auf.
Damit basiert das Interesse sowie der Aufmerksamkeits- und Wissenshorizont der Nutzer nahezu aller Medien in den USA auf einer quantitativ wie qualitativ ausgesprochen schmalen und inhaltlich krankheitenlastigen Berichtsbasis.
Da diese Erkenntnisse zwar nicht auf Deutschland übertragen werden können, es aber gleichwohl Indizien für eine ähnliche Krankheitenlastigkeit der Berichterstattung in den zahlreichen "Wartezimmer-Zeitschriften" oder anderen Gesundheitsgazetten hierzulande gibt, wäre eine vergleichbare Untersuchung auch der deutschen Medien wünschenswert. Diese könnte dann auch untersuchen, ob, wie oder durch welche Verzerrungen von Wirklichkeit einige der hartnäckigen und negativ-dramatisierenden Mythen über das gegenwärtige und künftige deutsche Gesundheitssystem "produziert" oder geschürt werden und bestimmte Patentrezepte platziert werden.
Der Anfang Dezember 2008 erscheinende 14-Seiten-Report "Health News Coverage in the U.S. Media" steht Interessenten komplett kostenlos zur Verfügung. Er enthält eine ausführliche Übersicht zur Methode und zu den mit ihnen untersuchten Medien.
Bernard Braun, 1.12.08
Medienberichte über Infektions-Krankheiten: Was häufig in den Schlagzeilen auftaucht, wird auch als bedrohlicher eingestuft
 Eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen der Medien aufgetaucht: Die Vogelgrippe und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, BSE oder "Rinderwahn" (Bovine spongiforme Enzephalopathie). Eine kanadische Studie hat nun untersucht, ob die Häufigkeit der Berichterstattung in den Medien über solche Erkrankungen und Ansteckungsrisiken auch unsere Einschätzung der Krankheit beeinflusst, im Hinblick auf Schweregrad und Heilungschancen sowie die vermutete Verbreitung der Erkrankung in nächsten Jahr. Tatsächlich zeigt sich: Ganz unabhängig vom tatsächlichen Risikopotential werden Krankheiten dann als besonders schwerwiegend und bedrohlich erlebt, wenn über sie besonders häufig in den Medien berichtet wird.
Eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen der Medien aufgetaucht: Die Vogelgrippe und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, BSE oder "Rinderwahn" (Bovine spongiforme Enzephalopathie). Eine kanadische Studie hat nun untersucht, ob die Häufigkeit der Berichterstattung in den Medien über solche Erkrankungen und Ansteckungsrisiken auch unsere Einschätzung der Krankheit beeinflusst, im Hinblick auf Schweregrad und Heilungschancen sowie die vermutete Verbreitung der Erkrankung in nächsten Jahr. Tatsächlich zeigt sich: Ganz unabhängig vom tatsächlichen Risikopotential werden Krankheiten dann als besonders schwerwiegend und bedrohlich erlebt, wenn über sie besonders häufig in den Medien berichtet wird.
Teilnehmer an der Studie waren Psychologie- und Medizinstudenten, denen man verschiedene Infektions-Krankheiten vorgab und sie bat, bestimmte Merkmale einzuschätzen. Insgesamt 10 Krankheiten wurden vorgegeben, jeweils zur Hälfte solche, über die in den letzten Monaten sehr häufig in den Medien berichtet wurde und solche die nur sehr selten in den Schlagzeilen auftauchten. Die Häufigkeit der Nennung war über eine Internet-Suche überprüft worden. Die fünf häufig erwähnten Krankheiten waren: Anthrax, West-Nil-Virus, Vogelgrippe, SARS, Lyme-Krankheit. Die Krankheiten mit wenig Medienaufmerksamkeit: Tularämie, Gelbfieber, Hantavirus, Lassafieber, Babesiosis.
Die Studentinnen und Studenten wurden dann gebeten, mehrere Einschätzungen abzugeben:
• Handelt es sich bei ... tatsächlich um eine Krankheit?
• Wie schwerwiegend ist ... (auf einer Skala von 0-10) ?
• Wie stark verbreitet wird ... im kommenden Jahr sein, wie viele (in %) werden betroffen sein?
In der Auswertung der Antworten zeigte sich dann: Die jeweils vorgegebenen Erkrankungen wurden umso bedrohlicher eingeschätzt und auch häufiger als Erkrankung eingestuft, wenn sie sehr oft in Medienberichten aufgetaucht waren, und zwar auch dann, wenn diese Bewertung objektiv gar nicht zutraf. Für die Schätzung der Krankheitsverbreitung zeigte sich allerdings kein Zusammenhang zur Häufigkeit der Berichterstattung in den Medien.
Dieser Befund ist im Prinzip eher besorgniserregend, zeigt er doch, dass Zeitungsleser oder TV-Zuschauer sich unterbewusst beeinflussen lassen von der Häufigkeit der Berichterstattung - auch wenn dies gar nicht stimmt - nach dem Motto: Je häufiger über eine Krankheit berichtet wird, desto gefährlicher ist sie. Allerdings gab es auch ein Ergebnis, das zuversichtlicher stimmt: In jener Versuchsanordnung, in der nicht nur der Name der Krankheit genannt war, sondern auch einige kurze Informationen gegeben wurden (wie z.B. Art der Übertragung, Krankheitssymptome nach einer Infektion, Häufigkeit des Auftretens), war die Einschätzung der Krankheit nicht mehr davon abhängig, wie oft sie in Medien-Schlagzeilen vorher auftauchte.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Meredith E. Young u.a.: Medicine in the Popular Press: The Influence of the Media on Perceptions of Disease (PLoS ONE 3(10): e3552. doi:10.1371/journal.pone.0003552)
Gerd Marstedt, 25.11.08
Nicht nur Patienten, auch Journalisten und Ärzte sind Analphabeten, was Gesundheitsstatistiken anbetrifft
 Relatives und absolutes Risiko, Überlebensraten und Lebenserwartung, Sensitivität und Spezifität diagnostischer Tests - nicht nur für Patienten, auch für Medizinjournalisten und sogar für Ärzte sind diese Begriffe oftmals böhmische Dörfer. Woran sich dies im Einzelnen zeigt, warum dies so ist und welche negativen Effekte dieses "statistische Analphabetentum" mit sich bringt, diese Fragen diskutiert eine Forschungsgruppe aus Berlin und Dartmouth in einem jetzt in der Zeitschrift "Psychological Science in the Public Interest" veröffentlichten, ebenso ausführlichen wie lesenswerten 44seitigen Aufsatz, auf den kürzlich auch die Frankfurter Rundschau in dem Artikel Wie lüge ich mit Statistik noch einmal hinwies.
Relatives und absolutes Risiko, Überlebensraten und Lebenserwartung, Sensitivität und Spezifität diagnostischer Tests - nicht nur für Patienten, auch für Medizinjournalisten und sogar für Ärzte sind diese Begriffe oftmals böhmische Dörfer. Woran sich dies im Einzelnen zeigt, warum dies so ist und welche negativen Effekte dieses "statistische Analphabetentum" mit sich bringt, diese Fragen diskutiert eine Forschungsgruppe aus Berlin und Dartmouth in einem jetzt in der Zeitschrift "Psychological Science in the Public Interest" veröffentlichten, ebenso ausführlichen wie lesenswerten 44seitigen Aufsatz, auf den kürzlich auch die Frankfurter Rundschau in dem Artikel Wie lüge ich mit Statistik noch einmal hinwies.
Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani erklärte im Jahre 2007 im Rahmen einer Werbekampagne: "Ich hatte Prostatakrebs, jetzt vor 5 oder 6 Jahren. Meine Überlebenschance - und Gott sei Dank wurde ich geheilt - betrug in den USA 82 Prozent. Meine Chance zu überleben in England? Wäre nur 44 Prozent gewesen in einem sozialistischen Gesundheitssystem." Mit dieser in der Washington Post verbreiteten Anekdote und dem Kommentar "Eine tolle Feststellung, dass die Überlebenschance bei Prostatakrebs in den USA fast doppelt so groß ist wie in England. Leider falsch." beginnt der Aufsatz von Gerd Gigerenzer , Wolfgang Gaissmaier, Elke Kurz-Milcke, Lisa M. Schwartz und Steven Woloshin. Und es wird auch sogleich erklärt, warum Giuliani den Irrtümern einer gesundheitspolitisch konservativen Werbekampagne (für das US-Gesundheitssystem, gegen das verstaatlichte System in England) aufsaß. Die Erklärung ist einfach: Tatsächlich basieren beide Zahlen auf 5-Jahres-Überlebensraten nach der Diagnose von Prostatakrebs, aktuell liegen die Zahlen bei 98% (USA) und 74% (England). Diese Zahlen sagen jedoch nichts über die Qualität der medizinischen Versorgung aus und nichts über die Lebenserwartung. Denn in den USA wird (auch aufgrund der weit verbreiteten PSA-Tests) bei vielen Patienten Prostatakrebs bereits in einem sehr frühen Stadium und bei jüngeren Patienten festgestellt.
Die Autoren bringen dazu das Beispiel: "Stellen wir uns eine Gruppe von Patienten vor, bei denen allesamt im Alter von 67 Jahren Prostatakrebs festgestellt wurde. Alle starben dann 3 Jahre später mit 70. Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt also 0 Prozent. Stellen wir uns weiterhin vor, bei derselben Gruppe sei aufgrund von gehäuft verwendeten PSA-Tests und nachfolgenden Biopsien aufgrund von Krebsverdacht schon im Alter von 60 der Krebs festgestellt worden. Alle sterben dann mit 70 und somit beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate 100 Prozent. Das heißt: Der statistische Wert der Überlebensrate steigt ganz massiv, obwohl nicht ein einziges Leben gerettet oder verlängert wurde, nur weil die Diagnose auf einen früheren Zeitpunkt gelegt wurde."
Anhand eines zweiten Beispiels machen die Autoren deutlich, dass eine in wissenschaftlichen medizinischen Artikeln leider weit verbreitete Unsitte, nur relative Risiken mitzuteilen und absolute Risiken zu verschweigen, erhebliche Negativeffekte bewirken kann. Im Oktober 1995 gab eine Aufsichtsbehörde im United Kingdom eine Warnung an Ärzte heraus, derzufolge ein bestimmte, neue Generation oraler Verhütungsmittel ein deutlich erhöhtes Risiko von lebensbedrohlichen Blutgerinnseln mit sich bringen würde. Dieses Risiko sei im Vergleich zu herkömmlichen Pillen doppelt so hoch, um 100 Prozent gesteigert. Die Warnung wurde auch den Medien zugespielt und veröffentlicht, was bei einer großen Zahl von Frauen bewirkte, dass sie die Pille absetzten. Eine Vielzahl ungewollter Schwangerschaften war die Folge und im Folgejahr wurden im UK rund 13.000 Schwangerschaftsabbrüche mehr als in den Vorjahren gezählt. Das Problematische hieran: Die Mitteilung des doppelt so hohen Risikos war korrekt, aber dieses relative Risiko war nur die halbe Wahrheit. Hätte man auch das absolute Risiko mitgeteilt, wären die Folgen wohl weniger dramatisch ausgefallen. Dieses absolute Risiko betrug nämlich bei der neuen Pille 2:7.000, bei den Pillen der alten Generation 1:7.000. Tatsächlich also eine Steigerung um 100 Prozent, tatsächlich jedoch ein verschwindend geringes Risiko von 0,014 Prozent bzw. 0,028 Prozent.
Gerd Gigerenzer und Kollegen berichten aber nicht nur in sehr unterhaltsamer Weise über die Folgen solcher Irrtümer und Fehleinschätzungen (was man auch als amüsanten Nachhilfeunterricht in medizinischer Statistik in Anspruch nehmen kann), sondern über vieles weitere mehr: Studien über mathematische und statistische Defizite bei Ärzten und Journalisten, Mängel bei der Information von Patienten über Unzulänglichkeiten und Fehler diagnostischer Tests, negative Folgen für eine partnerschaftliche Entscheidungsfindung (Shared Decision Making), Ansätze für Veränderungsmöglichkeiten.
• Hier ist ein Abstract des Artikels: Gerd Gigerenzer u.a.: Helping Doctors and Patients Make Sense of Health Statistics (Psychological Science in the Public Interest, Volume 8 Issue 2, Pages 53 - 96, Published Online: 8 Oct 2008)
• Der volle Text ist kostenlos auch auf der Website der APS (Association for Psychological Science) abrufbar: PDF: Gerd Gigerenzer u.a.: Helping Doctors and Patients Make Sense of Health Statistics
Gerd Marstedt, 12.10.2008
Die journalistische Berichterstattung über neue Medikamente, Diagnose- und Therapiemethoden ist überwiegend mangelhaft
 Die Entwicklung evidenzbasierter medizinischer Leitlinien und Therapieempfehlungen macht deutliche Fortschritte und das Kriterium der Evidenz wird in wissenschaftlichen und medizinischen Kreisen kaum noch angezweifelt. Weniger Fortschritte hingegen gibt es zu vermelden, was eine evidenzbasierte journalistische Berichterstattung über neue Medikamente und Gesundheitsprodukte, Diagnose- und Therapiemethoden anbetrifft. Die unabhängige Health News Review Organisation bemüht sich seit einigen Jahren um eine seriöse und wissenschaftlich fundierte Berichterstattung in den Medien über medizinische Themen, insbesondere solche, die einen deutlichen Fortschritt durch neue Therapien oder Arzneimittel suggerieren. Zu diesem Zweck rezensiert sie Medienberichte und veröffentlicht die Kritik auf ihrer Website. Eine Zwischenbilanz nach 500 Rezensionen hat jetzt gezeigt, dass die große Mehrzahl der begutachteten Berichte (62-77%) Defizite aufweist, was bestimmte Kriterien anbetrifft wie Evidenzbasierung, Erwähnung von Risiken und Nebenwirkungen, Information über alternative medizinische Vorgehensweisen.
Die Entwicklung evidenzbasierter medizinischer Leitlinien und Therapieempfehlungen macht deutliche Fortschritte und das Kriterium der Evidenz wird in wissenschaftlichen und medizinischen Kreisen kaum noch angezweifelt. Weniger Fortschritte hingegen gibt es zu vermelden, was eine evidenzbasierte journalistische Berichterstattung über neue Medikamente und Gesundheitsprodukte, Diagnose- und Therapiemethoden anbetrifft. Die unabhängige Health News Review Organisation bemüht sich seit einigen Jahren um eine seriöse und wissenschaftlich fundierte Berichterstattung in den Medien über medizinische Themen, insbesondere solche, die einen deutlichen Fortschritt durch neue Therapien oder Arzneimittel suggerieren. Zu diesem Zweck rezensiert sie Medienberichte und veröffentlicht die Kritik auf ihrer Website. Eine Zwischenbilanz nach 500 Rezensionen hat jetzt gezeigt, dass die große Mehrzahl der begutachteten Berichte (62-77%) Defizite aufweist, was bestimmte Kriterien anbetrifft wie Evidenzbasierung, Erwähnung von Risiken und Nebenwirkungen, Information über alternative medizinische Vorgehensweisen.
Dass viele Medien Meldungen von Forschungsergebnissen über "gesunde" oder "risikosenkende" Vitamine, Nahrungs- und Genussmittel ohne jede Kontrolle und Nachprüfung der Hintergründe, der Datenbasis und ihrer wissenschaftlichen Seriosität übernehmen, ist nicht neu (vgl. "Mit Rotwein und Kaffee, Walnuss und Olivenöl ein bißchen Gesundheit naschen").
Eine akribische und zugleich wissenschaftlich undierte Bilanz solcher Medienberichte leistet die unabhängige Einrichtung "Health News Review Organisation", die seit zwei Jahren ungefähr 500 Berichte rezensiert hat, in denen ein medizinischer Fortschritt durch neue Medikamente, Diagnose- oder Therapiemethoden behauptet wurde. Jeweils zwei unabhängige, journalistisch erfahrene Wissenschaftler bewerten dazu die Artikel nach insgesamt 10 Kriterien wie unter anderem: Gibt es eine hinreichende wissenschaftliche Evidenz für den behaupteten Fortschritt auf der Basis methodisch fundierter Studien? Werden mögliche Risiken und Nebenwirkungen erwähnt? Wird ein "Disease Mongering" vermieden, also werden normale Befindlichkeiten und Beschwerden nicht zu Krankheiten erklärt? Wird eine eigenständige Recherche durchgeführt und nicht nur auf Meldungen von Nachrichtenagenturen vertraut? Wird auch über die Kosten berichtet?
Je nach Erfüllung dieser Kriterien erhalten die Berichte dann eine Gesamtnote von 0 bis 5 Sternen, der Artikel wird mitsamt der detaillierten Bewertung dann auf der Website von Health News Review Org veröffentlicht. In einer Zwischenbilanz, die jetzt in der Open Access Zeitschrift "PLOS Medicine" veröffentlicht wurde, hat sich nun gezeigt, dass nur etwa ein Drittel der bislang rezensierten 500 Berichte tatsächlich zufriedenstellend war und die Anforderungen an einen fundierten und seriösen Bericht erfüllte. Am häufigsten zeigten sich folgende Mängel:
• In 77% der Berichte fehlten Informationen zu den Kosten
• 72% machten keine quantitativen Angaben zu den Vorteilen oder Effekten der besprochenen Verfahren
• 67% verschwiegen Hinweise über Risiken und Nebenwirkungen
• In 65% der Artikel gab es keine Hinweise, wie methodisch fundiert und evidenzbasiert die Verfahren sind
• 62% ließen Informationen über schon bestehende Alternativen außen vor.
Der Aufsatz bringt auch eine Reihe von Beispielen für besonders kritikwürdige Berichte, so zum Beispiel ein Bericht der NBC, der ein typisches Disease Mongering betreibt für Beschwerden wie Haarausfall, Schuppen und Schlafstörungen. Auf der anderen Seite werden auf der Website von Health News Review Org auch alle Artikel und Rezensionen präsentiert, so dass man auch besonders herausragende Positivbeispiele für Wissenschaftsjournalismus nachlesen kann.
Der Aufsatz in der Zeitschrift PLOS Medicine ist hier im Volltext kostenlos verfügbar: Gary Schwitzer How Do US Journalists Cover Treatments, Tests, Products, and Procedures? An Evaluation of 500 Stories (PLoS Med 5(5): e95 doi:10.1371/journal.pmed.0050095)
Gerd Marstedt, 11.8.2008
Der Kylie-Effekt: Prominente können auch Schaden anrichten, wenn sie ihre Krankheit öffentlich machen
 Am 17. Mai 2005, elf Tage vor ihrem 37. Geburtstag, schockierte die australische Pop-Sängerin Kylie Minogue die Öffentlichkeit mit der Nachricht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. In den folgenden zwei Wochen stieg die Brustkrebsberichterstattung in den australischen Medien um das 20fache. Beim australischen Brustkrebsprogramm, das Frauen zwischen 50 und 69 angeboten wird, fragten doppelt so viele Frauen, die bislang noch nicht zur Mammographie gekommen waren, um einen Termin an. Dabei hätte Kylie Minogue selbst von einer Früherkennung nicht profitiert: Sie gehörte keiner Risikogruppe an und war für eine Mammographie zu jung. Auch ein gezieltes Selbstabtasten verringert nach den Ergebnissen mehrerer Studien die Brustkrebssterblichkeit nicht.
Am 17. Mai 2005, elf Tage vor ihrem 37. Geburtstag, schockierte die australische Pop-Sängerin Kylie Minogue die Öffentlichkeit mit der Nachricht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. In den folgenden zwei Wochen stieg die Brustkrebsberichterstattung in den australischen Medien um das 20fache. Beim australischen Brustkrebsprogramm, das Frauen zwischen 50 und 69 angeboten wird, fragten doppelt so viele Frauen, die bislang noch nicht zur Mammographie gekommen waren, um einen Termin an. Dabei hätte Kylie Minogue selbst von einer Früherkennung nicht profitiert: Sie gehörte keiner Risikogruppe an und war für eine Mammographie zu jung. Auch ein gezieltes Selbstabtasten verringert nach den Ergebnissen mehrerer Studien die Brustkrebssterblichkeit nicht.
Australische Forscher gingen der Frage nach, welche Auswirkungen der beobachtete Prominenten-induzierte Früherkennungs-Boom, der so genannte Kylie-Effekt, auf Frauen hat, die für eine Früherkennung ebenso wenig in Frage kommen wie Minogue selbst, die sich aber durch das Schicksal der Sängerin bemüßigt fühlen, eine Früherkennungsmaßnahme wahrzunehmen. Es zeigte sich, dass zwar mehr Aufnahmen und Biopsien gemacht, dabei aber nicht mehr Tumore gefunden werden.
Ihre Studie publizierten die Autoren jetzt im International Journal of Epidemiology. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Von Januar bis Oktober 2005 erhöhte sich die Rate an Mammographien und Ultraschalluntersuchungen bei Frauen im Alter von 25 bis 34 Jahren von 8 auf 12 pro 1000 und bei Frauen im Alter von 35 bis 44 Jahren von 20 auf 28 pro 1000.
• Auch die Anzahl der Gewebeentnahmen stieg an: Bei den 25- bis 34-Jährigen von 1156 im Januar 2005 auf 1719 im Oktober 2006 und bei den 35- bis 44-Jährigen im selben Zeitraum von 2502 auf 3613.
• Die Anzahl der entdeckten und entfernten Tumore blieb jedoch gleich: Bei den 25- bis 34-Jährigen wurden jeweils 42 Tumore entfernt, bei den 35- bis 44-Jährigen 277 beziehungsweise 295.
Die Autoren fordern, dass erkrankte Prominente und ihre PR-Teams sich im Sinne eines "manage the message" intensiver mit Gesundheitsexperten abstimmen sollten. Auch müsse man darauf achten, "unangemessene Nachfrage zu vermeiden".
Christian Weymayr, 9.6.2008
"Kaffeetrinker sind im Bett wie aufgedreht" - Eine Dokumentation der journalistischen Berichterstattung über unsere Gesundheit
 Wussten Sie eigentlich, dass unsere Lust auf die Currywurst angeboren ist? Dass häufiger Konsum von Blumenkohl vor Bauchspeicheldrüsen-Krebs schützt? Dass die Engländer gesünder sein könnten, wenn sie öfter und aktiver Sex hätten? Dass Frauen, die in der Kindheit häufig Pommes Frites gegessen haben, auch ein erhöhtes Brustkrebs-Risiko haben? Wussten Sie alles schon? Dann sind Sie garantiert ein eifriger Leser von Zeitschriften der medizinisch aufgeschlossenen Regenbogenpresse oder Sie verfolgen die wöchentliche Gesundheits-Rubrik Ihrer Tageszeitung ebenso regelmäßig wie aufmerksam.
Wussten Sie eigentlich, dass unsere Lust auf die Currywurst angeboren ist? Dass häufiger Konsum von Blumenkohl vor Bauchspeicheldrüsen-Krebs schützt? Dass die Engländer gesünder sein könnten, wenn sie öfter und aktiver Sex hätten? Dass Frauen, die in der Kindheit häufig Pommes Frites gegessen haben, auch ein erhöhtes Brustkrebs-Risiko haben? Wussten Sie alles schon? Dann sind Sie garantiert ein eifriger Leser von Zeitschriften der medizinisch aufgeschlossenen Regenbogenpresse oder Sie verfolgen die wöchentliche Gesundheits-Rubrik Ihrer Tageszeitung ebenso regelmäßig wie aufmerksam.
All diese und noch viele weitere ebenso kuriose wie sensationelle Meldungen aus dem Bereich Medizin und Gesundheit hat ein Bremerhavener Journalist zunächst mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen und dann mit journalistischem Eifer gesammelt und zu einem hundertseitigen Werk verknüpft. "Kaffeetrinker sind im Bett wie aufgedreht" heißt die realsatirische Dokumentation von Volker Heigenmooser, in der es dem Autor nur am Rande um Volksbelustigung geht, primär jedoch um eine Kritik der Berichterstattung über medizinische und gesundheitliche Themen in den Tageszeitungen - durch das Aufbauschen von Nachrichten, die Übernahme von Meldungen der Nachrichtenagenturen ohne jede Kontrolle ihres Gehalts. Angeregt wurde der Betreiber der "Wortmanufaktur Heigenmooser" durch einen Kollegen. Jörg Blech schreibt in seinem Buch "Die Krankheitserfinder": "Viele der lancierten Geschichten werden von den Journalisten völlig unkritisch übernommen und verbreitet. Mögliche Therapien werden vorschnell als vermeintliche Sensation in die Welt hinausposaunt - später hört man in den allermeisten Fällen nie wieder etwas davon. Der Hang zur Übertreibung ist eine Berufskrankheit vieler Medizinjournalisten: Sie bauschen die Verbreitung und das Bedrohungspotenzial bestimmter Krankheiten häufig auf, um ihre Berichte darüber wichtig und relevant erscheinen zu lassen."
Heigenmooser kritisiert in seiner Dokumentation aber auch noch andere "Sünden" seiner Berufskollegen: Die fehlende Berichterstattung über finanzielle Abhängigkeiten und die Einflussnahme der Pharma-Industrie auf wissenschaftliche Studien ebenso wie Medienberichte, die mangelhaften Recherchen über die tatsächlichen Erfolge von Arzneimitteln oder neuen Therapien, die kommentarlose Übernahme von Meldungen, die ganz offensichtlich von Nahrungsmittelherstellern oder anderen Unternehmen lanciert und gesponsert wurden.
Der Titel seiner Dokumentation "Kaffeetrinker sind im Bett wie aufgedreht" stammt natürlich auch aus einer Nachrichten-Meldung, und zwar von der Agentur AFP vom 22. 9. 05., und sie dokumentiert nahezu alle Missstände der in Tageszeitungen gängigen Gesundheitsberichterstattung: "Kaffee ist laut wissenschaftlichen Studien gesund und trägt zu einem aktiven Sexleben bei. Entgegen seinem ungesunden Ruf sei das Getränk gut für die Zähne und senke das Leberkrebsrisiko, berichtet das Magazin 'Men's Health'. Demnach fanden Wissenschaftler heraus, dass die Spermien von Gewohnheitskaffeetrinkern beweglicher sind als die von Koffein-Abstinenzlern. Zudem seien Kaffeetrinker sexuell aktiver. Koffein verhindere auch die Entstehung von Karies und diene dem Schutz vor Leberkrebs: Bis zu zwei Tassen am Tag verringern demnach die Anfälligkeit um 48 Prozent, bei fünf Tassen und mehr sogar um 76 Prozent."
Die Dokumentation von Volker Heigenmooser steht hier kostenlos zum Download bereit: "Kaffeetrinker sind im Bett wie aufgedreht"
Gerd Marstedt, 12.4.2008
Medienkampagne zur Verbesserung der Bevölkerungs-Kenntnisse über Rückenschmerzen bleibt in Norwegen ohne großen Erfolg
 Rückenschmerzen sind überaus weit verbreitet, über die gesamte Lebenszeit betrachtet sind über 80% der Bevölkerung mindestens einmal davon betroffen. Nimmt man nur einen einzelnen Zeitpunkt, dann findet man 12-33 Prozent, die darunter leiden. Zumeist hören die Beschwerden auch ohne medizinisches Zutun nach spätestens 6 Wochen auf. Leitlinien zur Behandlung und Prävention der Kreuzschmerzen haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv gewandelt. In der Bevölkerung allerdings überwiegen zumeist noch die überholten Vorstellungen, wie zum Beispiel jene, dass man im solchen Fällen im Bett bleiben, zumindest aber körperliche Aktivität meiden sollte.
Rückenschmerzen sind überaus weit verbreitet, über die gesamte Lebenszeit betrachtet sind über 80% der Bevölkerung mindestens einmal davon betroffen. Nimmt man nur einen einzelnen Zeitpunkt, dann findet man 12-33 Prozent, die darunter leiden. Zumeist hören die Beschwerden auch ohne medizinisches Zutun nach spätestens 6 Wochen auf. Leitlinien zur Behandlung und Prävention der Kreuzschmerzen haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv gewandelt. In der Bevölkerung allerdings überwiegen zumeist noch die überholten Vorstellungen, wie zum Beispiel jene, dass man im solchen Fällen im Bett bleiben, zumindest aber körperliche Aktivität meiden sollte.
Auch andere Irrtümer finden sich im Volkswissen, Annahmen, die auch für das Gesundheitssystem Probleme mit sich bringen, weil sie zu vielen unnötigen und kostenträchtigen medizinischen Leistungen führen: Röntgenaufnahmen, Computer-Tomografien, Operationen. In Norwegen führte man deshalb in einigen großen Distrikten in den Jahren 2002 bis 2005 ein Interventionsprojekt durch, das sich hauptsächlich der Medien bediente und als Informationskampagne durchgeführt wurde. Auf Internetseiten, mit Plakaten, durch Anzeigen in Tageszeitungen und Werbespots in Radio und Fernsehen klärte man die Bevölkerung über Ursachen, Verlauf und sinnvolle Therapien bei Rückenschmerzen auf. Dazu wurden in den Medien sieben kurze und prägnante Informationen in den Vordergrund gestellt. Parallel dazu informierte man auch niedergelassene Ärzte, Physiotherapeuten und Chiropraktiker.
Kurz vor, während und unmittelbar nach der Kampagne wurde dann in Telefon-Interviews überprüft, ob sich das Wissen der Bevölkerung durch diese Informationen verändert hat. Dabei wurde auch eine Kontrollgruppe herangezogen, Bürger/innen aus einem Bezirk, in dem die Kampagne nicht gelaufen war. Insgesamt wurden dreimal etwa 1.500 Bürger/innen befragt. Im Vergleich zwischen denjenigen, die in ihrem Bezirk mit Plakaten und Anzeigen informiert worden waren und denjenigen ohne solche Kampagnen-Infos zeigte sich dann nach Abschluss der Intervention ein eher geringer Effekt, was den Wissensstand anbetrifft.
So gaben im Vergleich Kontrollgruppe - Interventionsgruppe auf die Wissensfragen korrekte Antworten:
• "Rückenschmerzen bessern sich meistens von selbst", korrekte Antwort "richtig": Kontrollgruppe 20% - Interventionsgruppe 28%
• "Nach einem Bandscheibenvorfall muss man operiert werden", korrekte Antwort "falsch": 27% - 33%
• "Moderne Röntgenaufnahmen finden meistens die Ursache der Rückenschmerzen", korrekte Antwort "falsch": 21% - 32%
• "Bei Rückenschmerzen muss man Ruhe halten und sich schonen", korrekte Antwort "falsch": 46% - 53%
• "Bei Rückenschmerzen sollte immer eine Röntgenaufnahme der Wirbelsäule gemacht werden", korrekte Antwort "falsch": 29% - 41%
• "Bettruhe ist die beste und wichtigste Therapie", korrekte Antwort "falsch": 63% - 68%
• "Man erholt sich schneller von Rückenschmerzen, wenn man weiter zur Arbeit geht oder so schnell wie möglich wieder arbeitet", korrekte Antwort "richtig": 40% - 47%
Unter dem Strich stellen die Wissenschaftler dann fest, dass sie auch bei statistischer Kontrolle anderer Variablen (Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Schichtzugehörigkeit) eher geringfügige Verbesserungen durch die Informationskampagne beim Wissensstand der Bevölkerung über Rückenschmerzen feststellen konnten. Auch andere Indikatoren wurden noch herangezogen, um zu sehen, ob es Effekte für die medizinische Versorgung gibt. Für die Zahl der Krankenstands-Tage bei Erwerbstätigen zeigte sich jedoch zwischen Bezirken mit und ohne Aufklärung ebenso wenig ein Unterschied wie im Hinblick auf die Zahl der Operationen nach einem Bandscheibenvorfall. Lediglich für Röntgen- oder CT-Aufnahmen gab es einen Lichtblick: Während in den Bezirken mit informierten Bürgern diese Zahl von 2001-2005 konstant blieb, stieg sie in den anderen Regionen um fast 60% an. Schlussfolgerung der Wissenschaftler: Möglicherweise war die 1,1 Millionen Dollar teure Kampagne finanziell und vom Medienaufwand her zu schmalspurig angelegt und es bedarf eines höheren Aufwands, um das Bevölkerungswissen nachhaltig zu verbessern.
Hier ist ein Abstract der Studie: Erik L. Werner u.a.: Low back pain media campaign: No effect on sickness behaviour (Patient Education and Counseling, Article in Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.pec.2007.12.009)
Gerd Marstedt, 12.2.2008
Wissenschaftler kritisieren: Leitlinien und Ratschläge zur gesunden Ernährung verursachen oft mehr Schaden als Nutzen
 Die Propagierung von Ernährungsrichtlinien basiert nur selten auf wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen, so wie dies in der medizinischen Forschung der Fall ist. Gleichwohl werden immer wieder Leitlinien aufgestellt und über die Medien Verhaltensratschläge verbreitet - in der Annahme, dass diese Empfehlungen zwar nicht 100prozentig abgesichert sind, aber zumindest nicht schaden können. Dass diese Informationspolitik sehr wohl großen Schaden anrichten kann, versuchen Wissenschaftler des Albert Einstein College of Medicine und der Yeshiva University (beide New York) in einem Aufsatz darzulegen, der jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Preventive Medicine" veröffentlicht wurde.
Die Propagierung von Ernährungsrichtlinien basiert nur selten auf wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen, so wie dies in der medizinischen Forschung der Fall ist. Gleichwohl werden immer wieder Leitlinien aufgestellt und über die Medien Verhaltensratschläge verbreitet - in der Annahme, dass diese Empfehlungen zwar nicht 100prozentig abgesichert sind, aber zumindest nicht schaden können. Dass diese Informationspolitik sehr wohl großen Schaden anrichten kann, versuchen Wissenschaftler des Albert Einstein College of Medicine und der Yeshiva University (beide New York) in einem Aufsatz darzulegen, der jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Preventive Medicine" veröffentlicht wurde.
Die aktuelle Übergewichts-Problematik, von der neben England in überdurchschnittlich starkem Maße auch die USA betroffen sind, ist nach der Argumentation der Forscher zu einem erheblichen Anteil verursacht worden durch Ratschläge von Ernährungswissenschaftlern, fettreiche Nahrungsmittel auf dem Speiseplan massiv einzuschränken oder ganz darauf zu verzichten. In den nationalen Richtlinien der USA, herausgegeben vom U.S. Department of Agriculture und dem U.S. Department of Health and Human Services war seit den 70er-Jahren immer betont worden, der Fettanteil in der Nahrung müsse reduziert werden, um länger und gesünder zu leben. Medien haben diese Empfehlungen dann immer wieder in ihre Schlagzeilen gebracht.
Ab dem Jahr 2000 korrigierte man dann die im Turnus von 5 Jahren jeweils überarbeiten Empfehlungen und attestierte, dass der Hinweis auf eine Reduktion des Fettanteils wohl unklug gewesen sei. Diese Empfehlung habe in der Bevölkerung zu der Überzeugung geführt, dass es für eine gesunde Ernährung schon ausreiche, wenn man nur fettarme und fettfreie Produkte zu sich nähme. Als Effekt davon war der Anteil von Nahrungsmitteln deutlich angestiegen, die einen besonders hohen Anteil von Kohlenhydraten und Kalorien aufweisen - was wiederum zu Übergewicht und Fettleibigkeit bei vielen Bevölkerungsgruppen führte.
Die Wissenschaftler dokumentieren diesen Prozess des Rückgangs fettreicher Nahrungsmittel an der Ernährung der US-Amerikaner und des gleichzeitigen Anstiegs von kohlehydratreichen Produkten mit exakten statistischen Daten im Zeitraum 1971 bis 2001. Deutlich wird aus den Abbildungen, dass der Konsum fettreicher Produkte abnahm, während sich die aufgenommene Kalorienmenge in diesem Zeitraum bei Männern wie Frauen deutlich erhöht hat. Hingewiesen wird darauf, dass hier die Ernährungswissenschaftler und Gesundheitsexperten in den nationalen Komitees einigen Missverständnissen aufgesessen sind. Zwar sei zu fettreiche Nahrung tatsächlich nicht gesund und ein Risikofaktor für viele Erkrankungen. Aber es sei zum ersten ein Unterschied, ob man sich bei Ernährungs-Empfehlungen pauschal an die Gesamtbevölkerung richtet oder ob Ärzte dies unter genauer Betrachtung des individuellen Gesundheitszustands für einen einzelnen Patienten formulieren. Und zum zweiten sei zu fettreiche Ernährung eben nur ein Risikofaktor, ein direkter Zusammenhang als alleinige Ursache etwa von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sei bislang nicht belegt.
Zum zweiten sei es problematisch nur Empfehlungen auszusprechen, die einen einzelnen Aspekt des Ernährungsverhaltens bzw. einen einzelnen Risikofaktor betreffen. Hierbei sei immer unklar, wie sich die Bevölkerung daraufhin verhalte und ob dies nicht andere Verhaltensrisiken bewirkt, die unter Umständen noch gravierendere Negativfolgen mit sich bringen. Die Warnung vor zu fettreicher Ernährung und in der Folge die Berücksichtigung dieser Warnung, aber die gleichzeitig ungehemmte Aufnahme extrem kalorienreicher Kohlehydrat-Produkte habe diese Gefahr deutlich gemacht.
Der Netto-Effekt der Ernährungsrichtlinie sei in diesem Fall also eindeutig negativ. Wenn es jedoch nur ungenügende wissenschaftliche Belege für den Netto-Effekt von Leitlinien zur Ernährung gibt - und dies sei fast durchweg der Fall - sei es besser zu schweigen und keine pauschalen Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung auszusprechen. Dass das Beispiel "zu fettreiche Nahrung" keineswegs ein Einzelfall oder eine Ausnahme ist, zeigen die Wissenschaftler noch einmal am Schluss ihres Artikels am Beispiel der "Transfette", die besonders intensiv in Pommes frites, Chips und industriellen Backwaren zu finden sind. Zwar gibt es tatsächlich statistische Zusammenhänge zu Risikofaktoren für koronare Herzerkrankungen. Die in den Medien zuletzt gehäuft zu findenden Warnungen vor diesen Transfetten hat jetzt jedoch zu einem Rückgang des Konsums geführt. Dabei ist jedoch völlig unklar, wodurch diese ersetzt werden und ob dies einen positiven Netto-Effekt für gesunde Ernährung mit sich bringt.
Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: Paul R. Marantz u.a.: A Call for Higher Standards of Evidence for Dietary Guidelines (Am J Prev Med 2008, Volume 34, Issue 3, March 2008, Pages 234-240; DOI: 1016/j.amepre.2007.11.017)
Eine ausführlichere Zusammenfassung ist hier: medpage today: Dietary Guidelines May Have a Downside
Zur Botschaft des Artikels passt recht gut die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Warnung aus dem Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie der Universität Münster, Olivenöl sei weitaus weniger gesund als landläufig angenommen. Arteriosklerose würde nicht verhindert, sondern womöglich ganz im Gegenteil sogar begünstigt. Die Wissenschaftler hatten Meerschweinchen (deren Grundnahrungsmittel ganz überwiegend Heu ist) 4 Monate lang mit einer ölsäurereichen Diät gefüttert. Am Ende konnten sie zwar keine Arteriosklerose bei den Versuchstieren finden. Um keine Antwort verlegen erklärte der leitende Forscher Prof. Krieglstein: "Das kann aber auch daran liegen, dass Meerschweinchen grundsätzlich nur selten Arteriosklerose entwickeln." Zumindest hatten die Meerschweinchen jedoch am Ende des Versuchs etwas kleinere und leichtere Herzen als die Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis reichte dann schon aus, um die in den Medien massenhaft kolportierte Warnung zu liefern: Olivenöl kann zu Arteriosklerose beitragen
Gerd Marstedt, 26.1.2008
Die Vielzahl der Informationen über Krebserkrankungen und Präventions-Empfehlungen hinterlässt überwiegend Abwehr und Verwirrung
 Wie eine Bevölkerungsumfrage in Deutschland unlängst gezeigt hat, sind Patienten heute anspruchsvoller, was Informationen zu Gesundheitsfragen anbetrifft. Die ärztliche Diagnose reicht den meisten nicht aus, zwei von drei Patienten bemühen sich vor oder nach einem Arztbesuch um zusätzliche Informationen. Da stellt sich die Frage, wie hilfreich solche außerhalb der ärztlichen Praxis - im Internet, Büchern oder Zeitschriften - gesuchten Informationen sind. Für das Beispiel Krebs-Informationen hat nun eine repräsentative US-amerikanische Studie äußerst ernüchternde Befunde gezeigt.
Wie eine Bevölkerungsumfrage in Deutschland unlängst gezeigt hat, sind Patienten heute anspruchsvoller, was Informationen zu Gesundheitsfragen anbetrifft. Die ärztliche Diagnose reicht den meisten nicht aus, zwei von drei Patienten bemühen sich vor oder nach einem Arztbesuch um zusätzliche Informationen. Da stellt sich die Frage, wie hilfreich solche außerhalb der ärztlichen Praxis - im Internet, Büchern oder Zeitschriften - gesuchten Informationen sind. Für das Beispiel Krebs-Informationen hat nun eine repräsentative US-amerikanische Studie äußerst ernüchternde Befunde gezeigt.
Der Titel der Studie "Frustriert und verwirrt", die jetzt im "Journal of General Internal Medicine" veröffentlicht wurde, deutet bereits das zentrale Ergebnis an: Die meisten US-Amerikaner bekunden in den Telefon-Interviews, dass sie trotz erheblicher zeitlicher Bemühungen von den Ergebnissen enttäuscht waren und erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit hatten. Eine repräsentative Stichprobe von knapp 6.400 erwachsenen US-Bürgern war Basis der Untersuchung. In Telefon-Interviews wurden sie gefragt, ob sie schon einmal nach Informationen über Krebserkrankungen gesucht hätten, ganz gleich, in welchen Medien, und wie das Ergebnis dieser Bemühungen ausgefallen sei. Ein wesentlicher Befund war, dass die Vielzahl der Informationen und Präventions-Empfehlungen offenbar bei vielen zu Abwehrreaktionen führt, und damit das Gegenteil der beabsichtigten Ziele erreicht:
• Gut die Hälfte derjenigen Befragten, die schon einmal Krebs-Informationen gesucht hatten (51%), stimmte nämlich der Aussage zu: "Man kann wohl zu fast allem sagen: Auch dies kann eine Krebserkrankung verursachen",
• etwa jeder vierte (24%) meinte: "Um eine Krebserkrankung zu vermeiden, kann man im Grunde nicht viel tun"
• und rund 75% waren der Auffassung "Es gibt viel zu viele Empfehlung zur Krebsprävention und man kann daher schwer entscheiden, welche man befolgen soll."
Weitere Ergebnisse der Studie:
• Knapp die Hälfte (48%) hatte sich schon einmal selbst um solche Informationen bemüht oder andere darum gebeten
• Überraschender Weise war dies in den Altersgruppen der unter 65jährigen deutlich häufiger der Fall als bei 65jährigen und älteren
• Frauen waren doppelt so oft engagiert wie Männer, ähnliche Unterschiede zeigten sich für das Bildungsniveau: je höher der Schulabschluss, desto öfter wurde nach Informationen gesucht
• Bei Studienteilnehmern mit einer Krebsdiagnose war die Informationssuche etwa 6mal so oft feststellbar. Aber auch wenn man selbst nicht betroffen war, es jedoch in der Familie Krebserkrankungen gegeben hatte, lag die Quote noch 2,5mal so hoch.
Für die Bewertung der jeweils gefundenen Informationen zeigte sich:
• 58% äußerten Zweifel, was die Qualität und Zuverlässigkeit der Informationen anbetrifft
• 49% hätten gerne detaillierte Informationen gehabt, wussten aber nicht, wo diese zu finden wären
• 48% sagten, dass es sehr mühsam und zeitaufwändig sei, solche Informationen zu finden
• 41% fühlten sich während der Suche sehr enttäuscht
Hier ist ein Abstract der Studie.: Neeraj K. Arora u.a.: Frustrated and Confused: The American Public Rates its Cancer-Related Information-Seeking Experiences
(Journal of General Internal Medicine, Online First, doi: 10.1007/s11606-007-0406-y
Unter dem Strich zeigt sich damit, dass trotz einer Vielzahl von Bemühungen zur Patienten-Information, sei es im Internet, sei es in Beratungsstellen oder in TV-Sendungen, die Vielfalt und Unübersichtlichkeit der angebotenen Informationen für die Mehrheit der Patienten ein großes Problem darstellt. Dieses Ergebnis gilt wohl nicht nur für die USA und für Informationen zu Krebserkrankungen. Denn erst kürzlich stellte eine deutsche Bevölkerungsumfrage fest: "Informationsflut in Gesundheitsfragen überfordert Patienten"
Gerd Marstedt, 22.1.2008
"Gesundheits-Hysterie!" - Englische Medien stellen Empfehlungen zum Gesundheitsverhalten massiv in Frage
 Lange Zeit hatten die englischen Medien nur kommentarlos berichtet über die stets neuen Gesundheits-Ratschläge von Wissenschaftlern und Ärzteverbänden. Nun scheint das Fass übergelaufen zu sein. Nachdem die Forschungs- und Informationsstelle "World Cancer Research Fund (WCRF)" im November letzten Jahres ihre neuen Ratschläge zum Gesundheitsverhalten und zur Prävention von Krebserkrankungen veröffentlicht hatte, schlugen die Medien in seltener Geschlossenheit zurück und attackierten die aus ihrer Sicht immer unverschämtere "Gesundheits-Hysterie" von Wissenschaftlern und Medizinern. Ausschlaggebend dafür war unter anderem, dass man englischen Bürgern den zum Frühstück ebenso wie auf Hamburgern ach so geliebten Speck verbieten wolle - unter Verweis auf darin verborgene Krebsrisiken.
Lange Zeit hatten die englischen Medien nur kommentarlos berichtet über die stets neuen Gesundheits-Ratschläge von Wissenschaftlern und Ärzteverbänden. Nun scheint das Fass übergelaufen zu sein. Nachdem die Forschungs- und Informationsstelle "World Cancer Research Fund (WCRF)" im November letzten Jahres ihre neuen Ratschläge zum Gesundheitsverhalten und zur Prävention von Krebserkrankungen veröffentlicht hatte, schlugen die Medien in seltener Geschlossenheit zurück und attackierten die aus ihrer Sicht immer unverschämtere "Gesundheits-Hysterie" von Wissenschaftlern und Medizinern. Ausschlaggebend dafür war unter anderem, dass man englischen Bürgern den zum Frühstück ebenso wie auf Hamburgern ach so geliebten Speck verbieten wolle - unter Verweis auf darin verborgene Krebsrisiken.
Rund 7.000 Studien zur Prävention von Krebserkrankungen hatte eine Expertenkommission gesichtet und in einem umfassenden Bericht "Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective" die Ergebnisse zusammengefasst. Auf der Basis dieses Expertenberichts wurden dann zehn Empfehlungen zum Gesundheitsverhalten formuliert, um Krebserkrankungen vorzubeugen. Die Liste liest sich wie ein kleiner Katechismus zum gesunden Leben:
"1. Sei so dünn wie möglich - ohne Untergewicht zu bekommen
2. Sei jeden Tag mindestens 30 Minuten körperlich aktiv.
3. Vermeide gezuckerte Getränke. Schränke den Verzehr besonders energiereicher Nahrungsmittel ein (insbesondere weiter verarbeitete Produkte mit hohem Zuckerzusatz, wenig Ballaststoffen oder hohem Fettanteil).
4. Iß mehr Gemüse, Obst, Früchte, Körner und sei dabei abwechslungsreich.
5. Schränke den Verzehr von rotem Fleisch ein (Rind, Schwein, Lamm) und vermeide weiter verarbeitetes Fleisch (Speck, Schinken, Salami, Würstchen) möglichst ganz.
6. Wenn überhaupt, dann trinke nur mäßig Alkohol, Männer höchstens 2, Frauen 1 Getränk am Tag,
7. Schränke den Verzehr stark salzhaltiger Nahrungsmittel ein und solcher Produkte, die mit Salz angereichert wurden.
8. Nimm keine Nahrungsergänzungsmittel zur Krebsvorbeugung zu Dir.
Empfehlungen für einzelne Bevölkerungsgruppen:
9. Für Mütter ist es das Beste, das neugeborene Kind bis zu 6 Monate nur zu stillen und erst danach auch andere Flüssigkeiten und Nahrungsmittel zu geben.
10. Krebspatienten sollten nach der Therapie die Ratschläge zur Vorbeugung beherzigen.
Und - denke immer daran! - nicht rauchen oder Kautabak konsumieren."
(vgl.: World Cancer Research Fund 2007: WCRF UK's recommendations for cancer prevention).
Hatten die englischen Medien zuvor meist ebenso kommentar- wie schnörkellos über ähnliche wissenschaftliche Ratschläge berichtet oder über Maßnahmen der Regierung (Rauchverbot in Pubs, Interventionen für ein gesünderes Schulessen, Einführung der Lebensmittelampel), so formierte sich nun in seltener Einmütigkeit Widerstand.
• Das Boulevardblatt "The Sun" zitierte den Radio- und TV-Prominenten Antony Worrall Thompson, der die medizinischen Ratschläge überaus harsch abkanzelte: "Sie testen Mäuse und Ratten, geben ihnen eine Zwangsernährung und sie bekommen Krebs. Wir Menschen werden nicht zwangsernährt. Es ist überhaupt nicht verkehrt, in der Woche auch mal ein Speck-Sandwich zu essen. Wenn es nach ihnen geht, werden wir noch alle Vegetarier." Und auch ein Krebsspezialist des London Imperial College School of Medicine kam zu Wort: "Rotes Fleisch und Speck im Maßen gegessen ist nicht schädlich,. Dies zu behaupten ist schlicht falsch." vgl.: The Sun: Save our bacon: Butty battle
• In einer Meldung der Nachrichtagentur Reuters kommt ein Repräsentant der Nahrungsmittelindustrie zu Wort: "Sie können 20 oder 30 Jahre lang auf Speck verzichten, keinen Spaß am Leben haben, und dann erwischt Sie im Straßenverkehr ein Auto. Ich meine: Alles in Maßen!" vgl.: Reuters: Bacon munchers defy cancer scare
• In der "Daily Mail" nennt der Krebsspezialist Prof. Karol Sikora die Empfehlungen "ebenso banal wie dogmatisch" und fügt hinzu: "Niemand wird sich daran halten. Ich jedenfalls werden nicht auf sonntägliches Roastbeef und mein Glas Wein verzichten." vgl.: Daily Mail: Is anything safe to eat? Cancer report adds bacon, ham and drink to danger list
• Im "Guardian" ist davon die Rede, dass der "Hysterie-Bazillus" nun endgültig die Mediziner befallen hat. Der Redakteur Mark Lawson beklagt: "Die aktuelle Aufregung über Speck und Fettsäuren zeigt, dass die Probleme der öffentlichen Übertreibung und Hysterie nun bei den Ärzten angekommen sind. Die allgemeine Steigerung der Rhetorik im heutigen Leben hat die Wissenschaft erreicht. Gierig nach Publicity und Geldern behandeln Forscher nun einzelne Getränke und Nahrungsmittel so, als ob sie Osama bin Ladens der Ernährung wären, während es in Wirklichkeit doch so ist, dass Krebserkrankungen von einer komplexen Kette unterschiedlicher Faktoren abhängen: Gene, Umgebungsbedingungen, Lebensstil und auch Glück." vgl.: Guardian Unlimited: Blame it on the bacon - The latest commotion over diet and cancer suggests the hysteria bug has now infected doctors
• In einem anderen Artikel des "Daily Mail" schließlich gerät die in wissenschaftlichen Studien gängige Übertreibung durch Angabe relativer Risiken und Verschweigen der absoluten Risiken unter Beschuss. Vorgerechnet wird hier, was es tatsächlich heißt, wenn durch den Verzehr von rotem Fleisch das Risiko einer Darmkrebserkrankung um 9 Prozent steigt. Es ist für den Einzelnen eine absolut minimale Risikoerhöhung. vgl.: Daily Mail: 'Ignore these scaremongers - I'm not giving up my bacon butties!'
Für die heftige Gegenreaktion der englischen Massenmedien dürfte sicher eine Rolle gespielt haben, dass Mediziner eine Lieblingsspeise der Nation ins Visier nahmen: Bacon. Gleichwohl ist überraschend, dass mit der Tradition einer kommentarlosen Übernahme von Schlussfolgerungen aus wissenschaftlichen Studien zur Prävention im November 2007 gebrochen wurde. Es bleibt abzuwarten, ob dies erste Hinweise auf einen öffentlichen Meinungswechsel sind, der nicht mehr klaglos Belehrungen und Gebote für das individuelle Gesundheitsverhalten akzeptiert. Möglicherweise gab es in den Medien zuletzt ein Übermaß davon. Oder man vermisst Glaubwürdigkeit, wenn stets nur das Verhalten des Individuums auf der Anklagebank steht, nicht aber Versäumnisse der Politik, krankmachende Umweltbedingungen oder gesundheitsschädigende Praktiken der Nahrungsmittelindustrie, wie sie zuletzt etwa im Film "Super Size Me" (auf sehr humorvolle Art) angeprangert wurden.
Gerd Marstedt, 13.1.2008
The Good, The Bad and the Ugly: Die Darstellung von Herz- und Krebserkrankungen in Zeitschriften-Artikeln
 Eine fast schon groteske Vereinfachung medizinischer Sachverhalte, Schuldzuweisungen für Krankheiten allein an das Individuum, fast vollständige Ausblendung der gesellschaftlichen Hintergründe chronischer Erkrankungen und der sozialen Ungleichheit vor Krankheit und Tod - so stellen die größten US-amerikanischen und kanadischen Zeitschriften Krebs- und Herzkreislauferkrankungen in ihren Artikeln und Titelgeschichten dar. Diese Feststellung treffen die beiden kanadischen Wissenschaftlerinnen Juanne Clarke und Gudrun van Amerom von der Universität von Ontario, nach einer detaillierten Inhaltsanalyse von Artikeln aus dem Jahre 2001.
Eine fast schon groteske Vereinfachung medizinischer Sachverhalte, Schuldzuweisungen für Krankheiten allein an das Individuum, fast vollständige Ausblendung der gesellschaftlichen Hintergründe chronischer Erkrankungen und der sozialen Ungleichheit vor Krankheit und Tod - so stellen die größten US-amerikanischen und kanadischen Zeitschriften Krebs- und Herzkreislauferkrankungen in ihren Artikeln und Titelgeschichten dar. Diese Feststellung treffen die beiden kanadischen Wissenschaftlerinnen Juanne Clarke und Gudrun van Amerom von der Universität von Ontario, nach einer detaillierten Inhaltsanalyse von Artikeln aus dem Jahre 2001.
Basis ihrer Studie waren 40 zufällig ausgewählte Berichte über Herz- und Krebserkrankungen aus solchen Zeitschriften und Magazinen, die in Kanada und den USA die höchste Verbreitung haben. Zur Einordnung der Ergebnisse heben die Wissenschaftlerinnen hervor, dass der typische Leserkreis dieser Zeitschriften nicht aus der Unterschicht kommt, sondern mittlere und höhere Bildungsabschlüsse hat. Ihre Kritik dürfte vermutlich noch deutlich schärfer ausfallen, wenn ihr Material aus den typischen Boulevardblättern oder Magazinen der Regenbogenpresse entnommen wäre. Und es ist wohl nicht abwegig, die Hypothese aufzustellen, dass die Ergebnisse der Studie in Deutschland keine wesentlich anderen gewesen wären.
Die Zusammenfassung der Befunde fällt recht harsch aus: "Die von uns analysierten repräsentativen Artikel suggerieren,
• dass Krankheit im Grunde auf eine Zelle oder ein Organ zurückgeht, das vorübergehend defekt ist,
• dass dies durch ein anderes Verhalten vermeidbar gewesen wäre,
• dass eine gute Gesundheitsversorgung allen zur Verfügung steht,
• dass Individuen zusammen mit ihrem Arzt die jeweils beste Therapie auswählen können,
• dass Medizin nur "schulmedizinische" und keine komplementären Therapien umfasst,
• dass medizinische Versorgung immer und für jeden verfügbar ist und Kosten keine Rolle spielen."
Die Darstellung von Krankheit ist nach der Interpretation der Forscherinnen "reduktionistisch" durch eine grotesk vereinfachende Darstellung der Krankheitsursachen und Krankheitshintergründe. Als Beispiel hierfür dienen viele Zitate wie die folgenden: "Eine blockierte Arterie war die Übeltäterin und sie wurde noch am selben Tag durch Angioplastie repariert". Oder folgende Beschreibung, die den Film "Zwei glorreiche Halunken" (Original: "The Good, the Bad and the Ugly") als Plot für die Entstehung von Herzerkrankungen vorschlägt: "Stellen Sie sich diesen Zusammenhang vor wie eine Hollywood-Neuverfilmung von 'The Good, the Bad and the Ugly' mit bekannten Schauspielern: Das gute Cholesterin (HDL), das böse Cholesterin (LDL) und das Hässliche (Herzinfarkt). Die Helden sind gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und eine Gruppe von Arzneien, die man Statine nennt. Diese kämpfen gegen den hohen Cholesterinspiegel, indem sie ein Leberenzym in die Enge drängen, das die Cholesterinproduktion anheizt."
Krankheitsrisiken werden in den Artikeln nahezu ausschließlich in individuellem Fehlverhalten gesehen: "Stress, Cholesterin und emotionale Narben sind beileibe nicht die größten Feinde, die uns krank machen. Ganz klar sind das Rauchen und der Alkoholkonsum jene Faktoren, die unsere Lebenserwartung verkürzen." Zwar verhält sich das Individuum fast immer ungesund, doch es gibt Hilfe durch medizinische Interventionen, wenn man sich darum bemüht, so wie im folgenden Beispiel nach einer Krebsdiagnose: "1.) Fragen Sie Ihren Arzt nach einer 'dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA)'. 2.) Nehmen Sie Kalzium ein. 3.) Heben Sie Gewichte. Wenn Sie dies 2-3mal in der Woche machen, stärkt es Ihre Knochen, baut Muskelmasse auf und stabilisiert Ihr Gleichgewicht." Natürlich gehört auch die regelmäßige Teilnahme an Früherkennung zu den Ratschlägen: "Der erste Schritt sind Früherkennungsuntersuchungen, so früh und so oft wie möglich. Fange Sie mit 20 schon an und dann alle fünf Jahre. Alle Erwachsenen, auch wenn sie keinerlei Beschwerden haben, sollten regelmäßig Blutanalysen durchführen lassen, um ein exaktes Lipoprotein-Profil zu bekommen (HDL, LDL, Gesamtcholesterin, Triglyzerine)."
Die Wissenschaftler kritisieren auch, dass es in den Artikeln "keinerlei Diskussion sozialer Zusammenhänge gibt wie soziale Integration oder sozialer Ausschluss, Schichtzugehörigkeit, ethnische Gruppen, Armut, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit oder andere Einflussfaktoren für Krankheit. Dafür dienen berühmte und reiche Personen als Aufhänger für die Berichte."
Die Befunde sind wohl nicht nur wissenschaftlich und soziologisch von Interesse. Da wir in einer Mediengesellschaft leben, werden durch die Stereotypie solcher Darstellungen auch die Einstellungen und Verhaltensorientierungen von Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen beeinflusst, seien es Gesundheitspolitiker oder auch leitende Mitarbeiter in Krankenkassen oder Sozialeinrichtungen. Ein Effekt hieraus ist beispielsweise die Platzierung von Geldmitteln, die nahezu ungebremst in pharmazeutische und medizintechnische Forschung und Ausstattung fließen, wobei soziale Rahmenbedingungen (Wohnen, Arbeiten, Bildung) fast vollständig negiert werden.
Hier ist ein Abstract der Studie: Juanne Clarke, Gudrun van Amerom: Mass print media depictions of cancer and heart disease: community versus individualistic perspectives? (Health & Social Care in the Community (OnlineEarly Articles), doi:10.1111/j.1365-2524.2007.00731.x)
Gerd Marstedt, 4.12.2007
Forschungsbilanz stellt fest: Gewaltdarstellungen in neuen Medien sind ein öffentliches Gesundheitsrisiko
 Die Vielzahl der Gewaltdarstellungen im Internet und in PC-Spielen, in Fernsehsendungen und Kinofilmen ist ein nachhaltiges Risiko für die Öffentliche Gesundheit. Zwar ist das Risiko für Erkrankungen durch das Rauchen noch ein wenig höher einzuschätzen. Doch in einer Rangfolge der Risiken (mit dem Rauchen auf Platz 1) ist der Konsum von Gewaltszenen mit der Folge daraus resultierender Aggressivität und krimineller Vergehen in der Bevölkerung schon auf Platz 2 einzustufen. Dies ist eine der Thesen, die der Wissenschaftler L. Rowell Huesmann von der University of Michigan nach einer Bilanzierung vorliegender empirischer Forschungsstudien und theoretischer Modelle jetzt in einem Aufsatz vorstellt, der in der Zeitschrift "Journal of Adolescent Health" veröffentlicht wurde.
Die Vielzahl der Gewaltdarstellungen im Internet und in PC-Spielen, in Fernsehsendungen und Kinofilmen ist ein nachhaltiges Risiko für die Öffentliche Gesundheit. Zwar ist das Risiko für Erkrankungen durch das Rauchen noch ein wenig höher einzuschätzen. Doch in einer Rangfolge der Risiken (mit dem Rauchen auf Platz 1) ist der Konsum von Gewaltszenen mit der Folge daraus resultierender Aggressivität und krimineller Vergehen in der Bevölkerung schon auf Platz 2 einzustufen. Dies ist eine der Thesen, die der Wissenschaftler L. Rowell Huesmann von der University of Michigan nach einer Bilanzierung vorliegender empirischer Forschungsstudien und theoretischer Modelle jetzt in einem Aufsatz vorstellt, der in der Zeitschrift "Journal of Adolescent Health" veröffentlicht wurde.
Der Übersichtsartikel geht auch kurz ein auf die theoretischen Konzepte, die den Zusammenhang von Gewalterleben und Gewaltausübung thematisieren (Lernen durch Beobachtung und Nachahmung, Desensibilisierung, "inaktives Lernen), bemüht sich aber hauptsächlich um die Zusammenfassung empirischer Forschungsbefunde.
Hinsichtlich der Häufigkeit, mit der Kinder in unterschiedlichen Medien Gewaltdarstellungen erleben, ist der Forschungsstand weit fortgeschritten. In den USA sehen Kinder im Durchschnitt etwa 3-4 Stunden täglich fern. Etwa 60% dieser Programme zeigen auch Gewalt und etwa 25% sogar sehr drastische Gewaltszenen. In 83% aller US-Haushalte mit Kindern gibt es Videospiele und etwa die Hälfte der 8-18jährigen spielt an einem Tag auch damit - im Durchschnitt knapp eine Stunde am Tag. Die allermeisten dieser Videospiele (83%) enthalten nach einer Studie auch Gewaltdarstellungen.
Zwei große Meta-Analysen von insgesamt weit über 200 Veröffentlichungen haben gezeigt, dass es sehr hohe Korrelatioonen gibt zwischen der Intensität von Gewalterleben und persönlicher Gewaltausübung oder Aggressivität. Berücksichtigt man nur den Aspekt der Gewaltausübung gegen Personen, so liegt diese Korrelation in den Studien im Durchschnitt bei 0.32. Zwar ist hier die Frage der Verursachung nicht geklärt: Verführt die häufige Wahrnehmung von Gewaltdarstellungen zur Nachahmung oder haben ohnehin schon gewaltbereite Kinder ein größeres Interesse an solchen Szenen? Allerdings zeigen auch Längsschnittanalysen, die die jeweilige Gewaltbereitschaft in einem bestimmten Alter mitberücksichtigen, gleichwohl, dass hier noch ein Verstärkungseffekt wirksam ist.
Auch mehrere experimentelle Studien, in denen man Kindern Gewaltdarstellungen in Filmen zeigte oder sie Gewalt in Videospielen ausüben ließ, zeigen - auch im Vergleich zu Kontrollgruppen - sehr eindeutig, dass schon die Wahrnehmung und das Erleben von Schlägereien, Schiessereien und Ähnlichem das eigene Aggressions-Verhalten beeinflusst. Eine bedeutsame Verlaufsstudie über 15 Jahre konnte aufzeigen, dass die Intensität des Fernsehkonsums mit Gewaltdarstellungen die Aggressivität der Kinder steigert, auch wenn eine Vielzahl anderer Einflussfaktoren, darunter die Gewaltbereitschaft zu Beginn der Studie, mitberücksichtigt wurde. Aggressivität wurde dabei mit unterschiedlichen Indikatoren erfasst, von kleineren Schlägereien bis hin zu kriminellen Vergehen.
Der Aufsatz zitiert in der Zusammenfassung der Befunde eine Analyse, in der unterschiedliche Gesundheitsrisiken hinsichtlich der Stärke des Zusammenhangs miteinander verglichen werden, auf der Basis unterschiedlicher Forschungsbefunde. Dabei rangiert der Aspekt "Rauchen - Lungenkrebs" ganz vorne, bei einer mittleren Korrelation von etwa 0.38. Direkt dahinter steht jedoch schon auf Platz 2 der Zusammenhang "Gewalterleben in Medien - Aggressivität" (Korrelation: 0.30), noch vor dem Risiko "Kondomgebrauch - HIV-Infektion" (0.18).
Hier findet man ein kostenloses Abstract der Studie: L. Rowell Huesmann: The Impact of Electronic Media Violence: Scientific Theory and Research (Journal of Adolescent Health, Volume 41, Issue 6, Supplement 1, December 2007, Pages S6-S13)
Gerd Marstedt, 1.12.2007
Statistische Schaumschlägereien mit Risiken: "Um 40% gesenktes Krankheitsrisiko durch XYZ"
 In Medienberichten über den Effekt neuer Medikamente oder über die Gefahren des Rauchens, Trinkens oder des Verzehrs bestimmter Lebensmittel findet man sie fast täglich: Risiko-Meldungen. "Achtfach erhöhte Erkrankungsrisiken bei häufigem Verzehr von AB!", "Um 40% gesenkte Krankheitsrisiken bei Einnahme von Medikament CD". Noch häufiger sind solche aufsichtserregenden, zugleich aber wenig aussagekräftigen Zahlen natürlich in den Werbeanzeigen für Medikamente und pflanzliche Arzneimittel zu finden oder auf Webseiten der Hersteller und Verkäufer. Wer sich überzeigen möchte, schaue einmal auf der Vitamin-PR-Seite Krebsvorsorge vorbei.
In Medienberichten über den Effekt neuer Medikamente oder über die Gefahren des Rauchens, Trinkens oder des Verzehrs bestimmter Lebensmittel findet man sie fast täglich: Risiko-Meldungen. "Achtfach erhöhte Erkrankungsrisiken bei häufigem Verzehr von AB!", "Um 40% gesenkte Krankheitsrisiken bei Einnahme von Medikament CD". Noch häufiger sind solche aufsichtserregenden, zugleich aber wenig aussagekräftigen Zahlen natürlich in den Werbeanzeigen für Medikamente und pflanzliche Arzneimittel zu finden oder auf Webseiten der Hersteller und Verkäufer. Wer sich überzeigen möchte, schaue einmal auf der Vitamin-PR-Seite Krebsvorsorge vorbei.
Da wird festgestellt, "dass die Supplementation der Antioxidantien Selen, Vitamin E und Beta-Carotin die Sterblichkeit an Magenkarzinomen um 21 Prozent senken konnte", dass "dass Testpersonen ein bis zu 50 Prozent geringeres Hautkrebsrisiko hatten", dass "Fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag das Risiko, an Krebs zu erkranken, um 20 Prozent senken" oder dass "das Darmkrebsrisiko einer Studie zufolge sich um 46 Prozent verringert, wenn man mindestens einmal am Tag Broccoli, Kohl, Salat, Rosenkohl oder Blumenkohl isst".
Dass die bloße Mitteilung solcher Risikosenkungen wenig aussagekräftig ist, mag folgendes Beispiel verdeutlichen, das jetzt ein US-amerikanisches Forschungsteam veröffentlichte, nachdem sie eine große Zahl wissenschaftlicher Publikationen analysiert hatten: Ein relatives Risiko von 50% im Vergleich einer Gruppe A mit einer Gruppe B besagt noch sehr wenig. Es kann sein, dass von der Gruppe A (1000 Personen, die regelmäßig ein Medikament XY einnehmen) später einmal 2 Personen von einer bestimmten Krankheit betroffen sind, während von der Gruppe B (1000 Personen, die kein Medikament einnehmen), später einmal 4 Personen erkranken. Das Risiko der Gruppe A ist also nur halb so groß, in Medien oder Werbung würde wohl erscheinen: "XY senkt das Erkrankungsrisiko um 50%". Dass insgesamt 998 bzw. 996 Personen von jeweils 1000 gar nicht erkranken, das absolute Risiko also bei 0,2% bzw. 0,4% liegt, bleibt außen vor.
Dass in der Presse nur sehr selten Berichte auch über absolute Risiken erscheinen, liegt einerseits wohl daran, dass solche Zahlen (wie 0,2% in Gruppe A und 0,4% in Gruppe B) unspektakulär und wenig schlagzeilenträchtig erscheinen. Wie die Analyse der US-Forscher jetzt gezeigt hat, gib es aber auch noch einen anderen Grund: Auch Wissenschaftler verstecken oder verschweigen solche Daten sehr gerne, wohl aus denselben Motiven. Die Forscher hatten aus sechs besonders renommierten Medizin-Zeitschriften insgesamt 222 Artikel herausgesucht, in denen bestimmte Schlagworte und Fachbegriffe zur Kennzeichnung eines relativen Risikos auftauchen. In diesen Zeitschritt überprüften sie dann, ob auch Angaben zu absoluten Risiken vorhanden waren. Als Ergebnis zeigte sich: Nur jede dritte Veröffentlichung machte solche Angaben auch direkt und schnell auffindbar in der Zusammenfassung. Bei den übrigen zwei Dritteln war diese Information bei der Hälfte zumindest im Textteil verborgen.
Berücksichtigt man, dass Journalisten, die nicht für medizinische Fachzeitschriften arbeiten, in der Regel keine Zeit haben, lange Fachaufsätze zeilengetreu zu lesen, und dass für den ganz überwiegenden Teil von Fachveröffentlichungen nur das Abstract frei und kostenlos zugänglich ist, dann wird deutlich, dass die Sensationsmeldungen der Presse ganz maßgeblich auch verursacht werden durch überaus lückenhafte wissenschaftliche Informationen.
Der Aufsatz ist hier im Volltext kostenlos nachzulesen: Lisa M Schwartz et al: Ratio measures in leading medical journals: structured review of accessibility of underlying absolute risks
(BMJ 2006;333:1248 (16 December), doi:10.1136/bmj.38985.564317.7C)
Gerd Marstedt, 24.1.2007
Mit Rotwein und Kaffee, Walnuss und Olivenöl ein bißchen Gesundheit naschen
 Wer für 2007 Vorsätze gefasst hatte wie "Nicht mehr so viel Kaffee trinken" oder "Weniger Alkohol!" wurde gleich zu Beginn des Neuen Jahrs verunsichert. Denn er fand Presse-Meldungen, deren Botschaft war: Alles gar nicht so schlimm für die Gesundheit, eher im Gegenteil! Da meldet das Deutsche Ärzteblatt: "Hypertonie: Mäßiger Alkoholkonsum senkt Herzinfarktrisiko": "Boston - Das neue Jahr beginnt mit einer angenehmen Nachricht für Hypertoniker. Nach einer neuen Auswertung der Health Professionals Follow-Up Study brauchen sie entgegen bisherigen Empfehlungen ihrer Ärzte alkoholischen Getränken nicht völlig abzuschwören. Die neue Analyse der prospektiven Beobachtungsstudie kommt in den Annals of Internal Medicine zu dem Ergebnis, dass täglich ein oder zwei Gläser eines alkoholischen Getränks das Herzinfarktrisiko senken."
Wer für 2007 Vorsätze gefasst hatte wie "Nicht mehr so viel Kaffee trinken" oder "Weniger Alkohol!" wurde gleich zu Beginn des Neuen Jahrs verunsichert. Denn er fand Presse-Meldungen, deren Botschaft war: Alles gar nicht so schlimm für die Gesundheit, eher im Gegenteil! Da meldet das Deutsche Ärzteblatt: "Hypertonie: Mäßiger Alkoholkonsum senkt Herzinfarktrisiko": "Boston - Das neue Jahr beginnt mit einer angenehmen Nachricht für Hypertoniker. Nach einer neuen Auswertung der Health Professionals Follow-Up Study brauchen sie entgegen bisherigen Empfehlungen ihrer Ärzte alkoholischen Getränken nicht völlig abzuschwören. Die neue Analyse der prospektiven Beobachtungsstudie kommt in den Annals of Internal Medicine zu dem Ergebnis, dass täglich ein oder zwei Gläser eines alkoholischen Getränks das Herzinfarktrisiko senken."
Und eingeschworene Kaffeetrinker konnten im Online-Magazin "Medizinauskunft" lesen: Kaffee: Manchmal Medizin: "Inzwischen sind die meisten Mediziner davon überzeugt, dass Kaffee eher Gutes tut. In manchen Fällen kann er sogar Medizin sein. Nach einer neueren Studie erkranken Menschen, die täglich vier bis sechs Tassen trinken, zu 30 Prozent seltener an Diabetes. Obwohl einigen Menschen nach zu starkem Kaffee schon einmal die Hand zittert, erkranken nach einer anderen Studie Vieltrinker seltener an der Parkinsonschen Schüttellähmung."
Die Serie der in den Medien kolportierten Forschungsergebnisse über gesundheitsförderliche Einflüsse von Rotwein und Olivenöl, Knoblauch, Tomaten und Walnüssen scheint ebenso endlos wie die der Sudoku-Rätsel. Und es sind nicht nur die vielfältigen Fitness-und-Diät-Magazine, die hier jedweden Befund von Forschungsprojekten nachdrucken, sondern auch seriöse Online-Zeitschriften wie FAZ, Focus, Welt.
Nach wie vor auf Platz 1 steht natürlich der Rotwein, der (in Maßen genossen!) gegen unterschiedlichste Erkrankungsrisiken vorbeugen soll: Ein Glas Rotwein am Tag halbiert das Risiko, an bösartigen Tumoren der Prostata zu erkranken, meldet Focus Online. Im Rotwein enthaltene Polyphenole wirken entzündungshemmend und beugen Krebs und Herzerkrankungen vor, meldet die "Welt", aber Achtung: Dabei kommt es auf hohe Konzentrationen an, und die haben vor allem Weine aus Südwestfrankreich oder Sardinien. Und französischer Rotwein beugt natürlich auch noch der Arterienverkalkung vor, meldet die FAZ. Zwar steht Rotwein unangefochten ganz oben, aber die Liste gesunder Nahrungsmittel scheint beliebig fortsetzbar. Ein Schnelldurchgang: Eine Hand voll Walnüsse täglich beugt verengten Gefäßen und Herzleiden vor. Regelmäßiger Konsum von Olivenöl schützt vor Krebserkrankungen. Schwarzer Tee beschleunigt Stressabbau. Bier hemmt Entzündungen und Omega-3-Fettsäuren schützen nicht nur Herz und Gefäße, sie beeinflussen auch die Stimmung. Tomaten und Brokkoli gemeinsam verzehrt dienen zur Vorbeugung gegen Krebs. Alkohol verlängert das Leben älterer Frauen und Joghurt ist gut für die Immunstärkung.
Man kann es Forschungsprojekten wohl nicht verdenken, wenn sie zur Legitimation ihrer Arbeit auch ihre epidemiologischen Befunde über eine 25%ige Senkung von Erkrankungsrisiken für die Krankheit X bei täglichem Verzehr von 20 Gramm des Nahrungsmittels Y veröffentlichen, wie wenig dies auch tatsächlich zu einem gesunden Lebensstil beiträgt. Denn: "Ernährung ist und war schon immer eingebettet in kulturelle Kontexte. Neben der Funktion des Hunger-Stillens hat das Essen mannigfaltige soziale und symbolische Bedeutungen. Diese Bedeutungs-Dimensionen von Ernährung werden in der wissenschaftlichen Ernährungskommunikation zu sehr vernachlässigt." (Claudia Empacher: Was kommt auf den Teller? Lebensstile und nachhaltige Ernährung).
Die Problematik der täglichen Berichterstattung über "gesunde" oder "risikosenkende" Nahrungs- und Genussmittel ist aber noch eine andere. Die isolierte Betrachtung einzelner Verhaltens- oder Ernährungsgewohnheiten und daraus abgeleitete Ratschläge sind ebenso einfältig wie verantwortungslos. Sie suggerieren dem Leser: Damit tust Du was für Deine Gesundheit. Gesundheitsrelevant sind jedoch komplexere Änderungen des Lebensstils und des gesamten Ernährungsverhaltens und nicht das vermehrte Naschen von Walnüssen oder der gehäufte Konsum von Omega-3-Fettsäuren. Medien verstärken durch ihre Meldungen den Eindruck: Gesundheit ist konsumierbar, durch Olivenöl, Rotwein oder Vitaminpillen. Dahinter steht wohl keine bewusste Ideologie-Produktion. Das tumbe Denkmuster "Ich kann mir Gesundheit in der Apotheke, im Reformhaus oder auf dem Öko-Bauernmarkt kaufen" wird jedoch weiter verfestigt.
Und schließlich: Viele Medien-Berichte übernehmen Meldungen von Forschungsergebnissen ohne jede Kontrolle und Nachprüfung der Hintergründe, der Datenbasis und ihrer wissenschaftlichen Seriosität. Wie wenig fundiert die Ergebnisse solcher Studien über den Einfluss bestimmter Nahrungsmittel auf Gesundheit und Lebenserwartung sind, hat unlängst Prof. Ingrid Mühlhauser auf dem Herbstkongress des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen dargelegt: Ob Diäten mit niedrigem Fettanteil, Folsäure und B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Fisch, moderater Alkoholkonsum oder Calcium- und Vitamin-D-Konsum - wissenschaftliche fundierte ("evidenzbasierte") Studien haben deutlich gemacht, dass die versprochenen Effekte zur Krebsprävention oder Senkung des kardiovaskulären Risikos in keinem Fall zutrafen. Der Foliensatz ist hier als PDF-Datei verfügbar: Ist vorbeugen besser als heilen?
Gerd Marstedt, 4.1.2007