



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"GKV"
andere Themen zur GKV |
Alle Artikel aus:
GKV
andere Themen zur GKV
Rehabilitation und Vorsorge für Mütter, Väter, Kinder und pflegende Angehörige - Bedarf, Wirkungen, Reformbedarf
 Die Datenbasis für diese Studie lieferten vor Beginn der Covid-19-Pandemie eine repräsentative bundesweite Befragung von 1.330 Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen und eine Befragung aller 960 Beratungsstellen (Rücklauf: 346 Stellen). Unter den Bedingungen der Pandemie wurden außerdem 73 Einrichtungen aus dem Verbund des Müttergenesungswerks (Rücklauf n=48), 1.050 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Rücklauf n=139), 1.650 ehemalige Patient*innen aus 55 MGW-Einrichtungen (Rücklauf n=671) und15 Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Beschäftigten in Einrichtungen befragt bzw. interviewt. Da das Projekt nicht verschoben werden konnte (unklar war aber auch, wann das "Ende der Pandemie" zu erwarten war und ob dies dann die Rückkehr zur vorherigen Normalität bedeuten würde), beeinflussen die Erfahrungen mit der Pandemie mit Sicherheit viele Antworten der befragten Väter und Mütter - ohne dass dieser Einfluss quantifiziert werden kann. Projektbegleitend tagte ein Begleitkreis aus Vertreter*innen der Trägerorganisationen (z.B. Caritas) der MGW-Einrichtungen und Angehörigen der Fachabteilung des BMFSFJ und war u.a. an der Erstellung von Fragebögen beteiligt.
Die Datenbasis für diese Studie lieferten vor Beginn der Covid-19-Pandemie eine repräsentative bundesweite Befragung von 1.330 Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen und eine Befragung aller 960 Beratungsstellen (Rücklauf: 346 Stellen). Unter den Bedingungen der Pandemie wurden außerdem 73 Einrichtungen aus dem Verbund des Müttergenesungswerks (Rücklauf n=48), 1.050 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Rücklauf n=139), 1.650 ehemalige Patient*innen aus 55 MGW-Einrichtungen (Rücklauf n=671) und15 Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Beschäftigten in Einrichtungen befragt bzw. interviewt. Da das Projekt nicht verschoben werden konnte (unklar war aber auch, wann das "Ende der Pandemie" zu erwarten war und ob dies dann die Rückkehr zur vorherigen Normalität bedeuten würde), beeinflussen die Erfahrungen mit der Pandemie mit Sicherheit viele Antworten der befragten Väter und Mütter - ohne dass dieser Einfluss quantifiziert werden kann. Projektbegleitend tagte ein Begleitkreis aus Vertreter*innen der Trägerorganisationen (z.B. Caritas) der MGW-Einrichtungen und Angehörigen der Fachabteilung des BMFSFJ und war u.a. an der Erstellung von Fragebögen beteiligt.
Mit einer Vielzahl von Fragen, die bereits 2007 in einer ersten Studie zur Ermittlung des Bedarfs an Mutter-, Vater-Kind-Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen nach §§ 24 und 41 SGB V gestellt, und für die aktuelle Studie nur noch z.B. um Fragen zu psychischen Beschwerden ergänzt wurden, wurde der Gesundheitszustand und die Belastungssituation von 1.330 Angehörigen dieser Zielgruppen als objektiver Bedarf für stationäre Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahmen erhoben.
Der Anteil der Personen mit Bedarf sah differenziert nach Untergruppen so aus:
• 18,9 % aller Mütter, Väter und pflegenden Angehörigen,
• 23,9 % der Frauen und 13,8 % der Männer,
• 33 % der Mütter und Väter, die Angehörige pflegen und
• 75 % der Eltern von Kindern mit einer Behinderung
hätten aufgrund ihrer gesundheitlichen und Belastungssituation eine Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahme benötigt.
Trotzdem überlegten sich nur 21,9 % dieser Personen, eine stationäre Maßnahme jedweder Art zu beantragen.
Zu den Gründen zählt weniger die Unkenntnis des Angebots (62,5 % gaben an, es zu kennen), sondern z.B. die im Vergleich mit "richtig Kranken" Unterschätzung des eigenen Bedarfs, Nachteile am Arbeitsplatz, die Scheu Pflegebedürftige während der Inanspruchnahme einer eigenen Maßnahme nicht in "fremde Hände" zu übergeben oder nicht den/die, Partner(in) allein zu lassen.
Weitere wichtige Ergebnisse der Studie lauten:
• 51 % der ehemaligen Patient*innen nutzten vor einer Maßnahme eine Beratungsstelle und 92 % von ihnen bewerteten deren Beratungsleistung mit gut/sehr gut
• rund 20 % der für eine Vorsorgemaßnahme zugewiesenen Patient*innen erwiesen sich nach der Eingangsuntersuchung in der Einrichtung als eine Person mit Rehabilitationsbedarf.
• Zu dem für die Nachhaltigkeit der Maßnahmewirkungen wichtigen Erhalt von Hinweisen über Nachsorgeangebote (schon seit längerem mit dem Begriff der "therapeutischen Kette" thematisiert) und ihrer Nutzung im Alltag nach der Maßnahme, gibt es u.v.a. folgende Ergebnisse: In ihrer Wahrnehmung erhielt die Mehrheit der zum Maßnahmezeitpunkt mehrheitlich schwer kranken und vielfach belasteten Patient*innen keine systematischen und breiten Hinweise auf gesundheits- und belastungsbezogene Nachsorgeangebote. Bei Gesundheitsangebote (z.B. Ernährung, Bewegung) sah dies etwas besser, bei Angeboten zur Bewältigung von erneuten Belastungen (z.B. Kindererziehung, Geschlechterrollen) etwas schlechter aus. Sofern solche Angebote überhaupt bekannt waren, wurden sie bis zum Zeitpunkt der Befragung nur gering bis sehr gering genutzt. Ein Teil der Befragten wollten sie aber später nutzen. Auch wenn es schon zahlreiche Hinweise auf Gründe der Nicht- oder Nochnichtnutzung gibt (z.B. Zeitmangel, keine Kinderbetreuungsmöglichkeit und die Nichtexistenz von Angeboten vor Ort) sollte das gesamte Nachsorgegeschehen noch gründlicher untersucht werden. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, weil die Nutzung diverser Nachsorgeangebote statistisch signifikante positive Effekte auf den Gesundheits- und Belastungszustand der ehemaligen Patient*innen hat.
• Die Wirkungen der Maßnahmen sahen aus Sicht der ehemaligen Patient*innen so aus: Es gibt eine deutliche Verbesserung des Gesundheits- und Belastungszustands am Ende der Maßnahme (vor Maßnahme: Gesundheit mangelhaft/schlecht=71 % und Belastungssituation sehr/eher belastet=95 %; am Ende der Maßnahme: 6 %; 27 %). Zum Befragungszeitpunkt, also rund 6 Monate nach Beendigung der Maßnahme finden sich aber deutliche Reboundeffekte (Gesundheit mangelhaft/schlecht : 18 %; Belastungssituation sehr/eher belastet: 52 %).
• Zu den versorgungspolitischen Schlussfolgerungen der Studie gehören u.a. die angesichts des Bedarfs (evtl. noch verstärkt durch die Langfristauswirkungen der Pandemie) notwendige Ausweitung der Kapazitäten für Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen für Mütter, Väter und pflegende Angehörige, die Organisation und Vergütung von Beratungsleistungen vor und nach der Maßnahme als Leistungsbestandteil, die systematische Vorbereitung aller Beteiligten auf neue Zielgruppen, die Verbesserung der spezifischen Informationen für Angehörige der neuen Zielgruppen (Väter und pflegende Angehörige), die Qualifizierung der Beratungsstellen für neue Zielgruppen, Ausbau der Kooperation in multiprofessionellen Teams, die bessere Berücksichtigung der Spezifika von Mütter/Väter/pflegende Angehörigen-Maßnahmen im QS Reha®-Verfahren, die deutliche Verbesserung der Nachsorgeangebote als Bedingung für Nachhaltigkeit: Nachsorgeberatung Pflichtleistung, Evaluation der Nicht-Inanspruchnahme und Modellversuche und der verstärkte Auf- und Ausbau interministerieller Verantwortung und Kooperation zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Der Endbericht der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellten Studie zur Untersuchung der Bedarfe von Müttern/Vätern und pflegenden Frauen und Männern (mit und ohne Kinder im Haushalt) in Vorsorge- und Reha-Maßnahmen in Einrichtungen des Müttergenesungswerkes verfasst von Jörn Sommer, Bernard Braun und Stefan Meyer, ist komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.7.21
Wer oder was fördert oder hemmt die Dissemination und Implementierung von Leitlinien? Wenig Evidentes und Erfolgversprechendes!?
 Leitlinien für die Behandlung von kranken Menschen entwickeln sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten national wie international zu immer wichtiger und auch verlässlicher werdenden Instrumenten zur Sicherung der Versorgungsqualität. Trotzdem zeigen eine Vielzahl von Studien über die Diagnostik und Therapie zahlreicher Erkrankungen und Patientengruppen, dass nicht wenige ÄrztInnen Leitlinien als Richtlinien oder Kochbuchmedizin generell ablehnen und andere ÄrztInnen es mit verschiedenen Begründungen ablehnen die Leitlinien als Empfehlungen zu bewerten und sie anzuwenden.
Leitlinien für die Behandlung von kranken Menschen entwickeln sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten national wie international zu immer wichtiger und auch verlässlicher werdenden Instrumenten zur Sicherung der Versorgungsqualität. Trotzdem zeigen eine Vielzahl von Studien über die Diagnostik und Therapie zahlreicher Erkrankungen und Patientengruppen, dass nicht wenige ÄrztInnen Leitlinien als Richtlinien oder Kochbuchmedizin generell ablehnen und andere ÄrztInnen es mit verschiedenen Begründungen ablehnen die Leitlinien als Empfehlungen zu bewerten und sie anzuwenden.
Um dies eventuell verhindern zu können, ist die Kenntnis der hinderlichen und förderlichen Faktoren und Bedingungen von Leitlinien notwendig. Um hierzu Transparenz zu schaffen, beauftragte das Bundesministerium für Gesundheit das "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" 2012, diesen Überblick zu erstellen.
Nach einem Zwischenbericht liegt nun seit dem 4. Juli 2016 der 409 Seiten umfassende Abschlussbericht vor. Er beschäftigt sich mit drei Teilzielen: der Bestandsaufnahme von Disseminierungs- und Implementierungsmaßnahmen sowie von Faktoren, die eine zielführende Umsetzung klinischer Leitlinien beeinflussen können, den Determinanten des Umsetzungserfolgs von "tailored interventions" und auf der Basis der Ergebnisse der beiden ersten Teilziele mit Vorschlägen für eine bessere Umsetzung von Leitlinien im deutschen Gesundheitssystem.
In den Bericht wurden "systematische Übersichten eingeschlossen, deren Publikation 2003 oder später erfolgte. Weiterhin wurden nur systematische Übersichten eingeschlossen, die mehrheitlich (mindestens 80 %) Maßnahmen zur Disseminierung und Implementierung von Leitlinien in Deutschland oder in Staaten untersuchen, die mit Deutschland grundsätzlich vergleichbar sind."
Für das Teilziel 1 wurden insgesamt 46 relevante systematische Übersichten eingeschlossen, von denen 33 systematische Übersichten Maßnahmen zur Disseminierung und Implementierung von Leitlinien, 11 systematische Übersichten Informationen zu beeinflussenden Faktoren und 2 systematische Übersichten sowohl Maßnahmen zur Disseminierung und Implementierung als auch Informationen zu beeinflussenden Faktoren enthielten. In den systematischen Übersichten ging es z.B. um die "Verbreitung von Informationsmaterialien": in Form einer postalischen, elektronischen oder persönlichen Verbreitung von Leitlinien, "Schulung", "lokale Meinungsführer": Unterstützung der Leitlinienimplementierung durch lokale Meinungsführer, "Audit & Rückmeldung": Rückmeldung von Leistungsdaten oder Ergebnissen (Handlungsempfehlungen, Versorgungsdaten) oder "Erinnerungssysteme": Maßnahmen, die so angelegt sind, dass sie bei dem Behandler bestimmte Informationen ins Gedächtnis rufen oder an angestrebte Handlungen erinnern.
Trotz der auch dargestellten Fülle von Einzelbeobachtungen und Erkenntnissen kommt der Bericht zu einer skeptischen Bewertung der Erkenntnislage: "Aufgrund der Heterogenität der Ergebnisse und der unzureichenden Datenlage der systematischen Übersichten kann die Effektivität für keine der identifizierten Einzel- und Mehrkomponenten-Interventionen sicher beurteilt werden."
Für das Teilziel 2, die Determinanten des Umsetzungserfolgs von "tailored interventions", wurden 22 Studien in 25 Publikationen näher betrachtet.
Und auch dann, wenn die Ergebnisse der für das Teilziel 2 untersuchten Studien mitberücksichtigt werden, lautet das Urteil bezogen auf das Teilziel 3 so: "Die zu den Teilzielen 1 und 2 analysierte Evidenz lässt keine eindeutigen und vor allem keine verallgemeinerbaren Schlussfolgerungen darüber zu, welche Implementierungsstrategien am ehesten Erfolg versprechend sind beziehungsweise die Beachtung welcher beeinflussenden Faktoren einen Implementierungserfolg sicherstellt."
Hinzu kommt für die Teilziele 1 und 2, dass nur 2 oder keine der bis zu 46 berücksichtigten Studien aus Deutschland stammten und daher "keine besonderen Rückschlüsse auf den Anwendungskontext Deutschland zulassen".
Und schließlich liefern 13 systematische Übersichten zwar 28 Faktoren, "die eine zielführende Umsetzung von klinischen Leitlinien behindern oder fördern können" (z.B. Format der Leitlinie, die Spezifität der Leitlinienempfehlungen, deren lokale Anwendbarkeit, die Qualität und Stärke der Evidenz, die den Empfehlungen zugrunde liegt, die Überprüfbarkeit der Leitlinienempfehlungen und die Autorschaft einer Leitlinie) und auch in den detaillierten Empfehlungen zur Implementierung von Leitlinien auftauchen. Dies verhindert aber nicht die unter der Überschrift "Forschungsbedarf" gezogene Schlussfolgerung: "Eine sichere Aussage zur zielführenden Disseminierung und Implementierung von klinischen Leitlinien im deutschen Gesundheitssystem ist auf Basis der identifizierten Evidenz nicht möglich."
Sowohl die 409-seitige Langfassung als auch eine 14-Seiten-Kurzfassung des IQWiG-Berichts 389 zum Thema "Umsetzung von Leitlinien - hinderliche und förderliche Faktoren" sind komplett kostenlos erhältlich. Dies gilt ebenfalls für die Dokumentation und Würdigung der Anhörung zum Vorbericht in der vor allem die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften mit einigen Belegen kritisiert, dass "bei der methodischen Planung relevante Erkenntnisse aus der Implementierungsforschung unberücksichtigt geblieben sind." Insofern hätten die im IQWiG-Bericht geäußerten Maßnahmenempfehlungen "keinen Neuigkeitswert" und würden bereits jetzt "vielfach…umgesetzt".
Angesichts der insbesondere für das deutsche Gesundheitssystem ernüchternden Bilanz stellt sich nicht nur für drittmittelabhängige GesundheitswissenschaftlerInnen oder -ökonomInnen, sondern vor allem auch für gesetzlich krankenversicherte BürgerInnen die Frage, warum es bei einem Gesamtumsatz der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von rund 202 Milliarden Euro (2015) nicht mehr Bemühungen um das Funktionieren von Leitlinien gibt. Vielleicht denken die gewählten SelbstverwalterInnen in den Krankenkassen und bei den Leistungserbringern mal darüber nach, wie sie ihrem gesetzlichen Auftrag im § 70 SGB V gerecht werden, zusammen u.a. eine "dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten" und dies in der "fachlich gebotenen Qualität"! Evidenzbasierte Leitlinien, die weit verbreitet und akzeptiert sind und dann angewandt werden, wären ein guter Beitrag!
Bernard Braun, 7.7.16
Krankheit, Sucht und Unfallfolgen Auslöser von privater Überschuldung - auch im Sozialversicherungs-Deutschland
 Überschuldung und Privatinsolvenzen wegen der Kosten für und durch Krankheiten, da kann es sich eigentlich nur um die USA handeln. Richtig, aber wenn man der neuesten Überschuldungsstatistik des Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2015 glaubt, gibt es dies auch hierzulande.
Überschuldung und Privatinsolvenzen wegen der Kosten für und durch Krankheiten, da kann es sich eigentlich nur um die USA handeln. Richtig, aber wenn man der neuesten Überschuldungsstatistik des Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2015 glaubt, gibt es dies auch hierzulande.
Diese Statistik stützt sich auf Angaben von 410 der rund 1.400 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland und damit auf anonymisierten Daten von etwa 103.000 beratenen Personen.
Die wichtigsten Ergebnisse:
• Bei 13,5% aller Ratsuchenden waren 2015 Krankheit, Sucht oder Unfallfolgen Auslöser der finanziellen Probleme. Die Schulden betrugen im Schnitt 25.181 Euro.
• Auch wenn die Statistiker nicht sagen können wie viele dieser Schuldner wegen ihrer Erkrankung arbeitslos wurden, verschärft sich das Schuldenproblem mit Arbeitslosigkeit noch einmal deutlich. Besonders häufig treten mit 16,6 % der Fälle mit gesundheitlichen Gründen der Überschuldung bei Arbeitslosen auf, deren Schuldenlast dann 23.389 Euro betrug. Für erwerbstätige Personen waren hingegen nur in 7,6 % der Fälle gesundheitliche Probleme die Hauptschuldenursache. Die Schuldenlast betrug bei ihnen dann 32.089 Euro.
• Über die konkreten Ursachen dieser Schuldenlasten gibt die Statistik keine Auskünfte. Zu vermuten ist aber, dass die Mehrheit der verschuldeten Ratsuchenden Mitglied eines gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherungsträger ist. Zusätzliche qualitative Studien mit befragungsbereiten NutzerInnen der Schuldenberatungsstellen könnten aber relativ unaufwändig genauere Einblicke verschaffen.
Geht man davon aus, dass wahrscheinlich nur ein Teil der überschuldeten Personen Hilfe bei einer der Beratungsstellen sucht, könnte der tatsächliche Umfang der wegen Krankheit verschuldeten Personengruppe noch wesentlich größer sein.
Die Pressemitteilung Nr. 184 vom 02.06.2016: Gesundheitliche Probleme häufig Auslöser für Überschuldung des Statistischen Bundesamt ist kostenlos erhältlich. Weitere Informationen zur Überschuldungsstatistik finden sich in der Ausgabe 2/2016 der Zeitschrift Wirtschaft und Statistik. Weitere Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2015 werden am 1. Juli 2016 im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht werden.
Bernard Braun, 12.6.16
"1,445.670.570 Milliarden Euro" - So teuer kommt die GKV-Versicherten die elektronische Versichertenkarte bis zum 19.6.2016-11.47
 Gäbe es im Guinessbuch der Rekorde den Rekord für den trotz klarer gesetzlicher Grundlage, der Existenz einer von allen Beteiligten besetzten und permanent tagenden Institution (gematik), der zahllosen Appelle und Versprechen aller Beteiligten, der Androhung von Versorgungsnachteilen für Versicherte im Falle ihrer Weigerung eine neue Versichertenkarte ohne Zusatzwert zu akzeptieren und trotz der genannten Finanzmittel, bisher am längsten laufenden (Start im Jahr 2004) und bisher erfolglosen Versuch den Sinn und Nutzen des Produkts, dessen Datensicherheit empirisch solide nachzuweisen und zu einem Abschluss zu kommen, so stünde er der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) bzw. ihren Protagonisten zu.
Gäbe es im Guinessbuch der Rekorde den Rekord für den trotz klarer gesetzlicher Grundlage, der Existenz einer von allen Beteiligten besetzten und permanent tagenden Institution (gematik), der zahllosen Appelle und Versprechen aller Beteiligten, der Androhung von Versorgungsnachteilen für Versicherte im Falle ihrer Weigerung eine neue Versichertenkarte ohne Zusatzwert zu akzeptieren und trotz der genannten Finanzmittel, bisher am längsten laufenden (Start im Jahr 2004) und bisher erfolglosen Versuch den Sinn und Nutzen des Produkts, dessen Datensicherheit empirisch solide nachzuweisen und zu einem Abschluss zu kommen, so stünde er der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) bzw. ihren Protagonisten zu.
Wer mehr über die Finanzierung, das bisherige Verfehlen fundamentaler Ziele und den "Fahrplan" der Akteure für die nähere Zukunft ("Einführung der ersten Online-Services: vorauss. 2017") erfahren will, erhält diese Informationen nun auf einer Seite des Innungskrankenkassen e.V. in übersichtlicher Art und Weise.
Dort erfährt er im Bereich "GKV-Welt in Zahlen: eGK" u.a. dass jede Kartengeneration im Schnitt 5 Jahre technisch gültig ist und dann ausgetauscht werden muss und dass die letzte bekannte Kosten-Nutzen-Analyse für die eGK aus dem Jahr 2006 stammt. Trotzdem werden die Protagonisten der Karte nicht müde, mantrahaft ihre Sicherheit und ihren finanziellen Nutzen zu behaupten. Wie unredlich manche dieser Versprechen sind, zeigt sich z.B. daran, dass mittlerweile das Jahr 2015 in den USA zum Jahr der millionenfach gehackten Gesundheitsdaten in ebenfalls "sicheren" Krankenversicherungsunternehmen erklärt wird und eine Reihe von Krankenhäusern und mindestens eine gesetzliche Krankenkasse wegen Trojaner- und anderen Attacken ihrer elektronischen Datenbestände bis zu mehreren Tagen unsicher oder handlungsunfähig waren.
Wohl um den "Guinessbucheintrag" zu vermeiden, droht die Bundesregierung mit einer Bestimmung des so genannten E-Health-Gesetzes dem GKV-Spitzenverband und den Kassen(zahn)ärztlichen Bundesvereinigungen für den Fall der Nichteinhaltung festgelegter Fristen mit dem Einfrieren ihrer Haushalte auf der Höhe des Betrages von 2014 minus 1 Prozent - egal wie groß die Einflussmöglichkeiten dieser Körperschaften auf die Entwicklung funktionsfähiger zertifizierten Konnektoren und Lesegeräte durch die Industrie sein mögen.
Auf die Frage der LINKEN-Bundestagsabgeordneten Kathrin Vogler, ob damit die am wenigsten für die derzeitige Situation verantwortlichen GKV-Versicherten und niedergelassenen Ärzte getroffen würden, antwortete die Bundesregierung am 9. Mai 2016 lapidar und irgendwie weltfremd: "Belastungen für die Versicherten oder die einzelnen Krankenkassen sind damit nicht verbunden" und auch von den Kürzungen für die KBV/KZBV sei "insoweit die Gemeinschaft der Versicherten nicht betroffen."
Auf eine beachtlich ehrliche Spitze treibt die parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums für Gesundheit, Annette Widmann-Mauz, aber ihren Versuch von dem nahezu nutzlos ausgegebenen Milliardenbetrag (es gibt in der Tat einige wenige durch die eGK angestoßene nutzvolle Produkte) abzulenken mit folgenden Argumenten: "Die tatsächlich bislang entstandenen Kosten können deshalb in weiten Teilen nicht konkret beziffert bzw. abgegrenzt werden. … Andererseits können auch Nutzeffekte, wie z.B. Einsparungen, durch bessere Kommunikationsstandards oder bessere Verfügbarkeit medizinischer Informationen, wie z.B. zur aktuellen Arzneimitteltherapie des Patienten, kaum konkret in ihrem finanziellen Nutzen berechnet werden."
Die Antwort des BMG auf die Frage der MdB Vogler ist hier erhältlich.
Die eGK-Website des IKK e.V. ist frei zugänglich und wird ständig aktualisiert.
Apropos aktuell: Die auf einer Schätzung des Schätzerkreises der GKV (unter Beteiligung von GKV) beruhenden nahezu nutzlosen Ausgaben aus Beitragsgeldern der GKV-Versicherten haben sich während des knapp einstündigen Schreibens dieses Beitrags laut der permanent laufenden "Ausgabenuhr" auf 1.445.692.780 Milliarden Euro erhöht.
Bernard Braun, 19.5.16
Der Datenfriedhof ist mittlerweile ganz schön lebendig oder Routinedaten in der Gesundheitsforschung
 Seitdem in den 1970er Jahren personenbezogene Daten zur Soziodemografie, ausgewählten Charakteristika der gesundheitlichen Lage und der gesundheitlichen Versorgung wie Behandlung für die rund 90% der Bevölkerung, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert waren und sind, in elektronischer Form gespeichert werden, gab es Bemühungen, diesen Datenschatz nicht nur als Datenablage und für Abrechnungszwecke zu nutzen.
Seitdem in den 1970er Jahren personenbezogene Daten zur Soziodemografie, ausgewählten Charakteristika der gesundheitlichen Lage und der gesundheitlichen Versorgung wie Behandlung für die rund 90% der Bevölkerung, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert waren und sind, in elektronischer Form gespeichert werden, gab es Bemühungen, diesen Datenschatz nicht nur als Datenablage und für Abrechnungszwecke zu nutzen.
Welche Möglichkeiten und Aktivitäten es gab und gibt, fasst nun ein rund 130 Seiten umfassendes Gutachten einer Reihe von Routine- oder Sekundärdatenforscher aus Köln und Magdeburg zusammen.
Es enthält u.a.
• eine Beschreibung der Daten der Sozialversicherungsträger GKV, SPV, GRV und GUV
• die Darstellung der Daten der amtlichen Statistik inklusive der Forschungsdatenzentren und der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (z.B. Krankenhausstatistik, Todesursachenstatistik, Pflegestatistik, Schwerbehindertenstatistik sowie die Daten der Bundesanstalt für Arbeit
• eine Information über den Datenbeistand bei der Privaten Krankenversicherung
• eine kurze Darstellung der Datenbestände, die von einzelnen Akteuren oder Institutionen im Gesundheitswesen erhoben und gepflegt werden und die, sofern es sich um Primärerhebungen handelt, z.T. für Wissenschaftler für eine Sekundärnutzung zur Verfügung stehen (z.B. Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, Daten des DAPI (Deutsches Arzneimittelprüfinstitut), Daten des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus - InEK-Institut, Survey- und Paneldaten, Nationale Kohorte
• Information über die Umsetzung des Datentransparenzparagraphen und den Datenbestand nach §§ 303a-e SGB V und
• Hinweise auf datenschutzrechtliche Regelungen, die Leitlinie Gute Praxis Sekundärdatenanalyse sowie auf ausgewählte Aspekte des Datenmanagements und der Operationalisierung von Fragestellungen.
Das im Auftrag des "Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" erstellte Gutachten: Daten für die Versorgungsforschung. Zugang und Nutzungsmöglichkeiten von Ingrid Schubert et al. ist im Juli bzw. Oktober 2014 erschienen und kostenlos erhältlich.
Zu hoffen ist, dass nicht nur weitere NutzerInnen dieser Daten und Nutznießer der damit erhältlichen Erkenntnisse gewonnen werden, sondern deren Analysen auch dem dazu verfügbaren Stand des Wissens entsprechen.
Bernard Braun, 3.12.14
Altes und Neues über Arbeitsbedingungen von Pflegekräften und Behandlungsqualität am Beispiel von 27 hessischen Akutkrankenhäusern
 Auch der aktuelle Bundesgesundheitsminister verkündete sofort nach Amtsantritt öffentlich, eine bedarfsgerechte Erhöhung der Anzahl der Pflegekräfte und ihrer Vergütung sowie weniger belastende Arbeitsbedingungen (dies steht sogar im Koalitionsvertrag) gehöre zu seinen vorrangigen politischen Zielen. Und auch der zweimalige Expertenanlauf zu einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff scheint scheint nun gesundheitspolitische Früchte zu tragen.
Auch der aktuelle Bundesgesundheitsminister verkündete sofort nach Amtsantritt öffentlich, eine bedarfsgerechte Erhöhung der Anzahl der Pflegekräfte und ihrer Vergütung sowie weniger belastende Arbeitsbedingungen (dies steht sogar im Koalitionsvertrag) gehöre zu seinen vorrangigen politischen Zielen. Und auch der zweimalige Expertenanlauf zu einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff scheint scheint nun gesundheitspolitische Früchte zu tragen.
Gegen eine Fortsetzung des Wettbewerbs um den Titel des größten Ankündigungsministers im Bereich Pflege in schwarz-rot hilft in jedem Fall eine noch intensivere Debatte über den Status quo der Belastung von Arbeitskräften und deren unerwünschten Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensqualität der Beschäftigten sowie der Versorgungsqualität der Patienten bzw. Pflegebedürftigen.
Wodurch und in welchem Maße Pflegekräfte in Krankenhäusern seit geraumer Zeit be- und überlastet werden, welchen Umfang der langjährigen Abbau von Pflegepersonal bei steigenden PatientInnenzahlen erreicht hat und wie sich dies auf die Behandlungsqualität von KrankenhauspatientInnen auswirkt, ist mittlerweile einer Reihe von Studien (z.B. der u.a. von der TU Berlin durchgeführten RN4CAST-Studie, dem "Pflegethermometer", den Analysen Michael Simons von der Evangelischen Hochschule Hannover oder dem Projekt "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System" des WZB und Zentrums für Sozialpolitik - vgl. dazu verschiedene Beiträge im forum-gesundheitspolitik) zu entnehmen.
Die aktuellsten Ergebnisse aus dem Jahr 2012 liefert das im Auftrag des hessischen Sozialministeriums von Gesundheits- und Pflegewissenschaftler der Universität Bremen (Ingrid Darmann-Finck, Agnes Greiner und Bernard Braun) und der Hochschule Fulda (Maren Siepmann, Klaus Stegmüller) erstellte "Gutachten zur Situation der Pflege in hessischen Akutkrankenhäusern" ("Hessenstudie").
Diese Studie bestätigt zum einen, dass die langjährig beschriebenen Veränderungen bzw. Verschlechterungen der Arbeitssituation der Pflegekräfte und deren Auswirkungen auf die Behandlungsqualität und -sicherheit anhalten. Sie kommt zum anderen zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Pflegekräfte allein zwar eine wichtige, aber nicht die einzige Determinante der Arbeits- und Behandlungsqualität ist.
Als Datenbasis dienten eine schriftliche Erhebung einer Fülle von Strukturbedingungen einer repräsentativen Auswahl von 27 hessischen Kliniken über deren Leitungen, eine schriftliche standardisierte Befragung der Pflegekräfte in diesen Krankenhäusern, eine qualitative Untersuchung der Auswirkungen erhöhter Arbeitsbelastung in zwei Krankenhäusern bzw. auf vier Stationen und ein Review der aktuellen Forschungsliteratur zum Thema.
Diese und weitere Analysen zeigen, dass wichtige Aspekte der pflegerischen Arbeits- und Behandlungsqualität in den hessischen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den Kliniken außerhalb Hessens zwar auch aber nicht allein durch die Anzahl der Pflegekräfte beeinflusst werden. Qualitative Arbeitsbedingungen wie z.B. die Kooperation der Pflegekräfte mit Ärzten, der Anteil aufwändiger Patienten und vor allem die Möglichkeit zu "guter Pflege" gehören zu den analytisch wie praktisch gleichzeitig zu berücksichtigenden positiven wie negativen Faktoren. Damit bestätigt sich die bereits in einigen internationalen Studien belegte Notwendigkeit, eine Verbesserung der Behandlungsqualität nur dadurch erreichen zu können, dass parallel die Anzahl der Pflegekräfte erhöht und wichtige Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Das 186 Seiten (inklusive ausführlichem Anhang u.a. mit Fragebögen und Literatur-Review) umfassende "Gutachten zur Situation der Pflege in hessischen Akutkrankenhäusern" von Bernard Braun, Ingrid Darmann-Finck, Agnes Greiner, Klaus Stegmüller und Maren Siepmann ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.1.14
Leben in der "sozialen Hängematte": Kosten-Nutzen-Abwägung für Freizeit oder Mangel an guten Arbeitsplätzen und Gesundheit?
 Manchen Oekonomen oder Arbeitsmarktpolitikern ist keine Spekulation über nutzenmaximierende Individuen zu dünn oder zu dumm, um nicht zum "blaming of the victims" und zur Entlastung von Arbeitgebern und anderen Akteuren genutzt zu werden. Dies galt z.B. auch für die meist älteren Langzeitarbeitslosen, die sich von 1986 bis 2007 mit Hilfe des so genannten "erleichterten Leistungsbezugs" ab dem 58. Lebensjahr vom Arbeitsmarkt "zurückziehen" konnten und damit als produktive Arbeitskräfte und Einzahler höherer Beschäftigten-Beiträge in die Sozialversicherungskassen ausfielen. Sie hatten nach dem Paragraphen 428 SGB III das Recht, bis zur normalen Altersrente Arbeitslosenunterstützung beziehen zu können, ohne nach Arbeit suchen zu müssen.
Manchen Oekonomen oder Arbeitsmarktpolitikern ist keine Spekulation über nutzenmaximierende Individuen zu dünn oder zu dumm, um nicht zum "blaming of the victims" und zur Entlastung von Arbeitgebern und anderen Akteuren genutzt zu werden. Dies galt z.B. auch für die meist älteren Langzeitarbeitslosen, die sich von 1986 bis 2007 mit Hilfe des so genannten "erleichterten Leistungsbezugs" ab dem 58. Lebensjahr vom Arbeitsmarkt "zurückziehen" konnten und damit als produktive Arbeitskräfte und Einzahler höherer Beschäftigten-Beiträge in die Sozialversicherungskassen ausfielen. Sie hatten nach dem Paragraphen 428 SGB III das Recht, bis zur normalen Altersrente Arbeitslosenunterstützung beziehen zu können, ohne nach Arbeit suchen zu müssen.
Vertreter der mikroökonomischen Angebotstheorie sahen die Entscheidung der Mehrheit dieser Gruppe von Arbeitslosen für die Inanspruchnahme der 58er-Regelung als das Ergebnis einer rationalen Kosten-Nutzen-Abwägung zu Gunsten von erträglich finanzierter Freizeit. Den NutzerInnen dieser Regelung wurde im Umkehrschluss pauschal mangelnde Arbeitswilligkeit unterstellt.
Oftmals bewegt sich die Pro- und Contra-Debatte über derartige Annahmen im theoretisch-spekulativen oder moralischen Bereich ohne die Annahmen gründlich zu untersuchen. Dies liegt u.a. daran, dass "normale" Arbeitslose im Prinzip dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen und daher auf Fragen zum Ausstieg aus dem Erwerbsleben sozial erwünschte bzw. opportune Antworten geben. Die Autorin der hier vorgestellten Studie weist zu Recht auf die methodisch vorteilhaftere Forschungssituation bei der von ihr untersuchten Gruppe von Arbeitslosen hin: "Die Untersuchung des Arbeitsmarktverhaltens dieser Gruppe ... verringert dabei ein methodisches Problem: Da arbeitslose Bezieher von Transferleistungen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen, dürften Fragen nach deren Erwerbsneigung, Konzessionsbereitschaft und Suchaktivitäten vielfach zu sozial erwünschten Antworten führen. Solche Verzerrungen sind hingegen bei denjenigen Leistungsbeziehern, denen der Gesetzgeber explizit das Recht eingeräumt hat, sich vom Arbeitsmarkt abzuwenden, in geringerem Maße zu erwarten."
Die Ergebnisse der jetzt veröffentlichten Interview-Befragung von mehr als 1.100 Beziehern des Arbeitslosengelds II und potenziellen NutzerInnen der 58er-Regelung in den Jahren 2005/06 zeigt dann auch, dass die Gründe für derartige Entscheidungen recht wenig mit der von Angebotsökonomen und entsprechend orientierten Politikern für wesentlich gehaltenen Nutzenmaximierung zu tun haben.
So war mangelnde Arbeitswilligkeit nur selten der Grund für den Wechsel in den Vorruhestand:
• Lediglich 13% der westdeutschen und 9% der ostdeutschen Nutzer des erleichterten Leistungsbezugs gaben an, sie wollten nicht mehr arbeiten.
• 25% der west- und 28% der ostdeutschen Befragten, wollten grundsätzlich arbeiten, strebten dabei aber mehr Autonomie an als ihnen z.B. die Jobcenter zubilligen wollten, und lehnten auch unzumutbare Arbeit ab.
• 23% der west-und 36% der ostdeutschen Befragten nannten fehlende Stellen- und Förderangebote als entscheidenden Grund für ihre Entscheidung.
• Und schließlich hinderten gesundheitliche Einschränkungen 39% der Befragten in Westdeutschland und 27% der Ostdeutschen erwerbstätig sein zu können.
Die Empfehlung für künftig vergleichbare Situationen und Entscheidung lautet daher auch: "Für die wirksame Aktivierung und Integration älterer Langzeiterwerbsloser dürfte es daher weniger auf ein strikteres 'Fordern' als vielmehr auf ein besseres 'Fördern' und geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten ankommen."
Die Debatte um die Hintergründe für den hohen, noch wachsenden und wahrscheinlich sozialpolitisch folgenreichen (z.B. Altersarmut insbesondere von früher teilzeitbeschäftigten Frauen) Anteil von Teilzeitbeschäftigten, zeigt freilich, dass mit einer einzigen Untersuchung der Dominanz angebotsorientierter Erklärungen in der Sozialpolitik nicht beizukommen ist. Auch hier behauptet z.B. das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft ungebremst und zum Teil wider besseres Wissen, die Mehrheit der Frauen wolle dies doch.
Zu dem Aufsatz Aeltere Arbeitslose am Scheideweg zwischen Erwerbsleben und Ruhestand Gründe für ihren Rückzug vom Arbeitsmarkt. von Christina Wübbeke - Anfang 2013 erschienen im Journal for Labour Market Research (Vol. 46, No. 1, S. 61-82) gibt es kostenlos ein Abstract.
Eine etwas längere Zusammenfassung der Ergebnisse gibt es kostenlos in Böcklerimpuls 19/2012).
Bernard Braun, 5.4.13
"Sich um das Wesentliche kümmern können": Bürokratieabbau im Gesundheitssystem "Ja", aber wo, wie viel und was?
 Im deutschen Gesundheitssystem nimmt in den letzten Jahren nicht nur z.B. der Umfang des gesamten Fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) und einzelner Paragraphen scheinbar unaufhaltsam zu, sondern als Folge und Lösungsversuch dieser für normale Versicherte wachsenden Unübersichtlichkeit auch die Anzahl gedruckter und digitalisierter Navigatoren, Case-, Care-, Versorgungs-, Beratungs- oder Entlassungsmanager und Anzahl wie Umfang der Dokumentationspflichten für Leistungserbringer.
Im deutschen Gesundheitssystem nimmt in den letzten Jahren nicht nur z.B. der Umfang des gesamten Fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) und einzelner Paragraphen scheinbar unaufhaltsam zu, sondern als Folge und Lösungsversuch dieser für normale Versicherte wachsenden Unübersichtlichkeit auch die Anzahl gedruckter und digitalisierter Navigatoren, Case-, Care-, Versorgungs-, Beratungs- oder Entlassungsmanager und Anzahl wie Umfang der Dokumentationspflichten für Leistungserbringer.
Vor allem niedergelassene und stationär tätige Ärzte, Krankenschwestern oder Angehörige ambulanter Pflegedienste klagen seit geraumer Zeit über den tatsächlich oder vermeintlich ständig steigenden Anteil von patienten- oder behandlungsfernen administrativen Tätigkeiten.
Wie viel genau an Zeit und Geld von Leistungserbringern und Versicherten oder Patienten aufgebracht werden muss, um bestimmte Leistungen zu erhalten, stützte sich bisher vor allem auf diese Klagen oder war rein spekulativ.
Der im Auftrag der Bundesregierung vom Normenkontrollrat erstellte und am 20. März 2013 veröffentlichte Bericht "Erfüllungsaufwand im Bereich Pflege - Antragsverfahren auf gesetzliche Leistungen für Menschen, die pflegebedürftig oder chronisch krank sind", stellt für einige Leistungen erstmals Transparenz her oder verbessert sie. Der Bericht liefert z.B. Antworten auf Fragen wie Wie viel Zeit und Kosten beansprucht die Dokumentation der Pflege? Wie viele Anträge auf Leistungen der häuslichen Krankenpflege werden jährlich gestellt? Welche Kosten werden durch die Antragsverfahren verursacht? Welche Zeit müssen Versicherte für den Erhalt dieser Leistungen aufbringen?
Die wichtigsten Erkenntnisse in Kürze:
• Der so genannte Erfüllungsaufwand liegt für die AntragstellerInnen von 10 Rehabilitations-, Hilfsmittel- und Pflegeleistungen zwischen drei Minuten für Anträge zu Leistungen der medizinischen Rehabilitation und 435 Minuten für Anträge für die Hilfe zur Pflege. Für einen Antrag zur Befreiung von Zuzahlungen benötigt allein der GKV-Versicherte rund 53 Minuten.
• Die Antragsverfahren für diese 10 Leistungen kosten die Krankenkassen, andere Sozialleistungsträger und die Wirtschaftsbetriebe jährlich rund 449 Millionen Euro.
• Die Dokumentation ambulanter und stationärer Pflege kostet die entsprechenden Wirtschaftsbetriebe jährlich rund 2,7 Mrd. Euro. Mehr als zwei Drittel dieser Kosten entfallen dabei auf das Ausfüllen von Leistungsnachweisen z.B. für jeden besuchten Pflegebedürftigen und jede einzeln erbrachte Leistung. Die Feststellungen von Pflegestufen verursachen 110 Mio. Euro. Die Kosten für die Antragsverfahren im Bereich der häuslichen Krankenpflege betragen 54 Mio. Euro.
• Alleine das Ausfüllen der Leistungsnachweise als Kernstück der Pflegedokumentation kostet jährlich rund 1,9 Mrd. Euro und wird jährlich rund 408 Mio. mal durchgeführt.
• Das bei jeder Neuaufnahme einer pflegebedürftigen Person notwendige Einrichten der Pflegedokumentation verursacht in den Pflegeeinrichtungen einmalig zwischen 158 Minuten in der Tagespflege und 386 Minuten in stationären Pflegeeinrichtungen. In jedem zweiten Fall entsteht zusätzlich ein Aufwand von 17 Minuten (entspricht rund 1,5 Millionen Euro) für Ärzte, die Informationen zwecks Erstellung der Pflegedokumentation an die Pflegeeinrichtung weitergeben. Daneben müssen Bürgerinnen und Bürger, zumeist deren Angehörige, im Mittel eine Stunde für die Zulieferung von notwendigen Informationen aufbringen.
• Der Gesamtaufwand für die Bearbeitung eines Antrags auf Feststellung der Pflegestufe durch eine gesetzliche Pflegekasse beträgt rund 66 Minuten.
• Wenn die Begutachtung eines Pflegeantrags beim MDK durch internes Personal erfolgt, fallen im Mittel neben den rund 30 Minuten MDK-Sachbearbeitung noch 77,5 Minuten für die Gutachterin bzw. den Gutachter für die Begutachtung an.
• Legt ein Versicherter Widerspruch gegen einen Pflegebescheid ein, braucht er für die Erstellung insgesamt 170 Minuten, d.h. mehr Zeit als für die erstmalige Antragstellung. Und auch der Zeitaufwand für den Umgang mit einem Widerspruch liegt mit rund 102 Minuten pro Fall über dem Aufwand für die Erstantragsstellung.
Der Bericht enthält bereits eine Mischung von neuen oder meist jahrzehntealten Verbesserungsvorschlägen für die verständliche Gestaltung von Antragsformularen (dies steht z.B. bereits im § 17 Abs. 1 Satz 3 des Ersten Buch des SGB aus dem Jahr 1975), den kostenfreien Zugang zu Beratungsstellen der Sozialversicherungsträger (bisher noch oft teure 0180er Nummern) oder die Entfristung von Pflegestufen-Einstufungen.
Ob es zu der erhofften Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung kommt oder trotz Bürokratieabbau-Rhetorik lediglich zum Umfüllen des alten Weines in neue Schläuche, wird abzuwarten sein. Allein die Lektüre der für mögliche weitere Vereinfachungen zuständigen und zu moderierenden institutionellen Akteure lässt zumindest die Hoffnung auf schnelle Lösungen schrumpfen. Auf "Vorschlag der Krankenkassen" soll eine "gemeinsame Arbeitsgruppe", der "Beteiligte, BMG/BMAS, Statistisches Bundesamt, OBF" (Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der Pflege) angehören, diese weiteren Arbeiten unter Leitung des Statistischen Bundesamtes als "neutralem Moderator" übernehmen. Einige dieser Akteure tragen seit Jahrzehnten durch ihr Verhalten eher zum Vertrauensschwund zwischen den Hauptakteuren im Gesundheitswesen, dem Grund-Misstrauen gegen Versicherte und Patienten, zur Zunahme des Verwaltungsaufwandes, der Notwendigkeit aufwändiger Beratung und der organisierten Nichtverständigung auf gemeinsam verpflichtende Lösungen bei.
Aufpassen sollten aber alle Interessierten vor allem darauf, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten und z.B. bei anhaltender normativer und regulatorischer Unübersichtlichkeit oder Undurchsichtigkeit das Zusammenstreichen von Beratungsaufwand oder Weiterbildungsangeboten für Sachbearbeiter als Verwaltungsvereinfachung zu verkaufen.
Der Originalbericht Erfüllungsaufwand im Bereich…Pflege. Antragsverfahren auf gesetzliche Leistungen für Menschen, die pflegebedürftig oder chronisch krank sind aus der "Projektreihe Bestimmung des bürokratischen Aufwands und Ansätze zur Entlastung" von 239 Seiten wird von der Bundesregierung und dem Statistischem Bundesamt gemeinsam herausgegeben und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.13
Sinkende Ausgaben = "hoher Stellenwert" der Prävention für die GKV!? Wenn nicht jetzt, wann denn dann "mehr Prävention"?
 Es kann nicht am Geldmangel der GKV liegen und auch nicht an mangelnden Er- und Bekenntnissen über und zur Notwendigkeit und zum Nutzen der Prävention, dass die Ausgaben der GKV für Prävention im Jahr 2011 spürbar geringer waren als im Jahr 2010 - und damit einen Trend der Vorjahre fortsetzten.
Es kann nicht am Geldmangel der GKV liegen und auch nicht an mangelnden Er- und Bekenntnissen über und zur Notwendigkeit und zum Nutzen der Prävention, dass die Ausgaben der GKV für Prävention im Jahr 2011 spürbar geringer waren als im Jahr 2010 - und damit einen Trend der Vorjahre fortsetzten.
Schon anlässlich der Veröffentlichung des Präventionsberichts 2011 des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) zeigte sich nämlich, dass die Pro-Kopfausgaben der GKV für Prävention von 4,83 Euro im Jahr 2008 auf 4,33 Euro im Jahr 2011 gesunken waren (vgl. dazu den Forumsbeitrag GKV-Präventionsbericht 2011: Nimmt man ein Glas, das klein genug ist, kann man davon reden es sei halb voll...). Der entsprechende Betrag betrug 2011 nur noch 3,87 Euro. Die Gesamtausgaben für Prävention sind damit von 339,8 Millionen Euro im Jahr 2008 auf 270 Millionen Euro im Jahr 2011 gefallen.
Auch wenn Prävention nicht ausschließlich auf ihre Ausgaben reduziert werden sollte, verstärkt sich mit dem kontinuierlichen Schrumpfen der Ausgaben für Prävention im Millionenbereich die Diskrepanz zum kontinuierlichen Wachstum der kurativen Ausgaben im Milliardenbereich, zur vollmundigen Krisenrhetorik über die Bedrohungen der Folgen der demografischen Alterung (Stichwort: "demografische Katastrophe"), die wenigstens zum Teil durch Prävention vermieden werden könne und schließlich auch zu den Absichten der unendlichen Geschichte einer "Nationalen Präventionsstrategie".
Daran ändert leider auch der Versuch nichts, dem Zustand im Jahr 2011 etwas Gutes abzugewinnen: "Damit wurde der gesetzlich vorgesehene Orientierungs-/Ausgabenrichtwert für das Jahr 2011 von 2,86 Euro je Versicherten um 35% übertroffen. Dies zeigt, dass die Krankenkassen der Prävention und Gesundheitsförderung einen hohen Stellenwert beimessen."
Der Präventionsbericht 2012 enthält auch wieder ausführliche und zum Teil auch erfreuliche Übersichten zur Anzahl der mit Präventionsaktivitäten erreichten Personen und die Art der Präventionsmaßnahmen.
So wurden 2011 u.a.
• insgesamt 4,9 Millionen Personen erreicht,
• die GKV-Kassen beteiligten sich in 22.000 Settings mit Gesundheitsförderungsaktivitäten und erreichten damit direkt 2,4 Mio. Menschen.
• 44% der Setting-Maßnahmen fanden in Kindertagesstätten und 18% in Grundschulen statt. In diesen Settings erreichen die Präventionsangebote Kinder aller sozialen Schichten. Die krankenkassengeförderte Gesundheitsförderung und Prävention erfasste 43% aller Kitas in Deutschland. Insgesamt lagen 25% aller Settings in "sozialen Brennpunkten", also Stadtteilen oder Kommunen, in denen Bewohner stark von Einkommensarmut, Integrationsproblemen und Arbeitslosigkeit betroffen sind."
• "Die Maßnahmen (der betrieblichen Gesundheitsförderung) erreichten 6.800 Betriebe, was einer Steigerung um 5% entspricht. Die Zahl der in der betrieblichen Gesundheitsförderung erreichten Beschäftigten steigerte sich um 19% auf 800.000."
• Die Zahl der eingerichteten Gesundheitszirkel hat "um gut ein Drittel zugenommen. Mittlerweile kommen bei 25% der Projekte Gesundheitszirkel zur Anwendung."
• "Als Inhalte der Gesundheitsförderung standen die Reduktion körperlicher Belastungen mit 76%, das Stressmanagement mit 47% und die gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung mit 35% im Vordergrund. Bei den beiden letztgenannten war eine Zunahme zu verzeichnen."
• Seit 2008 hat sich die "Zahl der drei- bis sechsjährigen Kinder, die über Interventionen erreicht wurden, welche sowohl an den Verhältnissen im Setting als auch am Verhalten der Menschen ansetzten und mehrere Themen gleichzeitig bearbeiteten, verdreifacht. In der betrieblichen Gesundheitsförderung stieg z. B. die Zahl der Präventionsmaßnahmen zu Stressbewältigung/Stressmanagement um 100%."
Den 128 Seiten umfassenden Präventionsbericht 2012. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung. Berichtsjahr 2011 der MDS-Autoren Nadine Schempp, Caroline Jung, Jan Seidel und Harald Strippel gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 11.1.13
"Generation Zahnspange": Wie notwendig, nützlich oder belastend ist die kieferorthopädische Behandlung aus Betroffenensicht?!
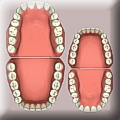 Über bestimmte gesundheitliche Probleme und Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung gibt es seit Jahren oder Jahrzehnten eine kontinuierliche, facettenreiche und oft kontroverse Berichterstattung und öffentliche Debatten. Einige Probleme und Leistungen führen dagegen ein ausgesprochenes Mauerblümchendasein -trotz oder auch wegen ihres durchaus vorhandenen gesundheits- und versorgungspolitischen Sprengstoffs.
Über bestimmte gesundheitliche Probleme und Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung gibt es seit Jahren oder Jahrzehnten eine kontinuierliche, facettenreiche und oft kontroverse Berichterstattung und öffentliche Debatten. Einige Probleme und Leistungen führen dagegen ein ausgesprochenes Mauerblümchendasein -trotz oder auch wegen ihres durchaus vorhandenen gesundheits- und versorgungspolitischen Sprengstoffs.
Obwohl fast alle BürgerInnen im Laufe ihres Lebens mehr oder weniger oft zahnmedizinisch behandelt werden, obwohl die Privatisierung der Finanzierung der zum Teil recht teuren Ersatzleistungen im Bereich der Zahn- und Kieferversorgung am weitesten fortgeschritten ist und nur noch Bruchteile der Gesamtkosten Kassenleistung sind und obwohl für viele in diesem Bereich angebotenen Leistungen ein Nutzennachweis fehlt oder der fehlende Nutzen bekannt ist, gehören die zahnmedizinische und gleich gar die kieferorthopädische Versorgung zu den am geringsten erforschten und debattierten Leistungsbereichen im deutschen Gesundheitswesen.
Einen Teilbereich, den der kieferorthopädischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen, macht nun eine 2012 veröffentlichte Studie der Bremer gesetzlichen Krankenkasse "hkk" etwas transparenter.
Im Jahr 2011 hat die hkk 1.309 hkk-Versicherte im Kindes- und Jugendlichenalter bzw. ihre Eltern angeschrieben, die ihre kieferorthopädische (kurz "KfO") Behandlung im Jahr 2010 abgeschlossen hatten, und um die Beantwortung einiger Fragen zu ihrer Behandlung gebeten. Repräsentative 435 der Angeschriebenen mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren beantworteten diesen Fragebogen, den der Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen und das "Bremer Institut für Arbeits- und Gesundheitsforschung (BIAG)" auf der Basis der wenigen dazu bereits durchgeführten Forschungsstudien entwickelten und auswerteten.
Zu den wesentlichen Ergebnissen des kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellten Berichts "Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen" gehören:
• 42,8 Prozent der von der hkk Befragten gaben an, sie hätten vor Behandlungsbeginn keine Beschwerden gehabt; 30,1 Prozent wollten "einfach besser aussehen". Diese Angaben weisen auf einen möglichen Konflikt mit der Vorgabe des Gesetzgebers hin, laut der die Krankenkassen eine kieferorthopädische Behandlung nur dann übernehmen dürfen, wenn eine gesundheitliche Notwendigkeit vorliegt. In einem ebenfalls für die Studie durchgeführten Interview mit Knut Thedens, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und KfO-Referent der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) Bremen, hebt dieser aber hervor, dass die Behandlungen häufig eine präventive Therapie zur Vermeidung späterer Funktionsstörungen darstellen. "Die Ästhetik ist lediglich ein Nebenprodukt dessen, was wir tun", so Thedens.
• 44 Prozent der Befragungsteilnehmer waren mit ihrer Behandlung insgesamt sehr zufrieden, weitere 42 Prozent immerhin zufrieden. Die wichtigsten Schlüsselfaktoren für die Zufriedenheit waren ein vertrauensvolles Verhältnis zum behandelnden Arzt, die Verbesserung des Aussehens und eine problemlose und schmerzfreie Behandlung.
• Zur Zufriedenheit mit der Behandlung kommen positive und möglicherweise dauerhafte Auswirkungen auf das gesundheitsrelevante Verhalten der jungen Patienten hinzu: 44,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen gaben an, ihre regelmäßige Zahnpflege im Lauf der Behandlung verbessert zu haben. Zwischen 21,6 und 22,7 Prozent sagten aus, sie hätten zahnschädigendes Verhalten (z.B. das Öffnen von Kronenkorkenverschlüssen mit den Zähnen) reduziert und stärker auf regelmäßige Zahnarztbesuche oder regelmäßige professionelle Zahnreinigung geachtet. Verschlechterungen in diesen Bereichen wurden so gut wie nicht berichtet.
• Auch mit den Beratungsleistungen erklärten sich die meisten Betroffenen - in diesem Fall die Eltern der hkk-versicherten Kinder und Jugendlichen - überwiegend zufrieden. Allerdings bestehen dabei erhebliche Unterschiede: Über den Nutzen und die Ziele der Behandlung fühlten sich 84,8 Prozent gut oder sehr gut informiert. Bezüglich der Auswahl des behandelnden Kieferorthopäden oder Zahnarztes meinten dies jedoch nur 57,9 Prozent. Anders als bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern und Fachärzten sind generell Bewertungen von KfO-Praxen kaum verfügbar und auch Krankenkassen nehmen keine eigenen Empfehlungen bestimmter Anbieter vor. Das zweitschlechteste Ergebnis entfiel auf die Beratung über die Kosten der Behandlung: Diese bezeichneten nur 61,8 Prozent als sehr gut oder gut.
• Dies ist umso verwunderlicher, weil private Zuzahlungen eine erhebliche finanzielle Belastung für die betroffenen Familien darstellen. Knapp drei Viertel der Befragten, also im Vergleich zu anderen Behandlungsbereichen einem extrem hohen Anteil, wurde mit verschiedenen Argumenten privat zu zahlende Zusatzleistungen angeboten und von ihnen auch meist in Anspruch genommen. 50 Prozent der Eltern gaben an, hierfür bis zu 500 Euro bezahlt zu haben. 32 Prozent leisteten Zuzahlungen von 500 bis 1.000 Euro, 15 Prozent von 1.000 bis 2.000 Euro. Drei Prozent erbrachten sogar noch höhere private Aufschläge. Die Ausgaben entfielen vor allem auf flexible Drähte und Bögen (35,6 Prozent), spezielle Zahnreinigung (33,8 Prozent), Fluoridierung und zusätzliche Diagnostik (24,4 bzw. 23 Prozent). Für diese Zusatzleistungen versprachen die Ärzte 34 Prozent der Befragten einen besseren Behandlungserfolg. 10,8 Prozent wurde eine attraktivere Optik während der Behandlung in Aussicht gestellt, weiteren 10,3 Prozent eine kürzere Behandlungsdauer.
Angesichts der bisher nur dürftig nachgewiesenen Langzeitwirkungen von kieferorthopädischen Interventionen im Kindes- und Jugendalter auf die Erwachsenen-Zahn-/Kiefergesundheit und des Mangels an Nutzennachweisen der oft teuren Zusatzleistungen sollten nach Meinung der Wissenschaftler und des interviewten Kieferorthopäden kontrollierte Langzeitstudien durchgeführt werden. Außerdem sollte es auch für diese Art von Leistungen eine unabhängige Patienteninformation geben. Die hkk beabsichtigt dazu bis 2013 ein Angebot zu entwickeln.
Weitere Einzelheiten über die kieferorthopädische Versorgung von Kindern und Jugendlichen (z.B. Anteil an Gesamtausgaben der GKV im Zeitverlauf, Rechtsgrundlagen und die Versorgung in anderen Ländern) finden sich in dem 22 Seiten umfassenden hkk-Bericht "Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen", der komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 13.10.12
Sind gesetzliche Krankenkassen Unternehmen oder trotz "Wettbewerb" immer noch Körperschaften öffentlichen Rechts? Zwischenstand
 Nach der am 25. Januar 2010 stattgefundenen öffentlichen Ankündigung der Vorstandsvorsitzenden von acht gesetzlichen Krankenkassen, man wolle der Ehrlichkeit halber gemeinsam Zusatzbeiträge einführen, strömten viele ihrer Versicherten in andere Kassen. Herein kam am 17. Februar 2010 ein so genannter Auskunftsbeschluss der Wettbewerbshüter des Bundeskartellamts, die in der Presse-Show abgestimmtes Verhalten von im Wettbewerb stehenden Krankenkassenunternehmen witterten und daher weitere Einzelheiten zum Hintergrund wissen wollten. Wenn der Wettbewerb zwischen Wirtschaftsunternehmen bedroht ist, ist in der Bundesrepublik das Bundeskartellamt mit dem entsprechenden Kartellrecht zuständig.
Nach der am 25. Januar 2010 stattgefundenen öffentlichen Ankündigung der Vorstandsvorsitzenden von acht gesetzlichen Krankenkassen, man wolle der Ehrlichkeit halber gemeinsam Zusatzbeiträge einführen, strömten viele ihrer Versicherten in andere Kassen. Herein kam am 17. Februar 2010 ein so genannter Auskunftsbeschluss der Wettbewerbshüter des Bundeskartellamts, die in der Presse-Show abgestimmtes Verhalten von im Wettbewerb stehenden Krankenkassenunternehmen witterten und daher weitere Einzelheiten zum Hintergrund wissen wollten. Wenn der Wettbewerb zwischen Wirtschaftsunternehmen bedroht ist, ist in der Bundesrepublik das Bundeskartellamt mit dem entsprechenden Kartellrecht zuständig.
Dieselben Vorstandsvorsitzenden, die bei anderen Gelegenheiten gerne das "Kassen-Image" loswerden und als "Unternehmen" auftreten wollen und dafür viel Geld in unternehmerische Alleinstellungsmerkmale investieren, fanden diese Anfrage nicht rechtens. Darin wurden sie durch eine Pressemitteilung des nach dem Gesetz auch für viele Angelegenheiten der GKV-Kassen zuständigen Bundesversicherungsamtes vom 8. März 2010 bestärkt. Darin erklärte das Bundesversicherungsamt, dass es die Bedenken des Bundeskartellamtes nicht teile. Die vom Bundeskartellamt unterstellte Unternehmenseigenschaft von Krankenkassen sei zu verneinen. Am 19. März 2010 ging schließlich die Klage einer der angeschriebenen Krankenkassen gegen das Auskunftsbegehren beim Hessischen Landessozialgericht ein.
Und dieses hat nun am 15. September 2011 einen Beschluss gefasst, der zwei grundsätzliche Punkte hervorhob: Erstens wäre "dem Bundesversicherungsamt für bundesunmittelbare Versicherungsträger eine umfassende und ausschließliche Rechtsaufsicht zugewiesen", was bedeutet, dass "für eine parallele Zuständigkeit der Kartellaufsicht durch das Bundeskartellamt über Krankenkassen kein Raum (besteht)." Und: "Krankenkassen handeln im 'Wettbewerb' um beitragszahlende Mitglieder nicht als Unternehmen im Sinne des Art. 101 AEUV oder §§ 1, 130 GWB."
Dieser Tenor wird durch eine Reihe lesenswerter normativer Feststellungen untermauert:
• So sei "das Handeln im Wettbewerb der Krankenkassen untereinander um beitragszahlende Mitglieder auch unter Berücksichtigung der Novellierungen des SGB V seit 2004 keine wirtschaftliche Tätigkeit."
• "Krankenkassen sind nach wie vor gesetzlich verpflichtet, ihren Mitgliedern im Wesentlichen gleiche Pflichtleistungen anzubieten, die unabhängig von der Beitragshöhe sind. Sie haben außerhalb der geringfügigen Bandbreite der Wahltarife keine Möglichkeit, auf diese Leistungen Einfluss zu nehmen. Sie sind auch nach der Gesundheitsreform 2007 zu einer kassenübergreifenden Solidargemeinschaft zusammengeschlossen, die es ihnen ermöglicht, untereinander einen Kosten- und Risikoausgleich vorzunehmen. … Bei der Einführung des Gesundheitsfonds handelt es sich um eine Schwächung des Selbstverwaltungsgedankens, nicht aber um eine Verantwortungsverlagerung, die den Solidarcharakter des Krankenkassenhandelns beseitigen könnte."
• "Der Spielraum, über den die Krankenkassen verfügen, um ihre Wahltarife festzulegen und untereinander einen gewissen Wettbewerb um Mitglieder auszulösen, führt nicht zu einer anderen Bewertung. So ist die Einführung der Wahltarife nach § 53 SGB V im Zusammenhang mit der Abschaffung unterschiedlicher Beitragssätze in der GKV durch das GKV-WSG zu sehen, die ab 2009 zu einem bundeseinheitlichen Beitragssatz für alle Krankenkassen geführt hat und kassenindividuell nur noch die Erhebung eines Zusatzbeitrags in Höhe von maximal 1 v.H. der Bemessungsgrundlage zulässt. … Dem damit einhergehenden Abbau von Gestaltungsräumen der Krankenkassen hat der Gesetzgeber zur Effizienzsteigerung neue Versorgungsformen und Wahltarife flankierend an die Seite gestellt, um auch weiterhin im Rahmen eines eingeschränkten Wettbewerbs das Funktionieren des Gesamtsystems so effizient und kostengünstig wie möglich zu gestalten."
• "Der (Europäische) Gerichtshof erkennt damit an, dass der Gesetzgeber den Trägern sozialer Sicherheit ökonomische Instrumente in die Hand geben kann, um im Rahmen eines "best practice" zu einer bestmöglichen Allokation öffentlicher Mittel zu gelangen, ohne dass dies als wirtschaftliche Tätigkeit gewertet werden muss. … Der "Krankenkassenwettbewerb" dient ausweislich der Begründung des Entwurfs des GKV-WSG der Qualitäts- und Effizienzsteigerung bei der Aufgabenerfüllung …; im Übrigen zielt "Wettbewerbsstärkung" nach den Materialien im Wesentlichen auf die Stärkung des Wettbewerbs der Leistungserbringer untereinander und auf das - hier nicht einschlägige - Verhältnis der Krankenkassen untereinander als Nachfrager. Die Nutzung des Wettbewerbs zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung der Tätigkeit der Träger eines Systems der sozialen Sicherheit wahrt am o.g. Maßstab gerade die Zielsetzung sozialer Art und ist keine wirtschaftliche Tätigkeit außerhalb der Aufgaben rein sozialer Art."
Ob nicht doch eine Reihe weiterer Aktivitäten der GKV-Kassen nicht nur unternehmerisch daherkommt, sondern dem Handeln eines Wirtschaftsunternehmens entspricht, wollte das LSG Hessen wohl nicht selber materiell entscheiden. Die Richter überließen dies "wegen grundsätzlicher Bedeutung" dem Bundessozialgericht. Das Revisionsverfahren vor diesem Gericht war daher zuzulassen.
Auf die Gefahr, dass die GKV-Kassen durch die "Verdünnung des Solidargedankens" z.B. durch Beitragsrückerstattungen oder die immer wieder angedachte einkommensunabhängigen Gesundheitsprämie europarechtlich immer mehr zu Wirtschaftsunternehmen mutierten und dann auch so behandelt werden, wiesen bereits vor einiger Zeit Juristen und Gesundheitswissenschaftler prophylaktisch hin.
Das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 15.9.2011 (Aktenzeichen: L 1 KR 89/10 KL) ist in ganzer Länge kostenlos zugänglich und auch für Nichtjuristen interessant. Auf das BSG-Urteil darf man gespannt sein.
Bernard Braun, 23.11.11
Lasst die "Sau am besten im Stall"! Verbessert Kostenerstattung die Transparenz und steuert die Inanspruchnahme von Leistungen?
 Auch wenn die Ablösung des Sachleistungs- durch das Kostenerstattungsprinzip im Moment nicht im Mittelpunkt der gesundheitspolitischen Reformbemühungen steht, handelt es sich bei Kostenerstattung um eine der "Säue", die je nach Bedarf mit viel Getöse durch das "gesundheitspolitische Dorf getrieben wird". Es lohnt sich daher quasi auf Vorrat gründlicher über die systematischen und empirisch erkennbaren Vor- und Nachteile und die Schlüssig- und Stimmigkeit der Kernannahmen und Versprechungen des Kostenerstattungsprinzips nachzudenken.
Auch wenn die Ablösung des Sachleistungs- durch das Kostenerstattungsprinzip im Moment nicht im Mittelpunkt der gesundheitspolitischen Reformbemühungen steht, handelt es sich bei Kostenerstattung um eine der "Säue", die je nach Bedarf mit viel Getöse durch das "gesundheitspolitische Dorf getrieben wird". Es lohnt sich daher quasi auf Vorrat gründlicher über die systematischen und empirisch erkennbaren Vor- und Nachteile und die Schlüssig- und Stimmigkeit der Kernannahmen und Versprechungen des Kostenerstattungsprinzips nachzudenken.
Dies liegt auch an der Attraktivität des Kostenerstattungsprinzips, die - so eine AutorInnengruppe der Hochschule Fulda - "darin (liegt), dass durch vergleichsweise einfache Maßnahmen - in der Hauptsache durch eine Veränderung der Zahlungsströme - gleichzeitig die Transparenz für die Versicherten erhöht, Abrechnungsbetrug verhindert, das Inanspruchnahmeverhalten der Versicherten reduziert und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung durch die gestärkte Rolle des Patienten verbessert werden sollen."
Ob diese Argumentationskette theoretisch wie empirisch haltbar ist, versuchen diese AutorInnen, allesamt Gesundheitsökonomen an der Hochschule Fulda, in einem 44 Seiten umfassenden Forschungspapier weitgehend frei von aktuellen Pulverdämpfen zu überprüfen.
Zu den wesentlichen Erkenntnissen der Studie gehören u.a.
• die Feststellung, dass der "durchschnittliche Patient weder die Notwendigkeit von medizinischen Diagnose- oder Therapiemaßnahmen noch deren Qualität in vielen Fällen hinreichend beurteilen kann" und daher "die bloße Kenntnis über die Kosten der erfolgten Maßnahmen für das eigene Inanspruchnahmeverhalten vermutlich weithin irrelevant" (Klaus Jacobs et al. 2010) ist,
• die gesicherte Erkenntnis, dass mit der Kostenerstattung insbesondere im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung weder eine Zunahme der Steuerungskompetenz des Patienten noch eine höhere Wirtschaftlichkeit erkennbar sind,
• die ebenfalls gesicherte Erkenntnis, mit den reinen Preisinformationen die immer noch weit verbreitete angebots- oder anbieterinduzierte Nachfrage nicht zu verhindern sein dürfte,
• die bereits in Untersuchungen während der 1990er gemachte Beobachtung, dass allein erhöhte Transparenz nicht zwangsläufig zu einem erhöhten Kostenbewusstsein führe. Wenn überhaupt, müsse Kostenerstattung erst noch durch ein zusätzliches System von Selbstbeteiligungen und Beitragsrückerstattungen "scharf gestellt" werden und
• die bereits mehrfach bestätigte Erkenntnis (u.a. durch eine Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung), dass Kostenerstattung höchstens für relativ wenige und vermögende Versicherte eine attraktive Wahloption ist und
• dass ein funktionierendes Kostenerstattungssystem unbedingt ein soziales Ausgleichssystem brauche.
Aus einer einer vergleichenden Untersuchung der Kostenerstattungsempirie in den Niederlanden, Australien und Deutschland leiten die Fuldaer GesundheitsökonomInnen drei Schlussfolgerungen für die weitere Debatte ab:
• "Wird dem Leistungserbringer die Wahl zwischen Abrechnung nach Kostenerstattung und Sachleistung überlassen und weichen außerdem die Abrechnungsbeträge von den Erstattungsbeträgen nach oben ab, kann dies für die Patienten erhebliche finanzielle Folgen haben. Die freie Arztwahl löst dieses Problem nicht vollständig. Die Patienten werden nicht immer Leistungsanbieter finden, die freiwillig nach dem Sachleistungsprinzip abrechnen."
• "Das Interesse der Leistungsanbieter am Kostenerstattungsprinzip ist dann extrem niedrig, wenn die Höhe der Abrechnungsbeträge in Kostenerstattung und Sachleistung nicht voneinander abweichen. Eine Angleichung der Abrechnungssysteme reduziert damit das Interesse der Leistungsanbieter an der Kostenerstattung dramatisch. Gleichzeitig würde aus Sicht der Versicherten ein wesentlicher Nachteil der Kostenerstattung entfallen."
• "Wenn sich die Versicherten des Unterschieds zwischen Sachleistung und Kostenerstattung nicht bewusst sind, können sich die Versicherer durch den Ausbau des Kostenerstattungsprinzips ihrer Verantwortung für die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung entziehen. Es besteht damit die Gefahr, dass sich die Krankenversicherer bei einem steigenden Anteil von Kostenerstattungstarifen ihrer Steuerungs- und vor allem Sicherstellungsverantwortung entziehen."
Die Quintessenz der eigenen systematischen Analyse dreier Szenarien, die von der obligatorischen Kostenerstattung mit differenziertem Abrechnungssystem über das Wahlrecht durch Leistungsanbieter mit differenziertem Abrechnungssystem bis zum Wahlrecht durch Versicherte mit einheitlichem Abrechnungssystem reichen, lautet zunächst relativ euphorisch: "Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein einheitliches Abrechnungssystem aus Versichertensicht eine zentrale Barriere zur Inanspruchnahme des Kostenerstattungsprinzips beseitigen würde. Zudem würden die Anreize zur angebotsinduzierten Nachfrage in einem solchen Szenario weitgehend beseitigt." Trotzdem wären aber "die Effekte auf die Inanspruchnahme der Versicherten ... ungewiss." Und damit bleibt aus Sicht der AutorInnen und letztlich verblüffend "zu fragen, ob die in einem solchen Szenario erhöhte Kostentransparenz nicht auch mit geringeren administrativen Aufwändungen durch eine für den Patienten kostenfreie Patientenquittung erreicht werden könnte."
Die Erfahrungen mit dieser Patientenquittung und ihre wissenschaftliche Evaluation zeigen aber, dass freiwillig relativ wenige Versicherte diese Transparenzmöglichkeit nutzen und von ihnen nur ein Bruchteil etwas mit der Leistungs- und Kostentransparenz anfängt.
Dies zeigt aber, dass effektive Ansätze zur Steuerung des Inanspruchnahmeverhaltens von Versicherten und Patienten mit den Standardrezepten der Gesundheitsökonomie brechen müssen und nicht allein oder sogar nur völlig nachrangig auf quantitative und kostenzentrierte Methoden setzen müssen.
Das Forschungspapier 1/2011 "Kostenerstattung in der Gesetzlichen Krankenversicherung" von Stefan Greß, Ingo Heberlein, Stephanie Heinemann und Dea Niebuhr ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.9.11
Grenzen der Kriminologie: Wie häufig ist die Abrechnung von DRG-Krankenhausfällen "fehlerhaft" und welche Fehler gibt es?
 Bereits mit der Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen oder "Diagnosis related groups (DRG)" in der deutschen Krankenhauslandschaft war die Befürchtung verbunden, dies reize die Krankenhäuser an, sich durch entsprechende Aktivitäten mehr Einnahmen zu beschaffen als ihnen nach dem tatsächlichen Aufwand zustünden. Dieser Verdacht wird auch nach der Veralltäglichung der DRG unvermindert weiter geäußert und zum Teil belegt.
Bereits mit der Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen oder "Diagnosis related groups (DRG)" in der deutschen Krankenhauslandschaft war die Befürchtung verbunden, dies reize die Krankenhäuser an, sich durch entsprechende Aktivitäten mehr Einnahmen zu beschaffen als ihnen nach dem tatsächlichen Aufwand zustünden. Dieser Verdacht wird auch nach der Veralltäglichung der DRG unvermindert weiter geäußert und zum Teil belegt.
Dies war der Ausgangspunkt eines Gutachtens, das sich im Auftrag des AOK-Bundesverbandes um eine kriminologische Betrachtung und Bewertung bemühen sollte.
Trotz der fehlenden oder systematisch verzerrten Datengrundlage für die Abrechnungspraxis der deutschen Krankenhäuser mit den Gesetzlichen Krankenkassen, kommt der Rechtswissenschaftler Kölbel von der Universität Bielefeld zu folgenden Erkenntnissen:
• Die Entdeckung von Abrechnungsfehlern oder Unstimmigkeiten von Berechnungsgrundlagen (z.B. Diagnose) ist nur im Verlaufe des normalen Abrechnungsprozesses möglich und kann zu Aktivitäten des Kassenmitarbeiters oder einer Weitergabe zur genaueren Prüfung durch den "Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)" (etwa jeder 10. Fall, der entdeckt wurde) führen.
• Die entdeckten Fehler werden dadurch limitiert, dass die Krankenkassen keineswegs sämtliche Falldaten erhalten, sondern nur die nach § 301 SGB V. Außerdem ist ihr eigenes Interesse überwiegend auf die wirtschaftliche Seite der Behandlung gerichtet.
• Die Fehler- und Betrugsempirie innerhalb der in den USA schon länger etablierten DRG-Abrechnung zeigt, dass bestimmte Abrechnungsfehler keine reine Spekulation sind: In durchschnittlich rund 18 % der Abrechnungsfälle treten entgeltrelevante Kodierfehler auf. In Befragungen in den USA gab nahezu die Hälfte des interviewten Kodier-Personals an, von ihrem Management zu einer grenzwertig erlösmaximierenden Kodierung angehalten worden zu sein.
• "Die amtliche DRG-Abrechnungsstatistik ebenso wie die kassenspezifische Auswertung ausgewählter Abrechnungsbereiche (bilden) ein modifiziertes Kodierverhalten der Kliniken ab, das eindeutig durch die DRG-Einführung ausgelöst wurde: namentlich eine zunehmende Mitkodierung von entgeltsteigernden Faktoren (Nebendiagnosen, Prozeduren und Komplikationen) - freilich ohne dass auf dieser Datenebene feststellbar wäre, ob sich darin eine erlösmaximierende Verschlüsselungspraxis niederschlägt oder nur die zunehmende Vermeidung des früheren (damals noch vergütungsirrelevanten) Downcodings."
• "Grenzwertige Vergütungsziele" spielen nach Ansicht des kriminologischen Gutachters eine eindeutige Rolle bei der "Verteilung der geltend gemachten DRG innerhalb mancher Diagnose- und Behandlungsgruppen, in denen das Abrechnungsverhalten ganz offensichtlich auf das Erreichen entgeltsteigernder Schwellwerte abzielt."
• Auch wenn der MDK in den vergangenen Jahren "beständig relativ große Abrechnungsanteile als überhöht reklamiert, im Durchschnitt knapp 40 %" ist dies keine repräsentative Erkenntnis und muss auch nicht Ergebnis einer unabhängigen fachkompetenten Überprüfung sein. Die Prüfpraxis des MDK variiert von Prüfung nach "Aktenlage" bis zu aufwändig recherchierenden Krankenhausbesuchen. Umgekehrt stecken in den Fällen, die nicht vom MDK überprüft wurden, mit Sicherheit noch weitere Fälle mit Abrechnungsfehlern.
• Wenn die Fehlerstatistik in den letzten Jahren als Hauptfehler feststellt, dass die stationäre Behandlung nicht notwendig war oder eine kürzere Dauer ausgereicht hätte, kommt hier nur die einseitige Suchstrategie der GKV zum Ausdruck. Eine umfassende Dokumentation der Fehlerschwerpunkte fehlt.
• Vor allem fehlen aber Analysen der Entstehungszusammenhänge. Diese können von Fehlern in der DRG-Software über Bedienungsfehler und Strategien der Erlösoptimierung innerhalb des legalen Rahmens bis zum vorsätzlichen Fälschen der Diagnosen etc. reichen.
• Dass eine "relevante Manipulationspraxis" existiert, sieht der Gutachter durch eine "Reihe "weicher" Indikatoren" als gegeben an: Die Abrechnungsfehler zu Gunsten der abrechnenden Kliniken sind auffällig häufiger als die Fehler zu deren Lasten. Auch ist ein Lerneffekt i.S. einer zunehmenden Abrechnungskonformität, … in den MDK-Prüfdaten nicht feststellbar. Obendrein werden von den MDK nicht nur deutliche Unterschiede in der Fehlerbelastung verschiedener Krankenhäuser, sondern sogar richtiggehend abrechnungsauffällige Kliniken ausgemacht."
• Schritte, die an der belegbaren und vermutlichen Abrechnungsfälschung bei DRGs etwas ändern könnten, sind bessere diagnosebezogene Informationsmaterialien, spürbare Sanktionen von Fehlern, pausachale Vergütungskürzungen beim Überschreiten bestimmter Fehlermarken und ggfls. die Nutzung des Strafrechts.
Das 14 Seiten umfassende Gutachten "Die Prüfung der Abrechnungen von Krankenhausleistungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Bewertung aus kriminologischer Perspektive" von Ralf Kölbel ist komplett kostenlos erhältlich und enthält im Anhang einige empirische Belege für die erwähnten Fehlerphänomene.
Bernard Braun, 14.11.10
Bremer Wissenschaftler fordern soziale Zuzahlungen nur für weniger kosteneffiziente Leistungen
 In einem Beitrag für die Zeitschrift für Sozialreform (Nr. 55 (1), S. 71-90) aus dem Jahr 2009 entwickeln Ralf Götze und Tina Salomon vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen die Idee einer einkommens- und morbiditätsadjustierten Selbstbeteiligung. Das klingt überzeugend, und dank des knackigen Namens fair fee auch verlockend.
In einem Beitrag für die Zeitschrift für Sozialreform (Nr. 55 (1), S. 71-90) aus dem Jahr 2009 entwickeln Ralf Götze und Tina Salomon vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen die Idee einer einkommens- und morbiditätsadjustierten Selbstbeteiligung. Das klingt überzeugend, und dank des knackigen Namens fair fee auch verlockend.
Zunächst zeichnen die AutorInnen die historischen Entwicklungen der Selbstbeteiligungen im deutschen Gesundheitswesen und ihre Rolle in Rahmen der Kostendämpfungspolitik nach, bevor sie den immanenten Konflikt zwischen Effizienz auf Grund der unterstellten Steuerungseffekte und sozialer Gerechtigkeit sowie erwünschte und unerwünschte Wirkungen diskutieren. Unter Verweis auf das in § 3 SGB V verankerte Solidarprinzip, wonach sich die Höhe der Finanzierungsbeiträge nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der BürgerInnen richten sollen, leiten die AutorInnen den Wunsch ab, Zuzahlungen mögen nicht die ärmeren und mit schlechterer Gesundheit geschlagenen Menschen benachteiligen. Dies geschähe aber zurzeit aufgrund aller geltenden Zuzahlungsregelungen, die eine regressive Wirkung entfalteten und insbesondere chronische Kranke stark belasteten. Die AutorInnen fordern zunächst das Verbot aller schädlichen und unnützen Gesundheitsleistungen und den Ausschluss von "Güter(n) und Leistungen ohne erkennbaren Nutzen" aus dem Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Ihr Vorschlag bezieht sich auf "das Segment der als medizinisch sinnvoll bewerteten Therapien, die sich für eine kollektive (Teil-)Finanzierung qualifizieren". Innerhalb dieser Gruppe sollen eine Güterabwägung nach individuellen Kosten-Nutzen-Erwägungen und die Zuordnung in einen Basis- und einen Wahlkatalog erfolgen mit unterschiedlichen Zuzahlungsmodalitäten: "Im Basisleistungskatalog hat die Selbstbeteiligung lediglich einen pauschalen Charakter, um einen statischen Moral Hazard in Form einer ungebremsten Mengenausweitung zu verhindern. Im Wahlleistungssegment nimmt sie dagegen zusätzlich den Charakter eines Indemnitätstarifs an. Durch die Beteiligung an den Mehrkosten einer teureren Therapieform wird der Patient dazu angehalten, seinen dynamischen Moral Hazard einzuschränken."
Vor allem im Wahlleistungsbereich würden die unterschiedlichen Einkommens- und Morbiditätsbedingungen zu unerwünschten Verzerrungen führen. Um dies zu verhindern, wäre eine Adjustierung der Selbstbeteiligungen nach Einkommen und Morbidität erforderlich - nach der schlichten Formel Zk = Aym (Zl + Zw) = Aym (Zl + (Kw - Kb)). Zwischen Finanzierern und Leistungserbringern ließe sich eine solche einkommens- und morbiditätsbezogene kombinierte Zuzahlung dank der elektronischen Gesundheitskarte und mit einer zertifizierten Anbietersoftware mühelos für jede Gesundheitsleistung ermitteln, mutmaßen die AutorInnen und liefern eine Matrix für die Berechnung der anfallenden Zuzahlungen mit. Insgesamt könne man so Steuerungswirkungen bei BezieherInnen hoher Einkommen verstärken und gleichzeitig die unerwünschten Wirkungen bei den unteren Einkommensgruppen abschwächen.
Diese Idee klingt auf den ersten Blick gut. Bei genauerem Lesen stellen sich aber mehr Fragen als die AutorInnen Antworten zu liefern in der Lage sind. Sehr praxisnah wirkt die Forderung nach "fair fees "nicht, zur Umsetzung ist eine erhebliche und zurzeit schwerlich absehbare IT-Nachrüstung des deutschen Gesundheitswesens erforderlich - einschließlich der wünschenswerten Vertraulichkeitsgarantien aller Daten. Und die Frage, wie sich ihr Vorschlag denn in die allgegenwärtige Forderung nach "Bürokratieabbau" einpassen soll, bleiben sie ebenfalls schuldig. Auffällig bei dem aufwändig entwickelten Vorschlag für gerechtere Zuzahlungen ist vor allem die Unterteilung nach unterschiedlichen Graden von Kosteneffizienz. Abgesehen davon, dass dies keineswegs so leicht zu ermitteln ist und unvermeidlich einen gewissen Grad an Willkür mit sich bringt, gestaltet sich das Differenzieren zwischen Basis- und Wahlleistungen ja bekanntlich in der Praxis als überaus schwierig. Unverständlich bleibt aber vor allem, warum gerade für Gesundheitsleistungen mit hohem Nutzen im Verhältnis zu den Kosten weiterhin pauschale und damit regressive Eigenbeteiligungen gelten sollten, und weshalb sich die soziale Nachjustierung auf Wahlleistungen mit schlechterer Kosten-Nutzen-Relation beschränken möge. Sich darüber derart ausgefeilte Gedanken zu machen erscheint nur dann sinnvoll, wenn man den Wahlleistungen eine ausgesprochen große Bedeutung zumisst. Das mag den Verfechtern des wachsenden - zweiten - Gesundheitsmarktes schmecken, erscheint aber zunächst nicht zwingend sinnvoll.
Nicht so offen, wie es die AutorInnen darstellen, ist auch "die Frage, ob durch die Zuzahlungen in der aktuell geltenden Praxis mehr als vereinzelte Individuen von der eigentlich notwendigen Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen abgeschreckt werden". Auch wenn die Auswirkungen der Praxisgebühr - abgesehen von den überschuldeten Haushalten, wie bereits im Forum Gesundheitspolitik in dem Artikel Zuzahlungen und Praxisgebühr führen zur eingeschränkten Inanspruchnahme auch medizinisch notwendiger Leistungen bei Überschuldeten nachzulesen war - bisher uneindeutig sind, sprechen Erfahrungen mit unterschiedlichen Zuzahlungsformen für verschiedene Gesundheitsleistungen in anderen Ländern eine sehr deutliche Sprache.
Erheblich unklarer ist indes die von den AutorInnen gar nicht gestellte Frage, ob und in welchem Maße nachfrageseitiges moral hazard - und nur diesem kann man durch Zuzahlungen effektiv begegnen - überhaupt im Gesundheitswesen relevant ist. Denn wer den engen Rahmen ökonomischer Modellrechnungen verlässt und klinisch-epidemiologische Erkenntnisse sowie solche aus der Versorgungsforschung in die Betrachtung von Zuzahlungswirkungen und moral hazard einbezieht, stößt auf unübersehbare Zweifel an der Vorstellung von sinnvoller Steuerung. Bisher ist nicht erwiesen, dass Zuzahlungen mehr Nutzen als Schaden anrichten. Vielmehr gibt es eine Vielzahl empirischer Hinweise - einschließlich der RAND-Studie -, die eher das Gegenteil nahe legen. Einer grundsätzlichen Fehlsteuerung können auch die ausgeklügelsten Zuzahlungsformen nicht entgegenwirken.
Dass die AutorInnen wesentliche Erkenntnisse aus der internationalen Zuzahlungsforschung nicht hinreichend zur Kenntnis genommen haben, zeigt sich an mehreren Stellen ihres Papers. So ist die Einschätzung bemerkenswert, die bis heute umfangreichste Studie zur Steuerungswirkung von Zuzahlungen sei das RAND Health Insurance Experiment. Mag diese Aussage für streng experimentelle Untersuchungen zutreffen, liegen doch mittlerweile etliche quasi-experimentelle Analysen mit weitaus mehr als den 5,500 Versuchspersonen des RAND-Experiments vor. Um an den wohlgemerkt ersten bzw. zunächst schlichten Schlussfolgerungen dieser Studie festhalten zu können, die bis heute maßgeblich den Glauben an sinnvoll steuernde Wirkungen von Zuzahlungen belegt, gehen die AutorInnen gar nicht auf den mittlerweile umfangreich diskutierten RAND-Irrtum ein, den sogar einige Studienautoren wie Joseph Newhouse im Nachhinein eingeräumt haben. Eine systematische Analyse der Beschränkungen, die zu großer Vorsicht bei der Verallgemeinerung der RAND-Befunde rät, liefern Raise Deber, Evely Forget und Leslie Roos in Ihrem Artikel Medical savings accounts in a universal system: wishful thinking meets evidence, der Anfang 2004 in Health Policy 70 (1) erschien Abstract. Bei den üblichen argumentativen Rückgriffen auf die RAND-Studie kommen die systematischen Unzulänglichkeiten regelmäßig zu kurz oder gar nicht zur Sprache.
Und noch ein Satz in der Abhandlung von Götze und Salomon lässt aufhorchen: "Zugrunde liegt beiden Ansätzen die Annahme, dass der Arztbesuch und die weiteren in Anspruch genommenen medizinischen Leistungen und Güter selbst nicht ausreichend unangenehm sind, um das Individuum dazu zu bewegen, seinen Konsum von Gesundheitsleistungen auf das zum Erhalt der Gesundheit notwendige Maß zu beschränken." Solche Aussagen können nur Menschen treffen, die bisher offenbar von schwerwiegenden Gesundheitsproblemen verschont geblieben sind und den "reichlich herben Genuss einer Bypass-Operation oder Chemo-Therapie" nicht kennen lernen durften, wie es Hartmut Reiners auf Seite 16 in seinem Aufsatz "Homo oeconomicus" so trefflich formuliert. Vor allem aber gehen die AutorInnen davon aus, es gäbe ein "zum Erhalt der Gesundheit notwendige(s) Maß" an Gesundheitsleistungen. Außerhalb universitärer Elfenbeintürme erweisen die klinische wie die Versorgungsforschung die unterstellte, der Zuzahlungsideologie grundsätzlich zu Grunde liegende klare Trennlinie in das Reich der Phantasie.
Die Zeitschrift für Sozialreform bietet keine Online-Volltexte im Internet ist nur das Abstract zu lesen. Allerdings hat das Pharma-Unternehmen Janssen-Cilag das Paper in seinem Sammelband Zukunftsideen für das Gesundheitssystem (Beiträge aus dem Hochschulwettbewerb "Perspektive 2020 - Gesundheit als Chance") nachgedruckt. Über diesen Umweg ist sich das gesamte Paper Fair Fee: Einkommens- und morbiditätsadjustierte Zuzahlungen für Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland von Götze und Salomon auch online zugänglich. Hier können Sie den Sammelband der Janssen-Cilag GmbH herunterladen, der besagte Beitrag findet sich auf den Seiten 109ff.
Jens Holst, 5.6.10
Nichts wissen, nichts sagen, lieber schweigen: Wie ahnungslos ist das Bundesgesundheitsministerium über den Pharmamarkt!?
 Manchmal bliebe man als Bürgerin oder Bürger um eine Illusion reicher, wenn Politiker oder ein Ministerium nicht jede Frage beantworten würden. Manchmal ist es aber für interessierte Bürgerinnen und Bürger ein Erkenntnis-Gewinn, wenn ihnen oder ihren Vertretern zwar nichts gesagt wird, aber dies in Antwortform geschieht.
Manchmal bliebe man als Bürgerin oder Bürger um eine Illusion reicher, wenn Politiker oder ein Ministerium nicht jede Frage beantworten würden. Manchmal ist es aber für interessierte Bürgerinnen und Bürger ein Erkenntnis-Gewinn, wenn ihnen oder ihren Vertretern zwar nichts gesagt wird, aber dies in Antwortform geschieht.
Ein Paradebeispiel für diese Art von Nullkommunikation ist die handschriftlich auf den 24. Februar 2010 datierte Antwort des BMG-Staatssekretärs Stefan Kapferer auf eine Kleine Anfrage einiger Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE zum Thema "Nationale und internationale Regelungen zur Arzneimittelpreisbildung" (BT-Drucksache 17/689). Dessen Minister, Herr Rösler, hat immer wieder die Wichtigkeit des Arzneimittelmarkts und dortiger entschiedener Reformen betont und daher hatten die Parlamentarier auch substanzielle Antworten auf entsprechende Fragen erwartet.
So fragten sie z.B. nach den durchschnittlichen Arzneipreisen in der OECD, welche Länder z.B. Arzneimittel-Positiv- oder Negativlisten haben, wo es noch unbegrenzte Herstellerabgabepreise gibt, in welchen Ländern Preisverhandlungen zu Arzneimitteln stattfinden und ob die Bundesregierung plant, Regularien einzuführen, die Einfluss auf den offiziellen Herstellerabgabepreis haben.
Die meisten Antworten bestanden aus der lapidaren Formulierung: "Siehe Antwort auf Frage 2". Und als ob diese Fragen nicht bereits seit Jahrzehnten gesundheitspolitischer Zündstoff wären (z.B. fragen sich nach jedem Auslandsurlaub Millionen von Urlaubern, warum dort Arzneimittelpreise niedriger sind) antwortet das BMG in seiner Antwort auf Frage 2 ebenso knapp wie absichtsvoll unhilfreich: "Die Bundesregierung führt kein Register über Preisregulierungen und Erstattungsregelungen in anderen Ländern und verweist auf entsprechende Fachveröffentlichungen."
Nur für eine wichtige und weltweit nahezu einmalige Bedingung des deutschen Arzneimittelmarktes verweist das BMG die Abgeordneten nicht in Lesesäle von Uni-Bibliotheken oder ins Internet, sondern weiß umfassend Bescheid: "Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, in denen pharmazeutische Unternehmer ohne vorherige staatliche Preisregulierung Arzneimittel in den Markt einführen können. Zudem kann in Deutschland jedes Unternehmen die Preise für seine Arzneimittel frei festsetzen." Und auch nach allen Gesundheitsreformgesetzen der letzten Jahre: "Die Bildung der Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmen bleibt frei."
Und als ob die akuten Finanzierungsprobleme der Arzneimittelversorgung nicht trotz der weit über 20 Instrumente zur Regulierung des deutschen GKV-Arzneimittelmarktes existierten, beharrt das BMG darauf, dass "dem Grunde nach für alle Arzneimittel die Höhe der Erstattung der Preise begrenzt werden" könne. Die Mittel im SGB V dazu wären festsetzbare Festbeträge und Erstattungshöchstbeträge sowie aushandelbare Preisnachlässe.
Welches die dem BMG scheinbar trotzdem notwendigen und in ihm gerade bearbeiteten "Vorschläge für die Umstrukturierung des Arzneimittelmarktes" bestehen, wird zwar nicht ausführlich gesagt. Dass dabei aber ausschließlich "Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Herstellern erörtert" werden, deutet kein Ende der Probleme an.
Die Kleine Anfrage 17/689 der Fraktion DIE LINKE ist kostenlos als Bundestagsdrucksache erhältlich. Das von der stellvertretenden Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags, Kathrin Vogler, veröffentlichte Antwortschreiben des BMG ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.3.10
Wohin geht und wohin könnte eine Behandlungs-Vergütungsreform gehen? Das Beispiel der "episode-based payment" in den USA.
 Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Köhler, denkt kaum ein Jahr nach der letzten Vergütungsreform für niedergelassene Ärzte und kaum, dass deren Mehrheit die neue Vergütungsordnung überhaupt verstanden hat, darüber nach, mit der nächsten Reform die "Rolle rückwärts" zur Einzelleistungsvergütung zu schlagen.
Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Köhler, denkt kaum ein Jahr nach der letzten Vergütungsreform für niedergelassene Ärzte und kaum, dass deren Mehrheit die neue Vergütungsordnung überhaupt verstanden hat, darüber nach, mit der nächsten Reform die "Rolle rückwärts" zur Einzelleistungsvergütung zu schlagen.
Dies formulierte er Mitte 2009 in einem Interview im Deutschen Ärzteblatt so: "Für die spezialisierte fachärztliche Versorgung wollen wir abweichen von der grundsätzlichen Forderung nach Einzelleistungsvergütung. Wenn man hier eine Angleichung vornimmt, dann ans DRG-System. Für alle anderen Bereiche fordern wir aber eine Rückkehr zur Einzelleistungsvergütung."
Wegen deren gewaltigen ökonomischen aber auch gesundheitlichen Nachteilen für PatientInnen und Versicherte denken in den USA, wo es noch Einzelleistungsvergütung in Aktion gibt, Gesundheitswissenschaftler dagegen über radikale Alternativen nach.
Eine ist die der bereits einmal im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte "bundled payment". Über eine eng verwandte Variante, nämlich die "episode based payment", gibt es eine im Januar 2010 veröffentlichte interessante Darstellung, die vom liberalen Think Tank "Center for Studying Health System Change (HSC)" erstellt wurde.
Zu Beginn ihrer Ausführungen fassen die AutorInnen nochmals knapp die Nachteile der Einzelleistungsvergütung ("fee-for-service") so zusammen:
• Überangebot und -nutzung gut bezahlter Leistungen und Unterangebot- und -nutzung weniger gut bezahlter Leistungen,
• Förderung einer Medizinkultur, die meist nicht explizit vergüteten, aber qualitativ wichtigen Aktivitäten wie der Koordination der Versorgung einen geringen Wert beimisst und
• Die mittelbare Förderung des Erhalts eines fragmentierten Versorgungssystems, in dem Anbieter wie vor allem PatientInnen erhebliche Orientierungsprobleme haben.
Aber auch pauschalierte Vergütung in einem weiterhin fragmentierten Anbietersystem haben für einzelne Ärzte nachweisbare Nachteile für Ärzte wie PatientInnen.
Die bereits in den 1990er Jahren in den USA entwickelte Lösung, die möglichst viele Nachteile vermeidet und Vorteile produziert, war das "bundled payment". Hier erhalten z.B. niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser für die Behandlung einer Krankheit einen Gesamtbetrag, den sie sich teilen mussten. Trotz einiger Kostenersparnisse bei der Behandlung von Herzkranken durch eine Bypass-Operation zwischen 12 und 27 % bemühte sich die staatliche Krankenversicherung Medicare nicht darum, diese Vergütungsform auf andere stationär behandelte PatientInnen auszudehnen. Dies ändert sich seit 2009 wieder, sodass jetzt auch wieder realer über das Für und Wider sowie die organisatorischen Umstände des "bundled" oder "episode-based payment" nachgedacht werden kann.
Die AutorInnen stellen dazu u.a. die folgende zu berücksichtigenden oder zu klärenden Aspekte vor:
• Was sind und wie definiert man "Behandlungsepisoden" von präakuten Beschwerden über akute Beschwerden, eine ambulante oder stationäre Behandlung/Operation bis zu postakuten und rehabilitativen Leistungen mehrerer Anbieter? Vorgestellt wird dazu eine Art Weiterentwicklung des bereits von den DRGs bekannten Grouper, der hier nur "episode grouper" heißt und auch bereits technisch existiert.
• Welches qualitative Gewicht und damit auch wie viel Geld haben die einzelnen Behandlungsschritte und Behandler an der Gesamtbehandlung?
• Wie viel Gesamtvergütung entfällt damit auf die Gesamtbehandlung und woran orientiert sich dieses Honorar? Spannende Alternativen sind die Ausrichtung an "historischen Kosten" oder an externen Benchmark-Größen oder gar an leitlinienorientierten Standards.
• Wie identifiziert man die Anbieter oder Leistungserbringer, denen die Episodenvergütung zufließt? Geschieht dies retrospektiv oder sollten nicht Gruppen von Anbietern den Krankenversicherungsunternehmen prospektiv ein Leistungsbündel für definierte Behandlungsepisoden anbieten?
• Wie verhält sich schließlich eine derartige Vergütungsreform zu anderen laufenden oder konzipierten Vergütungsreformen sowie Versorgungsformen, wie den DRGs oder den "patient-centered medical homes"?
• Wie implementiert man ein "episode-based payment program"? Welche Erfahrungen gibt es aus der praktischen Erprobung des so genannten "PROMETHEUS"-Modells, das sich an Episoden und an einer evidenzbasierten Konzeption von "good care" orientiert?
• Schließlich weisen sie auch auf die Notwendigkeit hin, derartige Vergütungsreformen nicht vor den Patienten zu verbergen, sondern diese einzubeziehen.
Worauf es beim Inhalt und der Form oder Performance weiterer Vergütungsreformen in den USA ankommt, bringen die VerfasserInnen zum Schluss ihrer Analyse auf folgenden Punkt: "Without dramatic reform of payment structures, payers and patients can expect to experience continued rapid growth of health care costs and little improvement in the quality or coordination of care. But moving too rapidly with reforms that bundle payments for all care delivered to a given patient can backfire if the majority of providers are ill equipped to respond constructively. Episode-based payments, if carefully developed, can serve as a bridge for many providers between current fee-for-service structures and a future that emphasizes care of whole patient populations."
Auch wenn der vorliegende Text nichts Abschließendes oder Evidenzbasiertes über den gesundheitlichen und finanziellen Nutzen des "episode-based payment" sagt, könnte seine Beachtung zumindest etwas mehr Phantasie in die Vergütungsdiskussion in Deutschland bringen. Der Traum von der Einzelleistungsvergütung scheint demgegenüber vor allem aus Patientensicht ein erfolgloser und verlustreicher Weg "zurück in die Zukunft" zu sein.
Den 16 Seiten umfassenden und zahlreiche Literaturhinweise enthaltenden Text "Episode-Based Payments: Charting a Course for Health Care Payment Reform" aus dem "National Institute for Health Care reform" des HSC von Hoangmai H. Pham, Paul B. Ginsburg, Timothy K. Lake und Myles Maxfield gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 22.2.10
Was soll sektorenübergreifende externe Qualitätssicherung wie machen? "Sagen Sie es bis zum 25.1.2010!"
 Die Qualitätssicherungs-Landschaft im deutschen Gesundheitswesen ist zumindest was ihre Institutionen betrifft in Bewegung. Ob dies auch für die inhaltliche Entwicklung gilt, kann man fast vom Startblock der neuen Institution für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung gemäß §137a SGB V weg mit verfolgen und beeinflussen. Konkret geht es darum, dass seit dem 1. Januar 2010 das Göttinger "Aqua-Institut" das für diese Aufgaben zuständige "interessenunabhängige und neutrale Dienstleistungsunternehmen" ist - im Auftrag von und mit Richtlinien des "Gemeinsamen Bundesausschusses". Das Institut hat sich auf Qualitätsförderungsprojekte spezialisiert und ging 1995 aus der 1993 gegründeten "Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung" hervor.
Die Qualitätssicherungs-Landschaft im deutschen Gesundheitswesen ist zumindest was ihre Institutionen betrifft in Bewegung. Ob dies auch für die inhaltliche Entwicklung gilt, kann man fast vom Startblock der neuen Institution für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung gemäß §137a SGB V weg mit verfolgen und beeinflussen. Konkret geht es darum, dass seit dem 1. Januar 2010 das Göttinger "Aqua-Institut" das für diese Aufgaben zuständige "interessenunabhängige und neutrale Dienstleistungsunternehmen" ist - im Auftrag von und mit Richtlinien des "Gemeinsamen Bundesausschusses". Das Institut hat sich auf Qualitätsförderungsprojekte spezialisiert und ging 1995 aus der 1993 gegründeten "Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung" hervor.
Die im Wesentlichen zuletzt durch das Wettbewerbsstärkungsgesetz (WSG) aus dem Jahr 2007 in den gesundheitspolitischen Vordergrund geschobene sektorenübergreifende externe Qualitätssicherung ist insbesondere aus den folgenden Gründen notwendig: Stationäre Aufenthalte werden immer kürzer, Patienten werden häufig ambulant und stationär sowie zum Teil auch in verschiedenen Bundesländern behandelt. Behandlungsverläufe sind in der bisherigen gesetzlichen Qualitätssicherung kaum sichtbar, Ergebnisse daher schwer interpretierbar. Informationsbrüche und Kommunikationsprobleme zwischen den Sektoren führen zu Qualitäts- und Sicherheitsmängeln.
Die eingangs des Methodenpapiers bereits genannten wichtigen Herausforderungen an die sektorenübergreifende Qualitätssicherung sind daher:
• Die Priorisierung von Themen und Bereichen der Qualitätssicherung in einem offenen Prozess, in den einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse von Experten und den beteiligten Institutionen nach § 137a SGB V einfließen, andererseits aber auch die weitere Öffentlichkeit Vorschläge einbringen kann.
• Die Veränderung des bisherigen strukturierten Dialoges von einem Kontrollverfahren mit Konzentration auf "Auffälligkeiten" (sog. "bad apples") zu einer kontinuierlichen Qualitätsförderung, die Anreize und Motivation zur ständigen Weiterentwicklung des internen Quali-tätsmanagements gibt.
• Die Schaffung eines transparenten Koordinatensystems zur Abbildung der Qualität, das Wahlentscheidungen der Versicherten unterstützt.
• Die Schaffung von Möglichkeiten zum Benchmarking auf der Ebene von Regionen, Einrichtungen und Abteilungen.
• Die Umsetzung eines transparenten und wissenschaftlich abgesicherten Entwicklungsprozesses von Qualitätsindikatoren und Messinstrumenten, der sich über Publikationen auch der internationalen Diskussion und Kritik stellt.
Obwohl es in vielen ausländischen Gesundheitssystemen auch eine Sektoralisierung der Behandlung gibt und damit Defizite in Behandlungsverläufen, gibt es nach Angaben von AQUA "weltweit bisher kein Vorbild für ein indikatorengestütztes, umfassendes sektorenübergreifendes Koordinatensystem zur Abbildung der Qualität der Versorgung."
Zu seinen ersten Arbeitsschritten, dies für die Bundesrepublik zu ändern, gehört daher der am 5. Januar 2010 von AQUA veröffentlichte erste Entwurf eines Methodenpapiers, das im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens bis zum 25. Januar 2010 von den nach § 137 a SGB V zu beteiligenden Organisationen sowie von der interessierten Öffentlichkeit erörtert und kritisiert werden kann. Wer will und es für notwendig hält, kann auf diesem Weg auch Vorschläge einreichen, die in einem förmlichen Verfahren darauf hin geprüft werden, ob sie in das künftige Routineverfahren zur Qualitätssicherung aufgenommen werden können.
Welche Schritte mit welchen Zielen und mit der Unterstützung welcher Experten und Versorgungsakteure dafür gemacht werden müssen, um die entsprechenden Qualitäts-Indikatoren zu entwickeln und sie in den Versorgungsalltag zu implementieren, sind zwei Kerninhalte des Methodenpapiers. Dabei bleibt manches notwendigerweise abstrakt. Das Papier versucht dies etwas zu lindern indem am Beispiel eines denkbaren Auftrags des G-BA die Qualitätssicherung im Bereich von Harninkontinenz aufzubauen, die von AQUA als Entwicklungsschritte vorgeschlagenen Institutionen und Verfahren vorgestellt und mit Leben gefüllt werden.
Der Ende November 2009 erstellte erste Entwurf des Methodenpapiers "Allgemeine Methoden für die wissenschaftliche Entwicklung von Instrumenten und Indikatoren im Rahmen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung im Gesundheitswesen nach § 137a SGB V" mit 127 Seiten Umfang ist kostenlos zu erhalten. Zugleich ist dies ein guter und auch für die Implementationsphasen anderer Innovationen wünschenswerter Einstand für die hoffentlich dauerhafte Transparenz in der ja keineswegs konfliktarmen Qualitätsberichterstattung und -sicherung.
Bernard Braun, 8.1.10
Hand- oder Elektrobetrieb: Wo endet für eine Krankenkasse die gesetzliche Pflicht, die Selbständigkeit von Behinderten zu fördern?
 Egal, ob es um Rehabilitationsleistungen oder Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung geht, verpflichtet der Gesetzgeber die Sozialverwaltungen, durch ihre Leistungen die Selbständigkeit und Selbstbestimmung ihrer betroffenen Versicherten zu fördern:
Egal, ob es um Rehabilitationsleistungen oder Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung geht, verpflichtet der Gesetzgeber die Sozialverwaltungen, durch ihre Leistungen die Selbständigkeit und Selbstbestimmung ihrer betroffenen Versicherten zu fördern:
• "Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen … um … die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. (§ 4 Abs. 1 SGB IX)
• "Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht" (§ 2 SGB XI)
• "Den besonderen Belangen behinderter und chronisch kranker Menschen ist Rechnung zu tragen." (§ 2a SGB V)
Dennoch verweigerte die Barmer Ersatzkasse einem ihrer an beiden Beinen amputierten und damit schon länger auf einen Rollstuhl angewiesenen Versicherten, der nun wegen Kreislauf- und Herzproblemen und einer durch das ständige Fahren des Rollstuhls verursachten ärztlich attestierten chronischen Entzündung beider Arme auch noch Probleme bekam, sich mit eigener Kraft zu bewegen, die Finanzierung eines Elektrorollstuhl nach § 33 SGB V.
Zentrale Begründung: Der Behinderte könne sich doch durch seine Frau oder seinen Schwiegersohn schieben lassen. Diese Position hielten das zuständige baden-württembergische Sozial- und Landessozialgericht (LSG) auf eine entsprechende Klage des behinderten Versicherten gegen die Barmer für rechtens.
Erst das Bundessozialgericht (BSG) besann sich jetzt auf die eingangs zitierten klaren und auch die Wuppertaler Großkasse verpflichtenden Ziele des Gesetzgebers, den Behinderten wenn irgend möglich unabhängig zu machen und erklärte in einer bereits im August 2009 veröffentlichten Entscheidung: "Zu Unrecht hat das LSG auf die Möglichkeiten der familiären Schiebehilfe verwiesen; wesentliches Ziel der Hilfsmittelversorgung ist es nämlich, den behinderten Menschen von der Hilfe anderer Menschen unabhängig zu machen und ihm eine selbständigere Lebensführung zu ermöglichen. Deshalb besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Versorgung mit einem Elektrorollstuhl, wenn ein Versicherter nicht (mehr) in der Lage ist, den Nahbereich der Wohnung mit einem vorhandenen Aktivrollstuhl aus eigener Kraft zu erschließen."
Das LSG müsse nun abschließend ermitteln, dass der Versicherte nicht selbst in der Lage sei, seinen Rollstuhl zu bewegen. Trotz der Hinweise und vorgelegter Atteste des klagenden Behinderten geschah dies im ersten Verfahren wohl nicht. Bestätigt sich dann das Unvermögen des Versicherten, sich mit eigener Kraft zu bewegen, muss ihm nach dem BSG-Urteil die Barmer Ersatzkasse einen Elektrorollstuhl finanzieren.
Dies ist leider kein Einzelfall, sondern es kommt immer wieder ausgerechnet zwischen schwer bedürftigen und damit natürlich so genannten "schlechten Risiken" und ihren Kassen zu derartigen vorgerichtlichen oder auch gerichtlichen Auseinandersetzungen. Daher sei die Frage erlaubt, ob in solchen Fällen bereits die rechts- und sozialblinden Betriebswirte das Sagen haben oder man den Kassenmitarbeitern empfehlen sollte, sich mal eine Stunde von ihrem Schwiegersohn durch die bergige Wuppertaler Innenstadt schieben zu lassen - Sammeln von Versorgungswirklichkeit eben!
Die wesentlichen Argumente zu dem beim BSG unter dem Aktenzeichen B 3 KR 8/08 R geführten Rechtsstreit stehen der Öffentlichkeit innerhalb des BSG-"Terminbericht 44/09" vom 13.8.2009 kostenlos zur Verfügung.
Aktueller Nachtrag: Außerdem ist auch der komplette Text des Urteils samt Begründung veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.09
Wie viele Krankenkassenmitarbeiter gibt es? Und was kosten sie die Versicherten? Daten zum Mythos aufgeblähte Verwaltungsausgaben
 Durch die rasch anwachsende und auch politisch gewollte Welle von Fusionen schrumpft derzeit die Anzahl gesetzlicher Krankenkassen rasanter als dies zuletzt mit den Instrumenten des Wettbewerbsstärkungsgesetz beabsichtigt war (Stand Februar 2009: 193). So unken selbst einige Zauberlehrlinge des Wettbewerbs von einer nicht mehr weit entfernten Gefahr eines Oligopols weniger Großkassen. Trotz der schon seit vielen Jahren stattfindenden Verringerung der Kassenzahl (z.B. 1999=459) gehört die Kritik an den zu hohen Verwaltungskosten der GKV zum stabilen Kernbestand der GKV-Mythen.
Durch die rasch anwachsende und auch politisch gewollte Welle von Fusionen schrumpft derzeit die Anzahl gesetzlicher Krankenkassen rasanter als dies zuletzt mit den Instrumenten des Wettbewerbsstärkungsgesetz beabsichtigt war (Stand Februar 2009: 193). So unken selbst einige Zauberlehrlinge des Wettbewerbs von einer nicht mehr weit entfernten Gefahr eines Oligopols weniger Großkassen. Trotz der schon seit vielen Jahren stattfindenden Verringerung der Kassenzahl (z.B. 1999=459) gehört die Kritik an den zu hohen Verwaltungskosten der GKV zum stabilen Kernbestand der GKV-Mythen.
Die oft im Ärztelager oder in den Chefetagen der privater Krankenversicherungsunternehmen zu findenden Ankläger von angeblich durch "Verwaltungspaläste", Scharen von unkündbaren Verwaltungsangestellten und Vorstandsboni der gesundheitlichen Versorgung schwerkranker Patienten vorenthaltenen Riesensummen, vergessen häufig, genaue Daten zu sagen.
Wer sich dafür interessiert, kann relativ aktuelle Daten in dem Bericht "Gesetzliche Krankenversicherung. Personal- und Verwaltungskosten 2007 (Ergebnisse der GKV-Statistiken KG1/ 2007 und KJ1/ 2007)" des Bundesministeriums für Gesundheit vom 28. Januar 2009 finden.
Die wesentlichen Informationen des 14 Seiten umfassenden Berichts lauten:
• Die 2007 existierenden gesetzlichen Krankenkassen beschäftigten insgesamt 137.513 Personen (ohne Eigenbetriebe). Davon waren 133.603 in der Verwaltung und noch 79 Beamte und 11.860 beamtenähnliche so genannte DO-Angestellte. Die restlichen Beschäftigten Tarifangestellte. Hinzu kamen noch 5.027 Beschäftigte in Eigenbetrieben.
• Je 1.000 Versicherte waren dies 1,96 Kassenmitarbeiter. Diese Relation schwankte zwischen 2.98 bei der Knappschaft (deren Mitarbeiter sind aber mit Fragen sämtlicher Sozialversicherungsträgern befasst) und 1,36 bei den Arbeiterersatzkassen. Der Wert für die AOKen lag bei 2,25.
• Sämtliche persönliche Verwaltungskosten der GKv betrugen 2007 absolut 7.109.545.129 Euro und stiegen gegenüber 2006 um 0,2%. Je Mitglied waren dies 140,11 Euro und dieser Betrag nahm gegenüber 2006 um 0,34% ab. Die sächlichen Verwaltungskosten beliefen sich 2007 auf 2.085.410.869 Euro. Dieser Betrag erhöhte sich gegenüber dem im Vorjahr um 1,6%, betrug 41,10 Euro pro Mitglied und erhöhte sich um 1,06% gegenüber 2006.
• Nimmt man die Ausgaben für eine Reihe weiterer Verwaltungsaufgaben hinzu (z.B. die für Rechtsverfolgung oder Kosten von Ausschüssen) kommt man 2007 zu Nettoverwaltungskosten von 8.180.141.593 Euro. Dieser Betrag nahm absolut von 2006 um 0,86% zu und pro Mitglied um 0,32% auf 161,21 Euro.
• Die Aufstellung ist so detailliert, dass man z.B. einen Anstieg der Aufwandsentschädigungen für Werbemaßnahmen um 45,34% im Bereich der persönlichen Verwaltungskosten findet oder die insgesamt 6.678.886 Euro, die als sächliche Verwaltungskosten für Aufwendungen für das Selbstverwaltungsorgan der Vertreterversammlung ausgegeben wurden und gegenüber 2006 um 1,82% zunahm, die Abnahme der Aufwendungen für Rehabilitations-Servicestellen nach §§ 22 bis 25 SGB IX um 2,35% auf einen absoluten Betrag von 702.605 Euro , die Zunahme der Aufwendungen für Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen um 12,57% auf den Betrag von 5.333.492 Euro. Schließlich nahmen 2007 die Kosten von Sozialgerichtsverfahren um 11,07% auf 9.959.350 Euro zu.
• Bezieht man die Nettoverwaltungskosten auf die Gesamtausgaben für Leistungen in Höhe von 144.432.734.000 Euro beträgt der Verwaltungskostenanteil 5,66%. Dies ist ein Wert leicht über dem seit Jahren um die 5,5%-Marke oszillierenden Wert.
• Im Vergleich mit anderen Sozialversicherungsträgern steht die GKV günstig da: Der Verwaltungskostenanteil an den jeweils erbrachten Leistungen beträgt etwa bei der Bundesagentur für Arbeit derzeit rund 5,9%, bei den Rentenversicherungsträgern knapp 7% und bei den Berufsgenossenschaften ca. 10%. Wesentlich höher ist die zuletzt für das Jahr 2004 ermittelte vollständige Verwaltungausgabenquote der privaten Kranken- und Pflegeversicherungen: Inklusive Abschlusskosten, aber ohne die in der GKV gewichtigen Vertrags- und Preisverhandlungskosten liegen sie nach der Gesundheitsausgabenrechnung des Statistischen Bundesamtes bei 16%.
Den Bericht "Gesetzliche Krankenversicherung. Personal- und Verwaltungskosten 2007 (Ergebnisse der GKV-Statistiken KG1/ 2007 und KJ1/ 2007)" gibt es kostenlos als PDF-Datei.
Bernard Braun, 24.8.09
Wie wirken sich die DRG in Deutschland auf die Versorgungsqualität aus? Patientenwahrnehmungen vor und während der DRG-Einführung
 Jahre nach dem verpflichtenden Start der DRGs bzw. Fallpauschalen für den Großteil der stationären Behandlungen gibt es immer noch keine Informationen über die Auswirkungen dieser neuen prospektiven Vergütungsordnung auf Beschäftigte und vor allem Patienten aus der gesetzlich vorgeschriebenen, aber ernsthaft erst Ende 2008 gestarteten Begleitforschung.
Jahre nach dem verpflichtenden Start der DRGs bzw. Fallpauschalen für den Großteil der stationären Behandlungen gibt es immer noch keine Informationen über die Auswirkungen dieser neuen prospektiven Vergütungsordnung auf Beschäftigte und vor allem Patienten aus der gesetzlich vorgeschriebenen, aber ernsthaft erst Ende 2008 gestarteten Begleitforschung.
Daher sind weiterhin die Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien über diese Auswirkungen auch aus früheren Jahren für aktuelle Diskurse von Bedeutung bzw. können Anhaltspunkte für weitere Studien oder Gegenmaßnahmen zu unerwünschten Effekten liefern. Dazu können auch die Ergebnisse zweier Patientenbefragungen aus den Jahren 2002 (also im Vorfeld des offiziellen und flächengreifenden Starts der DRG) und 2005 (also mitten in der Einführungsphase, die noch bis 2010 laufen wird) dienen, die bereits 2006 veröffentlicht wurden.
Die Ergebnisse der zwei schriftlich standardisierten bundesweiten Befragungen von jeweils mehreren tausend Versicherten der Gmünder Ersatzkasse (GEK) zwischen 30 und 80 Jahren, die gerade einen Krankenhausaufenthalt hinter sich hatten, wurden durch Analysen der Daten der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes sowie von Routinedaten der GEK aus den Jahren 1990 bis 2005 ergänzt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Die Fallzahlen vollstationärer Behandlungen sind langfristig steigend. Ganz gegen die Erwartung eines zunehmenden Fallsplitting oder von erneuten Aufnahmen von zu früh oder "blutig" entlassenen Patienten, sanken seit der obligatorischen Einführung der DRGs die Fallzahlen vollstationärer Behandlungen. Ein Grund: Eine steigende Zahl vollstationärer Behandlungen ist durch ambulante Operationen an oder außerhalb von Krankenhäusern ersetzt worden.
• Die durchschnittlichen Falldauern gehen schon langfristig zurück. Ein spezieller DRG-Effekt ist nicht erkennbar. Aus der Patientenbefragung entsteht nicht der Eindruck, die Verkürzung der Aufenthaltszeiten sei unangemessen. Allerdings werden die kürzeren Falldauern vermehrt bis an die untere Grenzverweildauer verlängert, um Abschläge bei der Abrechnung zu vermeiden.
• Die Aufnahme ins Krankenhaus ist seit der optionalen Einführung der DRGs in der Wahrnehmung von Patienten mit einer geringeren Wartezeit verbunden. Außerdem ist die Zahl der Patienten, die angaben, zuvor nicht von einem anderen Krankenhaus abgewiesen worden zu sein, relativ klein geblieben. Dennoch gibt es auch Umstände bei der Aufnahme, die verbesserungswürdig sind und sich nicht gebessert haben. Trotz des von den DRG ausgehenden Anreiz, Patienten so schnell und bedarfsgerecht zu behandeln, existiert nahezu ungebrochen ein nicht ausreichender Informationsstand der Krankenhausärzte sowohl über den Gesundheitszustand der Patienten als auch über die vorangegangenen Behandlungen.
• Die Erfahrungen der Patienten mit dem Krankenhaus-Personal sind weiterhin sehr gut. Die Zufriedenheit verwundert etwas, da in den Jahren 2003 und 2004 deutlich Personal abgebaut wurde und der Arbeitsaufwand für die Pflegekräfte deutlich gestiegen ist. Jüngere Patienten haben allerdings häufiger als Ältere schlechte oder kritische Erfahrungen mit Kostenkalkülen oder einer nicht rücksichtsvollen Behandlung gemacht.
• Vor allem in privaten Krankenhäusern werden seit 2002 Verschlechterungen in der Beurteilung der Behandlungssituation erkennbar. Zum Teil handelt es sich dabei lediglich um das Verschwinden der 2002 überdurchschnittlich guten Verhältnisse und das Erreichen des Durchschnittsniveaus. Teilweise sind die ihren Erfahrungen zugrunde liegenden Versorgungsbedingungen aber auch schlechter geworden als die von Patienten in öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern.
• Am auffälligsten sind die zwischen 2002 und 2005 verbreitet schlechter werdenden Erfahrungen und Bewertungen ihrer Behandlung durch die multimorbiden (3 und mehr Behandlungsanlässe) Patienten und zwar innerhalb dieser Patientengruppe als auch im Vergleich mit den Patienten, die "nur" wegen einer Krankheit in Behandlung waren.
• Andere Ergebnisse als erwartet zeigen sich auch über den wahrgenommenen Zustand des Entlassungs- oder Überleitungsmanagement. Dazu wurden die Patienten nach dem Erhalt von 5 Entlassungsleistungen gefragt: die "verständliche" Erklärung von "Sinn und Zweck der Medikamenteneinnahme nach der Entlassung" durch Ärzte, die Erklärung, wie sich die Patienten "nach der Entlassung verhalten und auf welche Warnsignale sie achten sollen", durch Ärzte, die Besprechung "wann und wie" Patienten "ihre gewohnten Alltagsaktivitäten wieder aufnehmen können", die "ausführliche" Erklärung, wie sich die Patienten "bei ihrer Genesung selber helfen können" und schließlich die Information der Angehörigen oder anderer nahe stehender Personen, wie dem Patienten "bei der Genesung geholfen werden kann".
In beiden Jahren existiert erstens ein im Prinzip stabiles Gefälle beim Nichterhalt zwischen medizinisch-ärztlichen, sozialmedizinischen und nichtmedizinisch-nichtärztlichen Leistungen zu Lasten Letzterer. Zweitens haben in beiden Jahren zwischen rund 10 und 60 % der befragten Patienten Leistungen nicht erhalten, deren Sinn und Wert vielfach anerkannt ist und deren Substanz oder Ziel z. B. in den gesundheitspolitischen Debatten über "mehr Eigenverantwortung" seit Jahren von den Patienten eingefordert werden und deren Erhalt theoretisch durch die DRGs forciert werden sollte. Drittens verringert sich der Anteil der Patienten, welche die Leistungen nicht erhalten haben, bei einigen der ausgewählten Leistungen innerhalb des dreijährigen Untersuchungszeitraums graduell um 3 bis knapp 5 Prozentpunkte.
• Die Routinedatenanalyse zeigt folgendes: Die Liegezeitverkürzung folgt einem schon lang anhaltenden Trend, der sich in 2005 eher abschwächt als sich im Zuge der DRG-Einführung zu beschleunigen. In der grob aggregierten Betrachtung lassen sich keine großen Veränderungen in der Rezidiv- oder Rehospitalisierungsrate feststellen. Auch der Blick auf einzelnen Diagnosen hat keine dramatischen Entwicklungen gezeigt. Zweimal gab es keine Veränderungen zu sehen. Den Verdacht des Fallsplittings kann man bis 2005 nach allen vorliegenden Ergebnissen zurückweisen.
Trotz einiger Hinweise, dass sich an diesen Ergebnissen in der Wahrnehmung der Patienten nach 2005 nichts Grundlegendes geändert hat, ist zu bedauern, dass es aus verschiedenen Gründen (paradoxerweise das bisherige Fehlen "dramatischer" oder "knackigerer" Ergebnisse und der verbreitete Schwund des Interesses an Betroffenenbefragungen) keine krankenhausübergreifende oder bundesweite Fortsetzung der Befragung von Krankenhauspatienten gab und auch absehbar nicht geben wird. Die theoretische Möglichkeit, solche Befragungen auch ohne Unterstützung einer oder mehrerer gesetzlichen Krankenkassen durchzuführen, scheitert an der Forschungsökonomie. So viel zum Thema "der Patient steht im Mittelpunkt" und "nichts ist für ihn zu teuer".
Die 154 Seiten umfassende 2006 erschienene Studie "Versorgungsqualität im Krankenhaus aus der Perspektive der Patienten" von Bernard Braun und Rolf Müller vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen erhält man kostenlos als PDF-Datei.
Bernard Braun, 13.6.09
Alle 4 Jahre wieder - "Angaben zur Krankenversicherung" aus dem Mikrozensus 2007 des Statistischen Bundesamtes
 2007 waren in Deutschland durchschnittlich 196 000 Personen nicht krankenversichert und besaßen auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Damit waren 0,2% der Gesamtbevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz. Zum größten Teil handelte es sich dabei um Männer (68%). Besonders häufig haben die Erwerbstätigen ohne Krankenversicherungsschutz einen niedrigen beziehungsweise keinen schulischen oder beruflichen Abschluss (76%). Gut 23% gaben an, mindestens einen mittleren Abschluss erworben zu haben. Ein Prozent der Befragten machten keine Angaben zum beruflichen Abschluss.
2007 waren in Deutschland durchschnittlich 196 000 Personen nicht krankenversichert und besaßen auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Damit waren 0,2% der Gesamtbevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz. Zum größten Teil handelte es sich dabei um Männer (68%). Besonders häufig haben die Erwerbstätigen ohne Krankenversicherungsschutz einen niedrigen beziehungsweise keinen schulischen oder beruflichen Abschluss (76%). Gut 23% gaben an, mindestens einen mittleren Abschluss erworben zu haben. Ein Prozent der Befragten machten keine Angaben zum beruflichen Abschluss.
Dies zeigen die Ergebnisse des alle vier Jahre erhobenen Zusatzprogramms "Angaben zur Krankenversicherung" im Mikrozensus, der mit rund 50.000 PflichteilnehmerInnen größten jährlichen Haushaltsbefragung in Europa. Seine wichtigsten und aktuellsten Daten im Bereich Krankenversicherungsschutz sind am 11. Dezember 2008 in der Fachserie 13 Reihe 1.1 des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht worden.
In der Publikationen finden sich zum Themenbereich Krankenversicherung folgenden faktenreichen Auswertungen:
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenversicherungsschutz und ausgewählten Merkmalen
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses und Beteiligung am Erwerbsleben
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Alter und Geschlecht sowie Art des Versicherungsverhältnisses
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses, Geschlecht sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Stellung im Beruf
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses, Alter sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Stellung im Beruf
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Geschlecht, Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses sowie monatlichem Nettoeinkommen
Ferner finden sich in der Publikation das für den Mikrozensus relevante Gesetz, der Fragebogen des gesamten Mikrozensus und eine Reihe wichtiger Anmerkungen zur Qualität und Qualitätssicherung der mit dieser Erhebung gewonnenen Daten.
Die 87 Seiten der Mikrozensus-Fachserie "Krankenversicherungsschutz" sind kostenlos als PDF-Datei über die Website "destatis" des Statistischen Bundesamtes erhältlich. Es ist aber auch möglich, die Ergebnisse in Broschürenform zu bestellen.
Bernard Braun, 11.12.08
Deutschland 2007: 0,3% der Bevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz mit sehr gering steigender Tendenz
 Zu den Grundansprüchen des deutschen Sozialstaats gehört immer noch der durch eine gesetzliche Pflicht zur Versicherung oder auch Zwangsversicherung und zusätzliche Möglichkeiten der freiwilligen und privaten Versicherung gewährleistete Zugang fast der gesamten Bevölkerung zur Behandlung der meist unplanbaren und unvermeidbaren Erkrankungen und zur Teilkompensation der durch Krankheit entstehenden Einkommensausfälle (insbesondere Krankengeld). Was passiert, wenn dieser Zwang mit liberalen Vorstellungen beseitigt wird, zeigen die USA mit einem seit Jahrzehnten um die 15-Prozentmarke schwankenden Anteil nicht- oder unterversicherter BürgerInnen. In absoluten Zahlen sind dies im Moment 47 Millionen Menschen.
Zu den Grundansprüchen des deutschen Sozialstaats gehört immer noch der durch eine gesetzliche Pflicht zur Versicherung oder auch Zwangsversicherung und zusätzliche Möglichkeiten der freiwilligen und privaten Versicherung gewährleistete Zugang fast der gesamten Bevölkerung zur Behandlung der meist unplanbaren und unvermeidbaren Erkrankungen und zur Teilkompensation der durch Krankheit entstehenden Einkommensausfälle (insbesondere Krankengeld). Was passiert, wenn dieser Zwang mit liberalen Vorstellungen beseitigt wird, zeigen die USA mit einem seit Jahrzehnten um die 15-Prozentmarke schwankenden Anteil nicht- oder unterversicherter BürgerInnen. In absoluten Zahlen sind dies im Moment 47 Millionen Menschen.
Wesentlich weniger nicht krankenversicherte Personen oder Personen, die auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung besaßen, fand jetzt der aktuellste Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes mit seinem nur alle vier Jahre erhobenen Zusatzprogramm "Angaben zur Krankenversicherung" im ersten Quartal 2007 in Deutschland: 211.000, was einem Anteil an der Bevölkerung von 0,3% entsprach. Im Vergleich zum April 1999 mit einem Anteil von 0,2% und dem Mai 2003 mit 0,2% ist dieser Anteil also zwar um jeweils rund ein Fünftel aber tatsächlich nur geringfügig gewachsen. Absolut betrachtet: 1999 besaßen in Deutschland 145 000 Menschen keinen Krankenversicherungsschutz, 2003 waren es 177 000 Personen.
Zu dieser Entwicklung trugen vor allem die Männer bei: Im Jahr 1999 betrug die Zahl der nicht krankenversicherten Männer 79 000. Vier Jahre später stieg sie auf 104 000 und im Jahr 2007 auf 142 000. Damit stellten Männer 1999 deutschlandweit gut die Hälfte (55%) aller Personen ohne Krankenversicherungsschutz, 2003 lag ihr Anteil bei knapp drei Fünfteln (59%) und 2007 bei rund zwei Dritteln (67%).
Eine methodische Kurzbeschreibung sowie eine zusätzliche Tabelle bietet die Online-Fassung dieser Pressemitteilung.
Bernard Braun, 7.2.2008
Niedergelassene Ärzte sind unzufrieden mit der Interessenvertretung durch die KV
 Obwohl ein Großteil der in Deutschland niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten höchst unzufrieden ist mit ihrer Interessenvertretung durch Kassenärztliche Vereinigungen (KV) und Bundesvereinigung (KBV), sieht trotz zahlreicher Kritikpunkte nur eine Minderheit andere realistische Alternativen zum KV-System. Allerdings haben fast 40% die Rückgabe der Kassenzulassung schon einmal ernsthaft erwogen. Dies sind die Kernbefunde einer im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Ende 2006 vom Meinungsforschungsinstitut infas durchgeführten Befragung von über 20.000 niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten zum KV-System.
Obwohl ein Großteil der in Deutschland niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten höchst unzufrieden ist mit ihrer Interessenvertretung durch Kassenärztliche Vereinigungen (KV) und Bundesvereinigung (KBV), sieht trotz zahlreicher Kritikpunkte nur eine Minderheit andere realistische Alternativen zum KV-System. Allerdings haben fast 40% die Rückgabe der Kassenzulassung schon einmal ernsthaft erwogen. Dies sind die Kernbefunde einer im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Ende 2006 vom Meinungsforschungsinstitut infas durchgeführten Befragung von über 20.000 niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten zum KV-System.
In Einzelnen zeigt sich folgendes Meinungsbild:
• Die durchschnittliche Zufriedenheit mit der Aufgabenerfüllung der KVen schwankt zwischen den Schulnoten 2,7 und 4,1. Am besten bewertet wurden die Zuverlässigkeit der Abrechnung und Honorarauszahlung sowie die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung. Am schlechtesten wurde die Interessenvertretung im Gesetzgebungsverfahren beurteilt.
• Vier von fünf Befragungsteilnehmern waren mit der KBV oder KV in mindestens einem Aspekt ihrer Arbeit nicht zufrieden. Dabei am häufigsten kritisiert wurde die Interessenvertretung durch das KV-System. Fast vier von zehn Unzufriedenen gaben als Grund für ihre Unzufriedenheit eine allgemein schlechte Interessenvertretung durch das KV-System an sowie die Interessenvertretung gegenüber der Politik und den Krankenkassen.
• 60% sehen trotz zahlreicher Kritikpunkte keine wirkliche Alternative zum KV-System. Zwei Drittel glauben allerdings, dass die meisten Funktionsträger die wirklichen Probleme des einzelnen Arztes oder Psychotherapeuten nicht erkennen. Das KV-System wird umso kritischer beurteilt, je jünger die Befragten sind und umso positiver, je älter sie sind.
• Fast 40% haben die Rückgabe der Kassenzulassung schon einmal ernsthaft erwogen, dabei haben Männer solche Überlegungen deutlich häufiger angestellt als Frauen. Knapp 10% haben über die Möglichkeit einer Rückgabe der Kassenzulassung sogar schon eine Rechtsauskunft eingeholt.
• Zu ausgewählten gesundheitspolitischen Forderungen (Abschaffung der Budgets, Einführung des Kostenerstattungsprinzips, Verlagerung des Morbiditätsrisikos auf die Krankenkassen, Begrenzung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Entbürokratisierung der Abrechnungen) gab es hohe Zustimmungsquoten: 95% votieren für eine Abschaffung der Budgetierung, 69% für die Einführung eines generell verbindlichen Kostenerstattungsprinzips (so wie in der PKV) auch in der GKV.
• Dem Statement "Abrechnungsprüfungen durch die KVen sind im Interesse aller Vertragsärzte/Psychotherapeuten notwendig" stimmen 87% zu, hingegen befürworten nur 43% die Aussage "Qualitätssicherungsmaßnahmen der KV wie Praxisbegehungen sind im Interesse aller Vertragsärzte/Psychotherapeuten notwendig."
Die KBV präsentiert auf einer Website zur Befragung viele Materialien:
• Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse (4 Seiten)
• Die Infas-Präsentation des Berichts (Foliensatz als PDF)
• Tabellenband mit Ergebnissen zu allen Fragen (55 Seiten) (Tabellen mit Differenzierung der Ergebnisse nach Alter, Geschlecht, Arbeitsschwerpunkt, KV-Bereich)
Gerd Marstedt, 10.1.2007
Absolute Selbstbeteiligung: Neues Tarifangebot der TK
 Im Zuge der Modernisierung des deutschen Gesundheitswesens stehen den
Im Zuge der Modernisierung des deutschen Gesundheitswesens stehen den
gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland seit kurzem neue Vertragsformen offen. Als erste große Versicherung bietet Techniker Krankenkasse (TK) ihren freiwillig versicherten Mitgliedern eine Police mit absoluter Selbstbeteiligung. Gut ein Prozent der freiwillig TK-Versicherten nehmen für 240 Euro Beitragsnachlass einen jährlichen Eigenanteil von 300 Euro in Kauf. In der soeben erschienenen wissenschaftlichen Evaluierung des Programm 240 kommen die Autoren zu dem Schluss, dass wählbare Selbstbehalte einen Steuerungseffekt in relevanter Größenordnung entfalten.
Das läßt aufhorchen, schließlich steht dieses Ergebnis in deutlichem Widerspruch zu internationalen Studien. Die eingehende Lektüre des Berichts wirft denn auch grundlegende Zweifel auf. Die Erhebung zu einem so frühen Zeitpunkt und die sehr kleine Stichprobe erlauben erfahrungsgemäß keine derart weit reichenden Schlussfolgerungen. Zudem gehen die Autoren implizit von einer Überausnutzung des Gesundheitswesens aus, sehen in jedem eingesparten Arztbesuch einen Gewinn und vernachlässigen Verwaltungs- und wahrscheinliche Folgekosten. Warum die Erfolgsmeldung der Autoren überzogen erscheint und einer kritischen Betrachtung kaum Stand hält, erklärt eine Analyse mit umfangreichen Literaturverweisen, die Teil einer Forschungsarbeit für das Wissenschaftszentrum Berlin ist.
Hier finden Sie die PDF-Fassung der Stellungnahme zur Studie über Selbstbehalte in der TK
Jens Holst, 26.4.2006
Landwirtschaftliche Krankenkassen: Die besondere Sozialversicherung
 Nach allen gängigen Definitionen von sozialer Krankenversicherung handelt es sich dabei um eine verpflichtende Absicherung von abhängig Beschäftigten gegen die finanziellen Folgen von Krankheit unter drei Bedingungen: Sie ist an formale Arbeitsverhältnisse gekoppelt, ihre Beiträge richten sich nach dem Einkommen und Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringen jeweils die Hälfte der Abgaben auf. Das ist zweifellos richtig - allerdings nicht für alle Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland und anderen europäischen Ländern mit Bismarckscher Sozialversicherung. Ebenso wie vergleichbare Krankenkassen in Österreich, Belgien und anderswo gehört die Landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKV) in Deutschland zwar zum System der Gesetzlichen Krankenversicherung. Aber sie versichert weder Angestellte noch richten sich die Beiträge ihrer Mitglieder nach dem Lohn oder Gehalt. Als einziger Sozialversicherungszweig versichert die LKV Selbständige, und die Beiträge richten sich nach der Betriebsgröße anstatt nach dem jeweiligen Einkommen.
Nach allen gängigen Definitionen von sozialer Krankenversicherung handelt es sich dabei um eine verpflichtende Absicherung von abhängig Beschäftigten gegen die finanziellen Folgen von Krankheit unter drei Bedingungen: Sie ist an formale Arbeitsverhältnisse gekoppelt, ihre Beiträge richten sich nach dem Einkommen und Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringen jeweils die Hälfte der Abgaben auf. Das ist zweifellos richtig - allerdings nicht für alle Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland und anderen europäischen Ländern mit Bismarckscher Sozialversicherung. Ebenso wie vergleichbare Krankenkassen in Österreich, Belgien und anderswo gehört die Landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKV) in Deutschland zwar zum System der Gesetzlichen Krankenversicherung. Aber sie versichert weder Angestellte noch richten sich die Beiträge ihrer Mitglieder nach dem Lohn oder Gehalt. Als einziger Sozialversicherungszweig versichert die LKV Selbständige, und die Beiträge richten sich nach der Betriebsgröße anstatt nach dem jeweiligen Einkommen.
Die Landwirtschaftlichen Krankenkassen (LKK) in Deutschland entstanden in Folge eines drastischen Strukturwandels und versichern heute nicht einmal einen von 85 Bundesbürgern. Dennoch können sie in der Praxis erprobte Hinweise liefern, wie eine soziale Pflichtversicherung auch bei Selbständigen funktionieren kann - in der deutschen Debatte um Bürgerversicherung oder Kopfpauschale ein nicht unwichtiges Thema. Vor allem aber bietet die Erfahrung der Landwirtschaftlichen Krankenkassen einige Ideen für den Aufbau von Krankenversicherungssystemen in Entwicklungsländern. Die Herausforderung einer umfassenden sozialen Sicherung steht in etlichen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas heute auf der Tagesordnung. Wenn es um die Versicherung von Kleinbauern und anderen Selbständigen aus dem zumeist großen informellen Sektor geht, kann der Blick auf die Erfahrungen der Landwirtschaftskassen in Europa helfen.
Aktuelle und weitere Hintergrundinformationen auf der Website des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Krankenkassen in Deutschland
Hier finden Sie die PDF-Fassung eines ausführlichen Artikels zum Thema Landwirtschaftliche Krankenkassen in Deutschland: Bestandsaufnahme und Erfahrungen für die Entwicklungszusammenarbeit
Jens Holst, 22.12.2005