



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"International"
USA - Andere Themen |
Alle Artikel aus:
International
USA - Andere Themen
Nutzerfreundlichkeit der elektronischen Gesundheitsakte aus Sicht von ÄrztInnen in den USA: mangelhaft und Burnout-fördernd
 In Deutschland geht es derzeit darum z.B. noch bei Zehntausenden niedergelassenen ÄrztInnen darum, ob die richtigen Konnektoren richtig, sicher und zukunftssicher angeschlossen sind, andere müssen Honorarabschläge für ihre fehlende IT-Struktur Honorarabschläge hinnehmen und noch andere versuchen den Nutzen der elektronischen Patientenakte, des E-Arztbriefs oder des E-Rezepts in positivstem oder negativstem Licht erscheinen zu lassen - oft nur auf gute Absichten gestützt. In anderen Ländern gibt es dagegen bereits Studien über die E-Praxis, ihre Folgen für die Versorgung und die Anwender. In Deutschland gibt es vergleichbar gute Studien trotz der seit 2005 existierenden gematik - Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH, jetzt gematik GmbH und deren Ausgabenvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro nicht.
In Deutschland geht es derzeit darum z.B. noch bei Zehntausenden niedergelassenen ÄrztInnen darum, ob die richtigen Konnektoren richtig, sicher und zukunftssicher angeschlossen sind, andere müssen Honorarabschläge für ihre fehlende IT-Struktur Honorarabschläge hinnehmen und noch andere versuchen den Nutzen der elektronischen Patientenakte, des E-Arztbriefs oder des E-Rezepts in positivstem oder negativstem Licht erscheinen zu lassen - oft nur auf gute Absichten gestützt. In anderen Ländern gibt es dagegen bereits Studien über die E-Praxis, ihre Folgen für die Versorgung und die Anwender. In Deutschland gibt es vergleichbar gute Studien trotz der seit 2005 existierenden gematik - Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH, jetzt gematik GmbH und deren Ausgabenvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro nicht.
Zu den internationalen Studien gehört eine am 14. November 2019 erschienene Studie in der Studienreihe "Mayo Clinic Proceedings" über die Assoziation zwischen der von US-ÄrztInnen aller Fachgruppen wahrgenommenen Nutzer- oder Gebrauchsfreundlichkeit der elektronischen Gesundheitsakte und dem Burnout unter ÄrztInnen.
Die Daten liefert eine in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführte Querschnittsbefragung von 30.456 ÄrztInnen, die Angehörige des "American Medical Association Physician Masterfile" sind. Von diesen nahmen 5.197 oder 17,1% an der Befragung teil. Von diesen Antwortenden erhielten 1.250 zufällig ausgewählte Personen einen Zusatzfragebogen, der die Nutzerfreundlichkeit der Gesundheitsakte evaluieren sollte und der von 870 oder 69,6% der ÄrztInnen beantwortet wurde. Diese Abfrage erfolgte mit einem einfachen und validierten Befragungsinstrument, der 10 Fragen umfassenden "System Usability Scale (SUS)" mit einem Gesamtwert von 0 bis 100. Burnout wurde mit dem ebenfalls validierten "Maslach Burnout Inventory" gemessen.
Die beiden zentralen Ergebnisse lauten:
• Der Mittelwert der Bewertung der Nutzerfreundlichkeit lag auf der 100er-Skala bei 45,9 Punkten (+-21,9 Punkte) was auf der us-amerikanischen Notenskala der schlechtesten Note, nämlich einem "not acceptable" oder F entspricht - auf der deutschen Notenskala eine 5 oder mangelhaft. Der Durchschnittswert für die SUS-Nutzerfreundlichkeit betrug in 1.300 Studien in unterschiedlichsten Branchen 68 Punkte. Und mit knapp 46 Punkten wird die elektronische Gesundheitsakte noch deutlich schlechter bewertet als das bisherige Schlusslicht Excel mit 57 Punkten.
• Nach einer umfassenden Adjustierung von Befragtenmerkmalen (u.a. Alter, Geschlecht, Facharzt, Praxisform, Arbeitsstunden) gab es in einer multivariaten Analyse eine hochsignifikante Assoziation zwischen der Bewertung der Nutzerfreundlichkeit durch ÄrztInnen und der Chance, dass sie einen Burnout erlitten. Zum Beispiel senkte eine Verbesserung von einem Punkt auf der SUS-Skala die Chance, einen Burnout zu bekommen um 3% (odds ratio 0,97).
Das in diesem Zusammenhang gebetsmühlenartig bemühte Argument, hier handle es sich um Kinderkrankheiten der Technik und die noch mangelnde Technikaffinität der NutzerInnen kann man glauben oder nicht. Die Schaffung von Akzeptanz durch geeignete Interventionen in einem lange Zeit brauchenden Prozess ist damit nicht erledigt. Und die Akzeptanz der elektronischen Instrumente wird durch schwere Bedienbarkeit, Bedienungspannen und Burnout mit Sicherheit nicht erhöht, was dann auch wieder zusätzlich die Wahrnehmung des Nutzens einschränkt.
Der Aufsatz The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Physicians von Edward R. Melnick et al. ist komplett kostenlos erhältlich. Dort finden sich auch weitere differenzierte Ergebnisse z.B. nach Facharztgruppen.
Bernard Braun, 19.11.19
Wodurch könnte die Lebenserwartung der 50-jährigen US-Bevölkerung um 14 oder 12 Jahre verlängert werden?
 Da die us-amerikanische Bevölkerung trotz der weltweit höchsten Gesundheitsausgaben im Vergleich mit anderen entwickelten Ländern eine geringere und teilweise sogar abnehmende Lebenserwartung hat, gibt es mehrere Studien zur Erforschung von möglichen Ursachen oder zur Suche nach Präventionsmöglichkeiten.
Da die us-amerikanische Bevölkerung trotz der weltweit höchsten Gesundheitsausgaben im Vergleich mit anderen entwickelten Ländern eine geringere und teilweise sogar abnehmende Lebenserwartung hat, gibt es mehrere Studien zur Erforschung von möglichen Ursachen oder zur Suche nach Präventionsmöglichkeiten.
Eine, in deren Mittelpunkt die Rolle und Wirkung von 5 überwiegend verhaltensbezogenen Faktoren auf die Sterblichkeit in frühen Lebensjahren und die Lebenserwartung steht, ist nun am 30. April 2018 in der Fachzeitschrift "Circulation" veröffentlicht worden.
Auf der Basis der "National Health and Nutrition Examination Surveys 2013-2014" bestimmten die WissenschaftlerInnen zunächst die Werte für 5 möglicherweise die Lebenserwartung fördernden Faktoren: niemals RaucherIn gewesen, BMI von 18,5 bis 24,9, mindestens 30 Minuten pro Tag mäßige bis kräftige körperliche Bewegung, mäßiger Alkoholkonsum und ein höherer Wert von über 40% auf einer in den USA verbreiteten Standardskala für gesunde Ernährung (dem sogenannten Health Eating Index).
Mit den für einen Zeitraum bis zu 34 Jahren vorhandenen Daten der "Nurses' Health Study" (1980-2014; n=78 865) und der "Health Professionals Follow-up Study" (1986-2014, n=44 354) identifizierten die WissenschaftlerInnen dann die Sterblichkeitshäufigkeit (42.167 Todesfälle) nach der Höhe des Gesamtwertes der verhaltensbezogenen Faktoren.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• Jeder der Faktoren wirkte sich signifikant auf die Gesamtsterblichkeit und das Risiko an Krebs oder einem kardiovaskulären Ereignis zu versterben aus.
• Wer bei allen 5 Faktoren positive Werte hatte, verringerte sein Gesamtsterblichkeits-Risiko gegenüber denjenigen, die dies bei allen Faktoren nicht schafften, um 74%.
• Die weitere Lebenserwartung von 50-jährigen Personen, die rauchten, übermäßig Alkohol tranken, Übergewicht hatten, sich zu wenig bewegten und sich schlecht ernährten, betrug 29 Jahre für Frauen und 25,5 Jahre für Männer. Frauen, die sämtliche dieser Risiken vermieden, hatten dagegen eine weitere Lebenserwartung von 43,1 Jahren, lebten also rund 14 Jahre länger. Männer mit ebenfalls geringem Verhaltensrisiko lebten durchschnittlich noch 37,6 Jahre, also noch rund 12 Jahre länger als Männer mit hohen Verhaltensrisiken.
Obwohl der Schwerpunkt der empirischen Analyse auf den möglichen Auswirkungen von Faktoren des Gesundheitsverhaltens liegt, weisen die AutorInnen zusätzlich auf die Bedeutung anderer eher verhältnisbezogener Faktoren hin: "There is still much potential for improvement in health and life expectancy, which depends not only on an individual's efforts but also on the food, physical, and policy environments."
Im Diskussionsteil des Aufsatzes deuten die AutorInnen unter Bezug auf andere Studien an, dass ähnliche Effekte auch in anderen Ländern wie z.B. in Deutschland existieren könnten.
Der mit Anhang 28 Seiten umfassende Aufsatz Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population von Yanping Li, An Pan, Dong D. Wang, Xiaoran Liu, Klodian Dhana, Oscar H. Franco, Stephen Kaptoge, Emanuele Di Angelantonio, Meir Stampfer, Walter C. Willett, Frank B. Hu ist online in der Zeitschrift "Circulation" (137) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.5.18
USA: Gesundheitsausgaben mit Abstand Platz 1 - Säuglings- und Kindersterblichkeit "rote Laterne" unter 19 anderen OECD-Ländern
 Obwohl in den USA der weltweit höchste Anteil von derzeit rund 18% des Bruttoinlandsprodukts für die gesundheitliche Versorgung ausgegeben wird, haben die US-BürgerInnen in mehrerlei Hinsicht deutlich weniger davon als die BürgerInnen in Ländern mit zum Teil niedrigeren Gesundheitsausgaben. Dies konnte bisher vor allem an der Lebenserwartung gezeigt werden, die in den USA trotz der ständig wachsenden Gesundheitsausgaben in weiten Teilen der Bevölkerung sank.
Obwohl in den USA der weltweit höchste Anteil von derzeit rund 18% des Bruttoinlandsprodukts für die gesundheitliche Versorgung ausgegeben wird, haben die US-BürgerInnen in mehrerlei Hinsicht deutlich weniger davon als die BürgerInnen in Ländern mit zum Teil niedrigeren Gesundheitsausgaben. Dies konnte bisher vor allem an der Lebenserwartung gezeigt werden, die in den USA trotz der ständig wachsenden Gesundheitsausgaben in weiten Teilen der Bevölkerung sank.
Eine aktuelle Studie verglich die Entwicklung der Sterblichkeit von Säuglingen und 1-19 Jahre alten Kindern und Jugendlichen zwischen 1961 und 2010 in den USA und 19 anderen OECD-Ländern, also ebenfalls insgesamt wohlhabenden Ländern.
Die Ergebnisse bestätigten die bei der Lebenserwartung gezeigten Trends:
• Obwohl in allen wohlhabenden Ländern die Kindersterblichkeit seit vielen Jahrzehnten abnimmt, liegt die Kindermortalität in den USA seit den 1980er Jahren über der in vergleichbaren Ländern.
• Zwischen 2001 und 2010 war das Risiko der Säuglingssterblichkeit in den USA 76% höher als in den 19 anderen OECD-Ländern (darunter auch Deutschland).
• Im selben Zeitraum war das Risiko im Alter von einem bis 19 Jahren zu sterben in den USA um 57% höher als in den Vergleichsländern.
• Betrachtet man die gesamte Studienperiode von rund 50 Jahren führte die mangelnde Performance des US-Gesundheits- und Sozialsystem zu über 600.000 zusätzlichen Toten.
• Die hohe Sterblichkeit unter Jugendlichen beruht vor allem auf Verkehrsunfällen und Waffenattacken. So war das Risiko mit einer Waffe ermordet zu werden unter den 15-19-Jährigen in den USA 82mal höher als in den OECD19-Ländern.
Zwei Dinge zum Hintergrund und warum sich u.U. die kinder- und jugendlichenbezogenen Indikatoren in den USA künftig sogar noch verschlechtern werden:
• Aktuelle Studien weisen nach, dass nicht die Inanspruchnahme oder andere nachfrager-/patienten-/versichertenspezifischen Faktoren oder Verhaltensweisen für die Gesamtausgaben verantwortlich sind, sondern die gerade auch im internationalen Vergleich hohen Preise nahezu aller Anbieter.
• Ebenfalls aktuell versucht ein Teil der "Nadelstichpolitik" (an Stelle des vorläufig gescheiterten frontalen Versuchs an die Stelle von Obamacare Trumpcare zu setzen) der republikanischen Mehrheit im Parlament gegen jede Form der öffentlichen Gesundheitsversicherung dem speziell für Kinder armer Familien, die allerdings für die andere öffentliche Krankenversicherung Medicaid zu viel Geld verdienen, konzipierten "Children's Health Insurance Program (CHIP)" seit September 2017 den Geldhahn zuzudrehen bzw. enorme Kürzungen durchzusetzen (Stand Dezember 2017). Sollte der Kongress auch im Jahr 2018 kein oder deutlich zu wenig Geld für CHIP bewilligen und den für die Umsetzung von CHIP zuständigen Bundesstaaten überweisen, droht nach einer Berechnung in der New York Times vom 14.Dezember 2017 Ende Januar 2018 der Krankenversicherungsschutz von 4,9 Millionen Kindern in 16 Staaten, Ende Februar der von 5,6 Millionen Kindern in 24 Staaten und am Ende des Sommers der von insgesamt 8,4 Millionen Kindern in 46 Staaten einschließlich Washington D.C. verloren gehen. Schwer vorzustellen, dass sich dies nicht auch auf die Mortalität und Morbidität von Kindern und Jugendlichen auswirkt.
Der Aufsatz Child Mortality In The US And 19 OECD Comparator Nations: A 50-Year Time-Trend Analysis von Ashish P. Thakrar, Alexandra D. Forrest, Mitchell G. Maltenfort und Christopher B. Forrest ist im Januarheft 2018 der Zeitschrift "Health Affairs" (37 (1): 140-149) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.1.18
Neue Krebsmedikamente 6 - FDA: Hürde für Zulassung niedrig, kein Biss bei Postmarketing-Studien
 Krebstherapien sollen das Leben von Kranken verlängern, darüber hinaus Beschwerden lindern, Komplikationen vermeiden und die Lebensqualität verbessern. Die Arzneimittelzulassungsbehörden legen ihren Entscheidungen über die Neuzulassung von Krebsmedikamenten jedoch häufig nicht diese patientenrelevanten Behandlungsendpunkte sondern Surrogatendpunkte zugrunde. Surrogatendpunkte messen z.B. die vorübergehende Verkleinerung eines Tumors (Ansprechrate) oder die Zeit bis zum Fortschreiten des Tumorwachstums (progressionsfreies Überleben). Dabei setzen die Zulassungsbehörden auf die Hoffnung, dass Medikamente, die auf Grundlage von Surrogatendpunkten zugelassen wurden, sich später als wirksam auf die Lebensdauer bzw. die Lebensqualität erweisen.. Um dies zu prüfen, verpflichtet die Zulassungsbehörde die Hersteller zu weitere Studien, sog. Postmarketing-Studien.
Krebstherapien sollen das Leben von Kranken verlängern, darüber hinaus Beschwerden lindern, Komplikationen vermeiden und die Lebensqualität verbessern. Die Arzneimittelzulassungsbehörden legen ihren Entscheidungen über die Neuzulassung von Krebsmedikamenten jedoch häufig nicht diese patientenrelevanten Behandlungsendpunkte sondern Surrogatendpunkte zugrunde. Surrogatendpunkte messen z.B. die vorübergehende Verkleinerung eines Tumors (Ansprechrate) oder die Zeit bis zum Fortschreiten des Tumorwachstums (progressionsfreies Überleben). Dabei setzen die Zulassungsbehörden auf die Hoffnung, dass Medikamente, die auf Grundlage von Surrogatendpunkten zugelassen wurden, sich später als wirksam auf die Lebensdauer bzw. die Lebensqualität erweisen.. Um dies zu prüfen, verpflichtet die Zulassungsbehörde die Hersteller zu weitere Studien, sog. Postmarketing-Studien.
Chul Kinnund und Vinay Prasad, zwei Amerikanische Onkologen, haben untersucht, wie hoch der Anteil von Surrogatendpunkten bei der Neuzulassung von Krebsmedikamenten durch die Food and Drug Administration (FDA) ist und inwieweit bei alleinigem Vorliegen von Surrogatendpunkte die Hersteller ihrer Pflicht nachkommen, die Verbesserung des Überlebens in weiteren Studien zu untersuchen.
Untersucht wurden alle 54 Neuzulassungen von Krebsmedikamenten durch die FDA von Anfang 2008 bis Ende 2012.
Surrogatendpunkte als Grundlage für die Zulassung akzeptierte die FDA bei 36 der 54 Substanzen (67%), und zwar bei allen 15 Substanzen im beschleunigten Zulassungsverfahrens und bei 21 von 39 Substanzen (54%) im traditionellen Zulassungsverfahren.
Die Ansprechrate akzeptierte die FDA bei 19 (53%) der 36 Neuzulassungen aufgrund von Surrogatendpunkten und das progressionsfreie Überleben 17 (47%).
Nach knapp 4 ½ Jahren wurde der Überlebensvorteil für 5 Medikamente in randomisierten kontrollierten Studien erbracht und zwar für eines der 15 Medikamente aus dem beschleunigten und für 4 der 21 Medikamente aus dem traditionellen Zulassungsverfahren.
Bei 18 Medikamenten zeigten randomisierte kontrollierte Studien keine Verbesserung des Überlebens und zwar in 6 der 15 Medikamente aus dem beschleunigten und für 12 der 21 Medikamente aus dem traditionellen Zulassungsverfahren.
Bei 13 Medikamenten bleibt unbekannt, ob sie die Überlebenszeit verlängern und zwar bei 8 der 15 Medikamente aus dem beschleunigten und bei 5 der 21 Medikamente aus dem traditionellen Zulassungsverfahren.
Zusammenfassend besteht bei 36 der 54 neu zugelassenen Krebsmedikamente kein Nachweis eines Überlebensvorteils vorliegt, insbesondere für keines der 15 beschleunigt zugelassenen Krebsmedikamente. Bezüglich der 36 Medikamente mit unbekanntem Nutzen zum Zeitpunkt der Zulassung liegen Jahre später Studien vor, die für 5 einen Überlebensvorteil und für 18 keinen Überlebensvorteil belegen. Für die übrigen 13 der 36 Medikamente haben die Hersteller auch nach Jahren keine aussagekräftigen Studien vorgelegt.
Bereits im Jahr 2009 hatte das U.S. Government Accountability Office (GOA), eine Aufsichtsbehörde des amerikanischen Kongresses, in einem Bericht grobe Mängel der FDA in der Handhabung von Postmarketing-Studien festgestellt. Es fehlten insbesondere Vorgehensweisen, Hersteller unter Druck zu setzen, die ihrer Verpflichtung, Postmarketing-Studien vorzulegen, nicht nachkommen. Auch fehlten Kriterien dafür, wann einem Medikament die Zulassung entzogen wird.
Kim, C., & Prasad, V. (2015). Cancer Drugs Approved on the Basis of a Surrogate End Point and Subsequent Overall Survival: An Analysis of 5 Years of US Food and Drug Administration Approvals. JAMA Intern Med, 175(12), 1992-1994. Link
United States Government Accountability Office (GOA). (2009). NEW DRUG APPROVAL. FDA Needs to Enhance Its Oversight of Drugs Approved on the Basis of Surrogate Endpoints. {Link}{http://www.gao.gov/products/GAO-09-866
David Klemperer, 4.11.17
Nutzung digitaler Informationen etc. von 65+-US-BürgerInnen 2011 bis 2014: Auf niedrigem, ungleichen Niveau wenig Veränderung!
 Glaubt man den Anbietern von Gesundheits-Apps und anderer eHealth-Produkte oder Dienstleistungen, befinden wir uns mitten in einer digitalen Revolution oder Demokratisierung der präventiven und kurativen Versorgung "der" Bevölkerung. Und selbstverständlich stellt "das Internet" und seine Nutzung eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Basis und Triebkraft einer immer höher und besser werdenden Gesundheitskompetenz dar.
Glaubt man den Anbietern von Gesundheits-Apps und anderer eHealth-Produkte oder Dienstleistungen, befinden wir uns mitten in einer digitalen Revolution oder Demokratisierung der präventiven und kurativen Versorgung "der" Bevölkerung. Und selbstverständlich stellt "das Internet" und seine Nutzung eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Basis und Triebkraft einer immer höher und besser werdenden Gesundheitskompetenz dar.
Ob dies in dieser Allgemeinheit stimmt, hängt wesentlich von der Frage ab, ob die Teile der Bevölkerung mit dem größten Informationsbedarf über Gesundheits- und vor allem Versorgungsfragen, nämlich die ärmeren und überwiegend älteren BürgerInnen die digitalen, elektronischen Möglichkeiten nutzen, verstehen, ihre Handlungsfähigkeit sowie die Kosten und die Qualität ihrer gesundheitlichen Versorgung verbessern - so weitere Erwartungen an die Nutzung elektronischer Hilfe.
Nationale und internationale Einmalbefragungen zeigen zwar, dass jüngere Menschen mehr im Internet unterwegs sind als ältere und Apps jedweder Art nutzen, behaupten aber, dass sich die Unterschiede nivellierten.
Ob dies wirklich so ist untersuchten jetzt US-Gesundheitswissenschaftler für die 65-jährigen und älteren US-BürgerInnen (2011 waren die 7.609 Berfragten durchschnittlich 75 Jahre alt und 57% waren Frauen) im Längsschnitt der Jahre 2011 bis 2014 mit Daten der jährlich erhobenen Daten der "National Health and Aging Trends Study (NHATS)". Dabei wurden dieselben Personen über den gesamten Zeitraum zu ihrer Nutzung von nicht gesundheitsbezogenen Alltagstechnologien und vier Techniken oder Handlungsweisen im Bereich digitaler Gesundheit befragt.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• 2011 nutzten 76% der SeniorInnen Mobiltelefone, 64% Computer, 43% ´das Internet und 40% E-Mail, Textnachrichten im Internet und Tablets. Deutlich weniger der befragten älteren Menschen nutzten digitale gesundheitsbezogenen Techniken und Angebote: 16% besorgten sich auf diesem Wege Gesundheitsinformationen, 8% informierten sich über verordnete Arzneimittel, 7% nahmen via Internet Kontakt mit Ärzten auf und 5% hielten mit ihrer Krankenversicherung online Kontakt. Eine geringe Nutzung von eHealth war 2011 mit hohem Alter, der Zugehörigkeit zur schwarzen oder Latino-Bevölkerung, einer gerade vollzogenen Scheidung und schlechter Gesundheit assoziiert.
• 2014 hatte sich der Anteil der älteren Befragten, die ein Mobiltelefon oder einen Computer nutzten nicht wesentlich verändert. Die Nutzung anderer Alltagstechnologien hatte sich dagegen signifikant erhöht. Drei der vier digitalen Prozeduren etc. wurden zwar von mehr SeniorInnen genutzt, aber der Anteil von ihnen, der irgendeine der genannten Techniken nutzte, stieg von 21% in 2011 auf 25% in 2014. An der wegen der Assoziation mit schlechter Gesundheit besonders problematischen sozial ungleichen Inanspruchnahme hatte sich nichts geändert.
Die Zusammenfassung der Wissenschaftler lautete: "Digital health is not reaching most seniors and is associated with socioeconomic disparities, raising concern about its ability to improve quality, cost, and safety of their health care. Future innovations should focus on usability, adherence, and scalability to improve the reach and effectiveness of digital health for seniors."
Der Forschungsbrief Trends in Seniors' Use of Digital Health Technology in the United States, 2011-2014 von David M. Levine, Stuart R. Lipsitz und Jeffrey A. Linder erschien am 2. August 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA" (316(5): 538-540. Das Abstract ist kostenlos.
Bernard Braun, 6.10.16
Grafische Warnungen auf Zigarettenschachteln mindern den Tabakkonsum
 Bereits 1964 haben die USA als erstes Land der Welt Warnungen in Textform auf Zigarettenpackungen eingeführt. Nicht umgesetzt ist bislang der Aufdruck von Grafiken, welche gesundheitliche Folgen des Tabakkonsums darstellen. Dies wird zwar vom Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs aus dem Jahr 2003 gefordert. Der Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act von 2009 sieht die Umsetzung vor. Die Umsetzung wurde vorübergehend von juristischen Schachzügen einiger der großen Tabakfirmen behindert, die den Standpunkt vertraten, die Bilder seien nicht mit der amerikanischen Verfassung zu vereinbaren.
Bereits 1964 haben die USA als erstes Land der Welt Warnungen in Textform auf Zigarettenpackungen eingeführt. Nicht umgesetzt ist bislang der Aufdruck von Grafiken, welche gesundheitliche Folgen des Tabakkonsums darstellen. Dies wird zwar vom Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs aus dem Jahr 2003 gefordert. Der Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act von 2009 sieht die Umsetzung vor. Die Umsetzung wurde vorübergehend von juristischen Schachzügen einiger der großen Tabakfirmen behindert, die den Standpunkt vertraten, die Bilder seien nicht mit der amerikanischen Verfassung zu vereinbaren.
Wissenschaftler der University of North Carolina at Chapel Hill führten jetzt den Nachweis, dass die grafischen Warnungen effektiv sind. Für eine randomisierte kontrollierte Studie rekrutierten sie 2149 erwachsene Raucher in North Carolina und Kalifornien. Die Teilnehmer mussten 5 Mal im Abstand von einer Woche ein Studienzentrum aufsuchen und dabei jeweils - bis auf den letzten Termin - ihren Wochenvorrat an Zigaretten mitbringen. Mitarbeiter versahen die Packungen der Interventionsgruppe mit einer grafischen Warnung, die mindestens 50% der Vorder- und Rückseite einnahm. Die Kontrollgruppe erhielt eine textliche Warnung. Die Teilnehmern erhielten als finanziellen Anreiz etwa 200 Dollar. Beim letzten Termin erhielten alle Teilnehmern Informationen über örtliche Rauchstopp-Programme.
Das Erfolgskriterium Rauchstopp - definiert als mindestens ein Tag Tabakabstinenz während der 4-wöchigen Studienphase - erfüllten 40% der Grafikgruppe und 34% der Textgruppe. In mindestens 7 Tagen vor dem letzten Termin waren 5,7% der Grafikgruppe und 3,8% der Testgruppe abstinent.
Im Vergleich stärker ausgeprägt war der Verzicht auf eine Zigarette, die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, die Nachdenklichkeit über die Warnung und über die Schäden des Rauchens, Angst, negativer Affekt, Gespräche über die Warnungen, die Gesundheitsrisiken und Rauchstopp. Keine Unterschiede war feststellbar für das wahrgenommene persönliche Risiko sowie die positive oder negative Haltung gegenüber dem Rauchen. Der Effekt war gleichmäßig über alle sozialen Gruppen ausgeprägt.
In der Diskussion heben die Autoren hervor, dass der Untersuchungszeitraum kurz sei und die Effekte der Grafikwarnungen prozentual klein erscheinen mögen, jedoch auf der Bevölkerungsebene zu hohen in absoluten Zahlen führen würden. Auch sollten Grafikwarnungen Teil umfassenderer Maßnahmen sein, zu denen insbesondere auch Öffentlichkeitskampagnen zählen. Die Autoren weisen auch darauf hin, dass viele der bisherigen Studien (die sie vor kurzem in einer Meta-Analyse zusammengefasst haben) die Reaktionen von Probanden z.B. bei Präsentation der Abbildungen am Computer gemessen hätten. Experimentelle Studien mit dem Endpunkt Rauchverhalten seien bislang jedoch rar.
Brewer NT, Hall MG, Noar SM, et al. Effect of pictorial cigarette pack warnings on changes in smoking behavior: A randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine 2016. Abstract
Noar SM, Hall MG, Francis DB, et al. Pictorial cigarette pack warnings: a meta-analysis of experimental studies. Tob Control 2016;25(3):341-54. Volltext
David Klemperer, 11.7.16
Profitieren Ehemänner gesundheitlich von Ehekrach? Ja, bei Diabetes, aber Ehefrauen nicht!
 In die lange Reihe der pharmakologischen Therapeutika und Verhaltensregeln gegen Diabetes gehört nach Ansicht einer am 25. Mai 2016 veröffentlichten Studie us-amerikanischer Soziologen auch eine unglückliche oder krisenhafte Ehe - jedenfalls für Männer. Dies ist zumindest auf den ersten Blick deshalb unerwartet, weil bisher die Ansicht überwog, Männer wie Frauen würden Ehekrisen vorrangig durch Frustessen und/oder -trinken sowie Körpervernachlässigung zu bewältigen versuchen, über kurz oder lang übergewichtig werden und damit beide einen klassischen Risikofaktor für Diabetes entwickeln.
In die lange Reihe der pharmakologischen Therapeutika und Verhaltensregeln gegen Diabetes gehört nach Ansicht einer am 25. Mai 2016 veröffentlichten Studie us-amerikanischer Soziologen auch eine unglückliche oder krisenhafte Ehe - jedenfalls für Männer. Dies ist zumindest auf den ersten Blick deshalb unerwartet, weil bisher die Ansicht überwog, Männer wie Frauen würden Ehekrisen vorrangig durch Frustessen und/oder -trinken sowie Körpervernachlässigung zu bewältigen versuchen, über kurz oder lang übergewichtig werden und damit beide einen klassischen Risikofaktor für Diabetes entwickeln.
Die neue Erkenntnis ist das Ergebnis einer Untersuchung der über 5 Jahre beobachteten Entwicklung der Ehequalität sowie der Gesundheitsqualität (389 Untersuchungspersonen waren am Ende des Untersuchungszeitraums an Diabetes Typ 2 erkrankt) von 1.228 verheirateten und zwischen 57 und 68 Jahren alten TeilnehmerInnen im us-amerikanischen "National Social Life, Health and Aging Project".
Wenn es sich um Männer handelte, verringerte eine Verschlechterung der Ehequalität das Risiko innerhalb der 5 Jahre diabeteskrank zu werden oder erhöhte sie für die an Diabetes Erkrankten die Chancen die Erkrankung gut steuern zu können. Quantitativ verringerte jede Einheit der Verschlechterung von Ehequalität auf einer dazu gebildeten mehrstufigen Ehequalitätsskala die Wahrscheinlichkeit diabeteskrank zu werden um 32%. Und nur bei Männern verringert eine Verschlechterung der Ehequalität mit jeder Einheit auf der Skala außerdem die relative Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierten Diabeteserkrankung um 58%. Die AutorInnen vermuten, dass dies u.a. daran liegt, dass zwar einerseits Frauen ihre Ehemänner stark zu einem gesunden Verhalten anstacheln, dies aber andererseits im Laufe der Zeit zu einer Belastung der ehelichen Beziehungen führen kann. Diese Erklärung stimmt mit einer Reihe anderer im Text zitierten Studien über die sozialen Dynamiken von Ehen überein.
Ganz anders sieht es bei Frauen aus. Bei ihnen war in den fünf Untersuchungsjahren eine gute Ehe mit einem niedrigeren Risiko verbunden, diabeteskrank zu werden. Mit jeder Einheit der Verbesserung von Ehequalität auf der gerade erwähnten Skala verringerte die Wahrscheinlichkeit an Diabetes zu erkranken um 45%.
Auch wenn man die Limitationen dieser Studie berücksichtigt, d.h. es wurden eine Vielzahl möglicher kranheits- oder gesundheitsfördernder oder -gefährdender Details von Ehen nicht berücksichtigt und auch 5 Jahre Betrachtungszeitraum sind nicht sonderlich lang, ist das Ergebnis ein interessanter Beitrag zur genderspezifischen Analyse von Erkrankungsrisiken. Sicherlich wäre eine Replikation einer derartigen Longitudinalstudie auch außerhalb der USA wünschenswert. Interessant wäre, auch die genderspezifischen Wechselwirkungen von Ehequalität oder der Qualität vergleichbaren Paarbeziehungen mit anderen Erkrankungen zu untersuchen.
Der Aufsatz Diabetes Risk and Disease Management in Later Life: A National Longitudinal Study of the Role of Marital Quality von Hui Liu, Linda Waite und Shannon Shen ist in der Zeitschrift "The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences" erschienen und sein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.5.16
Mehrheit der Studienergebnisse über Strahlentherapie in den USA trotz Verpflichtung nicht offen zugänglich
 Wichtige Entscheidungen über die Einführung und Nutzung neuer diagnostischen und therapeutischen Mittel werden immer mehr auf der Basis wissenschaftlicher klinischer Studien und der dort identifizierten Evidenz zum erreichbaren Nutzen getroffen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass dieses Entscheidungssystem funktioniert, ist die vollständige und zeitnahe Transparenz über alle Ergebnisse dieser Studien.
Wichtige Entscheidungen über die Einführung und Nutzung neuer diagnostischen und therapeutischen Mittel werden immer mehr auf der Basis wissenschaftlicher klinischer Studien und der dort identifizierten Evidenz zum erreichbaren Nutzen getroffen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass dieses Entscheidungssystem funktioniert, ist die vollständige und zeitnahe Transparenz über alle Ergebnisse dieser Studien.
Einer der möglichen und bereits mehrere Male aufgedeckte Mangel ist, dass Ergebnisse negativer Art, also z.B. fehlender Nutzen oder unerwünschte Wirkungen nicht, d.h. nur positive Ergebnisse veröffentlicht werden.
Um einen weiteren Mangel, nämlich die Nichtveröffentlichung oder zeitlich erheblich verzögerte Veröffentlichung von Ergebnissen, zu verhindern, gibt es in den USA seit 2007 die Verpflichtung, Studienergebnisse innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung der Studienarbeiten öffentlich zugänglich zu machen.
Wie die Realität im Bereich von in den USA durchgeführten Phase III-Studien zur Strahlentherapie, also einer für viele Patienten relevanten Therapieform - aussieht, haben nun Wissenschaftler für die "European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)" und auf deren Konferenz am 30. April 2016 präsentiert.
Als erstes untersuchten sie wie hoch der Anteil dieser Art von Therapiestudien war, die ihre Ergebnisse vor Inkrafttreten der Veröffentlichungspflichten im Jahr 2007 nicht veröffentlichten. Von den 552 berücksichtigten Studien waren dies 422 oder 76,4%.
Entgegen der Erwartung, die Publikationsverpflichtung sorge für mehr Transparenz, stieg der Anteil der Studien, die ihre Ergebnisse nicht wie ab 2007 vorgeschrieben transparent machten, und sei es nur in einer Zusammenfassung der Resultate, im Zeitraum bis 2013 sogar noch auf 81,7% an (655 von insgesamt 802 Strahlentherapiestudien).
Zu den weiteren Funden der beiden Wissenschaftler gehörte, dass sich die Intransparenz je nach Krankheitsart erheblich unterschied. So wurden Studienergebnisse über die strahlentherapeutische Behandlung von Augenkarzinomen "nur" zu 47% nicht veröffentlicht, die über die Behandlung von Brust- und Lungenkrebs zu 78% und 73,7% nicht und die über die Strahlentherapie von Hoden- und Dickdarmkrebs überhaupt nicht - jeweils nicht in dem vorgeschriebenen Einjahreszeitraum.
Ebenfalls unerwartet war, dass sich die für explizit unternehmensfinanzierte Studien Verantwortlichen deutlich häufiger regelkonform verhielten als die von akademischen Studien.
Um im ethischen und gesundheitlichen Interesse der StudienteilnehmerInnen und anderer PatientInnen mehr Transparenz erwirken zu können, schlagen die AutorInnen vor, dass Studienverantwortliche, die eine neue Studie öffentlich finanziert bekommen bzw. registrieren (diese Registration in einer speziellen Datenbank ist eine Voraussetzung für den Studienbeginn) wollen, vorher die Ergebnisse aller ihrer bisherigen Studien veröffentlichen müssen.
Eine Zusammenfassung der Präsentation Failure to publish trial results exposes patients to risks without providing benefits von Jaime Pérez-Aljia und Pedro Gallego ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.5.16
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig
 Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Eine amerikanische Studie ging der Frage nach, wie häufig neue Krebstherapien mit Superlativen beschrieben wurden. Die Autoren durchsuchten dafür Google news für den kurzen Zeitraum vom 21. bis 25. Juni 2015 mit dem Suchbegriff "cancer drug" in Verbindung mit den folgenden superlativen Begriffen: breakthrough, game changer, miracle, cure, home run, revolutionary, transformative, life saver, groundbreaking, marvel.
Sie fanden 94 Nachrichten aus 66 unterschiedlichen Nachrichtenquellen mit 97 Superlativen bezogen auf 36 bestimmte und 3 unbenannte Medikamente.
Unter den Therapieformen wurde die gezielte Therapie in 17 der 36 Artikel am häufigsten aufgegriffen, die zytotoxische Therapie bzw. Chemotherapie in 9 Artikeln, Checkpoint Inhibitoren in 5 Artikeln. 3 Artikel mit Superlativen bezogen sich auf Krebsimpfungen bzw. therapeutische Vakzine, einer auf Bestrahlungstherapie und einer auf Gentherapie.
Von den 97 Superlativen bezogen sich 39 auf eine gezielte Therapie, 37 auf einen Checkpoint-Inhibitor, 10 auf ein zytotoxisches Medikament, 5 auf eine Krebsimpfung, 3 nannten keine Therapieform, 2 auf eine Strahlentherapie, eine auf eine Gentherapie.
Von den 36 Substanzen hatten 18 bis Mitte Juli 2015 noch keine Zulassung von der Food and Drug Administration erhalten. Allein auf Grundlage von Tierversuchen, Zellkulturen oder präklinischer Forschung, also ohne Erkenntnisse aus Versuchen an Menschen, wurde 5 Substanzen mit einem Superlativ bedacht.
Die Superlative wurden 53 Journalisten, 26 Ärzten, 9 Industrievertretern, 8 Patienten und einem Kongressabgeordneten zugeschrieben. In der Mehrheit der Fälle wurde der Superlativ nicht vom Autor kommentiert.
Superlative wurden genauso häufig für zugelassene wie für nicht zugelassene Substanzen und für alle Arten von Krebstherapie gebraucht. Superlative erhielten auch Substanzen, wie z.B. Palbociclib und auch Krebsimpfungen, für die bisher keine Daten für einen Patientennutzen aus klinischen Studien vorliegt. Insgesamt wurden 5 Substanzen mit einem Superlativ vorgestellt, für die noch keinerlei Daten aus Studien an Menschen vorlagen.
Krebsmedikamente werden somit in der amerikanischen Öffentlichkeit häufig auf eine Weise dargestellt, dass die Leserinnen und Leser gefährdet sind, den Nutzen weit zu überschätzen, Risiken zu unterschätzen und falsche Hoffnungen zu entwickeln.
Dass eine entsprechende Studie in Deutschland ähnliche Ergebnisse erbringen könnte, zeigen die Ergebnisse bei Google News für die Eingabe der Begriffe "Krebstherapie" und "Durchbruch": zwischen dem 14.10. und 14.11.2015 finden sich 5 unkritische Berichte und 1 Bericht über die hier vorgestellte Studie. "Krebstherapie" und "Innovation" ergibt für denselben Zeitraum 14 Treffer.
Abola MV, Prasad V: THe use of superlatives in cancer research. JAMA Oncology 2015:1-2 Abstract
Serie Neue Krebsmedikamente
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA Link
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen Link
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig Link
Neue Krebsmedikamente 5: Niedrige Zulassungshürden behindern Fortschritte in der Forschung Link
David Klemperer, 14.11.15
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen
 Krebspatienten gründen ihre Entscheidungen über eine Chemotherapie auf den zu erwartenden Gewinn an Lebenszeit und auf die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die Toxizität der Behandlung. Dafür benötigen sie evidenzbasierte Informationen über ihr Krankheitsbild und die zu erwartenden Behandlungsergebnisse, insbesondere die Verlängerung der Überlebenszeit.
Krebspatienten gründen ihre Entscheidungen über eine Chemotherapie auf den zu erwartenden Gewinn an Lebenszeit und auf die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die Toxizität der Behandlung. Dafür benötigen sie evidenzbasierte Informationen über ihr Krankheitsbild und die zu erwartenden Behandlungsergebnisse, insbesondere die Verlängerung der Überlebenszeit.
Die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (Food and Drug Administration, FDA) kann seit dem Food and Drug Administration Safety and Innovation Act von 2012 Arzneimittel beschleunigt zulassen, wenn sie, als "Durchbruch" ("Breakthrough Therapy", dazu FDA Fact Sheet) anerkannt sind. Dies gilt für ein Arzneimittel zur Behandlung einer "ernsten Erkrankung", für das "vorläufige klinische Evidenz" für die substantielle Verbesserung von mindestens einem klinischen Endpunkt vorliegt im Vergleich zu den existierenden Therapien. Anerkannt werden u.a. Belege aus nicht-kontrollierten Studien und Surrogatendpunkte (Einzelheiten in der Broschüre für die Industrie). Eine Verbesserung der Prognose und/oder Lebensqualität ist nicht Bedingung.
Es liegt nahe, dass eine als "Durchbruch" bezeichnete Therapie hohe Erwartungen weckt. Eine Forschergruppe aus Dartmouth prüfte dies in einer kleinen, unaufwändigen Studie.
In einer Online-Befragung erhielten 597 Teilnehmer je eine von 4 Fallvignetten.
Alle 4 Gruppen erhielten einen Text mit den Fakten, dass die FDA ein neues Medikament gegen Lungenkrebs zugelassen habe, dass bei der Hälfte der Probanden den Tumor vorübergehend verkleinert. Genannt wurden auch unerwünschte Wirkungen, wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Veränderung von Laborwerten.
• Gruppe 1 erhielt nur diese Fakten (Basisinformation)
• Gruppe 2 erhielt zusätzlich die Information, dass die FDA das Medikament als "aussichtsreich" (promising) bezeichnet hat
• Gruppe 3 erhielt zusätzliche die Information, dass die FDA das Medikament als "Durchbruch" (breakthrough) bezeichnet hat
• Gruppe 4 wurde wie Gruppe 3 mit dem Begriff "Durchbruch" konfrontiert und erhielt zusätzlich die (eher vorsichtig formulierte) Erklärung, dass damit eine Verbesserung des Überlebens oder eine Minderung der Krankheitssymptome nicht gesichert sei und die Aufrechterhaltung der vorläufigen Zulassung möglicherweise vom Ergebnis weiterer Studien abhänge.
• Gruppe 5 wurde wie Gruppe 3 mit dem Begriff "Durchbruch" konfrontiert und erhielt zusätzlich die deutlich Erklärung, dass die vorübergehende Verkleinerung des Tumors noch keine Verbesserung des Überlebens oder eine Minderung der Krankheitssymptome bedeute und die Aufrechterhaltung der vorläufigen Zulassung definitiv vom Ergebnis weiterer Studien abhänge.
Die Probanden gaben dann an auf einer Likert-Skala an, wie sie den Nutzen, die Schäden und die Stärke der Evidenz des Medikaments beurteilten.
Zusammenfassend erhöhten die Begriffe "breakthrough" und "promising" den Glauben an den Nutzen und an die Stärke der Evidenz, die Information über den nicht erwiesenen Patientennutzen minderte den Glauben.
Im Einzelnen:
Die Zusatzinformation "promising" oder "breakthrough" erhöhte den Anteil der positiven Bewertungen
• sehr oder vollständig effektiv: Basisinformation 11% / promising 23% / breakthrough 25%
• viel oder etwas effektiver als die bisher verfügbaren Medikamente: Basisinformation 69% / promising 78% / breakthrough 86%
• Evidenz stark oder sehr stark: Basisinformation 43% / promising 59% / breakthrough 63%
•
• würde das Medikament vielleicht oder sicher einnehmen: Basisinformation 72% / promising 84% / breakthrough 76%
Die Frage, ob bewiesen sei, dass das Medikament leben rette bejahten 31% aus der breakthrough-Gruppe, 16% aus der Gruppe mit zurückhaltend erklärender Information und 10% aus der Gruppe mit deutlich erklärender Information.
Fazit
Die Verwendung von Begriffen wie "vielversprechend" (promising) oder "Durchbruch" (breakthrough) weckt in einer Gruppe Gesunder falsche und überhöhte Vorstellungen über den Nutzen des mit einem dieser Begriffe bezeichneten Medikaments. Dies wirkt der Anforderung an informierte Entscheidung durch den Patienten entgegen und erscheint auch ethisch bedenklich, denn Patienten treffen Entscheidungen über Chemotherapie differenziert entsprechend der Toxizität und der zu erwartenden Lebensverlängerung.
Die Tendenz zu illusionären Erwartungen an die Effekte einer Chemotherapie wird so verstärkt. Es sei daran erinnert, dass die Mehrheit der Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs und Darmkrebs die Chemotherapie fälschlich als möglicherweise heilend einschätzen {(wir berichteten){http://forum-gesundheitspolitik.de/artikel/artikel.pl?artikel=2170}.
Krishnamurti T, Woloshin S, Schwartz LM, Fischhoff B: A randomized trial testing us food and drug administration "breakthrough" language. JAMA Internal Medicine 2015, 175(11):1856-1858 Volltext.
Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Eine amerikanische Studie ging der Frage nach, wie häufig neue Krebstherapien mit Superlativen beschrieben wurden. Die Autoren durchsuchten dafür Google news für den kurzen Zeitraum vom 21. bis 25. Juni 2015 mit dem Suchbegriff "cancer drug" in Verbindung mit den folgenden superlativen Begriffen: breakthrough, game changer, miracle, cure, home run, revolutionary, transformative, life saver, groundbreaking, marvel.
Sie fanden 94 Nachrichten aus 66 unterschiedlichen Nachrichtenquellen mit 97 Superlativen bezogen auf 36 bestimmte und 3 unbenannte Medikamente.
Unter den Therapieformen wurde die gezielte Therapie in 17 der 36 Artikel am häufigsten aufgegriffen, die zytotoxische Therapie bzw. Chemotherapie in 9 Artikeln, Checkpoint Inhibitoren in 5 Artikeln. 3 Artikel mit Superlativen bezogen sich auf Krebsimpfungen bzw. therapeutische Vakzine, einer auf Bestrahlungstherapie und einer auf Gentherapie.
Von den 97 Superlativen bezogen sich 39 auf eine gezielte Therapie, 37 auf einen Checkpoint-Inhibitor, 10 auf ein zytotoxisches Medikament, 5 auf eine Krebsimpfung, 3 nannten keine Therapieform, 2 auf eine Strahlentherapie, eine auf eine Gentherapie.
Von den 36 Substanzen hatten 18 bis Mitte Juli 2015 noch keine Zulassung von der Food and Drug Administration erhalten. Allein auf Grundlage von Tierversuchen, Zellkulturen oder präklinischer Forschung, also ohne Erkenntnisse aus Versuchen an Menschen, wurde 5 Substanzen mit einem Superlativ bedacht.
Die Superlative wurden 53 Journalisten, 26 Ärzten, 9 Industrievertretern, 8 Patienten und einem Kongressabgeordneten zugeschrieben. In der Mehrheit der Fälle wurde der Superlativ nicht vom Autor kommentiert.
Superlative wurden genauso häufig für zugelassene wie für nicht zugelassene Substanzen und für alle Arten von Krebstherapie gebraucht. Superlative erhielten auch Substanzen, wie z.B. Palbociclib und auch Krebsimpfungen, für die bisher keine Daten für einen Patientennutzen aus klinischen Studien vorliegt. Insgesamt wurden 5 Substanzen mit einem Superlativ vorgestellt, für die noch keinerlei Daten aus Studien an Menschen vorlagen.
Krebsmedikamente werden somit in der amerikanischen Öffentlichkeit häufig auf eine Weise dargestellt, dass die Leserinnen und Leser gefährdet sind, den Nutzen weit zu überschätzen, Risiken zu unterschätzen und falsche Hoffnungen zu entwickeln.
Dass eine entsprechende Studie in Deutschland ähnliche Ergebnisse erbringen könnte, zeigen die Ergebnisse bei Google News für die Eingabe der Begriffe "Krebstherapie" und "Durchbruch": zwischen dem 14.10. und 14.11.2015 finden sich 5 unkritische Berichte und 1 Bericht über die hier vorgestellte Studie. "Krebstherapie" und "Innovation" ergibt für denselben Zeitraum 14 Treffer.
Abola MV, Prasad V: THe use of superlatives in cancer research. JAMA Oncology 2015:1-2 Abstract
Serie Neue Krebsmedikamente
1 Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
2 Leichtfertige Zulassung in den USA Link
3 "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen
Link
4 Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - neue Krebstherapien werden in der amerikanischen Presse häufig mit Superlativen bezeichnet Link
5 folgt: Patientennutzen meistens gering Link
David Klemperer, 6.11.15
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA
 Den Zusammenhang von Surrogatendpunkten und patientenrelevanten Endpunkten von Krebsmedikamenten untersuchten Mitarbeiter des amerikanischen National Cancer Institute.
Den Zusammenhang von Surrogatendpunkten und patientenrelevanten Endpunkten von Krebsmedikamenten untersuchten Mitarbeiter des amerikanischen National Cancer Institute.
Surrogatendpunkte sind dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zufolge "Endpunkte, die selbst nicht von unmittelbarer Bedeutung für einen Patienten sind, aber mit patientenrelevanten Endpunkten assoziiert sind (zum Beispiel Senkung des Blutdrucks als Surrogatparameter für Vermeidung eines Schlaganfalls)".
Als wichtigster patientenrelevanter Endpunkt wird in der Onkologie die Überlebenszeit, also die Verbesserung der Prognose angesehen (overall survival). Ein gebräuchlicher Surrogatendpunkt in der Onkologie ist das Schrumpfen ("Ansprechen") des Tumors (auch wenn es nur vorübergehend ist), was in Studien als Ansprechrate (response rate) erfasst wird.
Ein weiterer Surrogatendpunkt bezieht sich auf die Zeit, in der die Krankheit nicht voranschreitet und wird als krankheitsfreies Überleben (progression-free survival) bezeichnet.
Surrogatendpunkte werden in vielen Fällen von Zulassungsbehörden als ausreichend für die Zulassung anerkannt. Die Klärung der Frage, ob z.B. das Schrumpfen des Tumors tatsächlich mit längerer Überlebenszeit einhergeht, muss jedoch in Studien geprüft werden, die beide Arten von Endpunkt untersuchen (s.a. IQWiG "Validierung von Surrogatendpunkten").
Die amerikanischen Autoren fanden in ihrer Recherche 36 Studien mit 65 Korrelationen zwischen Surrogatendpunkten und patientenrelevanten Endpunkten.
• 34 von 65 Korrelationen (52%) waren schwach.
• 16 von 65 (25%) waren von mittlerer Stärke
• 15 von 65 (23%) waren hoch korreliert.
Surrogatendpunkte lassen also in der Mehrzahl der Fälle keine Verbesserung der patientenrelevanten Endpunkte erwarten.
Die Autoren stellen daher in der Diskussion die verbreitete Praxis der Zulassung von Krebsmedikamenten auf Grundlage von Surrogatendpunkten infrage. Sie weisen auch darauf hin, dass sie zahlreiche Studien einschließen konnten, weil zur Analyse notwendige Daten nicht veröffentlicht waren und ihnen auch auf Anfrage nicht zur Verfügung gestellt wurden. Möglicherweise sind daher die dargestellten Ergebnisse positiver als die Wirklichkeit.
Weit überwiegend erscheint daher der Nutzen von Krebsmedikamenten, von denen man lediglich weiß, dass sie einen Tumor vorübergehend schrumpfen lassen oder sein Wachstum verzögern, sehr fraglich. Viele Patienten erhalten somit hochtoxische Medikamente, die ihnen höchstwahrscheinlich nicht nutzen. Dass diese Medikamente mit exorbitanten Preisen zu bezahlen sind, berichteteÜber die Preisgestaltung neuer Krebsmedikamente berichteten wir im Forum.
Es gibt Beispiele dafür, dass die Zulassung eines Medikaments erhalten bleibt, selbst wenn sich in weiteren Studien herausstellt, dass der patientenrelevante Endpunkt Überleben nicht verbessert wird, wie bei Bevacizumab/Avastin® bei metastasiertem Brustkrebs. Bevacizumab war aufgrund der Verlängerung des progessionsfreien Überlebens zugelassen worden, obwohl aus früheren Analysen bekannt war, dass dieses Kriterium kein verbessertes Überleben erwarten ließ.
Die Autoren belegen an einer Reihe weiterer Beispiele die Zulassung von Krebsmedikamenten in den USA auf Grundlage einer sehr schmalen Evidenzlage.
Einen Einblick darin, wie die Akteure in Deutschland denken und fühlen, geben die Vortragsfolien zur Veranstaltung "BfArM im Dialog: Gemeinsam Gesundheit gestalten - Strategie BfArM 2025", die hier herunterladbar sind.
Prasad V, Kim C, Burotto M, Vandross A: The strength of association between surrogate end points and survival in oncology: A systematic review of trial-level meta-analyses. JAMA Internal Medicine 2015 Abstract
Journalistische Beiträge in der Laienpresse dürften für Patienten, die Öffentlichkeit und auch für Investoren eine wichtige Informationsquelle darstellen mit größerer Reichweite als Fachzeitschriften-Beiträge. Die Art der Darstellung dürfte wesentlich dazu beitragen, wie eine Therapieform in der Öffentlichkeit bewertet wird.
Eine amerikanische Studie ging der Frage nach, wie häufig neue Krebstherapien mit Superlativen beschrieben wurden. Die Autoren durchsuchten dafür Google news für den kurzen Zeitraum vom 21. bis 25. Juni 2015 mit dem Suchbegriff "cancer drug" in Verbindung mit den folgenden superlativen Begriffen: breakthrough, game changer, miracle, cure, home run, revolutionary, transformative, life saver, groundbreaking, marvel.
Sie fanden 94 Nachrichten aus 66 unterschiedlichen Nachrichtenquellen mit 97 Superlativen bezogen auf 36 bestimmte und 3 unbenannte Medikamente.
Unter den Therapieformen wurde die gezielte Therapie in 17 der 36 Artikel am häufigsten aufgegriffen, die zytotoxische Therapie bzw. Chemotherapie in 9 Artikeln, Checkpoint Inhibitoren in 5 Artikeln. 3 Artikel mit Superlativen bezogen sich auf Krebsimpfungen bzw. therapeutische Vakzine, einer auf Bestrahlungstherapie und einer auf Gentherapie.
Von den 97 Superlativen bezogen sich 39 auf eine gezielte Therapie, 37 auf einen Checkpoint-Inhibitor, 10 auf ein zytotoxisches Medikament, 5 auf eine Krebsimpfung, 3 nannten keine Therapieform, 2 auf eine Strahlentherapie, eine auf eine Gentherapie.
Von den 36 Substanzen hatten 18 bis Mitte Juli 2015 noch keine Zulassung von der Food and Drug Administration erhalten. Allein auf Grundlage von Tierversuchen, Zellkulturen oder präklinischer Forschung, also ohne Erkenntnisse aus Versuchen an Menschen, wurde 5 Substanzen mit einem Superlativ bedacht.
Die Superlative wurden 53 Journalisten, 26 Ärzten, 9 Industrievertretern, 8 Patienten und einem Kongressabgeordneten zugeschrieben. In der Mehrheit der Fälle wurde der Superlativ nicht vom Autor kommentiert.
Superlative wurden genauso häufig für zugelassene wie für nicht zugelassene Substanzen und für alle Arten von Krebstherapie gebraucht. Superlative erhielten auch Substanzen, wie z.B. Palbociclib und auch Krebsimpfungen, für die bisher keine Daten für einen Patientennutzen aus klinischen Studien vorliegt. Insgesamt wurden 5 Substanzen mit einem Superlativ vorgestellt, für die noch keinerlei Daten aus Studien an Menschen vorlagen.
Krebsmedikamente werden somit in der amerikanischen Öffentlichkeit häufig auf eine Weise dargestellt, dass die Leserinnen und Leser gefährdet sind, den Nutzen weit zu überschätzen, Risiken zu unterschätzen und falsche Hoffnungen zu entwickeln.
Dass eine entsprechende Studie in Deutschland ähnliche Ergebnisse erbringen könnte, zeigen die Ergebnisse bei Google News für die Eingabe der Begriffe "Krebstherapie" und "Durchbruch": zwischen dem 14.10. und 14.11.2015 finden sich 5 unkritische Berichte und 1 Bericht über die hier vorgestellte Studie. "Krebstherapie" und "Innovation" ergibt für denselben Zeitraum 14 Treffer.
Abola MV, Prasad V: THe use of superlatives in cancer research. JAMA Oncology 2015:1-2 Abstract
Serie Neue Krebsmedikamente
1 Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
2 Leichtfertige Zulassung in den USA Link
3 "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen
Link
4 Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - neue Krebstherapien werden in der amerikanischen Presse häufig mit Superlativen bezeichnet Link
5 folgt: Patientennutzen meistens gering Link
David Klemperer, 6.11.15
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant
 Die Behandlung mit neuen Krebsmedikamenten kostet in den USA zumeist mehr als 100.000 Dollar pro Jahr. Zwei Mitarbeiter des National Cancer Institute der National Institutes of Health sind der Frage nachgegangen, ob der Preis mit wesentlichen Verbesserungen der Behandlungsergebnisse im Vergleich zu den vorher verfügbaren Medikamenten oder zumindest mit neuen Wirkmechanismen zusammenhängt, die einen pharmakologischen Fortschritt bedeuten.
Die Behandlung mit neuen Krebsmedikamenten kostet in den USA zumeist mehr als 100.000 Dollar pro Jahr. Zwei Mitarbeiter des National Cancer Institute der National Institutes of Health sind der Frage nachgegangen, ob der Preis mit wesentlichen Verbesserungen der Behandlungsergebnisse im Vergleich zu den vorher verfügbaren Medikamenten oder zumindest mit neuen Wirkmechanismen zusammenhängt, die einen pharmakologischen Fortschritt bedeuten.
Dafür wurden alle 51 Krebsmedikamente untersucht, die von Anfang 2009 bis Ende 2013 von der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde, der Food and Drug Administration, für 63 Indikationen zugelassen wurden. 21 Substanzen hatten einen neuartigen Wirkmechanismus, 30 hingegen einen bereits bekannten Wirkmechanismus ("me-too"-Arzneimittel oder "next-in-class drugs").
Die Preise für die 30 Substanzen mit bekanntem Wirkmechanismus lagen mit durchschnittlich 119.765 Dollar für eine 12-monatige Behandlung etwas höher als die Preise für 21 Substanzen mit neuem Wirkmechanismus, die im Durchschnitt 116.100 Dollar pro Jahr kosteten.
Die Zulassung erfolgte auf Grund der Erfüllung von mindestens einem von 3 Kriterien, die im Folgenden mit den durchschnittlichen Jahresbehandlungskosten genannt werden.
• Gesamtüberlebens (overall survival) 112.370 Dollar
• Ansprechrate (response rate) 137.952 Dollar
• progressionsfreie Überleben 102.677 Dollar
Anzumerken ist hier, dass sowohl eine Verbesserung der Ansprechrate als auch ein verlängertes progressionsfreies Überleben keine Verbesserung der Prognose garantieren und lediglich Surrogatendpunkte darstellen.
Surrogatendpunkte sind dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zufolge "Endpunkte, die selbst nicht von unmittelbarer Bedeutung für einen Patienten sind, aber mit patientenrelevanten Endpunkten assoziiert sind (zum Beispiel Senkung des Blutdrucks als Surrogatparameter für Vermeidung eines Schlaganfalls)".
Kein Zusammenhang bestand zwischen dem Ausmaß des Zusatznutzens (erfasst in progessionsfreiem Überleben oder Gesamtüberleben) und dem Preis.
Davon ausgehend, dass die Entwicklung von Substanzen mit neuartigem Wirkmechanismus aufwändiger ist, als die Modifikation einer vorhandenen Substanz, spiegeln sich im Preis also auch nicht die Entwicklungskosten.
Die Autoren gelangen zum Ergebnis, dass die derzeitige Preisfindung für neue Krebsmedikamente nicht rational sei sondern allein reflektiere, was der Markt hergibt.
Hier ist zu ergänzen, dass von einem Markt nicht gesprochen werden kann, weil neu zugelassene Substanzen unter Patentschutz stehen das damit verbundene Monopol alle Marktmechanismen außer Kraft setzt. Der Hersteller kann den Preis nach Belieben festlegen. Entwicklungskosten und Forschungskosten spielen offensichtlich eine nachgeordnete Rolle. Aus Sicht der Hersteller dürfte es durchaus rational sein, den höchstmöglichen Preis zu erzielen.
Aus Patientensicht ist es hingegen wenig rational, dass Medikamente aufgrund von Surrogatparametern zugelassen werden und es ungeklärt ist, ob sie ob sie überhaupt einen Nutzen für die Patienten haben.
Mailankody S, Prasad V. Five years of cancer drug approvals: Innovation, efficacy, and costs. JAMA Oncology 2015;1:539-40 Volltext
Serie Neue Krebsmedikamente
Neue Krebsmedikamente 1: Nutzen für Patienten fraglich, Preise exorbitant Link
Neue Krebsmedikamente 2: Leichtfertige Zulassung in den USA Link
Neue Krebsmedikamente 3: "Durchbruch" in der Therapie weckt falsche Hoffnungen Link
Neue Krebsmedikamente 4: Wunder, Revolutionen und Durchbrüche - Superlative in der amerikanischen Presse häufig Link
Neue Krebsmedikamente 5: Niedrige Zulassungshürden behindern Fortschritte in der Forschung Link
David Klemperer, 5.11.15
Viel Risiko, viel Aufklärung, wenig Wirkung - Sonnenschutz und Sonnenbankbesuche bei US-High-School-SchülerInnen 2001-2012
 Trotz jahre- oder jahrzehntelanger multimedialer Aufklärung über die Risiken mancher Verhaltensweisen und entsprechend "harter" Zahlen zur assoziierten Morbidität und Mortalität, gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass davon entweder wenig ankommt, wenig hängenbleibt, wenig verhaltensbestimmend wirkt und oftmals sogar erwünschte Verhaltensweisen abnehmen.
Trotz jahre- oder jahrzehntelanger multimedialer Aufklärung über die Risiken mancher Verhaltensweisen und entsprechend "harter" Zahlen zur assoziierten Morbidität und Mortalität, gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass davon entweder wenig ankommt, wenig hängenbleibt, wenig verhaltensbestimmend wirkt und oftmals sogar erwünschte Verhaltensweisen abnehmen.
Eine neue Studie aus den USA, die sich auf der Basis von Daten des repräsentativen "Youth Risk Behavior Surveillance System" mit der Nutzung von Sonnenschutz und dem Besuch von Sonnenbanken der Jugendlichen im High-School-Alter zwischen den Jahren 2001 und 2011 beschäftigte, also Jahre in denen vielfältige Berichte über die Hautkrebsrisiken langer ungeschützter Sonneneinstrahlung oder zu intensiver Nutzung von Sonnenbanken das Licht der Öffentlichkeit erblickten, kommt zu folgenden Ergebnissen:
• Der Anteil der Teeenager, die in den 12 Monaten vor der Befragung Sonnenschutz genutzt hatten, sank in dem Untersuchungszeitraum von 68% auf 56%. Mädchen oder junge Frauen schützten sich dabei mehr als junge Männer vor Sonneneinstrahlung.
• Der Anteil der Jugendlichen, die eine Sonnenbank besuchten, sank insgesamt von 16% im Jahr 2009 auf 13% im Jahr 2011. Dass dies aber immer noch weit überdurchschnittliche 29% aller weißen Frauen machten, zeigt die auch hier ungleiche Verteilung riskanter Verhaltensweisen und damnit die besonderen Herausforderungen für Aufklärungsaktionen.
Auch hier stellt sich die allgemeinere Frage nach der Wirksamkeit der Gesundheitserziehung in der heute üblichen Form oder die nach der möglicherweise notwendigen Daueraufklärung mit einem Hauch von permanenter Gesundheitserziehungsdiktatur. Dies ist auch für all diejenigen Akteure im Gesundheitssystem ein nachdenkenswertes Ergebnis, die "die Schule" als Hauptträgerin und -verantwortliche für ein nachhaltiges Gesundheitswissen oder "health literacy" und gesündere Verhaltensweisen betrachten.
Der Aufsatz Use of Sunscreen and Indoor Tanning Devices Among a Nationally Representative Sample of High School Students, 2001-2011 von Basch CH, Basch CE, Rajan S und Ruggles KV. ist im August 2014 in der Zeitschrift "Preventing Chronic Disease (11: E144) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.8.14
"Fettleibigkeits-Epidemie"? Prävalenz der Bauchfettleibigkeit von US-Kindern/Jugendlichen pendelt sich zwischen 2003 und 2012 ein!
 Die Beschäftigung mit dem Gewicht oder Übergewicht von Kindern und Jugendlichen und vor allem dessen Entwicklung ist wegen der vielfach belegten langfristigen Folgen von Übergewicht und Fettsucht im späteren Leben und deren möglichen Prävention wichtig. Umso sorgfältiger muss dies aber geschehen. Wie bereits die generelle Debatte über validere (Über-)Gewichts-Indikatoren (z.B. Bauchfettleibigkeit bzw. abdominale Adipositas) als dem "Body Mass Index (BMI)" und die spezielle Debatte über die Fehlmessungen von kindlichem Gewicht durch den BMI zeigt, gibt es hier noch kein Patentrezept für die Methodik. Umso vorsichtiger sollten also Trendaussagen und bisherige Prognosen zur Gewichtssituation bewertet werden, die bisherige Trends linear oder gar exponentiell fortschreiben.
Die Beschäftigung mit dem Gewicht oder Übergewicht von Kindern und Jugendlichen und vor allem dessen Entwicklung ist wegen der vielfach belegten langfristigen Folgen von Übergewicht und Fettsucht im späteren Leben und deren möglichen Prävention wichtig. Umso sorgfältiger muss dies aber geschehen. Wie bereits die generelle Debatte über validere (Über-)Gewichts-Indikatoren (z.B. Bauchfettleibigkeit bzw. abdominale Adipositas) als dem "Body Mass Index (BMI)" und die spezielle Debatte über die Fehlmessungen von kindlichem Gewicht durch den BMI zeigt, gibt es hier noch kein Patentrezept für die Methodik. Umso vorsichtiger sollten also Trendaussagen und bisherige Prognosen zur Gewichtssituation bewertet werden, die bisherige Trends linear oder gar exponentiell fortschreiben.
Was bei gründlichen Langzeituntersuchungen ausgewählter Indikatoren zur Gewichtssituation herauskommen kann, zeigt eine im Juli 2014 online veröffentlichte Studie über die Entwicklung der abdominalen Fettleibigkeit - also der so genannten "Schwimmring-Übergewichtigkeit" bei 16.601 zwei- bis achtzehnjährigen us-amerikanischen Kindern und Jugendlichen zwischen den Jahren 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 und 2011-2012. Diese Art der Fettleibigkeit wurde im "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)" mit zwei Indikatoren gemessen: dem Taillenumfang ("waist circumference"), wenn eine Person im neunzigsten Percentil des geschlechts- und altersspezifischen Wertes lag und dem Verhältnis von Taillenumfang zur Körpergröße ("waist-to-height"), wenn dieses ≥0,5 ist.
Das Ergebnis sah so aus:
• Zunächst referieren die Wissenschaftler bisherige Studien, die für den Zeitraum von 1988-94 bis 2003-2004 eine signifikante Zunahme der Taillenfettleibigkeit unter den US-Kindern und -Jugendlichen nachgewiesen hatten.
• 2011-12 waren nach dem Indikator Taillenumfang 17,95% der zwei bis 18 Jahre alten Kinder und Jugendlichen abdominal fettleibig. Nach dem Indikator Taillen-Körpergrößen-Indikator waren es 32,93% der sechs- bis achtzehnJährigen.
• Das wichtiste Ergebnis lautete aber: Die durchschnittliche Prävalenz beider Arten von Fettleibigkeit veränderte sich zwischen 2003-2004 und 2011-2012 praktisch nicht bzw. blieb auf dem erreichten Niveau - und zwar unabhängig vom Geschlecht, Alter und der ethnischen Zugehörigkeit.
• In der Altersgruppe der Zwei- bis Fünfjährigen nahm die Fettleibigkeit im Untersuchungszeitraum sogar signifikant ab.
Auch wenn das Problem übergewichtiger oder schwer fettleibiger Kinder und Jugendlichen in den USA immer noch herausfordernd umfangreich ist, mindert das Einpendeln der Prävalenz im letzten Jahrzehnt einen Teil der Dramatik der Debatten in Richtung Obesity-Epidemie. Wichtig ist dabei auch, durch weitere Forschung mehr über die Ursachen dieses empirischen Trends zu erfahren und dabei Hinweise zu bekommen, ob sich dieser Trend stabilisiert, die Abnahme in der jüngsten Altersgruppe anhält, der Effekt beim Älterwerden dieser Gruppe erhalten bleibt oder sogar eine Abnahme der Prävalenz in anderen Altersgruppen möglich ist.
Der Aufsatz Trends in Abdominal Obesity Among US Children and Adolescents von Bo Xi et al. ist am 21. Juli 2014 online von der Zeitschrift "Pediatrics" verlöffentlicht worden und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.8.14
Pro und Contra zur Politik der Legalisierung von Cannabis in den USA - Vorbild für Deutschland!?
 Während die meisten Politiker in Deutschland die empirischen Entscheidungen über den legalen Gebrauch von Cannabis fast vollkommen den Gerichten überlassen (zuletzt das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln über den unter vielen Einschränkungen legalen Anbau von Cannabis in Wohnungen von schwer kranken Personen, Überblick nicht Urteilstext), ist die Debatte in den USA wesentlich mehr durch politische Grundsatzdebatten, die Gesetzgebung in zahlreichen Bundesstaaten, durch weniger letztlich hemmenden Einschränkungen und durch Diskurse in prominenten Medien getragen. Dies verdient u.a. deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil die USA über viele Jahrzehnte mit dem für sie fundamentalistischen Furor den "war on drug" geführt haben und das Vorbild für die Drogenpolitik in vielen anderen Ländern war.
Während die meisten Politiker in Deutschland die empirischen Entscheidungen über den legalen Gebrauch von Cannabis fast vollkommen den Gerichten überlassen (zuletzt das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln über den unter vielen Einschränkungen legalen Anbau von Cannabis in Wohnungen von schwer kranken Personen, Überblick nicht Urteilstext), ist die Debatte in den USA wesentlich mehr durch politische Grundsatzdebatten, die Gesetzgebung in zahlreichen Bundesstaaten, durch weniger letztlich hemmenden Einschränkungen und durch Diskurse in prominenten Medien getragen. Dies verdient u.a. deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil die USA über viele Jahrzehnte mit dem für sie fundamentalistischen Furor den "war on drug" geführt haben und das Vorbild für die Drogenpolitik in vielen anderen Ländern war.
Im Moment leben 4% der US-Bevölkerung in Bundesstaaten, die den Gebrauch von Cannabis für medizinische Zwecke aber auch zum Zwecke der Erholung und der Verbesserung der Lebensqualität für 21-Jährige und Ältere legalisiert haben.
33% der Einwohner leben in Bundesstaaten, die den Gebrauch für medizinische Zwecke legalisierten und zusätzlich eine Reihe von Entkriminalisierungsregelungen beschlossen.
4% der Bevölkerung leben mit Bundesstaats-Gesetzen, die den Handel und Gebrauch systematisch entkriminalisieren.
35% können Cannabis für medizinische Zwecke und Cannabis mit geringem Wirkstoffgehalt legal erwerben und verwenden
Der Rest, also 24% der US-Bevölkerung, leben noch unter vollkommenen prohibitiven Cannabis-Gesetzen.
Das so genannte "legal patchwork" sieht anders betrachtet so aus: 37 US-Bundessstaaten plus der District of Columbia haben die Marijuana-Gesetze in irgendeiner Weise liberalisiert.
Im Rahmen der Einführung in eine Meinungsserie der "New York Times" forderten nun die Herausgeber der "New York Times" am 26. Juli 2014 unter der Überschrift "Repeal Prohibition, Again" unmissverständlich: "The federal government should repeal the ban on marijuana", und nehmen ausdrücklich auf die Zeit der Alkohol-Prohibition in den Jahren 1920-33 Bezug. Auch hier allerdings mit der Begrenzung auf 21-Jährige und Ältere.
Diese Einführung und zwei weitere, ebenfalls am 26. Juli veröffentlichten Artikel enthalten in leicht leserlicher Form eine Reihe von epidemiologischen und sozialpolitischen Argumenten für eine Legalisierung. Mit Beiträgen zu den Themenaspekten "Criminal Justice", "History", "Health", "Track Records" und "Regulation" wird die Serie in der Zeit vom 29. Juli bis zum 5. August 2014 fortgesetzt.
Der "Editorial Board"-Beitrag Repeal Prohibition, Again, der Beitrag Let States Decide on Marijuana von David Firestone und der Beitrag The Public Lightens Up About Weed von Juliet Lapidos sind kostenlos erhältlich. Dies dürfte für die weiteren Artikel der Serie auch gelten bzw. kann durch den Besuch der NYT-Website bis Anfang August einfach verifiziert werden.
Dass mit den engagiert vorgetragenen Argumenten der NYT-AutorInnen die weitere Legalisierung keineswegs schnell erfolgt und die bisherige nicht unumstritten ist, zeigt sich u.a. in mehreren ebenfalls 2014 erschienenen Beiträgen in der renommierten Medizinzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)". Diese befassen sich vor allem mit der Bewertung des durch Cannabis möglichen gesundheitlichen Schadens. Cannabis sei, so die NYT, "weitaus weniger gefährlich als Alkohol". Sie stützen sich zum Teil auch auf Erkenntnisse aus einem US-Bundesstaat mit Legalisierung.
So warnte ein kurzer Leserbeitrag in der Januarausgabe des NEJM vor der Verbreitung von Cannabisprodukten ("Black Mamba" "K2" oder "Spice") mit einem synthetischen Cannabinoid, das bis zuz 1.000-fach stärker sein kann als natürliche Wirkstoffe. So müssten zunehmend Patienten wegen der schweren gesundheitlichen Schädigungen durch diese Produkte behandelt werden.
Der Beitrag An Outbreak of Exposure to a Novel Synthetic Cannabinoid ist in am 23. Januar 2014 in NEJM (2014; 370: 389-390) erschienen und komplett kostenlos lesbar.
Ein am 5. Juni 2014 in derselben Zeitschrift erschienener Aufsatz von AutorInnen, die am "National Institute on Drug Abuse" der USA arbeiten, beschäftigt sich ausführlich mit der Evidenz positiver und unerwünschter Wirkungen des Konsums von Cannabis oder Marijuana. Als Bereiche von eher unerwünschten Cannabis-Effekte betrachten die AutorInnen die "brain development", die "possible role as gateway drug", "mental illness", "effect on school performance and lifetime achievement", "risk of motor-vehicle accidents" (Zunahme in dem erwähnten Bundesstaat) und "risk of cancer and other effects on health". Gesundheitlich positive Effekte sehen sie dagegen z.B. bei chronischen Schmerzen, Glaukoma, AIDS-Begleiterkrankungen, Entzündungen, multipler Sklerose und Epilepsie.
In ihren Schlussfolgerungen überwiegt eine Skepsis gegenüber der Legalisierung des Cannabiskonsums bzw. die Warnung vor bereits jetzt erkennbar überwiegenden unerwünschten Wirkungen: "As policy shifts toward legalization of marijuana, it is reasonable and probably prudent to hypothesize that its use will increase and that, by extension, so will the number of persons for whom there will be negative health consequences."
Der Aufsatz Adverse Health Effects of Marijuana Use von Nora D. Volkow et al. ist in NEJM (2014, 370: 2219-2227) erschienen. Leider ist nur ein kurzer Preview-Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.7.14
Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder wie entwickelt sich das Gesundheitsverhalten von jungen Menschen in den USA seit 1991?
 Der am 13. Juni 2014 veröffentlichte 172-seitige "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" mit den Ergebnissen des "Youth Risk Behavior Surveillance Report" lieferte eine Reihe interessanter Ergebnisse zum aktuellen Gesundheitsverhalten bzw. riskanten Gesundheitsverhalten der High-School-Generation und vor allem auch zu seiner Entwicklung seit Beginn dieser Art von Survey zu Beginn der 1990er Jahre. Die Ergebnisse zeigen außerdem die inhaltliche Relevanz von Längsschnittanalysen zur Fundierung der vielen Debatten über die vermeintlich schlechter werdende Gesundheit oder das nachlässigere Gesundheitsverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Der am 13. Juni 2014 veröffentlichte 172-seitige "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" mit den Ergebnissen des "Youth Risk Behavior Surveillance Report" lieferte eine Reihe interessanter Ergebnisse zum aktuellen Gesundheitsverhalten bzw. riskanten Gesundheitsverhalten der High-School-Generation und vor allem auch zu seiner Entwicklung seit Beginn dieser Art von Survey zu Beginn der 1990er Jahre. Die Ergebnisse zeigen außerdem die inhaltliche Relevanz von Längsschnittanalysen zur Fundierung der vielen Debatten über die vermeintlich schlechter werdende Gesundheit oder das nachlässigere Gesundheitsverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
In dem zweijährig durchgeführten Survey werden repräsentativ für die gesamte USA und zusätzlich für 42 Bundesstaaten und 21 große städtische Schulbezirke Antworten auf Fragen nach 104 gesundheitsriskanten Verhaltensweisen, dem Sexualverhalten, dem Übergewicht und Adipositas sowie zum Auftreten von Asthma veröffentlicht.
Zur Fülle der Ergebnisse gehörten 2013/14 u.a. folgende Daten:
• In den 30 Tagen vor der Befragung schrieben 41,4% der Befragten, die ein Fahrzeug führten während der Fahrt eine Mail oder andere Texte,
• 34,9% hatten im selben Zeitraum Alkohol getrunken,
• 15,7% hatten Tabakwaren geraucht und 8,8% rauchlosen Tabak konsumiert,
• 23,4% nahmen Marijuana zu sich,
• 14,8% wurden elektronisch belästigt,
• von den sexuell aktiven SchülerInnen benutzten 59,1% ein Kondom,
• 88% der jungen RadfahrerInnen trugen nie oder nur sehr selten einen Helm,
• in den 7 Tagen vor der Befragung hatten 5% der High-School-BesucherInnen weder Obst gegessen noch Fruchtsäfte getrunken und 6,6% hatten kein Gemüse gegessen.
Was erste Kommentatoren des Surveys titeln ließen "the good news and the bad" waren die unterschiedlichen Ergebnisse des Vergleichs der Prävalenz verschiedener dieser Verhaltensweisen in den Jahren 1991 und 2013. Dieser Vergleich zeigte u.a. folgende zum Teil unerwartete Veränderungen:
• Der Anteil der tabakrauchenden Teens sank von 28% auf 16%
• Der Anteil AlkoholtrinkerInnen nahm von 51% auf 35% ab
• Der Anteil der Teens, der in Prügeleien oder körperliche Kämpfe verwickelt war, sank von 43% auf 25%
• Nahezu die Hälfte der Befragten versuchten 2013 Gewicht abzunehmen oder hatten versucht, das Rauchen aufzugeben
• Trotz all dieser Verbesserungen stieg der Anteil der sich nach dem öffentlichen Verständnis ungesund verhaltenden MarijuananutzerInnen im betrachteten Zeitraum von 15% auf 23%.
Was an den auch hier hierzulande meist elanvoll vertretenen pessimistisch gestimmten Annahmen über die Tendenz des Gesundheitsverhalten der jüngeren und restlichen deutschen Bevölkerung dran ist, lässt sich wegen der umgekehrt proportionalen Vernachlässigung von Längsschnittsanalysen leider nicht sagen. Dass es sich völlig anders entwickelt haben sollte als in den USA, ist aber eher unwahrscheinlich.
Der komplette Bericht Youth Risk Behavior Surveillance - United States, 2013 von Laura Kann et al. (Surveillance Summaries, Vol. 63, No. 4) ist am 13. Juni 2014 erschienen und kostenlos erhältlich. Er enthält u.a. 100 Seiten Tabellen mit Angaben zur regionalen, geschlechtsspezifischen und ethnischen Häufigkeit des Gesundheitsverhaltens.
Mehr zu dem diesem Report zugrundeliegenden "Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)" erfährt man auf der Website der für dieses System und den Report verantwortlichen staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention".
Bernard Braun, 15.6.14
Ärzte enden nicht an der Spitze ihres Skalpells oder am Rezeptblock: das politische Verhalten der Ärzte in den USA 1991-2012
 Zu den Standardannahmen oder -Ausreden von Gesundheitspolitikern gehört, Ärzte könnten bestimmte gesundheitspolitische Initiativen durch ihre vielfältigen Kontakte zu Patienten und damit auch WahlbürgerInnen erfolgreich blockieren bzw. die Wahlchancen dieser Politiker gefährden und seien politisch mehrheitlich konservativ.
Zu den Standardannahmen oder -Ausreden von Gesundheitspolitikern gehört, Ärzte könnten bestimmte gesundheitspolitische Initiativen durch ihre vielfältigen Kontakte zu Patienten und damit auch WahlbürgerInnen erfolgreich blockieren bzw. die Wahlchancen dieser Politiker gefährden und seien politisch mehrheitlich konservativ.
Ob dies wirklich der Fall ist, lässt sich gerade in Deutschland mangels guter empirischer Untersuchungen nicht abschließend beurteilen. Dies gilt auch für die implizite Annahme, an konservativen und besitzstandswahrlerischen Einstellungen der Ärzte ändere sich nichts.
Dass sich hier aber im Laufe der Zeit erhebliche Änderungen vollziehen und welche Faktoren hieran beteiligt sein können, zeigt jetzt eine am 2. Juni 2014 veröffentlichte Studie über bestimmte Aspekte des politischen Verhaltens us-amerikanischer Ärzte zwischen 1991 und 2012. Untersucht wurden dabei die finanziellen Beiträge der Ärzte zu den Wahlkampagnen unterschiedlicher Politiker und Parteien im Rahmen von Präsidentschafts- und Kongresswahlen und die finanzielle Unterstützung von Partei-Gremien und so genannten "super political action committees (Super PACs)". Die zentrale Hypothese der ForscherInnen lautete, dass sich dieses Verhalten stark geändert habe, die Unterstützung der Republikaner abgenommen habe und dazu die Zunahme weiblicher Ärzte und die Abnahme von Solo-Arztpraxen beitrage.
Zu den wichtigsten empirischen Erkenntnissen gehören folgende:
• Die absolute Summe der finanziellen Unterstützung wuchs von 20 auf 189 Millionen US-Dollar (inflationsbereinigt 143,2 Mill.).
• Die Unterstützung leistete ein von 2,6% auf 9,4% wachsender Anteil aller Ärzte.
• Der Anteil der Ärzte, die bei verschiedenen Wahlen die Republikanische Partei finanziell unterstützte, stieg von rund 50% im Jahr 1991 auf den mit fast 75% höchsten Stand im Jahr 1996, sank bis 2008 auf knapp unter 50%, stieg 2010 wieder auf rund 58% und sank schließlich 2012 wieder bei etwas mehr als 50%. Der Anteil der Ärzte, welche die Demokratische Partei finanziell unterstützte, stieg im Untersuchungszeitraum entsprechend stark an.
• Über alle Jahre betrachtet unterstützten 57% der Ärzte und 31% der Ärztinnen die Republikaner.
• Gravierende Unterschiede des politischen Verhaltens zeigten sich auch noch zwischen Ärzten, die entweder in "for profit" oder in "nonprofit"-Einrichtungen arbeiteten: Von Ersteren unterstützten 2011/12 52,3%, von Letzteren 25,6% die Republikaner. Erheblich unterschieden sich auch Arztgruppen: Von den Chirurgen unterstützten 70,2% die Republikaner, von den Kinderärzten gerade einmal 22,1%. Diese Unterschiede waren 1991/92 deutlich geringer.
• Insgesamt unterstützten Ärzte mit höherem Einkommen wesentlich häufiger die Republikaner als ihre KollegInnen mit niedrigerem Einkommen.
• In einer Regressionsanalyse erwiesen sich das Geschlecht, die Profitorientierung, die Größe der Praxis und die Facharztqualifikation als signifikante Prädiktoren für die Unterstützung der Republikanischen Partei.
Bei den für diese Untersuchung genutzten Daten handelt es sich durchweg um Daten aus öffentlichen Quellen.
Der Aufsatz The Political Polarization of Physicians in the United States. An Analysis of Campaign Contributions to Federal Elections, 1991 Through 2012 von Adam Bonica et al. ist "online first" am 2. Juni 2014 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Kostenlos erhältlich ist ein Abstract.
Bernard Braun, 3.6.14
"Zu den gesundheitlichen Folgen weiterer Kriegseinsätze in aller Welt fragen Sie bereits heute Ihre amerikanischen Waffenbrüder"
 Es ist abzusehen, dass der Bundestag dem Antrag des Bundesaußenministers Steinmeier zustimmen wird, den Alt-Einsatz der Bundeswehr in dem sicherlich nicht weniger kriegerischer werdenden Afghanistan bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Und die Bundesverteidigungsministerin v.d. Leyen will die Bundeswehr durch vermehrte Einsätze in Afrika oder an anderen "Hindukuschs" dieser Welt nicht aus der Übung kommen lassen - sie bei den Entfernungen aber mit Sicherheit nicht familienfreundlicher machen. Damit sie nicht am Ende sagen können, sie hätten nichts über die sicheren Folgen solcher Einsätze gewusst, seien ihnen und natürlich auch den Gegnern solcher Einsätze die laufenden Veröffentlichungen aus den USA zu den unerwünschten Folgen solcher zum Teil völlig "assymmetrisch" geführter Kriegseinsätze unbedingt empfohlen.
Es ist abzusehen, dass der Bundestag dem Antrag des Bundesaußenministers Steinmeier zustimmen wird, den Alt-Einsatz der Bundeswehr in dem sicherlich nicht weniger kriegerischer werdenden Afghanistan bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Und die Bundesverteidigungsministerin v.d. Leyen will die Bundeswehr durch vermehrte Einsätze in Afrika oder an anderen "Hindukuschs" dieser Welt nicht aus der Übung kommen lassen - sie bei den Entfernungen aber mit Sicherheit nicht familienfreundlicher machen. Damit sie nicht am Ende sagen können, sie hätten nichts über die sicheren Folgen solcher Einsätze gewusst, seien ihnen und natürlich auch den Gegnern solcher Einsätze die laufenden Veröffentlichungen aus den USA zu den unerwünschten Folgen solcher zum Teil völlig "assymmetrisch" geführter Kriegseinsätze unbedingt empfohlen.
Dies gilt auch für den am 13. Februar 2014 u.a. durch das "Institute of Medicine" der USA erstellten und veröffentlichten Bericht über die mittel- bis langfristigen gesundheitlichen und sozialen Folgen der bisher vor allem in Afghanistan und im Irak durch improvisierte Sprengsätze ("improvised explosive devices (IEDS)") verursachten Sprengverwundungen. Rund 32.000 der insgesamt in diesen Kriegen gravierend verwundeten 50.500 US-Soldaten wurden dies durch Auswirkungen von unter Straßen, im Gelände oder in Autos versteckten Sprengsätzen. Die häufig durch anhaltende Schmerzen und Entstellungen bestimmten Sprengverletzungen erschweren nach Feststellungen der staatlichen US-Krankenversicherung "Veteran Affairs (VA)" die Rückkehr vieler SoldatInnen in ihr ziviles Leben bis zum heutigen Tag.
Der vorgelegte Bericht bewertet umfassend die Evidenz der in den letzten Jahren gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine Fülle von durch IEDS-Einwirkung bedingten allgemeinen und spezifischen gesundheitlichen Folgen. Gesicherte Evidenz für die unspezifischen Folgen überwiegt. Für viele spezifische und vor allem kausale Assoziationen gibt es noch keine ausreichende Anzahl von evidenten Belegen aus qualitativ hochwertigen Studien. Angesichts der absehbaren Zunahme derartig verletzten us-amerikanischen aber z.B. auch deutschen SoldatInnen empfehlen die US-Gutachter eine Fülle zusätzlicher Forschungsbemühungen. Deren Ergebnisse sollen die VA, die häufig um Krankenbehandlungskosten kämpfen müssenden Ex-Soldaten und andere Interessenten "provide … with knowledge that can be used to inform decisions on how to prevent blast injuries, how to diagnose them effectively, and how to manage, treat, and rehabilitate victims of battlefield traumas in the immediate aftermath of a blast and in the long term."
Der 230 Seiten umfassende Bericht Gulf War and Health, Volume 9: Long-Term Effects of Blast Exposures. des National Research Council ist über die genannte Website sowohl online zu lesen als auch nach einer unaufwändigen und soweit bekannt folgenlosen Anmeldung auch kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 13.2.14
Arbeitszeit für Krankenhausärzte senken und "alles gut"? Ein Trugschluss bei Assistenzärzten in den USA!
 Eine Verkürzung der Pflichtarbeitsstunden für Krankenhausärzte erscheint für ihren Schlafbedarf, ihr Wohlbefinden und ihre und die der Patienten Sicherheit so evident zu sein, dass es überflüssig erscheint, zu überprüfen, ob die kürzere Arbeitszeit auch zu den erwarteten Effekten führt.
Eine Verkürzung der Pflichtarbeitsstunden für Krankenhausärzte erscheint für ihren Schlafbedarf, ihr Wohlbefinden und ihre und die der Patienten Sicherheit so evident zu sein, dass es überflüssig erscheint, zu überprüfen, ob die kürzere Arbeitszeit auch zu den erwarteten Effekten führt.
Bei einer doch durchgeführten Untersuchung der tatsächlichen Folgen der im Jahr 2011 für im ersten Jahr an us-amerikanischen Krankenhäusern tätigen Assistenzärzten eingeführte Begrenzung der Pflichtarbeitsstunden, gab es aber unerwartete und keineswegs nur positive Ergebnisse. Die Studie untersuchte dafür eine Reihe von arbeitszeitassoziierten Ereignissen in einer Kohorte von 2.323 Assistenzärzten an 14 universitären und kommunalen Lehrkrankenhäusern im Zeitraum 2009 bis 2011/12.
Die Ergebnisse:
• Wie erwartet sank die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit signifikant von durchschnittlich 67 Stunden vor der Arbeitszeitreduzierung im Jahr 2011 auf 64,3 Stunden pro Woche nach der Reform.
• Trotz der abnehmenden Arbeitsstundenzahl gab es keine signifikanten Veränderungen bei den Schlafstunden. Die Schlafdauer stieg von 6,8 auf 7 Stunden.
• Auch die Häufigkeit depressiver Symptome oder das Wohlbefinden der Nutznießer dieser neuen Arbeitszeitregelung veränderte sich nach den Angaben der Assistenzärzte nur sehr gering und in keinem Fall signifikant.
• Was sich deutlich und signifikant veränderte und sogar zunahm war der Anteil von angehenden Ärzten, der sich Sorgen machte einen ernsthaften medizinischen Fehler zu begehen. Vor der Reform dachten dies 19,9% und nach der Reform 23,3% (p=0,007).
• Die Studienautoren bieten eine Reihe von Erklärungen an. So scheint z.B. die Anzahl von Assistenzärzten nicht parallel zur Senkung der Arbeitsstunden zugenommen zu haben, was zu einer Verdichtung der Arbeit führte. Zugenommen hat auch die Anzahl der Übergaben von Patienten an andere Ärzte, was u.U. wegen so genannter "stille-Post"-Effekte zu einer Zunahme medizinischer Fehler führte.
Auch wenn die Studie einige Limitationen aufweist (z.B. das übliche Problem, dass die Beteiligungsbereitschaft von Ärzten an derartigen Studien relativ gering ist oder auch die Grenzen der Selbstwahrnehmung der Effekte bei den befragten Ärzten), wird zweierlei klar: Auch dort wo jedermann fest zu wissen meint, welche Folgen eine Reform haben wird, sollten diese untersucht werden. Zweitens können die hier erwarteten positiven Effekte wie mehr Schlaf und besseres Wohlbefinden offensichtlich auch nicht nur durch eine Intervention entstehen, sondern bedürfen eines Bündels von Maßnahmen. Dazu gehören nach Meinung der Wissenschaftler dieser Studie auch noch zusätzliche Qualifikationen der Jungärzte und in jedem Fall auch direkte Verbesserungen der Patientenbehandlung und der Sicherheitskultur in den Krankenhäusern.
Ob diese unerwarteten Folgen einer Arbeitszeitverringerung auch bei berufserfahrenen Fach- oder Oberärzten auftreten oder gar nach der auch in Deutschland seit einiger Zeit verkürzten Arbeitszeit bei deutschen Assistenzärzten und ihren ausgebildeten Facharztkollegen, ist so nicht bekannt. Vielleicht führt eine entsprechende Studie bei deutschen Krankenhausärzten auch zu unerwarteten Ergebnissen!?
Der Aufsatz Effects of the 2011 duty hour reforms on interns and their patients: a prospective longitudinal cohort study. von Sen S, Kranzler HR, Didwania AK, Schwartz AC, Amarnath S, Kolars JC, Dalack GW, Nichols B und Guille C. ist am 22. April 2013 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen (173(8): 657-62). Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.9.13
Ein erhellender Nachtrag: Warum gibt es wenig Transparenz über die Folgen der Freiheit des Waffenbesitzes in den USA ?!
 Der eine oder andere Leser des kürzlich vorgestellten Forumbeitrags zu einer Studie über die Gewalterfahrungen von Waffenbesitzern in den USA mag gedacht haben, ein aktuellerer Aufsatz als der aus dem Jahr 2004 wäre besser gewesen.
Der eine oder andere Leser des kürzlich vorgestellten Forumbeitrags zu einer Studie über die Gewalterfahrungen von Waffenbesitzern in den USA mag gedacht haben, ein aktuellerer Aufsatz als der aus dem Jahr 2004 wäre besser gewesen.
Warum keine aktuellere Untersuchung vorgestellt wurde, liegt nicht daran, dass sie übersehen wurde, sondern an massiven Interventionen der US-Bundesregierung und den Gesetzen einiger Bundesstaaten der USA, kritische Untersuchungen mit allen Mitteln zu verhindern oder gar zu verbieten.
Ein am 13. Februar 2013 in der Zeitschrift "JAMA" veröffentlichter Beitrag macht diese über anderthalb Jahrzehnte gelungenen Versuche transparent, freie Forschung über die von privat verfügbaren Waffen ausgehende Gewalt zu behindern oder zu verbieten:
• 1997 strich die damalige US-Bundesregierung den staatlichen "Centers of disease control and prevention (CDC)" bzw. einer ihrer Fachabteilungen das Geld für die Erforschung von Waffenbesitz und Waffengewalt.
• Um was es den politisch Verantwortlichen dabei ging, formulierten sie völlig offen und klar in der Begründung des Gesetzes. In der Omnibus Consolidated Appropriations Bill. HR 3610, Pub L No. 104-208. heißt es wörtlich: "none of the funds made available for injury prevention and control at the Centers for Disease Control and Prevention may be used to advocate or promote gun control."
• Als dann eine Fall-Kontroll-Studie des ebenfalls staatlichen "National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism" im Jahr 2009 sich doch noch einmal mit der Waffengewalt beschäftigte, dauerte es nur zwei Jahre bis das 1997er-Verbot solcher Forschung auf die "National Institutes of Health (NIH)" ausgedehnt wurde.
• Die massive Einflussnahme auf die öffentliche Transparenz und damit auch Diskussion der Zusammenhänge von Waffenbesitz und Mord wie Selbstmord beschränkte sich aber nicht nur auf die Bundesebene. Bereits 1997 blockierte der Bundesstaat Washington nach der Veröffentlichung einer diese Daten nutzenden Studie per Gesetz den Zugang zu den Meldedaten über privaten Waffenbesitz. Solche Analysen können daher bis zum heutigen Tag zumindest in diesem Bundesstaat mangels Datenzugang nicht durchgeführt werden.
• In Florida und sieben weiteren Bundesstaaten gibt es seit 2011 Gesetze, die Ärzten und anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen unter Androhung von Strafen bis hin zum Entzug der Arbeitslizenz verbieten, über Waffensicherheit zu diskutieren oder entsprechende Daten zu sammeln und zu dokumentieren. Der Rechtsstreit über die Zulässigkeit solcher Drohungen oder Verbote ist bisher noch nicht entschieden.
Zu welcher problemfernen, tendenziösen bzw. an den Interessen der Waffenlobby orientierten Forschung und öffentlichen Debatte diese Palette von Verboten und Zugangsbarrieren führt, illustrieren die Autoren mit dem Hinweis, dass in den USA über die seit 1997 in Kampfhandlungen im Irak und in Afghanistan getöteten 4.586 amerikanischen SoldatInnen unverhältnismäßig mehr und intensiver debattiert wird als über die wenigstens 427.000 Personen, die im selben Zeitraum durch einen Waffenschuss getötet wurden, einschließlich 165.000 Mordopfern.
Der kurze Aufsatz Silencing the science on gun research von Kellermann AL und Rivara FP. ist in der Zeitschrift "JAMA" (309:549) und komplett kostenlos erhältlich. Dort gibt es eine Reihe Links auf weitere interessante Hintergrundtexte.
Der Aufsatz Investigating the Link Between Gun Possession and Gun Assault von Charles C. Branas, Therese S. Richmond, Dennis P. Culhane, Thomas R. Ten Have und Douglas J. Wiebe ist im Jahr 2009 im "American Journal of Public Health" (Vol. 99, No. 11, pp. 2034-2040) erschienen und ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.3.13
"All the prices are too damn high." Warum können viele US-BürgerInnen auch mit Obamacare ihre Arztrechnungen nicht bezahlen?
 Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP), der in den USA für die gesamte gesundheitliche Versorgung in Rechnung gestellt und zum großen aber schwindenden Teil auch bezahlt wird, war schon immer deutlich höher als in der Schweiz, Norwegen oder Deutschland. Er steuert im Moment stramm auf die 18% zu, statt wie in Deutschland zwischen 11% und 12% zu schwanken. Zur Erinnerung: Dies schließt hierzulande den seit Jahrzehnten stabil zwischen 6% und maximal 7% (und dies auch nur, weil das BIP vorübergehend stagnierte oder sogar leicht abnahm) liegenden Anteil der Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung und alle Leistungen des so genannten zweiten Gesundheitsmarktes (z.B. Wellnessangebote) am BIP ein.
Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP), der in den USA für die gesamte gesundheitliche Versorgung in Rechnung gestellt und zum großen aber schwindenden Teil auch bezahlt wird, war schon immer deutlich höher als in der Schweiz, Norwegen oder Deutschland. Er steuert im Moment stramm auf die 18% zu, statt wie in Deutschland zwischen 11% und 12% zu schwanken. Zur Erinnerung: Dies schließt hierzulande den seit Jahrzehnten stabil zwischen 6% und maximal 7% (und dies auch nur, weil das BIP vorübergehend stagnierte oder sogar leicht abnahm) liegenden Anteil der Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung und alle Leistungen des so genannten zweiten Gesundheitsmarktes (z.B. Wellnessangebote) am BIP ein.
Seit Jahren wird daher in den USA über die Gründe dieses Zustands diskutiert. Dies umso mehr als nach kurzer Hoffnung, das große Gesundheitsreformgesetz der Obama-Administration bzw. Obamacare würde auch hier gegensteuern, Einigkeit besteht, dass das Ausgabenniveau im US-Gesundheitssystem auch mit Obamacare nicht sinken, sondern sogar ceteris paribus noch weiter steigen wird.
Wodurch diese Situation entstand und welche Einflussfaktoren auch künftig das Niveau nach oben treiben werden, stellt nun ein "Special Report" des TIME-Magazins facettenreich und journalistisch-anschaulich auf 26 (Aus-)Druckseiten dar.
Im Schlussteil sieht der Autor des Reports zwei wesentliche Fehler der bisherigen Gesundheitspolitik ohne deren Beseitigung sich am Grundproblem nichts ändern wird. Erstens hätten die wesentlichen gesundheitspolitischen Akteure "enriched the labs, drug companies, medical device makers, hospital administrators and purveyors of CT scans, MRIs, canes and wheelchairs. Meanwhile, we've squeezed the doctors who don't own their own clinics, don't work as drug or device consultants or don't otherwise game a system that is so gameable." Und als zweites habe auch die kritische Öffentlichkeit den Nutznießern der ökonomisch prosperierenden "Gesundheitsversorgungsinsel" und "their lobbyists and allies (allowed) to control the debate."
Der Report liefert eine Menge Argumente dieses Debattenmonopol beenden zu können.
Was aber kompetente us-amerikanische Autoren selbst dann, wenn sie nicht dem traditionellen Irrglauben von der "socialised medicine" verfallen sind, immer noch nicht kapieren ist, dass das deutsche Gesundheitswesen kein "government-run health care system" ist.
Den am 20. Februar 2013 erschienenen TIME Special Report Bitter Pill: Why Medical Bills Are Killing Us von Steven Brill gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 28.2.13
USA: Risiko zu Hause ermordet zu werden oder sich selber umzubringen in Schusswaffen-Haushalten höher als in waffenfreien.
 Sowohl bei der "National Rifle Association (NRA)", dem militanten und äußerst einflussreichen Verband der Waffenbesitzer in den USA, als auch z.B. bei der ansonsten eher friedlich-ökologisch gestimmten Organisation "NaturalNews" (Tenor: "Beyond the emotion, here are the facts: As more guns are sold, violent crime goes down" und als Überblick), erfreut sich die Suggestivfrage "was wäre, wenn plötzlich jemand in ihrer Wohnung oder Schule stünde, und bewaffnet wäre", in vielen Varianten hoher Beliebtheit. In diesen Fällen eine "gute Waffe" zur Hand zu haben, so die Verteidiger des in den USA bisher verfassungsmäßigen Rechts, Waffen zu besitzen und zu tragen, könne man sich doch nicht verbieten lassen. Wie das Tauziehen zwischen der US-Bundesregierung und der breiten Pro-Waffenallianz dieses Mal ausgeht, wissen wir nicht.
Sowohl bei der "National Rifle Association (NRA)", dem militanten und äußerst einflussreichen Verband der Waffenbesitzer in den USA, als auch z.B. bei der ansonsten eher friedlich-ökologisch gestimmten Organisation "NaturalNews" (Tenor: "Beyond the emotion, here are the facts: As more guns are sold, violent crime goes down" und als Überblick), erfreut sich die Suggestivfrage "was wäre, wenn plötzlich jemand in ihrer Wohnung oder Schule stünde, und bewaffnet wäre", in vielen Varianten hoher Beliebtheit. In diesen Fällen eine "gute Waffe" zur Hand zu haben, so die Verteidiger des in den USA bisher verfassungsmäßigen Rechts, Waffen zu besitzen und zu tragen, könne man sich doch nicht verbieten lassen. Wie das Tauziehen zwischen der US-Bundesregierung und der breiten Pro-Waffenallianz dieses Mal ausgeht, wissen wir nicht.
Bekannt ist aber seit einer epidemiologischen Studie im Jahre 2004, dass häuslicher Waffenbesitz eher das Gewalt- und Sterberisiko ihrer Besitzer erhöht als es senkt. Mit Daten des "US mortality follow-back survey" untersuchten Wissenschaftler der "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)", ob zu Hause vorhandene Waffen das Risiko eines gewaltsamen Todes durch Mord oder Selbstmord erhöht und ob das Risiko vom Lagerort, dem Waffentyp oder der Anzahl der Waffen abhängig ist.
Die Ergebnisse sahen im Detail so aus:
• Die Personen mit häuslichem Waffenbesitz hatten gegenüber waffenfreien Personen ein um 90% höheres Risiko zu Hause ermordet zu werden (adjustierte Odds Ratio=1,9)
• Das Risiko dieses Personenkreises zu Hause mit einer Feuerwaffe ermordet zu werden, war ebenfalls deutlich erhöht (OR=3,5), allerdings variierte dieses Risiko nach dem Alter und danach, ob die betreffende Person alleine oder mit anderen Personen zusammenlebte.
• Männer in Haushalten mit Waffenbesitz hatten im Vergleich mit Männern aus waffenfreien Haushalten das rund zehnfache adjustierte Risiko auf irgendeine Art Selbstmord zu begehen. Bei Frauen war dieses Risiko "nur" etwas mehr als doppelt so hoch.
• Bei Personen, die eine Waffe in ihrem Haushalt hatten, war das Risiko eines Selbstmords mit einer Feuerwaffe sogar um das Einunddreißigfache höher als Selbstmorde mit anderen Methoden.
• Die Risiken mit Schusswaffen ermordet zu werden oder Selbstmord zu begehen war in "Waffenhaushalten" unabhängig vom Lagerort, der Waffenart oder der Anzahl der Schusswaffen deutlich höher als in "Nicht-Waffenhaushalten".
• Zusammenfassend halten die Epidemiologen eine "strong association between guns in the home and risk of suicide" fest und fanden ein Ermordungsrisiko, das sie im Vergleich aber als "more modest" charakterisieren. Ob es sich um kausale ZUsammenhänge handelt, kann die Studie aber nicht mit abschließender Sicherheit beantworten.
Die Autoren schließen ihre Studie mit einigen Hinweisen auf Grenzen ihrer Untersuchung und auf mögliche zusätzliche Einflussfaktoren. Ein wichtiger Hinweis ist der auf den Einfluss der Nachbarschaft oder des sozialen Klimas im Stadtteil. Außerdem erfassen sie nicht die Waffengewalt gegen sich selbst und gegen andere Personen außerhalb der häuslichen Umgebung. Die Mehrheit dieser Gewalttaten fand aber innerhalb der häuslichen vier Wände statt.
Der Aufsatz Guns in the Home and Risk of a Violent Death in the Home: Findings from a National Study von Linda L. Dahlberg, Robin M. Ikeda und Marcie-jo Kresnow ist im "American Journal of Epidemiology" (2004. 160 (10): 929-936) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.2.13
"Frauen, die wie Männer rauchen sterben auch wie Männer" - 50-Jahre-Trends der nikotinassoziierten Sterblichkeit nach Geschlecht
 Die zahlreichen Berichte über den Zusammenhang von Zigarettenrauchen mit diversen schweren Erkrankungen oder auch mit einer erhöhten Sterblichkeit, die plakativen Hinweise auf diese Zusammenhänge auf Zigarettenpackungen sowie die in einigen Verfahren vor US-Gerichten bekannt gewordenen vorsätzlich gesundheitsgefährdenden Vermarktungsstrategien der Tabakindustrie haben insbesondere in Westeuropa und den USA einen Teil der RaucherInnen aufhören lassen.
Die zahlreichen Berichte über den Zusammenhang von Zigarettenrauchen mit diversen schweren Erkrankungen oder auch mit einer erhöhten Sterblichkeit, die plakativen Hinweise auf diese Zusammenhänge auf Zigarettenpackungen sowie die in einigen Verfahren vor US-Gerichten bekannt gewordenen vorsätzlich gesundheitsgefährdenden Vermarktungsstrategien der Tabakindustrie haben insbesondere in Westeuropa und den USA einen Teil der RaucherInnen aufhören lassen.
Bei denjenigen, die nicht zu rauchen aufhören spielen falsche oder unklare Annahmen über die Entwicklung des Risikos, Fehleinschätzungen über die Risikoreduktion durch den Verzicht auf Rauchen und auch schlichtweg fehlende Daten eine Rolle.
Eine jetzt für die USA durchgeführte Analyse der Mortalitätstrends für bevölkerungsrepräsentative RaucherInnen, die in den Jahren 1959-1965, 1982-1988 und 2000-2010 bei einem Follow-up 55 Jahre und älter geworden waren, liefert wichtige Daten für eine Entscheidung mit dem Rauchen aufzuhören.
Die wichtigsten Erkenntnisse der ForscherInnen lauten:
• Das relative Risiko von aktuell rauchenden Frauen an Lungenkrebs zu sterben nahm in den drei untersuchten Zeiträumen und im Vergleich mit Frauen, die nie rauchten stetig zu, und zwar von 2,73 über 12,65 auf 25,66.
• Anders als manchmal vermutet gleicht sich das Lungensterblichkeitsrisiko der rauchenden Frauen innerhalb des Untersuchungszeitraums dem der rauchenden Männer an. Deren relatives Risiko nahm von 12,22 über 23,81 auf 24,97 zu.
• In der zuletzt untersuchten Kohorte der Jahre 2000 bis 2010 ähnelten sich auch die geschlechtsspezifischen Sterberisiken der Raucher für COPD (25,61 für Männer und 22,35 für Frauen), ischämische Herzerkrankung (2,50/2,86), jegliche Form von Schlaganfall (1,92/2,1) und die Kombination aller Sterbeursachen (2,8/2,76).
• Die Sterblichkeit an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) stieg bei männlichen Rauchern in den letzten Kohorten nahezu in allen Altersgruppen und innerhalb aller Dauerklassen sowie bei allen Intensitäten des Rauchens weiter an. Dies ist auch deshalb von großer Bedeutung weil dieses Risiko bei den Nie-Rauchern gleichzeitig deutlich gesunken ist.
• Bei den Männern im Alter von 55 bis 74 Jahren und den Frauen zwischen 60 und 74 Jahren war die Gesamtsterblichkeit wenigstens drei Mal so hoch wie bei den gleichaltrigen Nie-Rauchern.
• Aufzuhören mit dem Rauchen "at any age dramatically reduced death rates." Wer vor dem vierzigsten Lebensjahr aufhört, baut die erhöhten Sterblichkeitsrisiken im weiteren Lebensverlauf ständig und am Ende fast völlig ab. Diese Untersuchung bestätigt außerdem, dass das vollständige Aufhören mit Rauchen wesentlich wirksamer für die Reduktion von Risiken ist als eine Reduktion der Anzahl von Zigaretten. Um nicht als Plädoyer für risikofreies "Rauchen bis 40" missverstanden zu werden, merkt einer der Studienautoren an: "That's not to say; however, that it is safe to smoke until you are 40 and then stop. Former smokers still have a greater risk of dying sooner than people who never smoked. But the risk is small compared to the huge risk for those who continue to smoke."
Auch wenn diese Studie anders als die bisherigen RaucherInnenstudien (z.B. eine Untersuchung der RaucherInnen unter Pflegekräften) nicht nur relativ gesunde TeilnehmerInnen untersucht, räumen auch ihre VerfasserInnen ein, dass erst in künftigen Studien das Rauchverhalten und die Erkrankungs- wie Sterblichkeitsrisiken jüngerer Personen untersucht werden müsste.
Der materialreiche Aufsatz "50-Year Trends in Smoking-Related Mortality in the United States" von Michael J. Thun et al. ist am 24. Januar 2013 im "New England Journal of Medicine" (368: 351-36) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.2.13
Gewichtiges aus den USA: Kann das Übergewichtsproblem bei Kindern und Jugendlichen abnehmen, und wenn ja, warum?
 Egal, ob es sich um die Gesundheitsausgaben oder Erkrankungen handelt, kennt die Entwicklung und der öffentliche Diskurs scheinbar nur eine Richtung oder Dynamik: Teurer bis zur Unfinanzierbarkeit, explodierender Bedarf an mehr Therapien und Therapeuten und schlimmer. Dies gilt insbesondere für die so genannten Volkskrankheiten und in besonderem Maße für das Übergewicht und die Fettsüchtigkeit von Erwachsenen und Kinder wie Jugendlichen.
Egal, ob es sich um die Gesundheitsausgaben oder Erkrankungen handelt, kennt die Entwicklung und der öffentliche Diskurs scheinbar nur eine Richtung oder Dynamik: Teurer bis zur Unfinanzierbarkeit, explodierender Bedarf an mehr Therapien und Therapeuten und schlimmer. Dies gilt insbesondere für die so genannten Volkskrankheiten und in besonderem Maße für das Übergewicht und die Fettsüchtigkeit von Erwachsenen und Kinder wie Jugendlichen.
Dass dies nicht so sein muss und woran dies möglicherweise liegt, belegen eine Reihe jüngster empirischer Funde und Spuren in den USA.
Erinnert sei daran, dass in den USA nach Statistiken der staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention" rund 17% aller Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren fettsüchtig sind, d.h. rund 12.5 Millionen junger Personen. Der Anteil dieser Kinder und Jugendlichen hat sich in den letzten 30 Jahren in etwa verdreifacht.
Bereits im September 2012 hatte ein "Health Policy Snapshot" der Robert Wood Johnson Foundation zum Thema "Childhood Obesity" mit seiner Überschrift signalisiert, dass entgegen des jahre- oder jahrzehntelangen epidemiologischen Trends und der herrschenden Krankheitsdebatte in den USA Unerwartetes zu beobachten ist: "Declining childhood obesity rates—where are we seeing the most progress?".
Die Kernbotschaften lauteten:
• In den Großstädten New York und Philadelphia sowie in so unterschiedlichen Bundesstaaten Kalifornien und Mississippi sanken die Raten der übergewichtigen und fettsüchtigen Kinder und Jugendlichen zwischen 2007 und 2011 signifikant.
• Diese Entwicklung trat besonders dort auf wo umfassende individuelle und öffentliche (z.B. Restaurants, Schulen) Aktionen im Bereich Ernährung (z.B. Förderung von Lebensmittelläden mit Nahrungsmitteln aus der Region und Akzeptanz der in den USA von Millionen Menschen benötigten Lebensmittelmarken bei Bauern), körperliche Aktivitäten und Freizeitverhalten (z.B. Limitierung der Fernsehzeit in öffentlichen Kindertagesstätten) stattgefunden haben und dauerhaft installiert wurden.
• Trotz vieler Bemühungen gibt es aber in den USA weiterhin eine erhebliche sozioökonomische, ethnische oder regionale Ungleichverteilung der Übergewichtigkeit. Aber auch hier zeigen Einzelbeispiele wie das von Philadelphia, dass dies kein unabänderlicher Zustand ist.
• Richtig ist aber auch, dass in Bundesstaaten, in denen die "obesity rate" insgesamt sank, sie in 31 der 58 "counties" trotzdem anstieg.
Wie stark der Rückgang der Rate übergewichtiger Kinder und Jugendlichen ausfällt und ob sich der Trend bis 2012 fortsetzte, findet sich ausführlich in einem am 10. Dezember 2012 in der "New York Times" veröffentlichten Bericht:
• So wird z.B. am Beispiel New Yorks sowohl gezeigt, dass sich die Rate insgesamt verkleinert, als auch, dass das Sinken je nach Ethnie deutliche Unterschiede aufweist: Eine Studie, welche die Gewichtsentwicklung einer Gruppe von Kindern vom Kindergarten bis zur achten Schulklasse untersuchte, fand zwischen 2007 und 2011 eine Abnahme des Anteils übergewichtiger weißer Kinder um 12,5%, aber nur um 1,9% unter den schwarzen Kindern. Im Durchschnitt sank die Rate um 5,5%.
• In Philadelphia sinkt die Rate laut zitierter amtlicher Angaben auch von 2011 auf 2012 um 2,5% weiter.
• Die beschriebene Entwicklung findet sich schließlich nicht nur in den bisher genannten Großstädten, sondern z.B. auch in Los Angeles, Anchorage in Alaska oder der eher kleineren Stadt Kearney im Bundesstaat Nebraska.
Damit scheint sich etwas fortzusetzen, was bereits in einer Studie über die Entwicklung seit Ende der 1990er Jahre bis 2010 belegt wurde und worüber im "forum-gesundheitspolitik" unter dem Titel "Ja, wo explodieren sie denn?" - Cui bono oder Grenzen der Anbieter- "Epidemiologie" von Übergewicht und psychischen Krankheiten" Anfang 2012 berichtet wurde.
Der Artikel "Obesity in Young Is Seen as Falling in Several Cities" von Sabrina Tavernise in der New York Times vom 10. Dezember 2012, ist kostenlos erhältlich und enthält zahlreiche Links zu weiteren wissenschaftlichen Texten zum Problem.
Dazu gehört auch der Hinweis auf den umfangreichen Konsensus-Report des "Committee on Accelerating Progress in Obesity Prevention; Food and Nutrition Board" des "Institute of Medicine (IOM)" der USA. In dem Report "Accelerating Progress in Obesity Prevention: Solving the Weight of the Nation", herausgegeben von Dan Glickman, Lynn Parker, Leslie J. Sim, Heather Del Valle Cook und Emily Ann Miller, ist auf fast 500 Seiten dargestellt, welche Interventionen und vor allem welcher Mix von Interventionen in den USA für erfolgreich gehalten wird bzw. nach den hier zitierten Entwicklungen erfolgreich ist. Der Report ist kostenlos, wie seit einigen Monaten alle Reports des IOM, nach einer kurzen und seriösen Anmeldeprozedur erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.12
Ethisches für Ärzte und Nichtärzte in den USA und anderswo: 6. Ausgabe des "Ethics Manual" des "American College of Physicians"
 Wer sich für das Niveau, die Aktualität und die Form der Darstellung und Kommunikation über die Ethik medizinischen oder ärztlichen Verhaltens außerhalb Deutschlands oder auch als Alternative zum in Deutschland etablierten Ethik-System interessiert, kann sein Interesse am Beispiel des gerade zum sechsten Mal seit 1984 überarbeitet veröffentlichten "Ethics Manual" des "American College of Physicians" ausführlich befriedigen.
Wer sich für das Niveau, die Aktualität und die Form der Darstellung und Kommunikation über die Ethik medizinischen oder ärztlichen Verhaltens außerhalb Deutschlands oder auch als Alternative zum in Deutschland etablierten Ethik-System interessiert, kann sein Interesse am Beispiel des gerade zum sechsten Mal seit 1984 überarbeitet veröffentlichten "Ethics Manual" des "American College of Physicians" ausführlich befriedigen.
Während die "Zentrale Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten" bzw. die "Zentrale Ethikkommission" der Bundesärztekammer sich auf die Erarbeitung von aktuell 16, inhaltlich eigenständigen Stellungnahmen konzentrierte, versucht das US-Handbuch die Fülle der ethisch relevanten Fragen und Herausforderungen für Ärzte programmatisch in einem so leserfreundlich wie möglich gemachten Dokument zu klären. "Leserfreundlich" beginnt dabei beim Umfang, der mit 32 Seiten genauso groß ist wie allein die "Stellungnahme der Zentralen Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten (Zentrale Ethikkommission) bei der Bundesärztekammer zur Priorisierung medizinischer Leistungen im System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) - Langfassung aus dem Jahr 2007".
Die Liste der in der 2012-Ausgabe des US-Handbuchs neu oder ausführlicher behandelten Themen reicht von "Treatment without interpersonal contact", "Confidentiality and electronic health records", "Social media and online professionalism", "Surrogate decision making and end-of-life care", "pay-for-performance and professionalism", "Physician-industry relations" bis zu den zu beachtenden Standards von "Scientific publication" und den zu vermeidenden Interessenkonflikten von "Sponsored research".
Wer sich nicht also nur über die Arzt-Ethik-Standards in den USA informieren, sondern auch Anregungen für mögliche Inhalte und Formen der Sicherung ethischen Handelns von Ärzten hierzulande sammeln will, kann dies auf den kostenlos erhältlichen 32 Seiten des "American College of Physicians Ethics Manual. Sixth Edition" von Lois Snyder, JD et al. (Annals of Internal Medicine. 2012; vol. 156; Part 2: 73-104) beginnen.
Bernard Braun, 3.1.12
12 "Leading Health Indicators" für die Gesundheitsberichterstattung der USA bis 2020
 Seit 1979 gibt es in den USA die so genannte "Healthy People"-Initiative, die maßgeblich durch das "Department of Health and Human Services (HHS)", also das Bundesgesundheitsministerium der USA getragen wird. Im Kern dieser Initiative stehen eine Fülle von gesundheitsbezogenen Indikatoren, die jeweils für ein Jahrzehnt quantitative gesundheitspolitische Ziele vorgeben, deren Erreichen oder Nichterreichen am Ende des Jahrzehnts bilanziert wird. Die aktuelle Version des Programms, "Healthy People 2020", enthält fast 600 Indikatoren oder Sachbereiche, die von der Anzahl von Morden, über die Neuerkrankungen an Diabetes bis zu der Zahl von Rauchern reicht, die versuchen, das Rauchen aufzugeben. Die Einzelthemen lassen sich zu 42 Themenbereichen (z.B. Gesundheitsverhalten, Teilnahme an Screening oder Inanspruchnahme von "primary care") zusammenfassen. Insgesamt werden 1.200 einzelne Maßzahlen und Statistiken aufbereitet.
Seit 1979 gibt es in den USA die so genannte "Healthy People"-Initiative, die maßgeblich durch das "Department of Health and Human Services (HHS)", also das Bundesgesundheitsministerium der USA getragen wird. Im Kern dieser Initiative stehen eine Fülle von gesundheitsbezogenen Indikatoren, die jeweils für ein Jahrzehnt quantitative gesundheitspolitische Ziele vorgeben, deren Erreichen oder Nichterreichen am Ende des Jahrzehnts bilanziert wird. Die aktuelle Version des Programms, "Healthy People 2020", enthält fast 600 Indikatoren oder Sachbereiche, die von der Anzahl von Morden, über die Neuerkrankungen an Diabetes bis zu der Zahl von Rauchern reicht, die versuchen, das Rauchen aufzugeben. Die Einzelthemen lassen sich zu 42 Themenbereichen (z.B. Gesundheitsverhalten, Teilnahme an Screening oder Inanspruchnahme von "primary care") zusammenfassen. Insgesamt werden 1.200 einzelne Maßzahlen und Statistiken aufbereitet.
Darüber, ob die Festlegung auf das Erreichen spezifizierter und quantitifizierter Gesundheitsziele von Nutzen ist, und ob die Ziele erreicht wurden oder nicht, gibt es z.B. über das Erreichen der Zielgrößen des "Healthy People 2010" unterschiedliche Bewertungen. Während das HHS meint, 71% aller Ziele seiren erreicht worden, bemängeln Kritiker, dass dies auch daran liege, dass das Erreichen der Ziele oft nur ein minimaler oder marginaler Fortschritt bedeutete.
Um die Bedeutung der "Healthy People"-Initiative mehr zu popularisieren und übersichtlicher zu machen, hat das HHS jetzt einen Katalog von 12 gesundheitsrelevanten sozialen Sachverhalten mit insgesamt 26 Indikatoren, so genannte "Leading Health Indicators" vorgestellt, deren Entwicklung bis 2020 regelmäßig ermittelt und veröffentlicht werden soll. Zu den 12 Sachverhalten zählen der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, die Präventionsangebote, die Umweltqualität, das Thema Verletzungen und Gewalt, Mütter- und Kindergesundheit, psychische Gesundheit, Ernährung, körperliche Aktivität und Fettleibigkeit, reproduktive und sexuelle Gesundheit, Abusus mit legalen und illegalen Drogen und das Tabakrauchen. Eine Innovation stellt für die Gesundheitsberichterstattung der USA die Aufnahme der Zahngesundheit und der sozialen Determinanten dar.
Bevor man zu diskutieren beginnt, ob z.B. das Problemfeld der sozialen Determinanten von Gesundheit allein durch die Anzahl der Studenten angezeigt werden kann, die mindestens 4 Jahre studiert haben und dies mit einem Diplom abgeschliossen haben, sollte abgewartet werden, wie die angekündigten Zwischenberichte aussehen und was die übersichtlichere Zahl von Indikatoren politisch und gesellschaftlich bewegt.
Mehr über die Inhalte und Methodik der "Leading Health Indicators" ist auf der entsprechenden Website zu erfahren.
Bernard Braun, 1.11.11
Was müde Maultiere mit Strafzahlungen der pharmazeutischen Industrie in Milliardenhöhe zu tun haben
 Lahme Gäule, müde Maultiere, defekte Gewehre, verdorbene Lebensmittel - skrupellose Händler betrogen die Nordstaatenarmee im Sezessionskrieg (1861-1865) auf jede nur erdenkliche Weise. Der "False Claim Act" (FCA) von 1863 sollte den Betrügern Einhalt gebieten. Durch dieses Bundesgesetz haften seitdem Personen und Firmen, welche den Staat durch falsche Behauptungen oder falsche Angaben finanziell schädigen. Ein bis heute wichtiger Aspekt ist das Recht von Privatpersonen, ihnen bekannte Fälle von Betrug zur Anklage zu bringen und dafür einen Teil der Schadenssumme als Belohnung zu erhalten ("whistleblower").
Lahme Gäule, müde Maultiere, defekte Gewehre, verdorbene Lebensmittel - skrupellose Händler betrogen die Nordstaatenarmee im Sezessionskrieg (1861-1865) auf jede nur erdenkliche Weise. Der "False Claim Act" (FCA) von 1863 sollte den Betrügern Einhalt gebieten. Durch dieses Bundesgesetz haften seitdem Personen und Firmen, welche den Staat durch falsche Behauptungen oder falsche Angaben finanziell schädigen. Ein bis heute wichtiger Aspekt ist das Recht von Privatpersonen, ihnen bekannte Fälle von Betrug zur Anklage zu bringen und dafür einen Teil der Schadenssumme als Belohnung zu erhalten ("whistleblower").
Wie in einer Studie in den Archives of Internal Medicine berichtet, mussten pharmazeutische Firmen im Zeitraum von 1996 bis 2010 in 31 Strafverfahren im Rahmen des FCA insgesamt 12 Mrd. Dollar als Strafe und zum Vergleich an die Bundesregierung und die Bundesstaaten zahlen.
Zumeist handelte es sich um Vergehen gegen die Marketing-Regeln, wie Off-Label-Marketing, betrügerisches Marketing, falsche Bezeichnungen von Chargen und betrügerische Preisauszeichnungen.
Den höchsten Betrag - 2,3 Mrd. Dollar - musste die Firma Pfizer 2009 im Zusammenhang mit der Vermarktung des inzwischen vom Markt genommenen Rheumamittels Bextra (Substanz Valdecoxib) zahlen wegen falscher Bezeichnung (misbranding), illegalem Marketing und der Zahlung von Bestechungsgeldern (kickbacks) an Ärzte. Wirklich weh getan hat Pfizer diese Summe bei einem weltweiten Jahresumsatz von 55,6 Mrd. Dollar im Jahr 2010 (IMS Health, Top 20 Global Corporations 2010) wohl eher nicht.
Den zweithöchsten Betrag - 1,4 Mrd. Dollar - zahlte Eli Lilly 2009 wegen der Off-Label-Vermarktung des Antipsychotikums Zyprexa (Substanz: Olanzapin). Zyprexa ist für die Behandlung der Bipolaren Störung und der Schizophrenie zugelassen. Eli Lilly bekannte sich des Versuchs schuldig, Ärzten gegenüber Werbung betrieben zu haben für den off-label-Einsatz bei Kindern und auch bei alten Menschen - bei Letzteren z.B. für die Behandlung von Demenz, Depression, Angst, Schlafproblemen und Verhaltensproblemen, insbesondere bei Bewohnern von Pflegeheimen. Die Strafzahlung von 515 Mio. Dollar war die höchste bis dahin jemals verhängte Zahlung (Department of Justice 2009).
Unter den wegen Betrugs verurteilten pharmazeutischen Firmen sind alle großen Namen vertreten einige sogar mehrfach.
Die vollständige Liste findet sich in der Studie, deren Volltext leider nicht frei zugänglich ist.
Qureshi ZP, Sartor O, Xirasagar S, Liu Y, Bennett CL. Pharmaceutical Fraud and Abuse in the United States, 1996-2010. Arch Intern Med 2011;171(16):1503-06
Link zu den ersten 150 Wörtern der Studie
Larry D. Lahman. Bad Mules. A Primer on the Federal False Claims Act. Link
Department of Justice. Presseerklärung 15.1.2009: Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa Link
New York Times 2.9.2009. Pfizer Pays $2.3 Billion to Settle Marketing Case Link
David Klemperer, 28.10.11
Geburtenraten sinken in wirtschaftlich schlechten Zeiten signifikant: Zufall oder kausaler Zusammenhang?
 Was die Kausalität dieses Zusammenhangs angeht, wird sie fast so oft wie ein enger Zusammenhang sichtbar wird, aus methodischen Gründen bestritten.
Was die Kausalität dieses Zusammenhangs angeht, wird sie fast so oft wie ein enger Zusammenhang sichtbar wird, aus methodischen Gründen bestritten.
Eine am 12. Oktober 2011 für alle 50 Bundesstaaten der USA und Washington D.C. mit den Daten des "National Center for Health Statistics" und des "Census Bureau" durchgeführte Analyse des PEW Research Centers, legt nun nicht nur erneut Geburtenzahlen vor, die sich exakt parallel zur Entwicklung der wirtschaftlichen Rezession in den USA verändern, sondern untermauert die Zusammenhänge auch noch durch eine Reihe differenzierterer Analysen.
Zunächst die generelle Entwicklung: In den USA gab es auch bereits in der Vergangenheit starke Assoziationen zwischen wirtschaftlichen Krisenphasen und sinkender Geburtenrate: Die Rate sank zum Beispiel zwischen 1926 und 1936, also der Zeit der Weltwirtschaftskrise, um 26%. Aktuell sank die Geburtenrate von einem Geburtenhoch von 69,6 Geburten auf 1.000 Frauen im wirtschaftlich guten Jahr 2007 auf 64,7 Geburten pro 1.000 Frauen im Rezessionsjahr 2010. In absoluten Zahlen heißt dies, dass trotz eines gleichzeitigen Zuwachses der Bevölkerung die Anzahl der geborenen Kinder von 4,32 Millionen auf 4,01 Millionen sank.
Einen möglichen Zusammenhang von Krise und Geburtenrate untermauert die Verfasserin der Analyse u.a. mit zwei differenzierten Analysen:
• Erstens stieg in den wenigen Bundesstaaten, die wie North Dakota bessere wirtschaftliche Eckdaten aufwiesen, die Geburtenrate sogar noch oder stagnierte nur. In den am stärksten von der Wirtschaftskrise betroffenen Bundesstaaten, wie z.B. Arizona, gab es dagegen mit 7,2% auch die stärkste Abnahme der Rate.
• Zweitens fiel die Geburtenrate in den Bevölkerungsgruppen am stärksten, deren Einkommens- oder Arbeitsplatzverluste am stärksten ausfielen: Die so genannten "Hispanics" verloren zwischen 2005 und 2009 einerseits durchschnittlich 66% ihres Vermögens. Andererseits war die Abnahme ihrer Geburtenrate zwischen 2008 und 2009 mit 5,9% am höchsten. In der schwarzen Bevölkerung der USA betrug die Abnahme 2,4%, in der weißen Bevölkerung dagegen 1,6%.
• Die Tatsache, dass die Geburtenrate in allen Altersgruppen außer bei den 40- bis 44-jährigen Frauen sank, wertet die Verfasserin als Beleg dafür, dass sich hinter der sinkenden Geburtenrate nicht prinzipielles Desinteresse an Kindern verbirgt, sondern die Frauen und ihre Familie nur auf wirtschaftlich bessere Zeiten warten wollen - wenn ihnen nicht die Zeit der Gebärfähigkeit davon läuft.
Die 15 Seiten umfassende Studie In a Down Economy, Fewer Births von Gretchen Livingston ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.10.11
Welche Rolle spielen Recht und Evidenz im Gesundheitswesen der USA? Mehr als man denkt!
 Wer Verrechtlichung im deutschen Gesundheitswesen angesichts der immer dicker werdenden Sozialgesetzbücher, Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses und der Normen sonstiger "kleiner" und "großer" Gesetzgeber für ein typisch deutsches Phänomen hält, irrt.
Wer Verrechtlichung im deutschen Gesundheitswesen angesichts der immer dicker werdenden Sozialgesetzbücher, Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses und der Normen sonstiger "kleiner" und "großer" Gesetzgeber für ein typisch deutsches Phänomen hält, irrt.
Auch und gerade "public health" wird selbst in angeblich weniger regulierten, freiheitlicheren und marktlicher orientierten Staaten wie den USA intensiv durch Gesetze, Verordnungen und rigide Standards reguliert. Wie detailliert dies erfolgt ließ sich nicht zuletzt an dem großen Gesetz zur Reform der us-amerikanischen Versicherungs- und Versorgungslandschaft, dem "Affordable Care Act" ablesen.
Einen guten Überblick über das insgesamt für den Bereich öffentlicher Gesundheit in den USA geltende Recht verschafft jetzt ein Report des "Committee on Public Health Strategies to improve Health" beim "Institute of Medicine (IOM)" der "Nationalen Akademie der Wissenschaften" der USA.
Der Report beschäftigt sich nach Klärung der Frage "why law and why now" mit dem Zusammenhang/-spiel von Recht und Public Health-Infrastruktur und der Bedeutung von Recht als Tool für die Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der intersektoralen Aktion der zahlreichen öffentlichen und privaten Einrichtungen und "stakeholder" im Gesundheitswesen und den dafür relevanten Rechtsbestimmungen.
Abschließend enthält der Report 10 Empfehlungen, die zum Teil auch für die weitere Entwicklung der Regulierung durch Recht und Politik im deutschen Gesundheitswesen interessant sind. So führt z.B. die neunte Empfehlung zur evidence-based public policy or politics aus "that state and federal governments evaluate the health effects and costs of major lefgislation, regulations, and policies that could habe a meaningful impact on health. This evaluation should occur before and after enactment."
Wer die mühselige und immer verspätete Entwicklung der Politikfolgenforschung in Deutschland erlebt, kann hier erkennen, dass es bei der Forderung nach mehr Gesundheitspolitik-Begleitforschung in Deutschland um den Anschluss an andernorts wesentlich entwickeltere Debatten und Planungen geht.
Der 154 Seiten umfassende Report "For the Public's Health: Revitalizing Law and Policy to meet new challenges" ist gerade erschienen und komplett kostenlos nach einer etwas komplizierten aber folgenfreien Anmeldung zum Download erhältlich.
Wer sich noch mehr für weitere Publikationen interessiert, die zu Gesundheits- und Systemfragen in der "National Academies Press" erschienen sind, kann seit drei Wochen praktisch alle Titel nach der bereits erwähnten Anmeldung kostenlos herunterladen. Dies gilt z.B. auch für die älteren IOM-Klassiker zur Versorgungsqualität im US-Gesundheitssystem "Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century" aus dem Jahr 2001 und "To Err Is Human: Building a Safer Health System" aus dem Jahr 2000 oder eine aktuelle Studie aus 2011 zur "The Future of Nursing: Leading Change, Advancing Health".
Bernard Braun, 5.7.11
USA: Wie der rein kommerzielle Verkauf von Rezeptdaten an die Pharmaindustrie zum Verfassungsrecht auf "freie Rede" wird.
 Am 26. Mai 2011 warnten drei Herausgeber des renommierten "New England Journal of Medicine" davor, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel der Redefreiheit die patient- und arztbezogene Aufbereitung von Rezeptinformationen durch so genannte "data mining"-Firmen für die Vertriebsinteressen der Pharmaindustrie (dem so genannten "detailing") für zulässig erklärt. Dem Rechtsstreit lag ein Gesetz des Bundesstaates Vermont zugrunde, das die Weitergabe derartiger Daten für diese kommerziellen Zwecke (ausdrücklich aber nicht für Forschungszwecke) verboten hatte und sich positive Effekte zur Senkung der Arzneimittelausgaben und Sicherung der Arzneimittelsicherheit erhofft hatte.
Am 26. Mai 2011 warnten drei Herausgeber des renommierten "New England Journal of Medicine" davor, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel der Redefreiheit die patient- und arztbezogene Aufbereitung von Rezeptinformationen durch so genannte "data mining"-Firmen für die Vertriebsinteressen der Pharmaindustrie (dem so genannten "detailing") für zulässig erklärt. Dem Rechtsstreit lag ein Gesetz des Bundesstaates Vermont zugrunde, das die Weitergabe derartiger Daten für diese kommerziellen Zwecke (ausdrücklich aber nicht für Forschungszwecke) verboten hatte und sich positive Effekte zur Senkung der Arzneimittelausgaben und Sicherung der Arzneimittelsicherheit erhofft hatte.
Der Datenhandel läuft so, dass sämtliche Rezeptdaten, die bei Apotheken zusammenlaufen, also Informationen über die Art und Menge von Verordnungen, der Arztname und soziodemografische Angaben zum Patienten, von diesen an Firmen weiterverkauft werden, die diese Daten so aufbereiten, dass sie von den Außendienstmitarbeitern der Pharmaunternehmen für die Direktwerbung oder die wie auch immer geartete Einflussnahme auf das Verordnungsverhalten einzelner Ärzte genutzt werden können. Zur Aufbereitung gehören patient- wie arztbezogene Verschreibungsgeschichten. Durch die Kenntnis des konkreten Arztes können die "data mining"-Firmen dem Verkaufsdatensatz durch einen Link zum Masterfile der "American Medical Association" (AMA) u.a. auch noch Informationen über die Ausbildung des Arztes und Praxisdetails hinzufügen. Das Ganze gleicht also einer Art Marketing-"Schlaraffenland" für die Pharmaindustrie, das die Empfänger der Rezepte, ohne dass sie einen Nutzen davon haben, letztlich über die Medikamentenpreise bezahlen.
Gegen das Gesetz, das dies zumindest Vermont verboten hatte, klagte u.a. die auch in Deutschland aktive Firma IMS Health. Sie sah in ihm eine Einschränkung der mit dem First Amendement zur US-Verfassung zum unverzichtbaren Kern der Verfassung gezählten Redefreiheit.
Die NEJM-Herausgeber wiesen dagegen sehr darauf hin, dass es hier nicht um den Schutz eines Verfassungsrecht geht, sondern um schlichte Geschäftemacherei ohne jeglichen Verfassungsrang: "As medical journal editors committed to the open communication of medical knowledge, we are strong proponents of First Amendment protection for speakers who attempt to communicate important evidence-based health information or advocate for patients and physicians' rights. But, the doctor-patient relationship is a sacred trust, and the sale of physicians' confidential prescribing information puts pa-tients' highly private medical information at risk. Why should this information be sold to data-mining and drug companies as a commodity, when it offers no benefit to patients and their physicians? This undesirable practice is nothing more than commercial conduct — not speech — and it is not in the best interest of the health of the American people." Sie wiesen ferner darauf hin, dass überhaupt nur 3% der Ärzte eine der wenigen Möglichkeiten kennt, einen Teil ihrer sie identifizierenden Daten zu verbergen oder nicht weitergeben zu lassen.
Trotz dieser und ähnlicher Einwände erklärte der "Supreme Court" am 23. Juni 2011 mit eine rMehrheit von sechs zu drei Stimmen das Gesetz zu einem Verstoß gegen die in der US-Verfassung durch den ersten Zusatz verankerte und auch sehr hoch geachtete Redefreiheit. Damit haben die Apotheken, die "data mining"-Unternehmen und die Pharmaunternehmen auch in Vermont wieder alle Freiheiten über die Daten von Ärzten und PatientInnen miteinander "zu reden" und brauchen auch nicht zu fürchten, dass andere Bundesstaaten das Gesetz übernehmen. Zugleich wurde damit zum ersten Mal in einem demokratischen Land die Vorbereitung und die Abwicklung rein kommerzieller und zum Teil auch qualitativ fragwürdiger Geschäfte zu einem schützenswerten Verfassungsgut höchstrichterlich aufgehübscht und gegen praktische Kritik immunisiert. Fragwürdig meint z.B. die nicht selten an Drückermethoden erinnernden "Beratungstätigkeiten" von Pharmavertretern bei den mittels dieser Daten identifizierten ärztlichen Wenigverordnern von Medikamenten.
Sieht man sich, sensibilisiert durch den Rechtsstreit in den USA an, was die deutsche Dependanz der Firma IMS Health an Dienstleistungen vor allem für die hiesigen "detailer" der Pharmaindustrie anbietet, fällt die geringe Transparenz über die Gewinnung der dazu genutzten Daten auf.
IMS bietet beispielsweise folgende Leistungen an:
• "Sales Optimization: Die IMS Sales Optimization Lösungen schaffen regionale Transparenz über die Vertriebs- und Verschreibungsaktivitäten in allen wichtigen Distributionskanälen. Damit können sowohl Führungskräfte in Vertrieb und Marketing als auch die einzelnen Außendienstmitarbeiter Potenziale und Ziele besser erkennen und ihre Aktivitäten auf einer verlässlichen Basis planen und kontrollieren."
• Das Leistungspaket "IMS Disease Analyzer liefert retrospektive Analysen tatsächlicher Therapie- und Krankheitsverläufe auf Patientenebene in deutschen Arzt-Praxen. Die erhobenen Daten erlauben eine Verknüpfung zwischen Arzt, Patient, Diagnose und Therapie. IMS Disease Analyzer bietet Entscheidungshilfen zu Fragen in allen Phasen des Produktlebenszyklus und unterstützt eine optimierte Produktpositionierung und Potenzialbestimmung. Als Datenquelle dienen Patientenkonsultations-Daten aus Praxiscomputern von mehr als 1.000 deutschen Arztpraxen (internationale Daten aus 3 weiteren europäischen Ländern stehen zusätzlich zur Verfügung). Insgesamt liegen Informationen zu mehr als 8 Mio. Patienten mit über 100 Mio. Verordnungen über einen Zeitraum von 12 Jahre vor."
Hier stellt sich die Frage, ob es sich nicht um Daten handelt, die primär für andere Zwecke und vor allem auf Kosten der Krankenversicherten generiert und gesammelt wurden. Mit Sicherheit werden diese Daten also nicht deshalb produziert, damit sie Firmen wie IMS wie auch immer aufbereitet weiterverkaufen können und dabei keinen erkennbaren substantiellen Nutzen für Patienten und Ärzte verfolgen.
Das 53 Seiten-Urteil des Supreme Court of the United States ist kostenlos erhältlich. Lohnenswert zu lesen sind sowohl das Mehrheits- als auch das Minderheitsvotum der mehrheitlich von den beiden Bush-Administrationen berufenen obersten Bundesrichter.
Bernard Braun, 24.6.11
Gläubig und/oder gesund oder wie weit sind die Kirchenführer von der Empfängnisverhütungspraxis ihrer Gläubigen entfernt?
 Egal ob sich "Pillen-Paul", "unser Papst" oder Teile der besonders in den USA ideologisch und politisch einflussreichen evangelikalen Sekten äußerten und äußern: Empfängnisverhütung durch Kontrazeptiva oder anderen hormonellen Methoden, eine Intrauterin-Spirale oder Sterilisation galt und gilt als mehr oder weniger offen gebrandmarkte Sünde für katholische aber auch eine Reihe protestantischer oder evangelikaler Gläubigen. Ginge es nach den Sexual- und Geburtsexperten in der vatikanischen Glaubenshierarchie sind die einzigen religiös zulässigen Methoden der Empfängnisplanung die meist unzuverlässigen natürlichen Mittel wie beispielsweise die Knaus-Ogino-Methode.
Egal ob sich "Pillen-Paul", "unser Papst" oder Teile der besonders in den USA ideologisch und politisch einflussreichen evangelikalen Sekten äußerten und äußern: Empfängnisverhütung durch Kontrazeptiva oder anderen hormonellen Methoden, eine Intrauterin-Spirale oder Sterilisation galt und gilt als mehr oder weniger offen gebrandmarkte Sünde für katholische aber auch eine Reihe protestantischer oder evangelikaler Gläubigen. Ginge es nach den Sexual- und Geburtsexperten in der vatikanischen Glaubenshierarchie sind die einzigen religiös zulässigen Methoden der Empfängnisplanung die meist unzuverlässigen natürlichen Mittel wie beispielsweise die Knaus-Ogino-Methode.
Egal ob es aber um das empirieresistente rigorose Verbot der präventiv sinnvollen und notwendigen Nutzung von Kondomen für die Bevölkerung im HIV/AIDS-bedrohten Afrika geht oder um die Verhinderung der meist ungewollten und sozialpolitisch seit Billy Clinton Sozialreformen schlecht abgepufferten Frühstschwangerschaften us-amerikanischer High-School-Schülerinnen, weiß man relativ wenig darüber, ob sich die gläubigen Frauen und ihre Männer von den Verboten überhaupt angesprochen fühlen und wie ihre Empfängnisverhütung wirklich aussieht.
Die 2006-2008 im Rahmen des "National Survey of Family Growth (NSFG)" des "National Center for Health Statistics" der USA durchgeführte gezielte Befragung von 7.356 nach eigenen Angaben aktiv religiösen Frauen zwischen 15 und 44 Jahren nach ihrer Nutzung von künstlichen empfängnisverhütenden Mitteln, zeigt daher zum ersten Mal, dass deren Einsatz in den USA die breite Norm und nicht die Ausnahme ist:
• Die Mehrheit der sexuell aktiven Frauen, die nicht gegen ihren Willen schwanger werden will, nutzt vorrangig künstliche kontrazeptive Methoden: 33% lassen sich sterilisieren, 31% nehmen die Anti-Baby-Pille oder setzen eine andere hormonelle Methode ein und 5% haben sich eine Intrauterin-Spirale einsetzen lassen.
• Selbst unter den verheirateten katholischen Frauen praktizieren in den USA nur 3% eine so genannte natürliche Empfängnisverhütung.
• Das Nebeneinander von strenger und praktizierter Religiosität samt entsprechenden Überzeugungen sowie künstlicher Empfängnisverhütung ist also im Alltag der Gläubigen keineswegs unversöhnlich oder zumindest nach den Ergebnissen dieser Studie nicht offensichtlich ethisch belastend.
Was leider in der Befragung nicht geklärt wird ist, wie sich die gegen die Gebote ihrer Glaubensführer empfängnisverhütenden Frauen und Männer bei ihrem "sündigen Tun" fühlen und ob ihr persönlicher Widerstand möglicherweise unerwünschte Folgen für ihre mentale oder psychische Gesundheit hat.
Mehr über die Ergebnisse der Befragung enthält der achtseitige Report "Countering Conventional Wisdom: New Evidence on Religion and Contraceptive Use von Jones RK and Dreweke J vom Guttmacher Institute, der im April 2011 erschienen und kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 30.4.11
"Wall Street Journal" vs. "American Medical Association": Wie viel verdienen US-Ärzte an der Behandlung von Medicare-Versicherten?
 Die stramm marktwirtschaftlich orientierte Tageszeitung "The Wall Street Journal" hatte im Verlaufe des Jahres 2010 verschiedene Artikel veröffentlicht, die auf der Basis von offen zugänglichen Daten der staatlichen steuerfinanzierten Rentner-Krankenversicherung "Medicare" zahlreiche Unwirtschaftlichkeiten, Betrugspraktiken und ausschließlich einkommensmaximierende Honorarpraktiken von Ärzten belegen konnten.
Die stramm marktwirtschaftlich orientierte Tageszeitung "The Wall Street Journal" hatte im Verlaufe des Jahres 2010 verschiedene Artikel veröffentlicht, die auf der Basis von offen zugänglichen Daten der staatlichen steuerfinanzierten Rentner-Krankenversicherung "Medicare" zahlreiche Unwirtschaftlichkeiten, Betrugspraktiken und ausschließlich einkommensmaximierende Honorarpraktiken von Ärzten belegen konnten.
Eine grundsätzliche Schlussfolgerung lautete, künftig routinemäßig und personenbezogen die Medicare-Einkünfte aller Ärzte veröffentlichen zu wollen.
Bereits 1979 hatte das Gesundheitsministerium der USA eine Liste der Ärzte veröffentlicht, die mehr als 100.000 US-Dollar für die Behandlung von Medicare-Versicherten erhielten. Als es auch die Einnahmen der anderen Ärzte veröffentlichen wollte, wehrten sich Ärzte und ihre Verbände vor einem Gericht im Bundesstaat Florida erfolgreich gegen diese Absicht. Dieses wertete das Recht auf den Schutz der Privatsphäre und der Einkommen höher als das Recht der Steuer- oder Beitragszahler zu erfahren, was mit ihrem Geld passiere.
Nachdem zwischenzeitlich Mitglieder des Obersten Bundesgerichts der USA betonten, dieses Recht auf Privatsphäre hätte keineswegs einen unverrückbaren verfassungsrechtlichen Rang, reichte der Verlag der Zeitung vor dem U.S. District Court for the Middle District of Florida Anfang 2011 eine Klage ein, die Veröffentlichung aller Ärzteeinkünfte aus Medicare für rechtlich zulässig zu erklären.
Während sich staatliche Stellen bis zu einer Entscheidung des Gerichts zurückhalten wollen, sind erneut die Ärzteverbände massiv gegen jede weitere Transparenz. Ärzte würden jetzt schon genug durch die Medicare-Verwaltung und 23 weitere Qualitätssicherungs-Institutionen kontrolliert. Die Daten seien nicht sonderlich aussagekräftig, unvollständig und könnten zu Fehlschlüssen führen. Keine Antwort geben die Vertreter der "American Medical Association (AMA)" aber auf die simple Klagebegründung der Zeitungsvertreter: "The Medicare system is funded by taxpayers, and yet taxpayers are blocked from seeing how their money is spent."
Ob und wie der Versuch ausgeht, die ansonsten ja immer auf mehr Markt und Wettbewerb und deren Beitrag zu mehr Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Qualität pochenden Ärzte zu mehr Einkommenstransparenz zu motivieren oder zu zwingen, verdient weiter beobachtet zu werden.
Wer jemals in Diskussionen über die Einkünfte von niedergelassenen Ärzten in Deutschland erlebt hat, wie sämtliche amtlichen oder selbst von Ärztevereinigungen genannten Beträge von allen anwesenden Ärzten ins Reich der Phantasie oder des Sozialneids verwiesen wurden, kann die USA nur um die praktische Konsequenz ihrer führenden Wirtschafts-Tageszeitung beneiden. Unabhängig davon, dass die Rechtslage in Deutschland es nicht so einfach erlaubt, stellt sich aber zumindest die Frage warum die aufwändig und letztlich mit Versichertengeldern erhobenenen Finanzdaten nicht als eine Quelle für mehr Transparenz diskutiert und vielleicht demnächst auch genutzt werden!?
Den Artikel, der sich mit der Klageerhebung befasst, "Journal Files Suit to Open Medicare Database" im Wall Street Journal vom 26. Januar 2011 kann man kostenlos herunterladen. Dort befinden sich auch Links zu den einzelnen Artikeln, die belegen können, dass und wie wichtig mehr Transparenz über die Finanzierung von Ärzten u.a. aus den Medicare-Kassen ist.
Bernard Braun, 31.1.11
Auf niedrigem Niveau weiter fallend: Die öffentliche Reputation der Pharmaindustrie in den USA im Jahr 2009.
 Über die Art und Weise wie viele Pharmahersteller in der Öffentlichkeit agieren berichten mittlerweile eine Vielzahl von Medien - darunter auch das Forum-Gesundheitspolitik - regelmäßig. Dies gilt auch und vor allem für die Transparenz über ihre Methoden auch nutzlose, gesundheitsgefährdende oder überteuerte Arzneimittel auf den Markt zu bringen und dort so lange wie profitabel zu halten.
Über die Art und Weise wie viele Pharmahersteller in der Öffentlichkeit agieren berichten mittlerweile eine Vielzahl von Medien - darunter auch das Forum-Gesundheitspolitik - regelmäßig. Dies gilt auch und vor allem für die Transparenz über ihre Methoden auch nutzlose, gesundheitsgefährdende oder überteuerte Arzneimittel auf den Markt zu bringen und dort so lange wie profitabel zu halten.
Wie jetzt der aktuelle, elfte "Annual Reputation Quotient" des Meinungsforschungsinstituts "Harris interactive" für das Jahr 2009 zeigt, wirkt sich das Verhalten der Arzneimittelhersteller zumindest in den USA auch immer stärker auf das Ansehen der Branche und ihrer größten Vertreter aus.
Im RQ wurden 29.963 US-BürgerInnen nach ihrer Bewertung von 20 Attributen mit jeweils mehreren Unterpunkten gefragt, die als Komponenten von Reputation angesehen werden: vision & leadership, social responsibility, emotional appeal, products & services, workplace environment und financial performance. Aus den Antworten wird ein sogenannter RQ-Score gebildet. Der maximale Wert des Scores kann 100 Punkte betragen. Die Befragten müssen zuerst angeben, welche Unternehmen ihnen im Zusammenhang mit Reputation überhaupt einfallen und dann für diese die Reputationsfragen beantworten.
Die wichtigsten Ergebnisse im Jahr 2009 lauteten:
• Unter den 60 Unternehmen mit dem höchsten Reputationswert gibt es ein einziges Pharmaunternehmen, die Firma Pfizer. Mit 69 Punkten liegt sie auf Platz 40 der Rangliste, an deren Spitze mit jeweils über 80 Punkten Firmen wie Google oder Intel liegen.
• Die gesamte Branche erreicht 2009 29 Punkte. Noch weniger Reputationspunkte erreichen nur noch Fluggesellschaften, Versicherungs- und Finanzdienstleister (16) oder das fast ewige Schlusslicht, die Tabakindustrie mit 11 Punkten. Im Vergleich mit 2008 ist die Pharmaindustrie die einzige Branche, deren Reputation sinkt, und zwar um 2 Punkte.
Auch wenn selbst diese Resonanz in der Öffentlichkeit die Pharmaindustrie wenig beeindrucken dürfte, kann ihre geringe Reputation der interessierten Öffentlichkeit nicht völlig egal sein. Möglicherweise ist damit nämlich auch ein Verfall des Vertrauens in die Produkte der Branche verknüpft ist, die nützlich sind und bei denen es aber auch auf eine maximale Therapietreue ankommt. Die offensichtlich weitverbreiteten negativen Assoziationen, wenn es um Pharmahersteller und ihre Produkte geht, können diese beeinträchtigen.
Wer mehr über die Methode des RQ und die weiteren Ergebnisse wissen will, kann sich die knapp 30 Seiten umfassende Zusammenfassung des "Annual RQ. 2009 Summary Report. A survey of the U.S. General pubic using the reputation quo-tient" kostenlos herunterladen.
Dass es auch in Deutschland erhebliche Vertrauensdefizite gegenüber der Pharma-Industrie gibt, hatte eine repräsentative Bevölkerungsumfrage im Jahr 2009 gezeigt: Arzneimittel-Information: Deutsche haben ähnliche Vorbehalte gegenüber der Pharma-Industrie wie US-Bürger
Bernard Braun, 8.11.10
"Wirtschaftliche Krise gleich sinkende Lebenserwartung - das ist so!" Kontraintuitives aus der Zeit der "Großen Depression"
 Wirtschaftliche Krise oder Depression gleich sinkende Einkommen, steigende Langzeit-Arbeitslosigkeit, Verlust an sozialer Perspektive und gesellschaftlicher Inklusion, anwachsende Morbidität und schließlich eine spürbare Verringerung der Lebenserwartung durch Selbstmord oder sonstige Mortalität so oder so ähnlich sehen Prognosen zu den Folgen heftiger ökonomischer Krisen aus.
Wirtschaftliche Krise oder Depression gleich sinkende Einkommen, steigende Langzeit-Arbeitslosigkeit, Verlust an sozialer Perspektive und gesellschaftlicher Inklusion, anwachsende Morbidität und schließlich eine spürbare Verringerung der Lebenserwartung durch Selbstmord oder sonstige Mortalität so oder so ähnlich sehen Prognosen zu den Folgen heftiger ökonomischer Krisen aus.
Die Finanzkrise der Jahre 2008ff. und die ökonomischen Folgen des "historischen" Renditemaximierungsspiels der europäischen und anderen Banken, Anleger und Spekulanten auf dem Rücken der griechischen aber auch eines Teils der EU-Bevölkerung, könnten also in Kürze große Spuren bei der Morbidität und Mortalität der Bevölkerungen vieler EU-Staaten und Staaten Nordamerikas hinterlassen.
Dass dies stimmt und/oder zwangsläufig so eintritt, lässt sich aber nach einer von zwei us-amerikanischen Sozialökonomen und -epidemiologen im September 2009 online veröffentlichen fundierten Studie über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 1920 und 1940 und dabei besonders der so genannten "Great Depression" in den 1930er Jahren auf die Lebenserwartung der damaligen US-Bevölkerung, bezweifeln.
Zu den wesentlichen Ergebnisse einer für den Zeitraum vom Anfang der 1920er bis zum Ende der 1930er Jahre durchgeführten Zusammenhangsanalyse gehört nämlich:
• "Life expectancy generally increased throughout the period of study. However, it oscillated substantially throughout the 1920s and 1930s with important drops in 1923, 1926, 1928-1929, and 1936 coinciding with strong economic expansions. During the Great Depression, it rose from 57.1 in 1929 to 63.3 years in 1933. The rates of infant mortality and age-specific mortality for all age groups under 20 years generally declined during the 1920s and 1930s. Superimposed on this general declining trend, peaks in both infant mortality and mortality for children aged 1-4, 5-9, 10-14, and 15-19 were observed in the years 1923, 1926, 1928-1929, and 1934-1936. These peaks all coincide with periods of strong economic growth."
• Entgegen allen Erwartungen verschlechterte sich also vor allem die gesundheitliche Situation und das Sterberisiko immer dann, wenn es zu Wirtschaftswachstum kam und verbesserte sich umgekehrt in den Jahren wirtschaftlicher und sozialer Depression.
• Dies gilt mit Ausnahme der Sterblichkeit durch Selbstmord, die während der Zeit der "Großen Depression" zunahm, aber insgesamt "nur" 2 % der Gesamtsterblichkeit umfasst.
• Und noch mal ausdrücklich bezogen auf die Phase der "Großen Depression" zwischen 1930 und 1934: "Population health did not decline and indeed generally improved during the 4 years of the Great Depression, 1930-1933, with mortality decreasing for almost all ages, and life expectancy increasing by several years in males, females, whites, and nonwhites."
• Schließlich:: "Population health did not decline and indeed generally improved during the 4 years of the Great Depression, 1930-1933, with mortality decreasing for almost all ages, and life expectancy increasing by several years in males, females, whites, and nonwhites."
Obwohl also große Rezessionen, und die Krise der Jahre 1930-34 gehört zu den größten, "periods of pessimism, shrinking revenues, and social malaise" sind, erklären sich die Forscher die unerwartete Nichtwirkung all dieser Bedingungen mit anderen sozialen Mechanismen, die mögliche negative Wirkungen von Krisen auf die Gesundheit und die Lebenserwartung (über-)kompensieren und sich umgekehrt in Zeiten wirtschaftlicher Erholung negativ auf die Gesundheit und Lebenserwartung auswirken (z.B. zunehmende Luftverschmutzung, mehr Verkehrsunfälle). Welche Faktoren aber im Einzelnen zu den unerwarteten Wirkungen führen, bleibt ungeklärt.
Eine durchaus naheliegende Erklärung, wirtschaftliche Krisen- und Wachstumsbedingungen wirkten sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf Gesundheitsbedingungen aus, halten die Wissenschaftler für den von ihnen untersuchten Zeitraum nicht für stichhaltig oder nur marginal bedeutsam. So sinkt zwar z.B. im ersten Boomjahr 1936, d.h. vier Jahre nach dem Beginn der "Großen Depression" die Lebenserwartung drastisch, um sich aber 1937 gleich wieder kräftig zu verbessern.
Geht man weiter davon aus, dass wirtschaftliche Krisen einen negativen Einfluss auf die soziale Lebenslage großer Teile der Bevölkerungen und damit auf deren Gesundheit und Lebenserwartung haben, hat die genauere Erforschung der fördernden und hemmenden Bedingungen eine enorme wirtschafts- und sozialpolitische Bedeutung.
Dazu braucht man sich noch nicht einmal mit der Empirie der 1930er Jahre in den USA oder in Deutschland auseinandersetzen (die Qualität mancher damaliger Statistik z.B. über die Arbeitslosigkeit ist schlecht), sondern findet mit der Finanzkrise der letzten drei Jahre und ihren Folgen genügend aktuelle Empirie.
Die 6 Seiten der Studie "Life and death during the Great Depression" von Jose´ A. Tapia Granados und Ana V. Diez Roux sind als Beitrag in den renommierten "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)" online veröffentlicht worden (Published online before print September 28, 2009, doi: 10.1073/pnas.0904491106) und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.5.10
Sie wissen, was sie tun! "National Research Council" der USA analysiert Sicherheitsrisiken des US-Biowaffenlabors Fort Detrick
 Bei vielen Diskussionen über eingetroffene Risiken für die Gesundheit oder das Leben weiter Teile der Bevölkerung gehört es zum Ex-Post-Kommunikationsritual, dass dies nach "Expertenmeinung" unabsehbar gewesen sei. Erst langsam sickern dann, wie beim Beispiel des Lagers für radioaktive Abfälle im Salzstock Asse, nicht nur radioaktive Flüssigkeiten in Richtung Grundwasser, sondern auch Wahrheiten an die Öffentlichkeit, die bereits seit langem in Behördenarchiven vergraben waren. Dieses späte Wissen trägt dann entweder nicht zur Problemlösung bei oder es kostet trotzdem Milliarden, die Folgen dieses Verschweigens und Ignorierens zu beseitigen.
Bei vielen Diskussionen über eingetroffene Risiken für die Gesundheit oder das Leben weiter Teile der Bevölkerung gehört es zum Ex-Post-Kommunikationsritual, dass dies nach "Expertenmeinung" unabsehbar gewesen sei. Erst langsam sickern dann, wie beim Beispiel des Lagers für radioaktive Abfälle im Salzstock Asse, nicht nur radioaktive Flüssigkeiten in Richtung Grundwasser, sondern auch Wahrheiten an die Öffentlichkeit, die bereits seit langem in Behördenarchiven vergraben waren. Dieses späte Wissen trägt dann entweder nicht zur Problemlösung bei oder es kostet trotzdem Milliarden, die Folgen dieses Verschweigens und Ignorierens zu beseitigen.
Umso mehr Aufmerksamkeit gebührt daher Berichten über aktuell geplante Projekte, deren landes- wenn nicht sogar weltweiten Risiken ermittelt, bewertet und im Prinzip auch öffentlich bekannt sind, aber im öffentlichen Risikodiskurs irgendwo zwischen Schweinegrippe-Pandemie und uranangereicherter Präzisionsmunition der US-Armee unterzugehen drohen.
Die Sprache ist hier aktuell vom beabsichtigten Um- und Ausbau des US-Biowaffenlabors Fort Detrick. Was interessiert nun aber Mitteleuropäer eine Anlage der US-Army im Bundesstaat Maryland? Um das verständlich zu machen, bedarf es eines Ausflugs in die jüngere Geschichte weltweiter gesundheitlicher Risiken.
In der Kommunikation schwerer und mysteriöser gesundheitlicher Risiken bzw. epidemischer Ereignisse, meist infektiöser Art, spielte nämlich dieses Biowaffen-Labor bereits mehrfach die Rolle der "Spinne" im Netz von großen gesundheitsbezogenen Verschwörungstheorien. So galt HIV/AIDS in manchen Kreisen und zum Teil bis heute bei südafrikanischen Spitzenpolitikern als "man made in USA" - so die Überschrift eines in der linken "Tageszeitung (TAZ)" am 18. Februar 1987 veröffentlichten Interviews des DDR-Schriftstellers Stefan Heym mit dem Ostberliner Biologen Jakob Segal. Nach dessen anschließend vielfach kolportierten Meinung sei das tödliche Virus der Immunschwächekrankheit einem Laborunfall im US-amerikanischen Militärforschungsinstitut Fort Detrick geschuldet, d.h. dort bei Experimenten entwichen. Dieses nachweisbar falsche Szenario ist immerhin noch so wirkmächtig oder präsent, dass auch heute noch Artikel veröffentlicht werden oder werden müssen, die es zu entkräften versuchen. Zuletzt am 14. Januar 2010 im ZEIT-Online-Angebot unter dem Titel "Verschwörungstheorien: Der Mythos vom Ursprung des Aids-Virus".
Dass derartige Mythen, und ausgerechnet die über das "Army Medical Research Institute of Infectious Diseases in Fredrick, Maryland (USAMRIID)", auch bekannt als Fort Detrick, glaubwürdig wirkten, liegt aber auch daran, dass es in der Vergangenheit ebenfalls nachweisbar und unwidersprochen für die Öffentlichkeit gefährliche Zwischenfälle gab, für die Mitarbeiter und mangelhafte Sicherheitsbedingungen dieses Instituts verantwortlich waren.
So stammten die Ende 2001 in Briefen versandten Anthraxsporen, also den Erregern des potenziell tödlichen Lungenmilzbrandes, und damit die gefährlichsten Mitteln der biologischen Kriegsführung und des Bioterrorismus, nicht von den nach dem 11. September 2001 üblichen Terrorverdächtigen, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem "netten" leitenden Biochemiker des Instituts, der kurz vor seiner wahrscheinlichen Enttarnung im Jahr 2008 Selbstmord beging. In diesem Zusammenhang wurde zusätzlich publik, dass bereits in den 1990er Jahren das eine oder andere "Reagenzglas" mit Anthraxsporen oder Ebola-Viren nicht mehr inventarisiert werden konnte, also "verschwunden" war.
Es nimmt daher kein Wunder, dass nach einer 2007 getroffenen Regierungsentscheidung, die Aktivitäten dieses Hochsicherheitslabors sogar noch auszudehnen, die Bevölkerung des Fredrick County Sorge um ihre künftige Sicherheit hatte. Weder die Sicherheitsbelange der Öffentlichkeit noch die der rund 7.500 Beschäftigten seien in den Plänen der US-Army und der Regierung ausreichend berücksichtigt. Darauf bat der US-Verteidigungsminister das "National Research Council (NRC)", und deren Experten für Biosicherheit, Infektionserkrankungen, Arbeitshygiene, Umweltschützer, Risikobewertung und Epidemiologie mit einem unabhängigen wissenschaftlichen Review der Risiken dieses Labors und seiner Erweiterung zu beauftragen.
Die umfangreichen Analysen und Bewertungen der technischen Sicherheit, der Sicherheitsregeln, der Notfallregularien, der Übereinstimmung der Regularien mit den anerkannten Standards der regierungsamtlichen"Centers for Disease Control and Prevention" und des "National Institutes of Health" und der Kommunikation der Biowaffen-Verwalter mit der Öffentlichkeit sind 2010 in dem 100-seitigen Buch "Evaluation of the Health and Safety Risks of the New USAMRIID High Containment Facilities at Fort Detrick, Maryland" zusammen mit Empfehlungen veröffentlicht worden.
Die Veröffentlichung erfolgte in der hochangesehenen Publikationsreihe der"National Academies", deren Selbstverständnis so lautet: "The nation turns to the National Academies • National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine, and National Research Council • for independent, objective advice on issues that affect people's lives worldwide."
Und da es bei einem Biowaffenlabor gar nicht so abwegig ist, dass seine Sicherheit bzw. seine Sicherheitsmängel von weltweiter Bedeutung ist, und weil mit diesem Bericht ein seltenes Beispiel für eine ex ante sehr differenzierte und präventive Beschreibung der Möglichkeit und Art von Sicherheitsproblemen vorliegt, wird seine Zusammenfassung auch etwas ausführlicher und in englischer Sprache zitiert.
Die Ergebniszusammenfassung zu den für möglich gehaltenen Wirkungen auf die Umgebung des Labors lautet:
• "The analyses in the EIS (dem vorgelegten "Environmental Impact Statement" der US-Army) of the risks and the mitigation measures to address them were not comprehensive and there was insufficient documentation for a fully comprehensive independent assessment of the risks to the community posed by biological agents. The problem was compounded by the fact that the MCE (maximum credible event) scenarios were not reasonably foreseeable accidents.
• The epidemiologic characteristics, including transmission pathways, natural reservoirs, geographic distributions, and clinical outcomes of the pathogens, were not systematically documented
• There was incomplete consideration of some of the possible routes through which the general public might be exposed to pathogens.
• Although the congressional mandate placing the National Interagency Biodefense Campus at Fort Detrick precludes siting the new USAMRIID facility elsewhere, it would have been appropriate for the EIS to include consideration of an alternative location, such as one in a less populated area. Such an exercise could have provided a comparison that identified advantages and disadvantages specific to each location, and guided preventive strategies and mitigation efforts if differential risks were found."
Zu den laborinternen Abläufen sieht die Bewertung etwas besser aus, findet aber trotzdem Beunruhigendes:
• Einerseits: "USAMRIID's current procedures and regulations for its biocontainment facilities meet or exceed the standards of NIH and CDC for such facilities and other accepted rules and guidance for handling and containing pathogens during use, inventorying, and storage; treating and safely disposing of laboratory solid waste; and handling and decontaminating wastewater."
• Andererseits: "Although USAMRIID has sought to set high standards for biosurety and biosafety, recent examples of laboratory-acquired infections (glanders and tularemia) and breaches in containment (B. anthracis spores) point to human error or deliberate misuse. The committee recommends further formalized training in responsibility and accountability at USAMRIID, similar to that required for NIHsponsored training programs. The circumstances surrounding the laboratory-acquired infections also should be carefully evaluated to determine what lessons can be learned for preventing future cases."
Zum Zustand der medizinischen Kapazitäten für den Unglücksfall merkt das Komittee ebenfalls Ambivalentes an:
• Einerseits: "USAMRIID, Fort Detrick, and Frederick County have the resources and partnerships in place to address medical and emergency situations at the containment laboratories."
• Andererseits: "A primary concern is the lack of readily available clinicians with the necessary specialized training to consult on the clinical diagnosis and treatment of unusual infectious diseases."
Die Kommunikation und Kooperation mit der Öffentlichkeit ist bei weitem nicht optimal: "A segment of the local population around Fort Detrick is not satisfied that the Army is doing everything it can to protect them from infection by pathogens being studied at USAMRIID."
Nach diesen ausführlichen Zitaten soll aber auch nicht ein wichtiger, insgesamt nach einigen Eiertänzen deeskalierender Schlusspassus dieses Gutachtens zur Risikoabschätzung, unterschlagen werden: "In summary, although the EIS failed to provide adequate and credible technical analyses, current procedures, regulations, physical security, and biosurety guidelines at USAMRIID meet or exceed accepted standards and practices. Furthermore, the Army and Frederick County have the resources and the partnerships in place to address medical and emergency situations at the containment laboratories. Thus, the committee has a high degree of confidence that policies and procedures are in place to provide appropriate protections for workers and the public. Nonetheless, no program can fully stop all threats resulting from human error (for example, laboratory-acquired infections), or from theft or misuse of select agents. In going forward, the Army and USAMRIID should review its methods and procedures for preparing an EIS (including consideration of human health issues), more actively train personnel regarding accountability and responsibility, and more proactively reach out to the local community to inform it of its safety and security policies and procedures and to constructively design approaches for communicating timely information should an adverse incident occur."
Inhalte einer wünschenswerten breiten öffentlichen Debatte könnte sein, ob es wirklich dem Interesse an öffentlicher Gesundheit gerecht wird, bei dem extrem hohen gesundheitlichen Gefahrenpotenzial allein der veröffentlichten Biowaffen in Fort Detrick und vergleichbaren Laboren, nonchalant von unvermeidbaren Restrisiken zu reden und ansonsten den dort Aktiven uneingeschränkt zu vertrauen. Dies ändert aber nichts daran, dass vergleichbare Berichte vor (!!!) der Anlage und dem Start derartiger potenziell gesundheitsgefährdender Einrichtungen standardmäßig vorgelegt werden sollten.
Von dem Bericht "Evaluation of the Health and Safety Risks of the New USAMRIID High Containment Facilities at Fort Detrick, Maryland" des Committee to Review the Health and Safety Risks of High Biocontainment Laboratories at Fort Detrick; National Research Council gibt es eine mehrseitige "Executive summary" und den kompletten Text als PDF-Datei. Um das komplette Buch zu erhalten, muss man sich mit seiner Mailadresse, seinem Namen und seiner Tätigkeit (Student geht auch) anmelden, was erfahrungsgemäß keine unerwünschten Folgen hat.
Bernard Braun, 11.4.10
"Take-it-or-leave-it" für Ärzte und Versicherte: Rasche Konzentration der US-Krankenversicherer zu regionalen Fastmonopolen
 Wer meint, die von der Obama-Administration immer noch gewollte Gesundheitsversicherungsreform würde den Staat so stark machen, dass der Wettbewerb ver- oder behindert würde und damit auch dessen propagierten Vorteile für die Kosten und die Qualität der Leistungen, täuscht sich gewaltig: Hier gibt es nämlich gar nicht mehr viel zu verhindern!
Wer meint, die von der Obama-Administration immer noch gewollte Gesundheitsversicherungsreform würde den Staat so stark machen, dass der Wettbewerb ver- oder behindert würde und damit auch dessen propagierten Vorteile für die Kosten und die Qualität der Leistungen, täuscht sich gewaltig: Hier gibt es nämlich gar nicht mehr viel zu verhindern!
Der am 23. Februar 2010 erschienene Bericht "Competition in health insurance: A comprehensive study of U.S. markets" der "American Medical Association (AMA)" über die Verhältnisse auf dem Markt für private Krankenversicherung der USA im Jahr 2009 vermittelt nämlich ein völlig anderes Bild vom Status quo des Wettbewerbs:
• In 99% der 313 städtischen Ballungsgebiete der USA herrschen bei den Krankenversicherungsunternehmen bzw. Anbietern von "health plans" nach den Kriterien des "U.S. Department of Justice" und der "Federal Trade Commission" "highly concentrated" Verhältnisse. Der Konzentrationsgrad wird mit dem so genannten "Herfindahl-Hirschman-Index (HHI)" gemessen, der durch die Division der in einem Ort aktiven Unternehmen und ihren relativen Marktanteilen gemessen wird und von 0 bis 10.000 reichen kann. Nach den Regeln des US-amerikanischen Justizministeriums gelten Märkte, in denen sich der HHI zwischen 1.000 und 1.800 bewegt, als mäßig konzentriert, und Märkte, in denen der HHI die Grenze von 1.800 übersteigt, als konzentriert. Nur Miami und Fort Lauderdale in Florida und Colorado Springs in Colorado gab es danach keinen hochkonzentrierten Versicherungsmarkt.
• Dabei nahm der Konzentrationsprozess und damit die Abnahme der Wahlmöglichkeiten für Krankenversicherte sogar gerade in jüngster Zeit zu. Im Vorjahresbericht betrug der Anteil der Ballungsgebiete erst 94%.
• In 24 von 43 Bundesstaaten für die diese Daten vorlagen, beherrschte ein Versicherer einen Anteil des Krankenversicherungsmarktes von 70% und mehr. Im Vorjahr war dies erst in 18 der damals untersuchten 42 Bundesstaaten so.
• In 92% der 313 großstädtischen Märkte hielt jeweils ein Versicherungsunternehmen mindestens einen 30%-Anteil des Marktes.
• Angesichts der von mehreren goßen Versicherungsunternehmen um bis zu 39% erhöhten Krankenversicherungsprämien, charakterisieren die AMA-Autoren die Entwicklung so: 2008 erlaubte ihre Marktdominanz vielen privaten Krankenversicherungen Ärzten so genannte "take-it-or-leave-it"-Verträge anzubieten. 2009 erlaubte ihnen der Konzentrationsgrad auf den großstädtischen Märkten, Patienten "take-it-or-leave-it"-Preise anzubieten.
Trotz einiger Versuche der Krankenversicherer, das Problem klein zu reden, fasste der AMA-Präsident J. Rohack die Situation so zusammen: The near total collapse of competitive and dynamic health insurance markets has not helped patients. As demonstrated by proposed rate hikes in California (um rund 39%) and other states, health insurers have not shown greater efficiency and lower health care costs. Instead, patient premiums, deductibles and co-payments have soared without an increase in benefits in these increasingly consolidated markets."
Nicht nur, weil sich in der Bundesrepublik jüngst das Kartellamt um das möglicherweise oligopolartig, wettbewerbswidrig abgestimmte Verhalten einiger gesetzlichen Krankenkassen bei der Einführung von Zusatzbeiträgen kümmert, sondern angesichts der rasanten Fusion vieler Krankenkassen zu immer größeren Einheiten, ist eine Diskussion um den politisch gewollten und gesetzlich seit 1993 immer weiter ausgebauten Wettbewerb der Krankenkassen als Körperschaften öffentlichen Rechts und um die ebenfalls politisch gewollte und gesetzlich geregelte Verhinderung unerwünschter Folgen von Monopolen und Oligopolen hierzulande überfällig.
Wenn es weiter, und daran zweifelt niemand, zu Fusionen à la Barmer/GEK oder DAK/Hamburg-Münchner kommt, werden bald auf vielen regionalen Versicherungs- und Anbietermärkten Oligopole der genannten Großkassen zusammen mit der AOK existieren, die bestimmte Konditionen ohne jeglichen Wettbewerb absprechen, bestimmen oder auch diktieren können. Dass dies nur erwünschte Wirkungen auf die Preise und die Qualität der kontraktierten Leistungen hat, ist wahrscheinlich blauäugig. "Take-it-or-leave-it" für jedermann könnte ohne prinzipielles Gegensteuern und Umstruktieren auch in der GKV bald das Geschehen bestimmen.
Leider ist nur eine Zusammenfassung der AMA-Studie "Competition in health insurance: A comprehensive study of U.S. markets, 2009 update" kostenlos erhältlich. Wer die 41 Seiten komplett lesen will, muss dafür als Nichtmitglied der AMA 150 US-Dollar bezahlen.
Bernard Braun, 11.3.10
Wohin geht und wohin könnte eine Behandlungs-Vergütungsreform gehen? Das Beispiel der "episode-based payment" in den USA.
 Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Köhler, denkt kaum ein Jahr nach der letzten Vergütungsreform für niedergelassene Ärzte und kaum, dass deren Mehrheit die neue Vergütungsordnung überhaupt verstanden hat, darüber nach, mit der nächsten Reform die "Rolle rückwärts" zur Einzelleistungsvergütung zu schlagen.
Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Köhler, denkt kaum ein Jahr nach der letzten Vergütungsreform für niedergelassene Ärzte und kaum, dass deren Mehrheit die neue Vergütungsordnung überhaupt verstanden hat, darüber nach, mit der nächsten Reform die "Rolle rückwärts" zur Einzelleistungsvergütung zu schlagen.
Dies formulierte er Mitte 2009 in einem Interview im Deutschen Ärzteblatt so: "Für die spezialisierte fachärztliche Versorgung wollen wir abweichen von der grundsätzlichen Forderung nach Einzelleistungsvergütung. Wenn man hier eine Angleichung vornimmt, dann ans DRG-System. Für alle anderen Bereiche fordern wir aber eine Rückkehr zur Einzelleistungsvergütung."
Wegen deren gewaltigen ökonomischen aber auch gesundheitlichen Nachteilen für PatientInnen und Versicherte denken in den USA, wo es noch Einzelleistungsvergütung in Aktion gibt, Gesundheitswissenschaftler dagegen über radikale Alternativen nach.
Eine ist die der bereits einmal im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte "bundled payment". Über eine eng verwandte Variante, nämlich die "episode based payment", gibt es eine im Januar 2010 veröffentlichte interessante Darstellung, die vom liberalen Think Tank "Center for Studying Health System Change (HSC)" erstellt wurde.
Zu Beginn ihrer Ausführungen fassen die AutorInnen nochmals knapp die Nachteile der Einzelleistungsvergütung ("fee-for-service") so zusammen:
• Überangebot und -nutzung gut bezahlter Leistungen und Unterangebot- und -nutzung weniger gut bezahlter Leistungen,
• Förderung einer Medizinkultur, die meist nicht explizit vergüteten, aber qualitativ wichtigen Aktivitäten wie der Koordination der Versorgung einen geringen Wert beimisst und
• Die mittelbare Förderung des Erhalts eines fragmentierten Versorgungssystems, in dem Anbieter wie vor allem PatientInnen erhebliche Orientierungsprobleme haben.
Aber auch pauschalierte Vergütung in einem weiterhin fragmentierten Anbietersystem haben für einzelne Ärzte nachweisbare Nachteile für Ärzte wie PatientInnen.
Die bereits in den 1990er Jahren in den USA entwickelte Lösung, die möglichst viele Nachteile vermeidet und Vorteile produziert, war das "bundled payment". Hier erhalten z.B. niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser für die Behandlung einer Krankheit einen Gesamtbetrag, den sie sich teilen mussten. Trotz einiger Kostenersparnisse bei der Behandlung von Herzkranken durch eine Bypass-Operation zwischen 12 und 27 % bemühte sich die staatliche Krankenversicherung Medicare nicht darum, diese Vergütungsform auf andere stationär behandelte PatientInnen auszudehnen. Dies ändert sich seit 2009 wieder, sodass jetzt auch wieder realer über das Für und Wider sowie die organisatorischen Umstände des "bundled" oder "episode-based payment" nachgedacht werden kann.
Die AutorInnen stellen dazu u.a. die folgende zu berücksichtigenden oder zu klärenden Aspekte vor:
• Was sind und wie definiert man "Behandlungsepisoden" von präakuten Beschwerden über akute Beschwerden, eine ambulante oder stationäre Behandlung/Operation bis zu postakuten und rehabilitativen Leistungen mehrerer Anbieter? Vorgestellt wird dazu eine Art Weiterentwicklung des bereits von den DRGs bekannten Grouper, der hier nur "episode grouper" heißt und auch bereits technisch existiert.
• Welches qualitative Gewicht und damit auch wie viel Geld haben die einzelnen Behandlungsschritte und Behandler an der Gesamtbehandlung?
• Wie viel Gesamtvergütung entfällt damit auf die Gesamtbehandlung und woran orientiert sich dieses Honorar? Spannende Alternativen sind die Ausrichtung an "historischen Kosten" oder an externen Benchmark-Größen oder gar an leitlinienorientierten Standards.
• Wie identifiziert man die Anbieter oder Leistungserbringer, denen die Episodenvergütung zufließt? Geschieht dies retrospektiv oder sollten nicht Gruppen von Anbietern den Krankenversicherungsunternehmen prospektiv ein Leistungsbündel für definierte Behandlungsepisoden anbieten?
• Wie verhält sich schließlich eine derartige Vergütungsreform zu anderen laufenden oder konzipierten Vergütungsreformen sowie Versorgungsformen, wie den DRGs oder den "patient-centered medical homes"?
• Wie implementiert man ein "episode-based payment program"? Welche Erfahrungen gibt es aus der praktischen Erprobung des so genannten "PROMETHEUS"-Modells, das sich an Episoden und an einer evidenzbasierten Konzeption von "good care" orientiert?
• Schließlich weisen sie auch auf die Notwendigkeit hin, derartige Vergütungsreformen nicht vor den Patienten zu verbergen, sondern diese einzubeziehen.
Worauf es beim Inhalt und der Form oder Performance weiterer Vergütungsreformen in den USA ankommt, bringen die VerfasserInnen zum Schluss ihrer Analyse auf folgenden Punkt: "Without dramatic reform of payment structures, payers and patients can expect to experience continued rapid growth of health care costs and little improvement in the quality or coordination of care. But moving too rapidly with reforms that bundle payments for all care delivered to a given patient can backfire if the majority of providers are ill equipped to respond constructively. Episode-based payments, if carefully developed, can serve as a bridge for many providers between current fee-for-service structures and a future that emphasizes care of whole patient populations."
Auch wenn der vorliegende Text nichts Abschließendes oder Evidenzbasiertes über den gesundheitlichen und finanziellen Nutzen des "episode-based payment" sagt, könnte seine Beachtung zumindest etwas mehr Phantasie in die Vergütungsdiskussion in Deutschland bringen. Der Traum von der Einzelleistungsvergütung scheint demgegenüber vor allem aus Patientensicht ein erfolgloser und verlustreicher Weg "zurück in die Zukunft" zu sein.
Den 16 Seiten umfassenden und zahlreiche Literaturhinweise enthaltenden Text "Episode-Based Payments: Charting a Course for Health Care Payment Reform" aus dem "National Institute for Health Care reform" des HSC von Hoangmai H. Pham, Paul B. Ginsburg, Timothy K. Lake und Myles Maxfield gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 22.2.10
HealthNewsReview.org - Vorbildliche Website bewertet Medienberichte zu Medizin und Gesundheit
 5 Sterne für "Asprin könnte das Rezidiv-Risiko für Frauen mit Brustkrebs mindern", 1 Stern für "Das Hormon Oxytocin könnte Patienten mit Asperger-Syndrom helfen". Wie diese Bewertungen von Presseberichten zustande kommen, erfahren Sie auf der Website HealthNewsReview.org.
5 Sterne für "Asprin könnte das Rezidiv-Risiko für Frauen mit Brustkrebs mindern", 1 Stern für "Das Hormon Oxytocin könnte Patienten mit Asperger-Syndrom helfen". Wie diese Bewertungen von Presseberichten zustande kommen, erfahren Sie auf der Website HealthNewsReview.org.
Die Betreiber der Website wollen die Genauigkeit von Medienberichten über medizinische Behandlungen, Untersuchungen und Produkte verbessern. Ziel ist es, den Nutzer unverzerrte, ausgewogene Informationen über Gesundheitsthemen zu vermitteln, damit sie Entscheidungen auf Grundlage der besten Evidenz treffen können. Journalisten sollen dazu angespornt und darin unterstützt werden, ihre Berichte anhand wohldefinierter Qualitätskriterien zu verfassen.
Dafür screent ein multidisziplinäres Team ein breites Spektrum von Tageszeitungen und Nachrichtendiensten und beurteilt die Qualität der Berichte nach einem standardisierten Bewertungssystem, das aus 10 Kriterien besteht. Je nach Bewertung werden zwischen 0 und 5 Sterne vergeben
Herausgeber der preisgekrönten Website ist Gary Schwitzer, Professor an der Abteilung für Journalismus und Massenkommunikation der University of Minnesota.
Finanziert wird die Website von der Foundation for Informed Medical Decision Making, einer non-profit-Organisation, die sich der Verbreitung von Shared Decision-Making widmet.
In der Liste der unabhängigen Experten finden sich prominente Namen, die aufmerksamen Lesern aus Berichten im Forum Gesundheitspolitik bekannt sein dürften, wie Marcia Angell, Lisa Bero, Adriane Fugh-Bergman und Steven Woloshin.
David Klemperer, 21.2.10
Prävalenz von Übergewichtigkeit und Fettsucht bei US-Kindern und Erwachsenen 1999-2008: Eher relative Stabilität als Explosion
 "Immer mehr "Amerikaner" (US-Kinder, Jugendliche und Erwachsene) sind übergewichtig oder fettsüchtig und ihr Anteil nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich und rasch zu!!!!!" Dieser Satz fände vermutlich in fast jeder Laien- und Expertenrunde spontane Zustimmung.
"Immer mehr "Amerikaner" (US-Kinder, Jugendliche und Erwachsene) sind übergewichtig oder fettsüchtig und ihr Anteil nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich und rasch zu!!!!!" Dieser Satz fände vermutlich in fast jeder Laien- und Expertenrunde spontane Zustimmung.
Dass dies gar nicht so zustimmungsfähig und jedenfalls wesentlich differenziert ist, zeigen jetzt zwei im US-Fachjournal JAMA veröffentlichten Studien über Prävalenz und Trends von Obesity und einigen mit ihr assoziierten Indikatoren bei jugendlichen und erwachsenen US-Amerikanern in den Jahren 1999-2008 bzw. den Jahren 2007 und 2008.
Die Datenbasis war der "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)", in dem eine repräsentative Stichprobe der US-Bevölkerung regelmäßig nach ihrer Körpergröße und ihrem Gewicht gefragt werden. Verglichen wurden in beiden Studien Daten, die für den Zeitraum 1999 bis 2006 erhoben wurden mit Daten der Jahre 2007-08. Der Indikator für die Prävalenz von Übergewicht war ein Body Mass Index (BMI) von 25,0 bis 29,9 und für Fettsucht ein BMI von 30,0 oder höher. Unbestritten und vielfach u.a. durch die Daten des NHANES belegt ist, dass die Obesity-Prävalenz von 1976 bis 2000 in mehreren Schüben anstieg.
Aus den Daten von 5.555 Befragten erwachsenen, d.h. 20 Jahre alten und älteren US-BürgerInnen (bis 74 Jahre) ergibt sich zunächst ein beträchtlicher Anteil, der übergewichtig und vor allem fettsüchtig ist: 2007-2008 waren altersadjustiert insgesamt 33,8% der erwachsenen US-Amerikaner fettsüchtig. 32,2% der Männer und 35,5% der Frauen. In derselben Abfolge waren 68%, 72,3% und 64,1% übergewichtig oder fettsüchtig. Zu den Geschlechtsunterschieden kommen außerdem beträchtliche Unterschiede nach Rasse, ethnischer Zugehörigkeit und Alter. Auch ohne dass dies aus den Analysen der NHANES-Daten hervorgeht, kann man ähnlich gravierende Unterschiede auch zwischen den Angehörigen unterschiedlicher sozialer Schichten als gegeben ansehen.
Interessant ist danach aber die Untersuchung der Entwicklung von Übergewicht und Fettsucht in der Zeit, d.h. zwischen 1999/2000 und 2007/2008. Hier ergibt sich folgendes Bild:
• Sowohl bei Männern als bei Frauen gibt es in multivariaten, nach Alter, Ethnie und Rasse adjustierten Analysen keinen über die gesamte Zeit linearen und/oder statistisch signifikanten Trend.
• Bei Männern gibt es immerhin für den gesamten Zeitraum einen signifikanten linearen Trend, der aber bei differenzierterer Betrachtung ab 2003 nicht mehr existiert.
• Für die Gesamtheit der US-Frauen gibt es für diesen 10-Jahreszeitraum keinerlei statistisch signifikanten Unterschiede und folglich auch keinen signifikanten Trend. Dies schließt nicht aus, dass es auch bei Frauen Alters- oder Untergruppen nach Rasse oder Ethnie gibt, deren Gewichtsrisiko signifikant zunimmt.
• Die Fettsucht-Prävalenz erwachsener US-Amerikaner wuchs in den beiden davor liegenden 10-Jahreszeiträumen jeweils um rund 7 bis 8 Prozentpunkte. Im aktuellen Zeitraum wuchs dagegen die Prävalenz nur noch um 4,7 Prozentpunkte für Männer (signifikant) und 2,1 Prozentpunkte (nicht signifikant) für Frauen.
• "These data suggest that the increases in the prevalence of obesity previously observed between 1976-1980 and 1988-1994 and between 1988-1994 and 1999-2000 may not be continuing at a similar level over the period 1999-2008, particularly forwomen but possibly for men." Und die Daten legen den Schluss nahe, dass "the prevalence may have entered another period of relative stability, perhaps with small increases in obesity".
Nach Kenntnis dieser differenzierten Verhältnisse und vor allem ihrer Dynamik liegt die Frage nahe, ob die materielle Basis für die Zustimmung zur eingangs zitierten Trendaussage dann eben bei den unter 20-Jährigen US-Amerikanern zu finden ist.
Die Ergebnisse der auch mit Daten des NHANES durchgeführten Analyse des Niveaus und des Trends beim Übergewicht und der Fettsucht von 3.281 Kindern und Heranwachsenden im Alter von 2 bis 19 Jahren und 719 Kindern bzw. Kleinkindern von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr sehen so aus:
• Mit mehreren an die Gewichtsbedingungen von Kindern und Jugendlichen angepassten Indikatoren sind je nach Subgruppe bereits zwischen 9 und 32 % übergewichtig und/oder gar bereits fettsüchtig.
• Mit Ausnahme der schwersten Gruppe der 6- bis 19-jährigen männlichen Kinder und Jugendlichen gab es zwischen 1999 und 2008 bei keinem der gewählten Indikatoren und weder bei Jungs noch bei Mädchen einen statistisch signifikanten linearen Trend.
Die beiden Wissenschaftler-Teams halten trotz zahlreicher selbst eingeräumter Grenzen der Datenbasis ihrer Analysen an der Richtigkeit ihrer Trendanalysen fest. Ganz nebenbei relativieren sie schließlich noch die Brisanz der richtigen Beobachtung, die Prävalenz von Diabetes habe innerhalb der Zeiträume zugenommen und dahinter stecke doch der Übergewichtstrend. Hinter dem Gesamttrend stecken nur relativ wenige Subgruppen, deren Prävalenz erheblich zunahm und nicht ein Trend für sämtliche BürgerInnen.
Diese Analysen lassen eine Menge heißer Luft und selbsteinschüchternder Hoffnungslosigkeit vor scheinbar unaufhaltsamen Trends entweichen. Damit wird das Problem Übergewicht und Fettsucht keineswegs kleingeredet, sondern lediglich Raum für realistische und Erfolg versprechende Überlegungen zur Prävention des immer noch sehr hohen Problemniveaus geschaffen.
Insofern ist auch dem zusätzlich in dieser JAMA-Ausgabe veröffentlichten Kommentar des Bostoner Public Health-Experten J. Michael Gaziano zuzustimmen: "But even if these trends can be maintained, 68 percent of U.S. adults are overweight or obese, and almost 32 percent of school-aged U.S. children and adolescents are at or above the 85th percentile of BMI for age. Given the risk of obesity-related major health problems, a massive public health campaign to raise awareness about the effects of overweight and obesity is necessary. Such campaigns have been successful in communicating the dangers of smoking, hypertension, and dyslipidemia; educating physicians, other clinicians, and the public has yielded significant returns. Major research initiatives are needed to identify better management and treatment options. The longer the delay in taking aggressive action, the higher the likelihood that the significant progress achieved in decreasing chronic disease rates during the last 40 years will be negated, possibly even with a decrease in life expectancy."
Der Aufsatz "Prevalence and Trends in Obesity Among US Adults, 1999-2008" von Katherine M. Flegal; Margaret D. Carroll; Cynthia L. Ogden und Lester R. Curtin ist in JAMA vom 13. Januar 2010 online publiziert worden (2010;303 (3) doi:10.1001/jama.2009.2014) und komplett kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz "Prevalence of High Body Mass Index in US Children and Adolescents, 2007-2008" von Cynthia L. Ogden, Margaret D. Carroll, Lester R. Curtin, Molly M. Lamb und Katherine M. Flegal ist in derselben Ausgabe des JAMA (doi:10.1001/jama.2009.2012) erschienen - kostenlos ist aber nur das Abstract erhältlich.
Den Kommentar "Fifth Phase of the Epidemiologic Transition: The Age of Obesity and Inactivity" von J. Michael Gaziano (JAMA. 2010;303(3):275-276) gibt es kostenlos leider nur in der Version mit den ersten 150 Worten.
Bernard Braun, 20.1.10
Verbindliche Alkoholtests für Berufskraftfahrer senken die Quote tödlicher Unfälle
 Eine Studie aus den USA hat für den Zeitraum von 1982 bis 2006 überprüft, welchen Einfluss die Einführung verbindlicher Alkoholtests bei Berufs-Kraftfahrern (Führer von Lkws und Bussen) auf Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang hat. Im Untersuchungszeitraum wurden in einigen Bundesstaaten Programme und gesetzliche Regelungen eingeführt, aufgrund derer dann unregelmäßige und unangekündigte Alkoholtests für Berufskraftfahrer vorgeschrieben waren. In der Auswertung von Unfallstatistiken zeigt sich dann in der Studie, dass im Gefolge dieser Regelungen die Zahl tödlicher Unfälle - auch unter statistischer Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren - um etwa ein Viertel (23%) gesunken ist.
Eine Studie aus den USA hat für den Zeitraum von 1982 bis 2006 überprüft, welchen Einfluss die Einführung verbindlicher Alkoholtests bei Berufs-Kraftfahrern (Führer von Lkws und Bussen) auf Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang hat. Im Untersuchungszeitraum wurden in einigen Bundesstaaten Programme und gesetzliche Regelungen eingeführt, aufgrund derer dann unregelmäßige und unangekündigte Alkoholtests für Berufskraftfahrer vorgeschrieben waren. In der Auswertung von Unfallstatistiken zeigt sich dann in der Studie, dass im Gefolge dieser Regelungen die Zahl tödlicher Unfälle - auch unter statistischer Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren - um etwa ein Viertel (23%) gesunken ist.
Am 1. Januar 1995 wurden in den USA gesetzliche Regelungen eingeführt, die für Berufskraftfahrer verbindliche Alkoholtests vorschrieben, sofern sie Fahrzeuge mit mehr als etwa 11,8 Tonnen Gewicht führen. Diese Tests wurden dann teilweise nach dem Zufallsprinzip und zu unvorhergesehenen Zeitpunkten durchgeführt, vor, während oder nach den Fahrten, darüber hinaus aber auch durchgängig nach Unfällen. Von den Alkoholkontrollen erfasst wurden im Zeitraum 1995-1997 etwa 25 Prozent und danach im Zeitraum 1998-2006 etwa 10 Prozent aller in Frage kommenden Berufskraftfahrer.
Zentrale Datenbasis der Studie ist das "Fatality Analysis Reporting System (FARS)", eine Datenbank, in der eine Vielzahl von Informationen gespeichert würde über nähere Umstände von Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang: Am Unfall beteiligte Fahrzeugtypen und sozialstatistische Merkmale der Fahrer, Ergebnisse von Alkoholtests direkt nach dem Unfall und zu früheren Zeitpunkten sowie weitere Informationen etwa zum Straßenzustand, Wetter, Region usw.
Aus dieser Datenbank FARS wurden Daten für die Jahre 1982-2006 berücksichtigt. Eingeteilt wurden diese in den Zeitraum vor Einführung der verbindlichen Alkoholtests (13 Jahre, 1982-1994) und nach Einführung (12 Jahre, 1995-2006). Berücksichtigt wurden dann Daten für etwa 69 Tausend Berufskraftfahrer und 66 Tausend andere Personen, die allesamt in Unfälle mit tödlichem Ausgang verwickelt waren. Überprüft wurde von den Wissenschaftlern, ob bei den Unfallbeteiligten in den beiden Zeiträumen 1982-1994 und 1995-2006 Alkohol eine Rolle spielte, also ob bei ihnen eine erhöhte Blut-Alkohol-Konzentration festgestellt worden ist.
Zunächst zeigte sich, dass man bei etwa 2,7 Prozent der Berufskraftfahrer und 19,4 Prozent der übrigen Personen überhöhte Blutalkoholwerte gefunden hatte. Ein Vergleich der beiden Zeiträume ergab dann, dass erhöhte Alkoholwerte bei Berufskraftfahrern um 80 Prozent und bei anderen Personen um 41 Prozent zurückgegangen waren. Da aber neben Alkohol auch andere Faktoren für Unfälle und Unfälle mit tödlichem Ausgang ursächlich sein können, führten die Wissenschaftlern eine statistische Analyse durch, in der eine Vielzahl möglicher Einflussfaktoren gleichzeitig kontrolliert wird. Zu diesen Faktoren gehörten dann unter anderem Alter und Geschlecht des Fahrers, frühere Alkoholvergehen, Region und Jahr des Unfalls, Tageszeit und Monat.
Hier ergab sich dann, dass männliche Berufskraftfahrer, solche im Alter von 25-34 Jahren und solche mit früheren Alkoholvergehen ein höheres Risiko aufweisen und häufiger an Unfällen mit tödlichem Ausgang beteiligt sind. Darüber hinaus bestätigte sich jedoch, dass die Einführung der verbindlichen Alkoholtests einen nachhaltigen Effekt zeigt für die Verwicklung der Kraftfahrer in Unfälle mit tödlichem Ausgang: Die Quote dieser Unfälle sank um 23 Prozent.
Frei zugänglich ist ein Abstract der Studie: Joanne E. Brady et al: Effectiveness of Mandatory Alcohol Testing Programs in Reducing Alcohol Involvement in Fatal Motor Carrier Crashes ( American Journal of Epidemiology 2009 170(6):775-782; doi:10.1093/aje/kwp202)
Gerd Marstedt, 4.12.09
Kostenlose Grafiken und Tabellen über das US-Gesundheitssystem im Präsentationsformat - Das Angebot "Kaiser slides".
 Das immer wieder für Interessenten an wichtigen Fragen des us-amerikanischen Gesundheitswesens und seiner Reformen empfehlenswerte Informationsangebot der liberalen "Kaiser Family Foundation (KFF)" enthält mit "Kaiser slides" auch ein umfangreiches Angebot von inhaltlich gehaltvollen und professionell erstellten Powerpoint-Abbildungen, Tabellen und Grafiken zu einer Reihe der wichtigsten Themenbereiche.
Das immer wieder für Interessenten an wichtigen Fragen des us-amerikanischen Gesundheitswesens und seiner Reformen empfehlenswerte Informationsangebot der liberalen "Kaiser Family Foundation (KFF)" enthält mit "Kaiser slides" auch ein umfangreiches Angebot von inhaltlich gehaltvollen und professionell erstellten Powerpoint-Abbildungen, Tabellen und Grafiken zu einer Reihe der wichtigsten Themenbereiche.
Die durchweg herunterladbaren und in eigene Präsentationen bzw. "slideshows" einfügbaren Abbildungen etc. befassen sich mit Medicaid/CHIP, Medicare, Costs/Insurance, Uninsured/coverage, Public opinion und Umfrageergebnisse zu Gesundheitsfragen, HIV/AIDS, minority health, women's health policy, media and health und global health-Fragen. Für jeden dieser Bereiche liefert die KFF-Seite bis an die 30 Abbildungen auf der Basis eigener und von anderen seriösen Akteuren durchgeführten wissenschaftlichen Surveys oder Studien nach denen auch einzeln thematisch über ein Suchfenster gesucht werden kann.
Über die Slides-Seite erhält man auch direkt Zugang zu weiteren bei der Information über die Strukturen des und das Geschehen im US-Gesundheitswesen hilfreichen Datentools. Dies ist zum einen der Zugang zu einem Chartbook über "Health Insurance Coverage in America, 2007" und dann Kurzinformationen und Links zu so genannten
• "Quick Takes", die z.B. Informationen des folgenden Typs enthalten: The top 1% of the U.S. population was responsible for 21% of health care spending in 2006 und 45 million nonelderly Americans were uninsured in 2007, and eight in ten were in families with at least one worker.
• "Key fact sheets" vom Typ "Women's Health Insurance Coverage" und
• "Online Data Tools" wie beispielsweise dem "wiederum äußerst materialreichen "Health poll search". Was dieser für den daran Interessierten bietet umreißen dessen Verwalter so: "Health Poll Search is a searchable archive of public opinion questions on health issues that allows users to know what Americans think about health issues, as well as what Americans have thought about health issues over time." Die Datenbasis geht zurück bis ins Jahr 1935.
Den Zugang zu den "Kaiser slides" der Kaiser Family Foundation und deren Nutzung ist kostenlos.
Bernard Braun, 28.4.09
Desinformation mit gesundheitlichem Risiko durch "sponsored links" der Pharmaindustrie in Suchergebnissen zur Krankheitsbehandlung
 Ein wichtiges Argument gegen die Ausdehnung von mehr Direktwerbung der Pharmafirmen für Patienten und die Forderung nach unabhängigen Informationsangeboten war und ist das Risiko von lückenhafter oder fehlerhafter Information durch die vorrangig an einem hohen Umsatz und Gewinn interessierten Hersteller. Dem widerspricht die Pharmaindustrie im Allgemeinen vehement, räumt die gelegentliche Existenz "schwarzer Schafe" ein, die aber dank brancheneigener Ethikcodes Einzelfälle blieben oder schnell verschwänden.
Ein wichtiges Argument gegen die Ausdehnung von mehr Direktwerbung der Pharmafirmen für Patienten und die Forderung nach unabhängigen Informationsangeboten war und ist das Risiko von lückenhafter oder fehlerhafter Information durch die vorrangig an einem hohen Umsatz und Gewinn interessierten Hersteller. Dem widerspricht die Pharmaindustrie im Allgemeinen vehement, räumt die gelegentliche Existenz "schwarzer Schafe" ein, die aber dank brancheneigener Ethikcodes Einzelfälle blieben oder schnell verschwänden.
Dass genau dieser Selbstreinigungsprozess selbst bei klaren inhaltlichen staatlichen Vorschriften nicht immer funktioniert und dann, wenn man ihnen die nötigen Freiheiten lässt, auch gleich bei einer ganzen Herde großer Schafe und "Leithammel" nicht, zeigen amtliche Briefe der US-"Food and Drug Administration (FDA)" an 14 der größten us-amerikanischen und internationalen Pharmaunternehmen am US-Markt.
In allen Fällen geht es darum, dass die Firmen in den USA für eine Reihe ihrer Präparate im Internet kurze Werbebeiträge bzw. so genannte "sponsored links" veröffentlichen können, auf die Informationssuchende stoßen, wenn sie mit einer Suchmaschine nach Informationen zu einer Erkrankung suchen. Wenn die Ratsuchenden dann den "short internet ad" gelesen haben, können sie von dort auch meist auf die Produkt-Webseiten gelangen.
Nach Ansicht der FDA, welche die Werbeauftritte der Pharmafirmen systematisch überwacht und überprüft, sind diese so genannten "sponsored links" geeignet Patienten irrezuführen, weil sie in den inkriminierten Fällen keinerlei Informationen über die möglichen und im Detail auch durch amtliche Warnhinweise erhärteten gesundheitlichen Risiken der beworbenen Medikamente enthielten(vor den Risiken von 19 der 48 der Medikamente, deren Auftritt als "sponsored link" von der FDA untersucht wurden, hatte die FDA mit ihrem härtesten Instrument gegen unerwünschte Nebenwirkungen gewarnt, einer "black box"-Warnung).
Eine genaue Auflistung darüber wann, wo und bei welchem Produkt derartige Desinformationen festgestellt wurden, erhielten u.a. die Firmen Biogen Idec, Sanofi Aventis, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novartis, Merck, Eli Lilly, Roche Holding und natürlich auch Pharmafirmen mit deutscher Mutter wie Bayer Healthcare Pharmaceuticals und Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals - kurz so ziemlich alle bedeutenden Arzneimittelhersteller dieser Welt.
An Auszügen aus drei der Briefe lassen sich einige der von den FDA-Kontrolleuren monierten Vorgehensweisen der Industrie genauer erkennen:
• In dem hier zur Veranschaulichung des Charakters dieser Briefe etwas ausführlicher zitierte FDA-Brief an die Firma Sanofi Aventis geht es um Plavix, ein so genanntes Block-Buster-Präparat dieses Weltkonzerns, dessen Wirkstoff Clopidogrel die Blutgerinnung und damit eine gefährliche Blutverklumpung hemmt: "As part of its routine monitoring and surveillance program, the Division of Drug Marketing, Advertising, and Communications (DDMAC) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has reviewed three sponsored links [US.CLO.08.02.035 (BMS#264US08PM115), US.CLO.08.02.036 (BMS#264US08PM116), US.CLO.08.02.037 (BMS#264US08PM117)] for PLAVIX (clopidogrel bisulfate) Tablets (Plavix) submitted by sanofi-aventis U.S. LLC (Sanofi) under cover of Form FDA- 2253. The sponsored links cited in this letter are misleading because they make representations and/or suggestions about the efficacy of PLAVIX, but fail to communicate any risk information associated with the use of this drug. The links also fail to use the required established name. Thus, the sponsored links misbrand the drug in violation of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the Act) and FDA implementing regulations. See 21 U.S.C. 352(a) & (n), 321(n); 21 CFR 201.10(g)(1), 202.1(b)(1), (e)(3)(i) & (e)(6)(i)." Und: "These sponsored links make representations and/or suggestions about the efficacy of PLAVIX, but fail to communicate any risk information. For promotional materials to be truthful and non-misleading, they must contain risk information in each part as necessary to qualify any claims made about the drug. By omitting the most serious and frequently occurring risks associated with PLAVIX, the sponsored links misleadingly suggest that PLAVIX is safer than has been demonstrated."
• Die Firma GlaxoSmithKline verstieß gleich bei einer Fülle ihrer führenden Mittel gegen FDA-Vorschriften, nämlich bei "AVANDIA (rosiglitazone maleate) Tablets (Avandia), AVANDAMET (rosiglitazone maleate and metformin hydrochloride) Tablets (Avandamet), AVANDARYL (rosiglitazone maleate and glimepiride) Tablets (Avandaryl), AVODART (dutasteride) Soft Gelatin Tablets (Avodart), COREG CR (carvedilol phosphate) Extended-release Capsules (Coreg CR), and TYKERB (lapatinib) Tablets (Tykerb)."
• In ihrem Brief an GlaxoSmithKline ging die FDA auch auf das mögliche entlastende Argument ein, es stünde ja jedem Leser einer Google- oder Yahoo-Recherche frei, auf den verlinkten Produktseiten in den dort umfänglich dokumentierten Unterlagen die ganze Wahrheit über diese Mittel zu erfahren und verwirft eine solche Argumentation von vornherein: "We note that these sponsored links contain a link to the products' websites. However, this is insufficient to mitigate the misleading omission of risk information from these promotional materials."
• Auch die Firma Bayer verstieß nach Ansicht der FDA klar gegen die Gebote einer verantwortungsvollen Informationspolitik und zwar bei ihren weit verbreiteten Mitteln Levitra, Yaz und Mirena, die u.a. bei erektiler Dysfunktion und als Antibabypille wirken sollen. Die problematischen Informationsmängel stellt die FDA bei einem der Mittel, der Antibabypille YAZ, folgendermaßen im Detail dar: "Inadequate Communication of Indication/Overstatement of Efficacy. The sponsored link for YAZ provides a very brief statement about what the drug is for; however, this statement is incomplete and misleading, suggesting that YAZ is useful in a broader range of conditions or patients than has been demonstrated by substantial evidence or substantial clinical experience. Specifically, the sponsored link for YAZ misleadingly broadens the indication for YAZ by implying that all patients with moderate acne are candidates for YAZ therapy ("YAZ® Prevents Pregnancy, May Help Moderate Acne and PMDD"), when this is not the case. Rather, YAZ's indication is limited to the treatment of moderate acne vulgaris in women at least 14 years of age who have achieved menarche, and it should be used for the treatment of acne only if the patient desires an oral contraceptive for birth control."
Die Briefe sind sämtlich, zusammen mit vielen anderen aus den früheren Jahren stammenden, oft ähnlich interessanten und nur selten geschwärzten Briefen, vom CDER Freedom of Electronic Information Office auf der Website der FDA "Warning Letters and Untitled Letters to Pharmaceutical Companies" faksimiliert veröffentlicht und frei zugänglich.
Da die Briefe zum Teil kurze Antwortfristen enthalten (9.4.2009) und auch darauf hinweisen, dass die FDA nicht sämtliche "sponsored links" der Firmen untersucht habe, die Firmen dies aber nachholen sollen, gibt es erste Antworten. So nimmt die Sprecherin der Firma Biogen Idec die Vorwürfe "very seriously" und verspricht mit der FDA zu kooperieren. Selbst wenn sich alle anderen Empfänger ähnlich äußern, bleibt die Frage, warum es erst solch massiver Interventionen bedarf, um die Firmen von Mindeststandards einer seriösen Arzneimittelinformation oder der Nutzung solider Informationen gegenüber Patienten zu überzeugen.
Bernard Braun, 6.4.09
Ärzte-Shopping in den USA zwischen aktivem und informiertem Konsumentenverhalten und Mund-zu-Mund-Information
 Befürworter, Organisatoren und Autoren von mehr und besseren Informationsangeboten über Umfang und Qualität von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten sehen häufig große Teile der Krankenversicherten oder Patienten als eine permanent bedürftige Zielgruppe ihrer Bemühungen an.
Befürworter, Organisatoren und Autoren von mehr und besseren Informationsangeboten über Umfang und Qualität von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten sehen häufig große Teile der Krankenversicherten oder Patienten als eine permanent bedürftige Zielgruppe ihrer Bemühungen an.
Dies vernachlässigt zum einen, wie beispielsweise bei Angeboten im Internet, die (noch) eingeschränkten Fähigkeiten und Fertigkeiten einer relevanten Untergruppe wie der älteren Menschen, das Internet überhaupt oder kompetent zu nutzen.
Zum anderen zeigt aber eine gerade in den USA im Auftrag des gemeinnützigen "Center for Studying Health System Change (HSC)" durchgeführte und im Dezember 2008 veröffentlichte Studie, dass die Anzahl der Menschen, die für wirkliche Entscheidungen Informationen suchen, weit geringer ist als erwartet. Dieselbe Studie untersucht außerdem, welche Informationsquellen Personen wirklich nutzen, wenn sie Rat für Entscheidungen im Gesundheitswesen suchen.
Die Datenbasis war der "Health Tracking Household Survey", in dessen Rahmen beinahe 13.500 Erwachsene befragt wurden von denen 43 % antworteten.
Insgesamt ergibt sich ein für das Jahr 2007 und die USA und für die Relevanz und Wirksamkeit einer Vielzahl von "Alles-für-alle"-Informationsangebote realistischeres Bild als das von den Sponsoren derartiger Portale, Führer und Berichte entworfene.
Die wesentlichen Ergebnisse lauten:
• Nur 11 % der amerikanischen Erwachsenen schauten während des gesamten Jahres nach einem neuen Primär- oder Hausarzt ("primary care physician"). Von ihnen erreichten 32 % dieses Ziel nicht. 28 % der Befragten suchten einen Facharzt und 27 % waren bei dieser Suche auch erfolgreich. 16 % suchten nach einer neuen ambulanten oder stationären Einrichtung in der sie eine medizinische Prozedur durchführen lassen wollten. Für 46 % der Suchenden war dies erfolglos.
• Von denen, die ernsthaft einen neuen Hausarzt gesucht hatten, zog rund die Hälfte "Mund-zu-Mund"-Empfehlungen von Freunden und Verwandten zu Rate, 38 % nutzrten Empfehlungen ihres Arztes, 35 % Ratschläge ihrer Krankenversicherung und nahezu 40 % nutzten mehrere Informationsquellen, um ihre Wahl zu treffen.
• Wenn Patienten aber einen Facharzt suchten oder eine neue medizinische Einrichtung, verließen sich die meisten "KonsumentInnen" ausschließlich auf Überweisungen oder Hinweise von Ärzten.
• Online-Informationen über Anbieter von Leistungen wurde nur von sehr wenigen Patienten zu Rate gezogen: Von 7 % der Befragten, die einen neuen Anbieter von medizinischen Prozeduren suchten, 11 %, die einen acharzt suchten ging und 11 %, wenn "Konsumenten" einen neuen Hausarzt suchten.
• Informationen über Preise wurden von 5,3 % der "primary care physician shoppers" genutzt. Der Anteil der "specialist physician shoppers", der sich für den Preis der Behandlung interessierte lag bei 1,1 % und von den "procedure shoppers" waren es 1,2 % mit Interesse am Preis der neuen Einrichtung. Etwas mehr nutzen die drei "Konsumentengruppen" Qualitätsinformationen: 23 % in der Hausarztgruppe, 10,3 % in der Facharztgruppe und nur noch 3,4 % in der Einrichtungsgruppe. Dabei ist es nach Ansicht der ForscherInnen möglich, dass einige Befragte auch Empfehlungen von Freunden etc. als Qualitätsinformation bewerteten, die Nutzung der Qualitätsindikatoren in sonstigen Informationssysteme also noch etwas geringer ist.
• Warum offensichtlich weltweit (Befragungen in Deutschland nach Informationsquellen bestätigen dies weitgehend) Empfehlungen von Verwandten und Freunden eine konstant herausragende Bedeutung haben, liegt nach Ansicht der beiden AutorInnen daran, dass Patienten bevorzugt Ärzte suchen, die ihnen gut zuhören und eine einfühlsame oder mitfühlende Art des Umgangs mit ihnen haben. Diese Art von Informationen können aber am besten Personen glaubwürdig zur Verfügung stellen, die dies aus Erfahrung tun können und dem suchenden Patienten nahestehen. Trotz des technischen und inhaltlichen Fortschritts bei Hilfsmitteln für die Wahl von Ärzten bestätigen sich im Wesentlichen für die USA Ergebnisse der 2003 veröffentlichten Studie " How Do Patients Choose Physicians? Evidence from a National Survey of Enrollees in Employment-Related Health Plans?" von Katherine Harris (Health Services Research:Volume 38(2)April 2003p 711-732), deren Kernergebnis so lautete: "Literature suggests that patients do not engage in rational or consumerist behavior when searching for or choosing physicians. They instead rely heavily on recommendations from family and friends and engage in limited searches for alternative physicians."
Die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen lauten: "The consumer-directed health care vision of consumers actively shopping is far removed from the reality of how most consumers currently choose health care providers."
Auf der Suche nach Gründen und möglichen Ansatzpunkte, mehr aktive Konsumenten schaffen zu können, landen die AutorInnen aber bei zwei doppelbödigen Aspekten. Einen Grund sehen sie darin, dass die Zuzahlungen praktisch bei allen Ärzten gleich sind, wenn man in derselben Versicherung bleibt. Ein zweiter Grund ist der, dass die meisten Patienten nicht an erhebliche und für sie mit gravierenden gesundheitlichen Folgen verbundene Qualitätsunterschiede zwischen Ärzten glauben. Daraus den Schluss zu ziehen, die politischen Macher sollten "educate consumers about the existence and the serious implications of provider quality gaps", ist nachvollziehbar aber mit Sicherheit langwierig und aufwändig. Abgesehen davon sollte aber vor Beginn solcher Erziehungsmaßnahmen und differenzierterer Zuzahlungen das Risiko kurz- und mittelfristig unerwünschter Wirkungen geprüft und ausgeschlossen werden.
Den neunseitigen HSC-Forschungsbrief No. 9 "Word of Mouth and Physician Referrals Still Drive Health Care Provider Choice" von Ha T. Tu, Johanna Lauer aus dem Dezember 2008 erhält man kostenlos.
Bernard Braun, 5.4.09
Obdachlos in Seattle: Neues Sozialhilfe-Konzept für Alkoholiker ohne festen Wohnsitz ist überaus erfolgreich
 "Housing First" ist ein in den USA neu entwickeltes Konzept der Sozialhilfe und Sozialpädagogik, das von etablierten Pfaden abweicht. Man versucht obdachlose Alkoholiker nicht mehr wie früher üblich in mehreren Etappen gesellschaftlich zu integrieren: Von der Straße in eine öffentliche Gemeinschaftsunterkunft, von dort in betreute Wohngemeinschaften und am Schluss in eigenes Apartment. Vielmehr bekommen sie in einer Reihe von Gemeinden jetzt sofort eine eigene Wohnung gestellt und - auch dies ist neu - es wird kein strenges Alkoholverbot ausgesprochen. Eine jetzt im "Journal of the American Medical Association" (JAMA) veröffentlichte Studie hat nun gezeigt, dass diese neue Vorgehensweise nicht nur erhebliche finanzielle Vorteile mit sich bringt, sondern auch therapeutisch effektiv ist aufgrund eines deutlich sinkenden Alkoholkonsums.
"Housing First" ist ein in den USA neu entwickeltes Konzept der Sozialhilfe und Sozialpädagogik, das von etablierten Pfaden abweicht. Man versucht obdachlose Alkoholiker nicht mehr wie früher üblich in mehreren Etappen gesellschaftlich zu integrieren: Von der Straße in eine öffentliche Gemeinschaftsunterkunft, von dort in betreute Wohngemeinschaften und am Schluss in eigenes Apartment. Vielmehr bekommen sie in einer Reihe von Gemeinden jetzt sofort eine eigene Wohnung gestellt und - auch dies ist neu - es wird kein strenges Alkoholverbot ausgesprochen. Eine jetzt im "Journal of the American Medical Association" (JAMA) veröffentlichte Studie hat nun gezeigt, dass diese neue Vorgehensweise nicht nur erhebliche finanzielle Vorteile mit sich bringt, sondern auch therapeutisch effektiv ist aufgrund eines deutlich sinkenden Alkoholkonsums.
Das von der Stadt Seattle im Bundesstaat Washington seit einiger Zeit umgesetzte Konzept im Umgang mit obdachlosen Alkoholikern war in der Öffentlichkeit und in den Medien überaus kontrovers diskutiert und zum Teil sehr heftig kritisiert worden, denn den betreuten Person wurde nicht wie sonst üblich eine kleine Wohnung nur unter der strengen Auflage erteilt, fortan konsequent auf Alkohol zu verzichten. Obdachlose mit Alkoholabhängigkeit sind in Seattle wie auch in anderen Städten eine bedeutsame Problemgruppe aufgrund einer häufigen Inanspruchnahme der Notaufnahme von Krankenhäusern und ebenso der Unterbringungskosten in Ausnüchterungszellen oder Gefängnissen. In sozialer Hinsicht ist ihr Schicksal beklagenswert: Sie werden im Durchschnitt nicht älter als 42-52 Jahre, etwa 30-70% der Todesursachen sind alkoholbedingt.
Das in Seattle wie auch in anderen US-Städten seit einiger Zeit erprobte Konzept des "Housing First" wurde nun in einer Studie einmal hinsichtlich seiner Effekte einer Evaluation unterzogen. Teilnehmer an der Studie waren einerseits 95 Obdachlose, die im kommunalen Zentrum in der 1811 Eastlake Avenue eine Wohnung bekommen hatten. Zum anderen wurden als Kontrollgruppe 39 interessierte Obdachlose mit einbezogen, die sich auf eine Warteliste eintragen mussten, weil die Nachfrage deutlich höher war als das Wohnungsangebot.
Zunächst wurden erhebliche finanzielle Vorteile des Konzepts für den Steuerzahler deutlich: Zuvor hatte jeder Obdachlose durch die medizinische Versorgung (ca. 700 US-Dollar für jede Aufnahme in eine Klinik-Notaufnahme) und durch Gefängnisaufenthalte (ca. 200 US-Dollar pro Tag) Kosten in Höhe von 4.066 US-Dollar pro Monat verursacht. Nach Beziehen der Wohnung sanken die Kosten dann im ersten halben Jahr auf durchschnittlich 1.492 US-Dollar und im zweiten halben Jahr auf nur 958 US-Dollar. Berücksichtigt man die Wohnungskosten in dieser Rechnung, so sind die Vorteile immer noch erheblich: Die Kommune spart im Durchschnitt monatlich 2.449 Dollar für jeden Obdachlosen, dem sie eine Wohnung zur Verfügung stellen kann.
Obwohl kein Alkoholverbot in den neu bezogenen Apartments galt, konnten die Wissenschaftler durch Befragung feststellen, dass der Alkoholkonsum nicht anstieg, sondern im Gegenteil sank: Von durchschnittlich etwa 16 Standard-Drinks am Tag auf 10 Drinks nach einem Jahr. Ebenso sank die Zahl der Tage, an denen die Betroffenen einen Vollrausch hatten.
Abstract der Studie: Mary E. Larimer et al: Health Care and Public Service Use and Costs Before and After Provision of Housing for Chronically Homeless Persons With Severe Alcohol Problems (JAMA. 2009;301(13):1349-1357)
Gerd Marstedt, 3.4.09
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder "Heimkehrertrauma": Liegt die "Hardthöhe" im Tal der Ahnungslosen?
 Es bedurfte erst des am 2. Februar 2009 in der ARD ausgestrahlten Fernsehfilms "Willkommen zu Hause" um die ersten realistischen Zahlen der an einer kriegsbedingten PTBS erkrankten in Afghanistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten aus den Verantwortlichen des immer noch auf der Bonner Hardthöhe residierenden Bundesverteidigungsministeriums herauszulocken und über ein bereits seit dem Vietnamkrieg in den USA dokumentiertes und diskutiertes Erkrankungsbild bei in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelten Soldaten offen zu diskutieren. Die Zahl der PTBS-Fälle bei diesen Bundeswehrsoldaten stieg nach offiziellen Angaben von 55 im Jahr 2006 über 130 in 2007 auf 226 in 2008 (laut Süddeutscher Zeitung vom 3. Februar 2009).
Es bedurfte erst des am 2. Februar 2009 in der ARD ausgestrahlten Fernsehfilms "Willkommen zu Hause" um die ersten realistischen Zahlen der an einer kriegsbedingten PTBS erkrankten in Afghanistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten aus den Verantwortlichen des immer noch auf der Bonner Hardthöhe residierenden Bundesverteidigungsministeriums herauszulocken und über ein bereits seit dem Vietnamkrieg in den USA dokumentiertes und diskutiertes Erkrankungsbild bei in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelten Soldaten offen zu diskutieren. Die Zahl der PTBS-Fälle bei diesen Bundeswehrsoldaten stieg nach offiziellen Angaben von 55 im Jahr 2006 über 130 in 2007 auf 226 in 2008 (laut Süddeutscher Zeitung vom 3. Februar 2009).
Offensichtlich saßen die ministerialen Strategen lange ihrer eigenen Propaganda vom "friedlichen Einsatz" auf, bei dem die Soldaten eigentlich nur Entwicklungshelfer in Uniform sind und "Deutschland am Hindukusch" verteidigen. "Kriegsbedingte" oder wie man dies seit dem Balkankrieg nennt kollaterale Schäden bei Bundeswehrangehörigen - unmöglich!!
Wer nicht warten will bis das vom Bundesverteidigungsministerium eigens dafür angekündigte "Kompetenz- und Forschungszentrum" der Bundeswehr die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten auch für die im Bundeswehr-Kriegseinsatz befindlichen jungen Deutschen zusammengetragen hat, sollte sich lieber gleich oder parallel in der umfänglichen und bemerkenswert realistischen us-amerikanischen Fachliteratur umsehen.
Diese kann auf die Erfahrungen mit mehreren massiven militärischen Interventionen der USA in Vietnam, am Golf, im Irak und eben auch in Afghanistan zurückgreifen in denen Hunderttausende wenn nicht gar Millionen von US-Amerikanern über Jahre und Jahrzehnte in brutale und assymmetrische Kriege verwickelt waren und körperlich wie seelisch litten.
Das eigens für die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange von Ex-Soldaten in den USA eingerichtete staatliche Department of Veterans Affairs (VA) gehört zu den Hauptauftraggebern mehrerer großer Studien und Reports über die physischen und psychischen Folgen der Teilnahme an diesen Kriegen. In einer mehrbändigen Serie beschäftigt sich das "Committee on Gulf War and Health: Physiologic, Psychologic, and Psychosocial Effects of Deployment-Related Stress" im 2008 erschienenen Band 6 unter der Überschrift "Gulf War and Health: Physiologic, Psychologic, and Psychosocial Effects of Deployment-Related Stress" auf 360 Seiten vor allem mit der seit 1980 in das "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III)" aufgenommenen Erkrankung des "posttraumatic stress disorder (PTSD)".
Akribisch und sehr differenziert und zurückhaltend listet das Komitee, dem auch das US-"Institute of Medicine (IOM)" angehört, die wissenschaftliche Evidenz für eine Assoziation zwischen dem Aufenthalt in einer kriegerischen Zone und den PTSD-Symptomen auf. So heißt es beispielsweise im "exekutive summary" des Buches:
• "Evidence from available studies is sufficient to conclude that there is a causal relationship between deployment to a war zone and a specific health effect in humans."
• "Evidence from available studies is sufficient to conclude that there is a positive association. That is, a consistent positive association has been observed between deployment to a war zone and a specific health effect in human studies in which chance and bias, including confounding, could be ruled out with reasonable confidence."
• "Evidence from available studies is suggestive of an association between deployment to a war zone and a specific health effect, but the body of evidence is limited by the inability to rule out chance and bias, including confounding, with confidence. For example, at least one high-quality study reports a positive association that is sufficiently free of bias, including adequate control for confounding, and other corroborating studies provide support for the association (corroborating studies might not be sufficiently free of bias, including confounding). Alternatively, several studies of lower quality show consistent positive associations, and the results are probably not due to bias, including confounding."
Der gesamte Report kann, wie viele anderen Publikationen der "National Academies press" auch kostenlos online gelesen werden. Wem dies zu zu augenbelastend ist, kann außerdem ein 29 Seiten umfassendes Summary samt Inhaltsangabe kostenlos als PDF-Datei herunterladen.
Neben dem evidenten Zusammenhang von kriegerischen Einsätzen und PTBS oder PTSD haben sich die amerikanischen Experten auch schon über andere Zusammenhänge Gedanken gemacht. Im Band 7 der Reihe "Gulf War and Health" geht es um "Long-Term Consequences of Traumatic Brain Injury" und seinen langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen.
Auch hier ist der Zugang zur Online-Lektüre des gesamten, 2008 erschienenen Buches und weiteren inhaltlichen Kurzfassungen kostenlos.
Bei allen gute Ideen zur besseren Vorbereitung, gezielten Untersuchung und spezifischen Behandlung von psychisch traumatisierten Soldaten vor künftigen oder nach vergangenen kriegerischen Einsätzen ist zu hoffen, dass auch primärpräventive Forderungen, derartige Kriegseinsätze künftig am besten zu unterlassen, nicht mehr länger als pazifistisches Gutmenschentum abgetan werden.
Bernard Braun, 3.2.09
USA: Direkte, an Konsumenten gerichtete Werbung für rezeptpflichtige Medikamente scheint an Wirkung zu verlieren
 In der Europäischen Union ist der Entscheidungsprozess über die sogenannte "Direct-to-consumer advertising (DTCA)" noch offen und es ist strittig, ob und in welcher Form und in welchen Medien es zukünftig Pharmaunternehmen gestattet wird, Verbraucher direkt über rezeptpflichtige Medikamente zu informieren. In den USA andererseits, dem neben Neuseeland einzigen Land, in dem die Direktwerbung gesetzlich erlaubt ist, deutet sich nach einer neueren Studie eine sinkende Wirkung dieser Werbung an, so dass Pharmaunternehmen sehr viel weniger als noch vor fünf Jahren von ihrer Werbung in Form steigender Umsätze profitieren.
In der Europäischen Union ist der Entscheidungsprozess über die sogenannte "Direct-to-consumer advertising (DTCA)" noch offen und es ist strittig, ob und in welcher Form und in welchen Medien es zukünftig Pharmaunternehmen gestattet wird, Verbraucher direkt über rezeptpflichtige Medikamente zu informieren. In den USA andererseits, dem neben Neuseeland einzigen Land, in dem die Direktwerbung gesetzlich erlaubt ist, deutet sich nach einer neueren Studie eine sinkende Wirkung dieser Werbung an, so dass Pharmaunternehmen sehr viel weniger als noch vor fünf Jahren von ihrer Werbung in Form steigender Umsätze profitieren.
Wenn man errechnet, wie lange der durchschnittliche Amerikaner im Jahr mit seinem Arzt spricht, und wie lange er im Fernsehen Direktwerbung für rezeptpflichtige Medikamente sieht, so ergibt sich ein Verhältnis von 1 Minute Arzt zu 100 Minuten Arzneimittelwerbung. Im letzten Jahrzehnt haben sich in den USA die Ausgaben der Pharma-Industrie für die Direktwerbung etwa vervierfacht und erreichten zuletzt eine Höhe von 4,5 Milliarden Dollar. (NYT: Showdown Looms in Congress Over Drug Advertising on TV). Dieser Anstieg ist durchaus erklärbar: Man schätzt, dass jeder einzelne für dieses Marketing eingesetzte Dollar die Umsätze um etwa 2,20 bis 4,20 Dollar steigert. In einer Studie aus dem Jahr 2003 zeigte sich, dass jeder dritte Amerikaner schon einmal mit dem Arzt über ein rezeptpflichtiges Medikament aus der Werbung diskutiert hat.
Möglicherweise ist der Boom der direkten Konsumentenwerbung jedoch in eine Krise geraten. Dies deutet eine Studie an, die in ähnlicher Form schon einmal im Jahr 2003 und jetzt erneut von einer Forschungsgruppe aus Colorado durchgeführt wurde. Befragt wurden 168 Ärzte verschiedener Fachrichtungen aus 22 Praxen, nachdem sie insgesamt 1.647 Gespräche mit Patienten durchgeführt hatten. Sie gaben dann zu jedem dieser Patientengespräche Auskunft, jeder Arzt füllte etwa 10 Erhebungsbögen aus. Die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung waren dann:
• Nur in 58 Fällen (3,5%) hatten Patienten nach einem ganz bestimmten Medikament gefragt und nur in 2,6% aller Fälle nach einem Medikament aus der TV-Werbung.
• Deutliche Unterschiede zeigten sich dabei zwischen Praxen nur für Privatpatienten und anderen Arztpraxen: Privatpatienten fragten deutlich häufiger (7,2%) nach einem bestimmten Arzneimittel als andere (1,7%).
• Im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung des Forschungsteams aus dem Jahr 2003 (vgl.: How does direct-to-consumer advertising (DTCA) affect prescribing? A survey in primary care environments with and without legal DTCA) wurde allerdings deutlich, dass diese Nachfrage bei Privatpatienten deutlich gesunken ist, von 15,8% fünf Jahre zuvor auf jetzt 7,2%.
• Die Forscher fanden weiterhin, dass einige Merkmale einen recht deutlichen Einfluss auf die Empfänglichkeit für Medikamentenwerbung und die direkte Nachfrage nach bestimmten Arzneimitteln bei Arzt. Dies ist - neben Privatpatienten - auch der Fall bei Frauen und Kranken, die drei und mehr Medikamente einnehmen müssen.
• Die Ärzte berichteten, dass das nachgefragte Medikament in den meisten Fällen (62%) nicht ihre erste Wahl gewesen wäre. Zumeist (in 53% der Fälle) wären sie jedoch dem Patientenwunsch gefolgt.
Die in den letzten Jahren gesunkene Nachfrage nach bestimmten rezeptpflichtigen Medikamenten erklären die Wissenschaftler daraus, dass in den letzten Jahren in den USA das Vertrauen der Patienten und Verbraucher in die Pharma-Industrie Schaden erlitten hat. Von daher werde den Aussagen der Pharma-Unternehmen in Werbespots nicht mehr so ohne weiteres vertraut wie zuvor. (vgl. US-Verbraucher: Das Vertrauen in die Pharmaindustrie ist im Keller).
Am 10. Dezember 2008 hatte die Europäische Kommission in Brüssel ihr sogenanntes "Pharmapaket" vorgestellt, das auch einen Entwurf für eine Richtlinie enthält, aufgrund derer Pharma-Unternehmen zukünftig Patienten direkt über verschreibungspflichtige Arzneimittel informieren können. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) und andere Verbände und Politiker hatten den Entwurf jedoch massiv kritisiert. (vgl. Das Pharmapaket in der Kritik)
Die Ärztebefragung aus Colorado ist hier im Volltext kostenlos verfügbar: Bennett Parnes u.a.: Lack of Impact of Direct-to-Consumer Advertising on the Physician-Patient Encounter in Primary Care: A SNOCAP Report (Annals of Family Medicine 7:41-46 (2009), doi: 10.1370/afm.870)
Gerd Marstedt, 15.1.09
Massenmedien und Berichterstattung über Gesundheit in den USA: Geringerer Anteil als erwartet und krankheitenlastig.
 Über das Gewicht von Medienberichten über Infektions-Krankheiten lieferte eine im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte Untersuchung bereits beeindruckende Belege. Was häufig in den Schlagzeilen auftaucht, so ihre Kernerkenntnis, wird auch als bedrohlicher eingestuft. Bedeutet dies auch, dass möglicherweise bestimmte und sogar wichtige Meldungen weder in Schlagzeilen noch sonstwo in den Massenmedien vorkommen und damit unbedeutend sind?
Über das Gewicht von Medienberichten über Infektions-Krankheiten lieferte eine im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte Untersuchung bereits beeindruckende Belege. Was häufig in den Schlagzeilen auftaucht, so ihre Kernerkenntnis, wird auch als bedrohlicher eingestuft. Bedeutet dies auch, dass möglicherweise bestimmte und sogar wichtige Meldungen weder in Schlagzeilen noch sonstwo in den Massenmedien vorkommen und damit unbedeutend sind?
Klarheit kann erst eine Analyse der inhaltlichen Schwerpunkte und publizierten Themen zum weiten Themenbereich Gesundheit in allen Medien verschaffen. Für die US-Medien schuf dies gerade eine Analyse der Kaiser Family Foundation und des Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism, die sich alle Massenmedien in den USA zwischen dem Januar 2007 und Juni 2008 hinsichtlich des Umfangs und der Inhalte ihrer Gesundheitsberichterstattung anschaute. In diesen 18 Monaten spielte in den USA das Thema Status quo und Zukunft der Gesundheitsversorgung und des Krankenversicherungssystem eine überdurchschnittliche Rolle in der Öffentlichkeit, da beide politischen Lager eine Reform des Gesundheitswesens im Präsidentschaftswahlkampf sehr intensiv bearbeiteten.
Umso interessanter sind die wesentlichen Ergebnisse dieser Medienanalyse:
• Nachrichten über Gesundheit und Gesundheitsversorgung machen weniger als 4 %, nämlich 3,6 %, aller Nachrichten während dieser 18 Monate aus.
• Dieser Anteil war mit 1,4 % in den Kabelfernsehprogrammen am niedrigsten und erreichten in den Abendnachrichten der großen nationalen Fernsehnetze wie z.B. von CBS mit 8,3 % den höchsten Wert.
• Den größten Raum nahmen mit 42 % Berichte über einzelne Krankheiten oder Gesundheitsprobleme ein. Nur in einzelnen TV-Nachrichtensendungen der großen TV-Netze und in großen Tageszeitungen wurden Gesundheitspolitik und Public Health-Themen mehr behandelt als einzelne Krankheiten. Letztere überwogen in den Kabelfernsehsendungen mit ihren kurzen Nachrichtenformaten.
• 30,9 % der Artikel und Meldungen fokussierten auf Nachrichten zu Gegenständen der öffentlichen Gesundheit, darunter beispielsweise Berichte über potentielle Epidemien (z. B. Vogelgrippe), Lebensmittelvergiftungen und Drogen.
• Das relativ geringste Gewicht unter den größeren Themen hatten mit 27,4 % Berichte über Gesundheitspolitik und das Gesundheitsversorgungssystem.
• Alle anderen Themen teilten sich auf 0,9 % aller Nachrichten auf.
Damit basiert das Interesse sowie der Aufmerksamkeits- und Wissenshorizont der Nutzer nahezu aller Medien in den USA auf einer quantitativ wie qualitativ ausgesprochen schmalen und inhaltlich krankheitenlastigen Berichtsbasis.
Da diese Erkenntnisse zwar nicht auf Deutschland übertragen werden können, es aber gleichwohl Indizien für eine ähnliche Krankheitenlastigkeit der Berichterstattung in den zahlreichen "Wartezimmer-Zeitschriften" oder anderen Gesundheitsgazetten hierzulande gibt, wäre eine vergleichbare Untersuchung auch der deutschen Medien wünschenswert. Diese könnte dann auch untersuchen, ob, wie oder durch welche Verzerrungen von Wirklichkeit einige der hartnäckigen und negativ-dramatisierenden Mythen über das gegenwärtige und künftige deutsche Gesundheitssystem "produziert" oder geschürt werden und bestimmte Patentrezepte platziert werden.
Der Anfang Dezember 2008 erscheinende 14-Seiten-Report "Health News Coverage in the U.S. Media" steht Interessenten komplett kostenlos zur Verfügung. Er enthält eine ausführliche Übersicht zur Methode und zu den mit ihnen untersuchten Medien.
Bernard Braun, 1.12.08
US-Arztpraxisstudie: Elektronische Patientenakten vermeiden Medizinschadensfälle nur sehr geringfügig!
 Die Hersteller elektronischer Erfassungs- und Verwaltungsgeräte und -programme für die in Arztpraxen anfallenden Patienten- und Abrechnungsdaten zählen zu den Vorteilen ihrer Angebote, dass sie die Qualität der Behandlung für die Patienten verbessern und durch die Vermeidung von Kunstfehlern aufgrund von Informationsmängel auch die Kosten senken können. Dem stimmen, wie man u.a. der jahrelangen Debatte über die Vorteile der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte entnehmen kann, auch zahlreiche Politiker und Krankenkassenakteure reflexartig zu.
Die Hersteller elektronischer Erfassungs- und Verwaltungsgeräte und -programme für die in Arztpraxen anfallenden Patienten- und Abrechnungsdaten zählen zu den Vorteilen ihrer Angebote, dass sie die Qualität der Behandlung für die Patienten verbessern und durch die Vermeidung von Kunstfehlern aufgrund von Informationsmängel auch die Kosten senken können. Dem stimmen, wie man u.a. der jahrelangen Debatte über die Vorteile der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte entnehmen kann, auch zahlreiche Politiker und Krankenkassenakteure reflexartig zu.
Doch ob dies wirklich so ist, weiß man nicht.
Einige Zweifel werfen jetzt die Ergebnisse einer in den USA durchgeführten Studie mit 1.140 niedergelassenen Ärzten im Bundesstaat Massachusetts auf. Zunächst hatte eine Wissenschaftlergruppe zwischen Juni und Ende November 2005 eine Zufallsstichprobe der Ärzte dieses Bundesstaates mit der Bitte angeschrieben, ihnen ausführlich über ihre Einstellung und Erwartungen zur Nutzung, zur Ausstattung mit und den Einsatz von elektronischen Datensätzen bzw. Gesundheitsakten ("electronic health records" [EHR])in ihren Praxen zu berichten. Zu diesen Arztpraxen spielten die ForscherInnen dann staatliche Daten über den bezahlten Ausgleich von Medizinschadensfällen aus den letzten 10 Jahren hinzu, die auf dem "Massachusetts Board of Registration in Medicine (BRM)" im April 2007 veröffentlicht waren.
Rund ein Drittel der den Survey beantwortenden Ärzten führte elektronische Patientenakten. Von den Ärzten mit einem elektronischen Patientenaktensystem hatten 6,1% einen Medizin- oder Behandlungsschaden, der zu einem finanziellen Schadenausgleich führte. Unter den Ärzten ohne elektronische Patientenakten waren dies 10,8% (nichtadjustierte Odds ratio 0,54, p =0.01). Unterscheidet man die Ärzte, die überhaupt ein System elektronischer Patientenverwaltung einsetzen nach "high usern" und "low usern" dieser Technologie, zeigt sich ein weiterer Unterschied bei den Schadenersatzzahlungen zugunsten der "high user": 5,7 % zu 12,1%, aber nur noch schwach signifikant (p = 0,14).
Wenn man die möglichen anderen Einflüsse auf die Häufigkeit von Medizinschäden berücksichtigt und in einer logistischen Regression den Einfluss des Geschlechts des Arztes, seine Rasse, Berufserfahrung, Spezialisierung und Praxisgröße kontrolliert, verringert sich der Effekt einer elektronischen Patientenakte gegenüber ihrer Nichtexistenz deutlich und ist auch nicht mehr statistisch signifikant (adjustierte Odds ratio 0,69 und p = 0,18).
Obwohl also die Forscherinnen keine überzeugenden oder schlüssigen Belege für die positive qualitätssichernde und kostensparende Wirkung liefern können, kommen sie dann doch zu dem etwas mutigen Schluss: ""Although the results of this study are inconclusive, physicians with EHRs appear less likely to have paid malpractice claims".
Für allzu Voreilige, welche die Ergebnisse doch als Beleg für die Richtigkeit ihrer Hoffnungen in den zwangsläufigen Nutzen elektronischer Patientenakten vereinnahmen wollen, relativieren die US-Forscher aber ihre Aussage schnell wieder: "Confirmatory studies are needed before these results can have policy implications."
Die alleinige Hoffnung, vor allem Ergebnisqualitätsprobleme mit technischen oder IT-Lösungen allein vermeiden zu können, muss aber gerade nach dieser Studie erheblich eingeschränkt werden. Technische Lösungen tragen erst dann ihren sicher wichtigen Teil zur Problemlösung bei, wenn sie durch eine ganze Reihe sozialer, mentaler und kommunikativer Veränderungen von Ärzten und anderen Akteuren in den Praxen sowie weitere organisatorische Interventionen ergänzt werden.
Zu dem Aufsatz "Electronic Health Records and Malpractice Claims in Office Practice" von Anunta Virapongse, David W. Bates, Ping Shi, Chelsea A. Jenter, Lynn A. Volk, Ken Kleinman, Luke Sato und Steven R. Simon in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2008;168(21): 2362-2367) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 25.11.08
Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus
 Schon seit einiger Zeit wird in den USA Kritik laut über die große Unübersichtlichkeit der Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA. In einem jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Aufsatz hat ein Forschungsteam in Massachusetts diese Kritik noch einmal anhand eigener empirischer Untersuchungsbefunde verstärkt. Die Wissenschaftler verglichen die Klinikbewertungen von fünf großen Einrichtungen für einige ausgewählte medizinische Eingriffe bei insgesamt 25 Kliniken im Großraum von Boston. Ihr Fazit fällt überaus negativ aus: Die Bewertungen unterscheiden sich teilweise wie Tag und Nacht, jeder Klinikführer hat andere Indikatoren zur Struktur-, Prozess- oder auch Ergebnisqualität. Selbst dann, wenn harte Indikatoren wie die 30-Tage-Mortalität herangezogen werden, gibt es noch massive Abweichungen in der Einstufung, wie eine Klinik bei diesem Aspekt abschneidet.
Schon seit einiger Zeit wird in den USA Kritik laut über die große Unübersichtlichkeit der Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA. In einem jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Aufsatz hat ein Forschungsteam in Massachusetts diese Kritik noch einmal anhand eigener empirischer Untersuchungsbefunde verstärkt. Die Wissenschaftler verglichen die Klinikbewertungen von fünf großen Einrichtungen für einige ausgewählte medizinische Eingriffe bei insgesamt 25 Kliniken im Großraum von Boston. Ihr Fazit fällt überaus negativ aus: Die Bewertungen unterscheiden sich teilweise wie Tag und Nacht, jeder Klinikführer hat andere Indikatoren zur Struktur-, Prozess- oder auch Ergebnisqualität. Selbst dann, wenn harte Indikatoren wie die 30-Tage-Mortalität herangezogen werden, gibt es noch massive Abweichungen in der Einstufung, wie eine Klinik bei diesem Aspekt abschneidet.
Die Wissenschaftler wählten im August 2007 alle Krankenhäuser mit mindestens 250 Betten im Großraum von Boston, Massachusetts, aus und berücksichtigten für ihre Analysen dann 25 Kliniken. Weiterhin wählten sie fünf große Klinikführer aus, die ihre Ergebnisse auch im Internet veröffentlichen, und zwar:
• die staatliche Klinikbewertung Hospital Compare
• das private Forschungsunternehmen Health-Grades
• die Qualitätsbewertungen der Leapfrog Group
• die Rangliste der Zeitung U.S News sowie
• den regionalen Klinikführer Massachusetts Healthcare Quality and Cost.
Festgestellt wurde zunächst, dass die hier verwendeten Bewertungssysteme eine außerordentlich große Heterogenität aufweisen: Im Hinblick auf die berücksichtigten Qualitätsindikatoren, ihre Spezifik (Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualiät), den zur Bewertung berücksichtigten Zeitraum, die Stichprobengröße und anderes mehr.
Für eine Reihe medizinischer Eingriffe, wie unter anderem koronare Bypass-Operationen oder kompletter Ersatz eines Hüftgelenks, wurden dann die Bewertungen der Klinikführer für die einzelnen Krankenhäuser miteinander verglichen. Das Fazit heißt: "Für alle Diagnosen bzw. Eingriffe gab es zwischen den Bewertungen nur eine sehr geringe Übereinstimmung. So wurden beispielsweise die beiden Kliniken, die beim Bypass zumindest einmal als beste eingestuft waren, zugleich auch in einer anderen Bewertung als schlechteste bewertet." 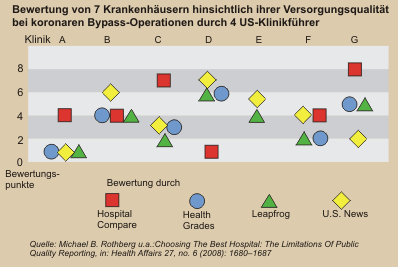
Die abgebildete Grafik zeigt für das Beispiel koronare Bypass-Operationen für 7 Kliniken die große Streuweite der Bewertungen. Auch für andere Eingriffe sind die Differenzen in der Bewertung ähnlich groß. Und selbst bei der Berücksichtigung "harter Indikatoren" wie 30-Tage-Mortalitätsraten und ihrer Einstufung ergaben sich ganz erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Bewertungssystemen.
Die Wissenschaftler machen verschiedene Vorschläge, um die überaus problematische und für Patienten verwirrende Situation zu überwinden. Zum einen, so sagen sie, müssten die Krankenhäuser endlich aus ihrer passiven Rolle herauskommen und sich darüber einigen, welche Indikatoren wirklich aussagekräftig und vergleichbar sind und daher zukünftig erfasst und veröffentlicht werden sollten. Zum zweiten sind aber auch mehr Forschungsanstrengungen nötig, um endlich herauszufinden, was Patienten nun wirklich interessiert: Möchten sie tatsächlich 30-Tage-Überlebensraten der einzelnen Kliniken miteinander vergleichen oder interessieren sie sich eher für Zufriedenheitsurteile anderer Patienten? Weitgehend ungelöst ist nach Auffasung der Forscher bisher auch das Problem der Risikoadjustierung, also der Berücksichtigung unterschiedlicher Vor- und Begleiterkrankungen von Patienten.
Für die Studie ist kostenlos leider nur ein Abstract verfügbar: Michael B. Rothberg u.a.: Choosing The Best Hospital: The Limitations Of Public Quality Reporting (Health Affairs, 27, no. 6 (2008): 1680-1687; doi: 10.1377/hlthaff.27.6.1680)
Gerd Marstedt, 13.11.08
74 Prozent der US-Amerikaner meinen: "Die Profite der Pharma-Industrie sind zu hoch"
 Eine Studie der Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) hatte Anfang des Jahres 2007 gezeigt, dass bei US-Verbrauchern das Vertrauen in die Pharmaindustrie im Keller ist. Unter anderem waren über die Hälfte der Verbraucher der Meinung, dass die Forschung und Entwicklung von Medikamenten sich nicht am tatsächlichen medizinischen Bedarf orientiert. In einer jetzt veröffentlichten Studie der Zeitschrift "USA Today", der Kaiser Family Foundation und der Harvard School of Public Health wurde noch einmal bestätigt, dass das Image der Pharma-Industrie in den USA erheblich in Mitleidenschaft gezogen ist. Dies wird auch daran deutlich, dass beim Vergleich verschiedener Wirtschaftszweige (Erdölkonzerne, Lebensmittelindustrie, Fluglinien, Banken, Krankenversicherungen, Ärzte, Pharmahersteller) die Pharmaindustrie am zweitschlechtesten bewertet wird, im Negativ-Image nur noch übertroffen von den Mineralölkonzernen.
Eine Studie der Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) hatte Anfang des Jahres 2007 gezeigt, dass bei US-Verbrauchern das Vertrauen in die Pharmaindustrie im Keller ist. Unter anderem waren über die Hälfte der Verbraucher der Meinung, dass die Forschung und Entwicklung von Medikamenten sich nicht am tatsächlichen medizinischen Bedarf orientiert. In einer jetzt veröffentlichten Studie der Zeitschrift "USA Today", der Kaiser Family Foundation und der Harvard School of Public Health wurde noch einmal bestätigt, dass das Image der Pharma-Industrie in den USA erheblich in Mitleidenschaft gezogen ist. Dies wird auch daran deutlich, dass beim Vergleich verschiedener Wirtschaftszweige (Erdölkonzerne, Lebensmittelindustrie, Fluglinien, Banken, Krankenversicherungen, Ärzte, Pharmahersteller) die Pharmaindustrie am zweitschlechtesten bewertet wird, im Negativ-Image nur noch übertroffen von den Mineralölkonzernen.
Weitere Ergebnisse der im Januar 2008 durchgeführten Repräsentativbefragung von 1.695 US-Bürgern/innen im Alter von 18 Jahren und älter waren unter anderem folgende:
• 80% sagen, dass die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente überhöht seien und 74% meinen, dass die Profite der Pharma-Industrie zu hoch sind. In ähnlicher Weise sind 70% der Ansicht, dass die Pharmahersteller sich stärker auf ihre Gewinne konzentrieren und zu wenig um das Ziel, Menschen zu helfen.
• Über die Hälfte ist der Meinung, dass zu viel Wert gelegt wird auf die Entwicklung von Lifestyle-Medikamenten wie Botox, Viagra usw. zu Lasten der Entwicklung von Arzneien für schwerwiegende Erkrankungen.
• Viele Befragungsteilnehmer hatten im letzten Jahr Probleme, die ihnen verschriebenen Medikamente zu bezahlen. 75% aller US-Bürger sind daher auch der Meinung, die Regierung solle die Preise beschränken, selbst wenn dies dazu führen sollte, dass die Pharmahersteller weniger Forschung betreiben.
• Bei der Bewertung der Werbung für rezeptpflichtige Medikamente (die in den USA erlaubt ist), sind die Meinungen gespalten. 53% finden solche Werbung überwiegend positiv, 40% eher negativ. Kritisiert wird dabei vor allem, dass es keine ausreichende Information über Nebenwirkungen gibt.
• Bei der Kritik an Werbung für rezeptpflichtige Medikamente zeigen sich überaus ambivalente Tendenzen: Einerseits sagen 66%, dass dies Leute dazu verführt, Arzneimittel einzunehmen, die sie eigentlich gar nicht benötigen. Andererseits sind ebenso viele der Ansicht, dass man erst aufgrund dieser Werbung auf Möglichkeiten einer medizinischen Hilfe aufmerksam gemacht wird.
• Bei der Bewertung von Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel gegen psychische Störungen (wie Angst, Depression) sind die US-Bürger überwiegend positiv eingestellt. 60% sagen, dass sich dadurch weniger Leute schämen und eher einen Arzt aufsuchen.
Zur Studie gibt es kostenlos
• eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse mit Diagrammen ("Summary and Charts")
• die Fragen im Wortlaut einschl. Grundauszählung der Antworten ("Toplines"),
die auf dieser Seite herunterzuladen sind: USA Today / Kaiser Family Foundation / Harvard School of Public Health Survey: The Public on Prescription Drugs and Pharmaceutical Companies
Gerd Marstedt, 9.10.2008
USA: Transparenz über Interessenkonflikte und -kollisionen in der öffentlichen Gesundheitsforschung unvollständig und unzulänglich
 Das Gesundheitswesen ist in den meisten der entwickelten Staaten einer der größten Wirtschaftsbereiche, d.h. dort werden im Durchschnitt 10% des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben, arbeiten über 10% aller Erwerbstätigen und werden konstant hohe Gewinne erzielt.
Das Gesundheitswesen ist in den meisten der entwickelten Staaten einer der größten Wirtschaftsbereiche, d.h. dort werden im Durchschnitt 10% des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben, arbeiten über 10% aller Erwerbstätigen und werden konstant hohe Gewinne erzielt.
Um diesen Zustand halten oder gar noch ausbauen zu können, wird im Gesundheitswesen auch außergewöhnlich viel geforscht. Über was, wofür und in wessen Interesse geforscht oder auch nicht geforscht wird, entscheidet in hohem Maße über die Art, Qualität und den Umfang der künftigen Gesundheitsversorgung mit. Neben der Forschung der verschiedensten Leistungsanbieter (z. B. Versicherungen, Pharmaindustrie, Medizintechnikindustrie) gibt es in den entwickelten Ländern auch eine umfangreiche, aus Steuergeldern finanzierte Forschung. Mit ihr sollen teilweise explizit die Forschungslücken geschlossen werden, die dadurch entstehen können, dass bestimmte Themen oder Problemfelder (z. B. Behandlung von seltenen Krankheiten oder Versorgungsangebote für Kranke in armen Ländern) für Unternehmensforschung finanziell uninteressant sind. Wird mit öffentlichen Geldern erfolgreich geforscht und dabei neue Produkte oder Prozeduren entwickelt, kann natürlich das Interesse privater Anbieter an der Nutzung, anbieterspezifischen Ausrichtung des Forschungs-Outcomes und möglichst den einzelnen Gewinninteressen dienenden Vermarktung rasch zunehmen.
Unter dem harmlosen Etikett von "public-private-partnership" investieren in solchen Konstellationen häufig private Anbieter in genau dieselbe zunächst noch öffentlich betriebene Forschung. Wie oft dies geschieht, wie umfangreich solche Mischfinanzierungen sind und ob und zu welchen finanziellen und inhaltlichen Interessenkonflikten es kommt, ist daher von hohem öffentlichem Interesse.
Wie unzulänglich allein schon die Transparenz darüber ist, dokumentiert für die USA der am 17. Januar 2008 vom "Office of Inspector General" des US-"Department of Health and Human Services (DHSS)" veröffentlichte 30-seitige Report "National Institutes of Health Conflicts of Health: Conflicts of Interest in Extramural Research".
Die vor allem von den staatlichen "National Institutes of Health (NIH)" (mit 27 einzelnen Instituten und Zentren) an öffentliche und private Universitäten und Forschungsinstitute vergebenen gesundheitsbezogenen Forschungsmittel betrugen 2007 mehr als 23 Milliarden US-$. Dafür wurden über 50.000 Zuschüsse an mehr als 325.000 WissenschaftlerInnen an über 3.000 Universitäten bezahlt. Dabei ist von vornherein davon auszugehen, dass jeder Zuschuss nur einen Teil des Forschungsaufwandes finanziert und dieser nur mit weiteren Zuschüssen, Stipendien oder Spenden bewältigt werden kann.
Die damit verbundenen Interessenkollisionen werden allgemein immer wieder angesprochen und weder das Engagement von Arzneimittel- oder Geräteherstellern an Universitäten noch die Existenz von Konflikten sind Geheimnisse.
Ein Bericht der New York Times vom 19. Januar 2008 zu diesem Thema ("Researchers go unchecked, report says" von Gardiner Harris)spitzt dies sogar mit der Bemerkung zu, die US-"Food and Drug Administration" (u.a. für die Zulassung von Arzneimitteln in den USA zuständig) habe sich "complained that it has difficulty finding experts for its advisory boards who do not have a conflict".
Nach einigen offenkundigen finanziellen Interessenskonflikten in den Jahren 2004 und 2005, hatten die NIH für die bei ihnen direkt beschäftigten Wissenschaftlern ein hartes Regelwerk über den Umgang mit Interessenkonflikten im Bereich der medizinischen Forschung eingeführt. Ihren ForscherInnen ist beispielsweise ohne Einschränkungen eine gleichzeitige Arbeit im Auftrag oder Beratung zugunsten von Arzneimittel- oder Medizintechnikherstellern verboten.
Einen ersten Überblick gibt ein kurzes Memorandum der "ethics rules" des NIH-Direktors Zerhouni. Ausführlichere Informationen und die entsprechenden Dokumente des mehrjährigen Verständigungsprozesses gibt es auf der speziellen Website "Conflict of Interest Information and Resources" des NIH.
Das zentrale Problem dieser inhaltlich akzeptablen Regeln ist, dass sie nur für "intramural"-Forschung und Forscher gilt. 80% des 29 Milliarden-Budgets der NIH für Forschung werden aber zur Unterstützung von "extramural"-Forschern an Universitäten etc. ausgegeben. Für diesen Teil der öffentlichen Forschungsfinanzierung gelten die Regeln nicht und es besteht aktuell noch nicht einmal ein Überblick über die Häufigkeit solcher Konflikte.
Damit beschäftigt sich nun der aktuelle Report des "inspector general" kritisch und deckte u.a. folgende Probleme auf:
• Obwohl die NIH praktisch keine Übersicht zu den conflict-of-interest von Forschern und Forschungseinrichtungen haben, denen sie öffentliche Gelder zur Verfügung stellen, hatten sie lediglich ein geringes Eigeninteresse, daran etwas zu ändern. Auf die Bitte, also keine Anweisung, Berichte über solche Interessenskonflikte an das "Office of Extramural Research" zu senden, reagierten viele der 27 Institute gar nicht.
• Die dann beginnenden eigenen Recherchen des DHSS förderten für den Zeitraum 2004 bis 2006 dann immerhin noch 438 solcher Berichte im NIH-Bereich ans Tageslicht. Dabei kam auch heraus, dass es Berichte gab, die von den Instituten nicht an die andere staatliche Behörde geschickt wurden. Der "Inspector General" geht auch davon aus, dass es noch deutlich mehr Berichte gibt, die aber nur nicht zentral zusammengetragen werden.
• Davon lieferten aber 89% keine Details über die Natur des Konflikts und berichteten auch nicht wie mit dem Konflikt umgegangen wurde.
• In 30 Berichten wurden detailliert finanzielle Interessenkonflikte beschrieben, die u. a. Rechte des geistigen Eigentums an Forschungsergebnisse betrafen. In 15 Berichten fanden sich detaillierte Beschreibungen wie Interessenkonflikte gemanagt, reduziert oder beseitigt wurden.
• Die NIH-Direktorin für die extramurale Forschung, Ruiz Bravo meinte außerdem, eine höhere Transparenz und Einmischung der NIH in solche Konflikte "would be not only inappropriate but pretty much impossible." Laut NYT schlägt sie trotz der unverkennbaren Wahrscheinlichkeit massiver Interessenkollisionen unter den universitären ForscherInnen stattdessen vor: "I think it is working to the extent that people are being honest and I think most people are honest."
Der Bericht empfiehlt statt des uneingeschränkten Vertrauens in die Ehre und Ehrlichkeit von Professoren mehr Transparenz und Kontrolle. Dazu fordert sie die NIH auf, zukünftig eine aktive Rolle bei der Beschaffung und Auswertung von "conclict-of-interest"-Reports zu spielen und zu versuchen, das intramurale Verständnis zur Vermeidung von Interessenkollisionen auch außerhalb ihrer Mauern zu verbreiten und vielleicht auch zu einem fernen Zeitpunkt durchzusetzen.
Trotz aller berechtigter Kritik an dem faktischen US-System, fehlt in Deutschland selbst ein derart gering wirksames vergleichbar institutionalisiertes Verfahren für die Vergabe öffentlicher Forschungsgelder an öffentliche oder private Einrichtungen im Gesundheitsbereich. Wie die gelegentlich im Rahmen von Publikationen bei den Autorenangaben mitveröffentlichten vielfältigen materiellen Verbindungen von Gesundheitsforschern mit industriellen aber auch körperschaftlichen Akteuren zeigt, gibt es auch in Deutschland genügend Ausgangsstoff für Interessenkonflikte und -kollisionen, den es zumindest systematisch zu sammeln gälte.
Bernard Braun, 19.1.2008
"Medicare macht’s möglich": Welchen gesundheitlichen Nutzen hat ein Krankenversicherungsschutz für vorher unversicherte Personen?
 Jeder glaubt es zwar irgendwie oder ist sich hochplausibel sicher, dass eine obligatorische und verpflichtende Krankenversicherung positive individuelle und letztlich gesellschaftliche Wirkungen hat - nur wissen und vor allem den Nachteil mangelhaften oder fehlenden Versicherungsschutzes kennen tut niemand so richtig. Dies liegt vor allem in Deutschland daran, dass rund 90% in der Gesetzlichen und mindestens 8% in einer Privaten Krankenversicherung vollversichert sind und über die Effekte der Nichtversicherung bei den armen Nichtversicherten wenig oder nichts bekannt ist.
Jeder glaubt es zwar irgendwie oder ist sich hochplausibel sicher, dass eine obligatorische und verpflichtende Krankenversicherung positive individuelle und letztlich gesellschaftliche Wirkungen hat - nur wissen und vor allem den Nachteil mangelhaften oder fehlenden Versicherungsschutzes kennen tut niemand so richtig. Dies liegt vor allem in Deutschland daran, dass rund 90% in der Gesetzlichen und mindestens 8% in einer Privaten Krankenversicherung vollversichert sind und über die Effekte der Nichtversicherung bei den armen Nichtversicherten wenig oder nichts bekannt ist.
Angesichts der gerade mal wieder leicht ansteigenden Anzahl von 47 Millionen dauerhaft oder temporär nicht- oder unterversicherter US-AmerikanerInnen eignet sich im Moment noch die USA makaberer weise besonders dafür, empirisch vergleichende Analysen über die gesundheitlichen Effekte von fehlendem und vorhandenen obligatorischen Krankenversicherungsschutz durchzuführen.
Dabei ist gerade aus den USA bereits bekannt, dass unversicherte BürgerInnen, die beispielsweise an Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes leiden, schlechtere gesundheitliche Ergebnisse haben als vergleichbar erkrankte Krankenversicherte. Ob sich bei den bisher Unversicherten etwas durch einen Versicherungsschutz ändert, wurde aber bisher auch in den USA nicht nachgewiesen.
Eine Gruppe von vorwiegend an Bostoner Hochschulen forschenden Wissenschaftlern um Michael McWilliams führte dazu mit den Daten des national repräsentativen Health and Retirement Surveys für den Zeitraum von 1992 bis 2004 eine quasiexperimentelle Längsschnittanalyse durch. Es handelt sich um Angaben für 5.006 ständig versicherter und 2.227 hartnäckig oder mit kurzen Unterbrechungen unversicherter Personen im Alter von 55 bis 64 Jahren.
Da mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres die meisten vorher nicht versicherten US-BürgerInnen Mitglied der staatlichen Versicherung für RentnerInnen werden, also von Medicare, kann man in den USA den gesundheitlichen Effekt dieses Schutzes messen.
Dazu erfragten McWilliams et al. für alle über 65 Jahre alten StudienteilnehmerInnen eine Reihe von gesundheitlichen Indikatoren: Generelle Gesundheitslage, Veränderungen im Gesundheitszustand, Schmerzen, Beweglichkeit, depressive Zustände und Behendigkeit sowie einen jahresbezogenen Summenwert aller 6 Faktoren. Außerdem erhoben sie das Auftreten unerwünschter kardiovaskulärer Outcomes.
Die Ergebnisse waren eindeutig und signifikant:
• Bisher unversicherte Personen berichteten im Vergleich mit den immer schon Krankenversicherten statistisch hochsignifikant von einer stärkeren Verbesserung ihrer summarisch dargestellten gesundheitlichen Entwicklung und mehrerer Einzelindikatoren mit jedem Jahr nach dem Beginn der Mitgliedschaft bei Medicare (differential change in annual trend, +0,20; P=0,002).
• Auch Herz-Kreislauferkrankte oder DiabetikerInnen unter den bisher Nichtversicherten berichteten im Vergleich von wesentlich stärkeren gesundheitlichen Verbesserung bei ihrer Gesamtgesundheit (differential change in annual trend, +0,26; p=0,006), bei ihrer Beweglichkeit (+0,04; p=0,05) oder bei unerwünschten Kreislaufereignissen (-0,015; p=0,03) aber nicht bei depressiven Symptomen (+0,04; p=0,32).
• Bei den vorher unversicherten jetzigen RentnerInnen ohne eine dieser Vorerkrankungen gab es signifikante ausgeprägtere Verbesserungen bei depressiven Zuständen aber meist nur schwächere Verbesserungen bei allen anderen Indikatoren, die dann auch nicht mehr statistisch signifikant waren.
• Im Alter von 70 Jahren war die mit Eintritt ins Rentenalter ohne Medicare erwartbare Differenz der allgemeinen Gesundheit zwischen versicherten und unversicherten BürgerInnen mit kardiovaskulären Erkrankungen und Diabetes um 50% reduziert.
Der Aufsatz "Health of Previously Uninsured Adults After Acquiring Medicare Coverage" von J. Michael McWilliams; Ellen Meara; Alan M. Zaslavsky und John Z. Ayanian ist gerade im "Journal of American Medical Association (JAMA)" (2007; 298(24): 2886-2894) erschienen. Ein Abstract kann kostenfrei heruntergeladen werden.
Auf der Website des "Commonwealth Fund" ist ferner eine zweiseitige Zusammenfassung mit weiteren Daten und einer Grafik kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 29.12.2007
Ein Hauch von "socialized medicine" in den USA - Informationen über Medicare und Medicaid
 Über die beiden häufig Im Ausland unbekannten oder jedenfalls nicht genügend transparenten seit 1965 existierenden staatlich organisierten und finanzierten Versicherungssysteme für Alte (Medicare) und Arme (Medicaid) unter den amerikanischen BürgerInnen gibt es seit März 2007 zwei von entsprechenden Expertenkommissionen der liberalen "Kaiser Family Foundation (KFF)" zusammengestellten Reports oder "Primers".
Über die beiden häufig Im Ausland unbekannten oder jedenfalls nicht genügend transparenten seit 1965 existierenden staatlich organisierten und finanzierten Versicherungssysteme für Alte (Medicare) und Arme (Medicaid) unter den amerikanischen BürgerInnen gibt es seit März 2007 zwei von entsprechenden Expertenkommissionen der liberalen "Kaiser Family Foundation (KFF)" zusammengestellten Reports oder "Primers".
Auf 19 Druckseiten findet man ausführliche systematische, normative und empirische Informationen über das Medicare-System, das gegenwärtig nahezu 44 Millionen BürgerInnen der USA, darunter 37 Millionen Menschen über 65 und außerdem noch 7 Millionen jüngeren Erwachsenen mit dauerhaften Behinderungen Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellt. Genauer dargestellt wird beispielsweise, welche Leistungen die Medicare-Versicherten erhalten, wieviel sie das kostet, wie hoch die Gesamtkosten des Programms sind und wie viele Versicherte es in den einzelnen Bundesstaaten gibt.
Eine PDF-Fassung des mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen versehenen "Medicare: A Primer" von KFF im Umfang von insgesamt 25 Seiten kann man hier herunterladen.
Auf 33 Seiten finden sich von der Darstellung her ähnliche "key informations on the Health Program for Low-Income Americans" zum Medicaid-Programm, das mit derzeit 55 Millionen gering verdienenden Mitgliedern (einschließlich ihren Familien, Menschen mit Behinderungen und Älteren) das größte Versicherungsprogramm der USA und die Hauptstütze der Finanzierung von Langzeitpflege ist. Neben einer genaueren Darstellung der Medicaid-Leistungen, zeigt die Broschüre u.a. die teilweise von Bundesstaat zu Bundesstaat verschiedenen Berechtigungen zum Leistungserhalt, Versicherungsgrad und Leistungsniveaus.
Hier finden Sie die ebenfalls von der KFF herausgegebene Broschüre "Medicaid: A Primer. Key information on the Health Program for Low-Income Americans".
Bernard Braun, 20.7.2007
Allgemeinmedizin in den USA= Schlechtbezahlte "Frauenarbeit" oder der Exodus männlicher Ärzte in die Facharztwelt!?
 Bestimmte Tätigkeiten gelten als fast natürliche Domänen von Männern oder Frauen, Alten oder Jungen oder verteilen sich auf andere klar unterscheidbare Gruppen. Zu den Prototypen unter den Berufen mit akademischer oder vergleichbar hoher Qualifikation gehören in Deutschland und vielen anderen Ländern etwa die "typisch weiblichen" Berufe der Grundschullehrerin oder auch der Krankenschwester. Männer gehen gar nicht in diese Berufe, sind dort eine Minderheit und fühlen sich aus den verschiedensten Gründen "unwohl". Sie verlassen solche Tätigkeiten auch bei der erstbesten Gelegenheit.
Bestimmte Tätigkeiten gelten als fast natürliche Domänen von Männern oder Frauen, Alten oder Jungen oder verteilen sich auf andere klar unterscheidbare Gruppen. Zu den Prototypen unter den Berufen mit akademischer oder vergleichbar hoher Qualifikation gehören in Deutschland und vielen anderen Ländern etwa die "typisch weiblichen" Berufe der Grundschullehrerin oder auch der Krankenschwester. Männer gehen gar nicht in diese Berufe, sind dort eine Minderheit und fühlen sich aus den verschiedensten Gründen "unwohl". Sie verlassen solche Tätigkeiten auch bei der erstbesten Gelegenheit.
Zwar galt in einigen Ländern bereits in der Vergangenheit der an sich hoch angesehene Arztberuf als überwiegender Frauenberuf. So war deren Anteil in den staatlichen Gesundheitseinrichtungen der meisten ehemalig sozialistischen Länder weit überdurchschnittlich. Dies hing vor allem mit der in diesen Ländern lange Zeit verbreiteten sozialen Minderschätzung von Akademikern gegenüber Arbeitern und Bauern zusammen, die sich u.a. auch in einem relativ niedrigen Einkommen niederschlug.
Dass aber heute und in einem erzkapitalistischen Land wie den USA bestimmte Tätigkeitszweige Ärztinnen im wahrsten Sinne des Wortes von ihren "flüchtenden" männlichen Kollegen "übriggelassen" werden, zeigt überraschenderweise ein Blick auf die jüngste Statistik der beruflichen Mobilität der dortigen Ärztinnen. Dabei handelt es sich um Ergebnisse des vom "Center for Studying Health System Change (HSC)" durchgeführten "Community Tracking Study Phycisian Survey", einer USA-weiten repräsentativen Telefonbefragung von Ärzten, die mindestens 20 Stunden in der Woche direkt in der Patientenversorgung tätig sind. Der 1996-97 Survey sowie der über den Zeitraum 2000-01 umfassten zusammen rund 12.000 befragte Ärzte und 2004-05 waren mehr als 6.000. Der Antwortrate schwankte reichte von 52 bis 65 %.
In dem gesamten Untersuchungszeitraum vollzog sich einer der bemerkenswertesten Arbeitskrafttrends für die amerikanischen Ärzte:
Zunächst nimmt der Anteil von Ärztinnen jeglicher Fachrichtung von 1996 bis 2005 von 18 auf 25,2 % zu. Schaut man sich die Veränderungen genauer an, bedeutet dies aber keineswegs eine durchgängige Erhöhung des Anteils von Ärztinnen. Deren Anteil wuchs nämlich besonders stark bei den Allgemeinärzten, nämlich von 23,6 % auf 34 %, während der Anstieg bei den Fachärzten von 18,5 % auf 22,3 % wesentlich geringer war. Auch noch einen Zuwachs weiblicher Ärzte, aber auf niedrigem Niveau, gab es bei den Chirurgen, bei denen der Frauenanteil von 9,8 % auf 16,8 % stieg. Diese und andere Teilentwicklungen trugen dazu bei, dass 2005 der relativ größte Teil, nämlich 39 % aller männlichen Ärzte Fachärzte waren. 1996/97 lagen noch die Allgemeinärzte mit einem Anteil von 36,3 % aller männlicher Ärzte an der Spitze. Bei den Frauen waren in sämtlichen Untersuchungsjahren etwas mehr oder weniger als die Hälfte (z. B. 1996/97: 51,1 % und 2004/05: 49,5 %) Allgemeinärzte. Unter den Fachärzten waren Ärztinnen dann aber in den "allgemeinärztlichen" Fachdisziplinen Pädiatrie und Gynäkologie wesentlich stärker vertreten als Ärzte.
Generell stieg die Zahl von Ärztinnen und Ärzten bezogen auf 100.000 Einwohner von 131,9 im Jahre 1996/97 leicht auf 136,2 im Jahre 2004/05 an. Die Zahl der Allgemeinärzte fiel im selben Zeitraum von 39,3 auf 33 und wäre ohne die wachsende Anzahl von allgemeinärztlich tätigen Ärztinnen noch wesentlich stärker gefallen.
Interessant ist außerdem, dass rund ein Viertel aller Ärzte in den USA aus dem Ausland stammen.
Diese Trends gehen mit einer geschlechtsspezifischen Entwicklung der Einkommen der meist angestellten Ärzte und Ärztinnen einher:
• Zuletzt in 2003 erhoben, fielen die inflationsbereinigten Netto-Einkommen aller Ärzte seit Mitte der 1990er Jahre in den USA um rund 10 %.
• Davon waren besonders Allgemeinärzte betroffen, während vor allem die Fachärzte noch am besten dastanden.
• Der Einkommensunterschied zwischen allgemeinmedizinisch tätigen Ärztinnen und Ärzten belief sich 2003 selbst nach der Kontrolle von persönlichen und Praxisbesonderheiten und unterschiedlichen Arbeitsstunden auf 22 %. 1995 betrug dieser "gender gap" dagegen "nur" 16 %. Dem steht in der gleichen Zeit ein sich verringernder Einkommensunterschied von Ärztinnen und Ärzten bei den Fachärzten gegenüber.
Eine der versorgungspolitischen Schlussfolgerung ist, dass bei weiter sinkendem oder niedrigeren Einkommen sowohl noch mehr Ärzte die Allgemeinmedizin verlassen und auch Ärztinnen vermeiden, dort tätig zu werden. Dies könnte also zu einer unerwünschten Verschlechterung der allgemeinärztlichen Versorgung und einer Verschiebung vieler Beschwerden in den teureren und qualitativ häufig überforderten Facharztbereich führen.
Eine sechsseitige Darstellung der Befragungsdaten durch Ha T. Tu und Ann S. O'Malley findet sich kostenlos hier unter der Überschrift "Exodus of Male Physicians from Primary Care Drives Shift to Specialty Practice" im Tracking Report No. 17 von HSC vom Juni 2007.
Einen flexiblen Zugang zu eigenen Auswertungen der Ärzte-Surveydaten mit dem Web-basierten und interaktiven System "CTSonline" erhält man über die Homepage von HSC.
Bernard Braun, 3.7.2007
Gesundheitliche Lebensqualität der us-amerikanischen Kinder und Jugendlichen 2006 am tiefsten Punkt seit 30 Jahren
 Bereits zum vierten Mal seit 2004 erschien in den USA im April 2007 der jüngste umfassende Bericht über die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen.
Bereits zum vierten Mal seit 2004 erschien in den USA im April 2007 der jüngste umfassende Bericht über die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen.
Dieser so genannte "Child Well-Being Index (CWI)" wird auf der Basis von 28 seit 1975 landesweit erhobenen Schlüsselindikatoren für sieben Kernbereiche der Lebensqualität gebildet. Die Daten stammen u.a. aus Erhebungen des U.S. Census Office, der Centers for Disease Control, dem National Center for Education Statistics und einer Reihe von Surveys. Verantwortlich für die Indexbildung und die Herausgabe des jährlichen Reports ist die "Foundation for Child Development".
Der CWI-Report 2007 kommt zunächst zu einer zurückhaltend positiven Generalaussage: Der Aufwärtstrend der Lebensqualitätsverbesserungen, der Anfang dieses Jahrzehnts und zwar im Jahre 2002 seinen Höhepunkt hatte, hat sich danach insgesamt nicht fortgesetzt, sondern insgesamt einen Stillstand erlebt.
Die "Sicherheit" der Kinder und Jugendlichen setzte aber beispielsweise ihren Aufwärtstrend fort, die Teenager-Schwangerschaften nahmen weiter ab, was auch für die Erfahrung von Gewaltkriminalität, Drogen- und Alkoholkonsum gilt. In den letzten sechs Jahren gab es beim Niveau der Gesamt-Lebensqualität keine gravierenden Ausschläge.
Völlig anders sieht aber die gesundheitliche Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen aus: Sie ist in den 30 Jahren in denen sie erhoben wird, auf den niedrigsten Punkt gefallen. Die dabei am heftigsten treibenden Faktoren waren die Übergewichtigkeit der jungen US-Amerikaner und eine kleinere Abnahme der Kindersterblichkeit als dies in den letzten Jahren geschafft wurde.
Der CWI zeigt außerdem signifikante und hartnäckig existierende Ungleichheiten der gesundheitlichen Lebensqualität zwischen weißen, afro-amerikanischen und hispanischen Kindern. Obwohl die Trends in den ethnisch unterschiedlichen Gruppen von Kindern und Jugendlichen sowohl auf- als auch abwärts ähnlich verlaufen, hatten sie sich in den späten 1990er Jahren stärker angenähert. Dieser Trend setzt sich jetzt nicht fort.
Im Rückblick kommt der Report zu dem Schluss, dass es sich bei dem besten Indexwert im Jahr 2002 um eine Anomalie gehandelt hat, die auf den singulären Bedingungen nach dem 11. September 2001 beruht. So kümmerten sich offensichtlich Eltern und die Öffentlichkeit nach den Attentaten wesentlich intensiver um Kinder und Jugendliche, was sich u.a. in einer kräftigen Verbesserung des emotionalen und geistigen "well-beings" und einem hohen Niveau der sozialen Beziehungen als zwei weiteren von den sieben gemessenen Lebensaspekten niederschlug. Diese Werte rutschten in den Jahren danach wieder ab.
Der 21 Seiten umfassende, von Kenneth Land (Duke University, Durham) koordinierte "2007 Report of The Foundation for Child Development Child and Youth Well-Being Index (CWI), 1975-2005, with Projections for 2006. A composite index of trends in the well-being of America’s children and youth" kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 31.5.2007
Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA: Die große Unübersichtlichkeit
 Das Informationsangebot für Patienten über die Behandlungsqualität deutscher Kliniken ist noch eher bescheiden und regional begrenzt. Der "Klinik-Führer Rhein-Ruhr", veröffentlichte 2005 als erster Informationen, die deutlich hinausgingen über die in den "Strukturierten Qualitätsberichten" mitgeteilten Mengenangaben (Häufigkeit einzelner medizinischer Eingriffe) und Selbstdarstellungen: Qualitätsbewertungen auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Patienten-Morbidität, Zufriedenheitsurteile von Patienten, Empfehlungen von Ärzten. Mittlerweile gibt es in drei norddeutschen Großstädten Klinikführer, die mit ähnlichen Qualitätsindikatoren arbeiten und teilweise als Broschüre verfügbar sind (Bremer Klinikführer), teilweise ihre Infos im Internet veröffentlicht haben (Hamburger Krankenhausspiegel, Der große Berliner Klinikvergleich).
Das Informationsangebot für Patienten über die Behandlungsqualität deutscher Kliniken ist noch eher bescheiden und regional begrenzt. Der "Klinik-Führer Rhein-Ruhr", veröffentlichte 2005 als erster Informationen, die deutlich hinausgingen über die in den "Strukturierten Qualitätsberichten" mitgeteilten Mengenangaben (Häufigkeit einzelner medizinischer Eingriffe) und Selbstdarstellungen: Qualitätsbewertungen auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Patienten-Morbidität, Zufriedenheitsurteile von Patienten, Empfehlungen von Ärzten. Mittlerweile gibt es in drei norddeutschen Großstädten Klinikführer, die mit ähnlichen Qualitätsindikatoren arbeiten und teilweise als Broschüre verfügbar sind (Bremer Klinikführer), teilweise ihre Infos im Internet veröffentlicht haben (Hamburger Krankenhausspiegel, Der große Berliner Klinikvergleich).
Das Informationsangebot für deutsche Kliniken ist nicht nur in regionaler Hinsicht eher begrenzt, auch die Zahl der bewerten medizinischen Eingriffe ist noch sehr überschaubar. Berlin bewertet in diesem Jahr zehn verschiedene Interventionen (von Geburtshilfe bis Implantation vob Herzschrittmachern), in Bremen sind es neun, die insgesamt etwa 15 Prozent aller Krankenhaus-Eingriffe umfassen. Wirft man einen Blick über den großen Teich in die USA, wo solche Qualitäts-Berichte und Rankings schon zwei Jahrzehnte, etwa seit Mitte der 80er Jahre gebräuchlich sind, so entsteht allerdings nicht unbedingt Neid. Wo hierzulande spärliches Informationswachstum zu beobachten ist, wuchert drüben die große Unübersichtlichkeit.
In einem Artikel in der Washington Post macht sich jetzt - nicht zum ersten Mal - ein renommierter Journalist Gedanken zum Informationsangebot, das aus seiner Sicht immer stärker zum Informationsproblem wird. Mit leicht ironischem Unterton nimmt er sich der verschiedenen Ranglisten für US-Kliniken an, "die jene Konkurrenz-Jagd an die Spitze verursachen, von denen gesundheitspolitische Reformer seit Jahrzehnten träumen." Zwar wird anerkannt, dass die Veröffentlichung der Ranglisten mit Angaben zu Spitzenpositionen und Ferner-Liefen-Ergebnissen wichtig sind, um Qualität und Kosten der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das große Problem sind jedoch nach Ansicht von Steven Pearlstein die überaus verwirrenden Unterschiede zwischen verschiedenen Ranglisten und Bewertungssystemen, von denen es in den USA eine große Zahl gibt. "Eine Klinik", so schreibt er, "schneidet in einer Rangliste hervorragend ab. Schaut man sich jedoch eine andere an,. dann sieht das Urteil unter Umständen schon wieder völlig anders aus."
Der Artikel ist hier nachzulesen: Steven Pearlstein: Hospitals Check Their Charts - Rankings Push Them to Improve Care (Washington Post, Friday, April 20, 2007; Page D01)
Eine Kurzfassung findet man hier bei der Kaiser Family Foundation: Hospital Quality Rankings Lead Hospitals To Improve Care, But Can Be 'Baffling,' Columnist Writes (KFF Daily Health Policy Report, Apr 20, 2007)
Tatsächlich ist das Angebot der teilweise von Privatfirmen, teils aber auch von staatlicher Seite erarbeiteten und im Internet veröffentlichten Klinikführer überbordend. Nur für einzelne Bundesstaaten wie z.B. Ohio findet man im WWW etwa ein Dutzend Ranglisten und Bewertungen für Ohio-Krankenhäuser. Unterschiedlich sind die Bewertungssysteme, die teilweise für Kliniken Punktzahlen liefern und diese in Top-50 oder Top-100 Ranglisten veröffentlichen, teilweise aber auch nur eine Zusammenfassung aller Datenauswertungen in einem System mit 1-5 Sternen liefern. Auch die den Bewertungen zugrunde liegenden Daten und Indikatoren zeigen deutliche Abweichungen. Verwendung finden zwar fast durchgängig offizielle Statistiken über Todesfälle, darüber hinaus sind die herangezogenen Indikatoren wie Komplikationen, Behandlungsfehler, Infektionen oder telefonisch ermittelte Bewertungen von Ärzten jedoch höchst verschieden.
Die vier größten Bewertungssysteme mit Informationsangeboten für Kliniken in allen US-Bundesstaaten sind:
• Health Grades, ein privates Forschungsunternehmen, das eine größere Zahl von Indikatoren zur Behandlungsqualität und Patientensicherheit verwendet - unter Berücksichtigung der jeweiligen Patienten-Vorerkrankungen. Diese Basisinformationen sind kostenlos, zusätzliche Informationen (wie Klinik-Service, Daten zur Patientensicherheit, Behandlungskosten) kosten allerdings 17.95 $. Daten sind für insgesamt 28 Diagnosen und Eingriffe verfügbar. Veröffentlicht wird ein zusammenfassendes Gesamturteil, das von 1 Stern bis zu 5 Sternen reicht.
• Solucient ist ebenfalls ein privates Unternehmen im Bereich medizinischer Informationsleistungen. Es veröffentlicht jährlich eine Liste "100 Top Hospitals: Benchmarks for Success." Für die Rangordnung berücksichtigt werden nicht nur Daten zur Behandlungsqualität, sondern auch Behandlungskosten pro Fall und Kostenentwicklungen. Die Kliniken werden nach ihren medizinischen Schwerpunkten und Aufgabenbereichen aufgegliedert. Die Grundinformationen sind für Patienten kostenlos. Für detaillierte Berichte mit einzelnen Benchmark-Daten verlangt die Firma allerdings 125-150 $.
• U.S. News ist eine auch im WWW präsente Zeitung, die jährlich eine Rangliste der besten (25-50) Kliniken veröffentlicht, aufgegliedert nach Fachrichtungen (Krebs, Psychiatrie usw.). Verwendung finden dabei unterschiedliche Kriterien wie Mortalitätsraten, Pflegequalität oder technische Ausstattung. Darüber hinaus werden auch Ergebnisse einer schriftlichen Umfrage bei rund 3.000 medizinischen Spezialisten berücksichtigt. Die Listen sind kostenlos zugänglich.
• Hospital Compare ist das staatliche Informationssystem des Department of Health and Human Services. Es ist sehr viel differenzierter hinsichtlich der Veröffentlichung einzelner Indikatoren für ausgewählte Kliniken, für Patienten deshalb aber auch schwieriger in den Ergebnissen zu bewerten. So sind für das Krankheitsbild "Herzattacke" beispielsweise rund zwei Dutzend Indikatoren auswählbar , angefangen vom Prozentsatz der Patienten, denen bei der Ankunft Aspirin gegeben wurde bis hin zum Prozentsatz derjenigen, die eine Beratung zur Raucherentwöhnung erhielten. Für alle angeklickten Indikatoren und für die ausgewählten Krankenhäuser werden sodann die Daten tabellarisch dargestellt. Für viele Patienten ist hier dann wohl eine Überforderungsgrenze erreicht: Wie sollen diese zum Teil widersprüchlichen Informationen gewichtet und zu einem Gesamturteil zusammengefasst werden? Viele werden dann wohl wieder zum einfacheren, wenngleich intransparenten 1-5-Sterne-Testurteil einer anderen Website gehen.
Die in Deutschland zukünftig zu aktualisierenden oder auch regional ganz neu erscheinenden Klinikführer dürften alsbald vor einem ähnlichen Problem stehen. Welchen Weg sollen sie beschreiten: Ein für Laien einfach zu handhabendes, aber höchst intransparentes 1-5-Sterne-System, Top-10-Ranglisten für Städte oder Kreise oder auch Testurteile, wie sie die Stiftung Warentest vergibt? Ein System also, das für unterschiedliche Interessen und Kriterien (Behandlungsqualität, Service und Komfort, Nähe zur Wohnung und zu Verwandten, Patientenzufriedenheit, Arztbewertungen) oft allzu pauschal gerät? Oder doch differenzierte Tabellen mit Daten zu einer Vielzahl einzelner Indikatoren, die aber womöglich für viele eine Überforderung darstellen? Eine einfache Antwort fällt schwer. Zu bedauern ist allerdings, dass bislang keine Forschungsstudien begonnen wurden oder in Planung sind, die hierzu einmal unterschiedliche Nutzergruppen, deren Interessen und Umgangsweisen mit den schon vorhandenen Klinikführern näher analysieren. Es scheint wieder mal so zu sein, dass Informationen für Patienten auf den Markt gebracht werden, aber in paternalistischer Manier hoch über ihre Köpfe hinweg.
Gerd Marstedt, 24.4.2007
US-Unterrichtsprogramme für sexuelle Enthaltsamkeit: 1 Milliarde Dollar zum Fenster hinaus geworfen
 Fast eine Milliarde Dollar haben US-Bundesregierung und Bundesstaaten seit 1998 für Unterrichtsprogramme aufgewendet, mit denen Schüler zu sexueller Enthaltsamkeit vor der Ehe erzogen werden sollen. Jedes Jahr fließen staatliche Gelder in Höhe von 87.5 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 65 Millionen Euro) in diese ganz besondere Sexualerziehung. Wie es scheint, haben die Moralpredigten jedoch so gut wie nichts bewirkt: Ein jetzt vorgelegter Evaluationsbericht hat gezeigt, dass das Sexualverhalten von Schülern und Schülerinnen, die an solchen Unterrichtsprogrammen teilnahmen, und ebenso auch ihre Kenntnisse zu Sexualität, Schwangerschaft oder Infektionsrisiken sich absolut nicht unterscheiden von Vergleichsgruppen, die nicht an den Programmen teilnahmen.
Fast eine Milliarde Dollar haben US-Bundesregierung und Bundesstaaten seit 1998 für Unterrichtsprogramme aufgewendet, mit denen Schüler zu sexueller Enthaltsamkeit vor der Ehe erzogen werden sollen. Jedes Jahr fließen staatliche Gelder in Höhe von 87.5 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 65 Millionen Euro) in diese ganz besondere Sexualerziehung. Wie es scheint, haben die Moralpredigten jedoch so gut wie nichts bewirkt: Ein jetzt vorgelegter Evaluationsbericht hat gezeigt, dass das Sexualverhalten von Schülern und Schülerinnen, die an solchen Unterrichtsprogrammen teilnahmen, und ebenso auch ihre Kenntnisse zu Sexualität, Schwangerschaft oder Infektionsrisiken sich absolut nicht unterscheiden von Vergleichsgruppen, die nicht an den Programmen teilnahmen.
Seit 1998 gibt es an weiterführenden Schulen vieler US-Bundesstaaten Programme zur Sexualerziehung, die teilweise schon für 10-11jährige, teilweise erst für 13jährige und ältere angeboten werden. Die Kurse werden zum Teil nach der Schule, zum Teil aber auch während der regulären Unterrichtszeiten angeboten. Auch die Unterrichtsinhalte der 11 verschiedenen Programme sind nicht völlig deckungsgleich. Vermittelt werden überwiegend jedoch Kenntnisse zu Sexualität und Schwangerschaft, sexuell übertragbaren Krankheiten, Ehe und Partnerschaft. In einem Punkt sind sich jedoch alle Programme gleich: Sie sollen die grundlegende Verhaltensnorm vermitteln, dass Sex vor der Ehe moralisch verwerflich und für die Persönlichkeitsentwicklung schädlich ist.
So heißt es in den Grundsätzen, die bei der staatlichen Verabschiedung der Gesetze zum Unterricht formuliert wurden: "Erziehung zur Enthaltsamkeit zielt darauf,
• den sozialen, psychologischen und gesundheitlichen Nutzen zu lehren, der aus sexueller Enthaltsamkeit gewonnen werden kann
• zu vermitteln, dass allein durch sexuelle Enthaltsamkeit frühe Schwangerschaften, sexuelle Krankeiten und andere Gesundheitsrisiken vermieden werden können,
• zu lehren, dass Sex außerhalb und vor der Ehe körperliche und seelische Beeinträchtigungen hervorruft."
Die in Schulklassen gepredigte Prüderie hat jedoch offensichtlich keinerlei Wirkung gezeigt. In dem jetzt veröffentlichten Evaluationsbericht der regierungsunabhängigen Forschungseinrichtung "Mathematica" wurden über 2.000 Jugendliche befragt, von denen etwas mehr als die Hälfte an einem der Enthaltsamkeitskurse teilgenommen hatten, die übrigen Teilnehmer bildeten eine Kontrollgruppe ohne Teilnahme an solcher Sexualerziehung. Die Ergebnisse waren überaus ernüchternd. Es zeigte sich:
• Mit oder ohne Enthaltsamkeits-Erziehung waren die Daten zur sexuellen Aktivität dieselben: Jeweils 49% waren bislang völlig enthaltsam, 56% in den letzten 12 Monaten
• Keinerlei Unterschiede zeigten sich für Verhütungspraktiken : In den letzten 12 Monaten hatten in beiden Gruppen jeweils 23% immer ein Kondom benutzt, 17% manchmal, 5% nie, 56% waren enthaltsam.
• Bis hinter dem Komma stimmte auch das Alter für den ersten Sex in beiden Gruppen überein, es betrug 14.9 Jahre.
• Identisch waren auch die Kenntnisse über sexuell übertragbare Krankheiten.
• Nur minimale Differenzen zeigten Sich, was die Kenntnisse über einige Krankheiten anbetrifft, die durch Kondombenutzung vermeidbar sind.
Die Enthaltsamkeits-Erziehung war schon vor der Veröffentlichung der Studie mehrfach von vielen Pädagogen, aber auch Politikern kritisiert worden. Die jetzt veröffentlichten Befunde scheinen allerdings nicht zu bewirken, dass man ihren Fortbestand in Frage stellt. Ganz im Gegenteil diskutieren die Autoren der Studie, ob es in Anbetracht der Befragungsergebnisse und der festgestellten Wirkungslosigkeit des Unterrichts nicht darüber nachdenken müsse, die Programme schon in früheren Schuljahren zu beginnen und darüber hinaus auch noch im späteren Alter etwa an Universitäten anzubieten.
Hier ist eine Pressemitteilung von "Mathematica" mit den wichtigsten Befunden
Hier ist der komplette Bericht: Impacts of Four Title V, Section 510 Abstinence Education Programs - Final Report (PDF, 164 Seiten)
Gerd Marstedt, 15.4.2007
Eine Checkliste für die Gesundheit soll US-Amerikaner zu noch mehr Früherkennungs - Untersuchungen motivieren
 Die "Agency for Healthcare Research and Quality", eine Forschungs- und Kontrollbehörde der US-Regierung hat eine Checkliste für die Gesundheit herausgegeben, die in komprimierter Form für amerikanische Männer und Frauen Empfehlungen ausspricht, welche Früherkennungsuntersuchungen in welchem Alter sinnvoll sind, welche körperlichen Funktionswerte man beim Arzt überprüfen lassen sollte und welche Verhaltensweisen im Alltag dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten.
Die "Agency for Healthcare Research and Quality", eine Forschungs- und Kontrollbehörde der US-Regierung hat eine Checkliste für die Gesundheit herausgegeben, die in komprimierter Form für amerikanische Männer und Frauen Empfehlungen ausspricht, welche Früherkennungsuntersuchungen in welchem Alter sinnvoll sind, welche körperlichen Funktionswerte man beim Arzt überprüfen lassen sollte und welche Verhaltensweisen im Alltag dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten.
Die Ratschläge basieren nach eigener Aussage der Behörde auf evidenz-basierten Forschungsergebnissen. Sie wurden in komprimierter Form zusammengestellt, um der quantitativen Flut und Unübersichtlichkeit von Internet-Informationen zur Gesundheit etwas entgegen zu setzen. Auch die Beeinflussung der Informationen auf vielen Gesundheits-Websites durch kommerzielle Interessen war ein Anlass für die Veröffentlichung.
Die Broschüre soll von Benutzern individuell gelesen oder auch zum Arzt mitgenommen und dort in der Sprechstunde diskutiert werden. Sie hat für Männer und Frauen einen unterschiedlichen Inhalt. Aufgeteilt sind die Broschüren jeweils in mehrere Abschnitte, in denen unter anderem die Themen behandelt werden:
• Früherkennungs- und Kontrolluntersuchungen: Welche Untersuchungen in welchem Alter wichtig sind
• Tägliche Schritte zur Gesundheit (Ratschläge zum Gesundheitsverhalten)
• Welche Arzneimittel zur Krankheitsverhütung sinnvoll und welche nicht?
Ergänzend zu diesen Broschüren gibt es im Internet ausführliche Informationen zur Prävention , Krankheitsfrüherkennung und zum Gesundheitsverhalten, dabei gibt es spezielle Informationsangebote auch für Ältere ab 50.
Bei den Früherkennungs- und Kontrolluntersuchungen für Frauen werden beispielsweise folgende Empfehlungen gegeben:
• Überprüfung des Body-Mass-Index (BMI)
• Brustkrebsuntersuchungen: Mammographie alle 1-2 Jahre ab dem Alter von 40
• Gebärmutterhalskrens: Screening alle 1-3 Jahre im Alter von 21-65 Jahren
• Kontrolle des Cholesterinspiegels: regelmäßig ab 45
• Bluthochdruckkontrolle alle 2 Jahre
• Darmkrebsuntersuchungen ab dem Alter von 50
• Diabetes: Kontrolle bei hohem Blutdruck oder ungünstigen Cholesterinwerten
• Depression: bei Anzeichen von Niedergeschlagenheit, Hoffnungs- oder Interesselosigkeit in den letzten zwei Wochen sollte der Arzt gefragt werden
• Chlamydien und sexuell übertragbare Krankheiten: Kontrolluntersuchungen für unter 25jährige bei regelmäßigem Sex
• HIV-Test: bei ungeschütztem Sex, Schwangerschaft und einigen anderen Voraussetzungen
Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die Broschüre mit ihren Empfehlungen nicht bei sehr vielen Amerikanern nennenswerte Veränderungen des Gesundheitsverhaltens hervorrufen wird, dürfte sie schon bald etliche Kritiker auf den Plan rufen. Man kann die Broschüren ohne Weiteres kritisieren, werden doch pauschale und undifferenzierte Empfehlungen ohne jede Abwägung von Chancen und Risiken (wie z.B. Falsch-Positiv-Befunde und darauf folgende z.T. gesundheitsriskante diagnostische Methoden) einer Früherkennung abgegeben.
• Broschüre für Frauen: Women: Stay Healthy at Any Age - Your Checklist for Health
• Broschüre für Männer: Men: Stay Healthy at Any Age - Your Checklist for Health
• Ergänzende Gesundheits-Informationen: The Pocket Guide to Good Health For Adults
• Ergänzende Gesundheits-Informationen für Ältere: The Pocket Guide to Staying Healthy at 50+
Gerd Marstedt, 22.3.2007
US-Verbraucher: Das Vertrauen in die Pharmaindustrie ist im Keller
 Die Pharmaindustrie hat aus einer Vielzahl von Gründen in den letzten Jahren zunehmend das Vertrauen von Patienten, Versicherungen und Ärzten verloren. In einer aktuellen Studie für den US-Pharmamarkt stellt die Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) die Gründe für diesen Vertrauensverlust dar und will für Unternehmen der Branche Möglichkeiten zur Umkehr dieses Trends aufzeigen. Auch wenn die Ergebnisse der US-Studie wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht 1:1 auf den deutschen und europäischen Markt übertragbar sind, zeigen die Kernaussagen ein grundsätzliches Problem der Pharmaindustrie auf. Es gelingt der Branche offensichtlich nicht, Konsumenten vom Nutzen der Pharmaforschung und neuer Präparate im Verhältnis zu den hiermit verbundenen Kosten zu überzeugen. Auch wird ein allgemeines Misstrauen deutlich gegenüber Informationsstrategien der Pharmabranche und ihren Konzepten zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit.
Die Pharmaindustrie hat aus einer Vielzahl von Gründen in den letzten Jahren zunehmend das Vertrauen von Patienten, Versicherungen und Ärzten verloren. In einer aktuellen Studie für den US-Pharmamarkt stellt die Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) die Gründe für diesen Vertrauensverlust dar und will für Unternehmen der Branche Möglichkeiten zur Umkehr dieses Trends aufzeigen. Auch wenn die Ergebnisse der US-Studie wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht 1:1 auf den deutschen und europäischen Markt übertragbar sind, zeigen die Kernaussagen ein grundsätzliches Problem der Pharmaindustrie auf. Es gelingt der Branche offensichtlich nicht, Konsumenten vom Nutzen der Pharmaforschung und neuer Präparate im Verhältnis zu den hiermit verbundenen Kosten zu überzeugen. Auch wird ein allgemeines Misstrauen deutlich gegenüber Informationsstrategien der Pharmabranche und ihren Konzepten zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit.
Für die Studie befragte PwC in den USA über 500 Konsumenten und mehr als 150 Branchenexperten, darunter Ärzte, Krankenhausmanager, ehemalige gesundheitspolitische Entscheidungsträger und Wissenschaftler. Außerdem wurden die Antworten von 15 nach einem Zufallsverfahren ausgewählten Managern verschiedener Pharma- und Biotech-Unternehmen ausgewertet. Als Ergebnis zeigte sich:
• 55% der Verbraucher sind der Meinung, dass Medikamenten-Forschung und Entwicklung sich nicht am tatsächlichen medizinischen Bedarf orientiert. Bei den befragten Experten sind sogar über 70% dieser Ansicht.
• Etwa die Hälfte der Verbraucher und wiederum noch mehr Experten bezweifeln, dass die Pharma-Industrie über ausreichende Konzepte verfügt, um die Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten.
• Die Mehrheit der befragten Experten bezweifelt den korrekten Umgang der Pharmaindustrie mit Medikamentenstudien. So sind über 60 Prozent der Ansicht, dass die Arzneimittelhersteller häufig negative klinische Testergebnisse unterdrücken oder sogar manipulieren.
• Die verstärkten Werbeausgaben im US-Pharmamarkt tragen kaum zu einer Imageverbesserung bei. Nur 10 Prozent der Konsumenten fühlen sich durch die Arzneimittelwerbung sinnvoll und ausreichend informiert. Im Gegenteil, 94 Prozent sind sogar davon überzeugt, dass die Pharmaindustrie zu aggressiv für nicht zugelassene Anwendungsindikationen ihrer Produkte wirbt.
• Überraschend ist, dass sogar eine Mehrheit der Pharma-Manager am Informationsgehalt der direkt auf den Konsumenten ausgerichteten Werbung zweifelt. Besonders ausgeprägt ist die Kritik an den Werbebudgets unter den Branchenexperten. Über 90 Prozent halten den Marketingaufwand insgesamt für zu hoch, und über 70 Prozent sind der Ansicht, dass die Markenhersteller zu viel Geld für die Abwehr von konkurrierenden Generika ausgeben.
• Das Misstrauen beruht zum Teil auch auf Informationsdefiziten. So schätzen die meisten Verbraucher den Anteil der Medikamentenausgaben an den Gesundheitskosten viel zu hoch ein. Knapp 64 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass 40 bis 80 Prozent des amerikanischen Gesundheitsbudgets für Arzneimittel ausgegeben werden, weitere elf Prozent schätzen den Budgetanteil sogar auf mehr als 80 Prozent. Tatsächlich entfielen im Jahr 2004 nur 10 Prozent der Gesundheitsausgaben in den USA auf verschreibungspflichtige Medikamente.
Die Studie ist hier verfügbar (PDF, 32 Seiten): Recapturing the Vision: Restoring Trust in the Pharmaceutical Industry by Translating Expectations into Actions
Hier sind einige Grafiken mit Befragungsergebnissen in deutscher Sprache
Gerd Marstedt, 15.3.2007
Große Kampagne in den USA: Patienten sollen ihren Ärzten mehr Fragen stellen
 Mit einer groß angelegten Kampagne mit Radio- und TV-Werbespots sowie Anzeigen in Zeitungen und im Internet wollen mehrere US-amerikanische Gesundheitsbehörden in dieser Woche versuchen, Patienten zu einer stärkeren Mitarbeit bei medizinischen Behandlungen in Arztpraxen und Kliniken zu motivieren. Dazu wurde eine kostenlose Telefonhotline eingerichtet und auf einer speziellen Website "Questions Are The Answers" (Fragen sind die Antwort) finden Besucher Informationen, Anregungen und Formulierungshilfen, welche Fragen man als Patient bei welcher Gelegenheit seinem Arzt sinnvoller Weise stellen sollte. Auf insgesamt 28.000 Rundfunksendern werden eine Woche lang Informationen und Ratschläge verbreitet.
Mit einer groß angelegten Kampagne mit Radio- und TV-Werbespots sowie Anzeigen in Zeitungen und im Internet wollen mehrere US-amerikanische Gesundheitsbehörden in dieser Woche versuchen, Patienten zu einer stärkeren Mitarbeit bei medizinischen Behandlungen in Arztpraxen und Kliniken zu motivieren. Dazu wurde eine kostenlose Telefonhotline eingerichtet und auf einer speziellen Website "Questions Are The Answers" (Fragen sind die Antwort) finden Besucher Informationen, Anregungen und Formulierungshilfen, welche Fragen man als Patient bei welcher Gelegenheit seinem Arzt sinnvoller Weise stellen sollte. Auf insgesamt 28.000 Rundfunksendern werden eine Woche lang Informationen und Ratschläge verbreitet.
Hintergrund der für deutsche Verhältnisse zweifellos ungewöhnlichen Werbekampagne ist das Bemühen der staatlichen Gesundheitseinrichtungen um mehr Patientensicherheit, die Zahl der Komplikationen und Todesfälle im Rahmen der medizinischen Versorgung soll gesenkt werden. Nach Schätzungen staatlicher Einrichtungen kommt es aufgrund medizinischer Behandlungsfehler in Krankenhäusern der USA zu jährlich 44.000 bis 98.000 Todesfällen, also rund 120 tödlich verlaufenden ärztlichen "Kunstfehlern" täglich. Viele könnten nach Auffassung der Gesundheitsbehörden vermieden werden, wenn auch Patienten im Rahmen der Versorgung aktiver würden und sich stärker informieren und in eigener Sache engagierten.
Auf der Website "Questions Are The Answers" bekommen Patienten in Texten und auf Videos Hinweise und Informationen, wie sich selbst stärker in ihre medizinische Behandlung einmischen können. Für unterschiedliche Situationen im Rahmen der medizinischen Versorgung gibt es dort sogar die Möglichkeit, sich Fragen ausdrucken zu lassen, die sie ihrem niedergelassenen Arzt oder Klinikarzt stellen können. Angesprochen wird beispielsweise die Medikamentenverschreibung durch einen Arzt, ein vorgesehener Test oder eine Früherkennungsuntersuchung, eine vom Arzt übermittelte Diagnose oder vorgeschlagene Therapie oder auch der Vorschlag zu einer stationären Behandlung in einer Klinik.
Für den Fall einer Medikamentenverschreibung werden etwa folgende Fragen vorgeschlagen, die man einzeln auswählen, sich ausdrucken und dem Arzt vorlesen kann:
Wie heißt das Medikament ? Wie schreibt man das genau? Gibt es auch ein preiswerteres Mittel mit derselben Wirkung? Wozu ist das Medikament gut, was bewirkt es? Wie soll ich es einnehmen? Wann, zu welcher Uhrzeit soll ich es einnehmen? Wieviel soll ich jeweils einnehmen? Wie lange, wie viele Tage soll ich es einnehmen? Ab wann wirkt das Medikament? Kann ich es absetzen, wenn ich mich besser fühle? Was mache ich, wenn die Packung leer ist? Welche Nebenwirkungen hat das Medikament? Wann soll ich jemanden informieren, wenn ich solche Nebenwirkungen merke? Muss ich irgendwelche Getränke oder Speisen vermeiden oder bestimmte Tätigkeiten? Kann ich andere Arzneimittel weiter einnehmen? Vitamintabletten? Was soll ich machen, wenn ich die Einnahme einmal vergesse? Und was, wenn ich einmal mehr einnehme als verordnet? Gibt es schriftliche Informationen, die ich mit nach Hause nehmen kann? Muss ich irgendwelche medizinischen Untersuchungen mitmachen während der Zeit, in der ich das Mittel einnehme?
Der Vorschlag der US-Behörden, sich z.B. für den Fall einer Medikamentenverordnung Fragen ausdrucken zu lassen und dem Arzt dann vorzulesen, mag bei manchen deutschen Patienten ein mitleidiges Lächeln hervorrufen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass gerade in Deutschland Ärzte bei der Verordnung von Medikamenten besonders wenig Informationen vermitteln. Dies hat sich in mehreren Studien gezeigt, auch im europäischen Vergleich. (vgl. etwa: Peter Sawicki: Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland). Von daher erscheint eine Aufforderung an Patienten, ihrem Arzt mehr Fragen zu stellen, durchaus sinnvoll - wenn dieser Hinweis allein schon ausreicht, um ein entsprechendes Selbstbewusstsein auch in der Arztpraxis zu erzeugen.
• Hier ist die Pressemitteilung mit Hinweisen zum Hintergrund der Kampagne und Anregungen für Patienten: AHRQ and Ad Council Encourage Patients To Ask Questions and Get More Involved with Their Health Care
(Die "Agency for Healthcare Research and Quality" ist eine Einrichtung des U.S. Department of Health and Human Services. Das "Ad Council" ist eine nicht-kommerzielle Marketing-Einrichtung.)
•Website "Questions Are The Answers" mit Fragenvorschlägen auch für andere Situationen in der medizinischen Versorgung
Gerd Marstedt, 8.3.2007
Selbstzahlermarkt Gesundheitswesen: Konsumenten-Nirvana oder Käufer-Nepp? Was lehren die "self-pay markets" in den USA?
 Immer dann, wenn staatliche, intermediäre oder gemeinsame Einrichtungen oder die Selbstverwaltung von Krankenversicherern und Leistungserbringer daran scheitern, Verträge über möglichst preisgünstige aber qualitativ hochwertige Leistungen abzuschließen und die Patienten dazu zu bringen, diese Leistungen nachzufragen und zu akzeptieren, einigen sich die Gescheiterten darauf, diese schwierige Aufgabe, dem Patienten zu übertragen. Mit genügend Informationen über Preise und Qualitäten ausgestattet und mit kräftigen Sparanreizen bis hin zur völligen Vorfinanzierung in Kostenerstattungssystemen, erscheint der Patient geeignet, die Rolle eines einkaufenden Konsumenten ausfüllen zu können. Befreit von der bevormundenden und anonymen Preis- und Qualitätsregulierung durch dritte Parteien, werden diese Modelle als funktionierende Alternativen propagiert.
Immer dann, wenn staatliche, intermediäre oder gemeinsame Einrichtungen oder die Selbstverwaltung von Krankenversicherern und Leistungserbringer daran scheitern, Verträge über möglichst preisgünstige aber qualitativ hochwertige Leistungen abzuschließen und die Patienten dazu zu bringen, diese Leistungen nachzufragen und zu akzeptieren, einigen sich die Gescheiterten darauf, diese schwierige Aufgabe, dem Patienten zu übertragen. Mit genügend Informationen über Preise und Qualitäten ausgestattet und mit kräftigen Sparanreizen bis hin zur völligen Vorfinanzierung in Kostenerstattungssystemen, erscheint der Patient geeignet, die Rolle eines einkaufenden Konsumenten ausfüllen zu können. Befreit von der bevormundenden und anonymen Preis- und Qualitätsregulierung durch dritte Parteien, werden diese Modelle als funktionierende Alternativen propagiert.
Eine von der "California HealthCare Foundation" in Auftrag gegebene Studie, die von Forschern des Non-Profit-"Center for Studying Health System Change (HSC)" durchgeführt wurde, ist jetzt beendet und in der renommierten Zeitschrift "Health Affairs" in deren Web exklusive-Bereich zusammen mit einem langen Kommentar veröffentlicht worden. Beide Aufsätze fassen Erfahrungen aus den USA zusammen, also einem Land, in dem es die breitesten und längsten Erfahrungen mit derartigen Methoden und Anreizsystemen gibt.
Die auf vielen Interviews mit Gesundheitsmarkt-Experten, Leistungsanbietern, Berufsorganisationen und staatlichen Regulatoren basierende Studie "Self-Pay Markets in Health Care: Consumer Nirvana or Caveat Emptor (=Käufer sei auf der Hut)?" von Ha T. Tu and Jessica H. May (in: "Health Affairs 26, no. 2 (2007), w217-w226: published online 6 February 2007), kommt zu folgenden Erkenntnissen:
• Selbst wenn Patienten die gesamten Kosten einer medizinischen Behandlung aus eigener Tasche vorfinanzieren oder teilweise auch ganz allein zahlen müssen, suchen sie lediglich begrenzt durch systematische Vergleiche nach dem Angebot mit dem niedrigsten Preis und der höchsten Versorgungsqualität. Selbst dann, wenn die medizinischen Leistungen relativ übersichtlich sind und geradlinig zu erreichen sind, gibt es vor dem erwarteten Verhalten des "consumer Shopping" viele Barrieren.
• Auf dem näher betrachteten Markt für LASIK ( damit ist die Beseitigung von Kurz- und Weitsichtigkeit durch eine Laserbehandlung des Auges gemeint), der in den USA als ein idealer Selbstzahlermarkt gilt, sahen sich die Patienten zahlreichen Hürden, undurchsichtigen Rechnungen, fehlleitender Werbung und offenen Qualitätsfragen gegenüber. Ähnliches zeigte sich auf den Märkten für in vitro-Befruchtung, kosmetischer Nasenveränderung und Zahnkronen.
• Während diese Märkte und die genannten Anreize als ideal geeignete Modelle für kostensenkendes und qualitätsverbesserndes Konsumentenengagement gelten, verlassen sich nach den durchgeführten Untersuchungen Patienten bei der Wahl ihres Leistungserbringers oft nur auf mündliche Empfehlungen.
Der HSC-Präsident Paul Ginsburg verweist in seinem Co-Aufsatz "Shopping For Price In Medical Care. Insurers are best positioned to provide consumers with the information they need, but will they deliver?" (in: Health Affairs 26, no. 2 (2007): w208-w216. published online 6 February 2007) darauf, dass die laufenden Bemühungen, die Preistransparenz zu Gesundheitsleistungen für die genannten Ziele zu verbessern, oft die komplexen Entscheidungen über medizinische Behandlungen, die Abhängigkeit der Patienten von ärztlichen Ratschlägen und die Notwendigkeit von Qualitätsinformationen herunterspielten. Dem Patienten einfach eine Preisliste von "à la carte"-Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, hilft ihm bei den komplexen Wahlentscheidungen über preisgünstige und qualitativ gute Leistungen und Leistungserbringer wenig.
Für die USA kommen die Forscher und der HSC-Präsident zu der politischen Empfehlung, nicht die Rolle von "health plans", also der kollektiven Organisation, bei der Aushandlung besserer Preise und der verständlichen Übersetzung komplexer Preis- und Qualitätsdaten in nützliche handlungssteuernde Informationen für das Patientenverhalten im Gesundheitsmarkt aus dem Auge zu verlieren.
Da nicht zu erwarten ist, dass deutsche Versicherte und Patienten von Natur aus bessere Konsumenten sind oder deutsche Informationssysteme den us-amerikanischen Marktsystemen überlegen sind, verdienen die kritischen Bewertungen der empirischen Steuerungsfähigkeit durch einzelne Konsumenten gerade in der aufkommenden Begeisterung für deren Rolle im deutschen Gesundheitswesen einer gewissen Aufmerksamkeit.
Die kalifornischen Auftraggeber ziehen für sich folgenden Schluss: "Unlike shopping for a car or going to a restaurant, there is no easily-obtained 'list price' or menu of medical services. We commissioned this research to highlight the disconnect between consumers' growing financial responsibility for medical care and the lack of easily-accessible cost and quality information to guide decision-making."
Hier finden Sie den komplett kostenfreien Text des 10 Seiten umfassenden Aufsatzes "Self-Pay Markets In Health Care: Consumer. Nirvana Or Caveat Emptor? Experience with LASIK, dental crowns, and other self-pay procedures reveals key barriers to robust consumer price shopping" von Ha T. Tu and Jessica H. May in der Web exklusive-Ausgabe von "Health Affairs".
Außerdem können Sie hier auch den 9 Seiten umfassenden Aufsatz
"Shopping For Price In Medical Care. Insurers are best positioned to provide consumers with the information they need, but will they deliver?" von Paul Ginsburg kostenfrei komplett herunterladen
Bernard Braun, 6.2.2007
USA: Unternehmer und Ökonomen für die Existenz und Erhöhung eines Mindestlohns.
 In Deutschland warnt z. B. der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven in einer Presseerklärung am 29.1.2007 vor der Einführung allgemeiner Mindestlöhne. Seine Befürchtung: "Mindestlöhne würden die Arbeitskosten für einfache Tätigkeiten in vielen Branchen und Regionen erheblich verteuern. Die Folge wären Wegfall oder Verlagerung dieser Jobs ins Ausland" und nach Berechnungen des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums würde ein gesetzlicher Mindeststundenlohn von 7,50 Euro rund 2,4 Millionen Arbeitsplätze vor allem im Niedriglohnbereich akut gefährden.
In Deutschland warnt z. B. der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven in einer Presseerklärung am 29.1.2007 vor der Einführung allgemeiner Mindestlöhne. Seine Befürchtung: "Mindestlöhne würden die Arbeitskosten für einfache Tätigkeiten in vielen Branchen und Regionen erheblich verteuern. Die Folge wären Wegfall oder Verlagerung dieser Jobs ins Ausland" und nach Berechnungen des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums würde ein gesetzlicher Mindeststundenlohn von 7,50 Euro rund 2,4 Millionen Arbeitsplätze vor allem im Niedriglohnbereich akut gefährden.
Ganz anders sieht die Debatte und Positionierung in Teilen der Unternehmerschaft und der Wissenschaft ausgerechnet der USA aus. Zur Erinnerung: In den USA gibt es bereits seit langem einen gesetzlichen Mindestlohn, der laufend erhöht wird, aber natürlich von Anbeginn bis zur letzten ERhöhung ebenfalls mit ähnlichen Argumenten "verteufelt" wurde.
In einem Artikel ("Slapping the invisible hand")vom 29.1. 2007 auf der Website der liberalen Initiative Tompaine.common.sense werden zahlreiche Unternehmerinitiativen für den Mindestlohn vorgestellt, in denen Klein- und Mittelunternehmer genauso aktiv sind wie Führungskräfte größerer Unternehmen. Auf der Unterschriftenliste "Business for a fair minimum wage" finden sich hunderte von Unternehmern, die sich gegen den zu niedrigen Minimallohn von US-$ 5,15 und die dafür verbreiteten Begründungen wenden sowie für eine Erhöhung auf $ 7,25 im Jahre 2009 plädieren.
Das Arbeitspapier 178 des ebenfalls liberalen "Economic Policy Institute (EPI)" mit dem Titel "MINIMUM WAGE TRENDS. Understanding past and contemporary research" bewertet die auch in den USA immer wieder in die Debatte geworfenen dramatischen Negativprognosen über die Wirkungen der Einführung und Erhöhung von Mindestlöhnen auf der Basis zahlreicher und mehrjähriger Studien folgendermaßen: "There is a growing view among economists that the minimum wage offers substantial benefits to low-wage workers without negative effect. Although there are still dissenters, the best recent research has shown that the job loss reported in earlier analyses does not, in fact, occur when the minimum wage is increased. There is little question that the overall impact of a minimum wage is positive."
Sicherlich können und dürfen auch hier viele Positionen und Konzepte aus den USA nicht umstandslos nach Deutschland importiert werden. Dass es in den USA eine breite Initiative für einen Mindestlohn und gegen das Schüren negativer Folgewirkungen gibt, sollte die deutschen Diskutanten trotzdem nachdenklich stimmen.
Eine PDF-Datei der 11-seitigen EPI-Studie von Liana Fox zum Thema "MINIMUM WAGE TRENDS. Understanding past and contemporary research" können Sie hier herunterladen.
Bernard Braun, 29.1.2007
USA: "Todesart Mord" eindeutig abhängig von der "Freiheit" des Waffenbesitzes
 Trotz der derzeit in den USA sinkenden Tendenz gehören Morde immer noch zu einer der häufigeren Todesursachen und tragen kräftig dazu bei, dass manche Bundesstaaten mehr für Gefängnisse als für Schulen und Hochschulen (so z.B. Kalifornien) ausgeben. Jedes dritte Mordopfer wird mit einer Handfeuerwaffe umgebracht. Trotzdem wird der nahezu barrierefreie Zugang und Besitz von Waffen in den USA von einer einflussreichen Waffenlobby als ein Freiheitsrecht verteidigt und hartnäckig der Zusammenhang von freiem Waffenbesitz und Gewaltkriminalität bestritten. Während die so genannte Healthismus-Bewegung in den USA in Bereichen wie dem Rauchen, dem Fett- und Cholesteringehalt in Lebensmitteln oder beim Übergewicht regelrechte "Präventionskriege" führte und führt, gab es bis in die Gegenwart hinein noch nicht einmal solide wissenschaftliche Analysen über den möglichen Zusammenhang von Waffenbesitz und der Häufigkeit von Morden.
Trotz der derzeit in den USA sinkenden Tendenz gehören Morde immer noch zu einer der häufigeren Todesursachen und tragen kräftig dazu bei, dass manche Bundesstaaten mehr für Gefängnisse als für Schulen und Hochschulen (so z.B. Kalifornien) ausgeben. Jedes dritte Mordopfer wird mit einer Handfeuerwaffe umgebracht. Trotzdem wird der nahezu barrierefreie Zugang und Besitz von Waffen in den USA von einer einflussreichen Waffenlobby als ein Freiheitsrecht verteidigt und hartnäckig der Zusammenhang von freiem Waffenbesitz und Gewaltkriminalität bestritten. Während die so genannte Healthismus-Bewegung in den USA in Bereichen wie dem Rauchen, dem Fett- und Cholesteringehalt in Lebensmitteln oder beim Übergewicht regelrechte "Präventionskriege" führte und führt, gab es bis in die Gegenwart hinein noch nicht einmal solide wissenschaftliche Analysen über den möglichen Zusammenhang von Waffenbesitz und der Häufigkeit von Morden.
Dies hat sich mit der ersten für die gesamte USA repräsentativen Studie von Wissenschaftlern des "Harvard Injury Control Research Center" an der Harvard School of Public Health geändert. Die Studiengruppe von Miller et al. werden ihre Ergebnisse im Februarheft der Fachzeitschrift "Social Science and medicine" (2007 Feb.;64(3):656-64) unter dem Titel "State-level homicide victimization rates in the US in relation to survey measures of household firearm ownership, 2001-2003" veröffentlichen.
Danach ist für den genannten Zusammenhang auf der Basis von 200.000 Befragten nun u. a. folgendes eindeutig gesichert:
• Die Mordraten bei Kindern, Frauen und Männern aller Altersstufen sind in Bundesstaaten der USA mit einer größeren Anzahl von Waffen eindeutig, d.h. statistisch hochsignifikant höher. Dabei wurde der Einfluss vieler immer wieder bei Gewalt genannter Einflussfaktoren, wie etwa der Arbeitslosigkeit, des Alkoholkonsum oder des Wohnens in städtischen Ballungsgebieten kontrolliert
• Unter diesen Bundesstaaten, hatten die Staaten, die im obersten Viertel der Waffenbesitz-Skala lagen um 114 % höhere Morde mit Waffen als die, die im niedrigsten Viertel des Waffenbesitzes ("firearm prevalence"). Die Mordraten in allen Staaten mit hohem Waffenbesitz war 60 % höher als in allen Staaten mit einem niedrigerem Besitz an Waffen.
• In einem von drei us-amerikanischen Haushalten gab es Waffenbesitzer.
• Potenzielle Täter erhalten in Staaten mit bereits hohem Niveau des Waffenbesitzes leichter eine Waffe als in Staaten mit niedriger Waffenbesitzrate.
Hier finden sie die Presseerklärung der Harvard- Universität zu dieser Studie.
Bernard Braun, 15.1.2007
Health, United States, 2006 erschienen
 Auf 559 Seiten der aktuellen Ausgabe des Reports "Health, United States, 2006" finden sich eine Fülle statistischer Angaben über die wichtigsten Bereiche und Aspekte der Gesundheit und Gesundheitsversorgung der us-amerikanischen Bevölkerung.
Auf 559 Seiten der aktuellen Ausgabe des Reports "Health, United States, 2006" finden sich eine Fülle statistischer Angaben über die wichtigsten Bereiche und Aspekte der Gesundheit und Gesundheitsversorgung der us-amerikanischen Bevölkerung.
Dazu gehören z.B.
• der Anstieg der Lebenserwartung bei der Geburt von 75 Jahren im Jahr 1990 auf für die USA rekordverdächtige, international aber eher geringe fast 78 Jahre in 2004,
• die Abnahme der Geburtsrate der 15 bis 19-Jährigen Teenager im 13. Jahr hintereinander auf 41 Geburten pro 1.000 Frauen diesen Alters,
• die weitere Abnahme der Kindersterblichkeit auf 6,8 Kinder auf 1.000 Lebendgeborene in 2004,
• der Rückgang des Anteils von Besuchen bei niedergelassenen Ärzten auf 23 % (1980 betrug dieser Anteil 34 %),
• der Rückgang der Ermordungsrate der 15-19-jährigen afroamerikanischen Männer um 12 % von 2003 auf 2004, und das obwohl Mord weiterhin die führende Todesart der Angehörigen dieser Gruppe blieb,
• die abnehmenden Abstände bei der Lebenserwartung von Männern und Frauen aber auch von weißen und afroamerikanischen BürgerInnen und
• die weitere Verringerung der altersadjustierten Sterberaten der "leading killers" Herzerkrankungen und Krebs.
Im jährlich wechselnden inhaltlichen Schwerpunkt des Statistikbandes erfährt man dieses Mal mehr über die Häufigkeit und die Arten von Schmerz.
Dass es sich auch in den USA um eines der verbreitesten gesundheitlichen Probleme handelt, zeigt die Angabe, dass ein Fünftel der 65 Jahre und älteren Bevölkerung mindestens an einem Tag des letzten Monats vor der entsprechenden Nachfrage wenigstens einen Tag an Schmerzen litt. Beinahe drei Fünftel dieser Schmerz-Personengruppe litt darunter dann ein Jahr oder länger. Mehr als ein Viertel der befragten Personen hatte in den letzten 3 Monaten Erfahrungen mit Lendenwirbelsäulenschmerzen. Der Anteil der Erwachsenen, die im letzten Monat ein Schmerzmittel nahmen, wuchs zwischen 1988-94 und 1999-2002 von 3,2 % auf 4,2 %.
Wer sich für zusätzliche Zeitreihen-Daten, Datentabellen, mit Powerpoint präsentierbare Grafiken oder ein Chartbook interessiert, kann diese ergänzend zu dem Report herunterladen. Hier gibt es auch ständig aktualisierte Daten zu wichtigen Indikatoren des Reports. Außerdem kann man sich hier für den Erhalt der Information über Updates etc. registrieren lassen.
Hier finden Sie die kostenlose sehr umfangreiche PDF-Datei von "Health, United States, 2006".
Bernard Braun, 25.11.2006
USA - die ganz andere Geschichte der Krankenversorgung in den USA
 Egal ob man dem privatwirtschaftlich und marktlich organisierten Kern des US-Gesundheitssystems prinzipiell ablehnend gegenübersteht oder eine Reihe seiner Strukturen und Prozeduren für nachahmenswert hält - aber "natürlich ohne die Auswüchse": Der Wissensstand über dieses System und seine lange Entstehungsgeschichte ist gering und nicht einfach zu verbessern.
Egal ob man dem privatwirtschaftlich und marktlich organisierten Kern des US-Gesundheitssystems prinzipiell ablehnend gegenübersteht oder eine Reihe seiner Strukturen und Prozeduren für nachahmenswert hält - aber "natürlich ohne die Auswüchse": Der Wissensstand über dieses System und seine lange Entstehungsgeschichte ist gering und nicht einfach zu verbessern.
Wer nicht weiß, dass in den 1920er Jahren für wichtige politische Akteure in den USA die "allgemeine Krankenversicherung ... der Versuch der Deutschen (!) (ist), mittels des sozialistisch-bolschewistischen deutschen Krankenversicherungsmodells eine Revolution in den USA vorzubereiten" oder die Gewerkschaften Seit an Seit mit Ärzteverbänden gegen eine am deutschen Vorbild orientierte allgemeine Krankenversicherung kämpften, kann manche aktuelle Situation nicht richtig verstehen.
Etwas Abhilfe schafft hier die umfangreiche Foliensammlung des Sozialmediziners Jens-Uwe Niehoff, die aus der Perspektive der Krankenversicherung und der Krankenversicherten sowie der Ärzte eine Fülle von historischen Entwicklungslinien und ihre gegenwärtigen Ausprägungen transparent macht.
Wie der Titel "Die Transformation des Systems der Krankenversorgung in den USA - ein medizinisches Versorgungsmodell zwischen Hoffnung und Befürchtung" ankündigt, stellt der Verfasser auch ausführlich die Umbauten des US-Systems in Richtung "managed competition" und "managed care industry" und die Alternative eines "single payer"-Systems dar. Um welche gewaltigen Interessen es dabei geht zeigt eine Zahl: Der US-Kongress schätzte 2004, dass ein single payer-System jährlich 225 Mrd. US-Dollar weniger kosten würde als das real existierende und außerdem das Nichtversichertenproblem lösen würde. Trotzdem gibt es keine breite Bewegung (sieht man von Massachusetts ab) in Richtung dieser Alternative.
Hier finden Sie die Powerpoint-Folien: Die Transformation des Systems der Krankenversorgung in den USA
Bernard Braun, 5.11.2006
Alte und neue Informationsquellen zum Medicaid-Programm der USA
 Im Jahre 2004 erhielten knapp 44 Millionen US-Amerikaner, darunter fast 20 Millionen Kinder, die sich wegen ihres niedrigen Einkommens keine private Krankenversicherung leisten konnten, ihren Krankheits-Versicherungsschutz über das 1965 geschaffene staatliche und steuerfinanzierte Medicaid-Programm. Rund ein Viertel der Gesamtausgaben der Bundesstaaten fließen mittlerweile in die Finanzierung von Medicaid.
Im Jahre 2004 erhielten knapp 44 Millionen US-Amerikaner, darunter fast 20 Millionen Kinder, die sich wegen ihres niedrigen Einkommens keine private Krankenversicherung leisten konnten, ihren Krankheits-Versicherungsschutz über das 1965 geschaffene staatliche und steuerfinanzierte Medicaid-Programm. Rund ein Viertel der Gesamtausgaben der Bundesstaaten fließen mittlerweile in die Finanzierung von Medicaid.
Wer sich über Einzelheiten von Medicaid genauer informieren will, findet mehrere gute Informationsquellen. Wer dort überhaupt Mitglied werden kann oder darf, welche Leistungen erhältlich sind, wie das Programm finanziert wird und wie seine Verwaltung funktioniert zeigt das bereits 2002 veröffentlichte "Medicaid Resource Book".
Wer sich über die 40-jährige Geschichte von Medicaid und seine zahlreichen gesetzlichen Veränderungen informieren will, kann auf der von der Kaiser Familiy Foundation (KFF) angebotenen und ständig aktualisierten Website "Medicaid: A Timeline of Key Developements" eine Menge Material finden.
Noch material- und faktenreicher sind zwei ebenfalls von der KFF angebotenen interaktiven Datentools für die Jahre 2003 und 2004. Die "State Medicaid Fact Sheets" liefern für jeden Bundesstaat neben demografischen Daten, Angaben zum Versicherungsschutz und seinen Grenzen auch Informationen zu den Ausgaben für die wichtigsten Leistungsbereiche und zur jeweiligen Zuzahlungspolitik. Vergleiche der jeweiligen Bundesstaat-Daten mit denen der gesamten USA sind fester Bestandteil.
Das Tool "Medicaid Benefits Online Database" gibt ebenfalls für jeden der 50 Bundesstaaten, Washington D.C. und 5 weitere zu den USA gehörige Regionen (z.B. Puerto Rico) aktuelle und detaillierte Einsichten in die Art und den Umfang der von Medicaid angebotenen und bezahlten Versorgungsleistungen.
Den breitesten Überblick über die Fülle von finanziellen, rechtlichen, politischen und qualitativen Einzelaspekten erhält man schließlich auf der offiziellen Website der "Centers for Medicare and Medicaid Services". Die Fülle der über einen sehr differenziert aufgebauten Index erreichbaren Informationen reicht von "Americans with disabilities act" bis zu "Waived survey project". Hier kann man sich auch einen vollständigen Überblick über die Vielzahl der staatlichen oder privaten Angebote und Programme verschaffen.
Bernard Braun, 11.11.2005