



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Gesundheitssystem"
Internationaler Gesundheitssystem-Vergleich |
Alle Artikel aus:
Gesundheitssystem
Internationaler Gesundheitssystem-Vergleich
Verantwortungsvolle Gesundheitsfinanzierung: Verfahren und Gestaltung gleichermaßen wichtig
 Die Forderung nach good governance bestimmt seit vielen Jahren die entwicklungspolitische Landschaft: Gute Regierungspolitik, besser die verantwortungsvolle Führung der Staatsgeschäfte, bezieht sich auf alle Lenkungsaktivitäten der öffentlichen Hand und setzt einen leistungsfähigen und zuverlässigen Staat voraus. Vielerorts verhindern aber fehlende Rechtsstaatlichkeit, Verletzung der Menschenrechte und weit verbreitete Korruption jegliches Vertrauen in den Staat und die wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung der Länder. Fehlende politische Verantwortlichkeit konterkariert auch die globalen Bemühungen um universellen Zugang zu Gesundheit und sozialer Sicherung. Verantwortungsvolle Organisation und Abwicklung der Gesundheitsfinanzierung schließt auch die Durchsetzung rechtsbasierter Versorgungsansprüche ein und ist unerlässlich für die Stärkung der Gesundheitssysteme und die Ausweitung der sozialen Absicherung im Krankheitsfall.
Die Forderung nach good governance bestimmt seit vielen Jahren die entwicklungspolitische Landschaft: Gute Regierungspolitik, besser die verantwortungsvolle Führung der Staatsgeschäfte, bezieht sich auf alle Lenkungsaktivitäten der öffentlichen Hand und setzt einen leistungsfähigen und zuverlässigen Staat voraus. Vielerorts verhindern aber fehlende Rechtsstaatlichkeit, Verletzung der Menschenrechte und weit verbreitete Korruption jegliches Vertrauen in den Staat und die wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung der Länder. Fehlende politische Verantwortlichkeit konterkariert auch die globalen Bemühungen um universellen Zugang zu Gesundheit und sozialer Sicherung. Verantwortungsvolle Organisation und Abwicklung der Gesundheitsfinanzierung schließt auch die Durchsetzung rechtsbasierter Versorgungsansprüche ein und ist unerlässlich für die Stärkung der Gesundheitssysteme und die Ausweitung der sozialen Absicherung im Krankheitsfall.
Dass sich good financial governance in der Gesundheitsfinanzierung nicht auf das Funktionieren des Finanzierungssystems beschränken darf, sondern in entscheidendem Maße auch von den Finanzquellen, der Lastenverteilung bzw. dem Umverteilungspotenzial abhängt, zeigt ein soeben erschienenes Arbeitspapier des Fachbereichs Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda. Unter dem Titel Good Governance and Redistribution in Health Financing: Pro-poor effects and general challenges analysiert der Autor Jens Holst zunächst ausführlich die Verteilungswirkungen der verschiedenen Gesundheitsfinanzierungsformen im Hinblick auf wesentliche Kriterien wie Universalität, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Das Arbeitspapier aus der Fuldaer Serie pg papers zeigt verschiedene Zusammenhänge auf:
Im Gesundheitswesen umfasst Governance alle regulierenden und steuernden Maßnahmen von Regierungen oder anderen öffentlichen Entscheidungsträgern und schließt den transparenten, korrekten Umgang des Staats mit seinen Einnahmen sowie die nachvollziehbare Verwendung der Mittel zum Wohle der Bevölkerung ein. Daher verfolgt zum Beispiel die deutsche Entwicklungspolitik auch die Förderung von Good Financial Governance, also den Aufbau eines funktionierenden Systems öffentlicher Finanzen. Verantwortungsvoller Umgang mit Finanzmitteln ist nicht zuletzt auch bei der Gesundheitsfinanzierung unerlässlich. Neben Ansätzen, Strategien und Programmen zur Einrichtung, Verwaltung und Kontrolle von Finanzströmen nach gesetzlichen Vorgaben oder ergebnisorientierten Indikatoren muss Governance in der Gesundheitsfinanzierung unweigerlich die Frage einschließen, inwieweit die Ressourcengenerierung, -mischung und -allokation in sozial gerechter, fairer und nachhaltiger Weise organisiert sind.
Individuelle und kollektive finanzielle Nachhaltigkeit, Lastenaufteilung und soziale Kohärenz oder Solidarität sind wesentliche Bestandteile von Governance in der Gesundheitsfinanzierung und hängen stark von gesellschaftlichen Prioritäten und Werten ab. Soziale Gerechtigkeit bei der Finanzierung, transparente Risikomischung und Rechenschaftspflicht beim Einkauf von Gesundheitsleistungen sind intrinsische Elemente von Governance in der Gesundheitsfinanzierung und entscheidend für die Erreichung des Ziels einer universellen Absicherung im Krankheitsfall. Dabei liegt die Verantwortung für ein transparentes, rechenschaftspflichtiges und verlässliches Gesundheitsfinanzierungssystem bei den Regierungen, die Transparenz und gute finanzielle Steuerung gewährleisten müssen.
Im Hinblick auf nachhaltige, sozial gerechte und somit verantwortungsvolle Gesundheitsfinanzierung zeigt das Papier einige grundlegende Lehren auf:
• Universelle Absicherung im Krankheitsfall ist allein durch öffentliche Gesundheitsfinanzierung, also über Steuern oder Sozialversicherungen für (nahezu) die gesamte Bevölkerung eines Landes möglich;
• Steuerfinanzierung bietet zwar erhebliche Vorteile gegenüber sozialen Krankenversicherungssystemen im Hinblick auf die universelle Bevölkerungsabsicherung, ihre Verteilungswirkungen und die Fairness der Steuerfinanzierung hängen aber vom jeweiligen Steuersystem ab, nämlich der Effektivität der Steuererhebung, der Ausgestaltung des Besteuerungssystems und nicht zuletzt der Verteilung der Einnahmen aus direkten und indirekten Steuern;
• Soziale Krankenversicherungssysteme können relevante Umverteilungseffekte entfalten, aber nur, wenn sie die gesamte Bevölkerung einschließen und kein Ausscheren in private Alternativsysteme erlauben;
• Globale öffentlich-private Partnerschaften und vertikale Gesundheitsprogramme haben bisher keinen erkennbaren Beitrag zur Gesundheitssystemstärkung und -finanzierung geleistet;
• Innovative Geldquellen wie Finanztransaktionssteuern sind für die Aufstockung der Mittel zum Aufbau wirksamer Krankenversorgungssysteme unerlässlich.
Good financial governance im Gesundheitswesen hängt immer von der Fähigkeit des Systems ab, Ressourcen für den Aufbau und die finanzielle Ausstattung sozialer Sicherungs- und Umverteilungssysteme zu mobilisieren und bereitzustellen und dabei die finanzielle Belastung durch medizinische Versorgungsleistungen sozial gerecht zu verteilen. Insgesamt erweist sich die Finanzierung über öffentliche Mittel, also durch Steuermittel und/oder Sozialversicherungsbeiträge, als nachhaltiger und sozial gerechter als über private Quellen, nämlich private Krankenversicherungen oder Selbstzahlung. Allerdings hängen die gesamtgesellschaftlichen Verteilungswirkungen unmittelbar von der Gestaltung des Steuersystems und Effektivität der Steuererhebung bzw. von der bevölkerungsbezogenen Breite und der Organisation bestehender sozialer Krankenversicherungen ab.
Das Arbeitspapier zum Thema Gesundheitsfinanzierung good governance steht kostenlos zum Download zur Verfügung: pg paper 2/2017.
Bernard Braun, 25.5.17
Zu viel und zu wenig Medizin - Artikelserie Right Care im Lancet
 Die bisher umfangreichste Aufarbeitung der Themen Overuse und Underuse bzw. Über-, Unter- und Fehlversorgung sowie deren Ursachen und Strategien zur Abhilfe ist am 8.1.2017 im Lancet erschienen.
Die bisher umfangreichste Aufarbeitung der Themen Overuse und Underuse bzw. Über-, Unter- und Fehlversorgung sowie deren Ursachen und Strategien zur Abhilfe ist am 8.1.2017 im Lancet erschienen.
27 AutorInnen aus 9 Ländern legen dar, dass Overuse und Underuse ein weltweites Problem darstellen mit jeweils nationaler Ausprägung.
Die 4-teilige Serie und 3 Kommentare sind kostenfrei zugänglich Link
1 Evidence for overuse of medical services around the world
Shannon Brownlee, Kalipso Chalkidou, Jenny Doust, Adam G Elshaug, Paul Glasziou, Iona Heath, Somil Nagpal, Vikas Saini, Divya Srivastava, Kelsey Chalmers, Deborah Korenstein
2 Evidence for underuse of effective medical services around the world.
Paul Glasziou, Sharon Straus, Shannon Brownlee, Lyndal Trevena, Leonila Dans, Gordon Guyatt, Adam G Elshaug, Robert Janett, Vikas Saini
3 Drivers of poor medical care.
Vikas Saini, Sandra Garcia-Armesto, David Klemperer, Valerie Paris, Adam G Elshaug, Shannon Brownlee, John P A Ioannidis, Elliott S Fisher
4 Levers for addressing medical underuse and overuse: achieving high-value health care.
Adam G Elshaug, Meredith B Rosenthal, John N Lavis, Shannon Brownlee, Harald Schmidt, Somil Nagpal, Peter Littlejohns, Divya Srivastava, Sean Tunis, Vikas Saini
Die Right Care-Serie schließt sich an die Artikelserie "Research: increasing value, avoiding waste" an, die Anfang 2014 im Lancet erschienen ist und ebenfalls kostenfrei zugänglich ist Link
David Klemperer, 2.3.17
"Englische Zustände" oder "point of reference": OECD-Report zur Versorgungsqualität in Großbritannien
 Wen bei Vergleichen verschiedener Gesundheitssysteme die jeweilige Qualität der angebotenen Leistungen interessiert oder wer für den eigenen Gebrauch nach "models of good practice" der Qualitätssicherung einer Vielzahl von Gesundheitsleistungen sucht, findet in der seit 2012 von der OECD herausgegebenen Reihe "Reviews of Health Care Quality" genügend Material. Bisher liegen solche Berichte für Australien, Japan, Portugal, Italien, Türkei, Tschechien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Israel und Korea vor.
Wen bei Vergleichen verschiedener Gesundheitssysteme die jeweilige Qualität der angebotenen Leistungen interessiert oder wer für den eigenen Gebrauch nach "models of good practice" der Qualitätssicherung einer Vielzahl von Gesundheitsleistungen sucht, findet in der seit 2012 von der OECD herausgegebenen Reihe "Reviews of Health Care Quality" genügend Material. Bisher liegen solche Berichte für Australien, Japan, Portugal, Italien, Türkei, Tschechien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Israel und Korea vor.
Hinzu kommt im Februar 2016 ein Bericht über Großbritannien bzw. die auch bei der Versorgungsqualität teilweise unterschiedlichen Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland.
Wer mit dem Stichwort Großbritannien und Behandlungsqualität nur "englische Zustände" und/oder endlose Warteschlange assoziiert, wird in dem Report gründlich eines Besseren belehrt.
So heben déssen Verfasser viel Positives und Vorbildliches hervor: "The United Kingdom's drive to continuously strengthen quality assurance, monitoring and improvement means that it has pioneered, or implemented more widely and deeply than elsewhere, several tools and approaches to monitoring and improving health care quality. The United Kingdom has become a point of reference, for example, in the development of evidence-based clinical guidelines; resources to support clinicians to stay up to date and engage in on-going professional development; use of patient surveys and patient reported outcome measures; data-linkage, transparency and public reporting; as well as reporting and learning from adverse events."
Kritik- und verbesserungswürdig und auch in anderen Gesundheitssystemen nicht unbekannt sind aber folgende Seiten der Qualitätssicherung in Großbritannien: "First, greater emphasis on bottom-up approaches, led by patients and clinicians, should be encouraged. As the same time there is scope to simplify the range of institutions and policies regulating health care quality at national and local level. Finally, renewed focus on the quality at the interfaces of care, as well as on community-based services, is needed."
Um Antworten auf die Frage zu erhalten, warum ein in weiten Teilen vorbildliches Gesundheitssystem trotzdem eine Reihe gewichtiger Qualitätsmängel hat, empfehlen die Verfasser folgendes Verfahren: "To secure continued quality gains, the four health systems will need to balance top-down approaches to quality management and bottom-up approaches to quality improvement; publish more quality and outcomes data disaggregated by country; and, establish a forum where the key officials and clinical leaders from the four health systems responsible for quality of care can meet on a regular basis to learn from each other's innovations."
Den materialreichen 296 Seiten umfassenden Bericht OECD Reviews of Health Care Quality: United Kingdom 2016: Raising Standards aber auch andere Reports dieser Reihe kann man kostenlos nur am Bildschirm lessen.
Bernard Braun, 29.2.16
"Und träumen vom Sommer in Schweden" aber auch vom dortigen Gesundheitssystem!?
 Während es sich "verschüttet im Regen" (so der aktuelle Song von Revolverheld) leicht vom schwedischen Sommer träumen lässt, benötigt man für die Beantwortung der Frage nach dem Gesundheitssystem in Schweden schon etwas mehr gesichertes Wissen.
Während es sich "verschüttet im Regen" (so der aktuelle Song von Revolverheld) leicht vom schwedischen Sommer träumen lässt, benötigt man für die Beantwortung der Frage nach dem Gesundheitssystem in Schweden schon etwas mehr gesichertes Wissen.
In kompakter Form liefert dies der am 1. Januar 2015 erschienene erste Aufsatz einer geplanten Serie über internationale Gesundheitssysteme des "New England Journal of Medicine (NEJM)" - in Zusammenarbeit mit dem liberalen US-Think Tank "Commonwealth Fund".
Auch 2015 wird die schwedische Gesundheitsreformpolitik zwar ähnlich wie bereits 1973 als "not very rational" charakterisiert, deren "strong commitment to equality in health care services" aber anerkennend als Rechtfertigung genannt. Wie der Titel des Aufsatzes andeutet, ist das schwedische Gesundheitssystem auch nuancierter als es seine Gleichheitsverpflichtung und seine öffentlich-staatliche Grundstruktur zunächst erwarten lassen. So gibt es z.B. einerseits seit 2007 eine Reprivatisierung des seit 1970 existierenden staatlichlichen Apothekenmonopols. Andererseits zeigen aber Studien, dass "the Swedish public wants choice but is more skeptical about profit incentives in tax-funded markets and about the payment of dividends by health care providers to owners". Letzteres verhindert auch faktisch eine weitere Verbreitung gewinnorientierter Akteure im schwedischen Gesundheitssystem.
Der Aufsatz enthält zusätzlich zur Darstellung des "Public-Private Pendulum" eine Auswahl wichtiger Indikatoren zur Struktur und zum Outcome des schwedischen Gesundheitssystems.
Der Aufsatz The Public-Private Pendulum — Patient Choice and Equity in Sweden von Anders Anell ist am 1. Januar 2015 im NEJM (372: 1-4) erschienen und kostenlos zugänglich.
Wer an vergleichbaren Informationen über weitere Gesundheitssysteme interessiert ist, sollte regelmäßig nach Beiträgen in der Rubrik "International Health Care Systems" des NEJM suchen.
Bernard Braun, 6.1.15
Mehr Gesundheitsausgaben, mehr Lebenszeit und Gesundheit oder auch weniger!? Interessantes aus OECD-/US-Bundesstaaten-Vergleichen
 Wer glaubt, viele Gesundheitsausgaben bewirkten bessere Gesundheit oder verlängerten die Lebenserwartung oder wer nicht glaubt, höhere Gesundheitsausgaben könnten mit geringerer Lebenserwartung assoziiert sein, bekommt in einem anderthalbseitigen, am 16. Oktober 2014 online in der Zeitschrift "JAMA" veröffentlichten Text etwas Stoff zum Nachdenken.
Wer glaubt, viele Gesundheitsausgaben bewirkten bessere Gesundheit oder verlängerten die Lebenserwartung oder wer nicht glaubt, höhere Gesundheitsausgaben könnten mit geringerer Lebenserwartung assoziiert sein, bekommt in einem anderthalbseitigen, am 16. Oktober 2014 online in der Zeitschrift "JAMA" veröffentlichten Text etwas Stoff zum Nachdenken.
Die Denkanstöße finden sich in einem einzigen Diagramm, das für 24 Mitgliedsländer der OECD sowie US-Bundesstaaten mit geringem oder hohem Einkommen die durchschnittliche Lebenserwartung sowie den prozentualen Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2009 darstellt.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählt:
• In entwickelten Ländern gibt es keine statistisch signifikante positive Assoziation zwischen Gesundheitsausgaben und Lebenserwartung.
• Dies gilt auch für die 25 reicheren US-Bundesstaaten. Bei den 25 ärmeren US-Bundesstaaten gibt es eine statistisch signifikante Korrelation, aber eine diametral andere als möglicherweise erwartet: höhere Gesundheitsausgaben sind nämlich dort mit einer geringeren Lebenserwartung assoziiert. Offensichtlich ein Effekt der dort stärkeren Morbidität.
• Für die inneren Verhältnisse der USA gibt es einige weitere interessante Details: So gibt selbst der US-Bundesstaat mit den geringsten Gesundheitsausgaben mit 12,6% vom BIP mehr aus als die Niederlande als das OECD-Land mit dem höchsten BIP-Anteil für Gesundheit (11,9%).
Für die hier angestellten und andere Gesundheitssystemvergleiche empfiehlt der Autor abschließend, in jedem Fall noch andere Einfluss- und Outcomefaktoren einzubeziehen als Lebenserwartung und Gesundheitsausgaben. Er denkt dabei an die meist komplexere aber auch schwieriger zu ermittelnde Lebensqualität, die angemessene Balance zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Verantwortung, Freiheitsspielräume oder soziale Gerechtigkeit.
Der in der Rubrik "Viewpoint" erschienene Text Critiquing US Health Care von Victor Fuchs ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.11.14
Spieglein, Spieglein an der Wand…Gesundheitssystemvergleich und was bei 11 Ländern von USA bis Deutschland aktuell herauskommt
 Rankings von Gesundheitssystemen gehören mittlerweile zum gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Standardrepertoire. Die Auswahl der Indikatoren, die verglichen werden, reichen aber von simplen Fragen nach der allgemeinen Zufriedenheit bis zu sehr differenzierten Abfragen verschiedenster Leistungsmerkmale. Mit der Auswahl - so die Kritik - lässt sich häufig das Ergebnis manipulieren. Eine Schwachstelle vieler Vergleiche ist ferner die verbreitet fehlende Berücksichtigung der unterschiedlichen strukturellen Bedingungen z.B. der Altersstruktur oder der Erkrankungsrisiken. Werden solche Bedingungen im Rahmen umfangreicher Standardisierungs- und Adjustierungsprozeduren berücksichtigt, schwindet nicht nur die Freude an Rankings, sondern rutscht das eine oder andere Land von so genannten Medaillenrängen ins Mittelfeld oder steigt auf.
Rankings von Gesundheitssystemen gehören mittlerweile zum gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Standardrepertoire. Die Auswahl der Indikatoren, die verglichen werden, reichen aber von simplen Fragen nach der allgemeinen Zufriedenheit bis zu sehr differenzierten Abfragen verschiedenster Leistungsmerkmale. Mit der Auswahl - so die Kritik - lässt sich häufig das Ergebnis manipulieren. Eine Schwachstelle vieler Vergleiche ist ferner die verbreitet fehlende Berücksichtigung der unterschiedlichen strukturellen Bedingungen z.B. der Altersstruktur oder der Erkrankungsrisiken. Werden solche Bedingungen im Rahmen umfangreicher Standardisierungs- und Adjustierungsprozeduren berücksichtigt, schwindet nicht nur die Freude an Rankings, sondern rutscht das eine oder andere Land von so genannten Medaillenrängen ins Mittelfeld oder steigt auf.
Bereits seit einigen Jahren schaut der Commonwealth Fund für das US-Gesundheitssystem in denselben Spiegel wie 10 andere internationale Gesundheitssysteme: Australien, Kanada, Frankreich, Niederlande, Neuseeeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien und schließlich auch Deutschland. Die Daten für den 2013er-Survey stammt aus mehreren internationalen Studien der Stiftung mit Primär- und Befragungsdaten aus den Jahren 2011 bis 2013, aus einem Scorecard-Projekt der Stiftung und diversen Daten der WHO und OECD.
Die für den Vergleich und das Ranking genutzten Indikatoren stammen aus den Bereichen Behandlungsqualität und deren Unteraspekte wirksame, sichere, koordinierte und patientenzentrierte Behandlung. Ein zweiter Bereich ist der Zugang zum Gesundheitssystem mit den Teilaspekten kostenbedingter Barrieren und Nahtlosigkeit bzw. Zügigkeit der Behandlung. Für den Aspekt Effizienz wird u.a. auf die Höhe der Gesundheitsausgaben, der Verwaltungskosten, die Häufigkeit vermeidbarer Notfallambulanzbesuche und von Doppeluntersuchungen geschaut. Beim Aspekt der Gerechtigkeit im Gesundheitssystem spielen Daten über die schichtspezifische Ungleichversorgung die zentrale Rolle. Als Gesundheitsindikatoren ("healthy lives") dienen die vermeidbare Sterblichkeit in der Behandlung, die Kindersterblichkeit und die im Alter von 60 Jahren erwartbare künftige gesunde Lebenszeit. In jedem Fall verdient dieser Vergleich sowohl wegen der Quantität aber auch wegen der Qualität sewiner Merkmale Aufmerksamkeit. Zusätzlich dokumentiert die Studie auch noch Gesundheitsausgaben (Kaufkraftparitäten) pro Kopf in US-Dollar.
Interessant sind aber nicht nur aus US-Sicht auch die Ergebnisse:
• Beim Insgesamt-Ranking liegt das Gesundheitssystem in den USA auf dem letzten, also elften Platz und das in Großbritannien auf Platz 1. Deutschland rangiert wie oft bei solchen Vergleichen im Mittelfeld auf Platz 5.
• Das britische National Health-Service-System liegt bei 8 der 11 Einzelindiokatoren ebenfalls auf Platz 1.
• Deutschland liegt bei keinem der 11 Indikatoren auf Platz 1. Das beste Ergebnis ist ein zweiter Platz beim Zugang zum System, das schlechteste gibt es mit einem zehnten Platz bei der koordinierten Versorgung. Aber auch die Effizienz (Platz 9( und die patientenzentrierte Versorgung (Platz 7) lassen zu wünschen übrig.
Diese und viele weiteren Daten finden sich im Report Mirror, mirror on the wall. How the performance oft he U.S.Health Care System compares internationally - 2014 update von Karen Davis et al., der mit 32 Seiten Umfang im Juni 2014 erschienen ist. Der Report ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.6.14
Schlusslicht der stationären pflegerischen Versorgung in Europa für das deutsche Gesundheitssystem - und Griechenland.
 Das deutsche Gesundheitssystem nimmt in internationalen Vergleichen bei vielen Leistungsindikatoren meist einen Mittelplatz ein, bei einigen problematischen landet es aber auch am Ende solcher Rangskalen.
Das deutsche Gesundheitssystem nimmt in internationalen Vergleichen bei vielen Leistungsindikatoren meist einen Mittelplatz ein, bei einigen problematischen landet es aber auch am Ende solcher Rangskalen.
Eine in der international durchgeführten Studie "Registered nurses forecasting (RN4CAST)" gestellte Frage nach der Anzahl von pflegerisch notwendigen Leistungen, die z.B. aus Zeitmangel nicht durchgeführt werden konnten, also eines Maßes für implizite Rationierung, zeigt, dass dies auch bei gesundheitlich gewichtigen Leistungen der Fall sein kann.
Diese und eine Reihe anderer für die Arbeitsbedingungen und die patientenbezogene Versorgungsqualität relevanten Fragen wurde 2009/10 33.659 Pflegekräften in 488 den chirurgischen und medizinischen Abteilungen in Akut-Krankenhäusern in zwölf europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Finnland, Griechenland, Schweiz und Deutschland, gestellt. In Deutschland betraf dies 1.508 examinierte Pflegekräfte in bundesweit 49 Kliniken.
Die Ergebnisse aus deutscher Sicht sahen u.a. so aus:
• Während in Europa durchschnittlich 54% aller Pflegekräfte über einen Bachelorabschluss verfügten, traf dies zu dem Befragungszeitpunkt für keine(n) Befragten an deutschen Krankenhäusern zu. Dies bedeutete beim Ausbildungsstand den letzten Platz.
• Beim Belastungsindikator Patient pro Pflegekraft landete Deutschland mit 13 Patienten erneut auf dem letzten Platz. Den Spitzenplatz nahm Norwegen mit 5 Patienten pro Pflegekraft ein.
• Abgerundet werden diese Negativrekorde mit dem erneut europaweit schlechtesten Indikator des Anteils der Pflegekräfte, die in ihrer letzten Arbeitsschicht mit nichtpflegerischen Tätigkeiten beschäftigt waren. Im europäischen Durchschnitt waren es 34%, in Spanien 17% und in Deutschland 61%.
• Bei den 13 pflegerischen Aktivitäten (z.B. physische Pflege, Patientenüberwachung und -mobilisierung sowie den psychosoziale äußerst notwendigen Patientengesprächen), für welche die Pflegekräfte befragt wurden, ob sie sie z.B. wegen Zeitmangel nicht durchführen konnten, lagen die Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern erneut deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 3,6. Mit durchschnittlich 4,7 nicht erbrachten notwendigen pflegerischen Maßnahmen landete Deutschland auf dem vorletzten Platz - vor Griechenland mit 5,8 solcher Aktivitäten. Dass es besser gehen kann zeigten die Pflegekräfte in der Schweiz, den Niederlanden und in Schweden mit 2,8 rationierten Pflegemaßnahmen.
• Angesichts des immer häufiger beklagten Pflegekräftemangels ist auch ein weiteres Ergebnis relevant: In Kliniken mit vorteilhafteren Arbeitsbedingungen, einer geringeren Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und eines unterdurchschnittlichen Anteils von nichtpflegerischen Tätigkeiten am gesamten Arbeitsvolumen ist der Anteil von AussteigerInnen aus dem Pflegeberuf signifikant am geringsten.
Diese Ergebnisse werden auch in einer neueren (2012) inhaltlich vergleichbaren Befragung von Pflegekräften an 27 hessischen Krankenhäusern bestätigt, deren Ergebnisse in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.
Der Forderung der Autorinnen des Europavergleichs, solche Befragung als eine Art Frühwarnsystem für dauerhaft die Arbeits- und Versorgungsqualität verschlechternde Arbeitsbedingungen regelmäßig durchzuführen und dadurch Druck auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und darunter auch eine Erhöhung der Personalanzahl auszuüben, ist zuzustimmen.
Der Aufsatz Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study von Dietmar Ausserhofer et al. ist in der Fachzeitschrift "BMJ Quality & Safety" online am 10. November 2013 erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.12.13
Zugang zu, Erschwinglichkeit von und Bürokratielasten in den Gesundheitssystemen von 11 entwickelten Ländern
 Wie in den Jahren zuvor führte der liberale us-amerikanische "Commonwealth Fund" auch 2013 eine Befragung von rund 20.000 bevölkerungsrepräsentativen Erwachsenen in 11 industrialisierten nordamerikanischen sowie mittel-, west- und nordeuropäischenLändern, darunter die USA, Schweden, Kanada, Schweiz oder Großbritannien über wesentliche Aspekte der Gesundheitssysteme durch. Dabei ging es vorallem um den Zugang, die Erschwinglichkeit und die Komplexität bzw. die Bürokratielasten der Krankenversicherungen.
Wie in den Jahren zuvor führte der liberale us-amerikanische "Commonwealth Fund" auch 2013 eine Befragung von rund 20.000 bevölkerungsrepräsentativen Erwachsenen in 11 industrialisierten nordamerikanischen sowie mittel-, west- und nordeuropäischenLändern, darunter die USA, Schweden, Kanada, Schweiz oder Großbritannien über wesentliche Aspekte der Gesundheitssysteme durch. Dabei ging es vorallem um den Zugang, die Erschwinglichkeit und die Komplexität bzw. die Bürokratielasten der Krankenversicherungen.
Wie in den vorherigen Surveys war das Gesundheitssystem in den USA in der Wahrnehmung und in den Erfahrungen der dort befragten BürgerInnen praktisch durchweg am schlechtesten, die Gesundheitssysteme in Schweden und Großbritannien immer die am besten bewerteten. Das deutsche Gesundheitssystem belegte fast immer einen mehr oder weniger guten Mittelplatz unter den 11 Ländern - wie bereits in vielen anderen Studien über die Versorgungsstruktur und -qualität.
Beispielhaft sahen die Versorgungsverhältnisse im Vergleich folgendermaßen aus:
• 37% der US-Erwachsenen nahmen empfohlene Behandlungen aus Kostengründen nicht in Anspruch, sahen im Krankheitsfall keinen Arzt und lösten verordnete Arzneimittel wegen der Kosten nicht ein. Dieses Problem hatten lediglich 4% der Schweden und 10% der Deutschen im Erwachsenenalter.
• 42% der ganzjährig versicherten und 39% der unversicherten US-BürgerInnen mussten während des gesamten Jahres 1.000 US-Dollar und mehr zusätzlich zu ihren Versicherungsbeiträgen aus der eigenen Tasche für medizinische Behandlung zuzahlen. Dies mussten in Schweden nur 2% und in Deutschland 11% der Befragten tun.
• 23% der US-Befragten hatten entweder ernste Probleme die Rechnungen von Ärzten und anderen Leistungserbringern zu bezahlen oder konnten sie definitiv nicht bezahlen. In Großbritannien waren dies nur 1% der Befragten und in Deutschland 7%.
• Während 28% der in den USA Befragten sagten, sie hätten eine Menge Zeit mit Papierkram oder Streitigkeiten über Behandlungsrechnungen und mit ihrer Krankenversicherung zugebracht, hatten dasselbe Problem nur 2% der Schweden und Briten sowie 8% der Deutschen.
• Versicherungen verweigerten insgesamt 28% der US-BürgerInnen die Bezahlung einer Rechnung oder überwiesen weniger als diese erwarteten bzw. benötigten. Dieselben Erfahrungen machten nur 3% der Norweger, Schweden und Briten. In Deutschland waren es 14%, in Frankreich 17% und in der Schweiz 16%.
• Trotz aller administrativen Leistungsdefizite bezahlten die US-Amerikaner mit jährlich 606 US-Dollar pro Kopf den absolut größten Betrag für die Verwaltungskosten ihrer Krankenversicherungen. Deutschland liegt hier mit 237 US-Dollar auf dem vierten Rang, Norwegen mit 35 US-Dollar auf dem letzten Platz.
• Angesichts der gezeigten Nachteile und bei dem weltweit mit Abstand höchsten Pro-Kopfbetrag für Gesundheitsversorgung von 8.508 US-Dollar im Jahre 2011 (im zweitteuersten Gesundheuitssystem in Norwegen belief sich dieser Betrag auf 5.669 US-Dollar), wundert es nicht, wenn nur 25% der Ansicht sind, ihr Gesundheitssystem liefe gut und bedürfe lediglich kleinerer Änderungen. Dies sagen in Großbritannien 63% und in Deutschland 42% der Befragten. Die Dreiviertelmehrheit der US-BürgerInnen, die in dieser und anderen Befragungen fundamentale Veränderungen oder einen kompletten Neuaufbau ihres Gesundheitssystems fordern, wird eigentlich nur noch von den Marktradikalen in der Republikanischen Partei ignoriert.
• Bei fast allen der gerade dargestellten Versorgungsaspekte ging es den chronisch Kranken in fast allen untersuchten Ländern schlechter.
Weitere Details des Surveys, darunter eine der bekannten "In the Literature"-Zusammenfassungen und diverse für eigene Präsentationen verwendbare Folienpakete findet man auf der entsprechenden Commonwealth Fund-Website.
Dort gibt es auch den Link zu dem Aufsatz Access, Affordability, and Insurance Complexity Are Often Worse in the United States Compared to 10 Other Countries von C. Schoen, R. Osborn, D. Squires, und M. M. Doty, der in der Zeitschrift "Health Affairs Web First" online am 14. November 2013 erschienen und komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 14.11.13
Weltgesundheitsbericht 2013: Research for universal health coverage
 Im August legte die Weltgesundheits-organisation(WHO ihren neuesten Jahresbericht vor, der sich diesmal dem Thema Forschung für universelle Absicherung im Krankheitsfall widmet. Damit knüpft die WHO an ihren letzten Bericht von 2010 an, der die Bedeutung geeigneter Gesundheitsfinanzierungssysteme zum Erreichen universeller Sicherung aufgezeigt hatte. Der Bericht Weltgesundheitsbericht 2010 der WHO: Der Weg zu universeller Sicherung im Forum Gesundheitspolitik stellte den Weltgesundheitsbericht 2010 vor.
Im August legte die Weltgesundheits-organisation(WHO ihren neuesten Jahresbericht vor, der sich diesmal dem Thema Forschung für universelle Absicherung im Krankheitsfall widmet. Damit knüpft die WHO an ihren letzten Bericht von 2010 an, der die Bedeutung geeigneter Gesundheitsfinanzierungssysteme zum Erreichen universeller Sicherung aufgezeigt hatte. Der Bericht Weltgesundheitsbericht 2010 der WHO: Der Weg zu universeller Sicherung im Forum Gesundheitspolitik stellte den Weltgesundheitsbericht 2010 vor.
Die meisten Entwicklungs- und Schwellenländer stehen vor der Herausforderung, mit den jeweils verfügbaren Mitteln der gesamten Bevölkerung Zugang zu erforderlichen Gesundheitsleistungen zu ermöglichen. Trotz der wachsenden weltweiten Bedeutung von universeller sozialer Absicherung im Krankheitsfall, die zu einem der dominierenden Themen der Entwicklungszusammenarbeit geworden ist, bestehen in den Ländern viele offene Fragen, wie die angemessenen Absicherung aller zu bewerkstelligen ist. Mit ihrem diesjährigen Bericht will die WHO auf den großen Forschungsbedarf hinweisen, der für eine weltweite Umsetzung von universeller Absicherung im Krankheitsfall erforderlich ist. Derzeit würde zwar viel in neue Ideen und Techniken investiert, aber vorhandenes Erfahrungswissen nicht hinreichend genutzt und in die Praxis umgesetzt.
Aber, so erklärt die Weltgesundheitsorganisation ihr Anliegen, universelle soziale Absicherung im Krankheitsfall lasse sich nicht ohne wissenschaftliche Evidenz und Untermauerung erreichen: "Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung erfährt vergleichsweise geringe Unterstützung und wenig Aufmerksamkeit", meint die WHO in ihrem Jahresbericht 2013, und erkennt einen "besonderen Bedarf, die Kluft zwischen bestehendem Wissen und dem Vorgehen zu überwinden". Zwar erfordern grundsätzliche Fragen universeller Absicherung wie die Struktur des Gesundheitswesens, Angebots- und Nachfrageverhalten und Zielvorgaben lokale Antworten, darüber hinaus bestehe aber in allen Ländern erheblicher Bedarf an systematischer Aufarbeitung und Umsetzung von Erfahrungswissen:
Der Weltgesundheitsbericht führt etliche Beispiele dafür auf, wie evidenzbasierte Erkenntnisse gesundheitspolitische Maßnahmen bestärken können:
• Evaluierungsergebnisse aus 22 afrikanischen Ländern belegen, dass insektizid-behandelte Moskitonetze die Kindersterblichkeit um 13-31 % reduzieren
• Die Auswertung von Studien aus sechs Ländern zeigen, dass konditionierte Transferzahlungen an arme Haushalte, die an die Inanspruchnahme bestimmter Gesundheitsleistungen gekoppelt sind, bei Kindern die Häufigkeit der Nutzung von Gesundheitszentren um 11-20 % und bei Vorsorgeleistungen sogar um 23-33 % erhöhte
• Studienergebnisse aus fünf europäischen Ländern belegen, dass die alterungsbedingte Ausgabensteigerung zwischen 2010 und 2060 nicht über 1 % pro Jahr liegt und sogar sinkende Tendenz aufweist.
Niemand wird die Bedeutung derartiger Ergebnisse für die Politik- und Entwicklungsberatung bezweifeln; insbesondere solche Erkenntnisse, die gängige gesundheitspolitische Mythen entkräften, sind überaus begrüßenswert. Aber so begrüßenswert wissenschaftliche Erkenntnisse zur Untermauerung politischer Entscheidungen auch sind, der Ansatz des WHO-Jahresberichts erweist sich letztlich doch als arg technokratisch und selbstreferenziell. Denn es fehlt eine systematische Analyse, welche Daten und wissenschaftlichen Erkenntnisse am wichtigsten sind, wie diese Erkenntnisse letztlich zur Verbesserung der Gesundheit beitragen können und wie sie sich in einen Systemansatz integrieren lassen.
Der Bericht betont in seinem Hauptteil, dass gesundheitsbezogene Forschung weltweit zunimmt und an Bedeutung gewinnt, und liefert 12 Beispiele von Studien, die beweisen, "wie wissenschaftliche Forschung einige der wesentlichen Fragen aufgreifen kann, wie universelle Absicherung zu erreichen ist". Die angekündigten Beispiele reichen von der Prävention und Kontrolle spezieller Erkrankungen bis hin zu funktionierenden Gesundheitssystemen. Allerdings verbleibt der Bericht auf rein programmatischer Ebene, greift keine Studie auf, die eine systemische Perspektive einnimmt oder Interaktionen verschiedener Akteure und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Interventionen einbezieht.
Das ist bemerkenswert, schließlich hatte die WHO nur vier Jahre zuvor ihren Bericht Systems thinking for health systems strengthening veröffentlicht, in dem sie Gesundheitssysteme als komplexe, anpassungsfähige Systeme beschreibt. Die WHO fordert und befördert Systemdenken als "einen wesentlichen Ansatz zur Stärkung von Gesundheitssystemen". Und vor einem Jahr veröffentlichte die WHO einen 474-Bericht mit dem Titel Health policy and systems research - a methodological reader, der umfagngreiche Ratschläge enthält, wie man die Evidenzgrundlage für Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemstärkung verbessern könnte.
Nicht minder überraschend ist die eher beiläufige Betrachtung der sozialen Determinanten von Gesundheit. Dabei hatte die WHO diesem Thema doch zwei Jahre zuvor eine globale Konferenz in Rio de Janeiro gewidmet, auf der es zur Verabschiedung der Rio Political Declaration on Social Determinants of Health kam. Und erst im Mai dieses Jahres hatte die 66. Weltgesundheitsversammlung den entsprechenden Sekretariats-Bericht Social determinants of health - Report by the Secretariat angenommen.
Der Weltgesundheitsbericht 2013 nimmt nur ansatzweise Bezug auf soziale Determinanten und deren immense Bedeutung für Forschung im Dienste einer universelle Absicherung im Krankheitsfall. Auf Seite 94 des WHO-Jahresberichts heißt es: "Many of the determinants of health and disease lie outside the health system so research needs to investigate the impact of policies for "health in all sectors". Research will add to the evidence on how human activities affect health, for example through agricultural practices and changes to the natural environment". Das ist zwar nicht falsch, aber trotz des Bezugs auf den großen Bereich der indirekten Gesundheitspolitik jenseits des Krankenversorgungswesens doch zu stark auf einzelne soziale Determinanten eingeengt, um den Eindruck einer ausgeprägten Krankheitsperspektive zerstreuen zu können.
Der Bericht bleibt bei der gesellschaftspolitischen Analyse weitgehend an der Oberfläche und lässt insgesamt deutlich erkennen, dass er ein Kompromisspapier zwischen sehr heterogenen staatlichen und nicht-staatlichen Interessensgruppen und darstellt. Gesellschafts- und verteilungspolitische Fragen räumt die WHO nicht die Rolle ein, die ihr gebührt, wenn das Ziel wirklich Universalität, d.h. die Absicherung aller Menschen mit allen notwendigen Leistungen und möglichst ohne direkte Beteiligung an den Behandlungskosten. Ohnehin stellt sich die Frage, ob selbst die solidesten und reliabelsten Daten und wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich ausreichen, bestehende Ungleichheiten zu reduzieren und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Evidenzbasierte Politik ist ein Wunschtraum aller Wissenschaftler, in der Praxis aber allenfalls rudimentär messbar. Gerade die Gesundheitspolitik ist zudem ein Feld, wo nicht nur unterschiedliche, sondern vielfach sogar widersprüchliche Evidenz aufeinander trifft.
Insgesamt lässt die WHO in ihrem Jahresbericht 2013 wieder einen eher technokratischen Ansatz erkennen, der hinter früheren Verlautbarungen und Veröffentlichungen zurückbleibt. Ihr Dilemma, letztlich nur gesundheitsbezogene Forschung fördern und betreiben zu können, bestärkt einen Forschungsansatz, der sich auf möglichst messbare, konkrete und auf Einzelphänomene fokussierte Fragestellungen konzentriert. In Zeiten unübersehbarer Dominanz von Marktinteressen und des wachsenden Einflusses transnationaler Konzerne auch in der WHO eine nicht unbedenkliche Entwicklung.
Auch wenn der WHO-Bericht 2013 die Themen Ungleichheit und Health-in-All hier und dort benennt und die Notwendigkeit erkennt, das gesundheitsfördernde Potenzial sektorübergreifender Politikansätze intensiver zu erforschen, betrachtet er diese und vergleichbare Aspekte als zusätzliche, komplementäre Herausforderung, die in Anbetracht der Vielzahl anderer offener Fragen keine besondere Priorität genießen können. Das ist nachvollziehbar - denn im Mittelpunkt des WHO-Forschungsansatzes im Dienste universeller Sicherung steht nicht der Mensch, sondern Erkrankungen und Erkrankungsrisiken. Der derzeitige internationale Boom um universal health coverage (UHC), also universelle Absicherung im Krankheitsfall einschließlich universellen Zugangs zu Versorgungsleistungen, könnte dasselbe Schicksal ereilen wie vor gut 30 Jahren die Primary Health Care (PHC) Bewegung, die mit der Erklärung von Alma Ata einen Aufbruch weg von der Medikalisierung und hin zu einem stärker gesellschaftlich bestimmten Gesundheitsverständnis einleitete. Unter der Führung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) stutzen wichtige entwicklungspolitische Akteure das ursprünglich umfassende PHC-Konzept auf eine selektive primäre Gesundheitsversorgung zurecht, wo die exogen bestimmte Bezahlbarkeit anstelle des realen Bedarfs zum Maß der Möglichkeiten wurde. Mit Ihrem Jahresbericht 2013 hat die WHO möglicherweise dazu beigetragen, dass der UHC-Bewegung dasselbe Schicksal widerfährt und zu einer selektiven "universellen" Absicherung degeneriert.
Auf der Website der Weltgesundheitsorganisation WHO steht der Weltgesundheitsbericht 2013 kostenfrei in voller Länge zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 10.11.13
Was wäre, wenn die Gesundheitsausgaben in den USA seit 30 Jahren "nur" so hoch gewesen wären wie in der Schweiz? 4 Ipads for all!
 Das schweizerische und das us-amerikanische Gesundheitssystem sind seit Jahrzehnten die teuersten der Welt, egal ob es um den Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt oder die Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit geht. Während die Pro-Kopf-Ausgaben beider Länder 1980 fast identisch waren lagen sie in den USA im Jahr 2010 um fast 3.000 US-Dollar (gerechnet in inflationsbereinigten Dollarpreisen des Jahres 2012) über den Ausgaben in der Schweiz und damit die USA weltweit einsam an der Spitze.
Das schweizerische und das us-amerikanische Gesundheitssystem sind seit Jahrzehnten die teuersten der Welt, egal ob es um den Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt oder die Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit geht. Während die Pro-Kopf-Ausgaben beider Länder 1980 fast identisch waren lagen sie in den USA im Jahr 2010 um fast 3.000 US-Dollar (gerechnet in inflationsbereinigten Dollarpreisen des Jahres 2012) über den Ausgaben in der Schweiz und damit die USA weltweit einsam an der Spitze.
In einem Beitrag für den Blogbereich des Commonwealth Fund vom 21. März 2013 stellt sich ein Autor zwei interessante Fragen: Als erstes berechnet er, wie viele US-Dollar in den USA nicht in das Gesundheitssystem geflossen wären, wenn das dortige Ausgabenniveau in den 30 Jahren seit 1980 weiter dem in der Schweiz entsprochen hätte. Zweitens fragt sich der Autor was stattdessen hätte mit dem "eingesparten" Betrag hätte finanziert werden können.
Die kumulative Einsparung hätte 15,5 Billionen US-Dollar betragen (da es in den USA keine Milliarde gibt, steht im Blogbeitrag der Betrag von 15,5 Trillionen US-Dollar).
Mit dieser Summe hätte das
• heutige Defizit im US-Bundeshaushalt von 11,6 Billionen US-$ in ein Plus von 3,9 Billionen US-$ umgewandelt werden können,
• hätte während dieses Zeitraums für 175.401.721 Studenten eine vierjährige College-Studium finanziert werden können,
• hätte ein Gebiet mit der Fläche des Bundesstaats South Carolina mit Solaranlagen bedeckt werden können, die mehr umweltfreundliche Energie erzeugen könnten als die USA selber brauchen
• oder hätte die US-Regierung jedem Erdenbürger 4 Ipads kaufen können.
Egal wie skurril oder machbar die Ausgabenalternativen im Detail sind, zeigt diese Berechnung doch, welche Unsummen knapper Finanzressourcen in der Gesundheitswirtschaft landen und ceteris paribus an anderen Ecken in der Gesellschaft fehlen. Und nicht nur im Falle der USA hat - wie zahlreiche Studien belegen - ein Teil der Gesundheitsausgaben noch nicht einmal einen Nutzen oder schadet sogar mehr als er nützt.
Bleibt die Frage, wie viele Ipads oder Samsung-Tablets man mit den Einsparungen aus einem 30-Jahres-Vergleich der deutschen Gesundheitsausgaben mit denen in den Niederlanden oder Schweden hätte kaufen können?
Wie man mit der drohenden Überversorgung mit Tablets umgehen kann, sollte dann aber gleich mitgeklärt werden.
Der kurze Beitrag The Road Not Taken: The Cost of 30 Years of Unsustainable Health Spending Growth in the United States von David Squires im "The Commonwealth Fund Blog" vom 21.3.2013 ist kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 23.3.13
Gesundheitssystemvergleich aus Verbrauchersicht - Ist ein 14. Platz für das deutsche System gut oder schlecht?
 Gesundheitssystemvergleiche, -rankings oder -benchmarkings gehören zum Standardrepertoire gesundheitspolitischer Debatten und lösen immer wieder Import-/Export-Pläne aus. Dass es dafür weder "die" gültigen Indikatoren gibt, noch soziale Systeme wie unterschiedliche Supermärkte sind aus denen man die jeweils günstigsten Leistungen, Strukturen oder Ergebnisse herauspicken und zu einem neuen Super-Supermarkt/-system bündeln kann, gehört aber auch zu den Erkenntnissen der Beschäftigung mit vielen dieser Vergleiche. Hinzu kommt, dass allein schon die Auswahl der Indikatoren häufig zu deutlich unterschiedlichen Rangpositionen der Systeme führt.
Gesundheitssystemvergleiche, -rankings oder -benchmarkings gehören zum Standardrepertoire gesundheitspolitischer Debatten und lösen immer wieder Import-/Export-Pläne aus. Dass es dafür weder "die" gültigen Indikatoren gibt, noch soziale Systeme wie unterschiedliche Supermärkte sind aus denen man die jeweils günstigsten Leistungen, Strukturen oder Ergebnisse herauspicken und zu einem neuen Super-Supermarkt/-system bündeln kann, gehört aber auch zu den Erkenntnissen der Beschäftigung mit vielen dieser Vergleiche. Hinzu kommt, dass allein schon die Auswahl der Indikatoren häufig zu deutlich unterschiedlichen Rangpositionen der Systeme führt.
Allein schon die häufig für den Vergleich benutzte Größe der Gesundheitsausgaben führt je nach der gewählten Variante beim beliebten Deutschland-Niederlande-Vergleich zu drei unterschiedlichen Rangreihen. Nimmt man den Indikator Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt nimmt das deutsche Gesundheitssystem sortiert nach der Höhe Platz 4 unter den OECD-Ländern ein und das der Niederlande Platz 9. ein. Nutzt man den Indikator Gesamtausgaben für Gesundheit pro Kopf in kaufkraftbereinigten US-Dollars fällt Deutschland auf Platz 8 und die Niederlande steigt auf Platz 5 der OECD-Rangreihe. Berücksichtigt man schließlich die Tatsache unterschiedlicher Altersstrukturen und damit auch Ausgabenhöhen in den OECD-Ländern und adjustiert die Gesundheitsausgaben pro Kopf nach der Altersstruktur, ist das niederländische Gesundheitssystem 15,49 % teurer als das deutsche. Dieses ist bei dieser Betrachtungsweise dann um 4%, 11% und 37% teurer als die Gesundheitssysteme in Schweden, Großbritannien oder Portugal.
Noch wichtiger als die Auswahl der Indikatoren für ein- und denselben Sachverhalt ist aber welche Strukturen, Abläufe und Ergebnisse eines Gesundheitssystems auf dem "Steckbrief" landen und welche oder wessen Blickwinkel dabei leitend sind.
Einen Versuch aus dem Blickwinkel der Verbraucher im Gesundheitswesen stellt der seit 2005 gerade zum sechsten Mal erschienene "Euro Health Consumer Index (EHCI)" (siehe u.a. den Forums-Bericht zu einer früheren Ausgabe) dar.
In der Rangliste 2012 werden 34 nationale europäische Gesundheitssysteme (darunter die aller 27 EU-Mitglieder) mit Hilfe von 42 Indikatoren bewertet. Diese Bewertung besteht aus fünf Bereichen, die nach Ansicht der Experten des schwedischen Instituts Health Consumer Powerhouse für den Verbraucher im Gesundheitssystem wichtig sind: Patientenrechte und -informationen, Wartezeiten für ausgewählte Behandlungen, Häufigkeit der Diagnosen bestimmter Krankheiten, Vorsorge, Vielfalt und Umfang der angebotenen Leistungen und Pharmazeutika. Der Index wertet dafür öffentliche Statistiken, Patientenumfragen und Forschungsprojekte aus.
Die Autoren des Berichts geben dabei vorbildlich an, dass die Erstellung des "EHCI 2012 … mit unbegrenzten (!??? - Anmerkung durch bb) Fördergeldern von EFPIA (europäischer Dachverband der nationalen Verbände forschender Pharmaunternehmen und einzelner Pharmaunternehmen), Pfizer Inc., Novartis SA und Medicover SA unterstützt (wurde)". Und ein bisschen merkt man dies auch zumindest bei der Auswahl der Indikatoren für die Arzneimittelversorgung. Für die Einzelheiten der ausgewählten Indikatoren und ihrer Werte für jedes Land sei die Lektüre empfohlen.
Das in der öffentlichen Wahrnehmung meist einzig wahrgenommene Ranking der europäischen Gesundheitssysteme bei dem maximal 1.000 Punkte umfassenden EHCI sieht so aus:
• Das deutsche Gesundheitssystem liegt mit 704 Punkten auf Platz 14. Die Niederlande mit 872 Punkten, gefolgt von Dänemark (822), Island (799), Luxemburg (791) und Belgien (783) liegen auf den vorderen Plätzen. Schlusslichter sind Bulgarien und Serbien mit 456 und 451 Punkten.
• Dies bedeutet, dass das deutsche Gesundheitssystem 2012 deutlich schlechter bewertet wird als 2009: 2009 lag es noch auf Platz sechs. Deutschland liegt somit zum ersten Mal hinter Großbritannien und befindet sich auf dem gleichen Niveau wie Tschechien und Irland.
• Beim Vergleich aller Wellen des Index seit 2005 verbessert sich die Qualität der europäischen Gesundheitssysteme insgesamt stetig.
• Dennoch weisen die Autoren für das 2012 auf mögliche unerwünschte Wirkungen der ökonomischen Krise in den meisten EU-Ländern hin: Die Tendenz ist, dass man in den Ländern, auf die sich die Wirtschaftskrise am meisten ausgewirkt hat, länger auf teure Operationen warten muss, gesteigerte Selbstbeteiligungsraten für zahlreiche Behandlungen ertragen muss, ein Mangel an Verbesserungen und ein sich verschlechternder Zugang zu neuen Medikamenten besteht.
• Zu dem beim internationalen Vergleich für einige der Länder dringenden Verbesserungsbedarf gehören die Krankenhausinfektionen, die in jedem zweiten der 34 bewerteten Länder konstant berichtet werden. Ähnlich sieht es beim oft gesundheitlich nicht notwendigen und auch noch folgenträchtigen (z.B. Bildung resistenter Keime) Einsatz von Antibiotika aus. Ob das von der EU geplante Verbot des Verkaufs von Antibiotika ohne Rezept wirklich helfen würde, kann angesichts der gerade von der Über- und Fehlversorgung von verordneten Antibiotika geprägten Situation in Deutschland bezweifelt werden.
Den 81-seitigen Bericht "Euro Health Consumer Index 2012" von Arne Björnberg erhält man komplett kostenlos.
Bernard Braun, 18.6.12
Zu kurze Liegezeiten können gefährlich werden
 Eine interessante internationale Vergleichsstudie veröffentlichte das renommierte us-amerikanische Ärzteblatt Journal of the American Medical Association in seiner ersten Ausgabe des Jahres 2012. Diese Untersuchung bestätigt zwar zum einen das bekannte und gesundheitspolitisch viel diskutierte Phänomen vergleichsweise langer Liegedauern in deutschen Krankenhäusern. Zum anderen aber liefert sie Hinweise darauf, dass eine ökonomisch attraktiv erscheinende Verkürzung der stationären Behandlungszeiten nicht unbegrenzt sinnvoll sein dürfte.
Eine interessante internationale Vergleichsstudie veröffentlichte das renommierte us-amerikanische Ärzteblatt Journal of the American Medical Association in seiner ersten Ausgabe des Jahres 2012. Diese Untersuchung bestätigt zwar zum einen das bekannte und gesundheitspolitisch viel diskutierte Phänomen vergleichsweise langer Liegedauern in deutschen Krankenhäusern. Zum anderen aber liefert sie Hinweise darauf, dass eine ökonomisch attraktiv erscheinende Verkürzung der stationären Behandlungszeiten nicht unbegrenzt sinnvoll sein dürfte.
Die Studienpopulation umfasste insgesamt 5.745 PatientInnen mit einem an Hand typischer EKG-Veränderungen nachweisbaren Herzinfarkt in insgesamt 17 Ländern. Bei der Behandlung des Myokardinfarkts haben verbesserte Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren zu einer Verkürzung der Therapiedauer und einer Verbesserung der Ergebnisse geführt. Außerdem sind sowohl die Diagnostik und Dokumentation als auch der klinische Umgang mit diesem Krankheitsbild vergleichsweise einheitlich, so dass Vergleichsanalysen durchaus Aussagekraft besitzen können.
Primärer Endpunkt dieser internationalen Vergleichsstudie waren sämtliche stationären Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlastung aus stationärer Herzinfarktbehandlung. Sekundärer Endpunkt waren alle nicht-elektiven Wiederaufnahmen in den ersten 30 Tagen nach Entlassung, wobei geplante angiografische Erweiterungen der Herzkranzgefäße oder Bypassoperationen explizit ausgenommen waren.
Von den insgesamt 5.571 überlebenden und in die Studie eingeschlossenen InfarktpatientInnen erfolgte bei 631 (11,3%; 95% Konfidenzintervall, 10,5-12,2 %) innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung eine erneute stationäre Aufnahme. Bei diesen 631 PatientInnen lag die Wiederaufnahmerate in den USA bei 14,5 % (95% KI, 12,9-16,2 %) und bei 9,9 % (95% KI, 9,0-10,9 %) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Abzüglich der geplanten stationären Wiederaufnahmen zur Revaskularisierung erfolgte bei 478 (8,6 %; 95 % KI, 7,8-9,3 %) PatientInnen der gesamten Kohorte innerhalb des ersten Monats nach Abschluss einer stationären Infarktbehandlung eine Rehospitalisierung, wobei dies für 10,5 % (95 % KI, 9,0-11,9 %) der US-PatientInnen und nur 7,7 % (95 % KI, 6,9-8,6 %) der übrigen PatientInnen zutraf. Dabei war zu beobachten, dass die PatientInnen mit frühzeitiger Wiederaufnahme in stationäre Behandlung in höherem Maße an Begleiterkrankungen litten, vor allem an vorbestehender koronarer Herzkrankheit (KHK), Bluthochdruck und Diabetes mellitus, und eine Mehrgefäßerkrankung aufwiesen. Außerdem erwiesen sich Komplikationen während der stationären Infarktbehandlung als Prädiktoren für eine Wiederaufnahme innerhalb des ersten Monats nach Entlassung.
Beim internationalen Vergleich zeigten sich zunächst die folgenden Unterschiede:
• US-PatientInnen waren etwas jünger als die internationale Vergleichsgruppe und wiesen eine diskret höhere Prävalenz einer KHK bzw. vorangegangener Bypassoperationen auf. Die übrigen Charakteristika stimmten weitgehend überein.
• Die stationäre Behandlungsdauer bei akutem Herzinfarkt war in den USA signifikant kürzer als in den anderen Ländern und betrug in 60 % der Fälle (95 % KI, 57,7-62,4 %) 3 Tage oder weniger, während in den anderen Ländern nur 15,9 % (95 % KI, 14,9-17.0%) in den Genuss solch kurzer Behandlungszeiten kamen.
• Während 54 % (95 % KI, 52,4-55,6 %) der InfarktpatientInnen außerhalb der Vereinigten Staaten sechs Tage oder länger in stationärer Behandlung blieben, traf dies nur für 16,6 % (95 % KI, 14,8-18,4 %) ihrer LeidensgenossInnen in den USA zu.
• Bei US-PatientInnen kam es häufiger zur stationären Wiederaufnahme im Rahmen von Revaskularisierungsmaßnahmen wie Dilatationen oder Bypass-Operationen (4,4 gegenüber 2,0 %; 95 % KI, 3,4-5,3 % vs. 1,5-2,4 %; p<0,001 bzw. 0,6 % vs. 1,2 %; 95 % KI, 0,2-1,0 % vs. 0,8-1,5 %; p=0,046).
• In den USA erhielten InfarktpatientInnen bei Entlassung häufiger ß-Blocker und Nitrate, etwas seltener Ticlopidin oder Clopidogrel und Statine und zu einem geringeren Anteil ACE-Hemmer oder Aldosteronantagonisten. Die Verschreibungsraten von ASS waren international ähnlich.
• Die mittlere Verweildauer im Krankenhaus aufgrund eines akuten Myokardinfarkts variierte im internationalen Vergleich recht stark zwischen 3 Tagen in den USA und 8 Tagen in Deutschland.
Im Hinblick auf die Endpunkte der Studie erwies sich neben der Lokalisation des Infarktes, wiederholten ischämischen Ereignissen, chronischer Lungenerkrankung, Bluthochdruck und chronischen Entzündungserkrankungen das Vorliegen einer Mehrgefäßerkrankung als wichtigster Prädiktor für eine kurzfristige stationäre Wiederaufnahme nach Abschluss einer Infarkttherapie, denn hier war die Wahrscheinlichkeit nahezu verdoppelt (OR 1,97; 95 % KI, 1,65-2,35). Die beiden weiteren relevanten Prädiktoren waren die Behandlung im us-amerikanischen Gesundheitswesen, was die Chance auf kurzfristige stationäre Wiederaufnahme um zwei Drittel erhöhte (OR 1,68; 95 % KI, 1,37-2,07) und Herzrasen während des Akutereignisses mit einer OR von 1,09; 95 % KI, 1,05-1,15 je Erhöhung der Herzfrequenz um 10 Schläge pro Minute. Schließt man die erneuten stationären Aufnahmen aufgrund von elektiven Revaskularisierungsmaßnahmen aus, blieb allein die Behandlung im US-System als signifikanter Prädiktor für eine frühzeitige Wiederaufnahme bestehen.
Mit Ausnahme von Dänemark und Schweden zeigte sich in allen Ländern eine geringere Wiederaufnahmerate als in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Monats nach Entlassung erneut in ein Krankenhaus gehen zu müssen, war in Italien und Deutschland nur etwas mehr als ein Viertel so groß (OR 0,26; 95 % KI, 0,15-0,43 bzw. OR 0,28; 95 % KI, 0,07-0,46), in Kanada nur ein Drittel so groß (OR 0,33; 95 % KI, 0,20-0,56) und in den Niederlanden nur halb so groß wie in den USA (OR 0,50; 95 % KI, 0,30-0,84). Es zeigte sich insgesamt eine umgekehrte Proportionalität zwischen der jeweils landestypischen mittleren Verweildauer und der Wiederaufnahmehäufigkeit, also je kürzer die stationäre Primärtherapie des Infarkts, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Aufnahme innerhalb des ersten Monats.
Von der interessanten Studien von Robb Kociol, Renato Lopes, Robert Clare, Laine Thomas, Rajendra Mehta, Padma Kaul, Karen Pieper, Judith Hochman, Douglas Weaver, Paul Armstrong, Christopher Granger und Manesh Patel mit dem Titel International Variation in and Factors Associated With Hospital Readmission After Myocardial Infarction aus dem JAMA 307 (1), Seiten 66-74, steht für Nicht-AbonentInnen kostenfrei ein Abstract zur Verfügung.
Jens Holst, 4.1.12
Weltgesundheitsbericht 2010 der WHO: Der Weg zu universeller Sicherung
 Für viele kam und ist er ziemlich überraschend, der Weltgesundheitsbericht 2010. Nicht nur der Titel Health Systems Financing: Path to universal coverage ist vielversprechend nach jahrzehntelanger Vorherrschaft neoliberaler, marktideologischer Forderungen nach Rückbau des Staates und Fokussierung auf pures Wirtschaftswachstum ohne Rücksicht auf soziale Verluste. Zwar hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon der Vergangenheit wiederholt die Themen Gesundheitssystementwicklung bzw. Gesundheitsfinanzierung aufgenommen. Dabei hatte sie sich jedoch wiederholt der Kritik von einigen Regierungen, vielen Nichtregierungsorganisationen (NGO) und nicht wenigen Wissenschaftlern ausgesetzt, die eine vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern wenig hilfreich erscheinende ökonomistische Einengung und Betonung von marktwirtschaftlichen Lösungsansätzen erkannten. Damit lag die WHO zwar näher an der Linie anderer großer internationaler Organisationen, allen voran der Weltbank, der Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Welthandelsorganisation (WTO).
Für viele kam und ist er ziemlich überraschend, der Weltgesundheitsbericht 2010. Nicht nur der Titel Health Systems Financing: Path to universal coverage ist vielversprechend nach jahrzehntelanger Vorherrschaft neoliberaler, marktideologischer Forderungen nach Rückbau des Staates und Fokussierung auf pures Wirtschaftswachstum ohne Rücksicht auf soziale Verluste. Zwar hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon der Vergangenheit wiederholt die Themen Gesundheitssystementwicklung bzw. Gesundheitsfinanzierung aufgenommen. Dabei hatte sie sich jedoch wiederholt der Kritik von einigen Regierungen, vielen Nichtregierungsorganisationen (NGO) und nicht wenigen Wissenschaftlern ausgesetzt, die eine vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern wenig hilfreich erscheinende ökonomistische Einengung und Betonung von marktwirtschaftlichen Lösungsansätzen erkannten. Damit lag die WHO zwar näher an der Linie anderer großer internationaler Organisationen, allen voran der Weltbank, der Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Welthandelsorganisation (WTO).
Nun hat sich die WHO als Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Bereich Gesundheit offenbar wieder stärker als in vergangenen Jahren auf ihr Kerngebiet besonnen und ihre Alleinstellungsmerkmale wieder entdeckt. Denn der WHR 2010 definiert ein zentrales, letztlich allen anderen Kriterien übergeordnetes Ziel von Gesundheitssystementwicklung und vor allem Gesundheitsfinanzierung: die universelle gesellschaftliche Absicherung gegen finanzielle Krankheitsrisiken. Universal coverage lautet der von der WHO genutzte Begriff, der systemunabhängig die Zielsetzung umreißt. Universalität beschränkt sich dabei nicht mehr nur auf die Frage, ob die gesamte Bevölkerung sozial abgesichert ist, sondern bezieht zwei zusätzliche Dimensionen ein, die für bezahlbaren Zugang zu erforderlichen Gesundheitsleistungen für Alle unerlässlich sind, nämlich den Umfang des zugänglichen Leistungskatalogs und das Ausmaß der Kostenübernahme.
Damit hat die WHO klare Vorgaben für den Aufbau ebenso wie für die Reform von Gesundheitssystemen gemacht, Vor dem Hintergrund, dass Milliarden Menschen über keinerlei soziale Absicherung verfügen, ist jedes Land aufgefordert, den Schutz seiner gesamten Bevölkerung anzustreben - egal wie zahlungskräftig die einzelnen BürgerInnen sind. Der WHR sagt dazu eindeutig, die Einbeziehung der Armen kann nur über öffentliche Mittel funktionieren, was im Übrigen in den europäischen und anderen Industrieländern viel selbstverständlicher der Fall ist, als viele Beobachter oder Politiker wahrnehmen.
Doch es reicht nicht, so die WHO in ihrem Jahresbericht 2010, dass die Menschen irgendeinem sozialen Sicherungssystem angehören; schließlich ist das Recht auf Gesundheit(sversorgung) in vielen Ländern in der Verfassung verankert, nützt den Menschen aber rein gar nichts. Entscheidend ist auch die Frage, welche Gesundheitsleistungen überhaupt abgesichert sind und in welchem Umfang das der Fall ist. Gerade in Entwicklungsländern haben die BürgerInnen nur Anspruch auf ein kleines Leistungspaket, oft nur Prävention und ambulante Versorgung, oder nur stationäre Behandlungen. Das akzeptiert der WHR 2010 allenfalls als Zwischenzustand auf dem Weg zum klar umrissenen Ziel, möglichst für alle Gesundheitsrisiken Schutz zu gewährleisten. Und es ist eine klare Absage an die von Weltbank und anderen Gebern Vorstellung eines "essential package" für ärmere Menschen, deren Absicherung nur von den verfügbaren oder als verfügbar angenommenen Ressourcen, aber nicht vom realen Bedarf abhängen soll.
Die dritte Dimension ist der effektive finanzielle Schutz, den das jeweilige soziale Sicherungssystem seinen Mitgliedern zugesteht. Der hängt zwar direkt mit dem Umfang des Leistungspakets zusammen, wo Menschen nicht abgesicherte Leistungen voll aus eigener Tasche zahlen müssen. Aber auch bei den eingeschlossenen diagnostischen- und Behandlungsleistungen erfolgt vielfach keine vollständige Kostenübernahme. Alle Formen von Selbstbeteiligungen bzw. Zuzahlungen schränken den Umfang der sozialen Absicherung ein und laufen daher dem Konzept universeller Absicherung zuwider. Überhaupt erkennt die WHO in ihrem Jahresbericht 2010 erstmalig ohne nennenswerte Relativierung die potenziell schädlichen Wirkungen von Direktzahlungen im Gesundheitswesen an: "Direct payments have serious repercussions for health. Making people pay at the point of delivery discourages them from using services (particularly health promotion and prevention), and encourages them to postpone health checks. This means they do not receive treatment early, when the prospects for cure are greatest." Und weiter heißt es: "Direct payments also hurt household finances. Many people who do seek treatment, and have to pay for it at the point of delivery, suffer severe financial difficulties as a consequence".
Alles zusammen genommen ist der Weltgesundheitsbericht 2010 eine klare Absage an gängige Glaubenssätze, die bisher die nationale wie die internationale Gesundheitspolitik bestimmten. Dazu gehört auch die von der aktuellen Bundesregierung unaufhörlich wiederholte Idee, eine Stärkung der Privatwirtschaft könne genügend ökonomische Reserven frei setzen, um im Sinne des ohnehin mittlerweile widerlegten Trickle-Down-Effekts irgendwann auch den Armen zu Gute zu kommen. Insgesamt liefert der WHR 2010 überzeugende konzeptionelle Begründungen und empirische Belege dafür, dass mehr Markt im Gesundheitswesen schwerlich die allseitig suggerierten heilsbringenden Effekte erwarten lässt. Der Bericht enthält viele nachvollziehbar begründete und empirische belegte Empfehlungen sowohl für die nationale Gesundheitspolitik, als auch für die internationale Entwicklungszusammenarbeit, die einige bisherige Ansätze grundsätzlich in Frage stellt und zum Neu-Denken auffordert. Nicht zuletzt in Deutschland, wo die Gesundheitspolitik der letzten Regierungen, also sowohl von Rot-Grün als auch der großen Koalition und Schwarz-Gelb, nur beim Einschluss der Gesamtbevölkerung Fortschritte erzielt haben; die kontinuierlichen Abstriche beim Leistungspaket und zunehmende Zuzahlungen entfernen das deutsche Gesundheitswesen hingegen zunehmend von universeller Absicherung im Krankheitsfall.
Die offizielle Vorstellung des Weltgesundheitsberichts fand in diesem Jahr im Berliner Sitz des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) in Berlin statt. Noch unter der großen Koalition hatte sich Deutschland als nicht-ständiges Mitglied im Exekutivrat der WHO für das Thema soziale Sicherung stark gemacht und die Weltgesundheitsorganisation in ihrem Bemühen unterstützt, dem Thema der sozial gerechten und nachhaltigen Gesundheitsfinanzierung den Raum zu geben, den es entwicklungs- und sozialpolitisch einnehmen sollte.
Die mittlerweile liberal geführten Ministerien BMG und BMZ (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) organisierten gemeinsam aus Anlass der Vorstellung des Weltgesundheitsberichts am 22. Und 23. November 2010 eine internationale Ministerkonferenz, an der knapp 40 Minister aus ganz unterschiedlichen Kontinenten teilnahmen. Zentrales Thema war die Frage, wie Länder die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger organisieren können. In enger Anlehnung an den Weltgesundheitsbericht 2010 lag das Augenmerk der anderthalbtägigen Konferenz auf der Frage, wie universelle Sicherung im Gesundheitswesen im Sinne er WHO-Definition zu erreichen ist.
Die Hauptrede hielt der ehemalige WHO-Mitarbeiter und mexikanische Gesundheitsminister Julio Frenk zum Thema Leadership for Universal Health Coverage. The Technical, Political, and Ethical Pillars of Reform. Darin analysierte er die Wege und die Effektivität wachsender internationaler Ressourcen für Gesundheit und betonte vor allem die große Bedeutung der Berücksichtigung empirisch belegter Ergebnisse und Auswirkungen in Politikentscheidungen im Sinne von "evidence-based policy". Genau darauf hatte er in seiner sechsjährigen Amtszeit gesetzt und mit Hilfe eines großen Teams aus Epidemiologen, Gesundheitswissenschaftlern, Ökonomen und anderen Disziplinen immer wieder überzeugende empirische Belege liefern können, um den Finanzminister davon zu überzeugen, dass mehr Geld heute später Einsparungen bewirken würde. Die Keynote des jetzigen Dekans der Public-Health-Fakultät in Harvard, der wie wenig andere Wissenschaft und Politikentscheidungen zusammenbringt, während der internationalen Ministerkonferenz Ende November 2010 steht hier zum Download zur Verfügung.
Weitere Vorträge und anderes Material zur internationalen Ministerkonferenz us Anlass der Vorstellung des Weltgesundheitsberichts finden Sie auf der Konferenzwebsite.
Den gesamten World Health Report 2010 in englischer Sprache kann man kostenfrei hier herunterladen. Ebenfalls frei verfügbar ist eine deutschssprachige Kurzfassung des Weltgesundheitsberichts 2010.
Jens Holst, 26.11.10
"Ein bisschen Niederlande aber nichts aus den USA" - Eine Leseliste zur ersten Orientierung über Gesundheitssystemvergleiche
 Kein Tag vergeht in der gesundheitspolitischen Diskussion ohne dass ein ausländisches Gesundheitssystem und seine Vergütungssysteme oder Qualitätssicherungsstandards als Vorbild oder Abschreckung zitiert wird. Und häufig werden bereits ohne vertiefte Kenntnisse weitreichende Schlussfolgerungen gezogen: Um Gottes Willen keine "englische Zustände" oder die kalifornischen "pay for performance"-Ansätze sind richtig "interessant" und allemal den Regelleistungsvolumina überlegen!
Kein Tag vergeht in der gesundheitspolitischen Diskussion ohne dass ein ausländisches Gesundheitssystem und seine Vergütungssysteme oder Qualitätssicherungsstandards als Vorbild oder Abschreckung zitiert wird. Und häufig werden bereits ohne vertiefte Kenntnisse weitreichende Schlussfolgerungen gezogen: Um Gottes Willen keine "englische Zustände" oder die kalifornischen "pay for performance"-Ansätze sind richtig "interessant" und allemal den Regelleistungsvolumina überlegen!
Wer sich für den internationalen Vergleich einiger der vielen Themen nicht tagelang in Bibliotheken informieren will oder kann, findet in einer 23 Seiten umfassenden Leseliste des britischen Kings Fund eine erste Hilfe. Diese Stiftung hat es zu ihrem Hauptziel erklärt, Gesundheitssysteme verständlicher zu machen und zur Verbesserung des britischen System beizutragen.
In der weit über einhundert Bücher-, Report- und Aufsatzhinweise umfassenden Liste sind u.a. die folgenden Themen zu finden: International developments in self-directed care., Euro health consumer index 2009., Private health insurance in the European Union, Gaining health : analysis of policy development in European countries for tackling noncommunicable diseases, Closing the gap in a generation : health equity through action on the social determinants of health, Commission on Social Determinants of Health : final report, Introducing activity-based financing : a review of experience in Australia, Denmark, Norway and Sweden, Engaging patients in their healthcare : how is the UK doing relative to other countries?, The state of ageing and health in Europe, Market failure, policy failure and other distortions in chronic disease markets, Cost of illness : an international comparison : Australia, Canada, France, Germany and The Netherlands, Priority setting in health care : lessons from the experiences of eight countries, Public trust in health care : a comparison of Germany, The Netherlands, and England and Wales oder Evidence into policy and practice? : measuring the Progress of U.S. and U.K. policies to tackle disparities and inequalities in U.S. and U.K. health and health care.
Die vorgestellten Arbeiten stammen z.B. vom Commonwealth Fund, der London School of Economics, der WHO oder dem Picker Institute.
Dort wo der Zugriff möglich ist, finden sich Links zu den vorgestellten Beiträgen. Wo dies nicht geht, muss man sich mit mehr oder minder umfangreichen Abstracts begnügen. Abgeschlossen wird die Liste mit einigen sachbezogenen Web-Links und einem Verzeichnis weiterer gesundheitssystembezogerner Leselisten, die über den Kings Fund erhältlich sind.
Die "Reading List" "International health care comparisons" des Kings Fund ist im März 2010 erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.11.10
"Health: Key tables from OECD" - Zeitreihen und Ländervergleiche ausgewählter Gesundheitsdaten
 Wer sich nicht die jährlich erscheinenden "OECD-Health-Data" leisten kann, muss seit Mitte November 2009 nicht völlig auf die Zeitreihen wichtiger Gesundheits- und Gesundheitssystemindikatoren verzichten.
Wer sich nicht die jährlich erscheinenden "OECD-Health-Data" leisten kann, muss seit Mitte November 2009 nicht völlig auf die Zeitreihen wichtiger Gesundheits- und Gesundheitssystemindikatoren verzichten.
Seitdem beginnt nämlich die OECD auf ihrer Website "Health: Key tables from OECD" die Veröffentlichung ausgewählter Indikatoren für ihre Mitgliedsländer und für den Zeitraum von 2001 bis 2007 oder 2008.
Derzeit sind es 16 Indikatoren, die von den kompletten Gesundheitsausgaben und ihrem Anteil am Bruttoinlandsprodukt, dem Anteil öffentlich finanzierter (Steuer- und Beitragsfinanzierung) Gesundheitsausgaben an allen Gesundheitsausgaben über die die Anzahl praktizierender Ärzte, verschiedene Lebenserwartungsindikatoren, mehrere Mortalitätsindikatoren bis zu den Anteilen übergewichtiger und fettsüchtiger Personen in der Bevölkerung reicht.
Die Daten für jeden Indikator sind im Moment (die OECD spricht von einer "preliminary version") als Webseite, PDF- und Exceldatei erhältlich. Einige Links verweisen in andere Datenbestände der OECD, zu denen der Zugang aber oft nur als zahlender Nutzer möglich ist.
Angesichts der Datenfülle der OECD sind weitere Schlüssel-Tabellen und Zeitreihen zu erwarten. Hinweise auf die oftmals existierenden Schwierigkeiten des Vergleichs unterschiedlich erhobener nationaler Daten findet man aber bisher nur auf anderen Websites der OECD. Bei intensiver Nutzung ist deren Lektüre unbedingt zu empfehlen.
Der Zugang zu den "Health: Key tables from OECD" ist kostenlos.
Bernard Braun, 26.1.10
OECD Systemvergleich 2009: Deutsches Gesundheitssystem zeigt gute Leistungen, aber zu sehr hohen Kosten
 Seit dem Jahr 2001 veröffentlicht die OECD im 2-Jahres-Turnus Vergleiche von Gesundheitssystemen, in denen unterschiedliche Indikatoren aus zuletzt 30 Staaten verglichen werden. Berücksichtigt werden unter anderem Morbiditäts- und Mortalitätsdaten, Angaben zum Gesundheitsverhalten, Ausgaben im Gesundheitswesen, Arztdichte und Krankenhausbetten. Der Systemvergleich liefert meist kein eindeutiges Fazit zur Bewertung wie dies bei Evaluationen anderer Einrichtungen der Fall ist (Euro Health Consumer Index, EHCI, Commonwealth Fund, CWF oder WHO), bietet aber für spezielle Fragestellungen recht gutes Datenmaterial und vor allem Informationen aus einer großen Zahl von Staaten weltweit.
Seit dem Jahr 2001 veröffentlicht die OECD im 2-Jahres-Turnus Vergleiche von Gesundheitssystemen, in denen unterschiedliche Indikatoren aus zuletzt 30 Staaten verglichen werden. Berücksichtigt werden unter anderem Morbiditäts- und Mortalitätsdaten, Angaben zum Gesundheitsverhalten, Ausgaben im Gesundheitswesen, Arztdichte und Krankenhausbetten. Der Systemvergleich liefert meist kein eindeutiges Fazit zur Bewertung wie dies bei Evaluationen anderer Einrichtungen der Fall ist (Euro Health Consumer Index, EHCI, Commonwealth Fund, CWF oder WHO), bietet aber für spezielle Fragestellungen recht gutes Datenmaterial und vor allem Informationen aus einer großen Zahl von Staaten weltweit.
Zentrale Befunde des letzten OECD-Berichts 2009 aus der Reihe "Health at a Glance" sind folgende:
• Deutschland hat ein relativ teures Gesundheitssystem, gibt im Jahr 2007 rund 10 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Gesundheitsversorgung aus. Nach den USA, Frankreich und der Schweiz ist dies der vierthöchste Wert in der OECD. Auch die Ausgaben pro Kopf liegen kaufkraftbereinigt um 20 Prozent über dem OECD-Schnitt. Einschränkend wird aber erwähnt, dass - anders als in den meisten anderen Ländern - die Gesundheitsausgaben nicht schneller gewachsen sind als die Wirtschaftsleistung und dies bei einer vergleichsweise rasch alternden Bevölkerung.
• Es gibt mehrere Gründe für diese hohen Kosten. Zum ersten liegen die Gesamtausgaben für Medikamente pro Kopf (kaufkraftbereinigt) um 17 Prozent über dem OECD-Schnitt und die von den Krankenkassen finanzierten Kosten für Medikamente sind mit die höchsten in der OECD. Zum zweiten liegt das Bruttoeinkommen der selbständigen Allgemeinmediziner nach Abzug der Praxiskosten in Deutschland beim 3,3-fachen der Durchschnittsverdienste - dies ist nach Großbritannien, Mexiko und den USA das höchste relative Einkommen in den 13 OECD-Ländern, für die diese Daten erhältlich sind. Selbstständige Fachärzte verdienen in Deutschland das 4,1-fache des Durchschnittslohns. Zum dritten schließlich ist der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesundheitsausgaben mit 5,7 Prozent deutlich höher als in den meisten anderen OECD-Ländern. Diese machen in der Schweiz nur 4,8 Prozent der Gesamtausgaben aus, in Österreich nur 3,8 Prozent.
• Mit 1,5 Allgemeinmedizinern je 1000 Einwohner hat Deutschland eine deutlich höhere Ärztedichte als andere OECD-Länder (Durchschnitt 0,9 Allgemeinmediziner je 1000 Einwohner). Dieser guten Ausstattung mit Ärzten steht eine eher mäßige Versorgung mit anderem medizinischen Fachpersonal gegenüber. So gibt es in Deutschland pro Arzt weniger Krankenschwestern oder Krankenpfleger als im OECD-Mittel. Diese Relation "praktizierende Ärzte : Krankenpfleger/innen" beträgt in Deutschland nur 1:3,1, in Norwegen hingegen 1:8,3 oder Dänemark 1:4,5.
Der OECD-Vergleich enthält noch eine Vielzahl weiterer Indikatoren. Das zentrale Fazit der Autoren für Deutschland lautet: "Deutschland hat ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, das eine Versorgung für nahezu die gesamte Bevölkerung gewährleistet. Allerdings gibt Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, die eine ähnlich breite Versorgung gewährleisten, viel Geld für sein Gesundheitssystem aus. Wichtige Kostenfaktoren sind viele Krankenhausbetten, hohe Ausgaben für Medikamente, relativ hohe Ärztehonorare und überdurchschnittlich hohe Verwaltungskosten. Dagegen sind in Zukunft in der Krankenpflege auch aufgrund der eher mäßigen Bezahlung Engpässe zu befürchten."
Der Bericht ist kostenlos hier verfügbar:
• Kurzfassung der Ergebnisse für Deutschland, in deutsch
• Gesamtbericht Health at a Glance 2009, englisch, Download einzelner Kapitel
Gerd Marstedt, 8.12.09
Befragung von über 10.000 Allgemeinärzten aus 11 Ländern zeigt Defizite auf: Leitlinien sind in deutschen Praxen wenig gefragt
 Eine neue Studie des Commonwealth Fund über die allgemeinärztliche Versorgung hat insbesondere in den USA Alarm ausgelöst. Die "USA hinken weit hinterher," heißt es im Forschungsbericht, "was den Zugang zur Versorgung, die Verwendung von Anreizen zur Qualitätsverbesserung oder die Nutzung von Informationstechnologien anbetrifft." Die empirische Studie, die Daten zur Verbreitung unterschiedlicher Innovationen in der Versorgung untersucht, hat aber auch für deutsche Arztpraxen einige Defizite aufgezeigt. So werden Leitlinien bei der Therapie chronisch Erkrankter in deutschen Arztpraxen im Vergleich zu anderen Ländern deutlich seltener angewendet.
Eine neue Studie des Commonwealth Fund über die allgemeinärztliche Versorgung hat insbesondere in den USA Alarm ausgelöst. Die "USA hinken weit hinterher," heißt es im Forschungsbericht, "was den Zugang zur Versorgung, die Verwendung von Anreizen zur Qualitätsverbesserung oder die Nutzung von Informationstechnologien anbetrifft." Die empirische Studie, die Daten zur Verbreitung unterschiedlicher Innovationen in der Versorgung untersucht, hat aber auch für deutsche Arztpraxen einige Defizite aufgezeigt. So werden Leitlinien bei der Therapie chronisch Erkrankter in deutschen Arztpraxen im Vergleich zu anderen Ländern deutlich seltener angewendet.
Die Studie basiert auf Fragebogen-Erhebungen bei über 10.000 zufällig ausgewählten niedergelassenen Allgemeinärzten aus 11 Ländern (Australien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, United Kingdom, USA). Die Befragungen fanden zwischen Februar und Juli 2009 statt. In Deutschland waren 715 Ärzte beteiligt, die Teilnahmequote lag hier bei 50 Prozent.
• Elektronische Patientenakten, also auf EDV gespeicherte Patienteninformationen zu durchgeführten Untersuchungen, Diagnosen und Therapien, sind in einigen Ländern gängiger Standard, so liegt zum Beispiel die Quote hierfür in Italien, den Niederlanden, Norwegen und Schweden bei 95% oder mehr. Deutschland liegt hier etwas zurück (72%), aber noch deutlich vor den USA (46%)
• Über Versorgungsprobleme aufgrund finanzieller Nöte von Patienten, insbesondere für privat zu bezahlende Arzneimittel, berichten US-amerikanische Ärzte besonders häufig (58%), während dies in Deutschland seltener festgestellt wird (28%), allerdings noch wesentlich öfter als in Norwegen oder Schweden (5-6%)
• Bei der Frage, ob es öfter lange Wartezeiten für einen Termin bei einem Spezialisten gibt, schneidet Deutschland trotz der hier gewährten freien Arztwahl nicht besonders gut ab. Zusammen mit Kanada (75%) und Italien (75%) ist in Deutschland (66%) die Quote der Ärzte am höchsten, die dieses Problem erkennt. Deutlich niedriger liegt dieser wert etwa im United Kingdom (22%) oder in den USA (28%).
• Eine Beachtung von Leitlinien für die Versorgung chronisch Erkrankter wird von den befragten deutschen Ärzten deutlich seltener bejaht. Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, liegt Deutschland im internationalen Vergleich hier bei Depressionen ganz am Ende, bei den übrigen drei ausgewählten chronischen Erkrankungen - Bluthochdruck, Asthma, Diabetes - an vorletzter Stelle und lediglich französische Ärzte verneinen noch öfter, dass Leitlinien im Rahmen der Therapie Verwendung finden. 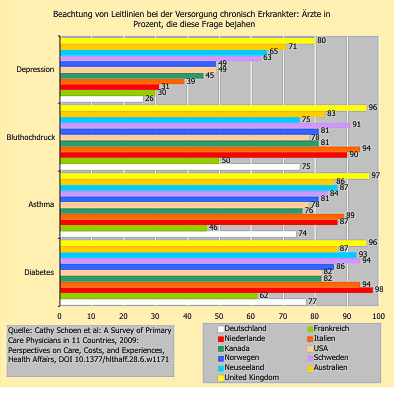
• Finanzielle Anreize zur Qualitätssicherung oder Qualitätsverbesserung stehen in allen Ländern mit Ausnahme des United Kingdom noch am Anfang. Allerdings liegt Deutschland hier (zusammen mit Norwegen, Schweden und Frankreich) ganz am unteren Ende. Eine Verbesserung von Arzthonoraren aufgrund von Kriterien wie Patientenzufriedenheit oder Qualitätsindikatoren wird ganz überwiegend verneint und nur bei DMPs (strukturierte Behandlungsprogramme für Chroniker) und Früherkennungsuntersuchungen besteht für deutsche Ärzte nach eigener Aussage öfter diese Möglichkeit.
Die Studie wurde in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlicht, kostenlos zugänglich ist dort nur ein Abstract: Cathy Schoen et al: A Survey of Primary Care Physicians in 11 Countries, 2009: Perspectives on Care, Costs, and Experiences (Health Affairs Web Exclusive, Nov. 5, 2009, w1171-w1183, DOI 10.1377/hlthaff.28.6.w1171)
Auf der Website des Commonwealth Fund (CWF) findet sich eine Kurzfassung der Befunde als PDF sowie verschiedene Publikationen mit wichtigen Befunden als Diagramm: CWF Publications - In the Literature: A Survey of Primary Care Physicians in 11 Countries, 2009: Perspectives on Care, Costs, and Experiences
Gerd Marstedt, 25.11.09
Warum kostet ein Medikament in Heraklion nur ein Viertel so viel wie in Husum? 27 Arznei-Preis- und Erstattungssysteme in der EU!
 Zu den geläufigsten ersten aber auch meist letzten Sätzen von Debatten über Arzneimittelpreise und -ausgaben in Deutschland gehört die Feststellung "man habe das Mittel X im letzten Kretaurlaub für ein Viertel des hiesigen Preises" erhalten. Befinden sich Apotheker oder Pharmareferenten im Raum, gibt es sofort jede Menge rechtfertigende Hinweise auf die in Deutschland kostspielige Versorgungsdichte, die bessere Qualitätssicherung, die höhere Steuerbelastung und last not least die Forschungsaufwände, die es ja schließlich zu refinanzieren gälte.
Zu den geläufigsten ersten aber auch meist letzten Sätzen von Debatten über Arzneimittelpreise und -ausgaben in Deutschland gehört die Feststellung "man habe das Mittel X im letzten Kretaurlaub für ein Viertel des hiesigen Preises" erhalten. Befinden sich Apotheker oder Pharmareferenten im Raum, gibt es sofort jede Menge rechtfertigende Hinweise auf die in Deutschland kostspielige Versorgungsdichte, die bessere Qualitätssicherung, die höhere Steuerbelastung und last not least die Forschungsaufwände, die es ja schließlich zu refinanzieren gälte.
Aber nicht nur die Preise von Arzneimitteln variieren allein schon zwischen den EU-Mitgliedsstaaten beträchtlich, sondern auch schon die Abläufe und Kriterien, mit und nach denen Arzneimittelpreise und die Erstattung dieser Ausgaben festgelegt und geregelt werden, weisen erhebliche Unterschiede auf.
Hinzu kommt, dass die Ausgaben für Arzneimittel respektive deren Bändigung oder gar Senkung zu den Kernelementen aller Gesundheitsreformen in Deutschland aber auch anderen Ländern gehört.
Kein Wunder, wenn z.B. in der Gesetzlichen Krankenversicherung seit einigen Jahren der Anteil der Ausgaben für Arzneimittel über denen für die gesamte ambulante ärztliche Behandlung liegt und der Medikamentenbereich zu den wenigen Leistungsbereichen mit scheinbar unaufhaltsamen Aufwärtstendenzen gehört. Entsprechend rasch ändern sich auch die jeweiligen Patentrezepte und -mittel und so kennen die meisten BürgerInnen weder Festbeträge, Rabattverträge, Arzneimittelrichtlinien, Positiv- oder Negativlisten, 4. Phase, aut idem und Generika im DEtail noch können sie diese und noch wesentlich mehr Instrumente und Methoden verstehen oder gar bewerten.
Wem dieser Zustand ein Graus ist, wer einen Teil der Hintergründe von Preisunterschieden zwischen Heraklion und Husum wirklich verstehen will, wer etwas Zeit hat und englisch kann, findet in dem im Mai 2008 veröffentlichten 187 Seiten umfassenden "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)"-Report und seinen diversen Anhängen und Anlagen die entsprechenden Informationen.
Es handelt sich um die Ergebnisse eines von der EU-Kommission geförderten Netzwerks von 52 Institutionen - Behörden und weitere wichtige Institutionen im Arzneimittelbereich - aus 31 Ländern der gesamten EU und darüber hinaus.
Das Projektmanagement erfolgte durch die Gesundheit Österreich GmbH, Geschäftsbereich Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen / Austrian Health Institute (GÖG/ÖBIG) und das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die TeilnehmerInnen schufen mit detaillierten Länderberichten (»PPRI Pharma Profiles«) die Basis für eine vergleichende Analyse der Systembesonderheiten und für einen Austausch über die Erfahrungen mit länderspezifischen Maßnahmen.
Der PPRI-Report stellt vergleichend umfangreiche Informationen zu folgenden Aspekten der Arzneimittelversorgung vor:
• Gesundheitssystemtypen, demographische und ökonomische Entwicklung als Hintergrundsbedingungen
• Grundzüge des pharmazeutischen Systems (Organisation, Erhältlichkeit von Arzneimitteln, Ausgabenstrukturen, "market players")
• Systeme der Preisfindung/-bildung
• Systeme der Erstattung von Arzneimittelaufwändungen (reimbursement)
• Systeme zum rationalen Gebrauch von Arzneimitteln (z.B. Budgets, Verordnungsleitlinien, Patienteninformation).
Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit den aus diesen Vergleichen gelernten Lektionen. Darunter befinden sich beispielsweise folgende:
• In 27 verglichenen Ländern gibt es 27 verschiedene Preis- und Erstattungssysteme.
• Länderspezifische Bedingungen erfordern offensichtlich primär länderspezifische Lösungen.
• Auch wenn in allen Ländern höchstes Interesse besteht, mehr über andere Länder zu lernen, existieren massive Verständnis-, Verstehens- und damit Verständigungsprobleme.
• Die wechselseitige Transparenz sollte verstetigt werden. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil kein Jahr ohne eine mehr oder weniger gravierendere Veränderung im Arzneimittelpolitikbereich vergangen ist und vergehen wird.
• Einigen Ländern, z.B. Schweden und den Niederländen, gelang es in diesem Jahrzehnt sogar, das Wachstum der Arznbeimittelausgaben unter 5 % pro Jahr zu halten.
• Eine erfolgreiche Kostendämpfungspolitik bei den Arzneimitteln muss nicht notwendigerweise zulasten der Patienten (z.B. durch Privatisierung der Ausgaben für die aus der Kassenerstattung genommenen Arzneimitteln) gehen.
• Ebenso ist es möglich, gleichzeitig Kosten zu senken und Qualität zu sichern.
• Eine verbreitete Inkompatibilität der nationalen Daten und Indikatoren machen internationale Vergleiche immer noch schwierig.
• Um den so genannten "pendulum effect" zu vermeiden, was meint, dass einzelne oder alle Beteiligten nach dem Wirksamwerden eines neuen Instrument mehr oder weniger schnell Schlupflöcher gegen das Gesetz entdecken, muss das Monitoring in kürzeren Abständen durchgeführt und inhaltlich stetig verfeinert werden.
• Mit der folgenden Lehre kommen wir zum Einstieg dieses Textes und einem wirklichen aber meistens ignorierten oder unterschätzten Grunddilemma gerade einer besonders aktiven Arzneimittelpolitik zurück: "Adjoint consensual policy environment tends to have a positive impact on the acceptance of decisions. The best reform is likely to fail if there is insecurity and lack of understanding among key stakeholders (in particular patients, prescribers, pharmacists and pharmaceutical industry) who consequently either ignore the measures or oppose them."
Der komplette "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)"-Report" ist kostenlos erhältlich. Die ebenfalls umfangreichen und ähnlich gegliederten Länderberichte, die so genannten "Pharma Profiles" können ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden. Dazu gehören natürlich auch 74 Seiten Deutschland-Pharma Profiles.
Bernard Braun, 14.12.08
Internationaler Vergleich der Versorgung von chronisch Kranken in acht Ländern: Deutschland - wie gewohnt - im Mittelfeld!
 Der Zugang zu Versorgungsleistungen, die Koordination einer meist komplexen und multisektoralen Versorgung und medizinische Irrtümer bei Medikamenten und bei Laboruntersuchungen gehören für Personen mit komplexen gesundheitlichen Problemen bzw. chronisch Kranken zu den wichtigsten Leistungen, die sie von ihrem Gesundheitssystem erwarten.
Der Zugang zu Versorgungsleistungen, die Koordination einer meist komplexen und multisektoralen Versorgung und medizinische Irrtümer bei Medikamenten und bei Laboruntersuchungen gehören für Personen mit komplexen gesundheitlichen Problemen bzw. chronisch Kranken zu den wichtigsten Leistungen, die sie von ihrem Gesundheitssystem erwarten.
Wie es damit im internationalen Vergleich in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Niederlanden, Neuseeland, Großbritannien und den USA aussieht erforschten im Auftrag des us-amerikanischen "Commonwealth Fund" C. Schoen, R. Osborn, S. K. H. How, M. M. Doty und J. Peugh und veröffentlichten ihre Ergebnisse in der neuesten (13. November 2008) Web Exclusive-Ausgabe von "Health Affairs" (Seite 1-16) unter dem Titel, In Chronic Condition: Experiences of Patients with Complex Health Care Needs, in Eight Countries, 2008".
Dazu interviewten die AutorInnen von März bis Mai 2008 innerhalb des "Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Sicker Adults" in den genannten 8 Ländern 7.500 (darunter z.B. 867 deutsche und 1.007 US-BürgerInnen) chronisch an mindestens einer der an 7 Erkrankungen (Hochdruck, Herzerkrankungen, Diabetes, Arthritis, Lungenprobleme, Krebs und Depression) leidenden Personen per Telefon.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Zwischen 7 (Niederlande) und 54 % (USA) der Befragten hatten kostenbedingte Probleme beim Zugang zur Versorgung (Deutschland=26 %).
• Zwischen 14 (NL) und 34 % (USA) hatten mit Koordinationsproblemen (u.a. Doppeluntersuchungen aufgrund mangelnder Transparenz) zu tun (D=26%, d.h. der zweithöchste Wert). 32 % der in Deutschland Befragten sagten, dass ihre in den letzten 2 Jahren besuchten Fachärzte keine Informationen über ihre Behandlungsgeschichte gehabt hätten. In Neuseeland betrug diese Subgruppe lediglich 12 %.
• 17 % der Befragten in den Niederlanden und 34 % in den USA hatten mit Irrtümern im medizinischen, Arzneimittel- und Laborbereich zu tun (D=19%).
• Während 41 % der chronisch Kranken in den USA im Jahr vor der Befragung mehr als 1.000 US-Dollar aus eigener Tasche für ihre Versorgung ausgeben mussten, waren britische (4 %) und niederländische Patienten (8 %) vor solchen Lasten relativ geschützt. In Deutschland belief sich dieser Anteil auf 13 %.
• In den vergangenen zwei Jahren mussten 64 % der kanadischen Chroniker eine Notfallstation aufsuchen, dicht gefolgt von den 59 % der US-Chroniker, die dies ebenfalls machen mussten und dann mit großem Abstand 39 % der deutschen Chroniker. Rund 20% von diesen Patienten suchten die Notfallstation deswegen auf, weil sie trotz der im Grunde ambulant behandelbaren Störung keinen verfügbaren Arzt gefunden hatten.
• Nur ein Viertel der Chroniker in den USA und Kanada erhielten bei Bedarf eine Behandlung am selben Tag ("same-day access") und mussten teilweise sehr lange warten. Dagegen erhielten 60% der holländischen, 54 % der neuseeländischen, 48 % der britischen und 43 % der deutschen chronisch Kranken einen sofortigen Behandlungstermin.
• An der Spitze der Länder, in denen chronisch Kranke 6 und mehr Tage auf einen Arzttermin warten mussten oder ihn sogar nie erhielten lag Kanada mit 34 %, dicht gefolgt von Deutschland mit 26 % und mit dem Schlusslicht Niederlande mit 3 % der Befragten.
• Ganz am Rande zeigen sich auch solch interessante Unterschiede der Behandlung wie der, dass 50% der deutschen Befragten in den zwei vergangenen Jahren 4 und mehr Ärzte in Anspruch nahmen während dies in Großbritannien nur 31 % berichteten.
• In Deutschland war der Anteil der Chroniker, die einen kompletten Umbau des Versorgungssystems für notwendig erachteten, mit 26 % am zweithöchsten (nach den US-Bürgerinnen mit 33 %) während er in den Niederlanden mit 9 % am niedrigsten lag.
Die ebenfalls vom Commonwealth Fund unterstützte spezielle Analyse der OECD Health Data 2008, im November 2008 veröffentlicht unter der Überschrift "Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2008" von Gerard F. Anderson und Patricia Markovich (Johns Hopkins University) unterstreicht und hinterlegt wichtige Erkenntnisse der Interviewbefragung.
Ein 36 Seiten umfassendes Chartpack über die Ergebnisse des Surveys zu den wichtigsten Zentraleffekte und Trends im Versorgungsszenario gibt es kostenlos als PDF-und Powerpointdatei.
Die 16 Seiten eines weiteren Chartpacks zum internationalen Vergleich wichtiger Eckziffern im OECD-Health-Data-Report von Anderson und Markovich sind ebenfalls kostenlos erhältlich.
Und schließlich erhält man auch den 16 umfassenden kompletten Aufsatz von Schoen et al. kostenlos als PDF-Datei.
Bernard Braun, 21.11.08
"Äpfel-mit-Birnen"-Vergleiche oder worauf man beim Vergleich unterschiedlicher Gesundheitssysteme achten muss? Acht Beispiele.
 Vergleiche der Organisation, Finanzierung, Versorgungsqualität und Leistungsfähigkeit unterschiedlicher nationaler Gesundheitssysteme gehören seit einiger Zeit zum Pflichtrepertoire internationaler Organisationen wie der
Vergleiche der Organisation, Finanzierung, Versorgungsqualität und Leistungsfähigkeit unterschiedlicher nationaler Gesundheitssysteme gehören seit einiger Zeit zum Pflichtrepertoire internationaler Organisationen wie der
• WHO: The world health report 2007 - A safer future: global public health security in the 21st century,
• der OECD: OECD Health Data 2007
• und in umfassendere Projekte eingebettet der UNO, z.B. im Millennium Project mit diversen Hintergrundpapieren zu einzelnen Gesundheitsthemen oder
• der Weltbank: z.B. Ergebnisse des Demographic and Health Survey (DHS)-Projekts des Poverty and Health-Schwerpunkts der World Bank u.a. zum Thema "Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and Population within Developing Countries".
Gleichzeitig übernehmen manche nationale Gesundheitspolitiker auch nicht nur die meist englischen Bezeichnungen für ausländische Gesundheitsversorgungsprogramme (z.B. Disease Management, Diagnosis related groups, Managed Care), sondern beginnen zumindest die "guten" Teile derartiger Programme zu importieren oder zu imitieren. Solche "Import-Export"-Politik stützt sich oft auf die Ergebnisse vergleichender Wirksamkeits- oder Outcomeanalysen.
Spätestens wenn es so praktisch wird, sollte aber hinterfragt werden, wie die möglicherweise positiven Ergebnisse solcher Versorgungsprogramme zustandegekommen sind, ob sie wirklich das abbilden was man aus dem eigenen nationalen Kontext zu sehen meint und ob die Übernahme derartiger Programme in andere Gesundheitssysteme wirklich verlässlich zu vergleichbaren guten Ergebnissen führt.
Kommen hier Zweifel auf, stellt sich die Frage worauf man bei vergleichenden Untersuchungen von Gesundheitssystemen besonders Acht geben muss und wie man dem Risiko, "Äpfel mit Birnen" zu vergleichen und "Äpfel statt Birnen" einzuführen, entgeht.
Welche Indikatoren und Instrumente sind also in derartigen Vergleichen zulässig, valide und praktisch ertragreich? Mit Antworten auf diese Fragen beschäftigte sich bereits vor einigen Jahren das über 6 Jahre laufende Forschungsprojekt EUROHIS an dem sich eine Vielzahl von ExpertInnen aus Mitgliedsstaaten der WHO im europäischen Bereich beteiligte.
Nach einem Überblick über das Anliegen des Projekts enthält der Abschlussbericht Darstellungen über die Entwicklung von Indikatoren und Instrumente, die für derartige Vergleiche tauglich sind, in acht Bereichen: chronic physical conditions, mental health, alcohol consumption, physical activity, use of curative medical services, use of medicines, use of preventive health care und quality of life.
Jeder Aufsatz liefert konkrete Hinweise worauf bei versorgungsbezogenen Systemvergleichen besonders geachtet werden muss und wo scheinbar griffige Ergebnisse relativiert werden müssen.
Trotz des insgesamt von ihnen betriebenen Aufwands weisen die ForscherInnen in ihrem Fazit selbstkritisch auf die immer noch existierenden transregionalen und -kulturellen Grenzen und Einschränkungen auch ihrer Instrumente hin:
• "The results of the EUROHIS project confirm that the use of common instruments (i.e. harmonized inputs) is a prerequisite, but not a guarantee, for obtaining cross-culturally comparable health data (i.e. harmonized outputs). The recommended common instruments eliminate the unnecessary differences that arise from the instruments that are currently used, and encourage emphasis on the most relevant and feasible aspects in terms of crosscultural comparisons.
• However, the project has also shown the limits of input harmonization. First, different cultures have different social norms of what is acceptable behaviour and what are acceptable responses to questions on health, thus creating biases within the data. Second, living conditions and the level of health service provision differ in the WHO European Region and reflect a distinct east-west gradient of wealth, as measured for example by GDP per person. Such differences affect the relevance of the instruments in any given population. Third, there appears to be different concepts of health (and thus differences in the way that people assess their own physical and/or mental health) in different parts of the European Region."
Der 193 Seiten umfassende Bericht "EUROHIS: Developing Common Instruments for health surveys. Biomedical and health research, Volume 57" von Anatoliy Nosikov und Claire Gudex herausgegeben ist kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 6.5.2008
Europäischer Gesundheitssystem-Vergleich 2007: Deutschland schwächelt bei Patientenrechten und Patienteninformation
 Im aktuellen europäischen Gesundheitskonsumenten-Index 2007 (Euro Health Consumer Index, EHCI), einem seit 2005 jährlich erstellten Vergleich europäischer Gesundheitssysteme mit dem Schwerpunkt "Konsumentenfreundlichkeit", belegt Deutschland hinter Österreich, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz den fünften Platz. Im Vergleich zum Vorjahr (3.Platz) ist dies ein leichter Rückgang auf der Ranking-Liste, die auf der Basis verfügbarer Gesetzestexte, Dokumente und Statistiken erstellt wird. Bei einer Betrachtung der einzelnen Bewertungskategorien fällt auf, dass Deutschland insbesondere im Bereich Patientenrechte und Patienteninformation im Vergleich zu anderen Ländern schlechter abschneidet.
Im aktuellen europäischen Gesundheitskonsumenten-Index 2007 (Euro Health Consumer Index, EHCI), einem seit 2005 jährlich erstellten Vergleich europäischer Gesundheitssysteme mit dem Schwerpunkt "Konsumentenfreundlichkeit", belegt Deutschland hinter Österreich, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz den fünften Platz. Im Vergleich zum Vorjahr (3.Platz) ist dies ein leichter Rückgang auf der Ranking-Liste, die auf der Basis verfügbarer Gesetzestexte, Dokumente und Statistiken erstellt wird. Bei einer Betrachtung der einzelnen Bewertungskategorien fällt auf, dass Deutschland insbesondere im Bereich Patientenrechte und Patienteninformation im Vergleich zu anderen Ländern schlechter abschneidet.
Der Gesundheitssystemvergleich errechnet aus 27 einzelnen Indikatoren aus 5 Oberkategorien die Gesamtbewertung. Für jeden Indikator wurden 3, 2 oder 1 Punkte vergeben. Die vom Forschungs- und Beratungsinstitut Health Consumer Powerhouse verwendeten Kategorien und Indikatoren sind folgendermaßen definiert:
• Patientenrechte und Patienteninformation (9 Indikatoren, Gewichtungsfaktor 1.5): Verankerung von Patientenrechten in der Gesetzgebung, Beteiligung von Patientenorganisationen bei Entscheidungen, Versicherung gegen medizinische "Kunstfehler", Recht auf eine Zweitmeinung, Zugang zu Behandlungsunterlagen, Verfügbarkeit eines Ärzteverzeichnisses mit Angaben zu Schwerpunkten und Spezialisierungen, Anteil der Ärzte mit Führung einer EDV-gestützten Patientenakte, Verfügbarkeit eines Klinikführers mit Angaben zur Behandlungsqualität, telefonisch verfügbare Patientenberatung auch zu medizinischen Fragen
• Wartezeiten auf eine Behandlung (5 Indikatoren, Gewichtung 2.0): Hier werden Wartezeiten für unterschiedliche diagnostische Untersuchungen (z.B. Magnetresonanz-Tomografie) oder Behandlungsverfahren bewertet (z.B. direkter Zugang zu einem Facharzt ohne Überweisung, Chemo- oder Strahlentherapie bei Krebs)
• Behandlungsergebnisse (5 Indikatoren, Gewichtung 2.0): Als Outcomes werden hier berücksichtigt: 28-Tage-Sterblichkeit nach Herzinfarkt, Kindersterblichkeit, 5-Jahres-Überlebensrate bei Krebs, vermeidbare Sterbefälle bzw. Lebensjahre, MRSA-Infektionen
• "Großzügigkeit" ("generosity") (4 Indikatoren, Gewichtung 1.0): Anzahl der Katarakt-Operationen pro 100.000 Einwohner, Impfrate bei 4jährigen, Anzahl der Nieren-Transplantationen pro 1 Million Einwohner, zahnärztliche Behandlung als Teil des Gesetzlichen Krankenversicherungssystems
• Arzneimittel (4 Indikatoren, Gewichtung 1.0): Kostenfreiheit verschreibungspflichtiger Arzneimittel, Verfügbarkeit eines für Laien und Patienten verständlichen Arzneimittel-Registers (oder ähnliche Informationen), Geschwindigkeit der Entwicklung neuer Krebs-Medikamente, Geschwindigkeit der Zulassung neuer Medikamente.
Man kann ohne Zweifel darüber streiten, ob das Spektrum der ausgewählten Indikatoren nun "repräsentativ" ist für eine Gesamtbewertung des Gesundheitssystems eines Landes und man kann auch bei einzelnen Merkmalen Zweifel an ihrer Aussagekraft anmelden. Dass Deutschland jedoch beim Thema "Patientenrechte und Patienteninformation" insgesamt lediglich 15 Punkte bekommt (von 27 möglichen Punkten) und damit im hinteren Drittel der 29 berücksichtigten Länder rangiert, ist ein Befund, der nicht gänzlich neu ist und auch in anderen Studien schon zutage getreten ist. Dänemark und die Niederlande sind hier besonders vorbildlich. Im Kommentar zu den deutschen Ergebnissen heißt es: "Um wieder an die Spitze zurückzukehren, muss sich das deutsche Gesundheitswesen in Bezug auf die Bereiche Patientenrechte und Information öffnen! Dies ist ein unterentwickelter Bereich in einem ansonsten gut funktionierenden System", erklärt Dr. Arne Björnberg, Forschungsdirektor für den Euro Health Consumer Index.
• Der komplette Bericht (englisch, 55 Seiten, PDF) kann hier heruntergeladen werden: EHCI Report 2007
• Hier ist eine Tabelle mit den Einzelergebnissen für alle Indikatoren
• Hier ist eine kurze Pressemitteilung speziell zum deutschen Abschneiden: Deutsches Gesundheitswesen verliert in Konsumenten-Ranking an Boden
Gerd Marstedt, 3.10.2007
Deutsche Ärzte erkennen Mängel in der medizinischen Versorgung sehr viel seltener als ihre Kollegen im Ausland
 Eine Umfrage des Commonwealth Fund bei Primärärzten in insgesamt sieben Ländern hat jetzt aufgezeigt, dass sich deutsche Ärzte in der Kritik des Versorgungssystems, im Hinblick auf wünschenswerte Veränderungen, aber auch hinsichtlich der Patientenkontakte teilweise massiv unterscheiden von ihren ärztlichen Kollegen in anderen Ländern. Die vom Commonwealth Fund initiierte Erhebung wurde im Jahre 2006 in insgesamt sieben Ländern durchgeführt (Australien, Kanada, Deutschland, Niederlande, Neuseeland, Großbritannien und USA). Für Deutschland finanzierte die Umfrage das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Beteiligt haben sich hier insgesamt 1006 niedergelassene Ärzte der Primärversorgung, das sind 20 Prozent der angefragten Mediziner.
Eine Umfrage des Commonwealth Fund bei Primärärzten in insgesamt sieben Ländern hat jetzt aufgezeigt, dass sich deutsche Ärzte in der Kritik des Versorgungssystems, im Hinblick auf wünschenswerte Veränderungen, aber auch hinsichtlich der Patientenkontakte teilweise massiv unterscheiden von ihren ärztlichen Kollegen in anderen Ländern. Die vom Commonwealth Fund initiierte Erhebung wurde im Jahre 2006 in insgesamt sieben Ländern durchgeführt (Australien, Kanada, Deutschland, Niederlande, Neuseeland, Großbritannien und USA). Für Deutschland finanzierte die Umfrage das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Beteiligt haben sich hier insgesamt 1006 niedergelassene Ärzte der Primärversorgung, das sind 20 Prozent der angefragten Mediziner.
Bestätigt wurde in der Umfrage zunächst noch einmal ein Ergebnis, das schon frühere Studien aufgezeigt hatten, das jedoch bezweifelt worden war (vgl. GEK-Studie zeigt: Bei der Zahl der Arztbesuche sind deutsche Patienten führend). Tatsächlich sind deutsche Patienten im internationalen Vergleich besonders häufig beim Arzt. Dies ist jedoch kein Hinweis darauf, dass Deutsche kränker sind als ihre Mitbürger im Ausland. Eher schon könnte dies darauf zurück zu führen sein, dass die Gesprächsdauer beim Arztbesuch hierzulande zeitlich sehr viel kürzer ausfällt, so dass das Bedürfnis entsteht, in weiteren und zusätzlichen Arztterminen Versäumtes nachzuholen, wie zum Beispiel weitere Untersuchungen oder auch Informationen und Erläuterungen. Die Studie hat gezeigt: Deutsche Ärzte sind mit 243 Patienten-Kontakten pro Woche deutlich führend. In den übrigen einbezogenen Ländern liegt diese Zahl nur bei 102-154 Patientenkontakten. Da die wöchentliche Arbeitszeit kaum Differenzen zwischen den Ländern zeigt (etwa 29-32 Stunden in der Woche) ergibt sich daraus für deutsche Ärzte und Patienten eine sehr viel kürzere Gesprächsdauer: Sie liegt in 5 der 7 Länder zwischen 13 und 19 Minuten, in England bei etwa 11 und in Deutschland bei unter 8 Minuten. 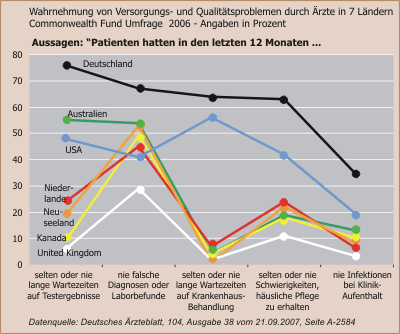
Auffällig geworden ist ebenfalls, dass deutsche Ärzte Mängel in der medizinischen Versorgung sehr viel seltener wahrnehmen als ihre Kollegen im Ausland und auch seltener über eigene Behandlungsfehler berichten (vgl. Abbildung). So erklären 67% der deutschen Mediziner, dass Patienten in den letzten 12 Monaten niemals falsche Diagnosen oder Laborbefunde erhalten hätten, in anderen Ländern findet sich diese Selbstgewissheit deutlich seltener (30-55%). Ein ähnliches Bild zeigt sich auch für andere Befragungsaspekte wie Probleme häuslicher Pflege, Krankenhaus-Infektionen oder Wartezeiten auf Termine bei einem Spezialisten oder Krankenhausbehandlungen. Etwa jeder dritte deutsche Arzt (34%) verneint vollständig das Vorkommen von Krankenhaus-Infektionen seiner Patienten im letzten Jahr, in anderen Ländern ist diese optimistische Sichtweise weniger stark ausgeprägt, hier sind es nur 3-19%.
Differenzen finden sich auch, was die Bewertung von Maßnahmen anbetrifft, um die Versorgungsqualität zu verbessern. So sind deutsche Ärzte überaus distanziert, was den Einbezug anderer Berufsgruppen (wie z.B. Krankenschwestern) in das Feld der Patientenberatung anbetrifft. Dieser unlängst auch vom Sachverständigenrat vorgetragene Vorschlag findet nur bei 20% der deutschen Ärzte Zustimmung, im Ausland sind dies mit 30-51% sehr viel mehr. Die knappe Zeit, die der deutsche Arzt aufgrund der Vielzahl von Patientenkontakten für den einzelnen Patienten hat,. schlägt sich dann auch nieder in einer hohen Zustimmung zum Statement "Der Arzt sollte mehr Zeit zur Patientenberatung haben." Hier sind 75% der deutschen im Vergleich zu 44-62% der Ärzte in anderen Ländern der Meinung, dass dies besonders effektiv wäre zur Verbesserung der Versorgungsqualität.
Die Mehrzahl der befragten Ärzte erkennt in den meisten Ländern einen Änderungsbedarf für das jeweilige Gesundheitswesen, doch in keinem Land ist die Unzufriedenheit so ausgeprägt wie in Deutschland: 54% der Ärzte "halten grundlegende Änderungen für nötig" und 42 % bewerten im deutschen System sogar so stark als verkehrt, dass es komplett reformiert werden müsste. Der Anteil der Unzufriedenen liegt damit hierzulande mit 96 % deutlich höher als in den anderen Ländern, in den Niederlanden sind es nur 45 %, in den USA 85 %.
Die Autoren der Studie interpretieren diese Ergebnisse vor einem gesundheitspolitischen Hintergrund: "Die Umfrage fand in Deutschland in einer Zeit kontroverser Diskussion um Reformen des Gesundheitswesens statt. Möglich ist, dass ein Teil der Befragten strategisch geantwortet hat. Wer eine bestimmte gesundheitspolitische Entwicklung wünscht, antwortet eher so, dass er seine Argumentation unterstützt, auch wenn es nicht der Sachlage entspricht."
Offen bleibt damit allerdings noch die Frage, ob die im internationalen Vergleich nur sehr geringe Kritik der deutschen Ärzte an Versorgungsmängeln (und auch die ärztliche Selbstkritik) nun ein Hinweis ist auf tatsächlich sehr viel bessere Versorgungsstrukturen oder eher ein Mangel an Kritikfähigkeit und Veränderungsbereitschaft. Ergebnisse internationaler Systemvergleiche im Gesundheitswesen können können als Beleg für die erste Interpretation leider nur sehr begrenzt herangezogen werden. Die hohe Abneigung der deutschen Mediziner gegen einen Einbezug anderer Berufsgruppen in das Terrain der Patienberatung deutet eher darauf hin, dass doch wohl ein sehr starke Abneigung gegen Veränderungen des status quo vorherrscht.
Der Übersichtsartikel zu den Umfrage-Ergebnissen ist im Deutschen Ärzteblatt nachzulesen: Koch, Klaus; Gehrmann, Ulrich; Sawicki, Peter T.: Primärärztliche Versorgung in Deutschland im internationalen Vergleich: Ergebnisse einer strukturvalidierten Ärztebefragung
Gerd Marstedt, 25.9.2007
Aktualisierter Gesundheitssystem - Vergleich des CWF: Deutschland auf Platz 2, USA wieder mal auf dem letzten Platz
 Zum dritten Mal nach 2004 und 2006 hat der Commonwealth Fund (CWF) jetzt im Mai 2007 seinen Gesundheitssystem-Vergleich herausgegeben. Einbezogen waren sechs Länder, Australien, Neuseeland, Kanada, United Kingdom, die USA und Deutschland. Wie schon in den vorherigen CWF-Berichten und wie auch in vielen anderen internationalen Vergleichen schneidet das Gesundheitssystem der USA am schlechtesten ab: Es ist das weltweit teuerste, das medizinisch am wenigsten effektive und zugleich das ungerechteste System, weil untere Sozialschichten keinen Krankenversicherungsschutz genießen und darum medizinisch oft unterversorgt sind.
Zum dritten Mal nach 2004 und 2006 hat der Commonwealth Fund (CWF) jetzt im Mai 2007 seinen Gesundheitssystem-Vergleich herausgegeben. Einbezogen waren sechs Länder, Australien, Neuseeland, Kanada, United Kingdom, die USA und Deutschland. Wie schon in den vorherigen CWF-Berichten und wie auch in vielen anderen internationalen Vergleichen schneidet das Gesundheitssystem der USA am schlechtesten ab: Es ist das weltweit teuerste, das medizinisch am wenigsten effektive und zugleich das ungerechteste System, weil untere Sozialschichten keinen Krankenversicherungsschutz genießen und darum medizinisch oft unterversorgt sind.
Deutschland landet im Systemvergleich auf Platz 2, das United Kingdom liegt auf der Rangliste ganz vorne auf Platz 1. Kanada schneidet in einer großen Zahl von Bewertungs-Kategorien ähnlich schlecht ab wie die USA. Die Daten der Analyse stammen aus unterschiedlichen Quellen. Herangezogen wurden OECD-Daten zu den Gesundheitsausgaben pro Kopf der Bevölkerung sowie Ergebnisse von drei repräsentativen Telefon-Umfragen mit unterschiedlichen Stichproben: Patienten in der ambulanten Versorgung, Patienten, die einen besonders schlechten Gesundheitszustand aufweisen und niedergelassene Allgemein- und Hausärzte.
Für die Bewertung wurden fünf Kategorien berücksichtigt:
• Qualität der Versorgung (unterteilt in Versorgungslücken, Patientensicherheit, Koordination, Patientenzentrierung),
• Zugang zur Versorgung,
• Effektivität (Versorgungsqualität in Relation zu den Kosten),
• soziale Gerechtigkeit ("Equity")
• und Lebenserwartung.
Die Daten hierzu wurden aus den oben genannten Quellen herangezogen, so wurde beispielsweise für den Aspekt "Zugang zur Versorgung" berücksichtigt: Ergebnisse der Ärztebefragung über Wartezeiten für Patienten, Ergebnisse der Patientenbefragung über verschobene oder unterlassene Arztbesuche aus Kostengründen, Zugang zu Versorgungseinrichtungen nachts und am Wochenende. Für den Aspekt "Qualität der Versorgung - Versorgungslücken" wurden insgesamt 17 Indikatoren verwendet, die den Bereich Prävention und die Versorgung chronisch Erkrankter berühren, darunter etwa: Anteil der 50-64jährigen, bei denen in den letzten zwei Jahren eine Mammographie durchgeführt wurde, Anteil der Diabetiker, bei denen bestimmte Tests gemacht wurden, Anteil chronisch Erkrankter, die eine schriftliche Anleitung zum Umgang mit ihrer Krankheit bekamen usw.
Während Deutschland beim Aspekt "Patientensicherheit" ganz vorne auf Rang 1 eingestuft wurde, fiel das Urteil in der Kategorie "Koordination der Versorgung" nur mittelmäßig aus (Platz 4). Mit einer einzigen Ausnahme wurde das weitgehend privatisierte US-Gesundheitssystem in allen Kategorien auf Platz 5 oder 6 eingestuft, und dies, obwohl die Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit in den USA im Jahre 2004 mit rund 6.100 $ dreimal so hoch ausfallen wie in Neuseeland (2.100$) und doppelt so hoch wie in Deutschland (3.000$).
Hier ist eine Kurzfassung des Berichts mit den wichtigsten Ergebnissen
Der vollständige Bericht: Mirror, Mirror on the Wall: An International Update on the Comparative Performance of American Health Care (PDF, 40 Seiten)
Gerd Marstedt, 29.5.2007
Health Policy Monitor: Was passiert gesundheitspolitisch in 20 Ländern?
 Gesundheitspolitische Konzepte und Modelle in vergleichbaren Ländern inner- und außerhalb Europas spielten und spielen eine gewisse Rolle in der deutschen Gesundheitspolitik. Äußerliches Indiz ist das immer häufigere Auftauchen von Disease und Case Management Programmen, Total Quality-Strategien, DRG-Systemen oder Managed Care-Orientierungen im deutschen Gesundheitswesen. Was das meint, welche Erfahrungen damit in den jeweiligen Herkunftsländern gemacht wurden und werden und welche Reformen im Finanzierungs- und Versorgungsbereich dort sonst noch verfolgt werden, trägt seit 2002 der von der Bertelsmann Stiftung initierte und mitgetragene "Health Policy Monitor (HPM)" für derzeit 20 Länder (u.a. Australien, Finnland, Singapore, Slowenien, United Kingdom, USA) zusammen. Zu finden sind dort u.a. auch die Berichte des WHO-getragenen "European Observatory"-Projekts "Health care systems in transition (HiT) profile" für diese Länder.
Gesundheitspolitische Konzepte und Modelle in vergleichbaren Ländern inner- und außerhalb Europas spielten und spielen eine gewisse Rolle in der deutschen Gesundheitspolitik. Äußerliches Indiz ist das immer häufigere Auftauchen von Disease und Case Management Programmen, Total Quality-Strategien, DRG-Systemen oder Managed Care-Orientierungen im deutschen Gesundheitswesen. Was das meint, welche Erfahrungen damit in den jeweiligen Herkunftsländern gemacht wurden und werden und welche Reformen im Finanzierungs- und Versorgungsbereich dort sonst noch verfolgt werden, trägt seit 2002 der von der Bertelsmann Stiftung initierte und mitgetragene "Health Policy Monitor (HPM)" für derzeit 20 Länder (u.a. Australien, Finnland, Singapore, Slowenien, United Kingdom, USA) zusammen. Zu finden sind dort u.a. auch die Berichte des WHO-getragenen "European Observatory"-Projekts "Health care systems in transition (HiT) profile" für diese Länder.
Das Hauptaugenmerk der online und zum Teil auch in gedruckter Buchform zugänglichen Dokumentationen liegt auf der Darstellung politischer Reformen von der Idee über die Details der Implementation bis zum tatsächlichen Wandel. Dabei wird der Darstellung der verschiedenen politischen Akteuren und ihren Interaktionen, also dem Prozess des "policy making", großer Raum eingeräumt. Anfang 2007 können 500 Berichte heruntergeladen werden.
Interessant sind auch die halbjährlich erscheinenden Reports "Gesundheitspolitik in Industrieländern", die zu einer aufgeklärt kritischen Fundierung der nationalen Gesundheitspolitiken und zur Verbreitung von "models of good practices" beitragen sollen. Der Anfang 2007 zuletzt erschienene 6. deutsche Band beschäftigt sich beispielsweise mit der Evaluationskultur und -praxis in den Monitorländern: "Im Mittelpunkt steht diesmal ein überfälliges, in Deutschland oft immer noch negativ besetztes Thema: Evaluation und Evaluationskultur. Wir wollen deutlich machen, wie es anderswo ganz selbstverständlich gelingt, Evaluation nicht als Kontrolle, sondern als Instrument für Qualitätsverbesserung, Coaching und professionelle Unterstützung durch Dokumentation und Feedback einzusetzen."
Hier finden Sie Zugang zum "Health Policy Monitor (HPM)".
Bernard Braun, 11.2.2007
Deutsches Gesundheitssystem: Mängel bei Patientenrechten und -information
 Im Europäischen Gesundheitskonsumenten - Index (Euro Health Consumer Index, EHCI 2006), einer jährlichen Untersuchung der öffentlichen Gesundheitssysteme in der EU, belegt Deutschland den 3. Platz. In den 26 untersuchten europäischen Ländern werden die französischen Verbraucher nach dieser Studie von ihrem Gesundheitswesen am besten versorgt. Knapp dahinter folgen die Niederlande, dann Deutschland und Schweden. In fünf Kategorien, die 28 Leistungsindikatoren erfassen, erreichte Deutschland 571 von insgesamt 750 möglichen Punkten. Das deutsche Gesundheitswesen liegt bei den Wartezeiten, beim Recht auf eine zweite Meinung, der zahnärztlichen Versorgung als Teil des staatlichen Gesundheitsleistungsangebots, der Bezuschussung von Arzneimitteln und dem Zugang zu neuen Arzneimitteln an der Spitze.
Im Europäischen Gesundheitskonsumenten - Index (Euro Health Consumer Index, EHCI 2006), einer jährlichen Untersuchung der öffentlichen Gesundheitssysteme in der EU, belegt Deutschland den 3. Platz. In den 26 untersuchten europäischen Ländern werden die französischen Verbraucher nach dieser Studie von ihrem Gesundheitswesen am besten versorgt. Knapp dahinter folgen die Niederlande, dann Deutschland und Schweden. In fünf Kategorien, die 28 Leistungsindikatoren erfassen, erreichte Deutschland 571 von insgesamt 750 möglichen Punkten. Das deutsche Gesundheitswesen liegt bei den Wartezeiten, beim Recht auf eine zweite Meinung, der zahnärztlichen Versorgung als Teil des staatlichen Gesundheitsleistungsangebots, der Bezuschussung von Arzneimitteln und dem Zugang zu neuen Arzneimitteln an der Spitze.
Es gibt zwar nur wenige wirkliche Schwachpunkte, doch die medizinischen Ergebnisse könnten sich generell noch verbessern. Und es gibt keine ausreichende gesetzliche Regelung der Patientenrechte in Deutschland. "Das deutsche Gesundheitswesen wäre wirklich toll, es nimmt aber im Qualitätsbereich noch keine führende Position ein", meint Dr. Arne Björnberg, Leiter des Euro Health Consumer Index. Deutschland sollte unter anderem in folgenden Bereichen aktiv werden: Einbeziehung von Patientenorganisationen in die Entscheidungsfindung und mehr bzw. bessere Informationen über Arzneimittel.
Insbesondere in der Rubrik "Patientenrechte und -information" schneidet Deutschland schlecht ab, bekam nur 17 von insgesamt 30 möglichen Punkten. Negativ wirkte sich im internationalen Vergleich insbesondere aus: Die Reichweite der Gesetze zu Patientenrechten, die eher geringe Beteiligung von Patienten-Organisationen bei Entscheidungen und Gesetzgebung, eine fehlende Versicherung gegen medizinische Kunstfehler, fehlende Broschüren oder andere Informationen zur Bewertung der Qualität medizinischer Anbieter. (vgl. EHCI 2006, S. 19)
Der Europa-Gesundheitskonsumenten-Index (Euro Health Consumer Index) bewertet jährlich die nationalen europäischen Gesundheitssysteme nach fünf Bereichen, die für den Verbraucher ausschlaggebend sind: Rechte und Aufklärung der Patienten, Wartezeiten für gängige Behandlungen, Behandlungsergebnisse, Kundenfreundlichkeit und Zugang zu medikamentöser Behandlung. Der Index wurde erstmals 2005 veröffentlicht. Er wird aus einer Kombination aus öffentlichen Statistiken und unabhängigen Forschungsarbeiten zusammengestellt. Er wird von der in Brüssel ansässigen Analyse- und Informationsorganisation Health Consumer Powerhouse erstellt.
Verfügbar ist bei Health Consumer Powerhouse
• der komplette Bericht (englisch, 40 Seiten): Euro Health Consumer Index - EHCI 2006
• sowie eine deutschsprachige kürzere Pressemitteilung
Gerd Marstedt, 11.1.2007
Praxisausstattung von Primärarzt-Praxen in sieben Industrieländern
 Die gerade in einem Aufsatz in "Health Affairs Exclusive" ("On the Front Lines of Care: Primary Care Doctors’ Office Systems, Experiences, and Views in Seven Countries") veröffentlichten Ergebnisse einer Studie mit 6.000 Allgemein- und Hausarztpraxen in Australien, Großbritannien, Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Neuseeland und den USA, weisen auf erhebliche Unterschiede bei ausgewählten Elementen der Praxisausstattung und insbesondere der Informations-.Infrastruktur hin, die sich auf die Wirksamkeit und Effizienz der Behandlung auswirken können.
Die gerade in einem Aufsatz in "Health Affairs Exclusive" ("On the Front Lines of Care: Primary Care Doctors’ Office Systems, Experiences, and Views in Seven Countries") veröffentlichten Ergebnisse einer Studie mit 6.000 Allgemein- und Hausarztpraxen in Australien, Großbritannien, Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Neuseeland und den USA, weisen auf erhebliche Unterschiede bei ausgewählten Elementen der Praxisausstattung und insbesondere der Informations-.Infrastruktur hin, die sich auf die Wirksamkeit und Effizienz der Behandlung auswirken können.
Besonders schlecht stehen die US-Ärzte da: Sie verfügen u.a. am wenigsten (28 %; Spitzenreiter Niederlande: 98 %) über klinische Informationssysteme, erhalten am wenigsten (30 %; Spitzenreiter Großbritannien: 95 %) qualitätsbasierte Zahlungsanreize, bieten am wenigsten (40 %; Spitzenreiter Niederlande: 95 %) Sondersprechstunden außerhalb der normalen Öffnungszeiten an und berichten am meisten (51 %) darüber, dass ihre Patienten Schwierigkeiten haben, die Behandlung zu bezahlen.
Die deutschen Ärzte nehmen, wie aus anderen internationalen Vergleichen gewohnt, meist eine Mittelposition ein: 42 % nutzen nach eigenen Angaben elektronische Informationssysteme, 73 % setzen elektronische Hinweissysteme auf mögliche Verordnungsprobleme ein (Spitzenreiter sind mit 95 % die britischen Hausärzte), 76 % bieten Sondersprechstunden an und 43 % berichten von qualitätsorientierten finanziellen Anreizen. Positiv herausragend sind die 63 % der deutschen Primärärzte, die ihren Patienten einen Plan für die Organisation von häuslicher Versorgung ausfertigen, negativ ragen aber 53 % aller deutschen Ärzte heraus, die 15 und mehr Tage brauchen, um einen vollständigen Bericht über einen Krankenhausaufenthalt eines ihrer Patienten in Händen zu halten. Nur in Kanada brauchen etwas mehr, nämlich 58 % der Ärzte im "primary care"-Bereich, so viel Zeit.
Hier finden sie ausführlichere Informationen: Aufsatz in Health Affairs Web Exclusive
Bernard Braun, 6.11.2006
Ergebnisse des Gesundheitssystemvergleichs von 9 OECD-Ländern 2005
 Auf 118 Seiten legten im April 2006 zwei Wissenschaftler der Johns Hopkins University im Auftrag des Commonwealth Fund auf Basis der OECD-Health Data 2005 und einer Reihe nationaler Surveys eine umfassende Darstellung von "Multinational Comparisons of Health Systems Data 2005" vor. Dabei handelt es sich um Vergleiche der Strukturen und Leistungen der Gesundheitssysteme von 9 industrialisierten Länder: Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Niederlande, Neuseeland, Großbritannien und USA. Wo möglich, enthalten die Abbildungen und Tabellen auch den Mittelwert aller 30 Mitglieder der OECD.
Auf 118 Seiten legten im April 2006 zwei Wissenschaftler der Johns Hopkins University im Auftrag des Commonwealth Fund auf Basis der OECD-Health Data 2005 und einer Reihe nationaler Surveys eine umfassende Darstellung von "Multinational Comparisons of Health Systems Data 2005" vor. Dabei handelt es sich um Vergleiche der Strukturen und Leistungen der Gesundheitssysteme von 9 industrialisierten Länder: Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Niederlande, Neuseeland, Großbritannien und USA. Wo möglich, enthalten die Abbildungen und Tabellen auch den Mittelwert aller 30 Mitglieder der OECD.
Das Chartbook ist in 11 Abschnitte aufgeteilt: Gesamtausgaben, Verhältnis privater und öffentlicher Versorgungsfinanzierung, Gesundheitsausgaben nach Bereichen, Krankenhäuser, Altenpflege, Ärzte, Krankenhauspflege, Arzneimittel, Medizintechnikprodukte, nichtmedizinische Einflussfaktoren auf Gesundheit und Sterblichkeit.
Abgeschlossen wird die Dokumentation mit Kurzsteckbriefen der 9 Gesundheitssysteme und ausführlichen Definitionen der dargestellten Indikatoren. Der Nutzwert wird zusätzlich dadurch erhöht, dass die Abbildungen per Mausklick kopiert und in eigene Darstellungen als Zitat eingefügt werden können.
Hier finden Sie die Powerpointdatei: Gesundheitssystemvergleich-Chartbook
Bernard Braun, 6.11.2006
Gesundheitssysteme in Europa: Große Lösungen und komplette Systemwechsel sind chancenlos
 Die Finanzierung der Krankenversicherung über einkommensabhängige Beiträge steht nicht nur in Deutschland unter Druck. Das zeigt ein Vergleich unter 16 europäischen Ländern, die der Frankfurter Professor für Sozialpolitik Diether Döring und Gutachter der Hessen Agentur im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung jetzt analysiert haben. Ein Patentrezept fürs Gesundheitssystem sucht man auch im Ausland vergeblich, aber ein Trend geht zu einer stärkeren Steuerfinanzierung.
Die Finanzierung der Krankenversicherung über einkommensabhängige Beiträge steht nicht nur in Deutschland unter Druck. Das zeigt ein Vergleich unter 16 europäischen Ländern, die der Frankfurter Professor für Sozialpolitik Diether Döring und Gutachter der Hessen Agentur im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung jetzt analysiert haben. Ein Patentrezept fürs Gesundheitssystem sucht man auch im Ausland vergeblich, aber ein Trend geht zu einer stärkeren Steuerfinanzierung.
Das alte Europa der EU-15 ist zweigeteilt: In acht Staaten, darunter in Deutschland, finanziert sich die Krankenversicherung über Beiträge, die auf das Arbeitseinkommen fällig werden. In sieben Ländern werden Ärzte, Medikamente und Kliniken dagegen aus dem allgemeinen Steuertopf bezahlt. Neben Großbritannien und Irland sind das die nordischen Staaten Dänemark, Finnland, Schweden sowie Spanien und Portugal. Ausreißer in Europa in der Krankenkassenfinanzierung ist die Schweiz.
Seit 1996 zahlen die Eidgenossen Kopfpauschalen, unabhängig von Einkommen, Geschlecht und Alter. Lediglich für Kinder und Jugendliche gibt es Ermäßigungen. Zufrieden sind die Eidgenossen mit ihrem System jedoch nicht. Die Gesundheitsausgaben, seit langem die höchsten in Europa, sind nicht gesunken, der Trend nach oben habe sich seit Einführung der Kopfpauschale eher beschleunigt, stellen die Forscher fest. Die durchschnittliche Pauschalprämie ist dementsprechend drastisch gestiegen - von 173 Schweizer Franken im Jahr 1996 auf 280 Franken 2004. Ein knappes Drittel der Schweizer erhält staatliche Subventionen, weil sie sonst mehr als zehn Prozent ihres Einkommens für die Krankenversicherung ausgeben müssten. Generell müssen die Versicherten bei den Krankheitskosten überdies einen Selbstbehalt von 300 Franken im Jahr tragen. Die Konsequenz ist Unzufriedenheit. Die Beitragsentwicklung "in Verbindung mit steigenden privaten Zuzahlungen hat die Akzeptanz dieses Finanzierungssystems sinken lassen", analysieren die Wissenschaftler.
Aber auch in anderen EU-Ländern zeigen sich zunehmende größere Probleme der Finanzierung des Gesundheitswesens, ohne dass irgendwo eine Patentlösung in Sicht wäre. Großen Lösungen im Sinne eines kompletten Systemwechsels geben die Forscher kaum Chancen. Das liegt nicht nur daran, dass Institutionen und Sozialrecht in jedem Land auf das seit Jahrzehnten existierende System zugeschnitten sind. Die möglichen Alternativen haben selber ihre Schwachstellen:
• In Ländern mit Kopfpauschalen steigen die Gesundheitsausgaben wie in der Schweiz besonders stark. Außerdem belastet das Schweizer Modell nach Erkenntnis der Forscher insbesondere Familien mit mittlerem Einkommen und ältere Menschen überproportional.
• Aus Steuern finanzierte Gesundheitssysteme weisen wiederum zwar oft relativ niedrige Gesundheitsausgaben auf, weil der Staat als Financier die Aufwendungen direkt lenken kann. Doch was in den Haushaltsbilanzen gut aussieht, führt in Praxen und Kliniken nicht selten zum Behandlungsstau. So müssen Patientinnen und Patienten etwa in Großbritannien, Irland und Spanien nach wie vor lange auf Operationen oder sogar auf manche Untersuchungen warten.
• Realistischer sind nach Analyse der Frankfurter Forscher deshalb Kombinationslösungen, bei denen künftig ein höherer Anteil aus Steuermitteln in die Finanzierung fließt. Einige dieser Länder sind auf dem Weg zu einer Mischfinanzierung auch schon weit fortgeschritten, wie in Luxemburg, Österreich, Belgien oder Griechenland.
Auf der Website der Hans-Böckler-Stiftung ist das komplette Gutachten (116 Seiten) als PDF-Datei verfügbar: Europäische Gesundheitssysteme unter Globalisierungsdruck. Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, Wiesbaden 2005, Hessen Agentur Report Nr. 689
Gerd Marstedt, 2.12.2005
Deutsches Gesundheitssystem: Positive Patienten-Noten, aber auch mit Reformbedarf
 "Deutschland hat im internationalen Vergleich die kürzesten Wartezeiten, Laborbefunde sind verlässlicher und liegen schneller vor, Patienten haben mehr Möglichkeiten bei der Arztwahl, bekommen im Krankenhaus seltener eine Infektion und wer chronisch krank ist, wird häufiger und regelmäßiger präventiv untersucht. Dennoch sind Deutsche mit ihrem Gesundheitswesen weitaus unzufriedener als Patienten in anderen Ländern." Dies ist das Fazit eines jetzt vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) vorlegten Berichts zu einer Umfrage in Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, den USA und Deutschland. Schwachstellen zeigt das deutsche Versorgungssystem laut Studie bei der Patienteninformation und bei der Koordination zwischen Leistungsebenen.
"Deutschland hat im internationalen Vergleich die kürzesten Wartezeiten, Laborbefunde sind verlässlicher und liegen schneller vor, Patienten haben mehr Möglichkeiten bei der Arztwahl, bekommen im Krankenhaus seltener eine Infektion und wer chronisch krank ist, wird häufiger und regelmäßiger präventiv untersucht. Dennoch sind Deutsche mit ihrem Gesundheitswesen weitaus unzufriedener als Patienten in anderen Ländern." Dies ist das Fazit eines jetzt vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) vorlegten Berichts zu einer Umfrage in Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, den USA und Deutschland. Schwachstellen zeigt das deutsche Versorgungssystem laut Studie bei der Patienteninformation und bei der Koordination zwischen Leistungsebenen.
In der vom vom Commonwealth Fund (CWF) seit 1999 durchgeführten Erhebung zur Qualität der Versorgung beteiligte sich jetzt erstmals auch die Bundesrepublik. Besonderheit der Studie ist, dass kein repräsentativer Bevölkerungsdurchschnitt befragt wurde, sondern eine Stichprobe aus Patienten, bei denen besonders aktuelle und intensive Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung vorliegen: Erwachsene, die das 18. Lebensjahr vollendet hatten und die angaben, einen schlechten Gesundheitszustand zu haben, an einer chronischen Erkrankung oder Behinderung zu leiden oder in den letzten 2 Jahren stationär behandelt worden zu sein bzw. sich einer schweren Operation unterzogen zu haben. In Deutschland beantworteten 1.474 Männer und Frauen am Telefon durchschnittlich 55 Fragen. Ungewöhnlich war die hohe Teilnahmebereitschaft an der Umfrage.
Einige zentrale Ergebnisse:
• Fast jeder dritte Befragte in Deutschland ist der Meinung, dass das Gesundheitssystem so schlecht ist, dass es von Grund auf umgestaltet werden sollte. Dies ist etwa so häufig wie in den USA und Australien, aber höher als in Neuseeland, Kanada und Großbritannien.
• Deutsche Patienten haben die kürzesten Wartezeiten sowohl in der Allgemein- als auch in der Facharztpraxis und warten kürzer auf geplante Operationen und Behandlungen im Notfall.
• Deutsche werden bei Klinikaufenthalten weniger vollständig über die Risiken informiert und sagen öfter, dass ihr Hausarzt sie selten oder nie über mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten aufklärt.
• Die Versorgung bei der Entlassung aus dem Krankenhaus ist weniger gut organisiert als in den anderen Ländern, deutsche Patienten erhalten seltener Nachsorgetermine.
• Deutsche Ärzte informieren ihre Patienten seltener über Behandlungsfehler: Wenn im Verlauf einer Behandlung Fehler auftreten, wird dies seltener mitgeteilt.
• Privat versicherte Patienten gehen im Vergleich zu GKV-Mitgliedern häufiger zum Facharzt, werden öfter stationär behandelt und operiert. Sie berichten auch häufiger über unnötige Doppeluntersuchungen und geben kürzere Wartezeiten an.
Dass deutsche Patienten ihrem Gesundheitswesen in vielen Aspekten eine hohe Qualität bescheinigen, andererseits grundlegende Reformen für nötig halten, sei paradox, kommentierte IQWiG-Chef Peter Sawicki ein Ergebnis der Studie: "Wir fahren Mercedes, glauben aber, einen reparaturbedürftigen Golf zu steuern".
Zur Studie präsentiert das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) einige Materialien, unter anderem:
• Aufsatz von Peter Sawicki: Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland
• Ferner ist auf der Seite des Commonwealth Fund eine Zusammenfassung der Ergebnisse verfügbar
• sowie auch ein Tabellenband mit einem Ländervergleich für alle Fragen
Gerd Marstedt, 10.11.2005
Deutsches Gesundheitssystem: Positive Patienten-Noten, aber auch mit Reformbedarf
 "Deutschland hat im internationalen Vergleich die kürzesten Wartezeiten, Laborbefunde sind verlässlicher und liegen schneller vor, Patienten haben mehr Möglichkeiten bei der Arztwahl, bekommen im Krankenhaus seltener eine Infektion und wer chronisch krank ist, wird häufiger und regelmäßiger präventiv untersucht. Dennoch sind Deutsche mit ihrem Gesundheitswesen weitaus unzufriedener als Patienten in anderen Ländern." Dies ist das Fazit eines jetzt vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) vorlegten Berichts zu einer Umfrage in Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, den USA und Deutschland. Schwachstellen zeigt das deutsche Versorgungssystem laut Studie bei der Patienteninformation und bei der Koordination zwischen Leistungsebenen.
"Deutschland hat im internationalen Vergleich die kürzesten Wartezeiten, Laborbefunde sind verlässlicher und liegen schneller vor, Patienten haben mehr Möglichkeiten bei der Arztwahl, bekommen im Krankenhaus seltener eine Infektion und wer chronisch krank ist, wird häufiger und regelmäßiger präventiv untersucht. Dennoch sind Deutsche mit ihrem Gesundheitswesen weitaus unzufriedener als Patienten in anderen Ländern." Dies ist das Fazit eines jetzt vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) vorlegten Berichts zu einer Umfrage in Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, den USA und Deutschland. Schwachstellen zeigt das deutsche Versorgungssystem laut Studie bei der Patienteninformation und bei der Koordination zwischen Leistungsebenen.
In der vom vom Commonwealth Fund (CWF) seit 1999 durchgeführten Erhebung zur Qualität der Versorgung beteiligte sich jetzt erstmals auch die Bundesrepublik. Besonderheit der Studie ist, dass kein repräsentativer Bevölkerungsdurchschnitt befragt wurde, sondern eine Stichprobe aus Patienten, bei denen besonders aktuelle und intensive Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung vorliegen: Erwachsene, die das 18. Lebensjahr vollendet hatten und die angaben, einen
schlechten Gesundheitszustand zu haben, an einer chronischen Erkrankung oder Behinderung zu leiden oder in den letzten 2 Jahren stationär behandelt worden zu sein bzw. sich einer schweren Operation unterzogen zu haben. In Deutschland beantworteten 1.474 Männer und Frauen am Telefon durchschnittlich 55 Fragen. Ungewöhnlich war die hohe Teilnahmebereitschaft an der Umfrage.
Einige zentrale Ergebnisse:
• Fast jeder dritte Befragte in Deutschland ist der Meinung, dass das Gesundheitssystem so schlecht ist, dass es von Grund auf umgestaltet werden sollte. Dies ist etwa so häufig wie in den USA und Australien, aber höher als in Neuseeland, Kanada und Großbritannien.
• Deutsche Patienten haben die kürzesten Wartezeiten sowohl in der Allgemein- als auch in der Facharztpraxis und warten kürzer auf geplante Operationen und Behandlungen im Notfall.
• Deutsche werden bei Klinikaufenthalten weniger vollständig über die Risiken informiert und sagen öfter, dass ihr Hausarzt sie selten oder nie über mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten aufklärt.
• Die Versorgung bei der Entlassung aus dem Krankenhaus ist weniger gut organisiert als in den anderen Ländern, deutsche Patienten erhalten seltener Nachsorgetermine.
• Deutsche Ärzte informieren ihre Patienten seltener über Behandlungsfehler: Wenn im Verlauf einer Behandlung Fehler auftreten, wird dies seltener mitgeteilt.
• Privat versicherte Patienten gehen im Vergleich zu GKV-Mitgliedern häufiger zum Facharzt, werden öfter stationär behandelt und operiert. Sie berichten auch häufiger über unnötige Doppeluntersuchungen und geben kürzere Wartezeiten an.
Dass deutsche Patienten ihrem Gesundheitswesen in vielen Aspekten eine hohe Qualität bescheinigen, andererseits grundlegende Reformen für nötig halten, sei paradox, kommentierte IQWiG-Chef Peter Sawicki ein Ergebnis der Studie: "Wir fahren Mercedes, glauben aber, einen reparaturbedürftigen Golf zu steuern".
Zur Studie präsentiert das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) einige Materialien, unter anderem:
• Aufsatz von Peter Sawicki: Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland
• Ferner ist auf der Seite des Commonwealth Fund eine Zusammenfassung der Ergebnisse verfügbar
• sowie auch ein Tabellenband mit einem Ländervergleich für alle Fragen
Gerd Marstedt, 10.11.2005
Vergleich der Gesundheits- und Pflegeversorgung älterer Menschen in 19 OECD-Ländern
 Wer für die in Deutschland bevorstehende Debatte über die Zukunft der Pflegeversicherung oder die Möglichkeiten der Gesundheits- und Pflegeversorgung für ältere Menschen nach einer seriösen Quelle für systematische und empirische Argumente aus anderen Ländern sucht, dem sei ein im Juli erschienener OECD-Bericht empfohlen. Auf 138 Seiten werden beispielsweise die Nachfrage nach Pflegeangeboten, die Lösungsversuche, die Finanzierung, die Modelle integrierter Versorgung und die damit gemachten Erfahrungen sowie die Qualitätssicherung von Pflege in 19 OECD-Ländern (darunter z.B. Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, USA und auch Deutschland) dargestellt. Zu den gut dokumentierten Fragen gehört z.B. die für die betroffenen Personen wie die Öffentlichkeit wichtige Frage, was getan wird, damit möglichst viele Menschen im Alter zu Hause leben können.
Wer für die in Deutschland bevorstehende Debatte über die Zukunft der Pflegeversicherung oder die Möglichkeiten der Gesundheits- und Pflegeversorgung für ältere Menschen nach einer seriösen Quelle für systematische und empirische Argumente aus anderen Ländern sucht, dem sei ein im Juli erschienener OECD-Bericht empfohlen. Auf 138 Seiten werden beispielsweise die Nachfrage nach Pflegeangeboten, die Lösungsversuche, die Finanzierung, die Modelle integrierter Versorgung und die damit gemachten Erfahrungen sowie die Qualitätssicherung von Pflege in 19 OECD-Ländern (darunter z.B. Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, USA und auch Deutschland) dargestellt. Zu den gut dokumentierten Fragen gehört z.B. die für die betroffenen Personen wie die Öffentlichkeit wichtige Frage, was getan wird, damit möglichst viele Menschen im Alter zu Hause leben können.
Hier finden Sie die kostenlose so genannte "browse_it"-PDF-Version: des OECD-Berichts "Long-term Care for older people"
Bernard Braun, 19.9.2005
Deutsches Gesundheitssystem jetzt auf Platz 1
 Im Jahre 2000 rangierte das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich nur auf Platz 25. Die zugrunde liegende Studie der WHO "The world health report 2000 - Health systems: improving performance" wurde jedoch von vielen Wissenschaftlern wegen methodischer und inhaltlicher Defizite heftig kritisiert, zuletzt distanzierte sich die WHO von den Bewertung. Unlängst nun erreichte das deutsche Gesundheitssystem in einer Untersuchung in 12 europäischen Ländern den 3.Platz. Ganz oben stehen dort die Niederlande, gefolgt von der Schweiz. Dieser verbraucherorientierte Euro Health Consumer Index wurde von dem in Brüssel ansässigen Think-Tank "Health Consumer Powerhouse" sowohl aus öffentlich zugänglichen Statistiken wie aus einer Bilanzierung von unabhängigen Forschungsarbeiten zusammengestellt. Er besteht aus insgesamt 20 Indikatoren (z.B. Anbieterkatalog mit Qualitätseinstufung, Direkter Zugang zu Facharzt-Behandlung, Wartezeit bis zur Behandlung, Therapiergebnisse, Kundenfreundlichkeit.)
Im Jahre 2000 rangierte das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich nur auf Platz 25. Die zugrunde liegende Studie der WHO "The world health report 2000 - Health systems: improving performance" wurde jedoch von vielen Wissenschaftlern wegen methodischer und inhaltlicher Defizite heftig kritisiert, zuletzt distanzierte sich die WHO von den Bewertung. Unlängst nun erreichte das deutsche Gesundheitssystem in einer Untersuchung in 12 europäischen Ländern den 3.Platz. Ganz oben stehen dort die Niederlande, gefolgt von der Schweiz. Dieser verbraucherorientierte Euro Health Consumer Index wurde von dem in Brüssel ansässigen Think-Tank "Health Consumer Powerhouse" sowohl aus öffentlich zugänglichen Statistiken wie aus einer Bilanzierung von unabhängigen Forschungsarbeiten zusammengestellt. Er besteht aus insgesamt 20 Indikatoren (z.B. Anbieterkatalog mit Qualitätseinstufung, Direkter Zugang zu Facharzt-Behandlung, Wartezeit bis zur Behandlung, Therapiergebnisse, Kundenfreundlichkeit.)
In einer neueren (deutschen) Studie, die vom Kieler Forschungsinstitut IGSF (Fritz Beske) erstellt und heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, landet das deutsache Gesundheitssystem nun auf Platz 1 von insgesamt 14 untersuchten Industrieländern. "Deutschland hat im internationalen Vergleich nachweislich ein umfassendes, ein preiswertes und damit ein überdurchschnittlich effizientes Gesundheitswesen", erklärte Prof. Fritz Beske, Leiter des Kieler Instituts für Gesundheits-System-Forschung bei der Vorstellung des 479-seitigen Gutachtens mit dem Titel "Leistungskatalog des Gesundheitswesens im internationalen Vergleich".
Neben den Sachleistungen des Medizinbetriebs wurde auch Geldleistungen (zum Beispiel Lohnfortzahlung und Krankengeld) sowie die Leistungen der Pflegeversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung in das Gutachten einbezogen. Bei den Gesundheitsleistungen erreicht Deutschland mit einem Versorgungsindex von 119 den besten Wert aller miteinander verglichenen Länder, weit hinten liegen Großbritannien, Australien und die USA auf den letzten Plätzen. Das hohe deutsche Versorgungsniveau resultiert aus der hohen Dichte an Haus-, Fach- und Zahnärzten sowie der Krankenhauskapazität. Als Folge davon kennt Deutschland im Unterschied zu anderen Ländern kaum Wartezeiten.
AOK-Chef Hans-Jürgen Ahrens beurteilte die herangezogenen Strukturdaten skeptisch: Die landesweite Arztdichte besage nichts über die Versorgung vor Ort und die Zahl der Klinikbetten wenig über die Qualität der Versorgung. Das Gutachten (479 Seiten) ist gegen eine Schutzgebühr von 15 Euro vom IGSF zu beziehen.
Hier sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie in einer Pressemitteilung des IGSF
Gerd Marstedt, 1.9.2005
Deutsches Gesundheitssystem in Europa auf Platz 3
 In einer Untersuchung in 12 europäischen Ländern belegt das deutsche Gesundheitswesen aus der Perspektive der Verbraucher den 3.Platz. Ganz oben stehen die Niederlande, gefolgt von der Schweiz. Länder wie Frankreich und Schweden, die früher dauerhaft Spitzenpositionen innehatten und im internationalen Vergleich oft gelobt wurden, waren nur im Mittelfeld zu finden, als der neue EuroHealth Consumer Index (EHCI) 2005 vorgestellt wurde. Deutschland erreichte 46 von 60 möglichen Punkten. Bestnoten gab es in den Bereichen Gesetze über Patientenrechte, direkter Zugang zu fachärztlicher Betreuung, Zugang zu den eigenen medizinischen Unterlagen, Einhaltung der Wartezeitanforderungen bei drei von vier aufgelisteten Behandlungen, gute Versorgung von Herzinfarktpatienten und benutzerfreundliche Zahlungsmöglichkeiten. Schwachstellen sind laut Index der Anbieterkatalog mit qualitativer Bewertung und die Wartezeiten für eine Herz-/Bypass-Operation. Kritik gab es vor allem an unzureichenden Informationsmöglichkeiten für Patienten: "Eine größere Öffnung für Informationen würde das deutsche System hervorragend machen. Heute ist der Verbraucher weitgehend von seinem Arzt abhängig."
In einer Untersuchung in 12 europäischen Ländern belegt das deutsche Gesundheitswesen aus der Perspektive der Verbraucher den 3.Platz. Ganz oben stehen die Niederlande, gefolgt von der Schweiz. Länder wie Frankreich und Schweden, die früher dauerhaft Spitzenpositionen innehatten und im internationalen Vergleich oft gelobt wurden, waren nur im Mittelfeld zu finden, als der neue EuroHealth Consumer Index (EHCI) 2005 vorgestellt wurde. Deutschland erreichte 46 von 60 möglichen Punkten. Bestnoten gab es in den Bereichen Gesetze über Patientenrechte, direkter Zugang zu fachärztlicher Betreuung, Zugang zu den eigenen medizinischen Unterlagen, Einhaltung der Wartezeitanforderungen bei drei von vier aufgelisteten Behandlungen, gute Versorgung von Herzinfarktpatienten und benutzerfreundliche Zahlungsmöglichkeiten. Schwachstellen sind laut Index der Anbieterkatalog mit qualitativer Bewertung und die Wartezeiten für eine Herz-/Bypass-Operation. Kritik gab es vor allem an unzureichenden Informationsmöglichkeiten für Patienten: "Eine größere Öffnung für Informationen würde das deutsche System hervorragend machen. Heute ist der Verbraucher weitgehend von seinem Arzt abhängig."
Der verbraucherorientierte Euro Health Consumer Index wird von dem in Brüssel ansässigen Think-Tank "Health Consumer Powerhouse" sowohl aus öffentlich zugänglichen Statistiken wie aus einer Bilanzierung von unabhängigen Forschungsarbeiten zusammengestellt. Er besteht aus insgesamt 20 Indikatoren (z.B. Anbieterkatalog mit Qualitätseinstufung, Direkter Zugang zu Facharzt-Behandlung, Wartezeit bis zur Behandlung, Therapiergebnisse, Kundenfreundlichkeit.) Auf der Website werden Pressemitteilungen, Kurzfassungen und ausführlicher Bericht (27 Seiten) als zum Download angeboten.
Download PDF-Datei (auf deutsch) des EuroHealth Consumer Index 2005
Gerd Marstedt, 14.8.2005