



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Gesundheitssystem"
Demografie, Krankheitslast |
Alle Artikel aus:
Gesundheitssystem
Demografie, Krankheitslast
Alterung der Bevölkerung ein Treibsatz für starkes Wachstum der Gesundheitsausgaben? Nein sagt ein WHO-Report und zwar bis 2060!
 Zu den gewichtigsten Ursachen einer scheinbar nicht vermeidbaren Explosion der Gesundheitsausgaben in den jeweils nächsten Jahrzehnten gehört die Kombination der zunehmenden Anzahl älterer Einwohner mit deren steigenden Lebenserwartung.
Zu den gewichtigsten Ursachen einer scheinbar nicht vermeidbaren Explosion der Gesundheitsausgaben in den jeweils nächsten Jahrzehnten gehört die Kombination der zunehmenden Anzahl älterer Einwohner mit deren steigenden Lebenserwartung.
Zahlreiche auch in diesem Forum vorgestellte Studien haben nachgewiesen, dass es sich dabei um einen der hartnäckigsten Mythen oder Irrtümer der Gesundheitspolitik handelt.
Mythentypisch ist zunächst, dass eine Tatsache, nämlich die in der Regel höheren Gesundheitsausgaben älterer Personen, am Anfang der Argumentationskette steht. Wie hoch der Tatsachengehalt der sich darauf aufbauenden dramatischen Prognosen aber dann ist, hat nun eine Gruppe von europäischen und japanischen Gesundheitsökonomen und GesundheitspolitikforscherInnen für den Zeitraum 2020 bis 2060 für die EU, Japan und Indonesien etwas genauer untersucht.
Zu unterscheiden sind zwei Grundannahmen und Projektionen:
• Unter der Annahme, dass sich die Prokopf-Gesundheitsausgaben junger und älterer Personen nicht verändern und damit auch das Verhältnis der Ausgaben beider Personengruppen, erhöht sich der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der EU um 1,3 Prozentpunkte und in Japan um 1,8 Prozentpunkte - gestreckt über 40 Jahre! Das sind in der EU 0,03 Prozentpunkte Zunahme pro Jahr! Für das in der Studie mituntersuchte Indonesien, das sicherlich gegenüber Japan und der EU einen enormen Nachholbedarf bei den Gesundheitsaufwendungen hat, berechnen die AutorInnen einen jährlichen Zuwachs um 0,08 Prozentpunkte.
• In einem zweiten Schritt untersuchen die WissenschaftlerInnen wie die Gesundheitsausgaben wachsen, wenn die gesundheitliche Versorgung der älteren Personen im Untersuchungsraum kostspieliger wird als heute. Sie machen dies durch vier einzelne Szenarien in denen ein kräftiges Wachstum des Versorgungsvolumens, der Preise und Intensität der für ältere Personen konzipierten Behandlung und eine Veränderung der Finanzierungsstrukturen und des Angebotssystems für Ältere angenommen wird. In einem "extremen" Szenario wird angenommen, dass die Effekte aller vier Szenarien auftreten. Der Zuwachs des Anteils der Gesundheitsausgaben für ältere Personen am BIP von 2020 bis 2060 beträgt dann bei dem extremen Szenario in der EU 2,2 Prozentpunkte oder 0,06 Prozentpunkte pro Jahr. Der Unterschied zwischen dem Zuwachs des Anteils der Gesundheitsausgaben für Ältere am BIP im extremen Szenario und dem Anteil bei einer Entwicklung mit der Dynamik des Status quo beträgt 2060 ungerundet 0,85 Prozentpunkte. Nimmt man realistischerweise an, dass nicht alle Annahmen der vier Szenarien wirklich eintreten, verringert sich der relativ geringe Unterschied noch.
• Zusätzlich weisen die Autoren darauf hin, dass es eine Reihe von bekannten und zum Teil sogar erprobten und evaluierten versorgungsbezogenen Strukturveränderungen gibt, die sich insbesondere bei der Behandlung von Älteren kostendämpfend und positiv auf deren Lebensqualität auswirken. Dies ist z.B. die Verlagerung der "end-of-life-care" von den relativ teureren Krankenhäusern in spezielle Palliativeinrichtungen oder ins häusliche Umfeld oder der Auf- und Ausbau von gesundheitliche und soziale Leistungen integrierenden Einrichtungen nach dem Modell des niederländischen "care in the neighbourhood"-Programms.
• Für die Autoren steht damit fest: "Our analysis suggests that population ageing on its own is not, and will not become, a major driver of growth in health expenditure. Rather, other determinants of the growth in spending such as prices, technologies, and the ways in which health services are organized, provided and paid for are more important."
Was wie bei vielen anderen Studien über altersassoziierte Veränderungen der Gesundheitsausgaben für Ältere über lange Zeiträume auch bei dieser Studie problematisch ist, ist das rigide ceteris paribus-Design, das sich nicht um mögliche Veränderungen z.B. des BIP oder anderer möglicher Einflussfaktoren kümmert. Die mythenangereicherte Debatte über die ökonomischen Folgen des Alterns dürfte daher noch lange nicht beendet sein.
Die im "WHO Centre for Health Development" im japanischen Kobe für die Reihe "The economics of healthy and active ageing series" des "European Observatory on Health Systems and Policies" der WHO erstellte 22-seitige Studie Sustainable health financing with an ageing population: will population ageing lead to uncontrolled health expenditure growth? von Gemma A Williams, Jonathan Cylus, Tomáš Roubal, Paul Ong und Sarah Barber ist im Oktober 2019 erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.10.19
Risiko an Demenz zu erkranken stagniert oder nimmt ab, nicht signifikant. Resultat eines systematischen Reviews samt Meta-Analyse
 Über eine Reihe von methodisch hochwertigen Studien zum individuellen Risiko an Demenz zu erkranken, die meist das Erkrankungsrisiko in zwei weit auseinanderliegenden Kohorten verglichen, ist im "forum-gesundheitspolitik" schon mehrfach berichtet worden (zu finden mit dem Suchwort "Demenz"). Fast jede dieser Studie fand, dass das Erkrankungsrisiko (Inzidenz) entgegen vieler alarmistischer Szenarien mehr oder weniger stark abgenommen hat und diese Szenarien auf der ausschließlichen Betrachtung der Prävalenz beruhten. Deren Zunahme beruht danach ausschließlich auf der Zunahme des Anteils älterer Personen, die vor allem von Demenz betroffen sind.
Über eine Reihe von methodisch hochwertigen Studien zum individuellen Risiko an Demenz zu erkranken, die meist das Erkrankungsrisiko in zwei weit auseinanderliegenden Kohorten verglichen, ist im "forum-gesundheitspolitik" schon mehrfach berichtet worden (zu finden mit dem Suchwort "Demenz"). Fast jede dieser Studie fand, dass das Erkrankungsrisiko (Inzidenz) entgegen vieler alarmistischer Szenarien mehr oder weniger stark abgenommen hat und diese Szenarien auf der ausschließlichen Betrachtung der Prävalenz beruhten. Deren Zunahme beruht danach ausschließlich auf der Zunahme des Anteils älterer Personen, die vor allem von Demenz betroffen sind.
Ein im Oktober 2018 veröffentlichter systematischer Review von Leipziger und Nordhausener WissenschaftlerInnen betrachtete nun sieben dieser Studien mit 42.485 TeilnehmerInnen aus entwickelten Ländern ("high-income countries") zusammen. Mit fünf dieser Studien wurde eine Metaanalyse durchgeführt werden.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
— Die meisten Studien liefern trotz aller Heterogenität "evidence of favorable trends in dementia incidence", d.h. Hinweise darauf, dass sich das Risiko stabilisiert oder sogar abnimmt.
— Dies gilt ausdrücklich nur für entwickelte Länder und auch nicht für jedes. Wie eine der untersuchten Studien zeigt, nimmt nämlich das Demenzrisiko in Japan zu. Offensichtlich spielen also unterschiedliche soziale, kulturelle oder umweltliche Bedingungen eine in weiteren Studien noch genauer zu untersuchende Rolle.
— Einschränkend weisen die AutorInnen aber darauf hin, dass die Abnahme des Demenzrisikos bei Einschluss der Studie über Japan statistisch nicht signifikant ist (Incidence Change/IC=0,82; 95% CI 0,51-1,33) und auch ohne die Ergebnisse aus Japan lediglich eine "borderline evidence for a decrease" (IC=0,69; 95% CI 0,47-1,00) existiert.
Die Schlussfolgerungen der AutorInnen lauten daher, es bedürfe weiterer Studien aus entwickelten Ländern aber auch weniger entwickelten Ländern. Zumindest für mitteleuropäische oder nordamerikanische Länder ist aber auszuschließen, dass dabei gewaltige Zunahmen des Demenzrisikos entdeckt werden.
Die Studie Is dementia incidence declining in high-income countries? A systematic review and meta-analysis von S. Roehr, A. Pabst, T. Luck und S. Riedel-Heller ist in der Zeitschrift "Clinical Epidemiology" (10: 1233-1247) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.11.18
Von den Grenzen der Vererblichkeit langen Lebens
 Angesichts der in hoch entwickelten Ländern seit Jahrzehnten stetig steigenden Lebenserwartung stellt sich auch die Frage nach den Triebkräften dieses Prozesses. Nicht erst seitdem Gene durch die immer größere Transparenz über ihre Strukturen für immer mehr erwünschte und unerwünschte Erscheinungen und Ereignisse im menschlichen Leben verantwortlich gemacht werden, ja, diese zu determinieren scheinen, gelten 15 bis 30% der Lebenserwartung als genetisch, d.h. letztlich unbeeinflussbar bestimmt.
Angesichts der in hoch entwickelten Ländern seit Jahrzehnten stetig steigenden Lebenserwartung stellt sich auch die Frage nach den Triebkräften dieses Prozesses. Nicht erst seitdem Gene durch die immer größere Transparenz über ihre Strukturen für immer mehr erwünschte und unerwünschte Erscheinungen und Ereignisse im menschlichen Leben verantwortlich gemacht werden, ja, diese zu determinieren scheinen, gelten 15 bis 30% der Lebenserwartung als genetisch, d.h. letztlich unbeeinflussbar bestimmt.
Ob dies zutrifft und damit der Einfluss einer Vielzahl von natürlichen oder sozialen und damit in einem gewissen Maß beeinflussbaren Faktoren entsprechend begrenzt ist, ist nicht einfach zu untersuchen.
Ein im November 2018 in der Zeitschrift "Genetics" der us-amerikanischen Fachgesellschaft "Genetics Society of America" erschienener Aufsatz fasst nun die Ergebnisse einer quantitativ enorm großen und methodisch aufwändigen Untersuchung des Einflusses von Genen auf die Lebenserwartung der Angehörigen von 54 Millionen von Familienstammbäumen ("family trees") in den Geburtsjahrgangs-Kohorten zwischen 1800 und 1920 zusammen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil der genetischen Erblichkeit an der Lebenserwartung unter 10%, wenn nicht sogar unter 7% liegt ("well below 10%").
Dieser deutlich niedrigere Einfluss beruht vor allem auf einer Korrektur der möglichen Effekte von "assortative mating". Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig davon, ob genetische oder soziokulturelle Faktoren die spätere Lebenserwartung beeinflussen, oft Individuen zusammenfinden und Kinder bekommen, die sich in bestimmten Merkmalen wie z.B. dem Einkommen, dem Rauchverhalten oder der Körpergröße besonders ähnlich sind.
Auch wenn in der Studie nicht genauer auf den Einfluss von sozialen, kulturellen oder Umweltfaktoren eingegangen wird, liegt nahe, dass dieser bei dem geringeren Einfluss der Erblichkeit größer ist als bisher angenommen.
Die Studie Estimates of the Heritability of Human Longevity Are Substantially Inflated due to Assortative Mating von G. Ruby, K. Wright et al. ist im Novemberheft der Zeitschrift "Genetics" (210 (3): 1109-1124) veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.11.18
Häufigkeit unerwünschter Behandlungsereignisse sinkt - mindestens in Großbritannien
 Es gibt Hinweise, dass manche bedrohliche wirkende Entwicklung der Häufigkeit von Erkrankungen nicht auf einer tatsächlich größeren Häufigkeit beruht, sondern z.B. Effekt der Zunahme von Gesundheitssendungen oder Rubriken und der ausführlicheren Berichterstattung sind oder darauf beruhen, dass die Scham oder Rücksichtnahme bestimmte Erkrankungen (z.B. psychische Erkrankungen) nicht als solche zu diagnostizieren oder zu berichten, geschwunden ist. Daher sollte vor jedem Alarmismus der mögliche Einfluss dieser und weiterer Determinanten geprüft werden.
Es gibt Hinweise, dass manche bedrohliche wirkende Entwicklung der Häufigkeit von Erkrankungen nicht auf einer tatsächlich größeren Häufigkeit beruht, sondern z.B. Effekt der Zunahme von Gesundheitssendungen oder Rubriken und der ausführlicheren Berichterstattung sind oder darauf beruhen, dass die Scham oder Rücksichtnahme bestimmte Erkrankungen (z.B. psychische Erkrankungen) nicht als solche zu diagnostizieren oder zu berichten, geschwunden ist. Daher sollte vor jedem Alarmismus der mögliche Einfluss dieser und weiterer Determinanten geprüft werden.
Dass dies möglicherweise auch für andere unerwünschte gesundheits- oder behandlungsbezogene Ereignisse gilt, zeigt eine Studie, die mit Daten zweier inhaltlich identischer Befragungen in Großbritannien aus den Jahren 2001 (n=8.202) und 2013 (n=19.746), untersucht, ob sich die Häufigkeit unerwünschter Behandlungsereignisse (z.B. Verletzungen, schwere Infektionen) verändert hat. Auch hier erweckt die öffentliche Berichterstattung den Eindruck, diese Art der Ereignisse nähme zu.
Der Vergleich bringt aber folgendes zutage:
— Die Häufigkeit unerwünschter Behandlungsverläufe oder -Ereignisse in den 3 Jahren vor der Befragung fiel in den 12 Jahren signifikant von 4,8% auf 2,5%. Nach umfangreichen Adjustierungen nach Alter etc. betrug die Abnahme 33%.
— Die wahrgenommene Ernsthaftigkeit der Ereignisse hat sich zwischen beiden Befragungszeitpunkten nicht wesentlich verändert.
— Ebenfalls kaum verändert hat sich die Häufigkeit des Versuchs eine Entschädigung zu erhalten.
Bei allen von den AutorInnen selbst angesprochenen Einschränkungen (z.B. fehlen unerwünschte Ereignisse, die der Patient nicht merkt, ebenso wie "Beinahe-Ereignisse") halten die AutorInnen ihren Indikator für geeignet etwas über die Versorgungsqualität auszusagen. Die in Großbritannien mit der Kontrolle der Behandlungsqualität beauftragte Kommission betrachtet die Ergebnisse als Ausdruck ihrer Wirksamkeit, weist aber auch darauf hin, dass der Anteil von 2,5% derartiger Ereignisse an allen Behandlungsfällen immer noch zu hoch ist.
Ob dies auch für das deutsche Gesundheitswesen gilt, bliebe zu untersuchen.
Die Studie Changing experience of adverse medical events in the National Health Service: Comparison of two population surveys in 2001 and 2013 von Alastair M. Gray et al. ist 2017 in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" (2017; 195: 83-89) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.12.17
Wie verlässlich oder reliabel sind allgemeinärztliche ICD-10-Diagnosen - und zwar auch ohne die GKV-Beihilfe beim Up-Coding?
 Das wenige Tage alte "Geständnis" des Vorstandsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse, andere Kassen aber wahrscheinlich auch seine eigene hätten ambulant tätige Ärzte zum Teil sogar in vertraglicher Form dazu "animiert", noch gründlicher über die Art der Erkrankung ihrer Patienten nachzudenken und deren Ernst durch eine schwerere bzw. im Rahmen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs besser für die Kasse wirtschaftlich günstigere Diagnose zum Ausdruck zu bringen, offenbarte, dass es sich bei der dabei genutzten "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems/Internationalen statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)" (aktuell 10. Revision) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) keineswegs um eine objektive, sondern um ein auch durch nicht gesundheitsbezogene Erwägungen beeinflussbares System handelt.
Das wenige Tage alte "Geständnis" des Vorstandsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse, andere Kassen aber wahrscheinlich auch seine eigene hätten ambulant tätige Ärzte zum Teil sogar in vertraglicher Form dazu "animiert", noch gründlicher über die Art der Erkrankung ihrer Patienten nachzudenken und deren Ernst durch eine schwerere bzw. im Rahmen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs besser für die Kasse wirtschaftlich günstigere Diagnose zum Ausdruck zu bringen, offenbarte, dass es sich bei der dabei genutzten "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems/Internationalen statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)" (aktuell 10. Revision) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) keineswegs um eine objektive, sondern um ein auch durch nicht gesundheitsbezogene Erwägungen beeinflussbares System handelt.
Wie stark durch dieses Up-Coding auch alle Statistiken über den Gesundheitszustand der Bevölkerung, die sich auf die ICD-Klassifikation stützen, verfälscht worden sind und werden, ist nicht zu quantifizieren, dass es einen "Morbi-RSA-Bias" gibt, ist aber sicher.
Im Zusammenhang mit ihrer aktuellen öffentlichen Präsenz sei aber daran erinnert, dass Morbiditätsdaten, die mit den ICD-10-Diagnosen gewonnen werden, auch ohne die Anstiftung zum Up-Coding wahrscheinlich verzerrt sind.
Dies zeigt eine m.W. nie wiederholte und bereits 2009 veröffentlichte Untersuchung der Reliabilität, also der Wiederholbarkeit gleicher Diagnosen bei gleichen Bedingungen durch eine oder verschiedene Personen.
Vorab zur Erinnerung: Die ICD-10-Klassifikation (die aktuelle Version für das Jahr 2016 findet man hier) erlaubt eine vorliegende gesundheitliche Störung als erstes in eine von 21 Hauptgruppen einzuordnen, die von bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten über Krankheiten des Kreislaufsystems bis zu Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen reichen. Diese Zuordnung kann noch weiter verfeinert werden. So erhält ein Patient, der an Cholera leidet den dreistelligen Code A00 und ein anderer, der eine sonstige Salmonelleninfektion hat den Code A02. Diese Codierung kann noch durch eine vierte Stelle präzisiert werden. Bei Patienten mit einer sonstigen Salmonelleninfektion kann dann z.B. zwischen einer Salmonellenenteritis (A02.0) oder Salmonellensepsis (A02.1), also zwei vom Schweregrad deutlich unterschiedlichen Zustände nach einer Salmonelleninfektion und weiteren Unterformen unterschieden werden. Bei einigen Obergruppen gibt es auch noch eine 5. Stelle zu Komplikationsgraden und eine nicht WHO-offizielle Zusatzinformation über die Validität der Diagnose (z.B. Verdachtsdiagnose).
Eine Forschergruppe an der Universität Leipzig hatte in Kooperation mit der Sächsischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin für 8.877 zufällig ausgewählte ambulant-allgemeinärztlich behandelte Patienten von 209 (von 2.510 angesprochenen in Sachsen praktizierenden Allgemeinärzten!!) in den Jahren 1999/2000 eine Fülle von diagnoserelevanten Daten zusammentragen lassen und auf dieser Basis zwei berufserfahrene Ärzte die vierstellige Hauptdiagnose nach ICD-10 vergeben lassen. Je mehr deren Diagnosen übereinstimmten desto besser ist die Reliabilität der ICD-10-Diagnostik. Der Grad der Übereinstimmung oder eben auch Nichtübereinstimmung (so genannte "inter-rater reliability") wurde mit dem bewährten statistischen Kappa-Maß bestimmt.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Bei Patienten mit neu zu behandelnden Krankheiten war die Übereinstimmung der Zuordnungen zu Hauptgruppen in 12 von 19 Hauptgruppen (63,16%) mit ausreichender Fallzahl zufriedenstellend. In anderen Worten stimmten die Bewerter z.B. mindestens darin überein, dass es sich um eine Krankheit der Hauptgruppe infektiöse oder parasitäre Krankheiten handelt und nicht um eine andere.
• Bei der Vergabe von drei- oder vierstelligen Diagnosen, also einer Verfeinerung der Diagnosen, war die Übereinstimmung zwischen den beiden diagnostizierenden Ärzten in keiner Hauptgruppe zufriedenstellend. Die Diagnosen unterschieden sich also mehr oder weniger beträchtlich. Bei allen dreistelligen Diagnosen war die Übereinstimmung bei 36,01% zufriedenstellend, bei allen vierstelligen Diagnosen traf dies nur noch für 11,85% zu.
• Bei Patienten, die wegen chronischen Krankheiten dauerhaft behandelt wurden, war die Kodier-Reliabilität in 14 der dabei ausreichend besetzten 20 Hauptgruppen (65%) zufriedenstellend. Bei fast 43% aller dreistelligen Diagnosen gab es hohe Übereinstimmung und bei 18,02% der vierstelligen.
Selbst wenn man die methodischen Einschränkungen dieser Studie berücksichtigt, waren die im allgemeinärztlichen Bereich vergebenen Diagnosen allerhöchstens auf dem Niveau der Hauptgruppen reliabel, nicht oder lediglich bei 10% bis rund 40% aber bei den drei- und vierstelligen Diagnosen.
Da die im Lichte dieser Verhältnisse geforderte Vereinfachung des ICD-Katalogs (dies forderte auch der Sachverständigenrat für Gesundheit in einem seiner Jahresgutachten für die Allgemeinmedizin) und die Vorgabe klarer Kodierleitlinien nicht erfolgte, dürfte sich die Reliabilität bis heute nicht grundsätzlich verbessert haben. Ob und wie stark sich dies auch ohne die "Kodierpraxispflege" durch die GKV auf die Realität des Morbi-RSA mit seinen 80 relevanten Krankheiten auswirkt, wäre interessant zu untersuchen.
Die Hoffnung, die unbefriedigende Reliabilität der Krankheitenkodierung mit anderen einfacheren Klassifikationssystemen grundsätzlich zu verbessern, sollte aber nicht zu groß sein und nicht die Suche nach besseren Systemen verbauen. Dieselbe Forschergruppe hat nämlich 2012 die Ergebnisse einer auf derselben Datenbasis durchgeführten Studie veröffentlicht, die zur Klassifikation die "International Classification of Primary Care (ICPC-2)" benutzte. Die Schlussfolgerungen waren graduell besser, aber nicht grundsätzlich: "The reliability was good to excellent at the chapter level, at the component level the reliability was moderate though good in the components 1-symptoms and 7-diseases. At single code level the agreement was only fair to moderate in both chapters and components. One third to half of the used codes showed good inter-rater agreement."
Die Studie Three- and four-digit ICD-10 is not a reliable classification system in primary care von E. Wockenfuss et al. ist 2009 im "Scandinavian Journal of Primary Health Care" (27: 131-136) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Auch die 2012 in der Zeitschrift "Swiss Medical Weekly" (142: w13621) veröffentlichte Studie Inter-rater reliability of the ICPC-2 in a German general practice setting von Th. Frese et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.10.16
USA und Deutschland: Länger leben - "krank" oder "gesund"? Neues zur Empirie der "compression of morbidity".
 Für die seit Jahrzehnten laufende epidemiologische und sozialpolitische Debatte darüber, ob eine längere Lebenserwartung mehr gesunde oder kranke bzw. behinderte Jahre mit sich bringt, liegen für die USA aktuelle Daten über die Entwicklung der Lebenserwartung und der "kranken" oder "gesunden" Lebensjahre von Männern und Frauen zwischen den Jahren 1970 und 2010 vor.
Für die seit Jahrzehnten laufende epidemiologische und sozialpolitische Debatte darüber, ob eine längere Lebenserwartung mehr gesunde oder kranke bzw. behinderte Jahre mit sich bringt, liegen für die USA aktuelle Daten über die Entwicklung der Lebenserwartung und der "kranken" oder "gesunden" Lebensjahre von Männern und Frauen zwischen den Jahren 1970 und 2010 vor.
Mit den Ergebnissen lässt sich die optimistische Hypothese, nämlich die über eine so genannte "compression of morbidity", nicht bzw. nur mit Einschränkungen bestätigen und finden sich einige empirische Belege für die eher pessimistische "Medikalisierungs"-Hypothese.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Die Lebenserwartung bei der Geburt stieg im Untersuchungszeitraum bei Männern um 9,2 und bei Frauen um 6,4 Jahre.
• Die Anzahl der behinderungs-/erkrankungsfreien ("disability-free") Jahre stieg bei den Männern um 4,5 Jahre und die der Jahre mit Behinderungen/Erkrankungen um fast den denselben Zeitraum, nämlich 4,7 Jahre.
• Bei den Frauen stieg der Anteil der "gesunden" Lebensjahre um 2,7 und der der "kranken" Jahre um deutlich mehr, nämlich 3,6 Jahre.
• Untersucht man den weiteren Gesundheitsverlauf der 65-Jährigen und älteren Personen war bei diesen aber der Anteil der "gesunden" Jahre mehr angestiegen und damit höher als der der "kranken" Jahre.
• Das andere Bild bei den jüngeren Personen ist angesichts des Gesamtergebnisses zwingend. Für das Anwachsen der "kranken" Jahre von Angehörigen dieser Altersgruppe sind besonders die größere Bedeutung der psychischen Gesundheit, die steigende Häufigkeit von autistischen Störungen und Aufgmerksamkeitsstörungen und die Veränderungen des Gebrauchs von Drogen verantwortlich.
Auch wenn die Daten nicht den Schluss zulassen, dass längeres Leben komplett "gesundes" Leben bedeutet, weisen die AutorInnen darauf hin, dass das Augenmerk einer präventiven Gesundheitspolitik auf dem Erkrankungsgeschehen der jüngeren Bevölkerung und den dort zu beobachtenden Chronifizierungsprozessen liegen müsste.
Zu den Limitationen dieser Studie gehört, dass die Angaben zum Gesundheitszustand des größten Teils der Bevölkerung aus dem "National Health Interview Survey" stammen. Veränderungen in der Prävalenz wichtiger Krankheitsarten (z.B. psychische Erkrankungen) könnten also nicht die tatsächliche Zunahme ihrer Häufigkeit anzeigen, sondern auf deren offeneren Kommunikation beruhen.
Die naheliegende Frage wie das Verhältnis von "gesunden" zu "kranken" Lebensjahren in der deutschen Bevölkerung aussieht, gibt es in zwei Publikationen der OECD aus den letzten beiden Jahren (Health at a Glance 2014 - komplett kostenlos erhältlich - und OECD-Wirtschaftsberichte: Deutschland 2016 - nur Abstract kostenlos erhältlich, einzelne Kapitel aber online lesbar) Hinweise.
Mit den üblichen Einschränkungen zur Vergleichbarkeit von unterschiedlich erhobenen Daten, sieht die Situation in Deutschland so aus: Die weitere Lebenserwartung einer deutschen 65-jährigen Person betrug 2012 19,8 Jahre (EU: 18,8). Davon verbrachten diese Personen noch knapp 7 Jahre "gesund" (EU: 8,6). Nur in drei Ländern (Estland, Slowakei, Ungarn) war der Umfang "gesunder" Lebensjahre geringer. In Schweden lebten z.B. 65-Jährige durchschnittlich noch 19,9 Jahre, wovon 14,7 Jahre "gesunde" Jahre waren. In beiden Berichten wird außerdem auf die erheblichen Unterschiede zwischen sozial unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen hingewiesen.
Von der zunächst elektronischen Fassung des im "American Journal of Public Health" erschienenen Aufsatzes Trends Over 4 Decades in Disability-Free Life Expectancy in the United States von Eileen M. Crimmins, Yuan Zhang und Yasuhiko Saito ist nur ein Abstract kostenlos erhältlich.
Wer sich noch einen relativ aktuellen und kostenlosen Überblick über die Hypothese der "compression of morbidity" verschaffen will, kann dies mit folgendem Aufsatz machen: Compression of Morbidity 1980-2011: A Focused Review of Paradigms and Progress. Autoren sind James F. Fries (der Protagonist dieser Hypothese), Bonnie Bruce und Eliza Chakravarty. Erschienen ist der Aufsatz 2011 im "Journal of Aging Research".
Bernard Braun, 18.4.16
Multimorbidität: Alles klar oder doch eher Vorsicht vor Vielfalt und Uneindeutigkeit?
 In epidemiologischen Analysen und Prognosen, in gesundheitspolitischen Debatten über den künftigen gesundheitsbezogenen Bedarf an Ressourcen oder in Gesundheitssystemvergleichen spielt Multimorbidität eine bedeutende Rolle. Zu dieser Rolle gehört, dass eindeutig klar zu sein scheint, was Multimorbidität ist.
In epidemiologischen Analysen und Prognosen, in gesundheitspolitischen Debatten über den künftigen gesundheitsbezogenen Bedarf an Ressourcen oder in Gesundheitssystemvergleichen spielt Multimorbidität eine bedeutende Rolle. Zu dieser Rolle gehört, dass eindeutig klar zu sein scheint, was Multimorbidität ist.
Ob es diese eindeutige Definition wirklich gibt, versuchte nun ein dänisches Gesundheitswissenschaftler-Team durch einen systematischen Review von 163 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu finden. Diese Suche schloss nicht nur die quantitative Definition des "Multi", sondern auch qualitativ ein, ob es sich um eine bestimmte Anzahl von Krankheiten, Risikofaktoren oder Symptomen handelte. Hinzu kam die Quelle des Wissens über Multimorbidität.
Das Ergebnis zeigte eindeutig, dass es die eindeutige Definition von Multimorbidität nicht gibt, sondern eine ausgesprochene Vielfalt an Defintionen existiert:
• In 37% aller untersuchten wissenschaftlichen Versuche einer Definition lag der Schnittpunkt für das Vorliegen von Multimorbidität bei zwei oder mehr gesundheitlicher Zustände (Krankheiten, Risikofaktoren oder Symptome). In 7% der Studien fängt Multimorbidität bei drei Zuständen an, in 2% sogar schon bei einem. 34% der Studien spezifizierten die in ihnen gewählten Schnittpunkte überhaupt nicht.
• Die meisten Defintionen bezogen sich auf die allgemeine Bevölkerung (42%) und die primäre Krankenversorgung (25%).
• In 42% der Veröffentlichungen lagen den Definitionen selbst wahrgenommene Gesundheitszustände zugrunde.
• In 115 Aufsätzen finden sich individuell konstruierte Defintionen von Multimorbidität. In allen dieser Definitionen treten Krankheiten auf, am meisten Diabetes mellitus Typ 2. Die Anzahl der für die Definition herangezogenen Gesundheitsprobleme bewegte sich zwischen 4 und 147 und die Diagnostik bewegte sich zwischen engen (z.B. Herzinfarkt) und weiteren Diagnosen (z.B. Herzerkrankungen). Risikofaktoren oder Symptome werden in weniger, nämlich in 85% oder 62% dieser Aufsätze genannt. Die verbreitete Mitberücksichtigung von Risikofaktoren trägt maßgeblich zur hohen Prävalenz von Multimorbidität bei.
• Die Schwere der Multimorbidität wird nur noch in 23% der Definitionsversuche berücksichtigt, und dazu auch noch in verschiedenen Weisen.
• Das große Gewicht von Krankheiten und Risikofaktoren und das geringe der Schwere von gesundheitlichen Problemen ist wesentlich dafür verantwortlich, dass die Definitionen eher etwas für Epidemiologen als für den klinischen Alltag von Ärzten oder gar für PatientInnen sind.
Angesichts der eingangs skizzierten großen Bedeutung der Art und der Prävalenz von Multimorbidität ist der offenkundigen Uneindeutigkeit und qualitativen Verschiedenartigkeit ihrer Definition künftig eine wesentlich größere Aufmerksamkeit zu widmen als bisher und in Vergleichen vermieden werden, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Wichtige Hinweise liefert der am 8. März 2016 im "Scandinavian Journal of Primary Health Care" erschienene und komplett kostenlos erhältliche Aufsatz The role of diseases, risk factors and symptoms in the definition of multimorbidity - a systematic review von Tora Grauers Willadsen, Anna Bebe, Rasmus Křster-et al.
Bernard Braun, 3.4.16
Zugehörigkeit zu örtlichen sozialen Gruppen oder Was außer regelmäßiger Bewegung lässt Rentner länger und besser leben?
 Spätestens dann, wenn nicht ein biologistischer Determinismus oder Fatalismus die Vorstellung vom Rentner- und Älterwerden bestimmt oder das Heil allein in Anti-Aging-Pillen und -Cremes gesucht wird, stellt sich die Frage, was wirklich Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenserwartung der Angehörigen dieser Altersgruppe fördert bzw. vor den gesundheitlichen Folgen des Verlustes von arbeitsbezogenen Gruppenbindungen und der mit Beschäftigung assoziierten Identität bewahrt.
Spätestens dann, wenn nicht ein biologistischer Determinismus oder Fatalismus die Vorstellung vom Rentner- und Älterwerden bestimmt oder das Heil allein in Anti-Aging-Pillen und -Cremes gesucht wird, stellt sich die Frage, was wirklich Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenserwartung der Angehörigen dieser Altersgruppe fördert bzw. vor den gesundheitlichen Folgen des Verlustes von arbeitsbezogenen Gruppenbindungen und der mit Beschäftigung assoziierten Identität bewahrt.
In einer Langzeit-Kohortenstudie in der 424 TeilnehmerInnen von kurz vor ihrem Rentenbeginn bis 6 Jahre nach diesem Zeitpunkt teilnahmen haben dies nun australische Wissenschaftler etwas genauer untersucht.
Ihre Ergebnisse lauten:
• RentnerInnen, die vor dem Beginn ihrer Rentenzeit aktives Mitglied in zwei örtlichen sozialen Gruppen (z.B. Buchklub oder kirchliche Gruppe) waren und dies auch die ersten 6 Jahre ihrer Rentenzeit blieben, hatten in diesen 6 Jahren ein Sterblichkeitsrisiko von 2%. Schieden sie aus einer der Gruppen aus, stieg dieses Risiko auf 5%, und wenn sie beide Mitgliedschaften aufgaben auf 12%.
• Außerdem verringerte sich die mit einem Standardinstrument gemessene erfahrene Lebensqualität bei jeder verlorenen Mitgliedschaft um 10%.
• Die Ergebnisse waren auch nach der Berücksichtigung von Alter, Geschlecht oder sozialem Status robust.
• Der Effekt der Mitgliedschaft in sozialen Gruppen war schließlich mit dem von körperlichen Aktivitäten/Bewegung vergleichbar. Dies zeigte sich besonders deutlich bei der Untersuchung des Sterblichkeitsrisikos in einer soziodemografisch vergleichbaren so genannten "match control"-Gruppe von ebenfalls 424 Personen, die weiterarbeiteten aber ebenfalls 6 Jahre genau betrachtet wurden. Diejenigen von ihnen, die sich 6 Jahre wöchentlich kräftige körperlich betätigten, hatten in diesem Zeitraum ein Risiko von 3%, bei denen, die dies nicht mehr wöchentlich machten, stieg das Risiko auf 5% und auf 8%, wenn sie damit komplett aufhörten. Der Effekt von Bewegung etc. auf das Sterblichkeitsrisiko bei den berenteten Personen war ähnlich: 3%, 6% und 11%.
Auch wenn diese Studie als Beobachtungsstudie keine kausalen Belege liefern kann, gehört die Kombination des Erhalts alter und die Motivation zu neuen sozialer Beziehungen mit geeigneten körperlichen Aktivitäten sicherlich zu den praktikablen und wirksamen präventiven Mitteln für FrischrentnerInnen. In einem dänischen Modellversuch erwies sich das stundenlange, gemeinsame und enorm "bewegte" Billiardspielen in Altenzentren Kopenhagens als ein akzeptiertes, äußerst wirksames und regelmäßig genutztes Angebot dieser Art.
Der Aufsatz Social group memberships in retirement are associated with reduced risk of premature death: evidence from a longitudinal cohort study von Niklas K Steffens, Tegan Cruwys, Catherine Haslam, Jolanda Jetten und S Alexander Haslam ist im Februar 2016 in der Zeitschrift "BMJ Open" erschienen und daher auch komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.2.16
Zusammenhänge zwischen Gesundheitsreformen, Sterblichkeit und Nutzung des Gesundheitssystems: Zwischen Wunsch- und Alptraum
 Offen oder zumindest insgeheim haben Gesundheitspolitiker den Wunschtraum, sie könnten durch Gesundheitsreformen "die Gesundheit der Bevölkerung" verbessern, und zwar bis hin zur Verlängerung der Lebenserwartung.
Offen oder zumindest insgeheim haben Gesundheitspolitiker den Wunschtraum, sie könnten durch Gesundheitsreformen "die Gesundheit der Bevölkerung" verbessern, und zwar bis hin zur Verlängerung der Lebenserwartung.
Dabei spielt natürlich auch der Vergleich entsprechender Indikatoren, also z.B. der Mortalität, zwischen ansonsten vergleichbar entwickelten Ländern eine große Rolle.
In diesem Wettbewerb sah es in den 1980er und 1990er Jahren bei der Sterblichkeit so aus, dass sie den meisten Industrieländern zurückging, nur nicht in den Niederlanden, wo sie stagnierte und in einigen Bevölkerungsgruppen sogar anstieg. Dies änderte sich schlagartig ab dem Jahr 2002 und insbesondere bei den niederländischen 65+-BürgerInnen. Nicht nur Gesundheitspolitiker führten diese Verlängerung der Lebenserwartung in den Niederlanden auf die umfassenden Gesundheitsreformen und die dadurch bedingte bessere Gesundheitsversorgung zu Beginn der Nullerjahre zurück.
Ob dies stimmt bzw. stimmen kann, untersuchte jetzt eine Gruppe von niederländischen Epidemiologen durch den Vergleich zahlreicher Befragungsdaten einer 7.691 Personen umfassenden Kohorte aus dem "Dutch Health interview survey" im Jahr 2001/2002 mit einer 8.362 umfassenden Koghorte, die im Jahr 2007/08 befragt wurde. Diese Daten wurden durch eine Reihe von Daten aus Routinedatenregistern zur Mortalität, zu Arzneimittelverordnungen und Arztbesuchen ergänzt. Bei sämtlichen Analysen wurden mögliche Unterschiede des Gesundheitszustandes, der Risikofaktoren, verschiedener Verhaltensweisen, Übergewicht und soziodemografische Faktoren zwischen den beiden Kohorten adjustiert.
Die Ergebnisse können trotzdem paradoxer nicht sein:
• Wunschtraummäßig ging die Sterblichkeit zwischen den beiden Kohorten um 15% zurück. Die größte Reduktion fand in der Gruppe der am schwersten erkrankten Menschen (mit mindestens einer tödlichen und einer nicht-tödlichen Krankheit) statt. Der Rückgang betrug dort 58%.
• Angesichts der umfangreichen Adjustierungen kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der Rückgang "cannot be expolained by chganges in sociodemographic characteristics, behavioural risk factors or changes in health status".
• Alptraummäßig mutet aber dann ein weiteres Ergebnis an: Es gibt zum einen keinen Zusammenhang zwischen der niedrigeren Sterberate und einer verstärkten Nutzung von Gesundheitsleistungen. Zum anderen aber erhöhte sich sogar das Sterberisiko mit einer intensiveren bzw. häufigeren Nutzung von Gesundheitsversorgungsleistungen.
Den Schluss, unreformierte oder reformierte Angebote des Gesundheitssystems könnten mehr schaden als nutzen, verneinen die Forscher zwar, und hoffen in weiteren Untersuchungen Störfaktoren oder bisher ungenaue Angaben zur Versorgung identifizieren und deren Einfluss reduzieren zu können.
So richtig gut schlafen können aber aufmerksame Gesundheitspolitiker bis dahin wohl auch nicht!?
Näheres über die Studie erfährt man zum einen in dem von Frederik Peters, einem Koautor der Studie, verfassten kurzen Artikel Längeres Leben dank Gesundheitsreform? Zusammenhang zwischen höheren Gesundheitsausgaben und Rückgang der Sterblichkeit in den Niederlanden in der aktuellen Ausgabe (Nr. 2, 2015) des immer lesenswerten Newsletter "Demografische Forschung. Aus erster Hand" des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Der Aufsatz wie Newsletter sind kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz A closer look at the role of healthcare in the recent mortality decline in the Netherlands: results of a record linkage study von Peters F, Nusselder WJ und Mackenbach JP. Ist in der Fachzeitschrift "J Epidemiol Community Health" (2015; 69 (6): 536-542) erschienen. Leider ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.6.15
Universitäre Medizinerausbildung in Deutschland: Exzellenz statt Bedarfsgerechtigkeit
 Die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten stellt auch die Bundesrepublik Deutschland vor wachsende Herausforderungen und nimmt zunehmend Einfluss auf die gesundheitspolitische Debatte. Die Problematik einer dauerhaften Sicherstellung ausreichender Behandlungsmöglichkeiten für die geringer werdende, alternde Bevölkerung auf dem Land findet auch in der Presse ein wachsendes Echo, so beispielsweise in der ZEIT in dem Artikel mit dem anschaulichen Titel Ärztemangel: Notruf nach dem Landarzt!, wiederholt im SPIEGEL wie etwa in den Beiträgen Landarztmangel: Zu wenige weiße Kittel in der Provinz oder jüngst Patienten-Versorgung: Trotz Reformen weiter Ärztemangel auf dem Land, und natürlich auch im Deutschen Ärzteblatt, das dem Thema ein ganzes Dossier: Ärztemangel widmet.
Die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten stellt auch die Bundesrepublik Deutschland vor wachsende Herausforderungen und nimmt zunehmend Einfluss auf die gesundheitspolitische Debatte. Die Problematik einer dauerhaften Sicherstellung ausreichender Behandlungsmöglichkeiten für die geringer werdende, alternde Bevölkerung auf dem Land findet auch in der Presse ein wachsendes Echo, so beispielsweise in der ZEIT in dem Artikel mit dem anschaulichen Titel Ärztemangel: Notruf nach dem Landarzt!, wiederholt im SPIEGEL wie etwa in den Beiträgen Landarztmangel: Zu wenige weiße Kittel in der Provinz oder jüngst Patienten-Versorgung: Trotz Reformen weiter Ärztemangel auf dem Land, und natürlich auch im Deutschen Ärzteblatt, das dem Thema ein ganzes Dossier: Ärztemangel widmet.
Vorschläge zur Lösung der ursächlichen ungleichen Verteilung der ÄrztInnen in Deutschland gibt es zu Hauf, die meisten beziehen sich auf Anreize zur Ansiedlung von ÄrztInnen auf dem Land und die Weiterbildung von AllgemeinmedizinerInnen. Dazu gehören die Ablehnung von Zulassungen bei der Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in einem überversorgten Bereich, Entlastung von ÄrztInnen durch Delegation bestimmter Leistungen an qualifiziertes nicht-ärztliches Personal, Einbindung von Krankenhäusern in ambulante ärztliche Versorgung und die präventive Einrichtung von Strukturfonds zur Sicherstellung der Versorgung. Auch das derzeit beratene Versorgungsstärkungsgesetz soll explizit dazu beitragen, die Überversorgung mit Ärzten in der Stadt abzubauen und der Unterversorgung auf dem Land erfolgreich zu begegnen.
Im seinem Jahresgutachten 2014 hatte sich der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen ausführlich und detailliert mit dem Thema Bedarfsgerechte Versorgung  Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche befasst. Neben den genannten Vorschlägen beziehen sich seine Empfehlungen auch auf einen ansonsten wenig beachteten Bereich, die Ausbildung heranwachsender Medizinergenerationen. Dem Medizinstudium kommt eine entscheidendere Weichenstellung zu, als landläufig bekannt ist. Das Sachverständigengutachten empfiehlt daher: "Finanzielle Mittel zur Hochschulfinanzierung könnten zukünftig daran geknüpft werden, inwieweit die medizinischen Fakultäten erkennbar und nachhaltig die Ausbildung im Fach Allgemeinmedizin fördern. Medizinische Fakultäten könnten hier z. B. zielgerichtete Rekrutierungsstrategien, zentralere Positionierung der Allgemeinmedizin im Curriculum, Mentoring für am Fach Interessierte, freiwillige Landarzt-Tracks etc. nutzen."
Das klingt nachvollziehbar und machbar, stellt aber letztlich die Medizinerausbildung in Deutschland grundsätzlich in Frage. Die Lehre an medizinischen Hochschulen erfolgt vornehmlich in hochspezialisierten Versorgungseinrichtungen, die insgesamt nicht mehr als 1 % aller Gesundheitsprobleme behandeln und lässt förderliche Ansätze für eine Stärkung der Allgemein- und insbesondere der Landarztmedizin vermissen. Ein vielfach selbstreferenzieller Wissenschaftsbetrieb setzt primär auf technische, hochspezialisierte "Exzellenz", und Universitäten wetteifern um Drittmittel für ausgesuchte Grundlagen- und High-Tech-Forschung - der konkrete Versorgungsbedarf in der Region bzw. im jeweiligen Bundesland spielt kaum eine Rolle. So setzt beispielsweise die Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg seit Jahren auf zwei ausgesuchte Schwerpunkte, nämlich Neurowissenschaften und Immunologie, wie sie in ihrer Festschrift 60 Jahre Hochschulmedizin Magdeburg (S. 59 + 114) hervorhebt. Diese Auswahl der Universität in der Hauptstadt eines der einkommens- und strukturschwächsten Bundesländer ist bemerkenswert. Gerade Sachsen-Anhalt steht vor großen Herausforderungen, die medizinische Versorgung in ländlichen und abgelegenen Landesteilen aufrechtzuerhalten. Nach Schätzungen der dortigen Kassenärztlichen Vereinigung sind bis 2025 mehr als 820 Hausarztsitze nachzubesetzen. Jedes Jahr wären also fast 90 neue FachärztInnen für Allgemeinmedizin erforderlich, um den Bedarf zu decken - zurzeit produziert das Land Sachsen-Anhalt aber nicht mehr als 16 bis maximal 30 AllgemeinärztInnen pro Jahr.
Exzellenzbestrebungen deutscher Hochschulen bestimmen die Medizinerausbildung bisher erheblich stärker als akuter Nachwuchs- oder Versorgungsbedarf. Dabei gab es immer wieder Stimmen, die vor einer einseitigen Orientierung der Exzellenzbestrebungen auf Reputation verheißende Forschung anstatt einer Förderung der Lehre gewarnt haben. Schon 2007 monierte der damalige Vorsitzende der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) in seinem Artikel Exzellenz in der Hochschulmedizin durch die Einheit von Lehre und Forschung!, plötzlich sei überall von Exzellenz auch in der Lehre die Rede. In der Zeitschrift GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung beklagt der damalige Vorsitzende "das Primat der Forschung an den Fakultäten hat die Lehre (und damit die Gemeinschaft der Professoren mit den Lernenden) zu Ballast werden lassen" (S. 2), und weist kritisch darauf hin, "dass Eliteuniversitäten und Exzellenzinitiativen ohne Einbeziehung der Lehre ausgerufen wurden" (S. 3).
Diese Erkenntnisse waren aber schon damals keineswegs neu. Bereits Mitte der 1990er Jahre beobachteten US-ForscherInnen in ihrer literaturbasierten Meta-Analyse von Einflussfaktoren für die Rekrutierung von AllgemeinmedizinerInnen, dass der Umfang der Forschungsförderung medizinischer Fakultäten durch die Bundesbehörde National Institutes of Health, die wissenschaftliche Studien im Bereich Medizin unterstützt, umgekehrt proportional zur Produktion von Allgemein- und FamilienmedizinerInnen sowie LandärztInnen war. In Ihrem als Volltext kostenfrei zugänglichen Artikel The Effects of Medical School Curricula, Faculty Role Models, and Biomedical Research Support on Choice of Generalist Physician Careers: A Review and Quality Assessment of the Literature gelangen Douglas Campos-Outcalt, Janet Senf, Arleen Watkins und Stan Bastacky zu der Empfehlung: "Federal agencies that fund medical education, directly or indirectly, could establish criteria for receipt of monies that include outcome measures and that reward schools demonstrating an active, institutional commitment to producing generalist physicians."
Nun unterstreicht eine soeben im Scandinavian Journal of Primary Health Care veröffentlichte Studie aus Deutschland erneut die Bedeutung gerade frühzeitiger Kontakte von Medizinstudierenden mit der Allgemeinmedizin für die spätere Entscheidung für eine Tätigkeit als Hausa(e)rztIn. In Anbetracht der zunehmenden Hausarztknappheit von untersuchten WissenschaftlerInnen der Universität Leipzig die Auswirkungen von praxisorientierte Allgemeinmedizin-Kursen in verschiedenen Phasen des Medizinstudiums auf die Berufswahl der AbsolventInnen. Im Rahmen ihrer Beobachtungsstudie mit 659 AbsolventInnen ermittelten Sie an Hand multivariater binärer logistischer Regression den Einfluss verschiedener Studienangebote auf eine spätere Berufstätigkeit in der Allgemeinmedizin und konnten dabei sechs unabhängige Variablen als Prädiktoren ausmachen: Alter, Hausarzterfahrungen in der Familie oder im Freundeskreis, Interesse an hausärztlicher Tätigkeit zum Studienbeginn, Präferenz einer späteren Arbeit in einer ländlichen oder kleinstädtischen Bereich, positive Einstellung zu einen breiten Patientenspektrum und zu langfristigen Arzt-PatientInnen-Beziehungen. Insgesamt zeigte sich bei weiblichen Berufsanfängerinnen eine größere Bereitschaft zu einer hausärztlichen Tätigkeit.
In Bezug auf den Lehrplan waren nach Adjustierung unabhängig voneinander verschiedene Kursangebote positiv mit einer späteren Tätigkeit in der Allgemeinmedizin assoziiert:
• Elektives spezifisches Hausarztpraktikum im vorklinischen Studienabschnitt: OR 2,6, 95 % CI 1,3-5,3),
• Vierwöchige Famulatur in einer Hausarztpraxis während des klinischen Studienabschnitts: OR 2,6, 95 % CI 1.3 - 5,0
• Viermonatige allgemeinärztliche Tätigkeit im Rahmen des Praktischen Jahres: OR 10,7, 95 % CI 4,3-26,7.
Insgesamt bestätigen die Leipziger WissenschaftlerInnen vorliegende Untersuchungsergebnisse, dass praxisorientierte allgemeinmedizinische Ausbildungsangebote sowohl in frühen als auch in späteren Phasen des Medizinstudiums die Zahl späterer HausärztInnen erhöhen können. Diese Befunde sind von Interesse für politische EntscheidungsträgerInnen und für medizinische Fakultäten sowie für die Gestaltung von Lehrplänen. Denn sie zeigen machbare und pragmatische Wege auf, wie sich bereits im Medizinstudium die Bereitschaft angehender ÄrztInnen steigern lässt, eine Tätigkeit in der hausärztlichen Versorgung aufzunehmen; entsprechende Hinweise gibt es auch für die frühzeitige Heranführung junger MedizinerInnen an die Versorgung auf dem Lande. Der Weg dorthin ist aber alles andere als konfliktfrei, erfordert er doch eine grundlegende Auseinandersetzung mit der herrschenden Prioritätensetzung der deutschen Hochschulmedizin, mit der dortigen Eminenzen und mit der Forschungsförderung.
Der Artikel von Tobias Deutsch, Stefan Lippmann, Thomas Frese und Hagen Sandholzer mit dem Titel Who wants to become a general practitioner? Student and curriculum factors associated with choosing a GP career - a multivariable analysis with particular consideration of practice-orientated GP courses steht kostenfrei als Volltext zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 6.4.15
Lange Telomere gleich längere Lebenserwartung und gesundes Altern dank Mittelmeer-Diät!?
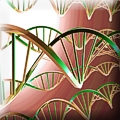 Telomere sind vereinfacht gesagt die Enden von Chromosomen. Wenn deren Länge unter ein bestimmtes Maß sinkt, kann sich die Zelle nicht mehr teilen, was wiederum dann, wenn diese Verkürzung zahlreich auftritt, zu vorzeitiger Alterung führt. Umgekehrt unterstützen und sichern längere Telomere gesundes Altern und längeres Leben - soweit die starken Annahmen.
Telomere sind vereinfacht gesagt die Enden von Chromosomen. Wenn deren Länge unter ein bestimmtes Maß sinkt, kann sich die Zelle nicht mehr teilen, was wiederum dann, wenn diese Verkürzung zahlreich auftritt, zu vorzeitiger Alterung führt. Umgekehrt unterstützen und sichern längere Telomere gesundes Altern und längeres Leben - soweit die starken Annahmen.
In einer Studie wurden nun die 4,676 gesunden mittelaltrigen Teilnehmerinnen an der "Nurses Health Study" in den USA sowohl umfassend nach ihren Essgewohnheiten gefragt als auch die Länge ihrer Telomere gemessen.
Nach dem Adjustieren von persönlichen Merkmalen (u.a. Alter, BMI, Rauchgewohnheiten und Bewegung), die als Einflussfaktoren für die Länge der Chromosomenenden gelten, stellten die ForscherInnen fest:
• Frauen, die sich bei ihrer Ernährung überwiegend an der so genannten Mittelmeer-Diät (vor allem viel Gemüse, Früchte, Nüsse, Vollkornprodukte, Fisch plus moderatem Alkoholkonsum) orientierten, hatten signifikant längere Telomere.
• Die damit erreichbare Verlängerung der Lebenserwartung berechneten die WissenschaftlerInnen mit durchschnittlich rund 4,5 Lebensjahre.
• Der Unterschied ist ähnlich groß wie der zwischen Nichtrauchern und Nichtrauchern, körperlich Aktiven und weniger Bewegten.
• Für die Erklärung dieser Assoziation und für die künftige Forschung interessant war, dass keine der einzelnen Komponenten der Mittelmeer-Diät mit der Länge von Telomeren korrespondierte, sondern offensichtlich nur das Gesamtkonzept.
Die Querschnitt-Studie Mediterranean diet and telomere length in Nurses' Health Study: population based cohort study von Immaculata de Vivo et al., online am 2. Dezember 2014 im "British Medical Journal" (349: g6674) veröffentlicht, ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.12.14
Hängt die Gesundheit der "Menschen mit Migrationshintergrund" von der Art der Integrationspolitik ab? Irgendwie schon.
 Um es gleich vorweg zu sagen: Wie die Gesundheit der länger als 10 Jahre in Deutschland lebenden "Menschen mit Migrationshintergrund" im Vergleich mit derselben sozialen Gruppe in anderen europäischen Ländern aussieht, findet sich einer gerade veröffentlichten Querschnittsuntersuchung mit Daten des "European Union Survey on Income and Living Conditions" zu den möglichen Zusammenhängen von Gesundheit und Integrationspolitik nicht. Der Grund: Für Deutschland kann wie für ein paar andere Länder (Estonia, Latvia, Malta, Slovenia) nicht unterschieden werden, ob die Einwanderer in EU-Ländern oder außerhalb der EU geboren wurden.
Um es gleich vorweg zu sagen: Wie die Gesundheit der länger als 10 Jahre in Deutschland lebenden "Menschen mit Migrationshintergrund" im Vergleich mit derselben sozialen Gruppe in anderen europäischen Ländern aussieht, findet sich einer gerade veröffentlichten Querschnittsuntersuchung mit Daten des "European Union Survey on Income and Living Conditions" zu den möglichen Zusammenhängen von Gesundheit und Integrationspolitik nicht. Der Grund: Für Deutschland kann wie für ein paar andere Länder (Estonia, Latvia, Malta, Slovenia) nicht unterschieden werden, ob die Einwanderer in EU-Ländern oder außerhalb der EU geboren wurden.
Die mit Daten aus dem Jahr 2011 durchgeführte Studie schließt 14 europäische Länder ein. Die Integrationspolitik dieser Länder wurde mittels des erprobten "Migrant Integration Policy Index" nach drei Typen unterschieden: multikulturell (9 Länder darunter Großbritannien, Italien, Schweden), exklusionistisch (Österreich, Dänemark) und assimilationistisch (je nach Dimension mehr oder weniger sind das Frankreich, Schweiz, Luxemburg). In die Untersuchung des Gesundheitszustandes wurden dann Daten von 177.300 über sechszehnjährige Personen einbezogen, die in den jeweiligen Ländern geboren waren und Daten von 7.088 Personen bzw. Immigranten, die außerhalb der EU geboren waren und bereits 10 und mehr Jahre in dem jeweiligen EU-Land wohnten. Mit diesem Merkmal sollte der so genannte "healthy immigrant effect" ausgeschlossen werden.
Gewichtet nach Alter, Bildungsabschluss, Beschäftigungsstatus und sozio-ökonomischen Bedingungen wurde dann der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand zur Bewertung der Gesundheit genutzt.
Verglichen mit Immigranten in Ländern mit multikultureller Integrationspolitik war der Gesundheitszustand der in Ländern mit exklusionistischer Integrationspolitik lebenden Immigranten signifikant schlechter, und zwar komplett adjustiert um das 1,78-fache bei Männern und um das 1,47-fache bei Frauen. Und selbst im Vergleich mit Ländern, deren Politik sich vor allem auf die Assimilation von ausländischen Personen konzentriert, war die Gesundheit der Immigranten in exklusionistischen Ländern noch signifikant schlechter: um das 1,19-fache bei Männern und 1,22-fache bei Frauen.
Zusätzlich war auch die Ungleichheit beim Gesundheitszustand zwischen Immigranten und Einwohnern ohne Migrationshintergrund in Ländern mit einer auf Exklusion gerichteten Integrationspolitik am höchsten - auch nach dem Ausschluss des Einflusses der sozioökonomischen Verhältnisse.
Auch wenn eine weitere Erforschung solcher Zusammenhänge sicher notwendig ist, kann sich nach den Ergebnissen dieser Studie niemand mehr damit selbst beruhigen, dass es sich bei der Alternative "Willkommenskultur" oder "Festung Europa"-Mentalität um eine Stimmungs- oder Stilfrage handelt.
Und vielleicht schaffen es dann auch die deutschen Organisatoren des Survey den Unterschied zwischen in Birmingham oder Manila geborenen Immigranten zu erfassen. Welche Art von Integrationspolitik dann in Deutschland praktiziert wird, ist im Lichte der aktuellen gesetzgeberischen und faktischen Asylbewerberpolitik leider nicht eindeutig abzusehen.
Der Aufsatz Immigrants' health and health inequality by type of integration policies in European countries von Davide Malmusi ist am 17. September 2014 im "European Journal of Public Health" online first erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.9.14
Henne oder Ei? Ist Sprachenlernen Hirn-Jogging gegen Demenz oder lernen Leute mit "fittem" Hirn mehr und besser Sprachen?
 Auf der Suche nach nichtmedizinischen Möglichkeiten sich bis in das höhere Lebensalter geistig fit zu halten, wird immer wieder das Lernen von Fremdsprachen genannt. Trotz zahlreicher bestätigender Hinweise aus Beobachtungsstudien konnte bisher nicht geklärt werden, welche Wirkrichtung hinter dieser Beobachtung steckt.
Auf der Suche nach nichtmedizinischen Möglichkeiten sich bis in das höhere Lebensalter geistig fit zu halten, wird immer wieder das Lernen von Fremdsprachen genannt. Trotz zahlreicher bestätigender Hinweise aus Beobachtungsstudien konnte bisher nicht geklärt werden, welche Wirkrichtung hinter dieser Beobachtung steckt.
Britische Forscher liefern mit den am 2. Juni 2014 in der Fachzeitschrift "Annals of Neurology" veröffentlichten Ergebnissen einer Längsschnittstudie schlüssige Belege für die positiven Wirkungen von Bilingualismus auf das kognitive Altern.
Dazu absolvierte eine Gruppe von 853 im Jahr 1936 geborenen TeilnehmerInnen im Alter von 11 Jahren, also 1947, einen Intelligenztest. Alle TeilnehmerInnen hatten Englisch als Muttersprache. Dieser Test wurde zwischen 2008 und 2010 mit den dann rund 70 Jahre alten Personen wiederholt. 262 von ihnen sprachen mindestens eine Fremdsprache, die sie entweder in der Schule oder im späteren Alter gelernt hatten.
Das Ergebnis war eindeutig: Unabhängig von der Anfangsintelligenz und auch vom Zeitpunkt des Sprachelernens (Quintessenz: Es ist nie zu spät!!) hatten die Personen mit mindestens einer Fremdsprache im hohen Alter bessere kognitive Fähigkeiten. Die stärksten protektiven Wirkungen traten bei der allgemeinen Intelligenz und beim Lesen auf. Kontrolliert wurde auch der mögliche Einfluss anderer Faktoren. Die Wirkungen können nicht durch das Geschlecht, den sozioökonomischen Status oder durch Immigrationsaspekte erklärt werden. Das positive Bild wird dadurch abgerundet, dass die Forscher keine negativen Wirkungen von Bilingualismus fanden.
Angesichts der Erkenntnis über die positive Wirkung des Erwerbs, der Kenntnis und Nutzung von Fremdsprachen auf die geistige Fitness, geben wir die zentralen Erkenntnisse der Studie nochmals in präventiver Absicht in der Originalsprache wieder: "Our results suggest a protective effect of bilingualism against age-related cognitive decline independently of CI (child intelligence). The effects are not explained by other variables, such as gender, socioeconomic status, or immigration. Importantly, we detected no negative effects of bilingualism. The cognitive effects of bilingualism showed a consistent pattern, affecting reading, verbal fluency, and general intelligence to a higher degree than memory, reasoning, and speed of processing."
Die Studie Does Bilingualism Influence Cognitive Aging? von Bak T. H. et al. ist in der Zeitschrift "Annals of Neurology" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.6.14
Wie stark soziale Unterschiede und nicht "die Natur" die Lebenserwartung und die Jahre in guter Gesundheit bestimmen
 Die Lebenserwartung und die Krankheitslast oder Pflegebedürftigkeit im Alter erscheinen oft als rein biologisch oder biochemisch determiniert oder als eine Folge gesundheitsbezogenen (Fehl-)Verhaltens. Wie stark aber dabei der Einfluss sozialer und damit auch beeinflussbarer Bedingungen ist, zeigt die aktuellste (Heft 2/2014) Ausgabe der vom Robert Koch-Institut herausgegeben Reihe "GBE kompakt; Zahlen und Trends aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes" facettenreich.
Die Lebenserwartung und die Krankheitslast oder Pflegebedürftigkeit im Alter erscheinen oft als rein biologisch oder biochemisch determiniert oder als eine Folge gesundheitsbezogenen (Fehl-)Verhaltens. Wie stark aber dabei der Einfluss sozialer und damit auch beeinflussbarer Bedingungen ist, zeigt die aktuellste (Heft 2/2014) Ausgabe der vom Robert Koch-Institut herausgegeben Reihe "GBE kompakt; Zahlen und Trends aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes" facettenreich.
Der dazu verfügbare Forschungsstand sieht so aus:
• "Ein niedriger sozioökonomischer Status geht mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko und einer verringerten Lebenserwartung einher."
• Selbst ab dem 65. Lebensjahr zeigen sich für die dann fernere Lebenserwartung deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen mit niedrigem und höherem Status ab.
• "Frauen und Männer aus den höheren Statusgruppen … können … mehr Lebensjahre in guter Gesundheit verbringen." So haben Frauen bei Geburt mit einem Einkommen, das auf dem Niveau von 60% des Netto-Äquivalenzeinkommens liegt, 60,8 Jahre in gesunder Lebenserwartung vor sich, Personen mit 150% und mehr über dem Netto-Äquivalenzeinkommen aber 71 gesunde Jahre. Bei Männern reicht diese Spanne von 56,8 bis zu 71,1 Jahren.
• Regionale Unterschiede bei Lebenserwartungsindikatoren haben etwas mit den Lebensbedingungen in den Regionen zu tun.
• Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung gibt es in fast allen europäischen Ländern. Für Deutschland sind "Aussagen über zeitliche Entwicklungen und Trends in Bezug auf die sozialen Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung" wie üblich "bislang nur eingeschränkt möglich." "Die wenigen vorliegenden Studien deuten aber bereits an, dass sich die beobachteten Unterschiede … im Zeitverlauf ausgedehnt haben könnten."
Die materialreichen 13 Seiten der Informationsbroschüre Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung von T. Lampert und LE Kroll sind komplett kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 21.3.14
Viel Krach um die "stille Epidemie" der Demenz versus wissenschaftlicher Evidenz zu ihrer sinkenden Inzidenz und Prävalenz
 Ein aktueller Bericht der "Alzheimer Disease International (AID)" progostiziert für das Jahr 2050 eine Verdreifachung der weltweiten Alzheimerfälle auf 135 Millionen. Die "Deutsche Alzheimer Gesellschaft - Selbsthilfe Demenz" verkündete ein vergleichbares Epidemie-Szenario bereits Ende 2012. Laut einem Informationsblatt zur Epidemiologie der Demenz, wird die Zahl der Erkrankten allein in Deutschland von aktuell 1,4 Millionen auf etwa 3 Millionen im Jahr 2050 steigen: plus 40.000 im Jahr und mehr als 100 am Tag!
Ein aktueller Bericht der "Alzheimer Disease International (AID)" progostiziert für das Jahr 2050 eine Verdreifachung der weltweiten Alzheimerfälle auf 135 Millionen. Die "Deutsche Alzheimer Gesellschaft - Selbsthilfe Demenz" verkündete ein vergleichbares Epidemie-Szenario bereits Ende 2012. Laut einem Informationsblatt zur Epidemiologie der Demenz, wird die Zahl der Erkrankten allein in Deutschland von aktuell 1,4 Millionen auf etwa 3 Millionen im Jahr 2050 steigen: plus 40.000 im Jahr und mehr als 100 am Tag!
Dass es sich bei derartig spektakulären Prognosen eher um interessengeleitete Spekulationen handeln könnte, zeigt ein Blick auf eine ebenfalls aktuelle Übersicht zum Stand der Forschung zur Entwicklung von Inzidenz und Prävalenz der Demenz in den letzten Jahrzehnten im seriösen "New England Journal of Medicine (NEJM)" - also von tatsächlichen Fällen in methodisch hochwertigen empirischen Studien in mehreren mit Deutschland vergleichbaren Ländern.
Vorgestellt werden die Ergebnisse von fünf großen Studien aus den Niederlanden, England, Schweden und zweimal aus den USA, die jeweils die Inzidenz und Prävalenz von Demenz oder schweren kognitiven Leistungseinschränkungen bei über 51-, 55-, 65 und 75-jährigen Personen zu zwei Zeitpunkten bzw. in Zeiträumen untersuchten.
Die zentralen Ergebnisse der Kohortenvergleiche se´hen folgendermaßen aus:
• Ein Vergleich der Prävalenz schwerer kognitiver Leistungseinschränkungen der Jahre 1982 und 1999 in den USA zeigte eine Abnahme der Prävalenz bei über 65-Jährigen von 5,7% auf 2,9%.
• Ein ähnlicher Vergleich der Prävalenz bei über 70-Jährigen in den USA in den Jahren 1993 und 2002 zeigte ebenfalls eine Abnahme von 12,2% auf 8,7%.
• In der so genannten Rotterdamstudie sank die Inzidenz von Demenz bei 55+-Personen in der 1990er- und in der 2000er-Gruppe von 6,56 Fällen pro 1.000 Personen und Jahr auf 4,92 pro 1.000 Personen und Jahr.
• In Schweden zeigten zwei Querschnittsanalysen bei 75+-Personen in den Jahren 1987-1989 und 2001-2004 ebenfalls eine sinkende Inzidenz aber auch eine alters- und geschlechtsstandardisiert sehr leicht steigende Prävalenz der Demenz: Von 17,5% in den Jahren 1987-89 auf 17,9% in den Jahren 2001-04.
• Und der jüngste Vergleich zweier Jahrgangs-Kohorten in drei Regionen Englands in der so genannten "Cognitive Function and Ageing Study (CAFS I und II)" fand bei über 65-Jährigen sogar eine Abnahme der Demenz-Prävalenz von 8,3% in den Jahren 1989-94 auf 6,5% in den Jahren 2008-11.
Einige der Autoren, die sich auf die Analyse der Neuerkrankungen konzentrierten, räumen ein, eine Zunahme der absoluten Anzahl älterer BürgerInnen könne selbst bei sinkender Inzidenz insgesamt oder für längere Phasen durchaus zu einer Zunahme der Prävalenz führen. Dies müsse aber nicht zwangsläufig so sein. Anders als die Alzheimer-Propheten oder -Lobbyisten in der Pharmaindustrie und in Teilen der Patientenorganisationen weisen sie aber auch auf Faktoren hin, die ihre bei weitem nicht so apokalyptischen und naturgewaltigen Funde erklären helfen und präventive Bedeutung haben.
"But for now, the evidence supports the theory that better education and greater economic well-being enhance life expectancy and reduce the risk of late-life dementias in people who survive to old age. The results also suggest that controlling vascular and other risk factors during midlife and early old age has unexpected benefits."
Und zu dem möglichen Effekt, der entsteht, wenn man diese Faktoren präventiv beeinflussen würde, stellen die AutorInnen fest: "That is, individual risk-factor control may provide substantial public health benefits if it leads to lower rates of late-life dementias. Just as control of vascular risk factors has had measurable effects on public health through reduced rates of stroke and myocardial infarction, the recent English study concluded that estimates of national dementia prevalence based on CFAS I needed to be revised downward by 24% on the basis of the age- and sex-specific prevalence rates in 2011 found in CFAS II."
Die Ergebnisse der AID-"Studie" G8 Policy Briefing reveals 135 million people will live with dementia by 2050 sind kostenlos erhältlich.
Das Wichtigste zur Epidemiologie der Demenz findet sich auf 5 Seiten, welche die Deutsche Alzheimer Gesellschaft kostenlos zur Verfügung stellt.
Die Übersichtsarbeit New Insights into the Dementia Epidemic von Eric B. Larson, Kristine Yaffe, und Kenneth M. Langa ist am 27. November 2013 im NEJM erschienen und komplett kostenlos erhältlich. Diejenigen Interessierten, die sich seriös intensiver und weiter über die Entwicklung des Demenzrisikos informieren wollen und am unbedingt notwendigen und keineswegs abgeschlossenen Diskurs über dessen Bedeutung für die heutige und künftige Gesundheitspolitik teilnehmen wollen, finden hier auch bibliografische Angaben zu den Originalaufsätzen über die zitierten Studien.
Bernard Braun, 5.12.13
Arme sterben jünger als Wohlhabendere und die sozialen Unterschiede bei der Lebenserwartung von 65-Jährigen werden größer
 Dass ärmere Menschen mit meist lebenslang schlechteren Lebensbedingungen als wohlhabendere oder reiche Menschen eine kürzere Lebenserwartung haben, ist auch aus anderen Untersuchungen bereits bekannt. Neu ist aber nach einer Längsschnittauswertung von Daten der deutschen Rentenversicherung für männliche deutsche Versicherte, dass der Abstand zwischen der künftigen Lebenserwartung von einkommensstarken und -schwachen 65-Jährigen zwischen der Mitte der 1990er Jahre und 2008 zunahm.
Dass ärmere Menschen mit meist lebenslang schlechteren Lebensbedingungen als wohlhabendere oder reiche Menschen eine kürzere Lebenserwartung haben, ist auch aus anderen Untersuchungen bereits bekannt. Neu ist aber nach einer Längsschnittauswertung von Daten der deutschen Rentenversicherung für männliche deutsche Versicherte, dass der Abstand zwischen der künftigen Lebenserwartung von einkommensstarken und -schwachen 65-Jährigen zwischen der Mitte der 1990er Jahre und 2008 zunahm.
Die von Wissenschaftlern des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung und des Zentrums für Bevölkerungsforschung durchgeführte Studie zeigte:
• Mitte der 1990er Jahre betrug der Abstand der Lebenserwartung der beiden Gruppen in Westdeutschland rund drei Jahre und in Ostdeutschland dreieinhalb Jahre.
• 2008 wuchsen die Abstände auf 4,8 und 5,6 Jahre.
• Dies heißt, dass alle deutschen männlichen 65-Jährigen mit sehr kleinen Renten (30-39 Rentenpunkte) 2008 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 79,8 Jahren hatten und ihre gleichaltrigen Mitversicherten mit hohen Renten (65 Rentenpunkte und mehr) im Durchschnitt 84,3 Jahre alt wurden.
Die aus verschiedenen Gründen erfolgte Nichtberücksichtigung von Frauen, Ausländern, Beamten und Selbständigen bei dieser Analyse, beeinträchtigt nach Meinung der Wissenschaftler nicht die "Aussagekraft des Ergebnisses". Dies unterstreicht aber den in Deutschland unterentwickelten Zustand der Datenbasis für Untersuchungen des Verhältnisses von Lebenszeit und sozialem Status.
Einen zweiseitigen Überblick über die Ergebnisse der Studie gibt der Beitrag Arme sterben jünger des Mitautors der wissenschaftlichen Studie, Domantas Jasilionis, in dem wie immer empfehlenswerten Newsletter "Demografische Forschung. Aus Erster Hand" (Nr. 3 2013).
Von dem Originalbeitrag Widening socioeconomic differences in mortality among men aged 65 years and older in Germany von Eva Kibele et al. im "Journal of Epidemiology & Community Health" (2013;67: 453-457) gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 9.10.13
Wo läßt es sich in der EU am besten aktiv Altern? Ergebnisse des "Active Ageing Index" 2012
 In dem Maße wie Alterung nicht mehr als etwas überwiegend Biologisch-Naturhaftes oder als Leistung von "active-ageing"-Pillen verstanden wird, sondern als sozial mitbedingt, wächst die Bedeutung der Bedingungen und Faktoren, die ein aktives und gesundes Altern ermöglichen oder fördern.
In dem Maße wie Alterung nicht mehr als etwas überwiegend Biologisch-Naturhaftes oder als Leistung von "active-ageing"-Pillen verstanden wird, sondern als sozial mitbedingt, wächst die Bedeutung der Bedingungen und Faktoren, die ein aktives und gesundes Altern ermöglichen oder fördern.
Was hier in Frage kommt und wie die 27 EU-Mitglieder dabei abschneiden, versucht der mit Förderung der EU-Kommission entwickelte und 2012 zum ersten Mal veröffentlichte "Active Ageing Index (AAI)" abzubilden.
Der AAI besteht aus 22 individuellen alterungsrelevanten Indikatoren, die zu den Schwerpunkten Beschäftigung, soziale Partizipation, selbstbestimmtes, gesundes und sicheres Leben und Kapazitäten und eine Umgebung, die aktives Altern ermöglichen zusammengefasst sind.
Die Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede zwischen den 27 Ländern und lauten u.a. so:
• Insgesamt betrachtet sind die Bedingungen für aktives Altern in Schweden und Dänemark am besten und in der Slowakei und Polen am schlechtesten. Deutschland liegt hier auf Platz 9.
• Bei den Beschäftigungsraten liegen Schweden und Zypern auf Platz 1 und 2 und Malta und Ungarn auf den Plätzen 26 und 27. Deutschland liegt hier auf Platz 10.
• Bei der sozialen Partizipation nehmen Irland und Italien die beiden besten Plätze ein, Bulgarien und Polen die beiden schlechtesten Plätze. Deutschland ritscht hier auf Platz 19.
• Bei der Bedingung selbstbestimmten Lebens liegen Dänemark und Schweden wieder auf den beiden Spitzenplätzen, Bulgarien und Lettland auf den beiden letzten Plätzen. Deutschland erreicht hier mit dem 5. Platz seine beste Positionierung beim aktiven Altern.
• Die Bedingungen für aktives Altern sehen in Schweden und Dänemark am besten, und in Lettland und Rumänien am schlechtesten aus. Deutschland belegt hier Platz 11.
Ausführlichere Erklärungen des AAI und weitere detaillierte Daten findet sich auf der Projekt-Website Active Ageing Index Home.
Noch gründlicher informiert über den AAI und seine Resultate der 2013 erschienene 76-seitige Projekt-Report Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology and Final Results ', Methodology Report von Zaidi, A., K. Gasior, M.M. Hofmarcher, O. Lelkes, B. Marin, R. Rodrigues, A. Schmidt, P. Vanhuysse und E. Zolyomi, der komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 23.9.13
Was bedeutet es, dass alle heute Geborenen 100 Jahre alt werden sollen? Wahrscheinlich weniger Schlimmes als gemenetekelt wird!
 Zu den auch nicht mehr so jungen Schrecken der Debatte über die gesundheitlichen Effekte der steigenden Lebenserwartung gehört die auf niedrigem Niveau kräftig zunehmende Anzahl von hochbetagten Menschen. Auch wenn im Moment nur wegen der geringen absoluten Anzahl von einer "Explosion" geredet werden kann, wird die Debatte u.a. mit der Prognose angefeuert, die seit 2000 in Deutschland und vergleichbaren Ländern geborenen Kinder könnten alle 100 Jahre alt werden - in 99 Jahren. Auch wenn natürlich niemand über deren Verlauf genügend Klarheit besitzt, kann und soll sich jeder vorstellen, was passiert, wenn diese 100-Jährigen alle krank und behandlungsbedürftig wären ….
Zu den auch nicht mehr so jungen Schrecken der Debatte über die gesundheitlichen Effekte der steigenden Lebenserwartung gehört die auf niedrigem Niveau kräftig zunehmende Anzahl von hochbetagten Menschen. Auch wenn im Moment nur wegen der geringen absoluten Anzahl von einer "Explosion" geredet werden kann, wird die Debatte u.a. mit der Prognose angefeuert, die seit 2000 in Deutschland und vergleichbaren Ländern geborenen Kinder könnten alle 100 Jahre alt werden - in 99 Jahren. Auch wenn natürlich niemand über deren Verlauf genügend Klarheit besitzt, kann und soll sich jeder vorstellen, was passiert, wenn diese 100-Jährigen alle krank und behandlungsbedürftig wären ….
Mehr Licht in die gesundheitlichen Verhältnisse der "oldest-old"- oder gar "supercentenarians"-(110- bis 119-Jährige) Bevölkerungsgruppe bringen seit einigen Jahren Demographen mit Hilfe von Register- und Surveydaten der Bevölkerung Dänemarks. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes und zum Teil eher entdramatisierendes Bild oder weisen auf die für eine rationalere politische Demographie-Debatte notwendigen differenzierten Sichtweisen und Methoden hin.
Eine zwischen 1998 und 2005 durchgeführte und 2008 veröffentlichte Längsschnittstudie aller 1905 in Dänemark geborenen Personen erhob für die 93- bis 100-Jährigen mit Standardinstrumenten (z.B. dem MiniMental State Examination Score) zu vier Zeitpunkten das Vorhandensein von Behinderungen und vor allem ihrer Unabhängigkeit.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörte
• der mäßige Rückgang des Anteils unabhängiger Personen in den vier Untersuchungsgruppen der 1905er-Kohorte von 38,9% auf 32,7% - mit einem Konfidenzintervall von 1% bis 14%,
• der deutlich größere Rückgang des Anteils unabhängiger "oldest-old" in der Gruppe der 1905 geborenen DänInnen, die an allen vier Messungen teilgenommen haben von 69,9% im Jahr 1997/98 auf 32,7% im Jahr 2005. Der Durchschnittswert des Verlustes an Unabhängigkeit bei den 2005 noch lebenden Kohortenmitgliedern betrug 37% und schwankte zwischen 28% und 46%.
• ähnlich sah es auch bei den anderen gemessenen Funktionsparametern aus.
Die etwas makabre aber politisch relevante Zweischneidigkeit dieser Ergebnisse fasst die international besetzte Forschergruppe so zusammen: "For the individual, long life brings an increasing risk of loss of independence. For society, mortality reductions are not expected to result in exceptional levels in cohorts of the very old."
Die Forscherinnen zeigen in ihrem kompakten Überblick über die weltweite Forschung zur Gesundheit von Hochbetagten, dass es dazu damals (und auch heute) noch keine abschließende Antwort gibt, und unterscheiden sich damit wohltuend von der selbstgewissen Krisen-Rhetorik zu diesem Thema.
In einer am 26. März 2013 veröffentlichten Studie wurden die Häufigkeit der Krankenhausaufenthalte, operativen Behandlungen sowie die stationäre oder nachoperative Sterblichkeit der Geburtsjahrgänge 1895 (N=12.326) und 2005 (N=15.477) zweier dänischer Bevölkerungskohorten im Lebensalter von 85 bis 99 Jahren verglichen. Auch hier wird die altersgesundheitliche Debatte eher durch dramatisch-negative Erwartungen und Prognosen geprägt.
Die Mischung aus erwarteten und unerwarteten Ergebnissen sieht so aus:
• Die Mitglieder der 1905er-Kohorte waren häufiger in stationärer Behandlung bzw. wurden häufiger im Krankenhaus operiert als die 1895er-Kohorte. Der Unterschied bewegte sich zwischen 2% und 17,2%.
• Die Krankenhauspatienten der 1905er Kohorte hatten vom 85. bis zum 99. Lebensjahr kürzere Liegezeiten als die der älteren Kohorte. Bei Männern waren die Krankenhausaufenthalte zwischen 1,6 und 3,6 Tagen kürzer und bei den Frauen zwischen 1,9 und 5,3 Tagen.
• Trotz mehr Krankenhausaufenthalten und Operationen gab es in der 1905er Kohorte keinen Anstieg der Krankenhaus- oder nachstationären Sterblichkeit. Hier gab es außerdem keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
• Die Autoren bewerten dieses differenzierte Geschehen als Ausdruck eines Abbaus altersspezifischer Ungleichheit bei der operativen Behandlung, einer besseren Gesundheit bzw. gesundheitlichen Robustheit der Angehörigen des Geburtsjahrgangs 1905 sowie von besser gewordenen anästhesistischen und operativen Fertigkeiten. In der nicht gestiegenen Sterblichkeit der stationär Behandelten sehen die Autoren auch einen Beleg dafür, dass nicht das Alter bzw. die traditionelle Absicht im Krankenhaus zu sterben, sondern der gesundheitliche Status und die Sicherheit von Operation und Behandlung der Hochbetagten Grundlage für die Einweisung oder Aufnahme ins Krankenhaus waren.
• Interessant, aber nicht weiter hinterfragt ist schließlich die Beobachtung, dass der Anteil dieser Altersgruppe, der zwischen dem 86. und 99. Lebensjahr und bis zum Tode zu Hause lebte, in der 1905er Kohorte für beide Geschlechter höher war als in der 1895er Kohorte.
Der Aufsatz Exceptional longevity does not result in excessive levels of disability von Kaare Christensen, Matt McGue, Inge Petersen, Bernard Jeune und James W. Vaupel ist am 9. September 2008 in den "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)" (vol. 105 no. 36) erschienen und kostenlos erhältlich.
Von dem am 23. März 2013 in der Fachzeitschrift "Age Ageing" erschienenen Aufsatz Changes in hospitalisation and surgical procedures among the oldest-old: a follow-up study of the entire Danish 1895 and 1905 cohorts from ages 85 to 99 years von Anna Oksuzyan, Bernard Jeune, Knud Juel, James W. Vaupel und Kaare Christensen, gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 29.3.13
Erhebliche Ungleichheit gesunder Lebensjahre in der EU27 - Deutschland auf Platz 23 und 24. Verbesserung möglich, aber aufwändig!
 In der Debatte über die Risiken der demografischen Alterung in entwickelten Gesellschaften spielt die Anzahl der gesunden Lebensjahre der dort geborenen Personen eine große Rolle. Je länger ein neugeborenes Kind in seinem künftigen Leben gesund lebt, desto besser ist seine Lebensqualität und desto geringer sind die diversen Folgen einer ungesund verbrachten längeren Lebenszeit.
In der Debatte über die Risiken der demografischen Alterung in entwickelten Gesellschaften spielt die Anzahl der gesunden Lebensjahre der dort geborenen Personen eine große Rolle. Je länger ein neugeborenes Kind in seinem künftigen Leben gesund lebt, desto besser ist seine Lebensqualität und desto geringer sind die diversen Folgen einer ungesund verbrachten längeren Lebenszeit.
Eine am 13. März im "European Journal of Public Health" veröffentlichte Studie über die derzeitige Anzahl gesunder Lebensjahre in den 27 EU-Mitgliedsländern, die dabei vorhandene Ungleichheit und die Bedeutung der heutigen Situation für das Jahr 2020, zeigt u.a. für Deutschland die tatsächlich enormen Gestaltungspotenziale einer als natürlich gegeben verstandenen Alterungssituation, aber auch die für ihre Nutzung notwendigen Anstrengung an.
Die wichtigsten aus Eurostat-Daten gewonnenen Kennziffern lauten:
• 2010 betrug die Anzahl der gesunden Lebensjahre für neugeborene Männer und Frauen in der EU27 61,3 und 61,9 Jahre.
• Die europaweite Ungleichheit beträgt bei Männern 17,5 und bei Frauen 18,9 Jahre.
• Spitzenreiter bei den gesunden Lebensjahren für Männer war 2010 Schweden (70,1 Jahre), Schlusslicht die Slowakei mit 52,6 Jahren). Auf dem fünftletzten Platz liegen die deutschen Männer mit 56,7 Jahren.
• Spitzenreiter bei den gesunden Lebensjahren für Frauen war 2010 Malta (71,5 Jahre), Schlusslicht auch hier die Slowakei mit 52,7 Jahren). Auf dem viertletzten Platz liegen die deutschen Frauen mit 57,8 Jahren.
• Sofern die bisherige Entwicklung bis 2020 anhält, steigen die gesunden Lebensjahre für Männer bis dahin um 1,4 und die der Frauen um 0,9 Jahre. Damit würde aber auch die Ungleichheit innerhalb der EU weiterwachsen.
• Wenn man diese Ungleichheit bis 2030 beseitigen will, bedeutet es für die Zeit bis 2020 dass die Anzahl der gesunden Lebensjahre EU-weit um 4,4 Jahre für Männer und 4,8 Jahre bei Frauen zunehmen müsste.
• Zutreffend ist die Anmerkung der Forschergruppe, dies würde für einige Länder eine enorme Anstrengung bedeuten. In Deutschland müsste die Anzahl gesunder Lebensjahre für Männer um 6,7 und für Frauen um 6,9 Jahre zunehmen.
• Strebt man das Ziel an, in 20 Jahren die Ungleichheitslücke beseitigen zu wollen, muss unter der Voraussetzung, dass die Zahl der ungesund verbrachten Jahre trotz steigender Lebenserwartung nicht ansteigt, die Zahl der gesunden Lebensjahre bis 2020 EU-weit um 5,8 (Männer) und 6,3 (Frauen) Jahre zunehmen. In Deutschland müssen dazu 8,1 und 8,4 gesunde Lebensjahre erreicht werden.
Wie die aktuellen Zahlen zeigen, steht die Anzahl der gesunden Lebensjahre in sozial vergleichbaren Ländern nicht unbeeinflussbar fest, sondern hängt so oder so von sozialen Lebensumständen ab. Insbesondere die Länder in der Schlusslichtgruppe, darunter besonders Deutschland, sollten sich statt den "Demografie-Blues" fortzusetzen sehr gründlich darüber informieren, mit welchen Maßnahmen und "Kulturen" es Länder in der Spitzengruppe geschafft haben, ihren EinwohnerInnen eine längere gesunde Lebensphase zu ermöglichen.
Der Aufsatz Mind the gap—reaching the European target of a 2-year increase in healthy life years in the next decade von Carol Jagger, Martin McKee, Kaare Christensen, Karolina Lagiewka, Wilma Nusselder, Herman Van Oyen, Emmanuelle Cambois, Bernard Jeune und Jean-Marie Robine ist am 13. März 2013 zuerst online im "European Journal of Public Health" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.3.13
Altersgemischte Teams: wirksamste Maßnahme die Beschäftigungsdauer älterer Arbeitnehmern bis zur Altersgrenze zu verlängern!
 In der Debatte über die Folgen des demografischen Umbaus und die Möglichkeiten sie abzumildern oder sie "uns leisten zu können", spielt der Erhalt und der Ausbau der Beschäftigung älterer Erwerbstätiger vor der heutigen Altersgrenze eine wichtige Rolle. Hier geht es also nicht um die Arbeit bis 67 oder gar 70 und auch nicht darum, dass manche Arbeitnehmer u.a. durch Arbeit gesundheitlich so beeinträchtigt sind, dass sie weder das 65. noch das 67. Lebensjahr arbeitend erreichen können. Aus Sicht des Gesundheitssystems tragen möglichst lange erwerbstätige ältere Personen einerseits länger und stärker zur Finanzierung der GKV und anderer Sozialversicherungsträger bei als Arbeitslose oder Frührentner. Da Erwerbstätigkeit auch Erwerbsfähigkeit und damit u.a. relative Gesundheit voraussetzt und im günstigen Fall erhält, trägt die Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen auch zur Senkung der laufenden Gesundheitsausgaben und vor allem auch zur Vermeidung eines Teils der künftigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder eines frühzeitigen Todes bei. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass z.B. aus gesundheitlichen Gründen frühpensionierten Arbeitnehmer auch nach ihrer Berentung eine wesentliche schlechtere Lebensqualität haben und früher sterben als normal pensionierte Personen. Und schließlich können im Zeichen des tatsächlichen oder vermeintlichen Fachkräftemangels ausgebildete und langjährig erfahrene Beschäftigte in besonderer Weise zur Arbeitsproduktivität von Unternehmen beitragen.
In der Debatte über die Folgen des demografischen Umbaus und die Möglichkeiten sie abzumildern oder sie "uns leisten zu können", spielt der Erhalt und der Ausbau der Beschäftigung älterer Erwerbstätiger vor der heutigen Altersgrenze eine wichtige Rolle. Hier geht es also nicht um die Arbeit bis 67 oder gar 70 und auch nicht darum, dass manche Arbeitnehmer u.a. durch Arbeit gesundheitlich so beeinträchtigt sind, dass sie weder das 65. noch das 67. Lebensjahr arbeitend erreichen können. Aus Sicht des Gesundheitssystems tragen möglichst lange erwerbstätige ältere Personen einerseits länger und stärker zur Finanzierung der GKV und anderer Sozialversicherungsträger bei als Arbeitslose oder Frührentner. Da Erwerbstätigkeit auch Erwerbsfähigkeit und damit u.a. relative Gesundheit voraussetzt und im günstigen Fall erhält, trägt die Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen auch zur Senkung der laufenden Gesundheitsausgaben und vor allem auch zur Vermeidung eines Teils der künftigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder eines frühzeitigen Todes bei. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass z.B. aus gesundheitlichen Gründen frühpensionierten Arbeitnehmer auch nach ihrer Berentung eine wesentliche schlechtere Lebensqualität haben und früher sterben als normal pensionierte Personen. Und schließlich können im Zeichen des tatsächlichen oder vermeintlichen Fachkräftemangels ausgebildete und langjährig erfahrene Beschäftigte in besonderer Weise zur Arbeitsproduktivität von Unternehmen beitragen.
So weit, so schön, aber auch gut, und wie schafft man dies? Auf diese Fragen gibt nun eine Ende 2012 veröffentlichte Studie des Mannheimer "Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)" eine Antwort. Das ZEW untersuchte die Wirkung verschiedener Maßnahmen mit Daten des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit zu Arbeitnehmern zwischen 40 und 65 Jahren aus dem Jahr 2002. Grundlage waren Angaben aus 1.063 westdeutschen Unternehmen, die mindestens fünf ältere Mitarbeiter beschäftigen.
Die Ergebnisse lauten im Einzelnen so:
• Nicht alle, sondern nur etwa die Hälfte der untersuchten Unternehmen boten ihren älteren ArbeitnehmerInnen mindestens eine Maßnahme an (so genannte "specific measures for older employees (SMOE)".
• 36% boten mit der Altersteilzeit die Möglichkeit an, bei möglichst bis zur normalen Altersgrenze verlängerter Vertragsdauer die Arbeitszeit zu reduzieren. 18% der Betriebe förderten altersgemischte Arbeitsteams aus älteren berufserfahrenen Arbeitnehmern und jüngeren Beschäftigten mit ihrem neueren Fachwissen und 17% boten allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen an.
• Altersgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes, verringerte allgemeine oder auch sehr spezifische Arbeitsanforderungen z.B. im physischen Bereich oder eine altersspezifische Weiterbildung wurden nur sehr selten, d.h. von 4%, 5% und 2% der Unternehmen angeboten. Für alle diese Maßnahmen gibt es seit Jahrzehnten aus der Forschung zur Humanisierung der Arbeitswelt genügend handfeste und modellhaft meist erprobte Maßnahmen. Der beobachtete Mangel ist also kein Wissensproblem.
• Die Wirkungen: In Betrieben, die Altersteilzeitregelungen anbieten, sind Beschäftigungsdauern bis zur heutigen Altersgrenze sogar kürzer als in anderen Betrieben. Nur in Betrieben mit altersgemischten Teams sind Beschäftigungsabgänge im Alter von 52 bis 64 Jahren durchgehend verringert, also die Beschäftigungsdauer länger. Für alle anderen SMOEs, also auch die Weiterbildung finden die ForscherInnen keinen Einfluss auf die Beschäftigungsdauer älterer ArbeitnehmerInnen. Dies kann allerdings auch daran liegen, dass die meisten dieser Maßnahmen zu selten angeboten werden.
Zuzustimmen ist den ZEW-Forschern, dass insbesondere mit personenbezogenen Methoden und Daten noch weitergeforscht werden muss. Warum ein Teil der Unternehmen gar keine Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer anbietet oder andere eventuell wirksame nur in geringem Umfang, ist aber keine Frage der Forschung, sondern der sozialen Verantwortung von Unternehmen und einer größeren Übereinstimmung des alarmistischen Diskurses über Alterungsfolgen mit der Bereitschaft selber etwas dagegen zu tun.
Das 40-seitige ZEW-Diskussionspapier Specific Measures for Older Employees and Late Career Employment, Boockmann von Bernhard, Jan Fries und Christian Göbel (ZEW Discussion Paper No. 12-059) ist komplett kostenlos in englischer Sprache erhältlich.
Bernard Braun, 14.3.13
Leben die alternden "baby boomer" in den USA länger und gesünder als ihre Väter? Ja und nein!
 Von 1946 bis 1964 wurden in den USA 78 Millionen Kinder geboren, die unter der Bezeichnung "baby boomer" 2010 26,1 der US-Bevölkerung stellten. Da auch in den USA die nachfolgenden Geburtsjahrgänge geringer besetzt sind und die "baby boomers" auch eine längere Lebenserwartung als ihre Eltern haben werden, wird dieser Anteil zukünftig noch zunehmen. Und zunehmen wird außerdem der Einfluss ihrer Gesundheit auf den künftigen Versorgungsbedarf und die Finanzierbarkeit des US-Gesundheitssystems. Je nachdem, wie gesund die "baby boomer" in das Rentenalter und damit in den meist gesundheitlich aufwändigeren Lebensabschnitt kommen, desto positiver oder negativer wird dieser Einfluss werden.
Von 1946 bis 1964 wurden in den USA 78 Millionen Kinder geboren, die unter der Bezeichnung "baby boomer" 2010 26,1 der US-Bevölkerung stellten. Da auch in den USA die nachfolgenden Geburtsjahrgänge geringer besetzt sind und die "baby boomers" auch eine längere Lebenserwartung als ihre Eltern haben werden, wird dieser Anteil zukünftig noch zunehmen. Und zunehmen wird außerdem der Einfluss ihrer Gesundheit auf den künftigen Versorgungsbedarf und die Finanzierbarkeit des US-Gesundheitssystems. Je nachdem, wie gesund die "baby boomer" in das Rentenalter und damit in den meist gesundheitlich aufwändigeren Lebensabschnitt kommen, desto positiver oder negativer wird dieser Einfluss werden.
Eine WissenschaftlerInnengruppe hat nun durch einen Vergleich der Daten für die Jahre 1988 bis 1994 und 2007 bis 2010 (Baby-Boomer-Generation) für die in diesen Zeiträumen jeweils 46- bis 64-jährigen Befragten aus dem "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)" folgendes herausgefunden:
• Die Lebenserwartung stieg zwischen den beiden Untersuchungszeiträumen deutlich an, d.h. die Baby-Boomer-Kohorte lebt länger.
• Bei sehr ähnlicher soziodemografischer Zusammensetzung sagten statistisch signifikant weniger, nämlich 13,2% der Baby-Boomer, ihr Gesundheitszustand sei exzellent, als es die Generation davor im selben Lebensalter gesagt hatten, nämlich 32%.
• Ein jeweils signifikant höherer Anteil der Baby-Boomer benötigte eine Gehhilfe (6,9% versus 3,3%), war eingeschränkt arbeitsfähig (13,8% versus 10,1%) oder hatte eine funktionale Beeinträchtigung (13,5% versus 8,8%).
• Ebenfalls signifikant höher war der Anteil der übergewichtigen Baby-Boomer (38,7% versus 29,4%).
• Auch bei einer Reihe von Lebensstil- und Gesundheitsverhaltensfaktoren (z.B. regelmäßige Bewegung, mäßiger Alkoholkonsum, Rauchen) waren die Baby-Boomer weniger aktiv oder verhielten sich ungesünder.
• Auch wenn die Veränderungen in der soziodemografischen Charakteristik der beiden Kohorten in einer multivariaten Analyse berücksichtigt wurden, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Baby-Boomer diabeteskrank waren, einen zu hohen Blutdruck oder Cholesterinspiegel hatten signifikant höher als in der vorherigen Generation.
• Besser war die gesundheitliche Situation der Baby-Boomer aber bei Emphysemen und Herzinfarkten. Außerdem rauchten sie weniger als ihre Mütter und Väter.
Die Hoffnung, dass die längere Lebenserwartung der Baby-Boomer-Generation ohne weitere Anstrengung eine höhere Anzahl gesunder Jahre mit sich bringe, muss nach den Ergebnissen dieses Kohortenvergleichs erheblich reduziert werden. Stattdessen sehen die WissenschaftlerInnen die Notwendigkeit so früh wie noch möglich Präventionsprogramme und Gesundheitsförderungsangebote für die Baby-Boomer-Generation zu entwickeln und anzubieten.
Die Ergebnisse sollten einerseits Anlass sein, die gesundheitliche Entwicklung und das Gesundheitsverhalten dieser Generation systematisch weiter zu untersuchen. Andererseits müssen sie in der weltweit geführten und gesundheitspolitisch enorm wichtigen Debatte über die gesundheitlichen Bedingungen oder Folgen der demografischen Alterung mitberücksichtigt werden.
Ob es solche unerwarteten intergenerationellen Veränderungen auch in Deutschland gibt, ist aktuell mangels entsprechender Untersuchungen weder zu bestätigen noch zu verwerfen.
Die als "research letter" am 1. Februar 2013 "online first" veröffentlichte Studie "The Status of Baby Boomers' Health in the United States: The Healthiest Generation?" von Dana E. King et al. ist in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.2.13
Lebenserwartung und Anzahl der gesunden Lebensjahre nehmen von 1990 bis 2010 zu - mit Unterschieden und Anregungen zum Nachdenken
 500 ForscherInnen aus 300 Forschungseinrichtungen in 50 Ländern berichten u.a. über 291 Krankheiten in 21 weltweiten Regionen, in 20 Altersgruppen, bewerten 67 Risikofaktoren und vergleichen mit dafür geeigneten Indikatoren, Maßen und Instrumenten die Verhältnisse im Jahr 2010 mit denen des Jahres 1990. Alles zusammen genommen ist dies die "Global Burden Disease (GBD) Study" 2010.
500 ForscherInnen aus 300 Forschungseinrichtungen in 50 Ländern berichten u.a. über 291 Krankheiten in 21 weltweiten Regionen, in 20 Altersgruppen, bewerten 67 Risikofaktoren und vergleichen mit dafür geeigneten Indikatoren, Maßen und Instrumenten die Verhältnisse im Jahr 2010 mit denen des Jahres 1990. Alles zusammen genommen ist dies die "Global Burden Disease (GBD) Study" 2010.
Wer sich über die Geschichte der GBD noch etwas ausführlicher informieren will, kann dies in dem "Lancet"-Aufsatz "The story of GBD 2010: a "super-human" effort" (Volume 380, issue 9859: 2067-2070) kostenlos tun.
Ansonsten ist in der Ausgabe des renommierten Medizinjournals "The Lancet" vom 15. Dezember 2012 eine Vielzahl von Ergebnissen veröffentlicht worden. Dazu zählen folgende Aufsätze: "Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the Global Burden of Disease Study 2010", "Healthy life expectancy for 187 countries, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010", "Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010" und "A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010."
Die Ergebnisse zu der Anzahl von Lebensjahren in Gesundheit bei steigender Lebenserwartung ("healthy life expectancy (HALE)"), einer der Dreh- und Angelpunkte der Demografiedebatte, sollen hier etwas ausführlicher vorgestellt werden:
• Mit einer aufwändigen und einheitlichen Methodik (dies schließt unterschiedliche Datenqualität nicht aus)legen die Autoren für 187 Länder Daten zur Verlängerung der Lebenserwartung und zum Umfang der gesunden Lebensjahre in den Jahren 1990 und 2010 vor. Sie schätzen dabei den Einfluss der in den letzten 20 Jahren geänderten Kinder- und Erwachsenensterblichkeit und von Behinderung auf die Gesamtveränderung der Bevölkerungsgesundheit.
• Die Anzahl der bei der Geburt zu erwartenden gesunden Lebensjahre betrug für alle Männer weltweit 1990 54,4 Jahre und stieg 2010 auf 58,3 Jahre. Bei Frauen waren es 57,8 und 61,8 Jahre. Ein 60-jähriger Mann hatte noch 12,3 bzw. 13,4 gesunde Jahre vor sich. Bei Frauen waren es 14,1 und 15,2 Jahre.
• In Deutschland stieg nach den GBD-Daten die Lebenserwartung der Männer zwischen 1990 und 2010 bei Geburt von 71,9 auf 77,5 Jahre. Die Anzahl der gesunden Lebensjahre stieg von 62,3 auf 65,8 Jahre.
• Einem Jahr zusätzlicher Lebenszeit ab Geburt steht 2010 für Männer im Durchschnitt aller Länder ein Zuwachs gesunder Lebenszeit von 0,84 Jahren gegenüber (für Frauen 0,81 Jahre). Die Lücke zwischen der künftigen Lebenserwartung und den noch bevorstehenden gesunden Lebensjahren wird mit steigendem Lebensalter größer. Ein Jahr längeres Leben führt bei 50-jährigen Männern zu 0,62 gesunden Jahren (bei Frauen sind dies 0,56 Jahre). Obwohl also gewonnene Lebensjahre keineswegs komplett in Krankheit verbrachte Lebensjahre sind, Altern zum größten Teil in "Gesundheit altern" bedeutet, wird ein Teil der gewonnenen Lebensjahre in Krankheit und Behinderung verbracht bzw. führt zu einer Zunahme von Morbidität. Zu der Anzahl der in Krankheit oder Behinderung verbrachten Lebensjahre ("years lived with disability (YLD)") tragen insbesondere psychische und verhaltensbezogene Erkrankungen wie Depressionen, Angst oder die Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch bei.
• Für die Debatte darüber, ob es bei einer Verlängerung der Lebenserwartung eine Expansion oder eine Kompression von Morbidität gibt, bedeutet dies zweierlei: Es gibt sowohl Evidenz für eine leichte bis moderate Zunahme von Morbidität in Gestalt der krank oder behindert verbrachten Lebensjahre bei hinausgeschobener Mortalität als auch dafür, dass der Großteil der gewonnenen Lebensjahre in Gesundheit gelebt werden können, potenzielle altersassoziierte Morbidität also ins höhere Lebensalter verschoben wird. Die mit den Daten möglichen internationalen Vergleiche zeigen aber auch, dass es sich hierbei keineswegs um ein rein naturbedingtes, sondern um ein stark sozial bedingtes und damit im Prinzip auch um ein durch Prävention oder Sozialkapital beeinflussbares Geschehen handelt. Die Autoren der GBD-Studie fassen dies so zusammen: "Although we report clear evidence of expansion of morbidity, we also show substantial variation among countries in age-specific YLD per person. For people aged younger than 1 year, the highest levels exceed the lowest by 4,9 to 12,4. Even in people aged older than 50 years, for whom disability rates are higher, YLD per person vary by a factor of 1,6 to 2,2 among countries. Although we might expect that addition of marginal years of life through reduction of mortality will be associated with more years lost because of morbidity and disability, there is clearly scope for healthier ageing. To achieve real compression of the total disability in a population, healthy life expectancy would need to increase faster than life expectancy at birth. Although this goal is ambitious, enormous potential exists for making substantial progress. If all countries could achieve the disability rates similar to countries such as Japan, healthy life expectancy would increase substantially and would probably be accompanied by reductions in costs of managing disease and injury sequelae. The potential for healthier ageing, and for reduction of YLD, is supported by several studies of socioeconomic variations in healthy life expectancy in high-income countries."
• Die gerade angesprochenen Länderunterschiede sind enorm: Während 2010 japanische Männer 68,8 und japanische Frauen ab Geburt 71,7 gesunde Lebensjahre zu erwarten haben, und damit weltweit Platz 1 einnehmen, betragen die entsprechenden Werte in Haiti 27,9 und 37,1 Jahre, was den Schluss-Platz 187 bedeutet. Entsprechend haben 2010 Männer in Haiti aber auch nur eine durchschnittliche Lebenserwartung von 32,5 und Frauen von 37,1 Jahren, also Werte, die es in Europa seit Jahrhunderten nicht mehr gibt.
• Deutschland befindet sich im Übrigen weder 1990 noch 2010 unter den 10 Ländern mit der höchsten Anzahl gesunder Lebensjahre.
Der Aufsatz schließt mit einer Reihe (selbst-)kritischer Anmerkungen zur Güte und Messbarkeit der Indikatoren in unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Die Autoren erklären außerdem die Absicht regelmäßiger und häufiger Analysen zur weltweiten Lebenserwartung und zur Erwartung gesunder Lebensjahre vorzulegen. Außerdem beabsichtigen sie, zusätzliche Analysen über die Einflussfaktoren auf das Krankheitsgeschehen und die Veränderungen der gesunden Lebensjahre zu erstellen.
Eine Übersicht über den Inhalt dieses "Lancet"-Themenheftes mit Links zu den Abstracts der einzelnen Aufsätze steht kostenlos zur Verfügung.
Zu dem materialreichen Aufsatz "Healthy life expectancy for 187 countries, 1990—2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010" von Joshua A Salomon, Haidong Wang, Michael K Freeman, Theo Vos, Abraham D Flaxman, Alan D Lopez, Christopher JL Murray (The Lancet, Volume 380, Issue 9859, Pages 2144 - 2162) gibt es ohne zusätzlichen Aufwand leider nur ein Abstract kostenlos. Durch eine kostenlose und auch hinsichtlich unerwünschter Werbung folgenlose Anmeldung als User auf der Lancet-Website bekommt man aber für diesen und manch anderen Aufsatz im "Lancet" kostenlosen Zugang zum gesamten Text.
Bernard Braun, 18.12.12
"IAB-Regional"-Bericht Altenpflege 2030 in Deutsch-Südwest: Wie rechnet man sich einen bedrohlichen Pflegebedarf zurecht!?
 Die Anzahl, der Qualifikationsmix und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte in Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten und stationären Einrichtungen der Altenpflege reichen mit Sicherheit weder heute noch in der weiteren Zukunft aus, um alle PatientInnen und Pflegebedürftigen bedarfsgerecht, wirksam, human und wirtschaftlich zu pflegen. Dies genau zu quantifizieren ist sozialpolitisch wichtig und berechtigt.
Die Anzahl, der Qualifikationsmix und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte in Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten und stationären Einrichtungen der Altenpflege reichen mit Sicherheit weder heute noch in der weiteren Zukunft aus, um alle PatientInnen und Pflegebedürftigen bedarfsgerecht, wirksam, human und wirtschaftlich zu pflegen. Dies genau zu quantifizieren ist sozialpolitisch wichtig und berechtigt.
Dazu trägt auch der gerade in der Reihe "IAB-Regional" erschienene Bericht 3/2012 zum zukünftigen Bedarf an Arbeitskräften im Bereich der Altenpflege in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis zum Jahr 2030 bei.
Auf der Basis des so genannten Status quo-Szenarios der weiteren demografischen und Pflegeentwicklung prognostizieren die Autoren zunächst folgende Veränderungen im Pflegebereich:
• Einen "Anstieg der Pflegebedürftigen von derzeit 105.800 auf bis zu 149.000 im Jahr 2030 in Rheinland-Pfalz und von gegenwärtig 30.400 auf bis zu 40.000 im Saarland."
• "Voraussichtlich (wird) die professionelle Pflege weiter an Bedeutung gewinnen, d. h. sowohl die Versorgung durch ambulante Pflegedienste als auch die Unterbringung in stationären Einrichtungen. Die Modellrechnungen zeigen für Rheinland-Pfalz, dass sich der Bedarf an Pflegearbeitskräften von heute rund 26.500 Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenten) auf 35.400 (starkes Engagement der Angehörigen und technischer Fortschritt in der Pflege) bis zu 48.300 (schwaches Engagement der Angehörigen und kein technischer Fortschritt in der Pflege) bis 2030 erhöhen könnte. Im Saarland ergibt sich ausgehend vom heutigen Bestand von 7.900 Arbeitskräften (in Vollzeitäquivalenten) im günstigsten Fall im Bereich der Altenpflege nur ein zukünftiger Bedarf von 9.900, sofern Produktivitätsfortschritte mit Effizienzgewinnen und eine hohe Versorgungsbereitschaft durch Angehörige gegeben sind. Oder, sofern Produktivitätsfortschritte ausbleiben und die Beteiligung von Angehörigen in der Pflege zurückgeht, werden im Bereich der Altenpflege an der Saar in 2030 13.000 Personen (in Vollzeitäquivalenten) erforderlich, um die Versorgung der Pflegebedürftigen zu ermöglichen.
• Dass die gesamte Weiterentwicklung "nicht nur vom Engagement der pflegenden Angehörigen sowie von Produktivitätsfortschritten in der Pflege" abhängt, "sondern auch von den Kosten für professionelle Pflegedienstleistungen" und der Höhe der "Verdienstmöglichkeiten im Pflegebereich" als Anreiz für Berufssuchende, sich für den Pflegebereich zu entscheiden, ist ein wichtiger Hinweis der Mitarbeiter des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit in den beiden Ländern und NRW.
Doch auch trotz der beabsichtigten differenzierten Prognose legen die Autoren wichtige Argumente und Faktoren entweder gar nicht auf den Tisch oder "begraben" sie nach kurzer Betrachtung unter ihm. So werden Mythen gemacht!
Als erstes erwecken auch sie den Eindruck, man könne gerade die Entwicklung der Nachfrage nach Pflege und des Angebots von Pflegekräften wirklich exakt für die nächsten 20 Jahre prognostizieren. Die zahllosen Fehlprognosen über die Entwicklung des Sozial- und Gesundheitsbereich in den letzten 30-40 Jahre und das oft für unmöglich oder undenkbar gehaltene Auftreten von Innovations- und Produktivitätsschüben, sollten solche Gewissheiten eigentlich verbieten.
Die Autoren weisen dann zwar selber auf die mögliche Einseitigkeit ihrer Annahmen über die zukünftige Nachfrage nach Pflegeleistungen und Pflegekräften hin, berücksichtigen die erwähnten Alternativannahmen bei ihren Berechnungen aber komplett nicht: "Diesem Szenario liegt die Annahme zugrunde, dass es zukünftig keine Verbesserungen im Gesundheitszustand der älteren Menschen gibt, z. B. durch präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen, Verhaltensänderungen und/oder durch bessere Behandlungsmöglichkeiten. … Diese Status-Quo-Hypothese basiert auf der Annahme, dass die Prävalenz der Pflegebedürftigkeit im Zeitablauf unverändert bleibt, obwohl sich die Lebenserwartung verlängert. Der Umfang, in welchem zukünftig Pflegeleistungen in Anspruch genommen werden, würde sich entsprechend der gegenwärtigen Struktur der Prävalenz verändern. Die Nachfrage nach Pflegeleistungen wächst nach dieser These daher nur, weil zukünftig ein höherer Bevölkerungsanteil auf die obersten Altersklassen entfällt. Diese Status-Quo-Hypothese ist nicht unumstritten, da bis dato nicht endgültig geklärt wurde, ob die altersspezifische Prävalenz in Zukunft tatsächlich unverändert bleibt … ." Wer danach Worte oder Zahlen sucht, die belegen was eine längere Lebenserwartung bei sich verbessernder Gesundheit und Pflegebedürftigkeit, d.h. die so genannte Kompressionshypothese oder eine Verbesserung der bei vielen Pflegeanlässen (z.B. Demenz) hilfreichen Rehabilitationsangebote ("Rehabilitation vor Pflege") für die künftige Nachfrage nach Pflegekräften in den beiden Bundesländern praktisch bedeutet, sucht vergeblich.
Der 42-seitige Bericht "Der zukünftige Bedarf an Arbeitskräften im Bereich der Altenpflege in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Modellrechnungen für die Länder bis zum Jahr 2030. von Anne Otto und Carsten Pohl ist 2012 in der Reihe "IAB-Regional. Berichte und Analysen aus dem Regionalen Forschungsnetz. IAB Rheinland-Pfalz-Saarland", erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.11.12
Was tun Betriebe um die sozialen Folgen des "drohenden" Mangels an leistungsfähigen Erwerbstätigen zu verhindern? 2011: zu wenig!
 Der zukünftig "drohende" wachsende Anteil älterer, leistungsgeminderter aber wirtschaftlich immer wichtiger werdenden Arbeitskräfte und der "Fachkräftemangel" beherrschen seit geraumer Zeit die Schlagzeilen mancher beschäftigungs- und gesundheitspolitischen Debatten. Ohne mehr qualifizierte, gesunde und bis zum gesetzlichen Rentenalter leistungsfähigen Beschäftigten scheint der Wohlstand in Deutschland massiv gefährdet.
Der zukünftig "drohende" wachsende Anteil älterer, leistungsgeminderter aber wirtschaftlich immer wichtiger werdenden Arbeitskräfte und der "Fachkräftemangel" beherrschen seit geraumer Zeit die Schlagzeilen mancher beschäftigungs- und gesundheitspolitischen Debatten. Ohne mehr qualifizierte, gesunde und bis zum gesetzlichen Rentenalter leistungsfähigen Beschäftigten scheint der Wohlstand in Deutschland massiv gefährdet.
Was von diesen Erwartungen zu halten ist bzw. wie ernst sie von ihren Verkündern genommen und praktisch angepackt werden, zeigt nun schlaglichtartig ein 2012 veröffentlichter Forschungsbericht des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit.
Dessen Ergebnisse stammen aus dem IAB-Betriebspanel, in dem 15.283 repräsentative Betriebe regelmäßig zu wichtigen Aspekten ihrer Betriebsstruktur und -politik befragt werden.
Danach werden zumindest im Jahr 2011 ältere ArbeitnehmerInnen in den 15.036 Betrieben, die ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigen, kaum bzw. speziell gefördert:
• So wurden von den Älteren deutschlandweit 9% in die allgemeine betriebliche Weiterbildung einbezogen. Spezielle Weiterbildung für Ältere bot nur 1% aller Betriebe mit MitarbeiterInnen dieses Alters an. Individuell angepasste Leistungs- und Arbeitsanforderungen wurden in 4% der Betriebe angeboten. In Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bezogen nur 4% aller Betriebe ältere MitarbeiterInnen ein. Altersgemischte Teams, eine immer wieder als wirksam nachgewiesene Maßnahme, gab es in 6% der Betriebe.
• Selbst den beim Angebot betrieblicher Gesundheitsförderung für ältere Beschäftigte führenden Branchen Bergbau und öffentliche Verwaltung sind hier nur 12% bzw. 21% der Betriebe aktiv.
• Die AutorInnen des Berichts heben außerdem Folgendes hervor: "Entgegen den Erwartungen bieten Betriebe mit einer eher älteren Belegschaft Maßnahmen für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer nicht häufiger an als andere Betriebe. … Der unerwartet geringe durchschnittliche Anteil von Maßnahmebetrieben bei Betrieben mit einer eher älteren Belegschaft hängt mit dem fast völligen Fehlen solcher Maßnahmen bei Kleinstbetrieben zusammen. Gerade bei den Kleinstbetrieben gibt es einen relativ hohen Anteil an Betrieben mit einer eher älteren Belegschaft."
• Ihr Fazit zu diesem Bereich lautet daher: "Die deutliche Veränderung der Beschäftigtenstruktur hin zu einem höheren Anteil älterer Arbeitnehmer scheint (noch) keine nennenswerten personalpolitischen Probleme generiert zu haben. Andernfalls müsste ein deutlich höherer Anteil von Betrieben altersspezifische Aktivitäten durchführen. Den Betrieben ist es offensichtlich auch ohne spezifische Maßnahmen gelungen, ihren betrieblichen Alltag mit älter gewordenen Belegschaften zu meistern. Dies wirft die Frage auf, ob die Befürchtungen der letzten Jahre möglicherweise übertrieben waren. Es könnte jedoch auch sein, dass durch die noch sehr verhaltene Praxis Hypotheken aufgebaut werden, die später von den betroffenen Arbeitnehmern eingelöst werden müssen - z. B. in Form von gesundheitlichen Folgeschäden (und damit verbundenen Belastungen der Sozialsysteme)."
• Generell stellen die VerfasserInnen aber schließlich auch noch fest, dass "die vorliegenden Ergebnisse … insgesamt auf einen eher mäßigen Problemdruck durch unbesetzte Fachkräftestellen hin(deuten). Insgesamt ist die Nachfrage nach Fachkräften und damit einhergehend der Umfang unbesetzter Fachkräftestellen 2011 stark angestiegen. Im Zeitverlauf sind das aktuell aber doch stark konjunkturabhängige Größen."
Die insgesamt informativen und lesenswerten 107 Seiten des "IAB-Forschungsbericht 13/2012" "Fachkräfte und unbesetzte Stellen in einer alternden Gesellschaft. Problemlagen und betriebliche Reaktionen" von Sebastian Bechmann, Vera Dahms, Nikolai Tschersich, Marek Frei, Ute Leber und Barbara Schwengler sind komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.12
Gesundheitsversorgung für ältere Bürger muss nicht unvermeidbar "zu teuer" sein. Pro-Kopfausgaben in den USA und Kanada 1980-2009
 Die oftmals dramatisch zugespitzten Prognosen oder Annahmen über die wachsende Anzahl möglicherweise gleich kranker oder sogar kränkerer Personen im Rentenalter, weisen häufig auf die Unfinanzierbarkeit der künftigen Ausgaben zur gesundheitlichen Versorgung älterer Menschen hin. In der dazu geführten Krisen-Debatte wird von politischer aber auch wissenschaftlicher Seite mit wachsender Intensität auf die wachsende und langsam "unerträglich" werdende Diskrepanz zwischen den Beiträgen der alten Menschen und den von ihnen benötigten Ausgabebeträgen hingewiesen. Dass der intergenerative Solidarausgleich ein von der Mehrheit der Bevölkerung und der Nettozahler als gerecht bewertetes Kernstück z.B. des deutschen Sozialstaats ist, wird dabei verschwiegen. Angedeutet wird aber immer öfter, dass Teile dieser "Last" demnach von den Älteren selbst privat finanziert werden müssten. Was dabei meist als gesetzt oder für unerschütterlich gehalten wird, ist das altersbedingte und damit unvermeidbare Niveau der Ausgaben.
Die oftmals dramatisch zugespitzten Prognosen oder Annahmen über die wachsende Anzahl möglicherweise gleich kranker oder sogar kränkerer Personen im Rentenalter, weisen häufig auf die Unfinanzierbarkeit der künftigen Ausgaben zur gesundheitlichen Versorgung älterer Menschen hin. In der dazu geführten Krisen-Debatte wird von politischer aber auch wissenschaftlicher Seite mit wachsender Intensität auf die wachsende und langsam "unerträglich" werdende Diskrepanz zwischen den Beiträgen der alten Menschen und den von ihnen benötigten Ausgabebeträgen hingewiesen. Dass der intergenerative Solidarausgleich ein von der Mehrheit der Bevölkerung und der Nettozahler als gerecht bewertetes Kernstück z.B. des deutschen Sozialstaats ist, wird dabei verschwiegen. Angedeutet wird aber immer öfter, dass Teile dieser "Last" demnach von den Älteren selbst privat finanziert werden müssten. Was dabei meist als gesetzt oder für unerschütterlich gehalten wird, ist das altersbedingte und damit unvermeidbare Niveau der Ausgaben.
Dass dies nicht so eindeutig und dramatisch ist, zeigten bereits früher internationale Vergleiche, in denen der Anteil der Gesundheitsausgaben für die Gruppe der älteren Bevölkerung enorme Unterschiede aufwies. Länder mit einem höheren Anteil älterer Personen gaben z.B. einen geringeren Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts oder ihrer gesamten Gesundheitsausgaben für diese Bevölkerungsgruppe aus als manche Länder mit kleinerem Altenanteil. Offensichtlich hing der Umfang der Ausgaben nicht (allein) vom Alter, sondern maßgeblich von den unterschiedlichen Bedarfen an gesundheitlicher Versorgung, den unterschiedlichen Leistungsvolumina und nicht zuletzt von den unterschiedlichen Leistungspreisen ab.
Eine für das Jahr 2007 durchgeführte Analyse der altersabhängigen Gesundheitsausgaben in 20 OECD-Ländern durch eine Autorengruppe des "Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP)" bestätigt dies aus einer anderen Perspektive: "Das amerikanische Gesundheitswesen wäre um 132,27 % teurer als das deutsche, hätte es das deutsche Gesundheitswesen mit den deutschen altersabhängigen Gesundheitsausgaben. Das niederländische Gesundheitssystem wäre bei Anwendung der deutschen Profile um 15,49 % ausgabenintensiver. Das portugiesische Gesundheitswesen wäre dagegen um 37,38 % weniger ausgabenintensiv, hätte es die deutschen Profile."
Zu welchen gewaltigen Unterschieden der Gesundheitsausgaben pro Kopf von Personen über 64 Jahren es im Laufe der Zeit kommen kann, zeigt nun für die Jahre 1980 bis 2009 eine am 29. Oktober 2012 als "Research Letter" in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlichte vergleichende Analyse der us-amerikanischen und kanadischen Verhältnisse durch die US-Gesundheitswissenschaftler David Himmelstein und Steffie Woolhandler.
Noch bis zur Mitte der 1960er Jahre waren die Gesundheitsausgaben für die in beiden Staaten in Medicare-Systemen krankenversicherten 64+-BürgerInnen vergleichbar hoch. Seitdem entwickelten sich diese Ausgaben deutlich auseinander.
Die Stärke dieser Entwicklung sieht nach der Analyse offizieller Daten aus Kanada und den USA so aus:
• Die durchschnittlichen absoluten jährlichen Pro-Kopfausgaben von Medicare (das ist die staatliche Krankenversicherung für 64+-BürgerInnen) stiegen von 1.215 US-Dollar im Jahr 1980 auf 9.446 US-Dollar im Jahr 2009.
• In Kanada wuchs dieser Betrag innerhalb des nationalen Gesundheitsversorgungssystems von 2.141 US-$ in 1980 auf 9.2.92 US-$. Der höhere Ausgangswert ist laut dem Autorenteam durch die umfassendere Versorgung in Kanada bedingt, die rund 80% der gesamten Gesundheitskosten der älteren Personen übernahm. In den USA betrug dieser Anteil bei Medicare-Versicherten nure rund 50%.
• Nach einer Inflationsbereinigung ergibt sich in den USA für den Zeitraum 1980-2009 ein Wachstum der Pro-Kopfausgaben für Ältere von 198,7%. In Kanada war es dagegen ein Wachstum um 73%. Die Ausgaben in den USA waren also fast dreimal so schnell angestiegen als in Kanada.
• Diese Unterschiede zeigen sich auch bei einzelnen Leistungsarten. So wuchsen die Ausgaben für ärztliche Leistungen in den untersuchten Jahren in Kanada um 100,7%, aber in den USA um 274,3%. Die Autoren vermuten als Ursache den deutlich größeren Anteil von Primärärzten in Kanada (51% zu 32% in den USA).
• Mit den bereits seit 1971 vorliegenden Kostendaten berechneten die Autoren den Anstieg der Kosten in beiden Staaten zwischen 1971 und 2009. Er betrug in den USA 374,1% und in Kanada 126,3%.
• Wären die Medicareausgaben für ältere Versicherte ceteris paribus so angestiegen wie in Kanada, hätte die US-Versicherung 2009 nicht ein Defizit von 17,1 Milliarden US-$ gehabt, sondern einen Überschuss von 32,3 Milliarden US-$.
• Schließlich betonen die Autoren auch noch, dass die niedrigeren Ausgaben für ältere Kanadier keinen gesundheitlichen Nachteil für sie bedeutet: Die Lebenserwartung als ein verhältnismäßig harter Indikator ist in Kanada höher und seit 1971 und 1980 auch deutlich schneller angestiegen als in den USA. Eine 2007 veröffentlichte Meta-Analyse von Studien über den gesamten gesundheitlichen Outcome für alle Versicherten oder Patienten in beiden Systemen, hatte gezeigt, dass eine ganze Reihe klinischer Outcomes für die kanadischen Versicherten oder Patienten auch noch besser sind als für versicherte US-Amerikaner. Es gab dort aber auch umgekehrte oder inkonsistente Ergebnisse (siehe dazu den komplett kostenlos erhältlichen Aufsatz von Guyatt/Devereaux et al. 2007: A systematic review of studies comparing health outcomes in Canada and the United States. In: Open Medicine, Vol 1, No 1).
Als Erklärungen stellen die beiden US-Forscher u.a. die deutlich niedrigeren administrativen Kosten im kanadischen System (16,7% zu 31%), die prospektiven globalen Budgets in den kanadischen Krankenhäusern und ein in diesen Einrichtungen etabliertes System, das kostentreibende Aktivitäten wie systematisches Up-Coding oder die Überversorgung mit monetär lukrativen Dienstleistungen verhindern soll bzw. verhindert. Außerdem sind die Ausgaben für Behandlungsfehler etc. in Kanada wesentlich geringer als in den USA. Praktisch alle dieser Faktoren sind sozial- und gesundheitspolitisch beeinflussbar und damit auch die Höhe und Dynamik der Gesundheitsausgaben für ältere und andere Krankenversicherte und Patienten.
Anstatt apokalyptischen und apodiktisch pessimistischen Befürchtungen über die Ausgabenlasten für ältere Krankenversicherte sollte daher auch in Deutschland über die konkrete Beeinflussbarkeit dieser Effekte unter den hierzulande existierenden sozialen und versorgungspolitischen Rahmenbedingungen nachgedacht werden.
Der zwei Seiten umfassende "Research Letter" "Cost Control in a Parallel Universe: Medicare Spending in the United States and Canada" von David U. Himmelstein und Steffie Woolhandler ist in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" am 29. Oktober 2012 "Online First" erschienen und im Moment noch komplett kostenlos erhältlich.
Die bereits im Jahr 2009 veröffentlichte Untersuchung des WIP, "Deutschland - ein im internationalen Vergleich teures Gesundheitswesen?" von Frank Niehaus und Verena Finkenstädt (WIP-Diskussionspapier 12/09) ist kostenlos erhältlich und enthält auch noch weitere interessante und keineswegs PKV-lastige Zahlen zur Titelfrage.
Bernard Braun, 1.11.12
Ist die Entwicklung von Demenz wirklich nicht oder nicht ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu verlangsamen?
 Das regelmäßige Angebot einer nichtmedikamentösen komplexen Behandlung kann die Entwicklung milder bis mäßiger und schwerer Demenz bei einer Personengruppe verlangsamen, die für die BewohnerInnen von Pflegeheimen repräsentativ ist. Dabei werden ihre kognitiven Funktionen und ihre Fähigkeiten für Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) positiv beeinflusst. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer einjährigen randomisierten, kontrollierten und für die 98 TeilnehmerInnen verblindeten Verlaufsstudie in 5 bayrischen Pflegeheimen.
Das regelmäßige Angebot einer nichtmedikamentösen komplexen Behandlung kann die Entwicklung milder bis mäßiger und schwerer Demenz bei einer Personengruppe verlangsamen, die für die BewohnerInnen von Pflegeheimen repräsentativ ist. Dabei werden ihre kognitiven Funktionen und ihre Fähigkeiten für Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) positiv beeinflusst. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer einjährigen randomisierten, kontrollierten und für die 98 TeilnehmerInnen verblindeten Verlaufsstudie in 5 bayrischen Pflegeheimen.
Solange es keine wirksame ursächliche Behandlung oder Prävention der degenerativen Demenz gibt, gilt das Hauptaugenmerk pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Interventionen, die den Erkrankungsprozess verlangsamen. Eine Reihe von so genannten Acetylcholinesterase-Präparaten ist zur symptomatischen Behandlung der Alzheimererkrankung als der häufigsten Form von Demenz zugelassen und sie erweisen sich zum Teil auch als wirksam. Wegen der letztlich doch geringen oder nur bei milden Erkrankungsformen spürbaren Wirksamkeit und der Fülle von dosisabhängigen unerwünschten Wirkungen, werden seit einiger Zeit nichtmedikamentöse Behandlungsformen gesucht und erprobt. Positive Effekte zeigten sich bei ihnen aber auch nur bei milden Formen der kognitiven Beeinträchtigung durch Demenz und meist auch nur für kurze Zeiträume.
Die Intervention mit dem mehrere qualitativ unterschiedliche Komponenten umfassenden so genannten MAKS-Programm unterscheidet sich konzeptionell von den bisherigen nichtmedikamentösen Behandlungsformen erheblich und ist in mehrerlei Hinsicht erfolgreicher. Die Intervention von MAKS besteht aus den durch kurze Pausen unterbrochenen Komponenten Motorische Stimulation (z.B. 30 Minuten Bowling oder das Balancieren eines Tennisballs auf einer Frisbeescheibe samt Weitergabe an andere TeilnehmerInnen), einer 30 Minuteneinheit mit Kognitiven Aufgaben, einer 40-Minuteneinheit mit Übungen zu den Aktivitäten des täglichen Lebens (z.B. Zubereitung eines Snacks) und einer 10-minütigen Spirituellen Einstimmung in die rund zweistündige Gesamtübung (z.B. ein Gespräch über Glück oder das Singen einer Hymne). Die rund zweistündige standardisierte Behandlung erfolgte geleitet durch zwei Therapeuten in Zehnergruppen mit einem vergleichbaren Erkrankungsniveau an sechs Tagen pro Woche über 12 Monate. Die Therapiekosten lagen unter 10 Euro pro Tag und PatientIn und waren damit nach Angaben der Studienverantwortlichen nicht wesentlich höher als die der medikamentösen Behandlung - allerdings ohne deren Nebenwirkungen.
Die Angehörigen der Kontrollgruppe konnten die gewöhnlicherweise in den Pflegeheimen angebotenen Nicht-MAKS-Leistungen (z.B. Gedächtnistraining, Anti-Sturztraining oder Beschäftigungstherapie) in Anspruch nehmen und nutzten durchschnittlich auch zwei von ihnen pro Woche. Die Angehörigen der MAKS-Gruppe konnten diese Angebote ebenfalls zusätzlich besuchen und taten dies auch durchschnittlich einmal die Woche.
Die Wirksamkeit der MAKS-Behandlung wurde mit zwei Standardinstrumente erhoben: Der "Alzheimer Disease Assessment Scale—Cognitive Subscale (ADAS-Cog)" für die Messung der kognitiven Fähigkeiten und dem "Erlangen Test of Activities of Daily Living (E-ADL)" für die Messung der Alltagsaktivitäten. Die Skalen der beiden Tests reichen von 0 bis 70, wobei der höhere Wert eine größere kognitive Behinderung anzeigt, und von 0 bis 30 Punkten, wobei hier der höhere Wert eine geringere Behinderung anzeigt.
Während 12 Monate nach Beginn der Studie die beiden Werte bei allen Angehörigen der Interventionsgruppe unverändert geblieben waren, hatten sich bei den Angehörigen der Kontrollgruppe der adjustierte Wert für die kognitiven Fähigkeiten um signifikante 7,7 Punkte und der Wert für die Alltagsfähigkeiten um 3,6 Punkte verschlechtert. Die Wirkung war zwar bei den TeilnehmerInnen mit milder oder mäßiger Demenz stärker, aber auch bei den Angehörigen der Untergruppe mit schwerer Demenz deutlich zu erkennen.
Obwohl die Studienverantwortlichen auf einige Grenzen der Studie wie z.B. die geringe Anzahl von TeilnehmerInnen, das Fehlen einer Placebo-Kontrollgruppe und den möglichen unspezifischen Einfluss der allgemeinen Aufmerksamkeit für die Angehörigen der Interventionsgruppen hinwiesen, halten sie die positiven Wirkungen ihrer nichtmedikamentösen Intervention für gesichert. In zukünftigen Studien sollte dies mit mehr TeilnehmerInnen bestätigt werden und auch die Wirkung einer Kombination medikamentöser und nichtmedikamentöser Behandlung untersucht werden.
Sowohl die englischsprachige Originalarbeitals auch eine deutschsprachige Fassung der Studienveröffentlichung sind frei zugänglich: Graessel E, Stemmer R, Eichenseer B, Pickel S, Donath C, Kornhuber J, Luttenberger K: "Non-pharmacological, multicomponent group therapy in patients with degenerative dementia: a 12-months randomized, controlled trial" - erschienen in "BMC Medicine" 9 (2011).
Bernard Braun, 17.4.12
Neues zur Demografie: Zu wenig "Tempo" bei der Geburtenrate und was kann man vom Geburtengeschehen türkischer Migrantinnen lernen
 1,4 Kinder pro ost- und westdeutscher Frau liegen weit unter dem Niveau, das notwendig wäre, um den Bestand der deutschen Bevölkerung zu erhalten und drohen künftig eher noch weniger zu werden - so eine der unerschütterbaren Gewissheiten des pessimistischen Demografiediskurses in Deutschland. Ähnlich gewiss wird etwa die These vertreten, insbesondere die Entwicklung der Geburtenrate in Ostdeutschland spiegele die dortigen immer noch schlechteren ökonomischen und sozialen Bedingungen wider, was maßgeblich und dauerhaft zur Kinderlosigkeit beitrage. Schließlich heißt es, dass wenn in Deutschland überhaupt wieder mehr Kinder geboren werden, die Eltern aus der Türkei oder anderen außerdeutschen Ländern stammen und diese Kinder "uns" damit auch wieder verloren gehen können oder Leuten wie Herrn Sarrazin gar nicht so willkommen sind.
1,4 Kinder pro ost- und westdeutscher Frau liegen weit unter dem Niveau, das notwendig wäre, um den Bestand der deutschen Bevölkerung zu erhalten und drohen künftig eher noch weniger zu werden - so eine der unerschütterbaren Gewissheiten des pessimistischen Demografiediskurses in Deutschland. Ähnlich gewiss wird etwa die These vertreten, insbesondere die Entwicklung der Geburtenrate in Ostdeutschland spiegele die dortigen immer noch schlechteren ökonomischen und sozialen Bedingungen wider, was maßgeblich und dauerhaft zur Kinderlosigkeit beitrage. Schließlich heißt es, dass wenn in Deutschland überhaupt wieder mehr Kinder geboren werden, die Eltern aus der Türkei oder anderen außerdeutschen Ländern stammen und diese Kinder "uns" damit auch wieder verloren gehen können oder Leuten wie Herrn Sarrazin gar nicht so willkommen sind.
Was daran empirisch stimmt, wo es sich allenfalls um spekulative Annahmen und ob sie dramatische Szenarien für die Zukunft der Ökonomie und Umbauten der sozialen Sicherungssysteme rechtfertigen, haben mehrere deutsche und österreichische Demografen etwas genauer untersucht. Ihre Ergebnisse tragen zu einer längst überfälligen realistischeren und differenzierteren demografischen und sozialpolitischen Debatte bei.
Unter der programmatischen Überschrift "Weißt du, wieviel Kinder kommen?" präsentieren die ForscherInnen u.a. folgende Daten:
• Berücksichtigt man den so genannten "Tempoeffekt", d.h. die seit längerem zu beobachtende Tendenz, dass viele Frauen das Kinderkriegen in ein immer höheres Alter verschieben (müssen), werden nicht mehr die genannten 1,4, sondern 1,6 Kinder pro Frau geboren. Angesichts der politisch folgenreichen Debatte ist es kaum fassbar, dass ein Teil der Heftigkeit dieser Debatte auf dem in anderen Ländern längst obsolet gewordenen Indikator der die tatsächliche Anzahl geborener Kinder unterschätzenden zusammengefassten Geburtenrate beruht. Natürlich liegt auch die "tempobereinigte" Geburtenrate von 1,6 Kindern unter dem Bestanderhaltungsniveau. Die Korrektur verändert aber zusammen mit dem (Wieder-)Ansteigen der endgültigen Kinderanzahl der 1970 und später geborenen Frauen einiges an der Dramatik der Debatte.
• Der Gebrauch der zusammengefassten Geburtenziffer führte insbesondere in Ostdeutschland zu einer enormen Fehlein- oder Unterschätzung der quantitativen Entwicklung der Geburten. Dort stieg aufgrund der mit der Wiedervereinigung verbundenen Zukunfts-Unsicherheiten und der Notwendigkeit sich zuerst einmal in Gesamtdeutschland sozial zu etablieren das Familienbildungs- und Gebäralter der Frauen erheblich an. Dies führte 1997 zu einem historischen Tief der zusammengefassten Geburtenrate von 1,04 Kindern pro Frau. Wenn man den "Tempoeffekt" berücksichtigt, lag diese Rate aber tatsächlich bei 1,47 Kindern.
• Die lange unbestrittene Annahme, dass der Geburtenrückgang in Ostdeutschland Folge oder Ausdruck der schlechten ökonomischen Bedingungen sei, erweist sich auf dem Hintergrund der dort seit einigen Jahren steigenden und sogar das westdeutsche Niveau überschreitenden Geburtenrate als Irrtum. Die besonderen soziokulturellen und infrastrukturellen Eigenarten Ostdeutschlands (z.B. hohe Erwerbstätigkeit junger Mütter und gute Ausstattung mit Krippenplätzen) kompensieren die möglichen Effekte der sonstigen, in der Tat auch heute noch ungünstigeren sozialen Bedingungen.
Mit dem Titel "In Deutschland bekommen türkische Zuwanderinnen später und seltener Kinder" als in anderen westeuropäischen Ländern, weist eine Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für demographische Forschung in Rostock auf einen anderen unerwartet vielschichtigen Komplex der demografischen Realität in Deutschland hin.
Auf der Basis einer Umfrage unter türkischen Einwanderern der zweiten Generation in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland, zeigen sich folgende Erkenntnisse:
• Die relative Wahrscheinlichkeit für ein erstes Kind bei türkischen Migrantinnen lag in der Schweiz um 6% über der in Deutschland. In Frankreich war sie um das 1,6-Fache und in den Niederlanden um das 1,73-Fache höher als hierzulande. Während die hier allein in Frage kommenden zusammengefassten Geburtenraten von Türkinnen in Deutschland und der Schweiz bei 1,3 Kindern pro Frau lagen, waren es in den beiden anderen Ländern fast 2 Kinder pro Frau. Die in den hier untersuchten Einwanderungsländern deutlich unterschiedlichen kinder- und elternbezogenen sozialen Bedingungen (z.B. Krippenplätze) wirken sich offensichtlich auch bei Migrantinnen enorm schnell und stark auf das Gebärverhalten aus.
• Die Untersuchung zeigte ferner, dass höhere Bildungsniveaus auch bei den Migrantinnen zu wesentlich niedrigeren Erstgeburtenraten (Rückgang zwischen 37% bei Migrantinnen mit Berufsausbildung und 59% bei Migrantinnen mit Hochschulabschluss) führen.
Trotzdem kommt die Wissenschaftlerin zu dem Schluss: "Doch selbst wenn verschiedenste Faktoren wie Bildung, Ehestand, Zugehörigkeit zu einer Religion und Geburtsjahrgang in die Berechnung der Erstgeburtenraten einflossen, blieb der Unterschied zwischen zugewanderten Frauen in Frankreich und den Niederlanden auf der einen sowie Deutschland und Schweiz auf der anderen Seite erhalten."
Nehmen die Untersuchungen zu den Effekten des "Tempoeffekts" ein wenig von der Dramatik niedriger Geburtenraten (ob die Bestandserhaltung einer Bevölkerung ein wirklich wichtiges Ziel ist, sei hier nicht weiter hinterfragt), zeigt die Untersuchung zum Gebärverhalten von Migrantinnen, dass und von welchen soziokulturellen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen und Angeboten dieses abhängig und daher beeinflussbar ist.
Die Ergebnisse kann man kompakt zusammengefasst in der neuesten Ausgabe des u.a. vom Max-Planck-Institut für demographische Forschung herausgegebenen Newsletter "Demografische Forschung. Aus erster Hand" (Nr. 1, 2012) nachlesen.
Wer es etwas ausführlicher nachlesen will, findet das Abstract der Studie "Transition to a first birth among Turkish second-generation migrants in Western Europe." von Milewski, N. in der Zeitschrift "Advances in Life Course Research"(2011: 16(2011)4: 178-189).
Der Aufsatz " Schätzung der tempobereinigten Geburtenziffer für West- und Ostdeutschland, 1955-2008" von Luy, M. und O. Pötzsch ist in der Zeitschrift "Comparative Population Studies - Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft (35 (2010)3: 569-604) und komplett kostenlos zugänglich.
Von dem Aufsatz " Has East Germany overtaken West Germany? Recent trends in order-specific fertility" von Goldstein, J.R. und M. Kreyenfeld in der Zeitschrift "Population and Development Review" ( 37 (2011)3: 453-472) gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 29.3.12
Prognosen über die künftigen Krankenhausfallzahlen müssen den Alterungseffekt, die Risikoerhöhung und -verminderung beachten
 Zum Standardrepertoire der Debatte über die Folgen der demographischen Alterung gehört die drohende Zunahme der Anzahl chronischer Krankheiten und deren Schwere und die damit verbundenen Belastungen der Kapazitäten und Finanzen des Gesundheitssystems. Am stärksten wird u.a. wegen der Schwere der Erkrankungen die stationäre Versorgung unter Druck geraten - so der Mainstream der Prognosen.
Zum Standardrepertoire der Debatte über die Folgen der demographischen Alterung gehört die drohende Zunahme der Anzahl chronischer Krankheiten und deren Schwere und die damit verbundenen Belastungen der Kapazitäten und Finanzen des Gesundheitssystems. Am stärksten wird u.a. wegen der Schwere der Erkrankungen die stationäre Versorgung unter Druck geraten - so der Mainstream der Prognosen.
Deutlich anders und vor allem differenzierter sieht dies eine aktuelle Analyse der Krankenhausdiagnosestatistik des Statistischen Bundesamt für die drei heute und künftig relevanten Diagnosehauptgruppen bösartige Neubildungen, Herz-Kreislauferkrankungen und Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes sowie nein Diagnosegruppen.
Der Autor, Epidemiologe am Robert-Koch-Institut, berücksichtigt und untersucht dabei nicht nur den alterungsbedingten Anstieg der Krankenhausfallzahlen, sondern auch die Veränderung des Risikos wegen bestimmter Erkrankungen überhaupt im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, also die Chance der Abnahme von Krankenhausfällen wegen sinkenden Risiken.
Die Kernergebnisse der differenzierten Analysen sehen so aus:
• "Die demografische Alterung hat im Zeitraum von 2000 bis 2009 zu einem Anstieg der Fallzahlen in der stationären Versorgung von 6 % geführt.
• Die Wirkung der Alterung auf die Behandlungszahlen wird je nach Diagnosegruppe vom sich verändernden Risiko, mit einer bestimmten Diagnose in einem Krankenhaus behandelt zu werden, verstärkt, abgemildert respektive kompensiert. Für die Diagnosen Herzinsuffizienz sowie Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens beispielsweise addieren sich Effekte der Alterung und der Risikosteigerung zu einer jeweiligen Steigerung der Behandlungszahlen von 40 % und mehr."
• Die Risikoverringerung bei Lungenkrebs und Prostatakarzinom reichen nicht aus, um die Effekte der Alterung zu kompensieren. Dies führt zu einem leichten Anstieg der Behandlungsfallzahlen.
• Bei ischämischen Herzerkrankungen, zerebrovaskulären Krankheiten (z.B. Schlaganfall), Darmkrebs und Brustkrebs sinkt das Risiko so stark, dass die Alterungseffekte deutlich überkompensiert werden und die im Krankenhaus erwartbaren Fallzahlen um bis zu 41% zurück gehen.
Um auch fürderhin realistischere Prognosen der künftigen Entwicklung zu erhalten, d.h. nicht nur alterungsbedingte "worst case"-Szenarien mit Selbstlähmungspotenzial, müssen künftig sowohl Alterungseffekte wie Veränderungen der Erkrankungs- und Behandlungsrisiken beachtet werden. Und beide Effekte müssen weiter nach Altersgruppen, Diagnosen und zeitlichem Auftreten unterschieden werden. So trivial das klingen mag: Nicht alle Personen, die das 65. Lebensjahr hinter sich haben, erkranken sofort und mit gleich hoher Intensität an allen chronischen Krankheiten.
Unbenommen davon gilt auch weiterhin die Warnung vor zu einseitig pessimistischen Prognosen der Alterungseffekte und der Hinweis auf die seit Jahren zunehmend gesünder werdende ältere Bevölkerung.
Der Aufsatz "Demografische Alterung und stationäre Versorgung chronischer Krankheiten" von Enno Nowossadeck ist im "Deutschen Ärzteblatt" vom 2. März 2012 (109(9): 151-7) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.3.12
Alter allein erklärt nicht die Anzahl depressiver Symptome als einem Indikator für seelische Gesundheit.
 Das Alter allein besitzt keine Erklärungskraft für die Häufigkeit von depressiven Symptomen oder Erkrankungen, die eine schwere Belastung der Gesundheits- und Lebensqualität älterer Menschen darstellen.
Das Alter allein besitzt keine Erklärungskraft für die Häufigkeit von depressiven Symptomen oder Erkrankungen, die eine schwere Belastung der Gesundheits- und Lebensqualität älterer Menschen darstellen.
Dies ist das zentrale Ergebnis einer Analyse von Daten aus der ersten Welle des SHARE-Projekts (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) von 28.538 repräsentativen Personen im Alter zwischen 50 und 89 Jahren mit depressiven Symptomen (gemessen mit der so genannten EURO-D-Skala) aus elf europäischen Länder sowie Israel. Im SHARE-Projekt werden im Längsschnitt nicht nur Alters- und Krankheitsdaten erhoben, sondern auch eine Fülle soziodemografischer Daten sowie Angaben zur wirtschaftlichen Situation und den Lebensarrangements der TeilnehmerInnen.
Ein Literaturreview zeigt, dass die empirischen Befunde zu den Effekten des Alters auf depressive Symptome gemischt sind und von positiven über keine bis hin zu negativen Effekten reichen.
Die SHARE-Ergebnisse zeigen zunächst, dass die Anzahl depressiver Symptome mit dem Alter steigen und bei den Frauen höher als bei den Männern ausfällt. So steigt die durchschnittliche Anzahl von depressiven Symptomen bei Männern von 1,72 im Alter von 50-54 Jahren auf 2,63 bei den 85-89-Jährigen. Bei den Frauen steigt die Anzahl der Symptome von 2,57 auf 3,46 Symptome.
Wenn man die soziodemografischen Merkmale, die Indikatoren des Gesundheitszustands (z.B. Behinderungen, chronische Erkrankungen und geistige Fähigkeiten), die Lebensstile und die wirtschaftliche Belas-tungen in multivariate Analysen einbezieht, hebt sich der Zusammenhang zwischen depressiven Symptomen und Alter in den meisten Modellen bei den Männern auf und kehrt sich bei den Frauen sogar um. Nicht das präventiv unbeeinflussbare Alter alleine, sondern erst das Wechselspiel der in Maßen beeinflussbaren Ausprägungen des körperlichen und kognitiven Gesundheitszustands und die individuellen Lebensumstände von Senioren mit dem Alter, sind mit dem Auftreten und dem Niveau der depressiven Symptome assoziiert. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass Faktoren wie die soziale Unterstützung, die Arbeitsbedingungen und die Art des Übergangs in die Nichtarbeitsphase im SHARE-Projekt bisher nicht erhoben werden, sehr wohl aber weitere Vermittlungsglieder zwischen Alter und Depressivität sein können.
Der Aufsatz "Der Zusammenhang zwischen Alter und depressiven Symptomen bei Männern und Frauen höheren Lebensalters in Europa. Erkenntnisse aus dem SHARE-Projekt"
von Isabella Buber und Henriette Engelhardt ist im Mai 2011 in den "Comparative Population Studies - Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.1.12
Welche Einzelfaktoren "befeuern" mit welcher Kraft den demografischen Wandel?
 Egal, ob "Deutschland altert" oder "immer mal wieder ausstirbt": "Ursächlich dafür sind der seit langem anhaltende Anstieg der Lebenserwartung und die auch seit längerem beständig niedrigen Geburtenzahlen". So weit ein Teil der zahllosen Schlagzeilen und schlaglichtartigen Ursachenzusammenstellungen zum demografischen Wandel. Was weit seltener zu lesen oder zu hören ist, sind Antworten auf die eigentlich naheliegende Frage, wie stark der Einfluss der Einflussfaktoren denn im Ensemble ist und ob es nicht auch Einflüsse in Richtung Verjüngung der Bevölkerung gibt. Selbst wenn aber über diese Art von Einfluss durch Migration geredet wird, fehlen auch hier quantitative Aussagen über das Wechselspiel aller genannten Faktoren.
Egal, ob "Deutschland altert" oder "immer mal wieder ausstirbt": "Ursächlich dafür sind der seit langem anhaltende Anstieg der Lebenserwartung und die auch seit längerem beständig niedrigen Geburtenzahlen". So weit ein Teil der zahllosen Schlagzeilen und schlaglichtartigen Ursachenzusammenstellungen zum demografischen Wandel. Was weit seltener zu lesen oder zu hören ist, sind Antworten auf die eigentlich naheliegende Frage, wie stark der Einfluss der Einflussfaktoren denn im Ensemble ist und ob es nicht auch Einflüsse in Richtung Verjüngung der Bevölkerung gibt. Selbst wenn aber über diese Art von Einfluss durch Migration geredet wird, fehlen auch hier quantitative Aussagen über das Wechselspiel aller genannten Faktoren.
In einem kurzen Beitrag in der Januar 2012-Nummer des vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)" herausgegebenen Newsletters "Bevölkerungsforschung aktuell" quantifiziert nun BiB-Forscher Scharein die Einflüsse der Faktoren aktuelle Altersstruktur, Fertilität, Mortalität und Migration im Wechselspiel für die Jahre 1991 bis 2009 in Deutschland.
Er beginnt seine Darstellung mit dem für die Messung der Alterung seltener verwandten Indikator des Medianalters, d.h. das Alter, das die Bevölkerung in eine Hälfte aufteilt, die älter und eine, die jünger ist. Dieses Alter stieg für die weibliche Bevölkerung in dem genannten Zeitraum von 39,5 auf 45,1 Jahre und bei Männern von 35,1 auf 42,8 Jahre an.
Mittels einer so genannten Kohoerten-Komponenten-Fortschreibung der Bevölkerung bestimmt der Autor dann, wie viele dieser Jahre von den vier Faktoren bestimmt werden: Die Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst bei Männern zu rund 69% den Anstieg des Medianalters (bei Frauen rund 64%), die Fertilität war bei den Männern zu knapp 39% daran beteiligt und bei den Frauen mit 52%. Die längere Lebenserwartung beeinflusste schließlich bei Männern "nur" noch zu 10,5% und bei den Frauen zu rund 14% die Erhöhung des Medianalters. Die Migration wirkte sich bei beiden Geschlechtern bremsend auf die Zunahme des Medianalters aus, nämlich mit 14,5% bei Männern und 20,3% bei Frauen. Interaktionen der vier Effekte wirkten sich ebenfalls mildernd aus, und zwar mit 4% bzw. 9,8% bei Männern und Frauen. Alles in allem wird also die Alterung in Deutschland "hauptsächlich durch die nach wie vor niedrigen Geburtenzahlen" erklärt.
Der Kurzaufsatz "Altersstruktur, Fertilität, Mortalität und Migration - Vier Komponenten befeuern den demografischen Wandel" von Manfred Scharein (Seite 23/24) ist kostenlos herunterladbar.
Den 6x im Jahr erscheinenden Informationsdienst "Bevölkerungsforschung aktuell" des BiB kann man stets komplett kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 25.1.12
Geburtenraten sinken in wirtschaftlich schlechten Zeiten signifikant: Zufall oder kausaler Zusammenhang?
 Was die Kausalität dieses Zusammenhangs angeht, wird sie fast so oft wie ein enger Zusammenhang sichtbar wird, aus methodischen Gründen bestritten.
Was die Kausalität dieses Zusammenhangs angeht, wird sie fast so oft wie ein enger Zusammenhang sichtbar wird, aus methodischen Gründen bestritten.
Eine am 12. Oktober 2011 für alle 50 Bundesstaaten der USA und Washington D.C. mit den Daten des "National Center for Health Statistics" und des "Census Bureau" durchgeführte Analyse des PEW Research Centers, legt nun nicht nur erneut Geburtenzahlen vor, die sich exakt parallel zur Entwicklung der wirtschaftlichen Rezession in den USA verändern, sondern untermauert die Zusammenhänge auch noch durch eine Reihe differenzierterer Analysen.
Zunächst die generelle Entwicklung: In den USA gab es auch bereits in der Vergangenheit starke Assoziationen zwischen wirtschaftlichen Krisenphasen und sinkender Geburtenrate: Die Rate sank zum Beispiel zwischen 1926 und 1936, also der Zeit der Weltwirtschaftskrise, um 26%. Aktuell sank die Geburtenrate von einem Geburtenhoch von 69,6 Geburten auf 1.000 Frauen im wirtschaftlich guten Jahr 2007 auf 64,7 Geburten pro 1.000 Frauen im Rezessionsjahr 2010. In absoluten Zahlen heißt dies, dass trotz eines gleichzeitigen Zuwachses der Bevölkerung die Anzahl der geborenen Kinder von 4,32 Millionen auf 4,01 Millionen sank.
Einen möglichen Zusammenhang von Krise und Geburtenrate untermauert die Verfasserin der Analyse u.a. mit zwei differenzierten Analysen:
• Erstens stieg in den wenigen Bundesstaaten, die wie North Dakota bessere wirtschaftliche Eckdaten aufwiesen, die Geburtenrate sogar noch oder stagnierte nur. In den am stärksten von der Wirtschaftskrise betroffenen Bundesstaaten, wie z.B. Arizona, gab es dagegen mit 7,2% auch die stärkste Abnahme der Rate.
• Zweitens fiel die Geburtenrate in den Bevölkerungsgruppen am stärksten, deren Einkommens- oder Arbeitsplatzverluste am stärksten ausfielen: Die so genannten "Hispanics" verloren zwischen 2005 und 2009 einerseits durchschnittlich 66% ihres Vermögens. Andererseits war die Abnahme ihrer Geburtenrate zwischen 2008 und 2009 mit 5,9% am höchsten. In der schwarzen Bevölkerung der USA betrug die Abnahme 2,4%, in der weißen Bevölkerung dagegen 1,6%.
• Die Tatsache, dass die Geburtenrate in allen Altersgruppen außer bei den 40- bis 44-jährigen Frauen sank, wertet die Verfasserin als Beleg dafür, dass sich hinter der sinkenden Geburtenrate nicht prinzipielles Desinteresse an Kindern verbirgt, sondern die Frauen und ihre Familie nur auf wirtschaftlich bessere Zeiten warten wollen - wenn ihnen nicht die Zeit der Gebärfähigkeit davon läuft.
Die 15 Seiten umfassende Studie In a Down Economy, Fewer Births von Gretchen Livingston ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.10.11
Gesundheitliche Ungleichheit am Beispiel Erwerbsminderung: Niedrig Qualifizierte tragen bis zu 10-x höheres Risiko als Akademiker
 Bildung ist der wichtigste Einflussfaktor auf die unfreiwillige, weil u.a. mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbundene Inanspruchnahme einer Erwerbsminderungsrente. Konkret heißt dies: Gering qualifizierte Arbeitnehmer tragen ein sehr viel höheres Risiko als Akademiker, wegen einer Krankheit dauerhaft arbeitsunfähig zu werden: Die Wahrscheinlichkeit ist bei niedrig Qualifizierten bis zu zehnmal so hoch.
Bildung ist der wichtigste Einflussfaktor auf die unfreiwillige, weil u.a. mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbundene Inanspruchnahme einer Erwerbsminderungsrente. Konkret heißt dies: Gering qualifizierte Arbeitnehmer tragen ein sehr viel höheres Risiko als Akademiker, wegen einer Krankheit dauerhaft arbeitsunfähig zu werden: Die Wahrscheinlichkeit ist bei niedrig Qualifizierten bis zu zehnmal so hoch.
Eine Auswertung der Rentenversicherungs-Routinedaten von 127.199 Menschen, die 2008 zum ersten Mal eine Erwerbsminderungsrente bewilligt bekamen, also zu krank waren, um regulär weiterzuarbeiten, zeigte zweierlei:
• Fast jeder fünfte Arbeitnehmer, der heute in Rente geht, muss sein Arbeitsleben aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden und bekommt eine Erwerbsminderungsrente. Sehr häufige Krankheiten sind Muskel-Skelett-Erkrankungen etwa aufgrund schwerer körperlicher Arbeit, Erkrankungen von Herz und Kreislauf sowie psychische Leiden aufgrund etwa von Arbeitsverdichtung und Stress.
• Bei den Frauen und Männern mit Fach- oder Hochschulabschluss gehen mit Ende 50 nur rund fünf von 1.000 gesetzlich Rentenversicherten in die Erwerbsminderungsrente. Bei niedrig qualifizierten Männern sind es hingegen fast 25, bei niedrig qualifizierten Frauen 19. Beschäftigte mit mittlerer Qualifikation liegen demnach dazwischen.
Neben der Qualifikation spielen aber auch noch Geschlecht und Wohnort eine Rolle beim Risiko nicht mehr regulär weiterarbeiten zu können: So haben westdeutsche Männer und Freauen ein generell niedrigeres Risiko als ihre ostdeutschen "Brüder und Schwestern". Männer haben sowohl in West- wie in Ostdeutschland das jeweils höhere Risiko, mit einer Erwerbsminderungsrente frühzeitig aus dem Arbeitsleben zu scheiden. Und auch bei den Krankheiten, die zur Erwerbsminderung führen gibt es einige soziodemografisch relevante Unterschiede: So ist in Ost wie West das Risiko wegen psychischer Erkrankungen in Frührente gehen zu müssen bei Frauen höher als bei Männern. Umgekehrt sieht es bei der Frührente wegen Muskel- und Skeletterkrankungen aus - doch ist in Westdeutschland der Anteil der männlichen und weiblichen Frührentner an 1.000 aktiv Versicherten fast gleich hoch (0,70 und 0,68).
Die von den im Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin, im Deutschen Zentrum für Altersfragen, im Robert-Koch-Institut und im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung arbeitenden WissenschaftlerInnen Christine Hagen, Ralf K. Himmelreicher, Daniel Kemptner und Thomas Lampert erstellte Studie Soziale Ungleichheit und Risiken der Erwerbsminderung ist in den WSI Mitteilungen (der Fachzeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung) 7/2011 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.9.11
Untergang oder Herausforderung! Was bedeuten Prognosen des Erwerbspersonenpotenzials für die Zukunft des deutschen Sozialsystems?
 Der Alltag des deutschen Arbeits- und Sozialsystems wurde seit knapp vierzig Jahren durch eine lange Jahre stetig ansteigende und erst jüngst kleiner werdende Nicht- oder Unternutzung des Arbeitskräftepotenzials durch millionenfache offene Arbeitslosigkeit und "stille Reserven" geprägt. Die für die nächsten Jahren prognostizierte absolute Abnahme des Arbeitskräftepotenzials gehört nun zu den Basistönen des dramatisierenden Demografiediskurses für die nächsten vierzig Jahre. Dabei fällt verbreitet unter den Tisch, dass es sich auch hier vor allem um die Effekte bestimmter Demografie- (z.B. Geburtenanzahl und Betreuungsinfrastruktur), Sozial- (z.B. Frühberentungsanreize), Arbeitsgestaltungs- (z.B. altersgerechte Arbeitsplätze) und Migrationspolitiken (z.B. Einwanderungsland Deutschland versus "Kinder statt Inder"-Politik) handelt.Politik muss also nicht nur auf unentrinnbare naturhafte Auswirkungen reagieren , sondern beeinflusst diese Situation immer schon und auch heute noch massiv.
Der Alltag des deutschen Arbeits- und Sozialsystems wurde seit knapp vierzig Jahren durch eine lange Jahre stetig ansteigende und erst jüngst kleiner werdende Nicht- oder Unternutzung des Arbeitskräftepotenzials durch millionenfache offene Arbeitslosigkeit und "stille Reserven" geprägt. Die für die nächsten Jahren prognostizierte absolute Abnahme des Arbeitskräftepotenzials gehört nun zu den Basistönen des dramatisierenden Demografiediskurses für die nächsten vierzig Jahre. Dabei fällt verbreitet unter den Tisch, dass es sich auch hier vor allem um die Effekte bestimmter Demografie- (z.B. Geburtenanzahl und Betreuungsinfrastruktur), Sozial- (z.B. Frühberentungsanreize), Arbeitsgestaltungs- (z.B. altersgerechte Arbeitsplätze) und Migrationspolitiken (z.B. Einwanderungsland Deutschland versus "Kinder statt Inder"-Politik) handelt.Politik muss also nicht nur auf unentrinnbare naturhafte Auswirkungen reagieren , sondern beeinflusst diese Situation immer schon und auch heute noch massiv.
Lohnen tut sich aber auch ein Blick auf das kommunizierte Zahlengerüst des Diskurses. Dieses steht im Mittelpunkt eines gerade veröffentlichten Kurzberichts des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit. Der Bericht beschreibt ausführlich die Entwicklung der "Zahl der Personen, die dem Arbeitsmarkt potenziell zur Verfügung stehen" - bis 2025 und bis 2050. Als wesentliche Einflussfaktoren berücksichtigt das IAB zwei relativ variable und sozial- wie beschäftigungspolitisch beeinflussbare Faktoren: die Erwerbsquoten, also z.B. den Anteil der erwerbstätigen Frauen, älteren oder jungen Menschen und den Wanderungssaldo zwischen aus- und eingewanderten Erwerbspersonen. Ob man Entwicklungen bis zum Jahr 2050 wirklich seriös prognostizieren oder projezieren kann oder dies reine "Kaffeesatzleserei" (Bosbach) ist, soll hier nicht weiter diskutiert werden.
Die Abnahme des Erwerbspersonenpotenzials von 2008 (44,748 Millionen Personen) reicht 2025 von 38,203 Millionen im worst-case-Szenario mit konstanten Erwerbsquoten und ohne Berücksichtigung von Wanderungen bis zu 42,576 Millionen im best-case-Szenario mit steigenden Erwerbsquoten und einem Wanderungssaldo von 200.000 Personen pro Jahr. Damit läge das Erwerbspersonenpotenzial knapp zwei Millionen unter oder sogar etwas über einer Million über der Zahl der 40,8 Millionen heute Erwerbstätigen. Wählt man die wahrscheinlich realistischere Variante mit der Zunahme der Erwerbsquoten und einem Wanderungssaldo von 100.000 Personen liegt das Potenzial 2025 immer noch knapp über der heutigen Anzahl der Erwerbspersonen. Der heutige Bedarf an Erwerbspersonen könnte also im Prinzip befriedigt werden, bedürfte aber enormer Anstrengungen im Bereich der Bildungspolitik und Arbeitsorganisation.
Setzt man die Projektion bis 2050 fort, sinkt das Erwerbspersonenpotenzial unter den realistischen Annahmen weiter auf 32,733 Millionen. Spätestens hier beginnt der apokalyptische Teil des Demografiediskurses.
Dass selbst dieser für 2050 prognostizierte quantitative Wert keinen zwingenden Grund zur Panik darstellt, liegt dann aber an weiteren wichtigen, auch im IAB-Bericht ausgeblendeten Einflussgrößen:
• Dazu gehört die ebenfalls bereits umfänglich prognostizierte weitere Bevölkerungsentwicklung. Die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2009 schätzt in einer mittleren Variante einen Rückgang der Einwohner Deutschlands von rund 82 Millionen im Jahr 2008 auf 73,6 bis 69,4 Millionen im Jahr 2050. Es ist eher unwahrscheinlich, dass man zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen selbst ohne Berücksichtigung von Produktivitätsfortschritten für eine um 8 oder 13 Millionen geschrumpfte Bevölkerung noch 40,8 Millionen Erwerbstätige und ein dazu notwendiges Erwerbspersonenpotenzial braucht.
• Eine zweite wichtige Einflussgröße ist die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Selbst die sehr zurückhaltenden Prognosen zur Entwicklung der Arbeitsproduktivität der Herzog- und der Rürup-Kommission von jährlich 1,25% bzw. 1,8% halten damit eine Gesamtsteigerung bis 2050 von 84% oder 140% für möglich. Sofern dieser Zuwachs nicht einseitig zugunsten der Unternehmen verteilt wird, kann also eine wesentlich kleinere Anzahl von Erwerbspersonen nicht nur mindestens das heutige Wohlstandsniveau halten, sondern auch auch möglicherweise steigende Sozialabgaben ohne eigene Wohlstandsverluste finanzieren. Dass dies möglich ist, zeigt der Verlauf der Produktivität bei der Produktion von Nahrung in den letzten 100 bis 150 Jahren.
Wer unbedingt die Anzahl von Köpfen als Problem kommunizieren will, sollte bedenken, dass die Beiträge der Sozialversicherungen nicht nach Köpfen erhoben werden, sondern ein Abzug von sozialversicherungspflichtigen Einkommenssummen sind.
Ohne dass das mögliche Schrumpfen des Erwerbspersonenpotenzials auf 32 Millionen Personen umgekehrt bagatellisiert werden soll, wird seine wohlstandsbedrohende Bedeutung weit überschätzt oder sogar fehlbewertet. Umfängliche Um- und Abbauten der sozialen Sicherungssysteme sind bis 2025 jedenfalls voreilig und für 2050 wahrscheinlich weit überzogen. Sie verhindern außerdem alternative bildungs- und sozialpolitische Überlegungen wie man mehr Personen erwerbsfähig und produktiver machen kann.
Der trotzdem sehr informative 3. IAB-Kurzbericht 16/2011: Projektion des Arbeitskräfteangebots bis 2050: Rückgang und Alterung sind nicht mehr aufzuhalten von Johann Fuchs, Doris Söhnlein und Brigitte Weber ist komplett kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für die vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Begleitmaterialien zur Pressekonferenz am 18. November 2009 "bevölkerung deutschlands bis 2060. 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung.
Bernard Braun, 26.8.11
Gesundheitsbericht-Ramsch: "Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" lieber nicht nach "Erinnerungen" zur Gesundheitsentwicklung!
 Es vergeht kaum eine Woche ohne dass ein neuer Report einer Krankenkasse, eines Ärzte- oder Apothekerverbandes über meist "dramatische" Veränderungen der Gesundheit irgendeiner Bevölkerungsgruppe innerhalb der letzten 5, 10 oder 20 Jahren erscheint. Ein Teil dieser Berichte stützt sich immerhin noch auf "objektive", kontinuierlich und nicht nur für den jeweiligen Berichts erfasste Routinedaten von Krankenkassen oder methodisch erprobte repräsentative Bevölkerungsumfragen. Deren mögliche oder gesicherte Verzerrungen oder Schwachstellen wie z.B. die Untererfassung von Angehörigen vulnerabler Gruppen in repräsentativen Umfragen oder die Verkürzung auf die Behandlungsmorbidität in den GKV-Routinedaten sind weitgehend bekannt und kalkulierbar.
Es vergeht kaum eine Woche ohne dass ein neuer Report einer Krankenkasse, eines Ärzte- oder Apothekerverbandes über meist "dramatische" Veränderungen der Gesundheit irgendeiner Bevölkerungsgruppe innerhalb der letzten 5, 10 oder 20 Jahren erscheint. Ein Teil dieser Berichte stützt sich immerhin noch auf "objektive", kontinuierlich und nicht nur für den jeweiligen Berichts erfasste Routinedaten von Krankenkassen oder methodisch erprobte repräsentative Bevölkerungsumfragen. Deren mögliche oder gesicherte Verzerrungen oder Schwachstellen wie z.B. die Untererfassung von Angehörigen vulnerabler Gruppen in repräsentativen Umfragen oder die Verkürzung auf die Behandlungsmorbidität in den GKV-Routinedaten sind weitgehend bekannt und kalkulierbar.
Mittlerweile nimmt allerdings ein Typ der Informationsgenerierung durch Querschnittsbefragungen von "Praktiker-Experten" zu, der schnell und preisgünstig ist, inhaltlich aber hinsichtlich seiner Aussagen über Entwicklungstrends äußerst fragwürdig.
Jüngstes Beispiel ist das "Vivesco Gesundheitsbarometer 2011". Vivesco ist nach eigenen Angaben eine Kooperation aus rund 1.100 Apotheken mit 9.000 Mitarbeitern und eine 100-prozentige Tochter des Pharmagroßhändlers Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG). Die Verantwortlichen des "Gesundheitsbarometers" und ihre wissenschaftliche Gallionsfigur, der schon als Finanzwissenschaftler nicht unumstrittene Bernd Raffelhüschen haben natürlich auch das Recht so viel Unsinn zu produzieren und zu publizieren wie ihnen einfällt. Wozu aber dann doch ein Kommentar nötig ist, ist die ihrer "Studie" exemplarisch eigene, durch "Erinnerungen" gestützte Sorgen- oder Panikmache über die weitere Entwicklung der Bevölkerungsgesundheit und ihrer Bewältigung durch das jetzige solidarische Krankenversicherungssystem. Und bevor das Strickmuster der Prognose noch weiter Schule macht - die Herausgeber kündigen eine jährliche Aktualisierung an -, verdient die dabei dominierende Unseriosität mehr Transparenz.
Die selbstbewusste Kernaussage der Studie lautet: "Erstmalig" sei "ausgehend von den zehn wichtigsten Krankheitsbildern … gezeigt (worden), wie sich der Gesundheitszustand der Deutschen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat…: Wir sind heute weniger gesund als noch vor zehn Jahren. … Das ist ein Grund zur Besorgnis - und ein Anlass zum Handeln. … Aktueller als jede andere Studie bietet das Gesundheitsbarometer … eine klare Orientierung, wohin sich Deutschlands Gesundheit entwickelt."
Um all dies liefern zu können, werteten die Autoren weder Daten einer Gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung noch Daten aus Arztpraxen aus - wie viele andere Gesundheitsreports. Sie fragten auch nicht mit den dazu vorhandenen wissenschaftlich validierten Fragen Patienten oder eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung nach ihrem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand und verglichen dies mit ähnlichen Informationen aus der Vergangenheit.
Stattdessen rührten Vivesco und der gesundheitswissenschaftlich oder epidemiologisch wirklich unbedarfte Finanzwissenschaftler Raffelhüschen einen bunten Cocktail zusammen, dessen Ingredenzien so aussehen:
• Zunächst wird der Gesundheitszustand im Jahr 2001 für die "zehn wichtigsten Krankheitsbilder" Depression, Schlafstörungen, Sodbrennen, Osteoporose oder Bluthochdruck auf der Basis von Angaben der WHO zur Krankheitslast (Indikator sind so genannte "disability adjusted life years" oder DALY [1 DALY entspricht einem verlorenen gesunden Lebensjahr]) gebildet und in einem Index auf 100 gesetzt.
• Im Frühjahr 2011 wurden dann 444 ApothekerInnen aus den 1.100 Apotheken gefragt, wie sich ihrer Ansicht nach der Gesundheitszustand im Bereich der genannten 10 Krankheiten verändert habe. Dazu sollten sich diese u.a. auf ihre "Kompetenz" und die "hautnah" an "vorderster Front im Gesundheitswesen" gewonnenen Eindrücke über die Anzahl der Erkrankungsfälle stützen. So werden die Häufigkeit des Klingelns der Ladentür und die Anzahl der Personen, die den Apotheker fragen, ob "Renni" wirklich "den Magen aufräumt" (gleich Sodbrennen) zum neuesten epidemiologischen Maß. Und man fragt sich, warum es eigentlich noch der ganzen epidemiologischen Expertise in der Gesundheitsberichterstattung bedarf.
• Die so gewonnenen Erkenntnisse werden noch "entsprechend der WHO-Einschätzung zur Krankheitsbelastung der einzelnen Krankheitsbilder gewichtet" und erfahren schließlich noch eine "abschließende Validierung". Dafür werden "sowohl Medikamenten-Verkaufsstatistiken der GESDAT als auch Fallzahlenstatistiken der WHO verwendet".
• Mittels einer hübsch kompliziert anmutenden Formel wird schließlich noch der jeweilige Indexwert berechnet - für 2011 also der Wert 141. Zwar "signalisiert" dieser "keine dramatische Verschlechterung", aber "es geht uns heute schlechter". Und 4 von 10 ApothekerInnen wissen sogar noch mehr und "gehen davon aus, dass sich der allgemeine Gesundheitszustand … in Zukunft weiter verschlechtern wird."
Wie schnell eine Längsschnitt-Gesundheitsberichterstattung, die sich auf die subjektiv wahrgenommene Häufigkeit öffnender Apothekentüren oder auf die Anzahl besetzter Stühle in Arztpraxen stützt, Schule macht, zeigt die jüngste Studie der DAK. Sie kommt zu dem - was auch sonst - "alarmierenden Ergebnis", dass sich der Gesundheitszustand der in Deutschland lebenden Kinder in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert hat. Die empirische Basis dieser Feststellung ist eine Umfrage unter hundert Kinderärzten, die u.a. gebeten wurden, sich zu erinnern (!), ob der Gesundheitszustand ihrer jungen PatientInnen sich seit 2000 verschlechtert oder verbessert hat. Die Ärzte werden also noch nicht einmal gebeten, einen Blick in ihre Praxis-Dokumentation oder EDV zu werfen und relativ objektiv vergleichen zu können, wie viele ihrer jungen Patienten beispielsweise 2000 und 2010 wegen der einen oder anderen Erkrankung bei ihnen in Behandlung waren. Zum Wert von Erinnerungen für die Identifizierung zeitlicher Verläufe und Trendanalysen gibt es aber gesicherte Erkenntnisse der empirischen Sozialforschung. Ohne den 100 Kinderärzten zu nahe treten zu wollen: Die Methode der retrospektiven Tatsachenerhebung wird durch eine Fülle von normalen Erinnerungsschwierigkeiten bestimmt und führt meist systematisch zur Über- und Unterschätzungen der Prävalenzen gesundheitlicher Zustände. Da aktuelle Phänomene oder Häufigkeiten am besten erinnert werden, wirken sie größer als dieselben Phänomene in der ferneren Vergangenheit. Die so erhobenen Phänomene nehmen daher fast immer in der Zeit zu.
Das Elend dieser Art von Untersuchungen und die Fragwürdigkeit und/oder den einzigen Zweck der ihnen eigenen Dramatisierung, brachte der Medizinhistoriker Roy Porter bereits gegen Ende seines Standardwerk "Die Kunst des Heilens" für die entwickelten Länder auf den folgenden Punkt: "Ängste und Eingriffe schrauben sich immer höher wie eine außer Kurs geratene Rakete. … Es ist Teil eines Systems, in dem ein wachsendes medizinisches Establishment angesichts einer immer gesünderen Bevölkerung dazu getrieben wird, normale Ereignisse … zu medikalisieren, Risiken zu Krankheiten zu machen und einfache Beschwerden mit ausgefallenen Prozeduren zu behandeln. Ärzte und 'Konsumenten' erliegen zunehmend der Vorstellung, dass jeder irgendetwas hat, dass jeder und alles behandelt werden kann."(Roy Porter [2000]: Die Kunst des Heilens; Heidelberg/Berlin: 717)
Und wer dasselbe aktueller, auf deutlich weniger als 700 Seiten und speziell für die "dramatisch zunehmenden Volkskrankheiten" Depression und Alzheimer nachlesen will, kann dies in dem Aufsatz "Geldmacherei mit Patienten. Die Krankheitserfinder" von Werner Bartens tun, der in der Wochenendausgabe der "Süddeutschen Zeitung" vom 16. Juli 2011 erschienen und kostenlos erhältlich ist.
Wer nun noch wissen will oder Demonstrationsmaterial braucht, um zu zeigen wie man längsschnittliche Gesundheitsberichterstattung nicht betreiben sollte, findet den Originaltext der beiden hier exemplarisch vorgestellten "Studien" kostenlos im Internet:
Das "vivesco-Gesundheitsbarometer" umfasst 19 Seiten.
Die Ergebnisse des DAK-Reports "Meinungen zur Gesundheit der Kinder in Deutschland" sind in einer vierseitigen Zusammenfassung des Forsa-Instituts zu sehen.
Bernard Braun, 16.7.11
Neues aus der Demografieforschung: Wir leben nicht länger, weil der Alterungsprozess länger dauert, sondern später anfängt!
 Ist die in den meisten europäischen und nordamerikanischen Ländern auch heute noch stetige Verlängerung der Lebenserwartung in Richtung 90 und mehr Jahre der nächste Höhepunkt der "demografischen Bedrohung" oder muss man sich vielmehr überlegen, was die immer zahlreicher werdenden 90+-Menschen mit den immer mehr werdenden gesunden Lebensjahren anfangen können?
Ist die in den meisten europäischen und nordamerikanischen Ländern auch heute noch stetige Verlängerung der Lebenserwartung in Richtung 90 und mehr Jahre der nächste Höhepunkt der "demografischen Bedrohung" oder muss man sich vielmehr überlegen, was die immer zahlreicher werdenden 90+-Menschen mit den immer mehr werdenden gesunden Lebensjahren anfangen können?
Auf diese Frage liefert jetzt eine materialreiche Studie zum Stand der demografischen Forschung des Rostocker Bevölkerungswissenschaftler James Vaupel in der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Nature" klare Antworten.
Die empirischen Tendenzen in Schweden (seit 1861), den USA (seit 1933) und Japan (seit 1947) belegen die von Vaupel in einer deutschsprachigen Zusammenfassung seines "Nature"-Aufsatzes so formulierte Kernthese: Es gibt "ein deutliches Indiz dafür, dass die Zahl gesunder Lebensjahre wächst. Die Lebenserwartung der Menschen nimmt also zu - nicht, weil der Alterungsprozess sich insgesamt verlängert, sondern weil er immer später einsetzt. Heute Geborene können somit nicht nur darauf hoffen, den 100. Geburtstag zu feiern, sondern auch die Zeit bis zum 90. Lebensjahr in zufrieden stellender körperlicher und geistiger Gesundheit zu verbringen."
Dies wird im wesentlichen an einer insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg in allen Ländern stetig zunehmenden Verschiebung des Zeitpunkts, ab dem es eine Restlebensdauer von 5 oder 10 Jahren gibt, ins immer höhere Alter belegt, wobei der Abstand zwischen beiden Tendenzen in etwa gleich bleibt. Seit 170 Jahren, seit dem gibt es in Schweden Lebenserwartungsstatistiken, verlängert sich das Leben pro Jahr durchschnittlich um drei Monate und hat, das sei den vielen zeitgenössischen Demografie-Auguren ins Stammbuch geschrieben, fast jede für absolut und unüberwindbare Altersmarke übersprungen.
Der Trefferstand in dem im "forum-Gesundheitspolitik" schon öfter erwähnten "Spiel" zwischen "compression of morbidity" und "Medikalisierung" verbessert sich damit zugunsten der Kompressionshypothese gut und gern auf 8:1.
Eine zweite wichtige Erkenntnis der Forschung über die Zunahme so genannter Hochbetagter lautet, dass Altern und die Umstände des Alterns beeinflussbar sind. Dabei spielten aber bisher nicht der medizinisch-technische Fortschritt und die genetische Disposition die entscheidenden Rollen, sondern "ein allgemeiner Anstieg im Lebensstandard, eine bessere Ernährung, Fortschritte in der Medizin und in der Gesundheitsversorgung sowie soziale Errungenschaften, wie etwa der erhöhte Zugang der Menschen zu Bildung" in einem bestimmten Mischungsverhältnis.
Wenn man über die gesellschaftlichen Konsequenzen des immer später eintretenden Alterungsprozesses nachdenkt, wird klar, dass sich hier auch Spreng- oder Konfliktstoff verbirgt. Hält man an den Berentungsgrenzen 60 und 65 Jahren fest, bedeutete es, dass demnächst immer mehr Menschen berentet werden, die den längsten erwachsenen und relativ autonomen Zeitabschnitt ihres Lebens erst bzw. noch vor sich haben.
Alternativ, so Vaupel, könnte eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit über die heutigen Altersrentenjahre hinaus zum einen helfen, dass das gegenwärtige Arbeitsstundenvolumen und damit ein wichtiger Faktor des heutigen und künftigen Wohlstands erhalten bleibt und dies sogar bei weniger Arbeitsstunden pro Person. Dass dies nicht bei allen Tätigkeiten geht, sollte nicht die reflexartige Beendigung dieser gesamten Diskussion provozieren, sondern der Ausgangspunkt einer Suche nach unbelastenderen Alterstätigkeiten für Dachdecker oder Krankenschwestern sein. Und wie der umstrittene Versuch der "Rente mit 67" zeigt, sollten solche andere Beschäftigungszeiten auch nicht nur zu Rentenabschlägen führen oder indirekt Beiträge zur Entlastung der Rentenkassen und des Bundeshaushalts sein.
Diese Debatte in aller Ausführlichkeit zu führen und sich auch zu streiten ist angesichts der langsam erdrückenden Datenlage zur tatsächlichen Dynamik des Alterns allemal besser als das dumpfe Räsonnieren über das Menetekel der "demografischen Bedrohung".
Der Aufsatz "Biodemography of human ageing" von James W. Vaupel ist in der Zeitschrift "NATURE" (Vol 464 vom 25.3. 2010: 536-542) erschienen und komplett kostenlos zu erhalten. Trotz seiner Kürze vermittelt er eine komplette Übersicht über die Inhalte und Quellen der seriösen demografischen Forschung, die zum Weiterlesen animiert.
Die deutschsprachige Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse des Aufsatzes findet sich unter der Überschrift "Eine angeborene Lebensspanne gibt es nicht" in der Nummer 2/2010 des u.a. vom Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung herausgegebenen kostenlosen Informationsdienstes "Demografische Forschung aus erster Hand".
Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht zurücklehnen und vom unaufhaltsamen Nahen ihres hundertjährigen Geburtstags träumen, enthält das genannte Heft des Informationsdienstes aber auch noch eine gehörige Portion Essig. Mit der Überschrift "Wirtschaftskrisen kosten zehn Monate Lebenszeit" deutet ein Autorenteam nämlich die Wahrscheinlichkeit an, dass andere beeinflussbare soziale Ereignisse auch lebenserwartungsverkürzend wirken können.
Bernard Braun, 22.7.10
"Todesursache" Nr. 1: Herzstillstand! Wie groß und inhaltlich folgenschwer ist das Elend der Todesursachenstatistik?
 Zu den Klassikern unter den in der weltweiten Gesundheitsberichterstattung verwandten Indikatoren der gesundheitlichen Lage gehören die Häufigkeit und die Ursachen der Sterbefälle. Damit handelt es sich auch um die meistverwendeten Indikatoren in Gesundheitssystemvergleichen.
Zu den Klassikern unter den in der weltweiten Gesundheitsberichterstattung verwandten Indikatoren der gesundheitlichen Lage gehören die Häufigkeit und die Ursachen der Sterbefälle. Damit handelt es sich auch um die meistverwendeten Indikatoren in Gesundheitssystemvergleichen.
Ebenso klassisch ist aber die Bemerkung, man könne zumindest die Verlässlichkeit oder Validität der Hauptinformationsquelle zu den qualitativen Details der Sterbefälle, nämlich die Todesursachenbescheinigungen "vergessen" - vor allem auch, wenn diese von niedergelassenen Ärzten ausgestellt wurden. Dies bestätigte sich auch in Studien, die die attestierten Todesursachen im Rahmen von Obduktionen überprüften. Zusätzlich zu den daraus ableitbaren Unsicherheitsquoten bei den normalen Todesursachenbescheinigungen, gab es aber Hinweise darauf, dass sowohl intertemporale als auch internationale oder -regionale Todesursachenstatistiken wegen einer Vielzahl von Schwächen mit Vorsicht zu nutzen und zu genießen sind. Wie groß die Vorsicht dabei sein sollte, konnte man bisher aber nicht ausreichend quantifizieren.
Eine gerade erschienene Studie von sechs us-amerikanischen Gesundheitsstatistikern der University of Washington in Seattle schafft hier erheblich Abhilfe. Sie benennen nicht nur die Fehlerquellen, sondern quantifizieren auch die durch sie produzierten Fehleinschätzungen.
Wesentliche Ursachen für die fehlerhafte und qualitativ mängelbehaftete Berichterstattung über Todesursachen selbst in den Ländern mit ausgezeichneten Gesundheitsberichterstattungssystemen gibt es nach den AutorInnen mehrere.
Dazu gehören
• die regelmäßigen Veränderungen der "International Statistical Classification of Disease and Related Health problems (ICD)". Wer die Entwicklung der Sterblichkeit im gesamten 20 Jahrhundert untersuchen will, muss Daten verwenden, die auf der Basis von fünf Versionen der "International List of Causes of Death (ILCD)" und danach von weiteren fünf Versionen der ICD (aktuelle Version ICD 10) bestimmt worden sind. Der Übergang von der reinen Todesursachenklassifikation ILCD zu den Mortalitäts- und Morbiditäts-Klassifikationen ICD 6-10 weitete die Anzahl der Ursachen von 179 auf rund 20.000 aus. Die zunehmende Komplexität und Unübersichtlichkeit trug dazu bei, dass weder im selben Land noch international immer die aktuellste Version benutzt wurde oder die differenzierteren Möglichkeiten gar nicht oder nur zeitverzögert ausgenutzt wurden.
• Um das Problem mit der Fülle von Todesursachen praktisch bewältigen zu können, gab es ab der ICD 6 Kurzformen oder "Kitteltaschenversionen" der ICD-Todesursachen. Deren unterschiedliche Zusammensetzungen und die gleichzeitige Anwendung des gesamten ICD-Katalogs machen die Gewinnung von Zeitreihen von Todesursachen nicht einfacher und inaltlich valide.
• Eine dritte Ursache für die inhaltlichen Mängel von Todesursachenstatistiken folgt aus dem Nebeneinander von Mortalitäts- und Morbiditätsursachen in den ICD-Versionen. Dies meint, dass Ärzte Diagnosen als Todesursachen benennen, die weder aus klassisch medizinischer noch aus Public Health-Sicht wirklich zum Tode führen können. Die WHO-VerfasserInnen der ICD-Klassifikationen haben dem sogar selber Rechnung getragen indem sie im Anhang der ICD-Codes eine "List of conditions unlikely to cause death" einfügten. Trotzdem war damit nach Expertenmeinung das Problem der so genannten "garbage codes" oder des "garbage coding" nicht verschwunden.
Wozu diese Fehler-Ursachen quantitativ führten haben die MedizinstatistikerInnen aus Seattle nun auf der Basis von 4.434 Länderjahren mit Todesursachendaten aus 145 Ländern im Zeitraum von 1901 bis 2008 genauer untersucht. Die Datenbasis umfasste 743 Millionen Todesfälle während des Geltungs- und Nutzungszeitraums der ICD-Versionen 1 bis 10. Die Wissenschaftler erstellten damit länderspezifische Todesursachenlisten und eine Public health-orientierte Todesursachenliste mit 56 Ursachen. Für jede Klassifikationsversion identifizierten sie außerdem die Arten und die Anzahl von "Mülldiagnosen oder -ursachen" und versuchten mit aufwändigen Methoden an ihrer Stelle die wirklichen Ursachen zu eruieren. Dabei unterschieden sie vier Arten von "Müll-Todesursachen" zu denen u.a. eindeutig unzutreffende oder die wahren Ursachen verhüllende Sachverhalte wie der Risikofaktor essentieller Bluthochdruck oder das Herzversagen als letztes Ereignis des Wirkens einer Reihe von Ursachen gehören.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Bemühungen sind:
• Der Anteil von Todesfällen, die mit "Müllursachen" fehlklassifiziert wurden, verändert sich über alle Länder hinweg und auch zwischen den einzelnen ICD-Versionen erheblich.
• Untersucht man die Daten sämtlicher Länderjahre ging der Anteil von "Müllursachen" von 43 % während des Geltungszeitraums der ICD 7 auf 24 % innerhalb der noch laufenden ICD 10-Zeit zurück.
• Im Jahr 2005 variierte der Anteil von falschen bzw. unbrauchbaren Todesursachen zwischen 11 % im austral-asiatischen Bereich und mehr als 50 % in Ländern wie Thailand.
• Die Arten der "Müllursachen" variierten zusätzlich noch erheblich nach dem Alter der Gestorbenen.
• Wenn man versucht, die "Müll-Todesursachen" durch wahrscheinlich tatsächliche Todesursachen zu ersetzen und dann z.B. altersstandardisierte Todesraten neu berechnet, verändern sich beispielsweise internationale Rangreihen nicht unwesentlich: In der Rangreihe der ischämischen Herzerkrankungen verändert sich die Rangfolge von 83 Ländern im Jahr 2005 so: Der Rang von 19 Ländern verändert sich um 2-4 Positionen und der von 49 Ländern um 5 oder mehr Rangpositionen nach oben oder unten. Bei den tödlichen Verkehrsunfällen ist der Effekt noch wesentlich stärker. Noch bedeutender wird die Kontrolle und Korrektur falscher Todesursachen aber im Bereich der nichtübertragbaren Erkrankungen wie z.B. Diabetes wo sich durch die genannten Korrekturen etwa Trendrichtungen in der Zeit umkehren. Ähnlich folgenreich erweisen diese Todesursachenkorrekturen sich beim genauen Timing der sozial- und gesundheitspolitisch relevanten epidemiologischen Transition.
Im Aufsatz und in 5 Anhängen legen die WissenschaftlerInnen umfassende Daten zu den Arten und dem Umfang der "Müll-Todesursachen" und den Folgen ihrer inhaltlichen Korrekturen für die Statistik von 56 Public health-relevanten Diagnosebereichen vor.
Nach Kenntnis der Anzahl falschklassifizierter Todesursachen und nach Kenntnis der inhaltlichen Auswirkungen für die Gesundheitsberichterstattung sollte noch mehr und intensiver als in der Vergangenheit versucht werden, die Diagnosequalität der Todesursachenbescheinigungen durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen für Ärzte und andere damit betraute Personen deutlich zu verbessern.
Der Aufsatz "Algorithms for enhancing public health utility of national causes-of-death data" von Mohsen Naghavi, Susanna Makela, Kyle Foreman, Janaki O'Brien, Farshad Pourmalek und Rafael Lozano ist als "Open access"-Beitrag und damit komplett kostenlos in der Fachzeitschrift "Population Health Metrics" (2010, 8:9) erschienen. Die Anhänge sind durch Links im Text zugänglich.
Bernard Braun, 13.6.10
Zu Hause betreute Demenzkranke leben über 2 Jahre länger als wenn sie in Heimen gepflegt würden. Was folgt daraus?
 Bei manchen Forschungsergebnissen stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, sie existierten nicht oder man müsste sich nicht mit den praktischen Konsequenzen auseinandersetzen.
Bei manchen Forschungsergebnissen stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, sie existierten nicht oder man müsste sich nicht mit den praktischen Konsequenzen auseinandersetzen.
Dies gilt beispielsweise für die Antwort auf die Frage "Leben Demenzkranke zu Hause länger als im Heim?", die am 5.April 2010 in einem Online-First-Beitrag in der Fachzeitschrift "Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie" erschienen ist. Sie beruht auf einer bemerkenswerten und in ihrer Art sehr seltenen Follow up-Studie, die mit 173 in einer Ambulanz der Uniklinik Bochum diagnostizierten Demenzkranken zwischen 1995 und 2001 bzw. 2006 durchgeführt wurde. Beim Erstkontakt lebten 48 der Patienten mit vollständiger Datenlage in einem Seniorenheim, die restlichen 97 Demenzkranken mit kompletten Daten wurden zuhause gepflegt.
Wie die ForscherInnen aus verschiedenen Kliniken betonen, sind Frage wie Antwort deshalb von großer Bedeutung, weil bei wahrscheinlich zunehmender Inzidenz von Demenz bei älteren Menschen die "Deckung der Kosten, die durch Demenzkranke verursacht werden, und die Sicherstellung ihrer adäquaten Betreuung" wichtige gesellschaftliche Fragen sind. Dabei gibt es bereits ohne diese Studie einige ethisch schwierigen Konstellationen. Dazu zählt u.a. das Neben- und Gegeneinander des auch bei dementen Personen bekannten Wunsches, solange wie möglich zuhause gepflegt zu werden und der enormen psychischen, psychosozialen und -mentalen Belastungen, denen pflegende Angehörige bis hin zur eigenen Psychiatrisierung ausgesetzt sind.
Die Studie der fünf Ärzte und Gerontologen kommt nun zu folgenden Ergebnissen:
• Die Sterblichkeit von Alzheimer-Patientenhängt hauptsächlich vom Alter und vom Schweregrad der Demenz ab. Demenzkranke Frauen leben länger als demenzkranke Männer.
• Im Seniorenheim gepflegte Patienten haben nach Ausschluss des Einflusses von Alters-, Geschlechts- und vor allem Schweregradunterschieden ein signifikant um 53,1% höheres relatives Sterberisiko (p=0,047) als zu Hause gepflegte Betreute. Dies entspricht absolut und maximal einem um 2,2 Jahre längeren Leben, was je nach Bewertung methodischer Besonderheiten leicht kürzer ist, aber bei einem anderen prospektiven Design auch "deutlich höher" liegen könnte.
Unter dem Ziel der Verlängerung von Lebenszeit bedeutet also eine Heimunterbringung eine bisher so nicht bekannte gravierende Verkürzung der "medianen Überlebenszeit".
Was es noch bedeutet, deuten die Autoren dann an, wenn sie nach der praktischen Bedeutung der Abschätzung von Überlebenszeiten fragen: "Angehörige bezüglich der Prognose fundierter beraten zu können, damit diese besser ihre eigenen Grenzen erkennen und sich entsprechend für eine häusliche oder in-stitutionelle pflegerische Versorgung entscheiden können. Dies hätte im Sinne einer psychiatrischen Primärpräventi¬on eine Verbesserung des Gesundheitzustandes der pflegenden Angehörigen zur Folge, da diese eine Hochrisikopopulation für psychiatrische Morbidität darstellen."
Die anschließende konkrete Schilderung der enormen Belastungsfolgen bei pflegenden Angehörigen von Demenzkranken und die Darstellung einiger struktureller Vorteile der Heimunterbringung (z.B. besserer Umgang mit Mangelernährung, Dehydrierung und dem oft gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus von Demenzkranken, befreit nicht von dem Druck des jetzt sogar quantifizierten Lebensverkürzungseffekt einer "vernünftig" erscheinenden Entscheidung zu Gunsten einer Heimunterbringung.
Offen bleibt in der Studie aber leider u.a. auch, warum unter den für die genannten Aspekte der Lebensqualität von Alzheimerpatienten und die Lebensqualität pflegender Angehöriger vorteilhaften Heimbedingungen die Pflegebedürftigen um Jahre früher sterben. Immerhin weisen die ForscherInnen auf die Unterbeachtung der Lebensqualität von Demenzkranken hin und die vermutlich in Heimen weniger berücksichtigten und befriedigten sozialen Bedürfnisse nach zwischenmenschlichen Kontakten und sinnvoller Beschäftigung.
Wer als Wissenschaftler Angehörige nicht unter einen extremen Rechtfertigungs- und möglicherweise Missbilligungsdruck setzen oder geraten lassen will, wenn sie eine Heimunterbringung für notwendig halten, und wem über zwei Lebensjahre für Demenzkranke nicht gleichgültig sind, muss also so schnell und klar wie möglich sagen, wie entweder die mortalitätsfördernden Bedingungen in Seniorenheimen geändert werden können oder wie Demenzkranke zu Hause betreut werden können ohne dass die Betreuenden selber schwer körperlich und psychisch erkranken.
Der 5 Seiten umfassende Aufsatz ""Leben Demenzkranke zu Hause länger als im Heim?" von D. Lankers, S. Kissler, S.D. Hötte, H.J. Freyberger und S.G. Schröder ist Online-First am 5.4.2010 in der Fachzeitschrift "Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie" (DOI: 10.1007/s00391-010-0096-7) erschienen und kostenlos lediglich als Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 22.4.10
Eine gute und eine schlechte Nachricht zur Sterblichkeit von Diabetikern
 Die gute Botschaft zuerst: Die Sterblichkeit von Menschen mit einer Diabetes mellitus Typ 2-Erkrankung in der kanadischen Provinz Ontario sank alters- und geschlechtsstandardisiert zwischen 1995 und 2005 von 4,05% auf 2,69%.
Die gute Botschaft zuerst: Die Sterblichkeit von Menschen mit einer Diabetes mellitus Typ 2-Erkrankung in der kanadischen Provinz Ontario sank alters- und geschlechtsstandardisiert zwischen 1995 und 2005 von 4,05% auf 2,69%.
Dies ist für die weltweit mit dramatisierender Vehemenz geführte Diskussion über die "Volksseuche" Diabetes eine wichtige Entwicklung, die Atem schafft, eher über Prävention und die leitliniengerechte bzw. evidenzbasierte Behandlung von DiabetikerInnen (z.B. die immer noch zu nachlässige systematische Untersuchung von Augen und Füßen, um die Erblindung und die Amputation unterer Extremitäten als schlimme Endpunkte zu vermeiden) zu reden.
Die 10-Jahresuntersuchung stützt sich auf eine bevölkerungsbezogene retrospektive Kohortenanalyse der Sterblichkeit mit 367.426 im Jahr 1994/95 an Diabetes erkrankten TeilnehmerInnen im Alter von 30 und mehr Jahren in der kanadischen Provinz Ontario. Die Anzahl der Erkrankten stieg bis zum Jahr 2005/06 auf 843.629 Personen, was wiederum vielen pessimistischen Prognosen als empirischer Beleg der von ihnen erwarteten Tendenz dient oder genügt. Schaut man etwas genauer hin, finden sich zum Teil andere Trends: In derselben Zeit stieg beispielsweise der Anteil der 30 Jahre und älteren Einwohner ohne (!) Diabetes um 17% von 5.907.012 auf 6.888.074. Die Analysen wurden mit Hilfe von Daten aus der Bevölkerungsstatistik und administrativer Gesundheitsdaten des regionalen Krankenversicherungsträgers geführt, bei dem alle Einwohner Ontarios versichert sind. Für Personen, die älter als 64 Jahre sind, gibt es materielle Unterstützung für verordnete Arzneimittel und bei Bedarf auch soziale Unterstützung ("social assistance"). Unter den soziodemografischen Verwaltungsdaten befinden sich auch Angaben zum Einkommen.
Und damit hängt die schlechte Nachricht zusammen. Sie lautet: Die Abnahme der Sterblichkeit ist bei Erkrankten mit hohem Einkommen wesentlich höher als bei Versicherten mit niedrigerem Einkommen. Bei den Gutverdienenden oder Angehörigen der höchsten Einkommensgruppe sank die Sterblichkeit an Diabetes bzw. Diabetesfolgen um 39% und bei Personen mit dem niedrigsten Einkommen statistisch signifikant verschieden um 31%. Auch hier liefert eine differenzierte Analyse noch deutlichere Aussagen: Betrachtet man nur die Gruppe der 30-64-Jährigen DiabetikerInnen betrug der Unterschied der Chance der Abnahme des Sterblichkeitsrisikos ("mortality rate ratio") von Gering- und Vielverdienern mehr als 40 Prozent. Bei weiblichen Geringverdienern betrug die Abnahme 12% (Männer: 14%) und bei den Gutverdienenden 59 % (Männer: 60%). Bei den über 64-Jährigen hatte das Einkommen einen geringeren Einfluss auf die Sterblichkeitstrends. Der einkommensabhängige Unterschied der Sterblichkeit von DiabetikerInnen beider Einkommensgruppen in diesem Alter wuchs in den 10 Untersuchungsjahren nur um 0,9%. Die AutorInnen der Studie werten diese relativ geringen ungleichen Trends bei Rentnern u.a. als Ausdruck der materiellen Unterstützung/Subvention ihrer Versorgung. Welche Faktoren im Detail und ursächlich für die einkommensabhängigen Unterschiede in anderen Altersgruppen verantwortlich sind, lässt sich noch nicht abschließend sagen.
Ausdrücklich weisen die VerfasserInnen auf die Existenz derartiger Mortalitätsunterschiede selbst in dem eher auf soziale Gleichheit orientierten Gesundheitssystem wie dem Kanadas hin.
Der Aufsatz "Income-related differences in mortality among people with diabetes mellitus" von Lorraine L. Lipscombe, Peter C. Austin, Douglas G. Manuel, Baiju R. Shah, Janet E. Hux und Gillian L. Booth ist im "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" (2010; 182 E1-E17) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.1.10
Ökonomie der Aufmerksamkeit: Täglich 13.000 tote Kinder und Mütter in Afrika und weltweit 6.250 Schweinegrippetote in 7 Monaten
 Während in Deutschland mit dem Tod von 16 Personen (Stand vom 13.11.2009) die Notwendigkeit des mehrere Hundert Millionen Euro schweren Schweinegrippe-Impfprogramms gerechtfertigt oder bestritten wird und der Fall des bisher einzigen Menschens, der nach Inanspruchnahme dieser Impfung mutmaßlich daran gestorben ist, wahrscheinlich erneut erbitterte Debatten über ihren Nutzen und mögliche Alternativen auslöst, sterben in anderen Ländern oder Regionen der Erde eine vielfache Anzahl von Menschen, ohne dass dies auch nur irgendjemand außerhalb dieser Regionen interessiert, aufregt oder über Gegenmaßnahmen nachdenken lässt.
Während in Deutschland mit dem Tod von 16 Personen (Stand vom 13.11.2009) die Notwendigkeit des mehrere Hundert Millionen Euro schweren Schweinegrippe-Impfprogramms gerechtfertigt oder bestritten wird und der Fall des bisher einzigen Menschens, der nach Inanspruchnahme dieser Impfung mutmaßlich daran gestorben ist, wahrscheinlich erneut erbitterte Debatten über ihren Nutzen und mögliche Alternativen auslöst, sterben in anderen Ländern oder Regionen der Erde eine vielfache Anzahl von Menschen, ohne dass dies auch nur irgendjemand außerhalb dieser Regionen interessiert, aufregt oder über Gegenmaßnahmen nachdenken lässt.
Aktuell gemeint ist die Tatsache, dass in der so genannten Sub-Sahara-Zone Afrikas jährlich 265.000 Mütter an Komplikationen während einer Schwangerschaft und einer Geburt sterben, 1.243.000 Babies innerhalb ihres ersten Lebensmonats sterben und 3.157.000 Kinder, die den ersten Lebensmonat überlebt haben, vor ihrem fünften Geburtstag sterben. Dies bedeutet, dass in dieser Region jeden Tag mehr als 13.000 Kinder und Mütter sterben - rund die Hälfte aller weltweit sterbenden Kinder und Mütter. 880.000 totgeborene Kinder wurden dabei noch nicht einmal berücksichtigt.
Nur um noch einen weiteren Einblick in die Ökonomie oder Priorisierung der Aufmerksamkeit gewinnen zu können: In der gesamten WHO-Region Afrika sind nach WHO-Angaben bis Anfang November 2009, also in ca. 7 Monaten Schweinegrippe-Pandemie, 103 Menschen an ihr gestorben.
Die aktuellen Zahlen zur Kinder- und Müttersterblichkeit im ärmsten Teil Afrikas und die Behauptung, das Leben von beinahe 4 Millionen Frauen, Neugeborenen und Kinder in dieser Region könne gerettet werden, wenn eine Reihe wissenschaftlich evidenter, erprobter und finanziell erschwinglicher Gesundheitsinterventionen 90% der Familien erreichen würden, gehören zu den wesentlichen Aussagen eines Reports, den die nationalen wissenschaftlichen Akademien von sieben afrikanischen Ländern am 9. November 2009 auf der jährlichen Konferenz der "African Science Academy Development Initiative" in Accra, Ghana, vorgestellt haben.
Zu den für wirksam gehaltenen Interventionen gehören die Erhältlichkeit von Verhütungsmitteln, gut ausgebildete GeburtshelferInnen, Belebungsprogramme für Neugeborene und insgesamt verbesserte Versorgung von Neugeborenen, ein Fallmanagement für Lungenentzündungen, die Förderung des Stillens, die Malariaprävention und die Durchführung ausgewählter Impfungen. Den enormen maximalen Wirkungsgrad dieser Interventionen berechneten die afrikanischen WissenschaftlerInnen mittels des Analyseprogramms "Lives Saved Tool (LiST)".
Die Einführung dieser Interventionen in den neun für die Berechnungen ausgewählten Ländern der Region (Ghana, Kenia, Senegal, Tansania, Uganda, Kamerun, Südafrika, Nigeria und Äthiopien) würde in zwei Jahren 2 US-$ pro Kopf der Bevölkerung kosten.
Der Bericht enthält über die Anzahl von Toten hinaus zahlreiche statistische Angaben zu den Gesundheitsverhältnissen in dieser Region der Welt, zu den dort existierenden Gesundheitssystemen und auch eine Anzahl von Beispielen für die Machbarkeit und den Erfolg derartiger Programme.
Das Aufwiegen und -rechnen von Toten ist natürlich keine wissenschaftlich und moralisch zulässige Methode. Trotzdem ist dem folgenden Satz aus einem Kommentar zum Nebeneinander der Vernachlässigung der ebenfalls für ein Sechstel der Weltbevölkerung potenziell tödlichen Unternährung und des mit Milliardenaufwand geführten Kampfes gegen die Schweinegrippe im renommierten Medizin-Journal "Lancet" vom 31. Oktober 2009 uneingeschränkt zuzustimmen: "Es ist schwierig, sich eine andere Situation vorzustellen, die gegenwärtig mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung beeinträchtigt. Eine, die durch reichlich vorhandene Hinweise auf negative gesundheitliche Spätfolgen gekennzeichnet ist, und die durch einfache Maßnahmen - nämlich Nahrung - behoben werden könnte, und bei der Vorbeugung elementar ist - ausreichend Nahrung muss verzehrt werden (bevorzugt unverarbeitete Kost, die vor Ort gekocht und zubereitet werden kann). Wäre die Unterernährung eine Krankheit wie H1N1, und wären unverarbeitete Lebensmittel Medikamente oder Impfstoffe, dann genössen beide die volle Aufmerksamkeit der gesamten internationalen Gemeinschaft."
Der 23 Seiten umfassende und trotz seiner Kürze sehr materialreiche Report "SCIENCE IN ACTION. Saving the lives of Africa's mothers, newborns, and children ist kostenlos erhältlich.
Den kompletten Text des Kommentars "The undernutrition epidemic: an urgent health priority" in The Lancet, Volume 374, Issue 9700, Page 1473, 31 October 2009 erhält man komplett und kostenlos nur (also nicht ärgern, dass dieser Link nicht zum kompletten Text führt), wenn man sich ebenfalls kostenlos für den Service für teilweise freien Zugang dieser Zeitschrift anmeldet. Macht man dies braucht man keine Belästigung durch Werbung etc. zu befürchten.
Bernard Braun, 14.11.09
Jüngerer Partner = Jungbrunnen oder Sterberisiko? Es kommt aufs Geschlecht an!
 Die talkshowtaugliche Floskel "die Menschen leben immer länger" verbirgt, so die sozialepidemiologische Forschung, eine Menge Ungleichheiten. Darunter fallen die Unterschiede zwischen städtischer und ländlicher, armer und reicher, gebildeter und ungebildeter sowie auch der Unterschied zwischen verheirateten oder mit Partner lebenden und alleinstehenden Personen.
Die talkshowtaugliche Floskel "die Menschen leben immer länger" verbirgt, so die sozialepidemiologische Forschung, eine Menge Ungleichheiten. Darunter fallen die Unterschiede zwischen städtischer und ländlicher, armer und reicher, gebildeter und ungebildeter sowie auch der Unterschied zwischen verheirateten oder mit Partner lebenden und alleinstehenden Personen.
Etwas, was trotz des Hinweises auf die Bedeutung von Partnerschaft im Allgemeinen in dieser differenzierenden Reihe bisher nicht vorkam, ist der Altersabstand zwischen Partnern.
Eine aktuelle Studie aus dem renommierten Rostocker "Max-Planck-Instituts für demografische Forschung" mit umfänglichen Personenstandsdaten aller Einwohner Dänemarks zwischen 1990 und 2005 schließt diese Wissenslücke und fördert Interessantes zutage.
Die Forschungsfrage, ob der Altersabstand zum Ehepartner die Lebenserwartung von Frauen und Männern beeinflusst und dies sogar unterschiedlich, wurde durch vielfache Vergleiche der relativen Sterberisiken von Paaren in verschiedenen Altersgruppen mit einer Referenzaltersgruppe des gleichen Geschlechts ermittelt, die mit einem praktisch gleichaltrigen Partner zusammen leben.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Männer, die mit einer jüngeren Partnerin zusammen leben, profitieren davon. Je größer der Altersabstand zur Partnerin ist, desto höher ist ihre Lebenserwartung. Wenn Männer 7 bis 9 Jahre älter sind, haben sie ein 11% geringeres Sterberisiko als Männer gleichen Alters mit einer gleichaltrigen Partnerin. In der Gruppe mit dem maximalen Abstand von 15 bis 17 Jahren ist das Sterberisiko vergleichsweise um 19% niedriger. Ob der "Gewinn" noch größer wird, wenn der Altersabstand noch größer ist, ist mangels entsprechender Untersuchungen nicht bekannt.
• Wenn Männer eine ältere Partnerin haben, steigt dagegen ihr Sterberisiko und zwar bei einem Altersabstand von 7 bis 17 Jahren um rund 22%.
• Bei Frauen wirken sich dagegen Altersabstände systematisch anders aus: Sie haben das geringste Sterberisiko, wenn sie und ihr Partner gleichaltrig sind. Ist ihr Partner jünger steigt ihr Sterberisiko und zwar um rund 20%, wenn ihr Partner 7 bis 9 Jahre jünger ist - wiederum im Vergleich mit einer Partnerschaft in der Frau wie Mann in etwa gleich alt sind.
• In Partnerschaften eines jüngeren Manns mit einer älteren Frau haben zumindest in Dänemark beide Partner ein erhöhtes Sterberisiko.
Unklar bleibt in der Studie, wie die beobachteten und teilweise gegenläufigen Effekte und vor allem die für die Lebenserwartung von Frauen viel gravierenderen Auswirkungen einer Partnerschaft mit einem jüngeren Mann zu erklären sind. Mit Sicherheit spielen dabei eine Menge sozialer, psychologischer und geschlechtsspezifischer Faktoren, Normalitätsnormen und Vorurteile eine Rolle. Zu denken ist dabei z.B. daran, dass die vermutete Beziehung des gestandenen SPD-Vorsitzenden Müntefering zu einer 40 Jahre jüngeren Frau unter dem Etikett "toller Hecht" durchaus die Lebensfreude Münteferings fördern kann, während schon die Beziehungen der prominenten 50-jährigen Entertainerin Madonna mit wesentlich jüngeren Männern naserümpfend als "peinlich" bewertet werden. Frauen mit geringerem Selbstwertgefühl als Madonna könnten darunter leiden - was sich möglicherweise auf ihre Lebenserwartung auswirkte. Wenn es sich nicht um prominente Partner handelt, hält es die Studie aus Rostock für möglich, dass Partnerschaften zwischen einem jüngeren Ehemann und einer älteren Ehefrau so stark "unter Druck" geraten, dass dadurch ein negativer Einfluss auf die Lebenserwartung beider entsteht.
Eine Zusammenfassung unter der Überschrift "Ein jüngerer Partner - ein längeres Leben?" der demnächst in der Zeitschrift "Demography" erscheinenden Studie "How does the age gap between partners affect their survival?" von Sven Drefahl ist kostenlos in der neuesten Ausgabe (Jahrgang 6, Nr. 1/2009) des vierteljährlich erscheinenden und uneingeschränkt empfehlenswerten und bestellbaren Newsletter "Demografische Forschung Aus erster Hand" des Max-Planck-Instututs für demografische Forschung, des Rostocker Zentrums zur Erforschung des demografischen Wandels und des Vienna Institute of demography erhältlich.
Bernard Braun, 28.5.09
Licht am Ende des langen dunklen Tunnels der Debatte über Gesundheit und Alter in Deutschland? Ein Bericht von RKI, StaBu und DZA
 Immer wenn die Zukunft der Gesundheit und der Finanzierung von Gesundheitssystemen so richtig dunkel erscheinen soll, wird seit geraumer Zeit je nach Temperament die demographische "Entwicklung" oder "Katastrophe" bemüht: Alt, älter, kränker, teurer und kollektiv unfinanzierbar aber immer öfter das Eldorado der Gesundheitswirtschaft.
Immer wenn die Zukunft der Gesundheit und der Finanzierung von Gesundheitssystemen so richtig dunkel erscheinen soll, wird seit geraumer Zeit je nach Temperament die demographische "Entwicklung" oder "Katastrophe" bemüht: Alt, älter, kränker, teurer und kollektiv unfinanzierbar aber immer öfter das Eldorado der Gesundheitswirtschaft.
Dass an einigen der Grundannahmen wenig oder nichts stimmt, wird seit einiger Zeit und vorwiegend im internationalen Rahmen intensiver diskutiert als im GKV-System. Dies gilt vor allem für die Stimmigkeit der Annahmen mit der Zunahme der Lebenserwartung sei eine Morbiditätsexpansion verbunden versus der Annahme, dass die Anzahl der gesunden Lebensjahre zunimmt und der Großteil der Morbidität ans Lebensende verschoben oder völlig bewältigt wird. Der internationale Forschungsstand gab einem der letzten "Alter-und-Gesundheit"-Beiträge im Forum-Gesundheitspolitik Anlass von einem "Spielstand" von 4:1 für die "compression of morbidity" zu sprechen.
Mit dem in der Reihe "Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes" 2009 erschienenen, 323 Seiten umfassenden Band zum Thema "Gesundheit und Krankheit im Alter" haben die drei HerausgeberInnen Böhm (Statistisches Bundesamt), Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Altersfragen) und Ziese (Robert Koch-Institut), deren Institute in diesem Bereich enger zu kooperieren beabsichtigen, eine bemerkenswert gründliche, verständliche und für die Bundesrepublik Deutschland aktuell empirisch gestützte Analyse vorgelegt. Ihre Analyse bricht mit einigen der reflexartigen Verständnisse über Alter und Gesundheit und unterstützt damit einen längst überfälligen Paradigmawechsel in diesem Bereich der gesundheitspolitischen Debatte.
Die Darstellung gliedert sich in die Abschnitte: theoretische Positionen zum Alter und Altern, Gesundheitszustand und Gesundheitsentwicklung mit der Frage, ob der demografische Wandel zu einer Kompression oder Expansion der Morbidität führen wird, gesundheitsrelevante Lebenslagen und Lebensstilen mit einer Erörterung der Frage »Wie wichtig ist Prävention?, Angebote gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung
für alte Menschen, Beiträge zu den ökonomischen Chancen und Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und der Frage, ob Gesundheit unter den Bedingungen von Demografie und Fortschritt bezahlbar bleibt.
Die wesentlichen Forschungsergebnisse zum Verhältnis von Gesundheit/Krankheit und Alter sowie der Morbiditätslast älterer Menschen sehen nach der Ansicht und im Originalton der AutorInnen aus dem RKI und seinen Kooperationspartnern so aus:
• "Es ist noch nicht endgültig zu beantworten, ob die Verlängerung der Lebenszeit im Alter auch mit einer Zunahme der Lebensjahre ohne substanzielle funktionale Einschränkungen einhergeht. Es überwiegen allerdings die Studien, die Verbesserungen in der funktionalen Gesundheit Älterer in den letzten Jahren nachweisen."
• "Entscheidend für weitere Erfolge bei der Verbesserung der funktionalen Gesundheit wird daher sein, inwieweit es gelingt, ältere Menschen über gesundheitsförderliches Verhalten zu informieren und sie zu Veränderungen im Gesundheitsverhalten zu motivieren."
• "Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Verschlechterung der subjektiven Gesundheit keiner altersinhärenten Gesetzmäßigkeit folgt. Vielmehr tragen vielfältige individuelle und gesellschaftliche Bedingungen dazu bei, ob und in welchem Ausmaß sich die subjektive Gesundheit mit steigendem Alter verschlechtert."
• Zwar argumentieren die AutorInnen zunächst relativ zögerlich: "Eine empirisch noch ungeklärte Forschungsfrage ist, inwiefern der Zugewinn an Lebensjahren ein längeres Leben bei guter Gesundheit impliziert. In der Tendenz verzeichnen die Länder mit einer sehr hohen Lebenserwartung auch die größeren Anteile an gesunden Lebensjahren." An anderer Stelle lautet die "Kernaussage" dann aber recht deutlich: "Auch wenn in Deutschland nur wenige Datenquellen zur Entwicklung der gesunden Lebenserwartung zur Verfügung stehen, deuten die vorliegenden Ergebnisse auf eine Zunahme der Lebenserwartung in Gesundheit hin."
• Außerdem: "Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorliegenden Ergebnisse auf einen Anstieg der gesunden Lebenserwartung seit Ende der 1980er-Jahre hindeuten. Es kam im Zuge der ansteigenden Lebenserwartung zu einer relativen Kompression chronischer Morbidität. Die Befundlage zur Entwicklung der gesunden Lebenserwartung in Deutschland stimmt mit den internationalen Ergebnissen überein. Ein Anstieg zeigt sich anhand unterschiedlicher Datenquellen und auf Basis verschiedener Gesundheitsindikatoren. Im Kohortenvergleich haben sich der Anteil und das Ausmaß der gesundheitlich beeinträchtigten Lebenszeit bei Männern und Frauen insbesondere für starke gesundheitliche Beeinträchtigungen verringert. Damit deutet sich insgesamt eine Entwicklung in Richtung der Kompressionsthese an."
Liegen damit genügend Hinweise auf die Evidenz der Kompressionshypothese vor, bleibt immer noch der Hinweis auf die Kostenträchtigkeit und auf Dauer Unfinanzierbarkeit der Krankheitskosten älterer Menschen.
Hierzu stellt der Bericht fest:
• "Obwohl ein beträchtlicher Teil der Krankheitskosten bei älteren Menschen entsteht, kann das Alter per se nicht dafür verantwortlich gemacht werden: Weitere, teils altersabhängige, teils altersunabhängige Faktoren müssen bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden."
• "Zusammenfassend gibt es eine Reihe zuverlässiger Belege dafür, dass weniger die Altersstruktur per se, als vielmehr ein Bündel verschiedener Faktoren Einfluss auf die Krankheitskosten ausübt, die teils selbst mit dem Alter in Zusammenhang stehen (z.B. die in der Sterbekostenforschung erkannte Ballung von Krankheitskosten im letzten Zeitabschnitt vor dem Tod - Anmerkung Bernard Braun), teilweise aber auch altersunabhängig sind. Welchem Faktor dabei im Einzelnen welcher Stellenwert zukommt, ist auf der gegenwärtigen Datenbasis und in Anbetracht der Komplexität des Themas nur schwer zu quantifizieren. ...Von einer (statistischen) Altersabhängigkeit der Krankheitskosten prospektiv auf eine "Kostenexplosion" im Gesundheitswesen zu schließen, würde die hier komplex wirkenden Mechanismen und Zusammenhänge deutlich verkennen."
• "Abschließend sei daher nochmals betont: Das Alter an sich muss keine größere gesundheitliche Belastung und Pflegebedürftigkeit bedeuten".
Wohltuend zurückhaltend, realistisch und differenziert geht die Expertise schließlich auch beim Versuch einer Prognose der künftigen Entwicklung der Gesundheitswirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Zunahme der 60/65+-Bevölkerung vor: "Zusammenfassend zeigt sich, dass einzelne Zweige der Gesundheitswirtschaft vom Älterwerden der Gesellschaft profitieren, ohne dass sie zwangsläufig einen Ausgabenfaktor für die GKV darstellen (individuelle Gesundheitsleistungen, Selbstmedikation). ...Ob und inwiefern sich eine florierende Gesundheitswirtschaft auf die künftige Beschäftigungsentwicklung auswirken wird, bleibt offen. ...Umgerechnet in Vollzeitäquivalente ist im Gesundheitswesen eine stagnierende bis leicht abnehmende Beschäftigungsentwicklung zu beobachten. Ausgenommen hiervon sind wenige Berufsgruppen, primär die Beschäftigten in der Altenpflege."
Der 323-seitige Untersuchungsband "Gesundheit und Krankheit im Alter" ist komplett und kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 26.5.09
Medikalisierung vs. Kompression: Künftiger Anstieg der Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben im Alter deutlich überschätzt.
 Nach mehreren klaren Relativierungen der auch in den USA dramatisierend geführten Debatte - "die demographische Katastrophe" - über unerwünschte gesundheitliche und ökonomische Auswirkungen des Altwerdens und der relativen Zunahme älterer Menschen, liegt mit einem achtseitigen Aufsatz des Essener Gesundheitsökonomen Stefan Felder nun auch aus deutschen Landen ein empirisch gut begründeter Einspruch gegen den Mainstream der Medikalisierungspropheten vor.
Nach mehreren klaren Relativierungen der auch in den USA dramatisierend geführten Debatte - "die demographische Katastrophe" - über unerwünschte gesundheitliche und ökonomische Auswirkungen des Altwerdens und der relativen Zunahme älterer Menschen, liegt mit einem achtseitigen Aufsatz des Essener Gesundheitsökonomen Stefan Felder nun auch aus deutschen Landen ein empirisch gut begründeter Einspruch gegen den Mainstream der Medikalisierungspropheten vor.
Die beiden Hypothesen stammen aus einer seit einiger Zeit geführten Debatte über den Zusammenhang von Altwerden und Älterwerden mit Morbidität und Gesundheitsversorgungs- wie Pflegekosten. Die "Medikalisierungshypothese" sieht durch die höhere Lebenserwartung auch die Anzahl der kranken Jahre oder multimorbid überlebenden Personen und damit die Pro-Kopf-Ausgaben wachsen, die "Kompressionshypothese" dagegen sieht die Anzahl der beschwerdefreien Jahre wachsen und die Gesundheitsausgaben erst am Lebensende oder im letzten Lebensjahr besonders wachsen. Je nachdem welcher Hypothese man folgt, wird die an sich erfreuliche Verlängerung der Lebenszeit als Katastrophe oder Gewinn gesellschaftlicher Lebensqualität dargestellt.
Während also insbesondere in den USA die Debatte zunehmend (in Fußballbegriffen steht es dort 4:1 für die Kompressionshypothese) von empirischen Erkenntnissen zugunsten der "compression of morbidity" bestimmt wird, hing die allemal zu Überdramatisierungen neigende deutsche Szene eher noch allen Varianten der Medikalisierung und erdrückenden Morbiditätslast des Alters nach.
Der bereits im Oktober 2008 erschiene Aufsatz von Stefan Felder liefert aber die folgenden Gegenargumente:
• Auch er hebt den von ihm bereits vor Jahren mit Krankenversicherungsdaten aus der Schweiz gewonnenen Trend der Konzentration der Gesundheitsausgaben (mit Pflegekosten) zu Beginn und am Ende des Lebens hervor.
• Der Versuch das Leben zu verlängern steigert die Ausgaben für medizinische Versorgung in der Regel im letzten Lebensjahr stark. Sie betragen mehr als das Zehnfache der Ausgaben für die in diesem Jahr überlebenden Personen.
• Trotzdem sinken die Gesundheitsausgaben für über 65-Jährige am Lebensende mit zunehmendem Alter. In einer deutschen Untersuchung fand sich folgender Beleg für diese Dynamik: Die Zahl der im letzten Lebensjahr verbrachten Tage im Krankenhaus lag zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr am höchsten und sank danach mit zunehmendem Alter. Dahinter vermutet man, dass Ärzte und Patienten in jüngerem Alter eher bereit sind, alle medizinischen Maßnahmen auszuschöpfen als in höheren Lebensjahren bzw. der Nähe zu einem "natürlichen" Sterbealter.
Die Folgen dieser Trends sehen nach Felder völlig anders aus als die Debatte über die Bedeutung der Alterung für die Finanzierungszukunft des Gesundheitssystems erwarten lässt:
• "Die demografische Alterung hat nur einen schwachen Einfluss auf die Gesundheitsausgaben einer Bevölkerung." Entscheidender ist die Nähe zum Tod.
• "Es gibt kaum empirische Evidenz, die für die Gültigkeit der Medikalisierungsthese spricht". Felder verweist dabei auch auf Berechnungen mit Daten des Mikrozensus für Deutschland, nachdem jüngere Alterskohorten nicht nur länger lebten, sondern auch einen "Zugewinn an Lebensjahren in guter Gesundheit erfuhren." Bereits im "Dritten Altenbericht der Bundesregierung" aus dem Jahr 2000 hieß es dazu auf der Basis der damals und derzeit bestmöglichen empirischen Daten u.a.: "Für Deutschland hat Dinkel auf der Grundlage der Mikrozensusdaten 1978-1995 die Entwicklung des - subjektiven - Gesundheitszustands im Alter und die Verlängerung der ferneren Lebenserwartung in Gesundheit in der Abfolge der Geburtsjahrgänge 1907, 1913 und 1919 untersucht (Dinkel 1999). Je nach Kohorte wurde dabei die Zeit zwischen dem 60. und 89. Lebensjahr betrachtet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung offenbaren eine merkliche Verbesserung des Gesundheitszustands auch im höheren Alter und einen absoluten und relativen Rückgang der in Krankheit verbrachten Lebensjahre der Seniorinnen und Senioren. Dinkels Ergebnisse ... legen nahe, dass zumindest in den letzten Dekaden die "gewonnenen" Altersjahre auch einen - sogar überproportionalen - Gewinn an gesunden Lebensjahren mit sich brachten."
• Auch für eine von Felder überprüfte so genannte Status-quo-Hypthese findet sich "keine empirische Bestätigung". Diese Hypothese meint, "dass altersspezifische Ausgaben nur von den Fortschritten der medizinischen Technik abhängen."
• Die Kompressionshypothese habe dagegen eine "feste empirische Basis".
Der Aufsatz "Im Alter krank und teuer? Gesundheitsausgaben am Lebensende" ist in Heft 4 des Jahrgangs 2008 der Beilage "Gesundheit und Gesellschaft-Wissenschaft (GGW)" einer Verlagsbeilage der Zeitschrift "Gesundheit+Gesellschaft" des Wissenschaftlichen Institus der Ortskrankenkassen (WIdO) erschienen und kostenlos komplett erhältlich.
Bernard Braun, 15.2.09
Wie viele Jahre kostet das Leben oder welche sozialen Faktoren tragen zur ungleichen Chance bei, ein hohes Alter zu erreichen?
 Eine mit Daten des "Sozioökonomischen Panels (SOEP)" im Auftrag des "Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller (VFA)" durchgeführte aktuelle Studie des Rostocker "Max Planckinstituts für demographische Forschung" zeigt dreierlei Grundtrends: Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt im Jahre 2006 77 Jahre für Männer und 82,3 Jahre für Frauen. Bei beiden Geschlechtern hat sich damit die Lebenserwartung seit 1998 erhöht. Von der Verlängerung der Lebenserwartung profitieren Männer mehr als Frauen: Der Anstieg bei Männern betrug 2,62 Jahre während er sich bei Frauen "nur" auf 1,78 Jahre belief.
Eine mit Daten des "Sozioökonomischen Panels (SOEP)" im Auftrag des "Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller (VFA)" durchgeführte aktuelle Studie des Rostocker "Max Planckinstituts für demographische Forschung" zeigt dreierlei Grundtrends: Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt im Jahre 2006 77 Jahre für Männer und 82,3 Jahre für Frauen. Bei beiden Geschlechtern hat sich damit die Lebenserwartung seit 1998 erhöht. Von der Verlängerung der Lebenserwartung profitieren Männer mehr als Frauen: Der Anstieg bei Männern betrug 2,62 Jahre während er sich bei Frauen "nur" auf 1,78 Jahre belief.
Auf derselben Datenbasis führten die Rostocker Demographen noch differenziertere Analysen durch und kamen zu interessanten Ergebnissen.
Zum einen zeigt eine Analyse der oben genannten Zuwächse der Lebenserwartung, dass sich diese vor allem aus dem Rückgang der Sterblichkeit im höheren Alter ergeben und kaum mehr aus Faktoren, Interventionen und Bedingungen in jüngerem Alter. So liegt bei den Männern der relativ höchste Beitrag zum Überleben mit 0,40 Jahren in der Altersgruppe von 65 bis 69. Bei den Frauen ist dies mit 0,32 Jahren die Gruppe 80 bis 84.
Zum anderen steigt die Lebenserwartung aber nicht in gleicher Weise für jeden. Es wird deutlich, dass das bisherige Leben einen erheblichen Einfluss darauf besitzt, wie viele Lebensjahre Menschen mit 50 Jahren noch zu erwarten haben. Das Sterberisiko ab diesem Alter erhöht sich durch ein Bündel von gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen, chronischen Erkrankungen, Arbeitslosigkeit, Familienformen oder eine niedrige Bildung. Viele Risikofaktoren fallen vor allem bei sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen ins Gewicht. Auch bei der Lebenserwartung gibt es also soziale Ungleichheit. Zu einem gewissen Maße hängen diese Faktoren voneinander ab, verstärken oder schwächen den Einfluss anderer Faktoren und tragen insgesamt zu einem "Risikoprofil der Sterblichkeit" bei.
Dass es sich bei vielen dieser Einflussfaktoren nicht um Bagatellwirkungen auf die Sterblichkeit handelt, zeigen folgende Risikoindikatoren: Bei den Männern mit 50 verringert sich die Lebenserwartung im Falle einer vorausgegangenen Scheidung um 9,3 Jahre, durch geringe Bildung um 7,2 und durch Arbeitslosigkeit um 14,3 Jahre. Männer, die mit ihrem Gesundheitszustand nicht zufrieden sind, leben durchschnittlich 18,9 Jahre weniger. Starker Tabak- aber auch Alkoholkonsum reduzieren die Gesamtlebenszeit um 18,2 bzw. 16,2 Jahre. Die stärkste Verschlechterung des Risikoprofils, nämlich um 21,4 Jahre, findet sich bei Personen, die an Diabetes mellitus erkrankt sind. Kleinere, aber immerhin noch spürbare Auswirkungen auf die Lebenszeit nach dem 50. Lebensjahr hat auch noch das Bundesland der über 50-jährigen Männer: Wer in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, den "kostet" dies 2,7 Jahre. Wer aber dagegen in Baden-Württemberg wohnt, "gewinnt" 3,1 Lebensjahre.
Bei Frauen wirken sich dieselben Faktoren zum Teil ähnlich aber auch an einigen Stellen völlig anders aus: So verlieren allein lebende Frauen 4,9 Lebensjahre, während dieselbe Lebensform Männern weder positiv noch negativ etwas "kostet". Wesentlich höhere Sterberisiken haben als Männer haben Frauen, wenn sie stark rauchen (-22 Jahre) oder stark dem Alkohol zusprechen (-23,1 Jahre). Auch Bluthochdruck wirkt sich bei Frauen um mehrere Lebensjahre schwerer auf ihre Lebenserwartung aus als derselbe Risikofaktor bei Männern. Die Autoren weisen darauf hin, dass es vielfältige Wechselwirkungen von sozialen Faktoren wie etwa Bildungsstand, gesundheitlichen Verhaltensweisen, Erkrankungshäufigkeiten und Sterblichkeitsrisiken gibt, die differenziertere Interventionen und zielgruppenspezifische Programme erforderlich machen.
In dem ebenfalls gerade veröffentlichten und zu der Lebenserwartungsstudie passenden Bericht "Unerreichbares Privileg oder Vorbild für alle? Die Lebenserwartung österreichischer Akademiemitglieder liegt deutlich über dem Schnitt" wird zum einen die herausragend höhere Lebenserwartung dieser speziellen Gruppe akademisch gebildeter Personen dargestellt. Zum anderen wird aber auch der Frage nachgegangen woran dies liegt. Dabei wird vor allem die geistige Aktivität bis weit nach Eintritt ins Rentenalter als wesentliche Erklärung genannt bzw. vermutet. Dies ist insofern plausibel, weil andere akademisch gebildete Berufstätige, die meist mit der Berentung relativ abrupt und umfassend inaktiv werden, nach der österreichischen Studie eine niedrigere Lebenserwartung als die aktiveren und "rüstigeren" Akademiemitglieder aufweisen.
Die Forschungsergebnisse der Demographen Doblhammer, G., Muth, E. und Kruse, A. sind zwar als Report des Rostocker Zentrum zur Erforschung des Demografischen Wandels (157 Seiten) unter dem Titel "Lebenserwartung in Deutschland: Trends, Prognose, Risikofaktoren und der Einfluss ausgewählter Medizininnovationen" angekündigt, liegen aber in dieser Form aktuell noch nicht vor.
Wer dennoch Näheres wissen will, kann dies an mehreren Stellen machen: Eine Kurzdarstellung von "Lebenserwartung in Deutschland" gibt es als Beitrag in der neuesten Ausgabe des wie gewohnt informativen und kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung stehenden Newsletters "Demografische Forschung Aus Erster Hand", der vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Rostock, in Kooperation mit dem Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, und dem Rostocker Zentrum zur Erforschung des Demografischen Wandels viermal jährlich herausgegeben wird.
Zusätzlich gibt eine 24 Seiten umfassende Präsentation der Forschungsergebnisse im Rahmen einer vom VFA veranstalteten Pressekonferenz kostenlos Auskunft zu weiteren Ergebnissen der Studie.
Ebenfalls kostenlos gibt es einen fünfseitigen Text einer Erklärung der VFA-Hauptgeschäftsführerin Frau Yzer zu den für die Pharmaindustrie interessanten Seiten der steigenden Lebenserwartung.
Jenseits einer ziemlich selbstgefälligen und irgendwie am Kern der Studienergebnisse vorbeigehenden Überschätzung des Beitrags der Pharmaindustrie zur steigenden Lebenserwartung, hebt Frau Yzer aber einen wichtigen Gedanken hervor: "Die Frage der Zukunft wird nämlich nicht so sehr sein, wie alt wir werden, sondern wie produktiv wir bleiben. Wenn künftig auch dank moderner Medikamente 70-Jährige durchaus die berechtigte Hoffnung haben dürfen, den Anforderungen ihres Berufes gewachsen zu sein, spricht nichts gegen die Annahme, dass auch eine alternde Gesellschaft insgesamt produktiv bleiben kann."
Auch für die Studie "Unerreichbares Privileg oder Vorbild für alle? Die Lebenserwartung österreichischer Akademiemitglieder liegt deutlich über dem Schnitt" gibt es in dem Newsletter einen kurzen, kostenlos zur Verfügung stehenden Beitrag.
Von dem im "European Journal of Population" 24 (2008) online veröffentlichten Aufsatz "Winkler-Dworak, Maria: The low mortality of a learned society" gibt es leider nur ein Abstract.
Wer dennoch mehr über die Erkenntnisse der österreichischen Forscherin wissen will, findet dies ausführlich und kostenlos in dem bereits 2007 im Vienna Yearbook of Population Research veröffentlichten 25-Seiten-Beitrag "On the age dynamics of learned societies—taking the example of the Austrian Academy of Sciences".
Bernard Braun, 11.11.08
"Demographische Katastrophe" oder eher "katastrophaler" Stand betrieblicher Maßnahmen für alternde Belegschaften?
 Die Debatte über die Art, Geschwindigkeit und soziale Gestaltbarkeit der demografischen Entwicklung gehört zu den u.a. für die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme und auch für die Zukunft der Finanzierung und Ausgaben der Krankenversicherung wichtigsten und am heftigsten geführten. Zur Heftigkeit gehört eine gewisses Maß an Überdramatisierung, die vor allem den Eindruck einer unvermeidbaren Entwicklung zu erwecken sucht. Ein immer größer werdender Anteil älterer und vor allem kränkerer oder leistungsgeminderter Menschen sowie die schließliche Abnahme der Gesamtbevölkerung gehören zum Repertoire dieser Überdramatisierung, die u.a. mit dazu dient, eine Art vorauseilenden Abbau oder die Privatisierung des sozialen Niveaus zu rechtfertigen.
Die Debatte über die Art, Geschwindigkeit und soziale Gestaltbarkeit der demografischen Entwicklung gehört zu den u.a. für die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme und auch für die Zukunft der Finanzierung und Ausgaben der Krankenversicherung wichtigsten und am heftigsten geführten. Zur Heftigkeit gehört eine gewisses Maß an Überdramatisierung, die vor allem den Eindruck einer unvermeidbaren Entwicklung zu erwecken sucht. Ein immer größer werdender Anteil älterer und vor allem kränkerer oder leistungsgeminderter Menschen sowie die schließliche Abnahme der Gesamtbevölkerung gehören zum Repertoire dieser Überdramatisierung, die u.a. mit dazu dient, eine Art vorauseilenden Abbau oder die Privatisierung des sozialen Niveaus zu rechtfertigen.
Richtig ist an der Problemanalyse zunächst, dass unter Annahme mittlerer Varianten zur Entwicklung der Bevökerung mindestens bis zum Jahr 2020 die Zahl der 55- bis 64-Jährigen bis 2020 um rund 40 Prozent zunehmen wird; in manchen Regionen sogar um zwei Drittel. Das Erwerbspersonenpotential schrumpft also zuerst einmal nicht, sondern altert.
Egal, ob man an dieser Bevölkerungsgruppe deshalb interessiert ist, weil sie auch dann noch im wesentlichen die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums betreibt und damit u.a. die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme trägt oder daran, dass sie trotz steigendem Altersdurchschnitt eine hohe gesundheitliche Lebensqualität hat, hängt beides ganz zentral von politischen und betrieblichen Aktivitäten und Strategien ab.
Ob und wie die Betriebe bereits jetzt, also in den Anfängen dieser Alterung des Erwerbspersonenpotenzials aktiv sind, hat das vom "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit gepflegte so genannte IAB-Betriebspanel jetzt untersucht.
Die Bilanz des von Lutz Bellmann, Ernst Kistler und Jürgen Wahse bearbeiteten IAB-Kurzberichts "Demographischer Wandel: Betriebe müssen sich auf alternde Belegschaften einstellen." (IAB-Kurzbericht, 21/2007, Nürnberg, 6 Seiten) weist einen mehrfachen Nachholbedarf nach:
• nur knapp ein Fünftel aller Betriebe (2002=19% und 2004=20%) betreibt Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung jenseits der gesetzlichen Mindestnormen, wobei sich darunter überwiegend eher geringinterventive Maßnahmen der Krankenstandsanalysen und Mitarbeitergespräche mit Schwerpunkt in größeren Betrieben befinden
• die betriebliche Weiterbildung ist hoch selektiv bezüglich Alter und beruflichem Status,
• der Anteil der Betriebe, der in der Weiterbildungsförderung aktiv ist, stieg zwar von 1997 bis 2005 von 37 auf 43%, der Anteil der diese Angebote nutzenden Beschäftigten stagniert aber seit 2005 bei 26% aller Beschäftigten,
• nur zehn Prozent der im ersten Halbjahr 2006 eingestellten Personen waren älter als 50 Jahre.
• Schließlich zeigt sich, dass (spezielle) Maßnahmen für ältere Beschäftigte äußerst selten sind und der Anteil der Betriebe mit derartigen Maßnahmen zwischen 2002 und 2006 sogar von 19 auf 17% abgenommen hat. Bei den Maßnahmen überwiegen außerdem Altersteilzeitregelungen, also Maßnahmen, die eher das frühzeitige Ausscheiden unterstützen als ein längeres gesundes Arbeiten ermöglichen helfen.
Da viele dieser Maßnahmen grundsätzliche Veränderungen der betrieblichen Politiken benötigen und auslösen, braucht ihre Entwicklung und ihr Einwirken so viel Zeit, dass derartige Spätstarts dann wirklich zu erheblichen künftigen Problemen bei der Beschäftigung, Produktivität und Gesundheit der älter werdenden Belegschaften führen.
Akteure, die spätestens dann wieder die Unentrinnbarkeit und die politisch nicht gestaltbare Entwicklung behaupten, können hier und heute bereits die wirklichen sozialen Einflussfaktoren und -nahmen betrachten.
Statistische Übersichten und den Link zu einem kostenlosen Volltext-Download finden Sie auf dieser IAB-Seite.
Bernard Braun, 26.10.2007
Sinkende Prävalenz der Behinderungen älterer Menschen in USA und Spanien - 4:1 für die "compression of morbidity"
 Zu den hartnäckigsten dramatisierenden Mythen der Sozial- und Gesundheitspolitik gehört der von der immer zahlreicher und dann noch kränker werdenden älteren Bevölkerung in den hochindustrialisierten Ländern.
Zu den hartnäckigsten dramatisierenden Mythen der Sozial- und Gesundheitspolitik gehört der von der immer zahlreicher und dann noch kränker werdenden älteren Bevölkerung in den hochindustrialisierten Ländern.
Für die wissenschaftlich unter den Etiketten "Medikalisierung" und "compression of morbidity" geführten Debatte gibt es mittlerweile und weltweit eine Menge empirischer Belege. Sportlich ausgedrückt könnte man die empirische Evidenz für die These, dass eine wachsende Anzahl von Lebensjahren nicht die Zunahme kranker Jahre bedeutet, sondern die "Krankheitslast" an das Ende der Lebenserwartung verschoben wird, mit dem Fussballresultat 4:1 beschreiben.
Hier und in weiteren Forums-Beiträgen sollen nun ältere und neuere Belege für den "Drei-Tore-Vorsprung" vorgestellt werden.
Einer der Klassiker für die These, dass die Morbiditätslast mit wachsendem Lebensalter nicht zu-, sondern abnimmt, ist der 2001 in der Zeitschrift "Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)" der USA veröffentlichte Text (PNAS 22. Mai 2001. Vol. 98 und Nr. 11: 6354-6359)
von Kenneth Manton und Xiliang Gu vom "Center for Demographic Studies der Duke University, Durham, North Carolina": "Changes in the prevalence of chronic disability in the United States black and nonblack population above age 65 from 1982 to 1999".
Die wesentlichen Ergebnisse dieser auf den Daten des "National Long-Term Care Survey on disability trends (NLTCS)" beruhenden Studie lauten:
• Die Häufigkeit von dauerhaften Behinderungen in der Altenbevölkerung der USA (65+- und Medicaid-Bevölkerung) sank seit 1982 ständig. Die Abnahme war in den 1990er Jahren höher als in den 1980er Jahren.
• Von 1982 bis 1989 betrug die jährliche Abnahme 0,26 %. Von 1989 bis 1994 nahm der Anteil behinderter älterer Personen um jährlich 0,38 % ab. 1994 bis 1999 stieg die jährliche Abnahme sogar auf 0,56 %.
• Schließlich nahm der Anteil älterer schwarzer Amerikaner mit Behinderungen über die gesamte Untersuchungszeit stärker ab als bei der nichtschwarzen Bevölkerung.
Die sechsseitige kostenlose PDF-Datei dieses Aufsatzes von Manton/Gu gibt es hier.
Die Forschungsergebnisse von Manton und Gu werden in dem ebenfalls 2001 und in den PNAS erschienenen Beitrag von David Cutler (Department of Economics, Harvard University und National Bureau of Economic Research) "The reduction in disability among the elderly" (5. Juni 2001; Vol. 98 und Nr. 12: 6546-6547) noch ausführlich eingeordnet und kommentiert. Der Tenor lautet: "Manton and Gu present clear, overwhelming evidence that the average health of the elderly poulation is improving". Außerdem hebt Cutler besonders die Erkenntnis der beiden Demografen der Duke-Universität hervor,dass gut ausgebildete Personen (gemessen in formalen High School.- und College-Jahren) ungefähr nur die Hälfte der Behinderungsrate aufweisen wie die weniger gut bzw. lang Ausgebildeten. Der Kommentar von Cutler ist hier zu finden.
Fünf Jahre später wiederholte Manton zusammen mit Gu und V. L. Lamb erneut mit Daten des NLTCS die alte Analyse und veröffentlichte seine Ergebnisse unter dem Titel "Change in chronic disability from 1982 to 2004/2005 as measured by long-term changes in function and health in the U.S. elderly population" erneut in den "Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)" der USA (28. November 2006; 103(48): 18374 - 18379).
Die aktualisierten Ergebnissen lauteten:
• "We found a significant rate of decline in the prevalence of chronic disability that accelerated from 1982 to 2004."
• Die Rate der Abnahme betrug über den 22-jährigen Untersuchungszeitraum hinweg 1,52 % pro Jahr.
• Der Anteil der altersstandardisierten (standardisiert auf die Altersverteilung des Jahres 2004) nichtbehinderten Personen im 65+-Alter wuchs von 73,5 % in 1982 auf 81 % in 2004.
Auch dieser 6 Seiten umfassende Aufsatz von Manton/Gu und Lamb ist hier komplett als kostenlose PDF-Datei erhältlich.
Wer jetzt den Eindruck gewinnt es handle sich um eine Sonderentwicklung in den USA, kann sich anhand der Ergebnisse einer vergleichbaren Analyse der langjährigen Behinderungstrends in Spanien vom Gegenteil überzeugen.
Die entsprechende Studie "Trends in Disability and Disability-Free Life Expectancy Among Elderly People in Spain: 1986-1999" von Sagardui et al. ist 2005 in der Fachzeitschrift "The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences" (60:1028-1034) veröffentlicht worden. Sie stützte sich auf die Daten zweier "National Disability, Impairment and Handicap Surveys" in der 65+-Bevölkerung aus den Jahren 1986 und 1999.
Das wesentliche Resultat lautete:
• "From 1986 through 1999, prevalence of severe disability among Spanish elderly persons decreased substantially, and the duration of life with disability was compressed between a later onset and the time of death."
• Für Männer betrug die jährliche Abnahme der gesamten Behinderungen 3,7 %.
• Bei den Frauen, den Befragten im Alter von 75 und mehr Jahren sowie den Personen mit dem niedrigsten Bildungslevel war die Abnahme geringer.
Näheres kann man hier nur einem kostenlosen Abstract des Aufsatzes entnehmen, der hier erhältlich ist.
Bernard Braun, 16.8.2007
Wer aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente muss, hat schon jetzt erhebliche finanzielle Probleme
 Das durchschnittliche Zugangsalter zur Rente ist gestiegen - in den letzten zehn Jahren um rund 12 Monate auf 63 Jahre. Ein Grund dafür sind die 1997 eingeführten Rentenabschläge, die ein frühes Ausscheiden aus dem Arbeitsleben unattraktiv machen. Wer gut im Beruf steht und gesund ist, bleibt länger im Job. Doch nicht alle älteren Erwerbstätigen können über ihren Abschied von Büro und Werkbank selbst bestimmen. Darum müssen - trotz des steigenden Durchschnittsalters - zunehmend mehr Senioren mit 60 in den Ruhestand gehen und von einer um Abschläge geschmälerten Rente leben.
Das durchschnittliche Zugangsalter zur Rente ist gestiegen - in den letzten zehn Jahren um rund 12 Monate auf 63 Jahre. Ein Grund dafür sind die 1997 eingeführten Rentenabschläge, die ein frühes Ausscheiden aus dem Arbeitsleben unattraktiv machen. Wer gut im Beruf steht und gesund ist, bleibt länger im Job. Doch nicht alle älteren Erwerbstätigen können über ihren Abschied von Büro und Werkbank selbst bestimmen. Darum müssen - trotz des steigenden Durchschnittsalters - zunehmend mehr Senioren mit 60 in den Ruhestand gehen und von einer um Abschläge geschmälerten Rente leben.
Dies zeigt der neue Altersübergangs-Report des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. "Die Abschlagsregelung kann als eine sanfte Anhebung der Altersgrenzen gesehen werden", so Martin Brussig, Autor des Reports. Die Folgen sind jedoch nicht immer sanft, denn die Rente reduziert sich um 0,3 Prozent für jeden Monat, der zum 65. Geburtstag fehlt. Das kann gerade bei Langzeitarbeitslosen zu massiven Einbussen führen.
2005 waren die Auszahlungen an vier von zehn Neu-Rentnern gekürzt. Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Anteil der vorzeitigen Abschiede aus dem Erwerbsleben deutlich erhöht: 2003 waren es noch 35 Prozent, zwei Jahre später bereits 42 Prozent. Etwa jeder siebte Erwerbstätige musste 2005 sogar eine erhebliche Rentenkürzung hinnehmen, weil er mit bereits mit 60 in den Ruhestand ging - die dann anfallenden maximalen Abschläge betragen 18 Prozent. Der Altersübergangs-Report identifiziert als besondere Problemgruppe Männer und Frauen, die in den drei Jahren vor dem Renteneintritt entweder arbeitslos, Minijobber oder lange krank waren. Von dieser Gruppe wechselte jeder fünfte Mann mit 60 - also zum erstmöglichen Zeitpunkt - in den Ruhestand. Unter den Frauen war es jede dritte. "Diesen Personen fehlen - verglichen mit durchgängig Erwerbstätigen, die mit 65 Jahren in Rente gehen - acht Jahre am Aufbau ihrer Alterssicherung", erklärt Brussig. Entsprechend gering seien die Auszahlungen.
Der Rentenzugang spiegelt die regionalen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt wider. Am schwierigsten ist es in Ostdeutschland, bis zum Ende dabei zu bleiben: Sieben von zehn Rentnern gehen vorzeitig. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind dabei im Osten gering, im Westen beträchtlich - weil westdeutsche Frauen weniger stark ins Erwerbsleben eingebunden sind, wie Brussig erklärt. Der Forscher unterscheidet drei Grundmuster des Altersübergangs:
• Einen direkten Rentenzugang hatten etwa 31 Prozent der neuen Altersrentner 2005. Das waren meist durchgängig sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die auch in den letzten drei Jahren vor dem Ruhestand im Job blieben.
• Einen kurzen Altersübergang erlebten 12 Prozent. Der ergibt sich, wenn die Beschäftigten auf der Zielgeraden des Arbeitslebens in einen prekären Arbeitsmarktstatus gewechselt sind.
• Ein langer und prekärer Altersübergang traf 20 Prozent. Die Ursache sind dauerhafte Arbeitslosigkeit, Krankheit oder geringfügige Beschäftigung.
Hinzu kommen rund 38 Prozent der Rentner, die keiner dieser Gruppen zuzuordnen sind - weil sie sich im Ausland aufhalten oder schon länger nicht mehr erwerbstätig sind, was gerade für viele Frauen gilt. Auch Beamte, die in frühen Berufsjahren als Angestellte Rentenansprüche erworben haben, gehören dazu.
Die Härten und die sozialen Abstände im Alter werden zunehmen, prognostizieren Brussig und der IAQ-Wissenschaftler Matthias Knuth. Denn berufliche Fehlschläge älterer Beschäftigter bergen ein doppeltes Risiko: das der Arbeitslosigkeit und der folgenden Rentenkürzung. Die Analyse der Abschläge erlaube zudem bereits eine Einschätzung der Rente mit 67, die ab 2012 eingeführt werden soll. Die Forscher folgern, "dass eine Anhebung der Altersgrenzen nur dann sozialpolitisch gerechtfertigt ist, wenn die Versicherten die Möglichkeit haben, ihre Erwerbstätigkeit bis unmittelbar zum Rentenzugang aufrechtzuerhalten". Das aber werde auch in Zukunft für viele sehr schwer werden, sofern sich das Einstellungsverhalten und die Weiterbildungsaktivitäten nicht verändern: Die Erwerbsmöglichkeiten Älterer werden nicht voll mit den Altersgrenzen mitziehen, warnen sie. Und für sozialversicherungspflichtige Jobs gelte das erst recht.
• Zusammenfassung der Studie (PDF, 1 Seite): Rente - Herbe Einschnitte für Arbeitslose
• Aufsatz in WSI-Mitteilungen 6/2006 (PDF, 7 Seiten): Martin Brussig, Matthias Knuth: Altersgrenzenpolitik und Arbeitsmarkt - Zur Heraufsetzung des gesetzlichen Rentenalters
• Altersübergangs-Report (PDF, 15 Seiten): Martin Brussig: Vier von zehn Zugängen in Altersrente erfolgen mit Abschlägen
Gerd Marstedt, 5.3.2007
Rentnerboom und Babynotstand - Neues Portal zum demographischen Wandel
 Die deutsche Bevölkerung hat laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2006 um 130.000 Einwohner im Vergleich zum Vorjahr abgenommen, derzeit leben 82 Millionen Menschen in Deutschland. Für 2050 rechnen die Experten mit einer Einwohnerzahl von etwa 70 Millionen. Welche Auswirkungen hat der "deutsche Schrumpfkurs" auf die Gesellschaft? Das Informationszentrum Sozialwissenschaften hat auf der Suche nach einer Antwort diese Frage aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet - und Ergebnisse, Diskussionen und weitere Fragen rund um die Demographie im Onlineportal "Rentnerboom und Babynotstand - der demographische Wandel in Deutschland" zusammengefasst und veröffentlicht. Zudem bietet es eine umfangreiche Literatur- und Forschungsdokumentation zum Thema an.
Die deutsche Bevölkerung hat laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2006 um 130.000 Einwohner im Vergleich zum Vorjahr abgenommen, derzeit leben 82 Millionen Menschen in Deutschland. Für 2050 rechnen die Experten mit einer Einwohnerzahl von etwa 70 Millionen. Welche Auswirkungen hat der "deutsche Schrumpfkurs" auf die Gesellschaft? Das Informationszentrum Sozialwissenschaften hat auf der Suche nach einer Antwort diese Frage aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet - und Ergebnisse, Diskussionen und weitere Fragen rund um die Demographie im Onlineportal "Rentnerboom und Babynotstand - der demographische Wandel in Deutschland" zusammengefasst und veröffentlicht. Zudem bietet es eine umfangreiche Literatur- und Forschungsdokumentation zum Thema an.
"Seit Monaten wird den Deutschen von allen medialen Seiten ein baldiges Aussterben prophezeit und dem Land ein unumkehrbarer Schrumpfkurs vorausgesagt", bemerkt Christian Kolle, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ). "Zeitungen, Talkshows und Sachbücher sehen die ganze Republik in einem unaufhaltsamen Prozess der Vergreisung gefangen und prognostizieren den nahenden Kollaps der Sozialsysteme. Wir haben versucht, die aktuelle Debatte aus sozialwissenschaftlicher Sicht zu begleiten und Entstehungsfaktoren, Wirkungsprozesse und Konsequenzen des demographischen Wandels in der Bundesrepublik zu beleuchten."
So werden im Portal die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf Wirtschaft, Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssysteme diskutiert. Es wird auf die Politik zur Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen eingegangen und auf Migration als demographischen Faktor. Zudem befasst sich das Portal mit den Folgen der demographischen Veränderungen für Städtebau & Stadtentwicklung. Angeboten werden sowohl wissenschaftliche Erörterungen, als auch Hintergründe, Reportagen und Portraits. Darüber hinaus liefert die Linksammlung Daten und Statistiken sowie kommentierte Links zu Organisationen und Institutionen sowie zu weiteren interessanten Websites und Informationsportalen. Die in das Portal integrierte Dokumentation enthält 173 Literatur- und Forschungsnachweise, die sich dem Forschungsgegenstand aus verschiedenen Richtungen nähern.
Die Rubriken des Portals sind:
• Bestandsaufnahme: (Zahlen, Fakten und Trends zum demographischen Wandel)
• Zwischen Geisterstadt und Boomtown - Auswirkungen des demographischen Wandels auf Städtebau & Stadtentwicklung
• Auswirkungen des demographischen Wandels auf Arbeitsmarkt und Sozialversicherung
• Migration als demographischer Faktor
• Familienpolitik: Politik zur Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen
Besonders positiv hervorzuheben ist, dass neben vielen Links in jeder der Rubriken eine große Zahl von Zeitschriften-Artikeln und wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum kostenlosen Download im Volltext angeboten wird. In der Rubrik "Bestandsaufnahme" sind dies unter anderem:
• Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Demographie e.V.: 9 Aufsätze und Beiträge rund um den Bevölkerungsrückgang in der Bundesrepublik Deutschland
• Elisabeth Niejahr: Die vergreiste Republik, ein Artikel über die Folgen des demographischen Wandels in Deutschland und die verhaltene Reaktion der Politik (Die Zeit 02/2003, 8 S.)
• Bertelsmann Stiftung [Hg.]: Die demographische Bedrohung meistern, Erste Bausteine zur Erarbeitung eines nationalen integrierten Aktionsplans
• Herrmann Adrian: Die demographische Entwicklung in Deutschland und Europa mit ihren katastrophalen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Vergleich Deutschland, Europa, Japan, USA; Problematik und Lösungswege, 2003, 78 S.
• Institut für Demoskopie Allensbach [Hg.]: Einflussfaktoren auf die Geburtenrate, Ergebnisse einer Repräsentativumfrage der 18- bis 44-jährigen Bevölkerung, 2004, 105 S.
Texte, Links und Online-Artikel sind hier zu finden:
Informationszentrum Sozialwissenschaften: Rentnerboom und Babynotstand
Verfügbar ist ferner die gesamte
Dokumentation als PDF-Datei
Gerd Marstedt, 14.1.2007
Geburtenentwicklung in Deutschland: Zwischen Dramatisierung und Verharmlosung.
 Im Vorfeld des am 1. Januar 2007 erfolgten Starts des so genannten "Elterngeldes" als einem in Deutschland neuen familienpolitischen Instrument, konnte man wieder mal in geballter Form Düsteres über die Gegenwart und vor allem die Zukunft der Geburtenhäufigkeit in Deutschland vernehmen. Die Tatsache, dass sich die deutsche wie die Bevölkerungen der meisten vergleichbaren Länder seit längerem nicht mehr komplett reproduziert (mehr als 2 Kinder pro Frau), wird zum Anlass genommen, von "Gebärstreik", Bevölkerungs-Implosion", Deutschland stirbt aus" und einem "freien Fall der Geburten" mit verheerenden Folgen für das Wohlstandsniveau in Deutschland zu reden.
Im Vorfeld des am 1. Januar 2007 erfolgten Starts des so genannten "Elterngeldes" als einem in Deutschland neuen familienpolitischen Instrument, konnte man wieder mal in geballter Form Düsteres über die Gegenwart und vor allem die Zukunft der Geburtenhäufigkeit in Deutschland vernehmen. Die Tatsache, dass sich die deutsche wie die Bevölkerungen der meisten vergleichbaren Länder seit längerem nicht mehr komplett reproduziert (mehr als 2 Kinder pro Frau), wird zum Anlass genommen, von "Gebärstreik", Bevölkerungs-Implosion", Deutschland stirbt aus" und einem "freien Fall der Geburten" mit verheerenden Folgen für das Wohlstandsniveau in Deutschland zu reden.
Diese dramatischen Analysen und Prognosen wirken noch düsterer, wenn sie mit der Annahme einhergehen, diese Entwicklungen seien unvermeidbar und entzögen sich jeglicher politischen Gestaltung. Diese Art des "demografischen Fatalismus" wird aber auch immer wieder durch eine Art "demografischen Aktionismus" unterbrochen, der meist mit dem Inkrafttreten eines neuen Geburtenförderungsprogramms, also aktuell mit der Einführung des Elterngeldes und einiger für sich gelungenen Projekte zur "Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit" einhergeht.
Beide Varianten der Demografiedebatte vernachlässigen sehr oft die tatsächliche Komplexität des Themas und ziehen positiv oder negativ falsche und verkürzte Schlüsse, hegen und verbreiten falsche Hoffnungen und lösen falsche Verhaltensweisen aus.
Einen Teil der Komplexität stellt ein im Jahr 2006 in der GEK-Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse erschienener Text des Bremer Sozial- und Gesundheitswissenschaftlers Bernard Braun zum Thema "Geburten und Geburtshilfe in Deutschland" auf den Seiten 6 bis 81 dar. Er hofft, damit zur Versachlichung und einer größeren Realitätsnähe der Debatte über die empirische Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, deren Ursachen und Beeinflussungsmöglichkeiten beizutragen.
Dies geschieht durch die theoretische und empirische Aufbereitung folgender Themen und Aspekte:
• Die Entwicklung des Geburtengeschehens in Deutschland über die letzten hundert Jahre und nicht nur für die Zeit der alten Bundesrepublik. Erst dann erkennt man, dass das hohe Geburtenniveau in der Startphase der Bundesrepublik ein durch die materiellen und mentalen Sonderbedingungen des Wirtschaftswunders bedingte Abweichung "nach oben" war und ein Teil des "Pillenknicks" die Rückkehr zur deutschen Geburten-Normalität war.
• Die Darstellung und kritische Würdigung der Aussagekraft unterschiedlicher Indikatoren der Geburtenhäufigkeit. Je nachdem man z.B. das Geburtengeschehen im Querschnitt aller gebärfähigen Frauen in einem Jahr oder im Längsschnitt einer bestimmten Geburtskohorte von Frauen bis zur biologischen Gebärgrenze betrachtet, kommt man zu erheblich unterschiedlichen Zahlen für die sensible öffentliche Debatte. Dargestellt werden die unterschiedlichen Aussagen von Indikatoren wie etwa der rohen Geburtsziffer, der altersspezischen Geburtsziffer, der adjustierten Geburtenrate, des "Tempoeffekts" sowie der Brutto- wie Nettoreproduktionsrate. Soweit dies möglich ist, werden auch die teilweise erheblichen Unterschiede der mit diesen Indikatoren kommunizierten Geburtenwerte dargestellt.
• Die Darstellung und kritische Diskussion der Mängel der unterschiedlichen Datenquellen für die Geburtenentwicklung.
• Die Problematik der Nutzung des Geburtengeschehens als Standortfaktor im internationalen ökonomischen und sozialen Vergleich und Wettbewerb.
• Die Überschätzung der absoluten Größe einer Bevölkerung für deren Wohlstandsniveaus.
• Die problematische Überschätzung des Geburten- und Bevölkerungszuwachses durch Einwanderung.
• Die Darstellung der Geburtenentwicklung als Produkt mehrerer materieller und immaterieller, ökonomischer, sozialer und kultureller Faktoren, Ursachen und Triebkräfte.
• Praktisch gewendet bedeutet dies, dass die Entwicklung der Geburtenhäufigkeit weder von finanziellen Anreizen wie dem Elterngeld, der Existenz einer öffentlichen Betreuungsinfrastruktur, der "Pille", einer kinderfreundlichen Kultur, familienfreundlichen Arbeitsmöglichkeiten allein (!) abhängig ist, sondern eine dynamische Mischung dieser und weiterer Bedingungen erfordert.
• Einen breiten Raum nimmt als Erklärung des Status quo die durch vielfältige soziale Faktoren bedingte Verschiebung des Kinderwunsches in ein dann auch natürlich nach oben begrenztes "Zeitfenster" jenseits des 30. Lebensjahres ein. Dort gerät der Kinderwunsch zunehmend in Konkurrenz mit anderen, genau in diesem biografischen Abschnitt wichtigen Aufgaben (z.B. Karriere, Alterssicherung).
• Am Beispiel der häufig extrem polemisch geführten Debatte der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen wird gezeigt, dass es sich dabei zum Teil um den Konflikt zweier gesellschaftlich erwünschter und geförderter Verhaltensweisen handeln kann. Hier führt die bessere und längere Qualifizierung von Frauen zu einem späteren Eintritt ins Erwerbsleben, dessen Dauer durch die soziale Erwartung eines möglichst langen produktiven Beitrags der hochqualifizierten Frauen eher noch länger wird als in der Vergangenheit und sich damit zwangsläufig immer weiter ins das vierte Lebensjahrzehnt hineinschiebt. Das "Zeitfenster" für die Geburt und die Erziehung eines Kindes wird also für hochqualifizierte Frauen unter sonst nicht relevant veränderten Rahmenbedingungen noch zusätzlich kleiner als für alle Frauen.
Hier finden Sie die PDF-Datei des Buches "Geburten und Geburtshilfe in Deutschland".
Bernard Braun, 1.1.2007
Information statt Dramatisierung der demografischen Veränderungen und ihrer Auswirkungen auf das Arbeitsleben
 Für die Diskussion über die Beteiligung Älterer am Arbeitsleben und die Bedingungen wie Konsequenzen des demografischen Alterungsprozesses bieten die Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) bzw. das Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) in Bonn ein vielfältiges nationales, internationales und transnationales Informationsangebot mit kommentierten Internetquellen an.
Für die Diskussion über die Beteiligung Älterer am Arbeitsleben und die Bedingungen wie Konsequenzen des demografischen Alterungsprozesses bieten die Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) bzw. das Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) in Bonn ein vielfältiges nationales, internationales und transnationales Informationsangebot mit kommentierten Internetquellen an.
Zu den wichtigsten Informationsfeldern zählen Übersichten zu forschenden und gestaltenden Institutionen, zu Informationssystemen und -sammlungen, digitale Publikationen (z.B. Aufsätze, Graue Literatur, Konferenzmaterialien, Regierungsdokumente) und Medieninformationen. Ein Gesamtverzeichnis der Internetquellen ermöglicht eine rasche Gesamtorientierung.
Da die letzte Änderung des Dokumentationsstands im Juni 2005 erfolgte, bleibt zu hoffen, dass es zu einer baldigen Aktualisierung und künftigen Weiterpflege der für Deutschland mustergültigen Homepage kommt.
Hier finden Sie die Informationsplattform "Arbeit in einer alternden Gesellschaft"
Bernard Braun, 30.11.2006
Kostenexplosion und demographischer Kollaps des Gesundheitssystems: Fragwürdig und differenzierungsbedürftig
 Auch wenn der frühere Gesundheitsminister Seehofer sie bereits 1999 gutbayrisch als einen "Schmarrn" bezeichnete, ist sie je nach Bedarf auch heute noch quicklebendig: die "Kostenexplosion". Genauso wie die "Kostenexplosion" gewalttätig und unbremsbar erscheint, wirkt auch der "demografische Kollaps" als eine Naturgewalt, unbezweifelbar und unbeeinflussbar durch Politik. Dass es sich dabei zunächst um Annahmen über die Ausgaben-, Einnahmen- und Leistungsseite des Gesundheitssystems handelt, die überprüft werden müssen und können, verschwindet häufig in dem von diesen Metaphern erzeugten geistigen Nebel.
Auch wenn der frühere Gesundheitsminister Seehofer sie bereits 1999 gutbayrisch als einen "Schmarrn" bezeichnete, ist sie je nach Bedarf auch heute noch quicklebendig: die "Kostenexplosion". Genauso wie die "Kostenexplosion" gewalttätig und unbremsbar erscheint, wirkt auch der "demografische Kollaps" als eine Naturgewalt, unbezweifelbar und unbeeinflussbar durch Politik. Dass es sich dabei zunächst um Annahmen über die Ausgaben-, Einnahmen- und Leistungsseite des Gesundheitssystems handelt, die überprüft werden müssen und können, verschwindet häufig in dem von diesen Metaphern erzeugten geistigen Nebel.
In dem im aktuellen 47. Band des "Jahrbuchs für christliche Sozialwissenschaft" (Aschendorff Verlag Münster) auf den Seiten 77 bis 102 veröffentlichten Beitrag von Rainer Müller vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen ("Kostenexplosion und demographischer Kollaps. Empirische und systematische sozialwissenschaftliche Präzisierungen zu einigen verbreiteten Annahmen") werden solche Annahmen auf ihre Stichhaltigkeit überprüft, beispielsweise unter dem Gesichtspunkt, welche empirische Faktenlage tatsächlich hinter der als 'Kostenexplosion' diskutierten Ausgabenentwicklung steht. Wie entwickelte sich beispielsweise der Anteil, den Arbeitgeber, Arbeitnehmer sowie schließlich die Kranken selbst an den Kosten tragen? Zugleich werden Zusammenhänge problematisiert, die in den Diskussionen häufig unreflektiert unterstellt werden: In welchem Zusammenhang steht etwa die Ausgabenentwicklung mit der demographischen Entwicklung? Einige der Annahmen erweisen sich als fragwürdig, andere als der Differenzierung bedürftig. Insgesamt verweist der Beitrag auf erhebliche Spielräume für die politische und soziale Gestaltung, mithin darauf, dass die Gesundheitsversorgung nicht als Ensemble von Sachzwängen zu interpretieren ist, sondern als politische Herausforderung.
Hier finden Sie die PDF-Datei des Aufsatzmanuskripts.
Bernard Braun, 16.11.2006
Einwohnerzahl vieler deutscher Städte wird erheblich schrumpfen
 In rund fünfzig Prozent aller deutschen Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2020 zum Teil erheblich schrumpfen. Dies prognostiziert ein bislang einzigartiges Informations- und Frühwarnsystem der Bertelsmann Stiftung für den demographischen Wandel. Die für Jedermann zugängliche Datenbank "Wegweiser Demographischer Wandel" zeigt eindrucksvoll, wie sich das Leben in den Städten und Gemeinden durch rückläufige Geburtenzahlen und den steigenden Anteil älterer Menschen grundlegend verändern wird. So wird das Durchschnittsalter in allen untersuchten Kommunen deutlich ansteigen - in Einzelfällen bis auf über 55 Jahre.
In rund fünfzig Prozent aller deutschen Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2020 zum Teil erheblich schrumpfen. Dies prognostiziert ein bislang einzigartiges Informations- und Frühwarnsystem der Bertelsmann Stiftung für den demographischen Wandel. Die für Jedermann zugängliche Datenbank "Wegweiser Demographischer Wandel" zeigt eindrucksvoll, wie sich das Leben in den Städten und Gemeinden durch rückläufige Geburtenzahlen und den steigenden Anteil älterer Menschen grundlegend verändern wird. So wird das Durchschnittsalter in allen untersuchten Kommunen deutlich ansteigen - in Einzelfällen bis auf über 55 Jahre.
Die Datenbank verbindet erstmals flächendeckende Prognosen zur demographischen Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland mit aktuellen Daten zur sozialen und ökonomischen Situation in den Städten und Gemeinden. Mit dem "Wegweiser Demographischer Wandel" der Bertelsmann Stiftung werden im Internet erstmals belastbare Daten zur lokalen Situation in 2.959 untersuchten Kommunen und 432 Landkreisen bereitgestellt. Erfasst wird das Lebensumfeld von 85 Prozent der Einwohner Deutschlands. Der Wegweiser gliedert sich in die drei Rubriken: Daten, Prognosen und Konzepte.
"Die Kommunen sind der Ort, wo der demographische Wandel unmittelbar und unausweich-lich erlebt wird", sagte Dr. Johannes Meier, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, bei der Vorstellung des Frühwarnsystems. Die Kommunen würden jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität von den Auswirkungen des demographischen Wandels erfasst. Der Wegweiser Demographischer Wandel mache diese Entwicklungen nun für jede Kommune transparent.
So sind die Städte Wolfen, Hoyerswerda und Weisswasser am stärksten von Alterung und Schrumpfung betroffen. Der Bevölkerungsverlust wird in diesen Städten bis zum Jahr 2020 laut Prognose bis zu 47 Prozent betragen. Dies ist in erster Linie auf eine besonders starke Abwanderung der 18 bis 24 Jährigen zurückzuführen. Demgegenüber stehen Kommunen, die bis zum Jahr 2020 über 40 Prozent an Bevölkerung hinzugewinnen werden. Dies sind häufig Städte und Gemeinden im Umfeld der wirtschaftsstarken und aufstrebenden Großstädte wie Ahrensfelde bei Berlin oder Wentorf bei Hamburg.
Die Aktion Demographischer Wandel der Bertelsmann Stiftung hat den Wegweiser gemeinsam mit kommunalen Experten aus Wissenschaft und Praxis entwickelt. Eine Besonderheit des Wegweisers ist die Einteilung der untersuchten Städte und Gemeinden in 15 unterschiedliche Demographietypen. Für diese Demographietypen bietet der Wegweiser konkrete Handlungskonzepte für die kommunale Praxis an. "Das kommunale Management, aber auch jeder Bürger haben damit die Möglichkeit, sich ein konkretes Bild über die zukünftigen Herausforderungen ihres unmittelbaren Umfelds zu machen", erläuterte Meier. "Der Wegweiser stellt darum auch für Journalisten und Bürger einen wichtigen Service dar, um sich aktiv in die Gestaltung des demographischen Wandels einzubringen."
Weitere Informationen finden Sie unter: Wegweiser Demographischer Wandel
Gerd Marstedt, 6.2.2006
Umfrage zur Pflegeversicherung: Viele würden auch mehr zahlen wollen - bei besseren Leistungen
 Zehn Jahre nach Einführung der sozialen Pflegeversicherung als fünfter Zweig der Sozialversicherung wird über Schwächen in der Ausgestaltung und über Fragen der zukünftigen Finanzierung diskutiert sowie nach Lösungswegen gesucht. In diesem Zusammenhang ist eine Bewertung aus der Sicht der Pflegeversicherten und -bedürftigen wichtig. Empirische Untersuchungen zur Akzeptanz und Einschätzung der sozialen Pflegeversicherung sind jedoch selten.
Zehn Jahre nach Einführung der sozialen Pflegeversicherung als fünfter Zweig der Sozialversicherung wird über Schwächen in der Ausgestaltung und über Fragen der zukünftigen Finanzierung diskutiert sowie nach Lösungswegen gesucht. In diesem Zusammenhang ist eine Bewertung aus der Sicht der Pflegeversicherten und -bedürftigen wichtig. Empirische Untersuchungen zur Akzeptanz und Einschätzung der sozialen Pflegeversicherung sind jedoch selten.
Der Monitor Nr. 3/2005 des WIdO (Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen) widmet sich den Einstellungen und Haltungen der Versicherten und pflegenden Angehörigen zur Pflegeversicherung. Es wird deutlich, dass die Einführung der Pflegeversicherung grundsätzlich begrüßt, der Versicherungsschutz und die Leistungsgewährung allerdings eher kritisch bewertet werden. Zudem ist bei den Befragten durchaus die Bereitschaft erkennbar, für einen qualitativ besseren und/oder umfangreicheren Versicherungsschutz auch einen größeren finanziellen Beitrag zu leisten.
Details zu den Ergebnissen der Umfrage:
• Die Zustimmung variiert deutlich mit der Schulbildung der Befragten. Sie ist bei Personen, die über eine höhere Schulbildung verfügen, deutlich niedriger (31,5 Prozent) als bei Befragten mit geringer Schulbildung: Von ihnen beurteilen 44,6 Prozent die Einführung der Pflegeversicherung positiv.
• 6,3 Prozent der Versicherten haben angegeben, dass in ihrem Haushalt jemand pflegedürftig ist, der von einem anderen Haushaltsmitglied gepflegt wird. In Familien geben sogar 15,8 Prozent der Befragten an, dass ein Haushaltsmitglied gepflegt wird.
• Den zeitlichen Aufwand für die Pflege von Angehörigen geben die Befragten mit durchschnittlich 24 Stunden pro Woche an, das sind 3,4 Stunden Pflegetätigkeit pro Tag. Immerhin bei 44% liegt der Aufwand bei 28 und mehr Stunden.
• Dass die Einführung der Pflegeversicherung sich bewährt hat, meinen fast 40 Prozent der 2.361 Befragten. Nur ein Fünftel (20,7 Prozent) ist gegenteiliger Auffassung.
- Die kritische Haltung gegenüber dem Pflegeversicherungsschutz steigt mit zunehmender Bildung der Befragten: Menschen mit hoher Schulbildung sind nur zu 13,5 Prozent davon überzeugt, dass die Pflegeversicherung einen ausreichenden Versicherungsschutz bietet. Die Mehrheit der Befragten weiß offenbar um den Teilkaskocharakter der Pflegeversicherung.
• Eine Beitragssatzerhöhung bei der Pflegeversicherung wird seitens der Versicherten nicht grundsätzlich abgelehnt. Mehr als jeder Dritte (38,6 Prozent) stimmt der Aussage zu, dass bei einer Erweiterung des Leistungsangebots der Pflegeversicherung auch der Preis steigen dürfe. 35,5 Prozent sind gegen eine Preiserhöhung. Dabei ist ein Einkommens- und Bildungseffekt deutlich erkennbar. Bei Versicherten mit hohem Einkommen und hoher Bildung sind knapp 50% bereit, mehr zu bezahlen, bei Geringverdienern und Versicherten mit einfacher Schulbildung sind es dagegen nur rund ein Drittel.
PDF-Datei zum WIdO Monitor 3/2005: Ergebnisse einer Repräsentativumfrage unter 3.000 GKV-Versicherten zur Pflegeversicherung
Gerd Marstedt, 20.12.2005
GKV-Beitragssatz 2040 = 31,2 %? So funktioniert demografischer Schwindel!
 "Hauptsache hoch und unausweichlich" scheint das Motto der meisten Prognosen der Entwicklung des künftigen Beitragssatzes der GKV unter den Bedingungen der demografischen Veränderungen zu sein. Die dann für die Jahre 2040 oder 2050 prognostizierten Beitragssätze von 15 bis 31,2 Prozent sind wegen der Schwierigkeiten einer gleichzeitig zuverlässigen Prognose der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung ihrer Gesundheit sowie der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der GKV für einen solch langen Zeitraum äußerst fragwürdig.
"Hauptsache hoch und unausweichlich" scheint das Motto der meisten Prognosen der Entwicklung des künftigen Beitragssatzes der GKV unter den Bedingungen der demografischen Veränderungen zu sein. Die dann für die Jahre 2040 oder 2050 prognostizierten Beitragssätze von 15 bis 31,2 Prozent sind wegen der Schwierigkeiten einer gleichzeitig zuverlässigen Prognose der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung ihrer Gesundheit sowie der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der GKV für einen solch langen Zeitraum äußerst fragwürdig.
Die wesentlichen Unsicherheiten und Fehlfolgerungen derartiger Prognostik trägt Hagen Kühn (WZB) in einem Aufsatz zusammen, der folgendes Resumee zieht: "Wer heute den demographischen Wandel für langfristig unausweichliche Pro-Kopf-Ausgaben der Krankenversicherung verantwortlich macht, begeht eine grobe und unprofessionelle Fehlinterpretation."
Hier finden Sie den Aufsatz von Hagen Kühn Demographischer Wandel und demographischer Schwindel - Zur Debatte um die gesetzliche Krankenversicherung
Bernard Braun, 31.7.2005
Demografie - Nicht Schicksal, sondern Politik!
 Statt sich und andere durch die Dramatik der "demografischen Bedrohung" zu lähmen, weisen die am "Center on a Aging Society" der Georgetown Universität in Washington D.C. arbeitenden Robert Friedland und Laura Summer in ihrer im März 2005 aktualisierten Studie "Demography is not destiny, Revisited" auf die Bedeutung und Möglichkeit hin, die Folgen der demografischen Veränderungen durch Politik zu bewältigen.
Statt sich und andere durch die Dramatik der "demografischen Bedrohung" zu lähmen, weisen die am "Center on a Aging Society" der Georgetown Universität in Washington D.C. arbeitenden Robert Friedland und Laura Summer in ihrer im März 2005 aktualisierten Studie "Demography is not destiny, Revisited" auf die Bedeutung und Möglichkeit hin, die Folgen der demografischen Veränderungen durch Politik zu bewältigen.
Neben der empirisch belegten Entdramatisierung der bisherigen Entwicklung in den USA (davon abgesehen sind die USA sogar "jünger" als andere Industriestaaten) geben sie zahlreiche Hinweise für die politische Gestaltbarkeit des demografischen Umbaus. So halten sie z.B. die Förderung der Produktivität künftiger Arbeitergenerationen und eine expansive öffentliche Bildungspolitik für wichtig.
Hier findet man den Text der Studie Demography is not destiny, Revisited
Bernard Braun, 26.7.2005
Länger leben mit geringer Krankheitslast
 Eine der meist empiriefreien Grundgewissheiten der Demografie-Debatte in Deutschland ist die Assoziation von längerer Lebenserwartung und höherer Krankheitslast. In einem weltweit einmaligen Forschungsprojekt des "National Bureau of Economic Research (NBER)" der USA, dem so genannten "Early Indicators Project", werden dieser und andere Zusammenhänge für das 20. Jahrhundert mit Lebensverlaufdaten von über 45.000 Armeeangehörigen in mehreren Studien genauer untersucht. Das Kernergebnis der Studie "Changes in the Process of Aging During the Twentieth Century Findings and Procedures of the Early Indicators Project" von Robert Fogel lautet dagegen: "Perhaps most striking, the average age of onset of various common chronic conditions increased by 10 years over an 80-year period, ..., while life expectancy increased by just 6.6 years. In sum, these facts suggest that Americans are not only living longer than in the past, but are also healthier throughout the life cycle, even in old age."
Eine der meist empiriefreien Grundgewissheiten der Demografie-Debatte in Deutschland ist die Assoziation von längerer Lebenserwartung und höherer Krankheitslast. In einem weltweit einmaligen Forschungsprojekt des "National Bureau of Economic Research (NBER)" der USA, dem so genannten "Early Indicators Project", werden dieser und andere Zusammenhänge für das 20. Jahrhundert mit Lebensverlaufdaten von über 45.000 Armeeangehörigen in mehreren Studien genauer untersucht. Das Kernergebnis der Studie "Changes in the Process of Aging During the Twentieth Century Findings and Procedures of the Early Indicators Project" von Robert Fogel lautet dagegen: "Perhaps most striking, the average age of onset of various common chronic conditions increased by 10 years over an 80-year period, ..., while life expectancy increased by just 6.6 years. In sum, these facts suggest that Americans are not only living longer than in the past, but are also healthier throughout the life cycle, even in old age."
Damit liegt ein weiterer empirischer Beleg für die so genannte "compression of morbidity"-Hypothese vor. Diese geht davon aus, dass längere Lebenserwartung auch die Zunahme gesunder Lebensjahre bedeutet und die mögliche Krankheitslast sich am Ende des Lebenslaufes befindet oder gar nicht auftritt. Die "Medikalisierungs"-Hypothese behauptet stattdessen eine mit zunehmender Lebenserwartung ebenfalls zunehmende Anzahl von Lebensjahren mit Krankheit.
Hier findet sich der Text der (kostenpflichtigen) Studie Changes in the Process of Aging During the Twentieth Century Findings and Procedures of the Early Indicators Project
Bernard Braun, 26.7.2005