



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Versorgungsforschung: Krebs |
Alle Artikel aus:
Patienten
Versorgungsforschung: Krebs
"Vorsicht Studie" oder oft werden "positive" Ergebnisse durch Anpassung des primären Endpunkts produziert
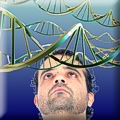 Die häufig als eine Art Schlussakkord beabsichtigte Bemerkung "das zeigt eine Studie" gehört mittlerweile zum Repertoire vieler gesundheitswissenschaftlicher und politischer Diskussionen oder Talkshows, ebenso wie die Gegenwehr in Gestalt des "aber eine andere Studie zeigt doch". Umso wichtiger ist es daher, weder jedem Argument mit dem Prädikat "Studie" zu trauen, dass die Studie korrekt wiedergegeben wird, noch blind studiengläubig zu sein. Auch Studien müssen methodisch und inhaltlich kritisch hinterfragt werden bzw. hinterfragbar sein. Faktenchecks am Folgetag der Debatte sind hilfreich, dürften aber nur von einer Minderheit der Zuhörer/-schauer und dazu überwiegend nur von jenen genutzt werden, die bereits Zweifel haben. Auch Faktenchecks sollten vielleicht einmal ihre quantitative und qualitative Reichweite und Wirksamkeit überprüfen.
Die häufig als eine Art Schlussakkord beabsichtigte Bemerkung "das zeigt eine Studie" gehört mittlerweile zum Repertoire vieler gesundheitswissenschaftlicher und politischer Diskussionen oder Talkshows, ebenso wie die Gegenwehr in Gestalt des "aber eine andere Studie zeigt doch". Umso wichtiger ist es daher, weder jedem Argument mit dem Prädikat "Studie" zu trauen, dass die Studie korrekt wiedergegeben wird, noch blind studiengläubig zu sein. Auch Studien müssen methodisch und inhaltlich kritisch hinterfragt werden bzw. hinterfragbar sein. Faktenchecks am Folgetag der Debatte sind hilfreich, dürften aber nur von einer Minderheit der Zuhörer/-schauer und dazu überwiegend nur von jenen genutzt werden, die bereits Zweifel haben. Auch Faktenchecks sollten vielleicht einmal ihre quantitative und qualitative Reichweite und Wirksamkeit überprüfen.
Wie notwendig dies ist, zeigt eine lange Reihe von vorsätzlich oder fahrlässig verzerrter oder manipulierter Ergebnisse von Studien mit einem auf den ersten Blick wissenschaftlichen Anspruch. Da fehlen z.B. Angaben zu den Interessenkonflikten der Autor:innen; Studien, in denen das als Endpunkt angegebene Ziel (z.B. die Reduktion einer Erkrankung durch das Medikament) nicht erreicht wurde; werden nicht veröffentlicht oder werden selbst in "good journals" nicht angenommen, bei zunächst beeindruckenden relativen Verbesserungen fehlen Angaben zur absoluten Anzahl der dahinter stehenden Studienteilnehmer:innen oder man erfährt nichts über die Anzahl und Art von Studienabbrechern.
Ăśber eine bisher nicht bekannte Variante, Ergebnisse einer ansonsten wissenschaftlichen Studie zu manipulieren, berichtet eine Gruppe von Wissenschaftler:innen jetzt als ein Ergebnis ihrer systematischen Analyse von 755 klinischen Studien zu Krebsmedikamenten, also einer gesundheitlich aber auch kommerziell bedeutsamen Arzneimittelgruppe.
Ihre Ergebnisse sind u.a.:
• 145 (19,2 %) dieser Studien verändern den fĂĽr die Beurteilung der Wirksamkeit und anderer Faktoren elementaren und zu Beginn jeder methodisch korrekten Studie festzulegenden primären Endpunkt nachträglich, d.h. im Lichte von Zwischenergebnissen.
• In ihren Veröffentlichungen gibt es bei 102 (70,3 %) dieser Studien keinen Hinweis auf diese Veränderungen.
• Zu den häufigsten erkennbaren Veränderungen gehört bei 49 Studien die Umwidmung primärer zu sekundären Endpunkte und bei 47 Studien eine neue Definition der primären Endpunkte.
• Obwohl ein Protokoll mit Endpunkten, Methodik etc. der beabsichtigten Studie vor ihrem Beginn zu den Essentials einer methodisch hochwertigen Studie gehören, gab es fĂĽr 473 der 755 Studien kein verfĂĽgbares Protokoll.
• Und honni soit qui mal y pense: Studien mit Veränderungen beim primären Endpunkt enthielten fast doppelt so häufig (odds ratio 1,86) "positive" Ergebnisse wie Studien ohne solche Aenderungen. Dies bedeutet zwar nicht automatisch, dass solche Medikamente unwirksam sind, sondern "nur", dass dies sein könnte oder andere Medikamente, bei denen das Ergebnis nicht durch Endpunktveränderungen mitproduziert wurde, nicht zugelassen werden.
In der Oktober-/Novemberausgabe 2023 des wie gewohnt informativen "Pharma-Briefs" der BUKO Pharma-Kampagne (u.a. Beiträge über verschwiegene Interessenkonflikte bei versteckter Werbung für die Abnehmspritze und die in die Ferne gerückte universelle Gesundheitsversorgung) wird dieses Geschehen so charakterisiert: "Das ist etwa so, wenn bei einem Schießwettbewerb erst geschossen und anschließend die Zielscheibe um den Treffer herum gemalt wird."
Die im Mai 2023 im "JAMA Netw Open" veröffentlichte Studie Incidence of Primary End Point Changes Among Active Cancer Phase 3 Randomized Clinical Trials von Marcus A. Florez, Joseph Abi Jaoude et al. ist komplett kostenlos erhältlich
, 3.12.23
Hohe Preise für 65 Krebsmedikamente sind nicht durch ihren Nutzen gerechtfertigt. Daten aus UK, USA, D, F und CH
 Folgt man den Begründungen der Hersteller von Medikamenten, die pro Dosis, Jahr oder gesamter Behandlung bis zu sechs- oder siebenstellige Summen kosten, sind diese Preise durch den damit ermöglichten Nutzen gerechtfertigt. Ob dies für die besonders teuren Krebs-Medikamente zutrifft, untersuchten jetzt Wissenschaftler*innen der Universität in Zürich und der Harvard Medical School mittels einer "cost-benefit"-Analyse für 65 zur Behandlung von festen Tumoren (Leber-, Lungen- oder Brustkrebs und verschiedene Arten von Blutkrebs in der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich und den USA neu auf den Markt gebrachten Medikamente.
Folgt man den Begründungen der Hersteller von Medikamenten, die pro Dosis, Jahr oder gesamter Behandlung bis zu sechs- oder siebenstellige Summen kosten, sind diese Preise durch den damit ermöglichten Nutzen gerechtfertigt. Ob dies für die besonders teuren Krebs-Medikamente zutrifft, untersuchten jetzt Wissenschaftler*innen der Universität in Zürich und der Harvard Medical School mittels einer "cost-benefit"-Analyse für 65 zur Behandlung von festen Tumoren (Leber-, Lungen- oder Brustkrebs und verschiedene Arten von Blutkrebs in der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich und den USA neu auf den Markt gebrachten Medikamente.
Sie untersuchten dafür ob und inwieweit die monatlichen Preise für diese Medikamente mit den Ergebnissen zweier wissenschaftlich anerkannten und etablierten Verfahren zur Messung des Nutzens von Krebstherapeutika korrelierten. Bei den Nutzenmessinstrumenten handelt es sich um das "American Society of Clinical Oncology Value Framework" und die "European Society of Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale". Die Frage war, ob die hochpreisigen Krebsmedikamente einen höheren Nutzen haben als solche mit niedrigeren Preisen. Korrelationskoeffizienten (hier der von Spearman's) sind dafür ein relativ grober, aber zur Bestimmung eines statistischen Zusammenhangs durchaus geeigneter Indikator.
Die Ergebnisse sind eindeutig und differenziert:
• Laut der Hauptautorin Kerstin Vokinger: "Our study clearly shows that, in general, for Switzerland, Germany, England and the United States, there is no association between clinical benefit of a cancer drugs and their prices,"
• Eines der Nutzenmessverfahren zeigte zwar eine positive Korrelation zwischen höheren Preisen und höherem Nutzen, dies gilt allerdings nur für Frankreich.
Das letzte Ergebnis weist auch auf ein weiteres Ergebnis dieser Studie hin, dass es nämlich auch bei dieser Medikamentengruppe erhebliche Preisunterschiede zwischen untersuchten Ländern gibt. Aufgrund des nahezu nicht regulierten, d.h. freien Marktes in den USA waren dort auch die Preise dieser Medikamente rund doppelt so hoch wie den europäischen Vergleichsländern. Aber auch unter denen gibt es ein deutliches Preisgefälle von der Schweiz bis zu Deutschland und Frankreich.
Der Aufsatz Prices and clinical benefit of cancer drugs in the USA and Europe: a cost-benefit analysis von Kerstin N Vokinger, Thomas J Hwang, Thomas Grischott, Sophie Reichert, Ariadna Tibau, Thomas Rosemann und Aaron S Kesselheim ist am 1. Mai 2020 in der renommierten Fachzeitschrift "The Lancet Oncology" (21 (5): 664-670) veröffentlicht. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Auch vom möglichen Ersatzargument für die hohen Preise, den riesigen Forschungs- und Produktionskosten, bleibt bei genauerer Untersuchung ebenfalls nicht viel übrig.
Bernard Braun, 11.5.20
Von den Möglichkeiten die Lebensqualität von PatientInnen zu messen. Nationale Normwerte machen es besser möglich!
 Immer noch spielt die Lebensqualität von PatientInnen selbst in methodisch hochwertigen Studien keine oder lediglich eine gegenüber so genannten "objektiven" Endpunkten (z.B. Mortalität oder Wiedereinweisungshäufigkeit) nachgeordnete Rolle. Dies kann aus Patientensicht zu falschen Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von Therapien führen oder dazu, dass die Suche nach anderen Therapien, die sich mehr auf die Lebensqualität auswirken, unterbleibt.
Immer noch spielt die Lebensqualität von PatientInnen selbst in methodisch hochwertigen Studien keine oder lediglich eine gegenüber so genannten "objektiven" Endpunkten (z.B. Mortalität oder Wiedereinweisungshäufigkeit) nachgeordnete Rolle. Dies kann aus Patientensicht zu falschen Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von Therapien führen oder dazu, dass die Suche nach anderen Therapien, die sich mehr auf die Lebensqualität auswirken, unterbleibt.
Selbst wenn aber in nationalen und international vergleichenden Studien Veränderungen der Lebensqualität zentrale Endpunkte sind, wird sie oft mit völlig unterschiedlichen Indikatoren gemessen, was Vergleiche unmöglich macht oder zu fragwürdigen Ergebnissen führt.
Insofern ist eine jetzt veröffentlichte Studie von nationalen Referenzwerten für die Lebensqualität oder das Wohlbefinden von Krebskranken in 11 Mitgliedsländern der EU und vier weiteren Ländern (Russland, Kanada, USA, Türkei) ein riesiger Fortschritt.
Als Grundlage dient der bereits vor über 25 Jahren entwickelte, weltweit anerkannte und eingesetzte, 30 Fragen umfassende Fragebogen "QLQ-C30" der European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), der nach einer kurzen und sicheren Anmeldung kostenlos zugänglich ist.
Aber selbst wenn man diesen Fragebogen in Studien einsetzte, existierte bisher das Problem, dass es weder für nationale noch für internationale Studien nationale Normwerte gab. Um wie viel schlechter oder sogar besser ist also die Lebensqualität von bestimmten PatientInnen im Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung im eigenen Land oder im Vergleich mit anderen Ländern?
Diesen Zustand beendeten nun an der Charité tätige ForscherInnen mit einer standardisierten Onlinebefragung zur Lebensqualität von 15.386 EinwohnerInnen der 15 Länder.
Dabei zeigten sich teilweise unerwartet deutliche Unterschiede des Wohlbefindens der Allgemeinbevölkerungen:
• "Während die unter den Deutschen (67) ermittelte Lebensqualität im Mittelfeld lag, gaben die Befragten in Österreich (75,6) und den Niederlanden (77,4) die höchsten Werte an. Menschen aus Polen (60), Russland (59,7), der Türkei (60,7), Großbritannien (62,3) und den USA (63,9) hingegen nannten in der Regel deutlich niedrigere Werte in sämtlichen Bereichen ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität. So schätzten sie beispielsweise ihre körperliche und emotionale Verfassung schlechter ein oder berichteten vermehrt über Erschöpfung oder finanzielle Nöte im Vergleich zu Befragten aus Österreich oder den Niederlanden."
• Eine der ForscherInnen wies auf die praktischen Konsequenzen für die Behandlung hin: "Denn es macht einen Unterschied, ob eine Krebspatientin aus Russland oder aus Spanien kommt, wenn sie angibt, erschöpft zu sein: In Russland gibt die Allgemeinbevölkerung eine deutlich stärkere Erschöpfung an als in Spanien. Für 15 Länder haben wir nun diese Normdaten, die sowohl länderspezifische als auch länderübergreifende Vergleiche ermöglichen."
Weitere nach den 30 Lebensqualitätsmerkmalen differenzierte Informationen finden sich in zwei komplett kostenlos erhältlichen Aufsätzen:General population normative data for the EORTC QLQ-C30 health-related quality of life questionnaire based on 15,386 persons across 13 European countries, Canada and the United States von Nolte S et al., online am 19. Dezember 2018 veröffentlicht in der Zeitschrift "European Journal of Cancer" (107 (2019) 153-163) und Establishing the European Norm for the health-related quality of life domains of the computer-adaptive test EORTC CAT Core von Liegl G et al., online am 19. Dezember 2018 veröffentlicht in der Fachzeitschrift "European Journal of Cancer" (107 (2019) 133-141).
Bernard Braun, 22.12.18
Digitale rektale Prostata-Untersuchung wegen Risiko von Über-/Fehldiagnostik nicht empfehlenswert, nur was sind die Alternativen?
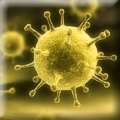 Die als "unangenehm" empfundene Untersuchung der Prostata mittels des in den After eingeführten Fingers des Urologen als Bestandteil der Früherkennungsuntersuchung auf ein Prostatakarzinom hindert wahrscheinlich Millionen von Männern, das Früherkennungsangebot in Anspruch zu nehmen. Viele Männer dürften aber auch versuchen, ihre Prostatagesundheit lediglich durch den via Blutprobe ermittelbaren PSA-Wert (Bestimmung eines prostataspezifischen Antigens) bestimmen zu lassen - selbst wenn sie von den Schwächen der Prädiktivität dieses Wertes schon einmal gehört haben. Hauptsache nicht "diese Untersuchung".
Die als "unangenehm" empfundene Untersuchung der Prostata mittels des in den After eingeführten Fingers des Urologen als Bestandteil der Früherkennungsuntersuchung auf ein Prostatakarzinom hindert wahrscheinlich Millionen von Männern, das Früherkennungsangebot in Anspruch zu nehmen. Viele Männer dürften aber auch versuchen, ihre Prostatagesundheit lediglich durch den via Blutprobe ermittelbaren PSA-Wert (Bestimmung eines prostataspezifischen Antigens) bestimmen zu lassen - selbst wenn sie von den Schwächen der Prädiktivität dieses Wertes schon einmal gehört haben. Hauptsache nicht "diese Untersuchung".
Nach der aktuellen Veröffentlichung einer Metaanalyse von 7 Studien (aus 8.217 themenbezogenen Studien) mit 9.142 Teilnehmern, die sowohl eine "digital rectal examination (DRE)" bei einem Primärarzt als auch in deren Folge eine Biopsie ihrer Prostata hinter sich haben, ergibt sich folgendes Bild:
• Die zusammengefasste Sensitivität betrug 0,51, d.h. nur 51% der tatsächlich erkrankten Personen werden durch die DRE-Untersuchung erkannt.
• Die zusammengefasste Spezifität der DRE betrug 0,59, d.h. es wurden 59% der tatsächlich gesunden Personen als solche identifiziert. In diesem Fall werden also gesunde Personen z.B. weiter mittels der invasiven Biopsie untersucht, also ohne Not psychisch belastet und den zahlreichen Risiken der Gewebeentnahme (z.B. Inkontinenz, erektile Dysfunktion) ausgesetzt.
• Der für die Leistungsfähigkeit von Tests wie der DRE berechenbare positive oder negative prädiktive Wert betrug 0,41 bzw. 0,64 - beides relativ geringe Werte.
• Die Qualität der Evidenz in den berücksichtigten Studien ist sehr gering.
Wegen der drohenden Über- oder Fehldiagnostik kommen die AutorInnen zu folgendem Schluss: "we do not recommend routine screening for prostate cancer using DRE in primary care, so as to minimize unnecessary diagnostic testing, overdiagnosis, and overtreatment."
Auch wenn damit die DRE als Screeninguntersuchung ausscheidet oder vermieden werden sollte, bleibt die Frage wie Männer sich angesichts regelmäßiger Berichte über Prostatakarzinome zu einem frühstmöglichen Zeitpunkt vergewissern können, ob ihre Prostata noch gesund ist oder nicht.
Der Aufsatz Digital Rectal Examination for Prostate Cancer Screening in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis von Leen Naji et al. ist im März 2018 in der Fachzeitschrift "Annals of Family Medicine" (vol. 16 no. 2: 149-154) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.3.18
Wie Massenmedien die Wahrnehmung von Erkrankten verzerren und spezifische Behandlungsangebote behindern - Beispiel Krebs in Irland
 Die Berichterstattung von Massenmedien spielt für die Wahrnehmung von Krankheiten, ja sogar teilweise bei ihrer "Entstehung" (so wurde der Anstieg von Patienten, welche wegen der Symptome der Krankheiten über die am Tag zuvor in dem in den 1960er bis 1980er Jahren populären ZDF-Gesundheitsmagazin Praxis berichtet wurde, nach dem Moderator "Morbus Mohl" genannt) und die Vorstellung von der Art von Erkrankungen und Erkrankten in der Öffentlichkeit eine große Rolle.
Die Berichterstattung von Massenmedien spielt für die Wahrnehmung von Krankheiten, ja sogar teilweise bei ihrer "Entstehung" (so wurde der Anstieg von Patienten, welche wegen der Symptome der Krankheiten über die am Tag zuvor in dem in den 1960er bis 1980er Jahren populären ZDF-Gesundheitsmagazin Praxis berichtet wurde, nach dem Moderator "Morbus Mohl" genannt) und die Vorstellung von der Art von Erkrankungen und Erkrankten in der Öffentlichkeit eine große Rolle.
Dass dies auch zu gravierenden Fehlwahrnehmungen führen kann, zeigt jetzt exemplarisch eine kleine Studie in Irland.
Es geht dabei um die auch in Irland häufigen und zunehmenden Krebserkrankungen. 70% der an Krebs erkrankten Personen sind 65 Jahre und älter. Trotz der damit verbundenen altersspezifischen Versorgungsbedürfnisse mangelt es auf der grünen Insel an speziellen geronto-onkologischen Versorgungsangeboten.
Zwei irische Gesundheitswissenschaftlern vermuteten, dass dies mit der dominanten Medienberichterstattung über Krebs als Erkrankung junger Menschen zusammenhängen könnte.
Um diese Hypothese zu überprüfen analysierten die Wissenschaftler die Berichterstattung zweier großer irischer Printmedien über Krebserkrankungen und -erkrankte im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2014 und Oktober 2015.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• In den insgesamt 167 gefundenen Artikeln gibt es Darstellung von an Krebs erkrankten Personen. Davon spezifizierten 48 das Alter der Patienten.
• Das durchschnittliche Alter der Erkrankten war 44,74 Jahre und das durchschnittliche Alter bei der Diagnose 39,87 Jahre.
• Vergleicht man dies mit dem in der Gesamtheit der Erkrankten bei durchschnittlich 67 Jahren liegenden Alter bei der Diagnose einer Krebserkrankung, sind die Erkrankten über die in den untersuchten Zeitungen berichtet wurde rund 27 Jahre jünger.
Wenn es eine Wirkung medialer Berichterstattung auf die Perzeption von Erkrankungen und Erkrankten gibt, könnte also der Mangel an speziellen geronto-onkologischen Leistungen zumindest teilweise auf dieser Art von verzerrter Darstellung (die Autoren sprechen sogar von "ageism") beruhen.
Ob es solche medialen Verzerrungen mit möglichen Folgen für die Thematisierung von Krankheiten und von spezifischen Angeboten auch z.B. in Deutschland gibt, könnte relativ leicht untersucht werden. Solche Untersuchungen könnten neben dem Merkmal Alter natürlich auch noch andere Inhalte der Berichterstattung miteinbeziehen. So gibt es z.B. Hinweise, dass die künftige Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Erkrankungen in Massenmedien (aber nicht nur dort) eher übertrieben dargestellt und die Rolle möglicher sozialer Einflüsse eher untertrieben oder gar nicht dargestellt wird.
Der Kurzbericht MISSING IN THE MEDIA: CANCER AND OLDER PEOPLE von A Fallon und D O'Neill ist am 16. Mai 2017 in der Zeitschrift "Age Ageing (46 (suppl_1): i1-i22) erschienen.
Bernard Braun, 21.5.17
Unheilbarer Krebs: die meisten Patienten wünschen vollständige Informationen
 Welche Informationen wünschen Patienten mit Krebs und welche wünschen sie nicht - diese Frage untersuchten holländische Wissenschaftler an 77 Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Zweitlinien-Chemotherapie standen. Bei diesen Patienten lag ein fortgeschrittener, nicht heilbarer Brustkrebs oder Darmkrebs vor, der sich unter der ersten Chemotherapie (Erstlinientherapie) weiter ausgebreitet hatte. Die Erfolgsaussichten einer Zweitlinientherapie sind zumeist eher gering oder auch unklar.
Welche Informationen wünschen Patienten mit Krebs und welche wünschen sie nicht - diese Frage untersuchten holländische Wissenschaftler an 77 Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Zweitlinien-Chemotherapie standen. Bei diesen Patienten lag ein fortgeschrittener, nicht heilbarer Brustkrebs oder Darmkrebs vor, der sich unter der ersten Chemotherapie (Erstlinientherapie) weiter ausgebreitet hatte. Die Erfolgsaussichten einer Zweitlinientherapie sind zumeist eher gering oder auch unklar.
Im Gegensatz zu anderen Studien, in denen Patienten mit einer hypothetischen Situation konfrontiert wurden, ging es in dieser Studie um eine "echte" Behandlungsentscheidung.
Die Patienten erhielten von ihrem Onkologen die üblichen Informationen über die Behandlung. Eine Pflegekraft bot ihnen zusätzlich Informationen auf Grundlage einer Entscheidungshilfe zu den Bereichen unerwünschte Wirkungen (Schaden), Tumorwachstum und Überleben an.
Die Information erfolgte schrittweise, indem die Pflegekraft erst erklärte, was für Informationen der Patient zu erwarten hatten damit dieser entscheiden konnten, ob er die Informationen erhalten wollte. Zum Thema Überleben erklärte die Pflegekraft beispielsweise das Konzept der mittleren Überlebenszeit mit dem Hinweis darauf, dass sich die Überlebenszeit für den einzelnen Patienten nicht genau vorhersagen lässt.
Die Patienten wurden befragt, zu welchen Bereichen sie sich informieren wollten. Die Ärzte wurden befragt, zu welchen Bereichen die Patienten nach ihrer Einschätzung informiert werden wollten.
95% der Patienten wollten zu unerwünschten Wirkungen informiert werden, 91% über das Ansprechen des Tumors auf die Therapie und 75% über die Überlebenszeit.
Die Ärzte schätzten den Informationswunsch auf 100%, 97% und 81%.
Informationswunsch des Patienten und Einschätzung des Arztes stimmten in 62% der Fälle überein.
Diese Studie zeigt, dass die meisten aber nicht alle Patienten voll über den Nutzen und den Schaden einer Chemotherapie informiert werden möchten. Selbst über die sehr sensible Frage der verbleibenden Lebenszeit wünschen 75% der Patienten informiert zu werden. Von Seiten der Ärzte werden die Informationsbedürfnisse der Patienten zwar zutreffend als hoch eingeschätzt, bezogen auf den einzelnen Patienten liegen sie aber nur zu 62% richtig. Dies unterstreicht einmal mehr die Aufgabe des Arztes, auf jeden Patienten einzugehen und ihn darin zu unterstützen, seine Bedürfnisse bezüglich Information und Behandlung zu erkennen und mitzuteilen.
Oostendorp LJM, Ottevanger PB, van de Wouw AJ, et al. Patients' Preferences for Information About the Benefits and Risks of Second-Line Palliative Chemotherapy and Their Oncologist's Awareness of These Preferences. Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education 2015. Volltext
David Klemperer, 11.7.16
Und es geht doch schnell! Wie die Evidenz zur nicht notwendigen Entfernung bestimmter Lymphknoten bei Brustkrebs im OP ankommt.
 Zu den fast schon gebetsmühlenartigen Beobachtungen im Rahmen von Versorgungsforschung gehört, dass selbst vielfach in Studien oder Leitlinien als evident, nützlich und wirtschaftlich belegte Therapien noch längere Zeit nach ihrer Veröffentlichung gar nicht oder nur bei einer Minderheit der Ärzte angekommen sind.
Zu den fast schon gebetsmühlenartigen Beobachtungen im Rahmen von Versorgungsforschung gehört, dass selbst vielfach in Studien oder Leitlinien als evident, nützlich und wirtschaftlich belegte Therapien noch längere Zeit nach ihrer Veröffentlichung gar nicht oder nur bei einer Minderheit der Ärzte angekommen sind.
Dass dies auch anders und dazu noch schnell gehen kann, zeigt eine im Juliheft 2016 der Fachzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichte Studie zur operativen Entfernung von Lymphknoten in den Achselhöhlen von Brustkrebspatientinnen vor und nach einer bahnweisenden Studie.
Diese Operation gehörte lange Zeit trotz einer Reihe unerwünschter Folgeeffekte zur Standardtherapie bei Brustkrebs, sollte die weitere Verbreitung von Brustkrebs verhindern und das Risiko eines Rezidivs signifikant senken helfen.
In einer großen kontrollierten Studie zwischen 2004 und 2012 wurden 891 Brustkrebspatientinnen genauer untersucht, bei denen eine brusterhaltende Operation ("lumpectomy") samt postoperativer Bestrahlungstherapie durchgeführt wurde, die einen T1- oder T2-Tumor ("early stage tumor") mit weniger als 5 Zentimeter Durchmesser und einen oder zwei positiv getestete Lymphknoten hatten, aber vor der Operation nicht chemotherapeutisch behandelt wurden.
In dieser Studie erwies sich, dass die 5-Jahres-Überlebensraten bei den operierten und nichtoperierten Frauen nahezu identisch waren: 91,8% bei den Frauen mit Entfernung der Achsel-Lymphknoten und 92,5% bei den Frauen ohne Entfernung dieser Knoten - letztere auch noch ohne die genannten unerwünschten Folgewirkungen.
Diese Ergebnisse wurden 2010 und 2011 auf einer Onkologietagung und in einer us-amerikanischen Medizin-Fachzeitschrift veröffentlicht (Axillary Dissection vs No Axillary Dissection in Women With Invasive Breast Cancer and Sentinel Node Metastasis. A Randomized Clinical Trial von Armando E. Giuliano et al. in "JAMA" (2011;305(6):569-575) und komplett kostenlos erhältlich).
Für die Versorgungsstudie untersuchten nun Versorgungsforscher auf der Basis zweier Brustkrebsregister mit 22.571 PatientInnen, die den oben genannten Brustkrebscharakteristika entsprachen, ob und wie sich der Anteil der Patientinnen mit Lymphknotenentfernung zwischen 2008 (nach einem Maximalanteil von 64,3% operierter Patientinnen) und 2012, also von vor bis nach Bekanntheit des fehlenden Nutzens verändert hatte. Der Anteil fiel nach der Adjustierung nach weiteren Patientinnenmerkmalen von rund 62% um mehr als 50% oder 32,6 Prozentpunkte auf unter 30%.
Als Erklärung dieses fast sofort nach Bekanntwerden der Studienergebnisse erkennbaren praktischen Effekts einer wissenschaftlichen Erkenntnis, nannte der Hauptautor zweierlei: Erstens handle es sich um hochspezialisierte Chirurgen, die einen besseren Überblick zur Forschungslage in ihrem Fachbereich haben. Zweitens handle es sich bei Brustkrebspatientinnen (in den USA) im Vergleich zu anderen PatientInnen um sehr aktive und gut über die neueste Evidenz informierte Patientinnen: "This puts additional pressure on physicians to look at evidence."
Die Studie Contrary To Conventional Wisdom, Physicians Abandoned A Breast Cancer Treatment After A Trial Concluded It Was Ineffective von David H. Howard ist in "Health Affairs" (35, no.7 (2016):1309-1315) erschienen. Ein Abstract ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.7.16
Zwischen unter 20% bis 70%: Unterschiede der durch Verhaltensmodifikationen beeinflussbaren Krebsinzidenz und Mortalität
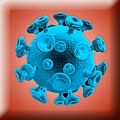 Eine 2015 in der Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlichte Studie zur Ätiologie von Krebserkrankungen führte zwei Drittel von ihnen auf zufällige und damit nicht verhinderbare oder beeinflussbare Mutationen bei der DNA-Replikation zurück und nur ein Drittel auf Erb- oder Umwelteinflüsse, die aber samt ihren Folgen auch nur zum Teil beeinflussbar sind.
Eine 2015 in der Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlichte Studie zur Ätiologie von Krebserkrankungen führte zwei Drittel von ihnen auf zufällige und damit nicht verhinderbare oder beeinflussbare Mutationen bei der DNA-Replikation zurück und nur ein Drittel auf Erb- oder Umwelteinflüsse, die aber samt ihren Folgen auch nur zum Teil beeinflussbar sind.
Nimmt oder nähme man dies ernst, schrumpften das Volumen der überhaupt sinnvollen präventiven Interventionen und der mögliche Erfolg einer Primärprävention von Krebserkrankungen gewaltig zusammen.
Eine andere, am 19. Mai 2016 online in der Fachzeitschrift JAMA Oncology" erschienene Studie kommt aber als Ergebnis einer prospektiven Kohortenstudien mit den Krebserkrankungs- und Lebensstildaten der "Nurses' Health Study"(16.531 Frauen) und der "Health Professionals Follow-up Study" (11.731 Männer), wieder zu einem deutlich höheren Anteil lebensstilassoziierter Krebserkrankungen und Krebsmortalität und damit einem höheren Erfolgspotenzial von Krebs-Primärprävention.
Unter gesundem gesundem Lebensstil wird Nichtrauchen, mäßiger Alkoholkonsum, ein gesundes Gewicht (BMI <27,5) und regelmäßige Bewegung verstanden.
Die altersstandardisierten Ergebnisse lauten u.a.:
• Das zusätzliche oder erhöhte bevölkerungsbezogene Risiko ("population-attributable risk" - PAR) für eine Neuerkrankung an allen Karzinomen war bei Männern mit einem gesunden Lebensstil bzw. einem niedrigen Verhaltensrisiko um 33% geringer als bei ihren Geschlechtsgenossen mit ungesünderem Gesundheitsverhalten. Bezogen auf die Mortalität aller Krebserkrankungen lag das zusätzliche Risiko bei den Männern mit gesundem Lebensstil um 44% unter dem der Mänbner mit ungesundem Lebensstil. Die PAR-Werte liegen bei den Frauen mit gesundem Lebensstil bei der Inzidenz aller Krebsarten um 25% und bei der Mortalität aller Krebsarten um 48% für unter den Werten der Frauen mit gesünderem Lebensstil.
• Beim Vergleich mit der gesamten weißen Bevölkerung in den USA, die einen deutlich schlechteren gesundheitsbezogenen Lebensstil als die Angehörigen der beiden Studienkohorten hat, steigen die Werte für Männer mit gesundem Lebensstil auf 63% (Inzidenz) und 67% (Mortalität) Abstand zu den Werten der ungesünderen Vergleichsgruppe. Bei den Frauen erhöhen sich die positiven Abstände auf 41% und 59%.
• Bei einzelnen Krebsarten wirkt sich ein gesunder Lebensstil zum Teil noch deutlich stärker positiv aus: So ist z.B. die Inzidenz von Lungenkarzinomen bei Frauen mit ungesundem Lebensstil um 82% und bei entsprechenden Männern um 78% höher als bei den sich gesund verhaltenden Angehörigen beider Geschlechter. Beim weiblichen Brustkrebs erhöht sich das PAR-Risiko um 4%, beim Prostatakrebs der Männer um 21%. Ähnliche Unterschiede gibt es auch bei der Mortalität.
• Zusammengefasst können bei den Angehörigen der beiden Kohorten potenziell 20% bis 40% aller Krebsfälle und rund die Hälfte aller Krebstodesfälle durch Modifikationen des Lebensstils verhindert werden. Rechnet man diese Ergebnisse auf die gesamte weiße Bevölkerung der USA hoch, steigt der Anteil präventiv verhinderbarer Krebsfälle auf 40% bis 70% an.
• Die für präventiv Tätige hoffnungsvolle Schlussfolgerung der StudienautorInnen lautet: "Primary prevention should remain a priority for cancer control."
Die Studie Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions von Cristian Tomasetti und Bert Vogelstein erschien am 2. Januar 2015 in "Science" (Vol. 347, Issue 6217: 78-81). Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Die Studie Preventable Incidence and Mortality of Carcinoma Associated With Lifestyle Factors Among White Adults in the United States von Mingyang Song und Edward Giovannucci ist am 19. Mai 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA Oncology" zunächst online erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
In dem ebenfalls kostenlos erhältlichen Editorial The Preventability of CancerStacking the Deck von Graham A. Colditz und Siobhan Sutcliffe werden die unterschiedlichen präventionsrelevanten Ergebnisse differenziert bewertet.
Bernard Braun, 23.5.16
Diagnostische Variabilität der Biopsien von Brustgewebe je nach Art der Zellveränderung erheblich
 Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Biopsie von entnommenen Gewebe zum Goldstandard der Diagnostik verschiedener Krebserkrankungen gehört und mehr oder weniger folgenschwere Therapieentscheidungen begründet, reduzieren die Ergebnisse einer in den USA durchgeführten Studie über die Zuverlässigkeit der Untersuchung von Brustgewebe auf das Vorliegen verschiedener Ausprägungen von Brustkrebs den Glanz erheblich.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Biopsie von entnommenen Gewebe zum Goldstandard der Diagnostik verschiedener Krebserkrankungen gehört und mehr oder weniger folgenschwere Therapieentscheidungen begründet, reduzieren die Ergebnisse einer in den USA durchgeführten Studie über die Zuverlässigkeit der Untersuchung von Brustgewebe auf das Vorliegen verschiedener Ausprägungen von Brustkrebs den Glanz erheblich.
Der Studie lag zum einen die zwischen drei Biopsieexperten konsentierte Diagnose der Brustgewebeproben von 240 US-Amerikanerinnen im Alter von 50 bis 59 Jahren zugrunde.
Zum anderen wurde jeweils eine Probe jeder Patientin auch noch 115 USA-weiten Pathologen zur Diagnostik zugesandt.
Die Ergebnisse bzw. die Übereinstimmung der konsentierten Diagnosen mit denen der 115 Pathologen sahen je nach Art der Gewebeveränderung unterschiedlich aus:
• Bei invasivem Krebs und gutartiger Gewebeveränderung ohne strukturelle Abnormalität der Zellen ("benign issue without atypia") stimmten die Ergebnisse zu mehr als 97% überein.
• Die Übereinstimmung betrug bei einem sogenannten duktalen Karzinom in situ (DCIS), also einer möglichen Krebsvorstufe nur noch rund 70%.
• Bei der Diagnostik einer gutartigen strukturellen Abnormalität von Zellen ("atypia") gab es nur noch in 40% der Fälle eine Übereinstimmung.
• Sowohl bei der Diagnose DCIS als auch bei der einer strukturellen Abnormalität waren die Diagnosen der 115 Pathologen ernster als die einhelligen der drei Experten. Bei der Atypia-Diagnose überintertpretierten zum Beispiel rund 54% der Pathologen den Ernst der Situation.
Angesichts der Folgenschwere einer Unter- oder Überinterpretation von Gewebeproben fordern die AutorInnen der Studie, dass die beobachtete diagnostische Variabilität so rasch wie möglich verringert werden müsse. Ob die für solche Fälle immer häufiger als Lösung vorgeschlagene Zweitmeinung dabei wirklich hilft, ist zu bezweifeln. Dies allein schon deswegen, weil in Zweitmeinungsverfahren generell weder bei Übereinstimmung noch bei Divergenz der Diagnose ausgeschlossen ist, dass beide Diagnosen falsch sind oder nicht geklärt ist, welche der beiden Diagnosen der Wirklichkeit entspricht.
Die Studie Variability in Pathologists' Interpretations of Individual Breast Biopsy Slides: A Population Perspective von Joann Elmore et al. ist am 22. März 2016 online first inb der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.3.16
Rückgang der Inzidenz und Mortalität von Darmkrebs durch Vorsorgekoloskopie - Ja, mit kleinen Einschränkungen
 Bei einigen Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen gibt es oft keine verlässlichen Daten für deren erwartete oder behauptete Wirkung auf die Inzidenz und die Mortalität.
Bei einigen Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen gibt es oft keine verlässlichen Daten für deren erwartete oder behauptete Wirkung auf die Inzidenz und die Mortalität.
Umso mehr ist zu begrüßen, dass es für die so genannte Vorsorgekoloskopie als GKV-Leistung für alle Versicherten ab dem 55. Lebensjahr nun derartige Daten gibt. Dies auch deshalb, weil es in Deutschland bisher im internationalen Vergleich besonders viel Neuerkrankungen an Darmkrebs gab. Hinzu kommt die Besonderheit der Koloskopie nicht nur Krebserkrankungen im Frühstadium erkennen und der Behandlung zuführen, sondern auch durch die Erkennung von Vorstufen eines möglichen Karzinoms eine Krebserkrankung verhüten zu können.
Auf der Basis der Daten der epidemiologischen Krebsregister und der Todesursachenstatistik kommt eine Gruppe von KrebsforscherInnen nun für den Zeitraum 2003 bis 2012 zu folgenden Ergebnissen:
• Die Inzidenz an Darmkrebs war vor Einführung der Koloskopie über mehrere Jahrzehnte angestiegen.
• Im Untersuchungszeitraum nahm die altersstandardisierte Darmkrebsinzidenz in Deutschland dann um 13,8 % bei Männern und um 14,3 % bei Frauen ab. Außerdem sank die altersstandardisierte Darmkrebsmortalität um 20,8 % bei Männern und um 26,5 % bei Frauen. Der starke Rückgang der Inzidenz war selektiv in den Altersgruppen ab 55 Jahren zu beobachten (17% bis 26%).
• Etwa 20-25 % der Anspruchsberechtigten nahmen bisher das Angebot einer Vorsorgekoloskopie in Deutschland wahr.
• Die beobachteten Muster sprechen für einen wesentlichen Beitrag der Vorsorgekoloskopie zur Senkung der Darmkrebsinzidenz und -mortalität in Deutschland.
• Nach den längerfristigen Erfahrungen aus den USA und auf Basis aktueller Hochrechnungen erwarten die ForscherInnen, dass sich der Rückgang der Darmkrebsinzidenz und -mortalität in Deutschland in den kommenden Jahren weiter deutlich fortsetzen und verstärken wird.
Auch wenn vieles dafür spricht, dass die Vorsorgekoloskopie wesentlich zu den erkannten gesundheitlichen Veränderungen beitrug, weisen die AutorInnen darauf hin, dass ein allerdings schwer zu quantifizierender Anteil z.B. durch den Rückgang des Rauchens bestimmt sein könnte. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die "Hauptlimitation" ihrer aber auch vieler anderer Studien, über keine getrennten Analysen zur Inzidenz und Mortalität in der mit bis zu 75% enorm großen Gruppe der NichtinanspruchnehmerInnen der Koloskopie zu verfügen. Dies erlaube nur "indirekte Rückschlüsse auf den möglichen Beitrag der Vorsorgekoloskopie". Für künftige Früherkennungs- und Vorsorgeangebote wünschen sich die AutorInnen daher weniger "unverhältnismäßig restriktive Datenschutzbestimmungen" bzw. eine andere Balance zwischen Datenschutz- und Vorsorgeinteressen der BürgerInnen.
Der Aufsatz Declining bowel cancer incidence and mortality in Germany—an analysis of time trends in the first ten years after the introduction of screening colonoscopy von H. Brenner, Schrotz-King P, Holleczek B, Katalinic A und Hoffmeister M ist am 19. Februar im Deutschen Ärzteblatt erschienen (113, 7: 101-6) und auch in deutscher Sprache komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.3.16
Der "fordernde Patient" - ein Mythos
 Werden Ärzte nach den Ursachen für die in vielen Bereichen festgestellte Überversorgung befragt, nennen sie häufig die Anspruchshaltung der Patienten (siehe z.B. "Mündige Patienten" aus Ärztesicht, Forum Gesundheitspolitik) als Ursache.
Werden Ärzte nach den Ursachen für die in vielen Bereichen festgestellte Überversorgung befragt, nennen sie häufig die Anspruchshaltung der Patienten (siehe z.B. "Mündige Patienten" aus Ärztesicht, Forum Gesundheitspolitik) als Ursache.
Eine amerikanische Studie ist dieser Hypothese nachgegangen und kommt zu anderen Ergebnissen.
Beteiligt waren 3624 Patienten und auf Seite der Professionellen 34 Onkologen, 11 onkologische Assistenzärzte sowie 15 Pflegekräfte und ArzthelferInnen in den onkologischen Behandlungszentren von 3 Krankenhäusern im Raume Philadelphia.
Die häufigsten Diagnosen waren Leukämien, Darmkrebs, Brustkrebs und Lungenkrebs. Knapp 2/3 der Patienten hatte Krebs im Frühstadium und etwa 1/3 metastasierten Krebs. Die Ärzte bewerteten die Beziehung zu über 80% der Patienten als hervorragend oder sehr gut.
Es wurden 5050 Arzt-Patienten-Gespräche ausgewertet. Die Ärzte bzw. Pflegekräfte wurden von geschulten wissenschaftlichen Mitarbeitern befragt, ob der Patient den Wunsch oder die Forderung nach einem bestimmten Test oder einer bestimmten Therapie vorgebracht hat. Wenn ja, sollte die Angemessenheit auf einer Skala von "extrem angemessen" bis "überhaupt nicht angemessen" bewertet werden.
In 3530 Gesprächen ging es um Chemotherapie oder Strahlentherapie, in 1520 Gesprächen ging es nicht um eine gegen die Krebserkrankung gerichtete Therapie.
In 440 Gesprächen (8,7%) äußerten Patienten einen Wunsch z.B. nach einer Computertomographie, nach einer Blutuntersuchung oder nach Palliativmaßnahmen.
316 (71,8%) dieser Wünsche beurteilten die Professionellen den Wunsch als angemessen und in 310 Fällen folgten sie ihnen. 50 Wünsche (11,4%) beurteilten sie als unangemessen, 7 befolgten sie. 74 Wünsche (16,8%) konnten sie nicht eindeutig zuordnen, 48 befolgten sie.
Ob Patienten einen Wunsch äußerten, hing nicht zusammen mit dem Geschlecht, dem Alter, der Ethnie, dem Versicherungsstatus, dem Krankheitsstadium oder dem Behandlungsziel. Erhöht war hingegen die Wahrscheinlichkeit für einen Wunsch bei Patienten mit einem Tumor im Kopf-Halsbereich und bei Patienten die aktuell eine Tumortherapie erhielten. Knapp 20% der Patienten, die ihrer Beziehung zum Arzt als nicht gut bewerteten, äußerten einen Wunsch, dagegen nur 8,2% der Patienten, die diese Beziehung als gut oder sehr gut empfanden.
Das Fazit dieser Studie lautet: Patienten äußern nicht häufig einen Wunsch oder eine Forderung. Wenn sie aber etwas wünschen oder fordern, bewerten das die Ärzte in den meisten Fällen als angemessen und setzen es auch um. Die wenigen als nicht angemessen bewerteten Wünsche und Forderungen setzten sie in den meisten Fällen nicht um.
In einem begleitenden Editorial bezeichnet der Onkologe Anthony Back den "fordernden Patienten", der die Gesundheitsausgaben in die Höhe treibt, als Mythos, der auf paternalistischen Sichtweisen beruhe. Vielmehr wandele sich die Arzt-Patient-Beziehung und die Ärzte seien gefordert auf die Kommunikationsbedürfnisse der heutzutage besser informierten und vorbereiteten Patienten einzugehen.
Gogineni K, Shuman KL, Chinn D, Gabler NB, Emanuel EJ: Patient demands and requests for cancer tests and treatments. JAMA Oncology 2015, 1(1):33-39.
Volltext
David Klemperer, 13.8.15
Arbeitslosigkeit und Sterblichkeit an Prostatakrebs - ein OECD-weit vielfach signifikanter Zusammenhang
 Dass Arbeitslosigkeit negative gesundheitliche Effekte und Wirkungen im ursächlichen Sinn hat, ist bereits seit mehreren Jahren und in unterschiedlichsten Ländern und Gesellschaften durch viele Studien belegt. Eine gerade veröffentlichte Studie ergänzt und vertieft diesen Zusammenhang noch in zweierlei Hinsicht: Erstens reicht ihr Untersuchungszeitraum von 1990 bis 2009 und bezieht Daten aus 30 Mitgliedsländer der OECD ein. Zweitens konzentriert sie sich auf mögliche Effekte bzw. "knock-on effects" von Arbeitslosigkeit auf die Krebsmortalität und besonders die durch Prostatakarzinome bedingte.
Dass Arbeitslosigkeit negative gesundheitliche Effekte und Wirkungen im ursächlichen Sinn hat, ist bereits seit mehreren Jahren und in unterschiedlichsten Ländern und Gesellschaften durch viele Studien belegt. Eine gerade veröffentlichte Studie ergänzt und vertieft diesen Zusammenhang noch in zweierlei Hinsicht: Erstens reicht ihr Untersuchungszeitraum von 1990 bis 2009 und bezieht Daten aus 30 Mitgliedsländer der OECD ein. Zweitens konzentriert sie sich auf mögliche Effekte bzw. "knock-on effects" von Arbeitslosigkeit auf die Krebsmortalität und besonders die durch Prostatakarzinome bedingte.
Das Ergebnis ist eindeutig:
• Der Anstieg von Arbeitslosigkeit in den OECD-Ländern um 1 Prozent ist unter rechnerischer Berücksichtigung der unterschiedlichen Bevölkerungsgröße, demografischen Strukturrn und weiteren Merkmalen der Infrastruktur mit signifikanten Anstiegen der Sterblichkeit an Prostatakrebs assoziiert.
• Dieser Effekt hält auch über mehrere Jahre an. So war die Sterblichkeit an Prostatakrebs über den gesamten Zeitraum von 5 Jahren nach einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit um 1 Prozent mit abnehmender Tendenz aber durchweg statistisch signifikant erhöht.
• Angesichts der Möglichkeit, dass so genannte Confounding-Faktoren also z.B. soziodemografische Merkmale oder Versorgungsstrukturen für die Assoziationen ursächlich sind, berücksichtigten die AutorInnen in einer weiteren Analyse insgesamt 46 mögliche Einflussfaktoren. Bei diesem "robustness check" blieb der Zusammenhang zwischen Anstieg der Arbeitslosigkeit und Prostatamortalität bei Berücksichtigung jedes einzelnen und aller 46 Faktoren signifikant.
• Schließlich führten die WissenschaftlerInnen auch noch eine so genannte "time trend analysis" durch. Sie untersuchten dafür die Häufigkeit der Prostata-Mortalität in den Jahren 2000 bis 2007, also den Jahren vor dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Rezession im Jahre 2008, leiteten daraus zu erwartende Werte in den Jahren 2008 bis 2010 ab und verglichen diese mit den tatsächlichen Werten. Mit einigen nationalen Unterschieden war die Prostatamortalität ab dem Krisenhöhepunkt auch aus dieser Perspektive signifikant erhöht.
• Neben diesen Ergebnissen ermutigt die Studie auch zu politische Initiativen gegen Arbeitslosigkeit.
Die Studie Unemployment and prostate cancer mortality in the OECD, 1990-2009. von Mahiben Maruthappuet al. ist im Mai 2015 in der Zeitschrift "E cancer medical science" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.5.15
16% oder 0,3% - Relativ oder absolut und was folgt daraus für das Screening von Lungenkrebs?
 Auch in Deutschland hat sich vor allem durch die Arbeiten des Harding Center for risk literacy am Max-Planckinstitut für Bildungsforschung in Berlin und seines Direktors Gerd Gigerenzer bei immer mehr Menschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass bei den Effekten von Interventionen und den daraus gezogenen Schlüssen für diagnostische und therapeutische Angebote sorgsam auf die Werte für relative und absolute Risikoveränderungen geachtet bzw. zwischen ihnen unterschieden werden muss.
Auch in Deutschland hat sich vor allem durch die Arbeiten des Harding Center for risk literacy am Max-Planckinstitut für Bildungsforschung in Berlin und seines Direktors Gerd Gigerenzer bei immer mehr Menschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass bei den Effekten von Interventionen und den daraus gezogenen Schlüssen für diagnostische und therapeutische Angebote sorgsam auf die Werte für relative und absolute Risikoveränderungen geachtet bzw. zwischen ihnen unterschieden werden muss.
Dass es sich dabei aber keineswegs bereits um versorgungswissenschaftliches Allgemeingut handelt, zeigt z.B. die gerade in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" geführte Debatte daüber, ob Medicare- und Medicaid-Versicherten eine Screeninguntersuchung auf Lungenkrebs mit einer niedrig dosierten Computertomographie bezahlt werden sollte oder nicht. Für diese Entscheidung sind in den USA die "Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)" zuständig.
Ein erster Autor kam nach einer Analyse der Daten des "National Lung Screening Trial" für 53.454 Personen zwischen 55 und 74 Jahren zu dem Schluss, der Nutzen des Screenings sehr größer als die Risiken z.B. durch die immer noch vorhandene Strahlenbelastung. Es gäbe "a substantial improvement in lung cancer mortality among screened patients" und mögliche unerwünschte Folgen könnten durch einen kritischen Umgang mit der Untersuchung verhindert werden. Der Durchschnittswert der Sterblichkeitsreduktion von 16% verbirgt im Übrigen erhebliche Unterschiede zwischen Männen und Frauen. Die relative Reduktion betrug bei Frauen 27% und 8% bei Männern.
In einem zweiten Beitrag kommen seine AutorInnen bereits bei der Datenanalyse zu anderen, weil differenzierteren Ergebnissen. Die dem Screening zugeschriebene relative Reduktion der Sterblichkeit an Lungenkrebs von 16% könne man nur beurteilen, wenn man auch zur Kenntnis nähme, dass die absolute Reduktion des Risikos 0,3% betrage, die Anzahl der Gestorbenen also von 21 auf 18 Tote pro 1.000 Personen gesunken ist. Auf der anderen Seite dieser gar nicht mehr so blendenden Bilanz stehen außerdem 16 an den Folgen der Vielzahl diagnostischer Verfahren (z.B. in der Folge der 10.246 Tomogramm-Analysen, 671 Bronchoskopien, 322 perkutane Biopsien, 713 Operationen) gestorbenen Personen und 228 Komplikationen, von denen 86 groß waren.
Da es die AutorInnen sowohl für unklar halten "if routine screening would result in net good or net harm" als auch ein großes Potenzial an "false-positive results, patient anxiety, radiation exposure, numerous diagnostic workups, and the complications of these workups" sehen, raten sie trotz der auch sie beschäftigenden großen Anzahl von Lungenkrebskranken zur Zurückhaltung bei der Aufnahme des CT-Screenings in den Leistungskatalog der staatlichen Krankenversicherungen.
In ihrer Schlussbemerkung weisen sie schließlich noch auf eine andere möglicherweise unerwünschte Folge der Konzentration der Leistungspolitik auf ein CT-Screening hin: "In any event, enthusiasm for low-dose CT screening should not draw attention or resources away from the priority of tobacco control."
Dass dies nicht an den Haaren herbeigezogen ist, deutet schließlich auch noch eine Herausgebernotiz an: "The decision about low-dose CT is one of the most consequential and closely watched coverage determinations that CMS has had to make in many years. … As CMS deliberates, an intensive lobbying effort is under way to influence the decision, with support from industry and various professional and advocacy organizations. In June 2014, 45 US Senators and 134 House Representatives, from both political parties, separately wrote to CMS to advocate for low-dose CT scans."
Der erste Beitrag unter dem Titel The Importance of Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography for Medicare Beneficiaries von Douglas E. Wood ist online first am 13. Oktober 2014 in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der zweite Beitrag Low-Dose Computed Tomography Screening for Lung CancerHow Strong Is the Evidence? von Steven H. Woolf et al. ist ebenfalls online first in derselben Ausgabe erschienen, und auch von ihm gibt es frei zugänglich das Abstract.
Die Editor's Note Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography for Medicare Beneficiaries von Robert Steinbrook komplettiert das Bild in derselben Zeitschrift.
Bei dieser Gelegenheit sei auch erneut auf die Rubrik der "Unstatistik des Monats" auf der Website des Harding-Centers hingewiesen, wo es sehr oft um vorsätzlich oder aus Unwissen aufgebauschte und dramatisierende Gesundheitsstatistiken geht.
Bernard Braun, 19.10.14
Risikopyramide Tabakrauchen: Aktivrauchen, Passivrauchen und nun auch noch "third hand smoke"-Rauchen
 Besonders Ex-Raucher riechen sie schon immer und leiden auch gelegentlich mehr oder weniger heftig darunter: die olfaktorischen oder auch stofflichen Rückstände von Tabakrauch in Räumen, in denen aktuell niemand raucht: das so genannte "Rauchen aus dritter Hand". Auch nachdem die gesundheitlichen Risiken des Selberrauchens und des Passivrauchens umfassend analysiert wurden, gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Räumen und in weiten Teilen der Gastronomie verfügt und durchgesetzt wurden und deren positiven gesundheitlichen Effekte in enorm kurzer Sicht nachgewiesen werden konnten (siehe dazu mehrere Beiträge im forum-gesundheitspolitik), galt der "third hand tobacco smoke" lange Zeit vor allem als hygienisches Problem oder als "Anstellerei" von Ex-Rauchern.
Besonders Ex-Raucher riechen sie schon immer und leiden auch gelegentlich mehr oder weniger heftig darunter: die olfaktorischen oder auch stofflichen Rückstände von Tabakrauch in Räumen, in denen aktuell niemand raucht: das so genannte "Rauchen aus dritter Hand". Auch nachdem die gesundheitlichen Risiken des Selberrauchens und des Passivrauchens umfassend analysiert wurden, gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Räumen und in weiten Teilen der Gastronomie verfügt und durchgesetzt wurden und deren positiven gesundheitlichen Effekte in enorm kurzer Sicht nachgewiesen werden konnten (siehe dazu mehrere Beiträge im forum-gesundheitspolitik), galt der "third hand tobacco smoke" lange Zeit vor allem als hygienisches Problem oder als "Anstellerei" von Ex-Rauchern.
Eine jetzt veröffentlichte Studie in der 2011 und 2012 die Rückstände von Tabakrauch in 46 Innenräumen (in der Stadt Tarragona) ohne zum Zeitpunkt der Messung anwesende RaucherInnen in einem technisch aufwändigen Verfahren gemessen und deren gesundheitliches Risiko bestimmt wurde, warnt vor einer Unterschätzung dieser Risiken vor allem bei Kindern.
Die Kernergebnisse der Studie sahen so aus:
• Im Staub von 77% der Raucherwohnungen fanden sich weit über den dafür geltenden Grenzwerten liegende gesundheitsschädliche Konzentrationen von rauchspezifischen, d.h. bei der Verbrennung von Tabak entstehenden Nitrosaminen.
• Diese Nitrosamine werden über die Haut aufgenommen und verursachen bei Kindern bis zu sechs Jahgren einen zusätzlichen Krebsfall pro 1.000 Personen.
• Zunächst mysteriös ist, dass solche Nitrosamine auch im Staub und auf Oberflächen in 64% aller Nichtraucherwohnungen gemessen wurden. Als eine Erklärung bietet sich die extrem schnelle und weite Verbreitung von Tabakrauch durch Luftströme an.
Angesichts der Schätzung, dass 40% der Kinder bereits durch ihre rauchenden Eltern einem "second hand"-Rauchrisiko ausgesetzt sind und ein Teil der restlichen 60% außerdem einem "third hand"-Risiko, raten die AutorInnen der Studie folgendes: "This risk should not be overlooked and ist impact should be included in future educational programs and tobacco-related public health policies".
Was dies konkret bedeuten könnte oder müsste, erörtern die AutorInnen nicht weiter. Das immer beliebter werdende "Balkonrauchen" ist allerdings weder für "second-" noch für "third hand"-Raucher eine gesunde Lösung. Eine Beobachtung der Studie lautet nämlich eindeutig so: "The strong correlation between the concentrations of nicotine that were found in the house dust from smokers' homes and the number of cigarettes smoked by the members of the household outside their homes demonstrates that tobacco smoke components are released to indoor environments by additional pathways such as off-gassing from the smokers' clothing or exhaled toxins."
Praktische Schlussfolgerungen mit dem Hinweis auf die geringe Anzahl von untersuchten Räumen, das Untersuchungsland "Spanien" oder andere, auch von den AutorInnen genannten Limitationen auf die lange Bank zu schieben, dürfte allerdings mit Sicherheit falsch sein.
Die britisch-katalanische Studie Exposure to nitrosamines in thirdhand tobacco smoke increases cancer risk in non-smokers. von Noelia Ramírez, Mustafa Z. Özel, Alastair C. Lewis, Rosa M. Marcé, Francesc Borrull und Jacqueline F. Hamilton erscheint in der Oktoberausgabe der Fachzeitschrift "Environment International" (2014; Volume 71: 139-147). Ein Abstract ist kostenlos erhältlich. Der Link könnte sich nach der Druckveröffentlichung ändern. Dann bitte mit den bibliografischen Angaben selber suchen.
Bernard Braun, 17.7.14
Bewohner sozial schlecht gestellter Landkreise in Deutschland haben höhere Krebssterberisiken als Bewohner anderer Landkreise
 Zahlreiche internationale wie nationale so genannte "small-aerea"-Studien haben gezeigt, dass Erkrankungsrisiken sowohl zwischen durchaus vergleichbaren Staaten aber auch innerhalb von Staaten ungleich verteilt sind. Weniger untersucht wurde bisher, ob die Chancen einer erfolgreichen Behandlung oder Überlebensrisiken ebenfalls regional unterschiedlich verteilt sind. Sowohl in Erkrankungsrisiko- wie Behandlungschancen-Studien spielt der mögliche Zusammenhang mit der sozialen Lage eine wichtige Rolle.
Zahlreiche internationale wie nationale so genannte "small-aerea"-Studien haben gezeigt, dass Erkrankungsrisiken sowohl zwischen durchaus vergleichbaren Staaten aber auch innerhalb von Staaten ungleich verteilt sind. Weniger untersucht wurde bisher, ob die Chancen einer erfolgreichen Behandlung oder Überlebensrisiken ebenfalls regional unterschiedlich verteilt sind. Sowohl in Erkrankungsrisiko- wie Behandlungschancen-Studien spielt der mögliche Zusammenhang mit der sozialen Lage eine wichtige Rolle.
Für Deutschland hat sich nun eine Analyse der zwischen 1997 und 2006 in 10 regionalen Krebsregistern gesammelten Daten über die Überlebenschancen der an 25 der häufigsten Krebsarten (z.B. Lungen-, Darm-, Prostata-, Brust- und Hautkrebs) erkrankten Personen beider Fragen angenommen.
Die vor allem am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) tätigen WissenschaftlerInnen konnten zeigen, dass Patienten, deren Wohn-Landkreis zum Fünftel der sozioökonomisch schwächsten Landkreise gehörte (gemessen durch Einkommen, Arbeitslosenquote, Kriminalität etc.), durchweg ein höheres Sterberisiko hatten als Mitpatienten aus allen anderen Regionen, d.h. früher starben. Dies traf bei 21 der 25 ausgewählten Krebsarten zu.
Zeitlich gestaffelt war das Sterberisiko der Krebspatienten in den 20% sozial schlechtgestelltesten Landkreisen
• nach drei Monaten um 24%,
• nach 9 Monaten um 16% und
• nach 4 Jahren immer noch um 8%
höher als in allen anderen Landkreisen.
Wie es in den restlichen 6 Bundesländern aussieht, konnten die DKFZ-WissenschaftlerInnen mangels vergleichbarer Registerdaten nicht ermitteln. An der Schlussfolgerung, diese Ungleichheiten "indicate a potential for improving cancer care and survival in Germany" ändert dies aber nichts.
Für praktische Interventionen hinderlich ist lediglich, dass die bisher vorliegenden Daten nicht erklären können, wodurch die Ungleichheit zustandekommt. So könnte entweder die medizinische Versorgung in den sozioökoomisch schwachen Landkreisen schlechter sein oder die Krankheitslast z.B. durch mehr oder schwerere Komorbidität höher sein. In Frage kommen könnte auch eine Kumulation beider Effekte.
Weitere Erklärungsfaktoren wie z.B. die Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen bzw. unterschiedliche Tumorstadien bei der Entdeckung der Krebserkrankung schließen die ForscherInnen aber bereits jetzt aus.
Der Aufsatz Socioeconomic deprivation and cancer survival in Germany: An ecological analysis in 200 districts in Germany von Lina Jansen et al. (Mitglieder der GEKID Cancer Survival Working Group ) ist am 2. Dezember 2013 online erschienen und wird im "International Journal of Cancer" erscheinen. Ein Abstract liegt kostenlos vor
Bernard Braun, 1.2.14
Risiko-Kommunikation bei einseitigem Brustkrebs überschätzt oft die Folgerisiken für die gesunde Brust und funktioniert zu wenig
 Oft wird bei jüngeren Frauen (40 Jahre und jünger) nach einer Krebserkrankung einer Brust aus Angst vor einer weiteren Erkrankung der anderen Brust und um die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen, auch die gesunde Brust komplett entfernt.
Oft wird bei jüngeren Frauen (40 Jahre und jünger) nach einer Krebserkrankung einer Brust aus Angst vor einer weiteren Erkrankung der anderen Brust und um die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen, auch die gesunde Brust komplett entfernt.
Dies und auch die Gründe für diese Entscheidung einer so genannten Mastektomie untersuchte jetzt eine Studie mit 550 Frauen diesen Alters, die in mehreren Krankenhäusern in den USA zwischen 2006 und 2010 einseitig an Brustkrebs erkrankt waren.
123 Frauen ohne eine Erkrankung der zweiten Brust gaben in einer Befragung zwei Jahre nach der Operation an, sie hätten sich auch die nicht erkrankte Brust entfernen lassen. 98% wünschten damit dem Risiko einer Zweiterkrankung zu entgehen und 94% wollten ihre Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen. Trotzdem dachten paradoxerweise nur 18%, dass Frauen, die sich die gesunde Brust nicht entfernen ließen, länger leben würden als die Frauen, die dies nicht machen ließen.
Ein wesentlicher Grund für die Amputation der gesunden Brust war die deutliche Überschätzung des Erkrankungsrisikos dieser Brust: 10% der Frauen, bei denen keines der BRCA-"Brustkrebs-Gene" nachgewiesen werden konnte, schätzten, sie hätten ein erhöhtes Risiko. Ein tatsächliches Risiko haben 2% bis 4% der primär einseitig erkrankten Frauen. Frauen mit einem BRCA-Gen schätzten ihr Risiko realistischer ein.
Ein anderer Grund ist, dass nur 51% der befragten Frauen sagten, ihre Ärzte hätten ihnen Gründe (z.B. Operationsrisiken, mögliche Alternativen) genannt, die Operation zu unterlassen und damit eine wichtige Grundlage für eine ausreichend fundierte gemeinsame Entscheidungsfindung geliefert.
Auch wenn die Autoren selber vor der Verallgemeinerung ihrer Erkenntnisse warnen, appellieren sie insbesondere an die fast 50% der Ärzte, die ihre Patientinnen unzureichend informierten, gerade bei einer so gravierenden Entscheidung wie der Entfernung einer gesunden Brust, die Patientin standardmäßig z.B. über das tatsächliche Folge-Erkrankungsrisiko und die Konsequenzen für die operative Behandlung zu informieren.
Die Studie Perceptions, Knowledge, and Satisfaction With Contralateral Prophylactic Mastectomy Among Young Women With Breast Cancer: A Cross-sectional Survey von Shoshana M. Rosenberg et al. ist in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (159[6]: 373-381) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.9.13
Über-/Fehlversorgung mit Koloskopien für knapp ein Viertel der 70-jährigen und älteren US-BürgerInnen
 23,4% der Krebs-Screeninguntersuchungen des Darmes älterer, in der staatlichen US-Krankenversicherung für RentnerInnen versicherter Personen durch eine Koloskopie, erscheinen im Lichte einer aktuellen Untersuchung der Medicare-Routinedaten von rund 75.000 TexanerInnen im Alter von 70 und mehr Jahren könnten unangemessen gewesen sein. Diese Personen wurden zwischen 2006 und 2009 jährlich mit einer vollständigen Koloskopie untersucht. Zusätzlich untersuchten die Forscher diese Art des Screenings auch in einer bundesweiten 5%-Stichprobe von Medicare-Versicherten.
23,4% der Krebs-Screeninguntersuchungen des Darmes älterer, in der staatlichen US-Krankenversicherung für RentnerInnen versicherter Personen durch eine Koloskopie, erscheinen im Lichte einer aktuellen Untersuchung der Medicare-Routinedaten von rund 75.000 TexanerInnen im Alter von 70 und mehr Jahren könnten unangemessen gewesen sein. Diese Personen wurden zwischen 2006 und 2009 jährlich mit einer vollständigen Koloskopie untersucht. Zusätzlich untersuchten die Forscher diese Art des Screenings auch in einer bundesweiten 5%-Stichprobe von Medicare-Versicherten.
Als unangemessen wurden Koloskopien bewertet, wenn sie bei den 2008-2009 untersuchten 70- bis 75-jährigen Personen ohne klare Indikation zu früh wiederholt wurde oder ihre Durchführung im klaren Gegensatz zu den altersspezifischen Leitlinien-Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaft stand. Diese spricht sich gegen das Routinescreening bei Personen zwischen 76 und 85 Jahren aus und empfiehlt für diese Altersgruppe eine Screeninguntersuchung nur dann, wenn andere Faktoren für die Notwendigkeit einer Untersuchung sprechen. Patienten über 85 Jahren sollten ausschließlich beraten werden, auf eine Koloskopie zu verzichten.
Die Untersuchungswirklichkeit sah deutlich anders aus als es die Fachgesellschaft empfiehlt:
• Hinter den insgesamt 23,4% unangemessenen Koloskopien in der Texas-Kohorte standen 9.9%, 38.8% und 24.9% unangemessene Untersuchungen der 70-75-, 76-85- und über 86-jährigen Personen.
• Die Häufigkeit der unangebrachten Koloskopien schwankte zwischen den 797 Fachärzten für Koloskopie bei mehrfacher Standardisierung der Patienten nach Alter, Geschlecht etc. zwischen 45,5% und 6,7%.
• Die Fachärzte mit überdurchschnittlich hohem Anteil unangemessener Untersuchungen waren im Vergleich mit ihren Fachkollegen mit unterdurchschnittlichem Anteil unangemessener Koloskopien eher Chirurgen, mit einem Ausbildungsende vor 1990 und mit großem Untersuchungsvolumen.
• Schließlich gab es auch bei den unangemessenen Koloskopien große regionale Unterschiede zwischen 13,3% und 34,9% in Texas und 19,5% und 30,5% in den gesamten USA.
Die Bewertung dieser Versorgungssituation als Fehlversorgung erfolgt wegen des immer vorhandenen Risikos unerwünschter Nebenwirkungen der Koloskopie (z.B. Schädigungen der Darmwand, falsch positive Ergebnisse).
Auch hier kommt man um die Textbausteine "vergleichbare Ergebnisse liegen für Bayern oder DEutschland (noch) nicht vor" oder "die deutsche Versorgungsforschung hat noch genug zu tun" leider nicht herum.
Der Aufsatz Potentially Inappropriate Screening Colonoscopy in Medicare PatientsVariation by Physician and Geographic Region von Kristin M. Sheffield et al., erschienen in der Fachzeitschrift "JAMA of Internal Medicine" (2013;(online first): 1-9) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.3.13
Wie viele Jahre müssen Darm- und Brustkrebs-Gescreente noch leben, um den Überlebensnutzen der Untersuchungen genießen zu können?
 10 Jahre müssen TeilnehmerInnen an Screeninguntersuchungen zur Früherkennung von Darm-(Teststreifen für okkultes Blut) und Brustkrebs (Mammografie) im Durchschnitt noch leben, um einen der von ihnen erwarteten oder versprochenen Nutzen, nämlich das Überleben für eine bestimmte Zeit erleben zu können.
10 Jahre müssen TeilnehmerInnen an Screeninguntersuchungen zur Früherkennung von Darm-(Teststreifen für okkultes Blut) und Brustkrebs (Mammografie) im Durchschnitt noch leben, um einen der von ihnen erwarteten oder versprochenen Nutzen, nämlich das Überleben für eine bestimmte Zeit erleben zu können.
Die Grundlage für diese Schätzung stellt erstens eine Metaanalyse der Überlebensraten in vier Darmkrebsstudien in Dänemark, Großbritannien, Schweden und den USA mit rund 31.000 bis 150.000 Teilnehmern im Alter zwischen 45 und 80 Jahren dar, in denen jährlich oder zweijährlich Tests auf okkultes Blut im Stuhl durchgeführt wurden. Zweitens lagen der Studie die Ergebnisse von fünf ebenfalls internationalen Brustkrebsscreening-Studien zugrunde, in denen rund 14.000 bis 61.000 Teilnehmerinnen im Alter von 40 bis 74 Jahren alle 12 bis 33 Monate mit einer Mammografie untersucht worden waren.
Die AutorInnen nahmen in ihrer Metaanalyse an, dass die absolute Risikoreduktion von einem krebsassoziierten Toten pro 1.000 ScreeningteilnehmerInnen ein vernünftiger Schwellenwert ist, bei dem der potenzielle Nutzen des Screenings für das Überleben die potenziellen Schädigungen oder Belastungen für die meisten Gescreenten aufwiegt. Zu den unerwünschten gesundheitlichen Folgen der beiden Screeningmethoden rechneten die WissenschaftlerInnen die Anzahl von 3 Personen pro 10.000 NutzerInnen von Teststreifen für okkultes Blut, bei denen der Befund durch eine Koloskopie validiert werden musste, die zu Darmverletzungen führte. Zu den unerwünschten Folgen der Mammografie gehört die bei einer von 1.000 mammografierten Frauen unnötigerweise durchgeführte Biopsie von Brustgewebe.
Diese Nachteile werden laut den Berechnungen dieser Metaanalyse erst nach 10 Jahren bzw. durch die erst dann erreichte Risikoreduktion oder den Gewinn beim Überleben aufgewogen.
Die wichtigste Schlussfolgerung der AutorInnen lautet: "Screening for breast and colorectal cancer should be targeted toward those patients with a life expectancy greater than 10 years".
Der Aufsatz Time lag to benefit after screening for breast and colorectal cancer: Meta-analysis of survival data from the United States, Sweden, United Kingdom, and Denmark. von Lee SJ et al. ist am 8. Januar 2013 im "British Medical Journal" (346:e8441) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.3.13
Helfen Flüssigkeitsinfusionen sterbenden (Krebs-)patienten? Sehr wenig, aber garantiert regelmäßige Besucher!
 Bei manchen wissenschaftlichen Studien ist die Frage berechtigt, ob sie wirklich notwendig oder ethisch vertretbar sind. Die "Entdeckung" der Wirkung einer weder primär noch sekundär vermuteten sozialen Bedingung rechtfertigt diese Studie aber möglicherweise doch. Es geht konkret um die randomisierte, kontrollierte und doppelblinde Untersuchung der Wirkung von parenteraler, d.h. per Infusion zugeführter Flüssigkeit auf im Sterben liegende Krebspatienten (durchschnittliche Überlebenszeit 17 Tage). Dies geschieht routinemäßig in Krankenhäusern, in Hospizen nach Darstellung der Studienautoren aber nicht. Die Evidenz für beide Behandlungsweisen ist begrenzt.
Bei manchen wissenschaftlichen Studien ist die Frage berechtigt, ob sie wirklich notwendig oder ethisch vertretbar sind. Die "Entdeckung" der Wirkung einer weder primär noch sekundär vermuteten sozialen Bedingung rechtfertigt diese Studie aber möglicherweise doch. Es geht konkret um die randomisierte, kontrollierte und doppelblinde Untersuchung der Wirkung von parenteraler, d.h. per Infusion zugeführter Flüssigkeit auf im Sterben liegende Krebspatienten (durchschnittliche Überlebenszeit 17 Tage). Dies geschieht routinemäßig in Krankenhäusern, in Hospizen nach Darstellung der Studienautoren aber nicht. Die Evidenz für beide Behandlungsweisen ist begrenzt.
In der bei 129 Krebspatienten an 6 Krankenhäusern durchgeführten Studie erhielt ein Teil der Patienten (n=63) täglich über vier Stunden verteilt einen Liter salzhaltiger Flüssigkeit per Infusion zugeführt. Die von ihrem Krankheitszustand zu Beginn der Studie vergleichbaren Patienten der Kontrollgruppe (n=66) erhielten als Placebo und für sie nicht erkennbar nur 100 Milliliter dieser Flüssigkeit infundiert.
Für alle Patienten wurde dann eine Reihe Indikatoren für Flüssigkeitsmangel (z.B. Müdigkeit, Halluzinationen), die Lebensqualität nach rund vier und sieben Tagen sowie die Überlebensdauer gemessen.
Das Ergebnis: Zu beiden Zeitpunkten gab es bei keinem der Indikatoren einen signifikanten Unterschied zwischen den Patientengruppen. Was aber nach Ansicht der Wissenschaftler den PatientInnen wirklich geholfen hat, waren die regelmäßigen Besuche der Forschungs-Pflegekräfte.
Auch wenn diese Forschergruppe jetzt bei weiteren Patientengruppen die Wirkung von Flüssigkeitszufuhr untersuchen will, spricht einiges dafür, dass regelmäßige Besuche von Pflegekräften und anderen Personen, also soziale Unterstützung, nicht nur bei sterbenden PatientInnen überhaupt einen oder zumindest einen gleichrangigen Nutzen wie medizinische Interventionen haben.
Der bereits am 19. November 2012 online und am 1. Januar 2013 auch gedruckt veröffentlichte Aufsatz Parenteral hydration in patients with advanced cancer: a multicenter, double-blind, placebo-controlled randomized trial. von Bruera E, Hui D, Dalal S, Torres-Vigil I, Trumble J, Roosth J, Krauter S, Strickland C, Unger K, Palmer JL, Allo J, Frisbee-Hume S und Tarleton K. ist im "Journal of Clinical Oncology" (2013, vol. 31 no.: 111-118) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.1.13
"Iss und stirb" oder "Iss Dich gesund" - geht es beim Essen so oder so immer um Krebs!?
 Weihnachten ist auch ein kulinarischer Höhepunkt - quantitativ und qualitativ. Diejenigen, die auch dann daran denken, welches Nahrungsmittel "ungesund" ist oder "gesund macht bzw. hält" und dann auch noch an das Risiko einer Krebserkrankung denken, sollten aber nicht jedem derartigen Hinweis auf der "Gesundheit"-Seite ihrer Tageszeitung oder in den TV-Gesundheitsratgebern uneingeschränkt trauen.
Weihnachten ist auch ein kulinarischer Höhepunkt - quantitativ und qualitativ. Diejenigen, die auch dann daran denken, welches Nahrungsmittel "ungesund" ist oder "gesund macht bzw. hält" und dann auch noch an das Risiko einer Krebserkrankung denken, sollten aber nicht jedem derartigen Hinweis auf der "Gesundheit"-Seite ihrer Tageszeitung oder in den TV-Gesundheitsratgebern uneingeschränkt trauen.
Das ist jedenfalls das Ergebnis einer methodisch wie inhaltlich beispielhaften Untersuchung zweier us-amerikanischen Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftler. Sie stellten zum einen fest, dass der mehr oder weniger dramatische negative oder auch positive Zusammenhang zwischen einer Vielzahl von Nahrungsmitteln und diversen Krebs- und zahllosen anderen Erkrankungen zu den Standardmeldungen in den Massenmedien gehören. Hinter den Meldungen dieser Art stehen dann meistens nicht näher dargestellte "Studien" einer möglichst renommierten Universität oder Firma.
Die beiden Wissenschaftler weisen zu Beginn ihrer eigenen Studie auf die wissenschaftlich geführten Debatten über die methodisch beschränkte Qualität (z.B. überwiegend Beobachtungsstudien und keine randomisiert kontrollierten Studien, keine veröffentlichten Studienprotokolle) und die inhaltlichen Verzerrungen (z.B. falsch positive Ergebnisse, selektive Veröffentlichungen mit der Tendenz, negative Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, Interpretationsfehler) der jährlich zu Tausenden publizierten ernährungsepidemiologischen Studien hin.
Sie selber wollen dann aber systematisch-zufällig untersuchen wie verlässlich der "Studien"-Boden der medialen Berichte über ernährungsassoziierte Krebsrisiken oder aber auch krebspräventive Wirkungen von Nahrungsmitteln ist. Dazu wählen sie zunächst aus dem "The Boston Cooking-School Cook Book" zufallsgesteuert 50 verbreitet beim Kochen benutzte Nahrungs- oder Inhaltsstoffe aus. Danach recherchierten sie, ob es für diese Stoffe Berichte über das Krebsrisiko fördernde oder verhindernde Wirkungen gibt.
Ihre Ergebnisse sehen so aus:
• Zu 40 Stoffen, also 80% aller ausgesuchten Nahrungsmittel, gibt es solche Berichte.
• In 264 Studien aus den Jahren 1976 bis 2011 fanden sich bei 191 (72%) Einzelbewertungen über krebsrisikoerhöhende oder -verhindernde oder -senkende Effekte. 103 Studien nannten risikoerhöhende und 88 risikosenkende Assoziationen.
• Unter allen Studien enthielten 80% Ergebnisse, die gar nicht (Irrtumswahrscheinlichkeit größer als 5%) oder nur schwach (Irrtumswahrscheinlichkeit größer als 0,1%) signifikant waren.
• Von den Studien, die explizit Schätzungen zu einem zunehmenden oder abnehmendem Krebsrisiko bei der Aufnahme des jeweiligen Nahrungsstoffs lieferten, enthielten 75% Ergebnisse, die gar keine oder lediglich eine schwache statistische Signifikanz besaßen.
• In den veröffentlichten Abstracts der Studien fanden sich beim Vergleich mit dem Gesamttext hoch-signifikant mehr signifikante als nicht signifikante Ergebnisse. Viel- und Schnellleser, also wahrscheinlich der große Teil der Journalisten, werden folglich durch die von ihnen oft bevorzugten Abstracts vorsätzlich oder fahrlässig in die Irre geführt.
• Verbreitet sind in solchen Studien auch völlig unterschiedliche Mengenangaben, deren positive oder negative Wirkung untersucht wurde und die dann unzulässigerweise miteinander verglichen wurden.
• Die 36 Metaanalysen waren insgesamt zurückhaltender: Nur 26% berichteten entweder ein zunehmendes (4 Analysen) oder ein abnehmendes Krebsrisiko (9 Analysen), das mit den jeweils näher betrachteten Nahrungsmitteln assoziiert waren. Nur 6 von diesen Metaanalysen konnten sich aber auf eine mehr als schwach signifikante Datenbasis stützen.
• Das durchschnittliche relative Risiko (RR) innerhalb des so genannten Interquartilsabstand, um das sich 50% aller Messwerte befinden, beträgt für die zahlreichen Einzelstudien, die ein zunehmendes Risiko berichten und im Vergleich mit keiner oder einer nur geringen Aufnahme des jeweiligen Nahrungsstoffes 2,20 (1,60 bis 3,44) und für Studien, die ein abnehmendes Risiko angeben 0,52 (0,39 bis 0,66). Derselbe Wert liegt bei den methodisch höherwertigen Metaanalysen im Durchschnitt bei 0,96, d.h. die Wirkungsunterschiede schrumpfen in Richtung Null.
Ein relevanter Teil der Berichterstattung über den Zusammenhang von Nahrungsmitteln, Krebsrisiken und Krebsprävention beruht also auf "Studien"-Ergebnissen, die rein zufällig sein können. Sie präsentiert oft Wirkungsstärken einzelner Studien, die inplausibel überschätzt sind und dies selbst dann, wenn die Evidenz für solche Effekte schwach ist.
Die Studie "Is everything we eat associated with cancer? A systematic cookbook review" von Jonathan D Schoenfeld und John PA Ioannidis ist am 28. November 2012 vorab vor dem Druck im "American Journal of Clinical Nutrition (AJCN)" online veröffentlicht worden und komplett kostenlos erhältlich. Für Vielleser gibt es auch das Abstract kostenlos. Nach den Funden der beiden Autoren ist aber auch hier der Blick in den kompletten Text empfehlenswert.
Zusätzlich lesenswert ist der ebenfalls vor Drucklegung am 5.12.2012 vorab veröffentlichte und kostenlos erhältliche Kommentar "Nutritional epidemiology in practice: learning from data or promulgating beliefs? von Michelle M Bohan Brown, Andrew W Brown und David B Allison in derselben Zeitschrift.
Bernard Braun, 26.12.12
Lungenkrebs und Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium: Illusionen über Heilung bei der Mehrzahl der Patienten
 Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung überschätzen häufig ihre Lebenserwartung. Eine jetzt im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ging der Frage nach, wie groß der Anteil derjenigen Patienten mit metastasierter Krebserkrankung ist, die sich von der Chemotherapie eine Heilung erhoffen - ein Ziel das leider weitgehend unrealistisch ist.
Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung überschätzen häufig ihre Lebenserwartung. Eine jetzt im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ging der Frage nach, wie groß der Anteil derjenigen Patienten mit metastasierter Krebserkrankung ist, die sich von der Chemotherapie eine Heilung erhoffen - ein Ziel das leider weitgehend unrealistisch ist.
Dafür wurden 1.193 Teilnehmer einer Kohortenstudie befragt, bei denen vor mindestens 4 Monaten die Diagnose eines fortgeschrittenen (Stadium 4) Karzinoms der Lunge (710 Patienten) oder des Dickdarms (483 Patienten) gestellt worden war.
Befragt wurden nur diejenigen, die sich für eine Chemotherapie entschieden hatten. Die Befragung wurde telefonisch von professionellen Interviewern durchgeführt.
Die entsprechende Frage lautete:
"Nachdem Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Chemotherapie ihnen hilft länger zu leben, ihren Krebs zu heilen oder ihnen hilft bei den Problemen, die der Krebs verursacht?" Die Antwortmöglichkeiten lauteten sehr / etwas / wenig / überhaupt nicht wahrscheinlich bzw. "ich weiß nicht".
Das Ergebnis lautet: 69% der Befragten mit Lungenkrebs und 81% der Patienten mit Darmkrebs erkennen nicht, dass eine Heilung durch Chemotherapie sehr unwahrscheinlich ist. Diese falsche Auffassung war überdurchschnittlich weit verbreitet unter Patienten mit hispanischem und asiatischem Hintergrund sowie unter Schwarzen. Einkommen und Bildung spielten keine Rolle. 20 bis 30% gaben zutreffen an, dass eine Heilung sehr unwahrscheinlich sei.
Patienten mit unrealistischer Erwartung schätzten die Kommunikation des Arztes besser ein als Patienten mit realistischen Erwartungen. Hier wird möglicherweise der realistisch informierende Arzt als Überbringer der schlechten Botschaft abgestraft.
Die Autoren äußern sich besorgt darüber, dass die Kriterien für die informierte Einwilligung nicht erfüllt sind, wenn Patienten falsche Vorstellungen vom Therapieziel haben. Aus früheren Studien sei bekannt, dass Patienten für eine Heilungschance von nur 1% eine stark belastende Therapie auf sich nehmen, nicht aber für einen alleinigen Gewinn an Lebenszeit.
Diese Studie verdeutlicht ein mal mehr, dass jeder Patient die Möglichkeit erhalten muss, eine Entscheidung auf Grundlage von Evidenz zu Behandlungseffekten zu treffen, die ihm wichtig sind.
Weeks JC, Catalano PJ, Cronin A, Finkelman MD, Mack JW, Keating NL, et al. Patients' Expectations about Effects of Chemotherapy for Advanced Cancer. New England Journal of Medicine 2012;367(17):1616-25. Abstract
s.a. Rubrik Shared Decision Making
David Klemperer, 25.10.12
Weniger operieren bei lokal begrenztem Prostatakarzinom
 Auf einen unnötigen Test folgt vielfach eine unnötige Operation. Die verläuft zwar meistens gut, allerdings bekommen die Patienten nicht selten hinterher Potenzprobleme oder werden harninkontinent. Das ist die Quintessenz einer im Juli 2012 in der renommierten Medizinerzeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie aus den USA. Der Artikel amerikanischer Urologen der Prostate Cancer Intervention versus Observation Trial (PIVOT) Study Group sollte und könnte dazu beitragen, betroffene Männern vor unnötigen Komplikationen und Einschränkungen der Lebensqualität zu bewahren.
Auf einen unnötigen Test folgt vielfach eine unnötige Operation. Die verläuft zwar meistens gut, allerdings bekommen die Patienten nicht selten hinterher Potenzprobleme oder werden harninkontinent. Das ist die Quintessenz einer im Juli 2012 in der renommierten Medizinerzeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie aus den USA. Der Artikel amerikanischer Urologen der Prostate Cancer Intervention versus Observation Trial (PIVOT) Study Group sollte und könnte dazu beitragen, betroffene Männern vor unnötigen Komplikationen und Einschränkungen der Lebensqualität zu bewahren.
Für ihre Studie Radical Prostatectomy versus Observation for Localized Prostate Cancer haben die Urologen 731 Männer untersucht, die an einem auf die Vorsteherdrüse begrenzten Krebs litten. Nach dem Zufallsprinzip wurde bei der Hälfte die komplette Prostata entfernt, während bei der anderen Hälfte der weitere Krankheitsverlauf ohne Therapie begleitet wurde. Nach einer Beobachtungsdauer von bis zu 15 Jahren ließ sich kein Vorteil für operierte Männer erkennen: Weder starben mehr Männer in der Gruppe, die nicht unters Messer kam, aus anderen Gründen, noch gab es ohne Behandlung mehr Todesfälle durch den Prostatakrebs.
Wer an dem begrenzten Tumor leidet, lebt ohne Behandlung genauso lange. "Viele Männer bekommen Angst, wenn sie die Diagnose Prostata-Krebs hören", sagt Erstautor Wilt, der an der Minnesota School of Medicine in Minneapolis tätig ist. "Sie denken, dass sie an dem Tumor sterben, wenn sie nicht therapiert werden. Unsere Daten zeigen jedoch eindeutig, dass dies nicht stimmt. Die überwältigende Mehrheit wird nicht an der Krankheit sterben, wenn sie unbehandelt bleibt."
Im aktuellen Studienbericht zeigen die ÄrztInnen um Timothy Wilt, dass die chirurgische Entfernung der Prostata bei lokalem Krebs kein Leben rettet (Bd. 367, S. 203, 2012) und Urologen künftig größere Zurückhaltung bei der Indikationsstellung zur operativen Prostata-Entfernung an den Tag legen. Die Studie zeigt nämlich, dass die moderne Medizin heute eine Vielzahl von Prostata-Tumoren diagnostiziert, die überhaupt nicht gefährlich sind. Denn leiden mehr als zwei Drittel aller Männer mit der Diagnose Prostata-Krebs an einer wenig aggressiven Frühform, die auf die Vorsteherdüse begrenzt ist. Die anfängliche Diagnosestellung beruht in den meisten auf dem höchst umstrittenen Bluttest auf prostataspezifisches Antigen (PSA).
Der PSA-Test ist ungenau und entdeckt zum einen viele Tumore, welche den betroffenen Männern nie ernsthafte gesundheitliche Probleme beschert hätten. Deshalb sprechen sich Fachorganisationen wie die US Preventive Services Task Force immer wieder gegen ungezieltes Screening aus. So hatte diese Behörde bereits 2008 in den Annals of Internal Medicine eine skeptische Einschätzung zum PSA-Screening abgegeben und dabei auf die Benefits and Harms of Prostate-Specific Antigen Screening for Prostate Cancer: An Evidence Update for the U.S. Preventive Services Task Force verwiesen. Die in dem ArtikelScreening for Prostata Carcinoma-US Preventive Service Task Force Recommendation Statement dargelegten Empfehlungen fassen die AutorInnen so zusammen: "No good-quality randomized, controlled trials of screening for prostate cancer have been completed. In 1 crosssectional and 2 prospective cohort studies of fair to good quality, false-positive PSA screening results caused psychological adverse effects for up to 1 year after the test. The natural history of PSA-detected prostate cancer is poorly understood." So ist es auch nicht überraschend, das die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland die PSA-Bestimmung im Rahmen bloßen Screenings nicht als Leistung anerkennt; folglich bieten die UrologInnen den PSA-Test als IGeL Individuelle Gesundheits-Leistung an und kassieren dafür zwischen 15 und 30 Euro zuzüglich der Kosten für die Blutentnahme.
Die AutorInnen der nun im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie untersuchten 731 Männer mit lokal begrenztem Protata-Karzinom über insgesamt sechs Jahre, die sie nach dem Zufallsprinzip operieren oder nur beobachten ließen. In diesem Beobachtungszeitraum starben nur 7,1 Prozent der mit Krebs diagnostizierten Männer an dem Tumor. Dabei ließ sich kein statistisch relevanter Unterschied zwischen der operierten und der nicht behandelten Gruppe erkennen. Lediglich bei Vorliegen eines wenig differenzierten und daher aggressiveren Malignoms oder bei einem deutlich erhöhten PSA-Wert oberhalb von 10 Nanogramm pro Milliliter bot die Operation Vorteile.
Allerdings ist vor einer Überinterpretation dieser Studienergebnisse zu warnen. Zwar verleitet die US-Studie auf den ersten Blick zu großer Skepsis gegenüber der operativen Entfernung der Vorsteherdrüse bei Vorliegen lokalisierter bösartiger Tumore. Allerdings ist der Beobachtungszeitraum von gut sechs Jahren zu kurz, um generell Entwarnung zu geben. Gerade im höheren Lebensalter entwickeln sich Karzinome eher langsam. Außerdem besteht immer ein gewisses Risiko, das aus einem anfänglich ungefährlichen Tumor bei einem mittelalten Mann Jahre später ein aggressiver Krebs entstehen kann. Außerdem empfinden viele Betroffene selber ein vermeintlich harmloses Prostata-Karzinom als Zeitbombe und entscheiden sich für eine Operation. Fraglos aber stärkt das Studienergebnis aus den USA all jene, die sich in Anbetracht der Gefahr, nach der Operation impotent zu sein - das betrifft bis zu 30 Prozent - oder sogar an Inkontinenz zu leiden - immerhin bei jedem zwanzigsten operierten Mann - eher für abwartende Beobachtung bzw. das medizinisch begleitete "Zuwarten" entscheiden.
Die Studie von Timothy Wilt und Kollegen können Sie hier herunterladen; in vollem Umfang steht der Studienbericht nur AbonentInnen zur Verfügung, für alle anderen ein kommentiertes Abstract.
Zeitlich passend legte die Barmer GEK am 24. Juli ihren Krankenhausbericht 2012 vor, der sich schwerpunktmäßig demselben Thema widmet. Nach Auswertungen der eigenen Daten kommt die Barmer-GEK zu der Einschätzung, dass im Jahr 2011 bundesweit an deutschen Krankenhäusern rund 31.000 offene radikale Prostatektomien, 10.000 minimalinvasive Operationen, 3.000 mit Brachytherapien, 2.000 Chemotherapien und 1.600 perkutane Bestrahlungen erfolgten, was Gesamtkosten von rund 364 Millionen Euro verursachte. Die durchschnittlichen stationären Pro Kopf Behandlungskosten lagen im vergangenen Jahr bei etwa 5.900 Euro, wobei sich hier die auch bei anderen Krankheiten bekannte Altersabhängigkeit bestätigte: Während die Krankenhausbehandlung bei jüngeren Patienten regelmäßig über 6.000 Euro kostete, schlug sie bei Patienten jenseits der 80 mit rund 4.000 Euro zu Buche.
Prostatakrebs ist für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sehr relevant, da er für etwa jeden zehnten krebsbedingten Sterbefall bei Männern verantwortlich ist. Häufigste Behandlungsmethode im Krankenhaus ist die "radikale Prostatektomie", die komplette operative Entfernung der Vorsteherdrüse. Das führt allerdings beim Gros der Patienten zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität: 70 Prozent klagen über Erektionsprobleme, 53 Prozent über sexuelles Desinteresse und rund 16 Prozent über Harninkontinenz. Rund ein Fünftel der operierten Patienten erleidet operationsbedingte Komplikationen wie Blutungen oder Darmverletzungen. Entsprechend durchwachsen sind die Zufriedenheitswerte: 52 Prozent der Befragten sind mit dem Behandlungsergebnis uneingeschränkt zufrieden, 41 Prozent eingeschränkt, 7 Prozent unzufrieden. Das sind schlechtere Ergebnisse als nach Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks (63 Prozent uneingeschränkte Zufriedenheit).
Diese und viele andere Informationen und statistische Daten enthält der diesjährige Krankenhausreport der Barmer-GEK. Für Interessierte stellt die Ersatzkasse kostenlos den Barmer-GEK Report Krankenhaus 2012 zum Download bereit. Ebenso sind eine überaus praktische Infografik- und Faktensammlung sowie eine Broschüre mit Behandlungsstrategien bei Prostatakarzinom auf der Internet-Seite verfügbar.
Jens Holst, 25.7.12
PSA-Massenscreening "nein danke" oder allenfalls noch individualisierte Suche nach Prostatakarzinom-Prädiktor!?
 Die seit einiger Zeit insbesondere in den USA intensiv geführte Debatte über den Nutzen und den Schaden, den das PSA-basierte Screening für Prostatakrebs anrichten kann, das Männern ab einem bestimmten Alter angeboten wird, geht in die nächste praktisch folgenreiche Runde. (vgl. dazu den Beitrag im Forum-Gesundheitspolitik und die dortigen Verweise auf Studien, welche die Empfehlung untermauern sollen).
Die seit einiger Zeit insbesondere in den USA intensiv geführte Debatte über den Nutzen und den Schaden, den das PSA-basierte Screening für Prostatakrebs anrichten kann, das Männern ab einem bestimmten Alter angeboten wird, geht in die nächste praktisch folgenreiche Runde. (vgl. dazu den Beitrag im Forum-Gesundheitspolitik und die dortigen Verweise auf Studien, welche die Empfehlung untermauern sollen).
Ausgangspunkt ist die Empfehlung der U.S. Preventive Services Task Force von einem Screeningangebot für Männer aller Altersgruppen abzusehen. Damit ist eine erste im Oktober 2011 zur Diskussion gestellte und auch heftige umstrittene vorläufige Empfehlung offiziell geworden. Medicare-Krankenversicherte und Versicherte einer Reihe weiterer privater Versicherungen erhalten damit die Kosten für PSA-Tests zur Früherkennung nicht mehr erstattet.
Die Empfehlung kulminiert in einer für alle medizinischen Interventionen leitenden Abwägung des Nutzens und des Schadens. Ihr vollständiger Wortlaut: "The reduction in prostate cancer mortality 10 to 14 years after PSA-based screening is, at most, very small, even for men in the optimal age range of 55 to 69 years. The harms of screening include pain, fever, bleeding, infection, and transient urinary difficulties associated with prostate biopsy, psychological harm of false-positive test results, and overdiagnosis. Harms of treatment include erectile dysfunction, urinary incontinence, bowel dysfunction, and a small risk for premature death. Because of the current inability to reliably distinguish tumors that will remain indolent from those destined to be lethal, many men are being subjected to the harms of treatment for prostate cancer that will never become symptomatic. The benefits of PSA-based screening for prostate cancer do not outweigh the harms."
In derselben Ausgabe sind außerdem ein zustimmender und ein ablehnender Kommentar veröffentlicht. Der Kernsatz der Zustimmung lautet: ""The harms are well-proven, whereas the evidence of benefit is weak. Even if one accepts that true benefits exist, the documented harms are likely greater than those small benefits. Despite this, some will continue to forcefully advocate advocate PSA-based screening because of a blind faith in early detection. We need to practice medicine on the basis of evidence and not on the basis of faith."
Eine Gruppe von Urologen kritisiert die Empfehlung u.a. deswegen, weil an der Erstellung der Leitlinienempfehlung zu wenig Urologen und Krebsspezialisten beteiligt gewesen wären und auch Studien mit 10 Jahre Dauer zu kurz wären, um die erwünschten und unerwünschten Effekte eines Screenings verlässlich messen zu können. Nach dem Hinweis, die Empfehlung gefährde möglicherweise Leben, empfehlen sie folgendes: "At this point, we suggest that physicians review the evidence, follow the continuing dialogue closely, and individualize prostate cancer screening decisions on the basis of informed patient preferences."
Schon damit wird klar, dass die Debatte in den USA nicht zu Ende ist. Dort, aber vor allem auch in Deutschland, ist daher die weitere Verbreitung der Forschungsergebnisse über Nutzen und Schaden von PSA-Messungen, die öffentliche Abwägung durch Ärzte und Patienten sowie auch weitere Forschung notwendig.
Alle zitierten Beiträge sind am 15. Mai 2012 in der Fachzeitschrift "Annals of internal medicine" (2012, 156 (10)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz "Clinical Guidelines. Screening for Prostate Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement" stammt von Virginia A. Moyer und der U.S. Preventive Services Task Force.
Der zustimmende Kommentar "In the Balance. Prostate Cancer Screening: What We Know, Don't Know, and Believe" stammt von Otis W. Brawley.
Der kritische und ablehnende Beitrag "In the Balance. What the U.S. Preventive Services Task Force Missed in Its Prostate Cancer Screening Recommendation" stammt von einer Gruppe von 9 Urologen um William J. Catalona.
Bernard Braun, 7.6.12
Zu viel Medizin, zu wenig Palliativ-Versorgung am Ende des Lebens
 Die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung in den letzten 6 Monaten ihres Lebens untersuchten Wissenschaftler unter Leitung von Nancy Morden vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice. Für die Studie wurden die Daten von 215.311 Medicare-Versicherten ausgewertet, die in den Jahren 2004 bis 2007 an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung verstorben sind. Die häufigsten Diagnosen lauteten Lungenkrebs (31% der Patienten), Blutkrebs (9,2%), Darmkrebs (8,5%) und Bauchspeicheldrüsenkrebs (6,2%).
Die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung in den letzten 6 Monaten ihres Lebens untersuchten Wissenschaftler unter Leitung von Nancy Morden vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice. Für die Studie wurden die Daten von 215.311 Medicare-Versicherten ausgewertet, die in den Jahren 2004 bis 2007 an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung verstorben sind. Die häufigsten Diagnosen lauteten Lungenkrebs (31% der Patienten), Blutkrebs (9,2%), Darmkrebs (8,5%) und Bauchspeicheldrüsenkrebs (6,2%).
Als Indikatoren für die Versorgungsqualität gelten laut National Quality Forum (Link) u.a. der jeweilige Anteil der Patienten:
• der in den letzten 30 Tagen des Lebens auf die Intensivstation aufgenommen wurde
• der Chemotherapie in den letzten 2 Wochen des Lebens
• der im Krankenhaus verstirbt
• mit Palliativversorgung für weniger als 3 Tage
• ohne Palliativversorgung
Untersucht wurde, ob sich Krankenhäuser unterschiedlicher Ausrichtung in insgesamt 11 Indikatoren der Versorgungsqualität unterscheiden. Dafür wurde die Krankenhäuser folgendermaßen gruppiert: kommunale Krankenhäuser, Universitätskliniken, for-profit- und nonprofit-Kliniken sowie Kliniken mit zertifizierten Abteilungen für Krebserkrankte.
Im Ergebnis zeigt sich, dass in keiner der Krankenhausarten die Patienten mit einer sehr guten Versorgung rechnen können.
Die Unterschiede zwischen den Krankenhausarten waren eher gering:
• Die Anzahl der in den letzten 4 Wochen im Krankenhaus verbrachten Tage lag zwischen 5,3 und 5,9.
• Chemotherapie in den letzten 2 Wochen ihres Lebens erhielten zwischen 5,3 und 6,3% der Patienten.
• Potentiell lebensverlängernde Maßnahmen wurden im letzten Lebensmonat an 8,9 bis 12,6% der Patienten durchgeführt.
• Palliativversorgung im letzten Lebensmonat erhielten zwischen 50,3 und 54,2% der Patienten.
• Der Beginn der Palliativversorgung erfolgte (zu) spät, also innerhalb der letzten 3 Lebenstage, bei 7,1 bis 8,6% der Patienten
Deutlicher waren hingegen die Unterschiede innerhalb der Krankenhausarten - die Raten für die genannten Indikatoren unterschieden sich durchgehend um einen Faktor von mehr als 2.
Die Autoren schließen aus den Ergebnissen, dass Patienten mit Krebs im Endstadium häufig aggressive Therapien erhalten. Für Chemotherapie in den letzten 2 Wochen des Lebens gilt beispielsweise, dass sie die Lebenserwartung verkürzt und nicht etwas - wie erhofft - verlängert.
Die großen Versorgungsunterschiede innerhalb der Krankenhausarten wirft die Frage nach der Ursache für diese Unterschiede auf. Die Wünsche und Präferenzen der Patienten sind es jedenfalls nicht, wie frühere Studien ergeben haben. Die Mehrheit der Patienten lege höheren Wert auf Lebensqualität und möchte lieber zu Hause als im Krankenhaus sterben. So sind die Ursachen eher auf Seiten der Anbieter zu finden. Notwendig sei insbesondere, dass in allen Krankenhäusern die Wünsche und Präferenzen der Patienten und ihrer Angehörigen besser erfasst und umgesetzt werden.
Morden NE, Chang C-H, Jacobson JO, Berke EM, Bynum JPW, Murray KM, et al. End-Of-Life Care For Medicare Beneficiaries With Cancer Is Highly Intensive Overall And Varies Widely. Health Affairs 2012;31(4):786-96 Abstract
Pressemitteilung des Dartmouth Institute Download
David Klemperer, 19.4.12
PSA-Screening senkt auch nach 13 Jahren Beobachtungszeit nicht das Risiko an Prostatakrebs zu sterben
 Was seit Jahren in vielen Untersuchungen mit kürzerer Laufzeit erkannt wurde, bestätigt auch die bislang am längsten, nämlich im Berichtsjahr 2009 13 Jahre laufende so genannte PLCO-Studie (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial) mit 76 .685 Teilnehmern aus 10 Screeningzentren im Alter von 55 bis 74 Jahren. Diese Teilnehmer wurden zufällig einer Gruppe zugewiesen, die 6 Jahre (bis zum Jahr 2006) regelmäßig an einem PSA-Screeningtest (PSA= prostataspezifisches Antigen) plus einer vierjährigen rektalen Untersuchung der Prostata teilnahm und einer Gruppe mit traditioneller Behandlung zu der von Fall zu Fall auch ein PSA-Test gehören konnte.
Was seit Jahren in vielen Untersuchungen mit kürzerer Laufzeit erkannt wurde, bestätigt auch die bislang am längsten, nämlich im Berichtsjahr 2009 13 Jahre laufende so genannte PLCO-Studie (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial) mit 76 .685 Teilnehmern aus 10 Screeningzentren im Alter von 55 bis 74 Jahren. Diese Teilnehmer wurden zufällig einer Gruppe zugewiesen, die 6 Jahre (bis zum Jahr 2006) regelmäßig an einem PSA-Screeningtest (PSA= prostataspezifisches Antigen) plus einer vierjährigen rektalen Untersuchung der Prostata teilnahm und einer Gruppe mit traditioneller Behandlung zu der von Fall zu Fall auch ein PSA-Test gehören konnte.
Das Ergebnis lautete:
• Die Inzidenz von Prostatakrebs war zwar in der Gruppe, die 6 Jahre an PSA-Screeningtests teilnahm, signifikant höher (108,4 gegenüber 97,1 Fälle pro 10.000 Personenjahre).
• An der Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer der Studie an Prostatakrebs verstarben, änderte die Teilnahme am Screeningtest nichts. Die kumulative Sterblichkeitsrate für Prostatakrebs betrug 3,7 Fälle pro 10.000 Personenjahre in der Screeninggruppe und 3,4 Fälle in der Gruppe mit Standardbehandlung. Der Unterschied war statistisch nicht signifikant (RR=1,09 mit einem Konfidenzintervall von 0,87 bis1,36).
Die Schlussfolgerung der Forschergruppe lautete daher: "There is no evidence of a benefit [from screening]. Indeed, there is evidence of harms, in part associated with the false-positive tests, but also with the overdiagnosis inseparable from PSA screening, especially in older men".
Nachdem die Forschergruppe bei der Vorlage ähnlicher Ergebnisse nach 10 Jahren Laufzeit kritisiert wurde, die Zeit sei zu kurz für verlässliche Ergebnisse, beabsichtigt sie auch nach 13 Jahren noch die Studie fortzusetzen und nach 15 Jahren Laufzeit erneut Daten zu veröffentlichen.
Der Aufsatz enthält neben den eigenen Ergebnissen die meistenteils übereinstimmenden Resultate zahlreicher anderer Studien und Metaanalysen und verschafft daher einen guten Überblick zur insgesamt screeningskeptischen Forschungslandschaft im Bereich PSA-Test und Prostatakrebs.
Der Aufsatz "Prostate Cancer Screening in the Randomized Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial: Mortality Results after 13 Years of Follow-up" von Gerald L. Andriole et al. ist in der Onlineausgabe der Krebsfachzeitschrift "Journal of the National Cancer Institute" vom 6. Januar 2012 erschienen. Kostenlos ist lediglich das umfangreiche Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 10.1.12
Avastin: Zulassungsverlust in den USA wegen Unwirksamkeit und Nebenwirkungen?! "Geld-zurück"-Vermarktungsstrategie in Deutschland!
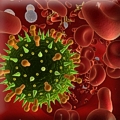 Die Verordnung des unter dem Markennamen Avastin seit einigen Jahren u.a. zur Behandlung eines bestimmten Brustkrebstyps (Her2-negativ-Typ mit Metastasen) eingesetzten Antikörpers Bevacizumab ist wegen empirisch bestätigtet erheblicher Zweifel an seiner Wirksamkeit und seinen zahlreichen schweren Nebenwirkungen in den USA spätestens seit Sommer 2010 massiv in die fachwissenschaftliche Kritik geraten. Die Kritik reicht so weit, dass seit Ende 2010 eine Expertengruppe der für die Zulassung von Arzneimittel in den USA zuständigen "Food and Drug Administration (FDA)" beraten hat, ob diese Zulassung nicht zurück genommen werden sollte. Im Juni 2011 haben die Experten der FDA in einer offenen Abstimmung einstimmig (6:0) empfohlen, diesen Schritt zu tun. Die Zulassung zur Behandlung anderer schwerer Krebserkrankungen wie Lungen-, Nieren- und Hirntumoren war davon nicht betroffen. Trotz dieses eindeutigen Votums und der ihm zugrunde liegenden Fakten, hat sich die FDA bisher (Ende Oktober 2011) nicht zu diesem Schritt entschieden.
Die Verordnung des unter dem Markennamen Avastin seit einigen Jahren u.a. zur Behandlung eines bestimmten Brustkrebstyps (Her2-negativ-Typ mit Metastasen) eingesetzten Antikörpers Bevacizumab ist wegen empirisch bestätigtet erheblicher Zweifel an seiner Wirksamkeit und seinen zahlreichen schweren Nebenwirkungen in den USA spätestens seit Sommer 2010 massiv in die fachwissenschaftliche Kritik geraten. Die Kritik reicht so weit, dass seit Ende 2010 eine Expertengruppe der für die Zulassung von Arzneimittel in den USA zuständigen "Food and Drug Administration (FDA)" beraten hat, ob diese Zulassung nicht zurück genommen werden sollte. Im Juni 2011 haben die Experten der FDA in einer offenen Abstimmung einstimmig (6:0) empfohlen, diesen Schritt zu tun. Die Zulassung zur Behandlung anderer schwerer Krebserkrankungen wie Lungen-, Nieren- und Hirntumoren war davon nicht betroffen. Trotz dieses eindeutigen Votums und der ihm zugrunde liegenden Fakten, hat sich die FDA bisher (Ende Oktober 2011) nicht zu diesem Schritt entschieden.
Die Umstände vor und nach der Entscheidung sind ein Lehrstück über die Schwierigkeiten, rationale und patientenorientierte Erkenntnisse gegen die mit der Behandlung einer der häufigsten Krebserkrankungen von Frauen verbundenen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Deutlich wird dabei auch, dass Herstellerfirmen, wirtschaftlich abhängige Wissenschaftler, einige Patienten, die sich erfolgreich behandelt fühlten (so genannte "super-responders") und möglicherweise auch wirtschaftlich interessierte Leistungserbringer eigentlich vor nichts zurück schrecken, um am Markt zu bleiben und dabei grundsätzlich "die Patienten" aus dem Sinn verlieren.
Dies zeigt u.E. die folgende unvollständige Übersicht wichtiger Etappen der Ver- und Entmarktung von Avastin und des Einfallsreichtums der Herstellerfirma Roche:
• Avastin wurde in den USA 2008 zur Behandlung des o.g. Brustkrebstyps aufgrund des Ergebnisses einer einzi-gen Studie der Herstellerfirma Genentech im Schnellverfahren zugelassen. In dieser Studie versprach das allein eingesetzte Mittel gegenüber dem alleinigen Einsatz eines anderen Mittels (Paclitaxel/Taxol) eine um 5,5 Monate längere progressions-freie Überlebenszeit als (11,3 Monate versus 5,8 Monate). Die beiden Mittel wurden auch gemeinsam verordnet und hatten Wirkungen auf beim Brustkrebs gezeigt. Die FDA verband diese Zulassung mit der Hersteller-Auflage, die Wirksamkeit und die Sicherheit/Nebenwirkungsfreiheit von Avastin durch weitere Studien zu untermauern. Dem folgte Genentech weitgehend nicht, und auch die Herstellerstudien AVADO und RIBBON-1 versagten aus Sicht aller FDA-Gutachter beim Versuch doch noch einen Nutzen für Avastin zu belegen. Andere Studien zeigten allerdings auch, dass der Nutzen höchstens durchschnittlich 0,8 Monate betrug und diese gewonnene progressionsfreie Überlebenszeit noch durch schwere, behandlungsbedürftige Nebenwirkungen, wie beispielsweise innere Blutungen und Magengeschwüre belastet wurde. Ob sich diese Art der Überlebenszeit aber auch auf die gesamte Überlebenschance der Erkrankten auswirkt war und ist ungeklärt. Der am 4. Oktober 2011 in den "Annals of Oncology 2011" veröffentlichte systematische Review samt Meta-Analyse der Ergebnisse von 5 RCTs "Adverse events risk associated with bevacizumab addition to breast cancer chemotherapy: a meta-analysis" von Cortes et al. belegt für vier unerwünschte Wirkungen ein vielfach erhöhtes Risiko (odds ratio): Das Risiko einer Proteinurie, d.h. einer übermäßigen Konzentration von Eiweiß im Urin, war unter einer Avastinbehandlung um das 27-Fache erhöht, das eines zu hohen Blutdrucks um das 3-Fache, das einer Fehlfunktion der linken Herzkammer um mehr als das Doppelte und das von diversen Blutungen um das 4-Fache. Dem während des FDA-Entscheidungsprozesses von behandelnden Onkologen bemühten Argument, die Nebenwirkungen seien deshalb hinzunehmen, weil die "disease is so terrible" konnten die Gutachter nichts abgewinnen, weil dies nur erwägenswert wäre, wenn das Medikament überhaupt etwas Positives schaffe. Die meisten hier geschilderten Ereignisse und noch ein paar mehr Hintergründe können in dem längeren Beitrag von Emily Walker "FDA Panel votes to yank Avastin's breast cancer indication" auf der Website "Medpage today" vom 29. Juni 2011 nachgelesen werden. Hier könnte u.U. eine kurze Anmeldung als LeserIn notwendig sein, die aber nach den Erfahrungen des Autors nicht zu Spam- oder Werbefluten führt.
• Der Empfehlung der Gutachter folgt eine Flut von Reaktionen und Ereignissen, deren Hintergründe sicherlich noch Gegenstand weiterer kritischer Nachforschungen sein werden. Einige, insbesondere private Krankenversicherunternehmen bezahlten selbst ohne eine endgültige Entscheidung der FDA ihren Versicherten die monatlich 8.000 US-Dollar kostende Behandlung nicht mehr. Die staatlichen Versicherungen Medicare und Medicaid bezahlen die Leistung weiter und kündigen auch an sie trotz einer möglichen Entscheidung der FDA gegen Avastin weiter zu bezahlen. Zahlreiche Onkologen und ihre Fachverbände erklärten außerdem, sie würden Avastin, wenn es weiter für die Behandlung der anderen Krebserkrankungen zugelassen bliebe, weiter und dann eben "off-label" zur Behandlung von Brustkrebspatienten verschreiben.
Dass dies keine spontanen Einzelmeinungen waren, zeigt eine von September bis November 2010 durchgeführte Mailbefragung von 3.000 Ex-TeilnehmerInnen eines Krebskongresses in Dubai. Von den 564 Antwortenden, also einer wahrscheinlich nicht repräsentativen Gruppe von praktizierenden Onkologen, vertrat die Mehreheit die Meinung, bei den FDA-Überlegungen ginge es vor allem um Kostenersparnis und außerdem würde damit die Entwicklung künftiger Medikamente gegen Brustkrebs be- oder verhindert. 46,5% der Befragten betrachteten die Verordnung von Avastin bei Personen, die an einem Her2-3x-negativen Brustkrebs erkrankt sind, als nützlich. 44,7% sagten, sie würden das Antikörperpräparat bei diesem Brustkrebstyp trotz aller FDA-Argumente mit Vorrang ("first line") weiter verordnen. 52% sagten schließlich, sie würden Avastin in der Regel zusammen mit Taxol als Therapeutikum einsetzen. Zu erwarten ist also, dass sehr viele Ärzte bei einer Streichung des Anwendungsgebiets Brustkrebs weiterhin "off-label" (Verordnung eines nicht zur Behandlung einer bestimmten Krankheit zugelassenen Medikaments) Avastin verordnen. Der Aufsatz "The use of bevacizumab among women with metastatic breast cancer: A survey on clinical practice and the ongoing controversy" von Dawood u.a. ist gerade online in der Fachzeitschrift "Cancer" erschienen und enthält neben weiteren Einzelheiten zur Entwicklungs- und Zulassungsgeschichte des Antikörpers differenziertere Ergebnisse der Befragung. Kostenlos ist nur das Abstract erhältlich.
• Auf dem 2011-"European Multidisciplinary Cancer Congress" in Stockholm hob eine deutsche Forschergruppe hervor, dass eine Subgruppenanalyse von Daten einer an Brustkrebs erkrankten Personengruppe aus onkologischen Praxen in Deutschland sowohl bei der Gesamtsterblichkeit als auch der progressionsfreien Überlebenszeit einen Nutzen der kombinierten Behandlung mit Avastin und Taxol zeige. Bevacizumab gälte daher in DEutschland zu Recht als "first line"-Präparat zur Behandlung des bereits mehrfach charakterisierten Brustkrebstyps. Anders als die der FDA-Experten-Empfehlung zugrunde liegenden Studien verglichen die deutschen Forscher aber nicht die Avastin/Taxol-Intervention mit einer anderen Interventionsform, sondern verglichen das Überleben einer dreifach-negativen Krankengruppe mit einer, die nicht an dieser Variante von Brustkrebs litten. Neben den um mehrere Monate längeren Überlebenszeiten in der Avastin/Taxol-Gruppe, konnten die ForscherInnen auch nur wenige der schweren unerwünschten Wirkungen beobachten. Ein Bericht über ihre Präsentation schloß daher auch mit den Worten "that the regimen is active in patients with triple-negative disease and is well-tolerated in routine practice."
Was an Wichtigem zu berichten übrigbleibt ist Folgendes: Die Studie wurde von der Firma Roche, also dem Hersteller von Avastin, gesponsert, was aber die AutorInnen nicht daran hinderte anzugeben, sie hätten "no conflicts of interest" gehabt. Einzelheiten zu den Ergebnissen der Präsentation "Bevacizumab combined with paclitaxel as first-line therapy for metastatic triple-negative breast cancer" von Schneeweiss et al auf dem ECCO-ESMO-Kongress 2011 (Abstract 5073) finden sich in einer kostenlosen Zusammenfassung auf einer der vielen Brustkrebs-Spezial-Websites. Ob die mündliche Präsentation jemals in einer Fachzeitschrift mit einem "peer review"-Verfahren erscheinen wird, verdient angesichts ihrer in diesem Zusammenhang eigentümlichen Methodik und ihren speziellen Ergebnissen besondere Aufmerksamkeit
• Dass die Firma Roche nicht nur offen Kongressbeiträge unterstützt, sondern auch noch andere Strategien verfolgt, zeigt sich an einer seit wenigen Tagen bekannten Vertragsstrategie des Konzerns gegenüber Krankenhäusern in Deutschland. Wie die "Süddeutsche Zeitung (SZ)" am 24.10.2011 in dem komplett kostenlos erhältlichen Beitrag "Rabatt bei Misserfolg" von Christina Berndt berichtet, bietet Roche Krankenhäusern einen so genannten "pay for performance"-Vertrag an, der folgendes Angebot enthält: Wenn in einem Krankenhaus Avastin zur Erstbehandlung fortgeschrittener Tumore des Darms, der Lunge, der Nieren und der Brust eingesetzt wird, was in Deutschland etwa 3.300 Euro pro Monat kostet, und der Krebs nicht zu wachsen aufhört, erhalten die Krankenhäuser das aufgewandte Geld zurück. Diese wohl einmalige "Geld-zurück"-Garantie kommentiert das pharmakritische "Arznei-Telegramm" in einem demselben Thema gewidmeten Beitrag in der leider nicht frei bzw. kostenlos zugänglichen neuesten Ausgabe (a-t 2011; 42: 83-4) so: "Die Regelung lädt geradezu ein, auch Patienten mit Bevacizumab zu behandeln, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es ihnen nützt." Noch folgenreicher für Patienten ist, dass den Avastin-Patientinnen möglicherweise eine wirksamere Therapien mit weniger attraktiven finanziellen Anreizen vorenthalten wird. Der Clou der "P4P"-Verträge ist nämlich, dass die Krankenhäuser Kostenerstattungen angeboten werden, hinter denen gar keine Ausgaben stehen. Die Behandlung mit Avastin bezahlen nämlich die Krankenkassen. In dem SZ-Artikel wird dann auch ein AOK-Vertreter zitiert, der meint, solche Preisvorteile müssten an die Kassen weitergegeben werden. Ein Überblick über die 12 in den letzten Jahren u.a. zu Avastin im "Arznei-Tegramm" erschienenen ebenfalls mehrheitlich nicht kostenlos zugänglichen Beiträge zeigt, dass der Nutzen des Medikaments schon seit längerem auch in Deutschland bezweifelt wird.
Unabhängig von legitimen und legalen Finanzierungsdetails bleibt die Frage, warum nach Bekanntwerden des Angebots Krankenkassen und Krankenhäuser nicht auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse über Avastin gemeinsam ein solches Angebot grundsätzlich als inhuman, patientengefährdend und unethisch ablehnten.
Nachtrag vom 20. November 2011: In einer FDA-Presseerklärung vom 18. November 2011 kündigte die FDA-Leiterin Margret A. Hamburg an, die Zulassung des Medikaments Avastin bzw. seines Wirkstoffs zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen werde in den USA zurückgezogen.
Die der Entscheidung zugrundeliegende Abwägung von Vor- und Nachteilen lautet: "This was a difficult decision. FDA recognizes how hard it is for patients and their families to cope with metastatic breast cancer and how great a need there is for more effective treatments. But patients must have confidence that the drugs they take are both safe and effective for their intended use." Und: "After reviewing the available studies it is clear that women who take Avastin for metastatic breast cancer risk potentially life-threatening side effects without proof that the use of Avastin will provide a benefit, in terms of delay in tumor growth, that would justify those risks. Nor is there evidence that use of Avastin will either help them live longer or improve their quality of life."
Ob und wie sich die europäischen und deutschen Zulassungsinstitutionen dieser Entscheidung anschließen, kann man hoffentlich nicht allzu lange beobachten.
Bernard Braun, 30.10.11
Brustkrebspatientinnen werden schlecht auf die sozialen, emotionalen und kognitiven Bedingungen nach dem Überleben vorbereitet
 Trotz zahlreicher Verbesserungen der diagnostischen und therapeutischen Techniken und Möglichkeiten in der Behandlung von Brustkrebserkrankten, ist die soziale, emotionale und auch kognitive Vorbereitung auf die zum Teil langwierige, die Gesundheit und Lebensqualität der Patientinnen über Jahre belastende Behandlung und die Zeit nach der unmittelbaren Therapie immer noch lückenhaft oder qualitativ schlecht.
Trotz zahlreicher Verbesserungen der diagnostischen und therapeutischen Techniken und Möglichkeiten in der Behandlung von Brustkrebserkrankten, ist die soziale, emotionale und auch kognitive Vorbereitung auf die zum Teil langwierige, die Gesundheit und Lebensqualität der Patientinnen über Jahre belastende Behandlung und die Zeit nach der unmittelbaren Therapie immer noch lückenhaft oder qualitativ schlecht.
Das zeigt die am 11. Oktober 2011 veröffentlichte Auswertung der Antworten von 1.043 Frauen, welche ihre Krebserkrankung und -therapie überlebt haben, im Rahmen des in dieser Form in den USA und weltweit einmaligen "The Breast Cancer M.A.P. (Mind Affects the Physical) Projects". In diesem Projekt werden die persönlichen, emotionalen, physischen und sozialen Wahrnehmungen und Erfahrungen dieser Frauen erfasst und auswertbar sowie kommunikabel gemacht.
Zu den wichtigen Funden des Projektes gehört:
• 90% der Teilnehmerinnen bekamen innerhalb ihrer gesamten Behandlung keine Übersicht oder keinen Plan ("survivorship care planning") ausgehändigt, der sich mit der oft noch jahrelang notwendigen Behandlung und ihren oft belastenden Umständen nach dem akuten Überleben der Erkrankung beschäftigte.
• Von den überlebenden Krebskranken, die keinen solchen Plan erhielten, hätten aber gerne 96% einen erhalten.
• Von den Empfängern eines derartigen Plans fanden ihn 71% nützlich oder sehr nützlich.
• Die Mehrheit der Patientinnen fühlte sich für die weiteren Kontakten und die wichtigste Unterhaltung mit verschiedenen Ärzten nach der Erstdiagnose Brustkrebs nicht gut vorbereitet.
• 75% der überlebenden Krebskranken berichteten, sie hätten gerne vor diesem Erstkontakt so viel wie möglich Informationsmaterial erhalten. Erhalten haben diese Information aber lediglich 15%.
• Entsprechend waren 48% der Frauen nicht völlig mit ihren Fragen zufrieden, die sie innerhalb des ersten Gesprächs mit einem Facharzt gestellt hatten.
• 87% der Befragungsteilnehmerinnen nahmen mindestens ein soziales, physisches oder emotionalen Problem als mittelmäßig bis sehr stark wahr.
• zu den häufigsten Fällen von Behandlungs-Stress gehören starke Müdigkeit, sexuelle Fehlfunktionen und Schlafprobleme. Zu den häufigsten Begleiterkrankungen gehören im Moment die Depression und eine Reihe von Komorbiditäten.
Eine der Beraterin des Projekts, Lidia Schapira von der Harvard Medical School in Boston, fasst die Projektergebnisse so zusammen: "We have made extraordinary advances in the treatment of breast cancer but it's clear from these findings that the full spectrum of care isn't currently being delivered to survivors." Dies ist verbunden mit der praktischen Aufforderung an die "cancer community" nach einem "renewed focus on providing social and emotional support to people with breast cancer, and improve the standard of care for the growing survivor population."
Da es keinen Grund gibt, dass die soziale und emotionale Unterstützung von an Brustkrebs erkrankten Frauen in Deutschland völlig anders oder gar besser aussieht, sollte auch hierzulande nicht erst auf eine solche Studie gewartet werden, sondern prinzipiell mehr für diese Seite der Versorgung getan werden. Dazu die betroffenen Frauen zu fragen und nicht allein den Expertenmeinungen zu folgen, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Den 73 Seiten umfassenden 2011-Bericht des Projekts erhält man komplett kostenlos.
Eine knappe Pressemitteilung über die wichtigsten Projektergebnisse ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.10.11
US-Empfehlung: Schluss mit PSA-basiertem Prostatakrebs-Screening bei gesunden Männern! Deutsche Urologen: "zu drastisch"!
 33 der 44 Millionen US-Amerikaner über 50 Jahre haben schon einen so genannten PSA-Test (Suche nach einem prostata-spezifischen Antigen) hinter sich. Vielen von ihnen wurde dabei, gestützt auf die "gute Erfahrungen" ihrer Urologen und auf entsprechende Leitlinien der Fachgesellschaften, ein großer persönlicher Nutzen bis hin zur Verbesserung der Überlebenschancen bei Prostatakrebs versprochen. Selbst die sich häufenden Hinweise, dass dieser Test bei symptomlos gesunden Männern wahrscheinlich weder diesen noch andere Nutzen erbringe, und daher die nachweisbaren Nachteile und Schäden durch weitere invasive Tests (z.B. Biopsien) und Behandlungen umso stärker zu bewerten sind, brachten das Vertrauen in den PSA-Test nicht ins Wanken.
33 der 44 Millionen US-Amerikaner über 50 Jahre haben schon einen so genannten PSA-Test (Suche nach einem prostata-spezifischen Antigen) hinter sich. Vielen von ihnen wurde dabei, gestützt auf die "gute Erfahrungen" ihrer Urologen und auf entsprechende Leitlinien der Fachgesellschaften, ein großer persönlicher Nutzen bis hin zur Verbesserung der Überlebenschancen bei Prostatakrebs versprochen. Selbst die sich häufenden Hinweise, dass dieser Test bei symptomlos gesunden Männern wahrscheinlich weder diesen noch andere Nutzen erbringe, und daher die nachweisbaren Nachteile und Schäden durch weitere invasive Tests (z.B. Biopsien) und Behandlungen umso stärker zu bewerten sind, brachten das Vertrauen in den PSA-Test nicht ins Wanken.
Gestützt auf die bewerteten Ergebnisse von 5 in den USA und Europa durchgeführten großen Studien, macht sich jetzt mit der "United States Preventive Services Task Force (USPSTF)" eine recht gewichtige und für die us-amerikanische Behandlungswirklichkeit autoritative Fachinstitution daran, aus dem Wanken einen Umsturz zu machen.
Nachdem die USPSTF bereits 2008 empfohlen hatte von einem PSA-Screening bei 75-Jährigen und Älteren abzusehen, lautet ihre jetzige Empfehlung: "The USPSTF now recommends against PSA-based screening for prostate cancer in all age groups." Die Studien hätten auf der Basis von Lebens- und Behandlungsverläufen von hunderttausenden Männern selbst nach bis zu 10 Jahren entweder keine lebensrettenden oder -verlängernden oder höchstens einen sehr kleinen Effekt des Tests nachweisen können.
Was die Experten zu dieser, im Moment auch noch gegen eine explizit andere Empfehlung der urologischen Fachgesellschaften der USA gerichtete Empfehlung bewogen hat, begründen u.a. die folgenden versorgungsepidemiologischen Daten: Von 1986 bis 2005 sind allein in den USA eine Million Männer operiert, bestrahlt oder beides geworden, die ohne den PSA-Test niemals behandelt worden wären. Von ihnen starben wenigstens 5.000 kurz nach der Operation und 10.000 bis 70.000 litten unter ernsthaften Komplikationen. Die Hälfte dieser Männer hatte anhaltend Blut in ihrem Samen und 200.000 bis 300.000 litten unter Impotenz oder Inkontinenz oder beiden gravierenden Einschränkungen ihrer Lebensqualität. Selbst der Entwickler des Tests, Richard Ablin, sprach daher bereits vor einiger Zeit von einem "public health disaster". Um einen Todesfall durch ein Prostatakarzinom zu verhindern, müssen 1.400 Männer gescreent werden und 48 Männer als Patienten behandelt werden.
Dabei verschweigen die Experten keineswegs, dass Prostatakrebs bei Männern zu den häufigsten, auch tödlichen Krebserkrankungen gehört: 2010 wurden in den USA bei schätzungsweise 217.730 Männer ein Prostakarzinom diagnostiziert und 32.050 Männer starben an dieser Krankheit.
Ab Dienstag dem 11. Oktober 2011 können interessierte Akteure die Empfehlung der Task Force kommentieren. Bereits bekannte Äußerungen lassen auch komplette Ablehnung oder moderatere Kompromissvorschläge erwarten. Hier lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Kommentar-Website der USPSTF.
Den deutschen Urologen sind die Empfehlungen laut dem entsprechenden Spiegel online-Beitrag von Cinthia Briseno "zu drastisch", es gäbe viele Männer, die ihn für nützlich hielten und außerdem würde der PSA-Test hierzulande bei weitem nicht so häufig angeboten und durchgeführt wie in den USA. Trotzdem wäre es nach Meinung einiger dieser Experten wahrscheinlich sinnvoll, einen anderen Test zu entwickeln - was aber noch viele Jahre dauern könne. Und deshalb windet sich diese Argumentation wieder der Position zu, dass doch lieber der PSA-Test weiter durchgeführt aber durch rektale Untersuchungen ergänzt werden solle.
Wer mit dieser Art von "Sachargumentation" nichts anfangen kann, dem seien die auf 7 Seiten zusammengetragenen vielfältigen Sach- und Fachinformationen im "Draft Recommendation Statement - Summary of Recommendation and Evidence" der USPSTF empfohlen, die es mit viel Literaturverweisen angereichert, komplett und kostenlos zum Herunterladen gibt. Egal wie die weitere Diskussion ausgeht, sollten die hier vorliegenden Fakten in keiner PSA- und Prostatakrebsdebatte der Zukunft mehr fehlen.
Eine lesenswerte Zusammenfassung der Empfehlungen und einige Ergänzungen liefert auch der von Gardiner Harris verfasste Artikel U.S. Panel Says No to Prostate Screening for Healthy Men in der New York Times vom 6. Oktober 2011.
Bernard Braun, 9.10.11
Screening, Überdiagnostik und Überbehandlung: Anstieg der Brustentfernungen statt Abnahme nach Einführung von Brustkrebs-Screening
 Zu den den vielen Versprechungen von Medizinern, diversen Beratungs- und Aufklärungsbroschüren von Krankenkassen, Patientenverbänden oder Verbände zum Nutzen des Brustkrebs-Screenings und zu den verständlichen Erwartungen der gesunden Nutzerinnen des Brustkrebs-Screenings gehört eine im Falle der Entdeckung eines Mamma-Karzinoms geringere Wahrescheinlichkeit und Notwendigkeit, die erkrankte Brust entfernen zu müssen. Die so genannte Mastektomie gehört zu den u.a. psychisch schwer belastenden Endpunkten einer Brustkrebserkrankung.
Zu den den vielen Versprechungen von Medizinern, diversen Beratungs- und Aufklärungsbroschüren von Krankenkassen, Patientenverbänden oder Verbände zum Nutzen des Brustkrebs-Screenings und zu den verständlichen Erwartungen der gesunden Nutzerinnen des Brustkrebs-Screenings gehört eine im Falle der Entdeckung eines Mamma-Karzinoms geringere Wahrescheinlichkeit und Notwendigkeit, die erkrankte Brust entfernen zu müssen. Die so genannte Mastektomie gehört zu den u.a. psychisch schwer belastenden Endpunkten einer Brustkrebserkrankung.
Wie viele andere Versprechungen und Erwartungen scheint dies aber nicht nachweisbar, einer der vielen Irrtümer über Früherkennungsuntersuchungen und das Gegenteil richtig zu sein.
Dies ist jedenfalls das ernüchternde Ergebnis einer Analyse der Daten von 35.408 Frauen im Alter von 40 bis 79 Jahren, die zwischen 1993 und 2008 wegen eines Mammakarzinioms operiert wurden und deren Daten im norwegischen Krebsregister erfasst sind. Verglichen wurden die Rate der Brustentfernungen in der Zeit vor (1993-95), während der Einführung (1996-2004) und nach beendeter Einführung (2005-08) des Brustkrebs-Screenings.
Die jährliche Rate an Brustkrebsoperationen stieg in der Gruppe der in dem Screeningprogramm zweijährig zu Untersuchungen eingeladenen Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren von der Vor-Screeningperiode bis zur Screeningperiode um signifikante 70%. In der nicht eingeladenen jüngeren Frauengruppe im Alter von 40-49 Jahren betrug der Anstieg der Operationsrate nur 8%. In der ebenfalls nicht systematisch zum Brustkrebs-Screening eingeladenen Altersgruppe von 70-79 Jahren sank die Rate sogar um 8%.
Was ebenfalls im Zusammenhang mit der Einführung des Brustkrebs-Screenings stieg, war die Rate der Mastektomien bei zum Screening eingeladenen 50-69-jährigen Frauen, und zwar um 9%. Dem stand die Abnahme der Mastektomien bei den jüngeren, nicht eingeladenen Frauen um 17%. In der zum Screening eingeladenen Frauengruppe war die Mastektomierate um 31% höher als in der nichteingeladenen jüngeren Gruppe. Die AutorInnen weisen zur Erklärung dieser Entwicklung der OP-Häufigkeiten auf Studien über die Effekte von fünf Screeningprogrammen hin, die zu einer 52%-igen Überdiagnostik von Brustkrebs führen, der ohne das Screening innerhalb der wahrscheinlichen Lebenszeit der untersuchten Frauen nicht klinisch relevant geworden wäre.
Die besonders in der Einführungszeit des Screenings gestiegenen Operationsraten und das teilweise Sinken nach Abschluss der Einführung interpretieren die AutorInnen vor allem als Folge einer veränderten, beispielsweise mehr brusterhaltenden Operations-Politik bei Brustkrebs.
Der Aufsatz "Effect of mammography screening on surgical treatment for breast cancer in Norway: comparative analysis of cancer registry data" von Pal Suhrke et al. ist im September 2011 in der Fachzeitschrift "British Medical Journal" (2011;343: d4692 doi: 10.1136/bmj.d4692) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.9.11
40 Jahre "war on cancer", 20 Jahre "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening trial" und kein "Sieg" in Sicht!
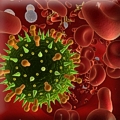 Der größte, langlebigste und solideste wissenschaftliche Beitrag (die "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer (PLCO) Screening"-Studie) zu dem im Jahr 1971 vom damaligen US-Präsidenten Nixon per Gesetz (The National Cancer Act (P.L. 92-218) erklärten Krieg gegen den Krebs ist zwanzig Jahre nach seinem Start bezogen auf die "Wunderwaffe" Screening zu recht "friedlichen" oder erfolglosen Ergebnissen gelangt.
Der größte, langlebigste und solideste wissenschaftliche Beitrag (die "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer (PLCO) Screening"-Studie) zu dem im Jahr 1971 vom damaligen US-Präsidenten Nixon per Gesetz (The National Cancer Act (P.L. 92-218) erklärten Krieg gegen den Krebs ist zwanzig Jahre nach seinem Start bezogen auf die "Wunderwaffe" Screening zu recht "friedlichen" oder erfolglosen Ergebnissen gelangt.
Sowohl über die Ergebnisse zum PSA-Screening: "Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches. als auch über das Eierstockkrebs-Screening: bringt nachweisbar Schaden durch nicht notwendige Operationen aber keinen Nutzen bei der Mortalität. gibt es 2009 und 2010 veröffentlichte Aufsätze über die im "forum-gesundheitspolitik" berichtet wurde.
Der aktuell als "Online first"-Beitrag im renommierten Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichte Aufsatz über die erwünschten und unerwünschten Erfolge und Wirkungen des Eierstockkrebs-Screenings bestätigt die bisher publizierten Ergebnisse grundsätzlich, erhärtet sie aber durch seine kompromisslos klaren Aussagen weiter.
Bezogen auf den primären Endpunkt oder Nutzenindikator "Mortalität" kommen die AutorInnen zu folgenden Schlüssen:
• "In this randomized controlled trial, we found no statistically significant reduction in mortality from ovarian cancer in a cohort of women derived from the general population who were screened for ovarian cancer with 6 annual CA-125 tests and 4 annual transvaginal ultrasound examinations. The numbers of deaths from ovarian cancer were similar in the 2 trial groups over the entire period of follow-up (maximal 13 Jahre - Einfügung d. Verf.), with a modestly (although not statistically significant) greater cause-specific mortality rate in the intervention group (RR, 1.18; 95% CI, 0.82-1.71)."
• Zur Häufigkeit und Art des Schadens, den das Screening den untersuchten Frauen unmittelbar und mittelbar zufügt - im kriegerischen Jargon also die Kollateralschäden -, kommt die Studie ebenfalls zu gewichtigen Zahlen. Von den 34.253 Frauen in der Interventionsgruppe erhielten 3.258 ein falsch-positives Resultat, d.h. bei ihnen wurde ein Eierstockkarzinom "entdeckt", das gar nicht existierte. 1.080 unterzogen sich nach dieser Fehldiagnose einer Operation, 32,9% davon einer Eierstockentfernung. Bei 163 operierten Personen, also 15% aller Operierten traten insgesamt 222 unterschiedliche Hauptkomplikationen (z.B. Blutungen, Herz-/Kreislaufstörungen, Infektionen) auf, was einer Rate von 20,6 Komplikationen pro 100 chirurgischen Eingriffen entsprach. Mangels einer wirklichen Erkrankung handelt es sich bei den Operationen und Komplikationen durchweg um mehr oder weniger gefährliche Körperverletzungen.
• Zusammenfassend heißt es dann: "We conclude that annual screening for ovarian cancer as performed in the PLCO trial with simultaneous CA-125 and transvaginal ultrasound does not reduce disease-specific mortality in women at average risk for ovarian cancer but does increase invasive medical procedures and associated harms."
Ob aus dem 0:2 für Krebs-Screenings durch die noch nicht veröffentlichten Mortalitätsdaten der PLCO nach Lungen- und Darmkrebs-Screening ein 2:2 wird, muss abgewartet werden. Das Ergebnis des "Kriegs" könnte aber auch bald 1:2, 1:3 oder 0:4 heißen. Trotz erster Anzeichen, dass CT-Untersuchungen bei Lungenkrebs sich positiv auf die Mortalität an dieser Krebsart auswirken, bleibt nämlich dann immer noch die Frage, ob z.B. allein die Strahlenbelastung bei einem Screening nicht doch mehr Schaden auslöst als präventiven Nutzen stiftet. 2010 hatte das National Cancer Institute (NCI" der USA als erstes und vorläufiges Ergebnis der "National Lung Screening Trial", einer randomisierten Studie mit mehr als 53.000 früher und auch heute noch schwer rauchenden Personen im Alter von 55 bis 74 berichtet, dass die Sterblichkeit an Lungenkrebs bei den mit einer niedrigen CT-Dosis untersuchten Personen um 20% geringer war als bei den Personen, bei denen ein Bruströntgenbild gemacht wurde. Auch beim Lungenkrebs-Screening gibt es aber wenigstens für ein Drittel der untersuchten Personen ein falsch-positives Ergebnis und bei einer Person unter 14 wird dann nutzlos eine Biopsie durchgeführt.
Von dem Online First-Aufsatz "Effect of Screening on Ovarian Cancer Mortality. The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Randomized Controlled Trial" im JAMA (2011; 305(22): 2295-2303. doi: 10.1001/jama.2011.766) gibt es dauerhaft ein kostenloses Abstract und anders als bei anderen Zeitschriften zumindest vorübergehend ebenfalls kostenlos den kompletten Text.
Bernard Braun, 11.6.11
Eierstockkrebs-Screening bringt nachweisbar Schaden durch nicht notwendige Operationen aber keinen Nutzen bei der Mortalität.
 Die bereits jetzt lange Reihe der als Screening konzipierten und angebotenen Früherkennungsuntersuchungen, deren Nutzen geringer und deren Nachteil für die untersuchten Personen höher als erwartet ist, wird jetzt gerade verlängert: durch die Ergebnisse einer Studie zur Wirkung von Screeningsuntersuchungen nach der zu den fünf häufigsten und schwersten Krebserkrankungen gehörenden Krebserkrankung der Eierstöcke.
Die bereits jetzt lange Reihe der als Screening konzipierten und angebotenen Früherkennungsuntersuchungen, deren Nutzen geringer und deren Nachteil für die untersuchten Personen höher als erwartet ist, wird jetzt gerade verlängert: durch die Ergebnisse einer Studie zur Wirkung von Screeningsuntersuchungen nach der zu den fünf häufigsten und schwersten Krebserkrankungen gehörenden Krebserkrankung der Eierstöcke.
An der großen randomisierten kontrollierten "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer"-Studie in 10 landesweiten Screening-Zentren in den USA waren zwischen 1993 und 2001 78.216 Frauen im Alter von 55 bis 74 Jahren beteiligt. 39.105 von ihnen wurden nach dem Zufallsprinzip dem so genannten Interventionsarm zugewiesen und nahmen, 39.111 gehörten der Kontrollgruppe mit standardmäßiger Behandlung an. Die Frauen in der Interventionsgruppe wurden sechs und danach noch weitere 4 Jahre mit zwei verschiedenen Methoden auf das Vorliegen von früh zu erkennenden Anzeichen für eine Eierstockkrebserkrankung untersucht. Die Testresultate standen den Teilnehmerinnen und ihren behandelnden ÄrztInnen zur Entscheidungsfindung zur Therapie vollständig zur Verfügung. Für alle Teilnehmerinnen wurden bis zu 13 Jahre lang mögliche Krebsdiagnosen und die Sterblichkeit als primärer Endpunkt der Studie erhoben. Die sekundären Endpunkte waren die Inzidenz von Eierstockkrebs und Komplikationen im Zusammenhang mit den Screeninguntersuchungen und weiteren diagnostischen Prozeduren.
Die Ergebnisse waren eindeutig:
• 212 Frauen in der Interventionsgruppe und 176 in der Kontrollgruppe erkrankten im Untersuchungszeitraum an Eierstockkrebs. In der Interventionsgruppe endete die Erkrankung bei 118 Frauen und in der Kontrollgruppe bei 100 Frauen mit dem Tod. Aus beiden Betrachtungswinkeln gab es also keine nachweisbaren Vorteile für die Teilnehmnerinnen am Screening.
• An anderen Ursachen verstarben zusätzlich 2.924 in der Screening- und 2.914 in der Standardbehandlungsgruppe.
• Dafür gab es nachweisbar massive Nachteile und starke Belastungen durch die Teilnahme am Screening: 3.285 Frauen mit einem falsch positiven Screening-Testergebnis wurden unnötigerweise operiert, 166 litten dabei mindestens eine ernste postoperative Komplikation.
Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der ForscherInnen sind ebenfalls eindeutig: Zumindest so lange wie die zum Screening angewandten Tests (CA-125= Cancer antigen 125 oder Carbohydrate antigen 125 und transvaginale Ultraschalluntersuchung) derart viel falsche und dann folgenreiche Krebsdiagnosen begründen, sollte von ihm und den hohen positiven Erwartungen Abstand genommen werden.
Für die auf dem diesjährigen Fachkongress der "American Society of Clinical Oncology (ASCO)" Anfang Juni vorgestellte Studie " Effect of screening on ovarian cancer mortality in the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) cancer randomized screening trial" von S. S. Buys, E. Partridge et al. (veröffentlicht im "Journal of Clinical Oncology 29: 2011 (suppl; abstr 5001)) gibt es nur das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 20.5.11
Auch nach 20 Jahren: Kein signifikanter Nutzen des PSA-Tests zur Senkung des Risikos an Prostatakrebs zu versterben zu entdecken!
 Der schon bisher vielstimmige Chor der Stimmen, die vor allzu überzogenen Erwartungen an den Nutzen des als Screeningmethode zur Messung des Risikos von Prostatakrebs empfohlenen PSA-Test (vgl. dazu auch mehrere Belege vgl. u.a. "Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches. in diesem Forum) warnten, wird seit wenigen Tagen durch die Ergebnisse einer in Schweden über 20 Jahre lang durchgeführten Studie kräftig verstärkt.
Der schon bisher vielstimmige Chor der Stimmen, die vor allzu überzogenen Erwartungen an den Nutzen des als Screeningmethode zur Messung des Risikos von Prostatakrebs empfohlenen PSA-Test (vgl. dazu auch mehrere Belege vgl. u.a. "Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches. in diesem Forum) warnten, wird seit wenigen Tagen durch die Ergebnisse einer in Schweden über 20 Jahre lang durchgeführten Studie kräftig verstärkt.
Die Länge des Beobachtungszeitraums ist deshalb wichtig, weil bei der Diskussion der PSA-kritischen Ergebnisse früherer Studien häufig der prinzipiell auch berechtigte Einwand eine Rolle spielte, die positiven Effekte des Tests würden erst nach längerer Zeit auftreten.
Ziel der Studie war zu bewerten, ob das regelmäßige Screening nach Anzeichen von Prostatakrebs der härteste Endpunkt einer solchen Untersuchung, nämlich die spezifische Sterblichkeit an Prostatakrebs in einem derart langen Zeitraum reduziert wird. An der Studie nahmen alle im Jahr 1987 50 bis 69 Jahre alten Männer in der schwedischen Mittelstadt Norrköpping teil. 1.494 Angehörige der Studiengruppe (jeder sechste Mann nach seinem Geburtsdatum) wurden zufällig für die Interventionsgruppe ausgewählt und mussten sich zwischen 1987 und 1996 jedes dritte Jahr auf Anzeichen eines Prostata-Karzinoms untersuchen lassen. Bis 1993 geschah dies durch eine digitale rektale Untersuchung, danach mittels des PSA-Tests. Die prostatakrebsspezifische Mortalität wurde samt genauerer Merkmale des Karzinoms und der Behandlungen bis zum 31. Dezember 2008 erhoben. Die Kontrollgruppe bestand aus den 7.532 restlichen Männern der 50-69jährigen Grundgesamtheit.
Die Ergebnisse lauteten:
• An den vier Screeningaktionen nahm ein von 78% auf minimal 70% sinkender Teil der Untersuchungsgruppe teil.
• In der Screeninggruppe erkrankten 85 Personen (5,7%) an Prostatakarzinom. In der Kontrollgruppe gab es 292 Erkrankte (3,9%). Rund die Hälfte der Tumore wurde in der Screeningsgruppe zwischen den Screeningterminen entdeckt. Auffällig war außerdem eine doppelt so hohe Entdeckungsrate von meist nicht großen oder extrem aggressiven lokalen Tumoren in der Screeninggruppe. Bei der Häufigkeit von Tumoren, die nicht lokal begrenzt also zum Teil deutlich gefährlicher waren als lokale Tumore, unterschieden sich die beiden Gruppen praktisch nicht.
• Die Gesamtmortalität bei Männern mit einem Prostatakarzinom betrug innerhalb der Untersuchungszeit bei den Angehörigen der Screeninggruppe 81% (69 von 85) und 86% (252 von 292) in der Kontrollgruppe.
• Weder die Überlebenszeit bei einer Krebserkrankung der Prostata noch die Gesamt-Überlebenszeit unterschied sich zwischen den beiden Gruppen signifikant.
• Um einen Todesfall wegen eines Prostatakarzinoms zu verhindern, müssen 1.410 Männer untersucht und 48 behandelt werden.
• Das relative Risiko ("risk ratio") für den Tod durch ein Prostatakarzinom betrug innerhalb der 20 Beobachtungsjahre 1,16, d.h. das Risiko an dieser Erkrankung zu versterben war in der Screeninggruppe höher als in der Kontrollgruppe, war aber statistisch nicht signifikant (Konfidenzintervall 0,78 bis 1,73). Da auch weitere Risikoindikatoren für das Prostatakrebs-Sterblichkeitsrisiko, wie beispielsweise das "hazard ratio" teilweise keine signifikanten Unterschiede zwischen der Sterblichkeit in beiden Gruppen zu Tage förderten, kommen die AutorInnen zu dem Schluss, das "screening for prostate cancer did not seem to have a significant effect on mortality" und die Indikatorwerte "did not indicate significant benefit from prostate cancer screening".
• Dem Mangel an signifikantem Nutzen des Screenings für ein längeres Leben mit Prostatakrebs steht ein beträchtliches Risiko zur Überentdeckung ("overdetection") von zum Teil (noch) harmlosem Krebs und einer Überbehandlung ("overtreatment") mit den bekannten und häufig auftretenden unerwünschten Nebenwirkungen (u.a. Impotenz und Inkontinenz) bei den Angehörigen der Screeninggruppe gegenüber.
Dass die Debatte über den Nutzen des PSA-Tests auch mit dieser Studie kein Ende hat, fördern die AutorInnen durch zwei weitere Überlegungen selbst: Zum einen weisen sie trotz der fehlenden Signifikanz zunächst darauf hin, es sei unmöglich, dass das Screening "more than a third" der Mortalität reduziere, dies könnte ("could") aber sein. Egal ob dies zutrifft oder nicht bestünde aber dann trotzdem das Risiko der Überentdeckung und nebenwirkungsreichen Behandlung von Tumoren. Zum anderen ist aber auch die Größe der schwedischen Studienpopulation "not sufficient to draw definite conclusions".
Was die Ergebnisse aber in jedem Fall liefern, sind massive Hinweise von der ungebremsten Nutzung des PSA-Tests als vermeintlich garantiert nützlicher Methode Abstand zu nehmen, das spezifische Sterblichkeitsrisiko gesichert zu verringern.
Der komplette Text des Aufsatzes "Randomised prostate cancer screening trial:20year follow-up" von Gabriel Sandblom, Eberhard Varenhorst, Johan Rosell, Owe Lofman, und Per Carlsson ist im März 2011 online im "British Medical Journal (BMJ)" (2011;342:d1539 doi:10.1136/bmj.d1539) veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.4.11
Verschwenderisch, nutzlos, inhuman: Warum erhalten todkranke Krebspatienten noch Untersuchungen zur Früherkennung?
 Ein Drittel aller Gesundheitsausgaben fallen unabhängig vom Lebensalter in den letzten 12 Monaten vor dem Tod an. Privat krankenversicherte Personen erhalten kurz vor ihrem Tod besonders häufig eine Vielzahl von möglicherweise lebensverlängernden Behandlungen. Über die Art der Leistungen weiß man wenig und vor allem ist es schwer den Nutzen dieser Leistungen in Frage zu stellen.
Ein Drittel aller Gesundheitsausgaben fallen unabhängig vom Lebensalter in den letzten 12 Monaten vor dem Tod an. Privat krankenversicherte Personen erhalten kurz vor ihrem Tod besonders häufig eine Vielzahl von möglicherweise lebensverlängernden Behandlungen. Über die Art der Leistungen weiß man wenig und vor allem ist es schwer den Nutzen dieser Leistungen in Frage zu stellen.
Eine jetzt veröffentlichte Untersuchung aus den USA ermöglicht aber tiefe Einblicke in einen Teil des Leistungsgeschehens für sterbenskranke Patienten und dessen medizinische und vor allem ethische Unsinnigkeit.
In die Untersuchung gingen 87.736 Versicherte von Medicare (eines der beiden staatlichen Krankenversicherungssysteme der USA mit Einzelleistungsvergütung) im Alter von 65 und mehr Jahren ein, die zwischen 1998 und 2005 im fortgeschrittenen Zustand an nicht mehr behandelbaren ("incurable") Lungen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- oder Brustkrebs erkrankt waren und in einem der Tumorregister erfasst waren. Die Behandlungsgeschichte aller Teilnehmer wurde bis zu ihrem Tode oder bis zum 31. Dezember 2007 erfasst und ausgewertet. Eine zweite Gruppe von 87.307 Medicare-Versicherte, die nicht an Krebs erkrankt waren, wurde der ersten Gruppe nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Rasse individuell zugeordnet. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung lag auf dem Angebot und der Nutzung von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen.
Die wesentlichen Ergebnisse sahen so aus:
• Dass es sich bei den an Krebs erkrankten Personen zu einem erheblichen Teil um tot-kranke Personen handelte, zeigen die Überlebensraten: Sie lagen zwischen 4,3 Monaten in der Gruppe der Pankreaskrebspatienten und 16,2 Monaten bei den Brustkrebspatienten. Die 5-Jahres-Überlebensrate betrug bei den Brustkrebspatienten 15,5 %, bei allen anderen Krebskranken aber 5% und weniger. Von der zu Beginn der Studie nicht an Krebs erkrankten Versichertengruppe lebten 5 Jahre nach dem Beginn der vergleichenden Untersuchung noch 80% bis 85 %.
• Unabhängig von ihrer geringen künftigen Lebenserwartung erhielt aber ein bedeutungsvoller Teil der eindeutig diagnostizierten Krebskranken noch weitere Krebsfrüherkennungsuntersuchungen im Rahmen des entsprechenden Screeningprogramms angeboten und nutzten sie auch: 8,9% der Frauen mit Krebs in fortgeschrittenem Stadium erhielten noch Mammographien (in der gesunden Kontrollgruppe waren es 22%), 5,8% erhielten einen PAP-Test zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs (in der Kontrollgruppe erhielten den Test 12,5%) und 15% der krenskranken Männer erhielten einen PSA-Test zur möglichen Früherkennung eines Prostatakarzinoms (Kontrollgruppe 27,2%). Eine endoskopische Untersuchung des Darmes erhielten dagegen nur 1,7% sämtlicher Patienten (Kontrollgruppe 4,7%). Dabei ist besonders bemerkenswert, dass die Raten bei den Schwerkranken zwischen 25% und 55% der Raten betragen, die in der gesunden Kontrollgruppe bei deren Angehörigen also Früherkennungsuntersuchungen auf Krebs möglicherweise einen gesundheitlichen Nutzen haben im selben Zeitraum zu finden sind.
• Die WissenschaftlerInnen vermuten, dass in der Gruppe der unter 65-Jährigen die Frühherkennungsuntersuchungsrate bei unheilbar erkrankten Krebspatienten sogar noch höher sein dürfte.
• Der Faktor mit dem höchsten Vorhersagewert für eine Früherkennungsuntersuchung bei Krebskranken war die langjährige Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen vor der Diagnose der Krebserkrankung.
• Aus dem gerade genannten Prädiktor leiten die Autoren eine Reihe von Erklärungen für die Angebote dieser unter den Erkrankungsumständen der Patienten nutzlosen Leistungen her: Um die Adhärenz für die Teilnahme an Screenings zu verbessern seien systematische Erinnerungs- und Einbestellsysteme eingerichtet und auch wirksam, die nicht den aktuellen Gesundheitszustand erfassten. Es gäbe außerdem eine Art Screeningkultur,, die wie ein "Autopilot" funktioniere und u.a. auch dazu beitrage, dass PAP-Tests selbst bei Frauen durchgeführt werden, deren Gebärmutter entfernt worden war. Nicht zuletzt seien dafür auch Kommunikationsdefizite über die reale oder ernsthafte Bedeutung von Erkrankungsprognosen innerhalb der Aerzteschaft und gegenüber Patienten verantwortlich.
Auch wenn man der Einschränkung der Autoren folgt, dass die eine oder andere Früherkennungsuntersuchung auch bei todkranken Personen angemessen und nützlich sein kann, steht mit ihrer Untersuchung fest, dass viele Ärzte oder das "Früherkennungssystem" speziell bei schwerkranken Patienten eine Menge verschwenderische und gesundheitlich nicht notwendige oder nutzlose Leistungen erbringen. Ob dies - wie vermutet - bei jüngeren Krebskranken sogar noch häufiger passiert und auch bei anderen Patienten mit geringer Lebenserwartung in anderer Weise erfolgt, müssen weitere Untersuchungen schnellstens klären. Dabei wäre allerdings auch zu prüfen, ob die ärztliche Vergütung nach Einzelleistungen nicht als zusätzlicher Anreiz für Leistungsangebote ohne gesundheitliche Rechtfertigung wirkt.
Und natürlich sollte man sich weder als Arzt noch als Versicherter oder Patient im deutschen Gesundheitssystem unbetroffen, entspannt oder nur entsetzt über die "amerikanischen Zustände" zurücklehnen, sondern sich auch hierzulande um mehr Transparenz bemühen.
Der Aufsatz "Cancer screening among patients with advanced cancer" von Sima CS et al. ist in JAMA (2010 Oct 13; 304:1584) erschienen und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.11.10
US-Massenmedien und Krebs - Nebeneinander von Risiko-Verharmlosung und Schweigen über palliative Angebote
 Krebserkrankungen gehören zu den häufigsten schweren Erkrankungen in allen industrialisierten Gesellschaften und auch zu den tödlichsten. In den USA sterben trotz vieler medizinisch-technischer Fortschritte noch rund die Hälfte der an Krebs erkrankten Personen - nicht selten nach schweren Schmerzen und heftigen Nebenwirkungen von Chemotherapie und anderen aggressiven Therapien.
Krebserkrankungen gehören zu den häufigsten schweren Erkrankungen in allen industrialisierten Gesellschaften und auch zu den tödlichsten. In den USA sterben trotz vieler medizinisch-technischer Fortschritte noch rund die Hälfte der an Krebs erkrankten Personen - nicht selten nach schweren Schmerzen und heftigen Nebenwirkungen von Chemotherapie und anderen aggressiven Therapien.
Entsprechend große Aufmerksamkeit genießen daher die Erkrankungen und ihre Therapien in den Massenmedien. Nur was eigentlich im Mittelpunkt der Berichterstattung der Print-Massenmedien steht und was nicht, ist eigentümlicherweise nicht sehr transparent.
Für die USA ist dieser Zustand jetzt durch eine große Analyse der Krebsberichterstattung in 8 großen und renommierten Tageszeitungen (z.B. New York Times, Chicago Tribune oder Philadelphia Inquirer) und 5 bundesweiten Magazinen (z.B. Newsweek, Time und People) im Zeitraum 2005 bis 2007 beendet. Aus einer Gesamtzahl von 2.228 insgesamt mit über 200 Worten zum Thema veröffentlichten Artikeln und Meldungen suchte die Forschergruppe der Universität von Pennsylvania per Zufall 436 Artikel aus und untersuchte sie inhaltsanalytisch.
Aus der Fülle der Ergebnisse sind die Interessantesten und für die öffentliche Risikokommunikation und -perzeption Wichtigsten:
• Über positive Ergebnisse der Krebsbehandlung und aggressive Behandlungsstrategien wird wesentlich häufiger berichtet als über palliativmedizinische Behandlung und das Sterberisiko. 32,1 % aller Artikel fokussierten auf eine erfolgreiche Behandlung von mindestens einem Patienten, nur 7,6 % aller Berichte beschäftigten sich mit Patienten, die starben oder die zu sterben drohten. Nur 2,2 % aller Berichte in den untersuchten Printmedien handelten ausgewogen von positiven und negativen Behandlungsergebnissen.
• Obwohl rund 50 % aller Krebskranken in den USA an ihrer Erkrankung sterben, überlebten von den 216 krebskranken Personen über die in den untersuchten Massenmedien namentlich berichtet wurde, 78,7 % und nur 21,3 % starben.
• 75 % der Presseberichte befassten sich nur mit den aggressiven Formen der Behandlung, nur 13,1 % gaben aber dabei an, dass solche Behandlungsformen nicht immer zu einem verbesserten Überleben beitragen, sondern auch tödlich enden können. Nur 0, 5 % aller Artikel (insgesamt zwei der 436 Artikel) sprachen die Behandlung und Versorgung am Lebensende an, während wenigstens 2,5 % der Artikel sowohl über aggressive Behandlungen als auch über Palliativversorgung berichteten.
• Dieses Bild wird noch dadurch abgerundet, dass trotz der ernsthaften und sogar gefährlichen Nebenwirkungen, die Krebsbehandlungen haben können, nur 30 % der Artikel die Möglichkeit unerwünschter Wirkungen zumindest erwähnt.
Die AutorInnen weisen darauf hin, dass eine derartig überoptimistische Berichterstattung nicht nur Millionen von Menschen hinters Licht führt und sie überhaupt nicht oder falsch über die unerwünschten Folgen zu aggressiver Behandlung informiert. Sie riskiert außerdem, dass Menschen, die z.B. nur noch eine qualitativ hochwertige Palliativversorgung gegen die häufigen schweren Schmerzen brauchen, gar nichts über die Möglichkeiten moderner Schmerztherapien, die Existenz von wirksamen palliativmedizinischen Hilfen und Hospizen wissen und sie im Leidensfall auch oft nicht mehr "in aller Ruhe" suchen können. So hilfreich im Zusammenhang mit ERkrankungen auch die Devise "think positive" sein mag, so negativ endet dies für die nicht kleine Gruppe der Krebspatienten mit dem ausschließlichen Bedarf an palliativen Hilfen.
Vergleichbare Untersuchungen zur Darstellung der Risiken anderer Krankheiten (z.B. Diabetes oder Demenz) und ihrer Prävention und Therapie in allen (z.B. einschließlich kostenloser Apothekenzeitschriften) in Deutschland verbreiteten Print- wie aber auch elektronischen Medien (z.B. TV und Internetportale) wären wünschenswert. Erste völlig unrepräsentative und oberflächliche Eindrücke lassen vermuten, dass es dabei keine wesentlich besseren, d.h. wirklichkeitsgerechteren Ergebnisse geben wird.
Eine gerade veröffentlichte Untersuchung über die Verbreitung potenter gesundheitspolitischer Mythen (z.B. "Kostenexplosion", "demografische Bedrohung") in der deutschen Bevölkerung, hat im Übrigen gezeigt, dass selbst die intensive Lektüre der zahlreichen Krankenkassenzeitschriften, Apothekenzeitschriften und anderen so genannten Gesundheitsinformationsangeboten nicht verhindert, dass ihre Leser-/ZuschauerInnen vielen der genannten und weiteren Mythen voll aufsitzen und daraus auch falsche gesundheitspolitische Orientierungen gewinnen.
Dies und weitere Daten über das "Ankommen" von Mythen in der Bevölkerung kann man in der neuesten Ausgabe des Newsletters des "Gesundheitsmonitors" nachlesen: "Mythen zur Gesundheitspolitik - Auch gebildete Bürger irren." von Bernard Braun und Gerd Marstedt: Gesundheitsmonitor-Newsletter 2-2010.
Von der Studie "Cancer and the Media. How Does the News Report on Treatment and Outcomes?" von Jessica Fishman, Thomas Ten Have und David Casarett, erschienen in den "Archives of Internal Medicine" (2010;170(6): 515-518) ist kostenlos ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 31.7.10
Früherkennung von Lungenkrebs mit Computertomographie: Risiken sicher, Nutzen nicht
 Erfolgt die Diagnose Lungenkrebs durch Untersuchungen infolge von Beschwerden, bestehen zumeist bereits Metastasen und damit wenig Aussicht auf Heilung. Daher erscheint die rechtzeitige Erkennung vor Auftreten von Symptomen besonders wünschenswert. Eine systematische Übersichtsarbeit (Cochrane Review, Stand 15.4.2010) ergab jedoch keine Hinweise dafür, dass die Früherkennung durch Röntgen oder Computertomographie der Lunge die Sterblichkeit an Lungenkrebs mindert.
Erfolgt die Diagnose Lungenkrebs durch Untersuchungen infolge von Beschwerden, bestehen zumeist bereits Metastasen und damit wenig Aussicht auf Heilung. Daher erscheint die rechtzeitige Erkennung vor Auftreten von Symptomen besonders wünschenswert. Eine systematische Übersichtsarbeit (Cochrane Review, Stand 15.4.2010) ergab jedoch keine Hinweise dafür, dass die Früherkennung durch Röntgen oder Computertomographie der Lunge die Sterblichkeit an Lungenkrebs mindert.
Auch wenn zur Effektivität keine belastbaren Ergebnisse vorliegen, wird derzeit die Früherkennung von Lungenkrebs durch Spiral-Computertomographie in den USA zunehmend propagiert, wie auf diesem Bild zu sehen z.B. durch Werbung im öffentlichen Raum.
Eine jetzt veröffentlichte Studie befasste sich mit den falsch positiven Ergebnisse beim Lungenkrebs-Screening mit Spiral-CT. "Falsch positiv" bezieht sich darauf, dass man mit der Röntgenaufnahme nach Veränderungen sucht, die Krebs sein könnten. Gutartige und bösartige Veränderungen sind dabei aber nicht sicher unterscheidbar. Daher muss durch weitere Untersuchungen abgeklärt werden, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Befund handelt.
Im Rahmen des National Lung Screening Trial wurden 3.190 aktuell oder ehemalig starke Raucher (mindestens eine Anzahl Zigaretten, die einem Konsum von einer Packung pro Tag über 30 Jahre entspricht, sog. pack years)im Alter von 55 bis 74 Jahren durch Randomisation (Zufallsverteilung)in 2 Gruppen geteilt. Beide Gruppen erhielten für drei Jahre pro Jahr eine Früherkennungsuntersuchung, die eine Gruppe eine Röntgenaufnahme, die andere Gruppe eine Spiral-Computertomographie. Die Studie ist auf 8 Jahre veranlagt.
Die Auswertung erfolgte ein Jahr nach Durchführung der 2. Früherkennungsuntersuchung.
Als falsch positiv wurde eine Untersuchung bewertet, wenn entweder die zur Abklärung durchgeführten Untersuchungen negativ waren (kein Krebs gefunden wurde) oder wenn mindestens 12 Monate nach der Screeninguntersuchung keine Lungenkrebsdiagnose gestellt worden war.
Ein falsch positives Ergebnis erhielten insgesamt 506 der 1398 Teilnehmer (31%) der CT-Gruppe sowie 216 der 1317 Teilnehmer (14%) der Röntgen-Gruppe. Lungenkrebs wurde entdeckt (richtig positives Ergebnis) bei 38 Teilnehmern (2%) der CT-Gruppe sowie bei 16 Teilnehmern (1%) der Röntgen-Gruppe.
Die weiterführende Diagnostik bestand zumeist in weiteren bildgebenden Verfahren. In der CT-Gruppe wurde jedoch bei insgesamt 7% und in der Röntgen-Gruppe bei 4% der Teilnehmer mit falsch positivem Ergebnis ein invasiver Eingriff durchgeführt, zumeist ein kleinerer wie Bronchoskopie oder Biopsie, bei 2% der falsch positiven Fälle der CT-Gruppe jedoch ein größerer operativer Eingriff.
Das Fazit lautet, dass zwar kein Nutzen für die Früherkennung durch Spiral-Computertomographie nachgewiesen ist, das Problem der falsch positiven Ergebnisse jedoch erheblich ist. Bereits bei zwei Untersuchungen erhält fast jeder Dritte ein falsch positives Ergebnis - eine Zahl die bei jeder weiteren Untersuchung weiter anwächst. Hinzu kommen Strahlenbelastung, psychologische Belastung und Kosten.
Croswell JM, Baker SG, Marcus PM, Clapp JD, Kramer BS. Cumulative Incidence of False-Positive Test Results in Lung Cancer Screening. Annals of Internal Medicine 2010;152(8):505-512. Abstract
Manser et al. Screening for Lung Cancer. Cochrane Review. Last assessed as up-to-date: April 15. 2010
Kapitel Lungenkrebs im Buch Untersuchungen zur Früherkennung Krebs.- Nutzen und Risiken. Klaus Koch und Stiftung Warentest 2005. Dieses Buch steht seit kurzem kapitelweise kostenlos zum Download zur Verfügung.
David Klemperer, 24.4.10
Warum Zweitmeinungen nicht nur bei teuren Spezialpräparaten? Funde aus der Praxis von Zweitmeinungszentren bei Hodenkrebs.
 Für die ärztliche Verordnung von "Spezialpräparaten mit hohen Jahrestherapiekosten oder mit erheblichem Risikopotenzial", für die "hinsichtlich der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolgs besondere Fachkenntnisse erforderlich sind", wurde 2007 im Wettbewerbsstärkungsgesetz das obligatorische Zweitmeinungsprinzip in den Alltag des deutschen Krankenversorgungssystems eingeführt (§ 73d SGB V). Der behandelnde Arzt ist bei der genannten Verordnung gehalten, sich mit "einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie" abzustimmen. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt die Einzelheiten des Verfahrens in Richtlinien.
Für die ärztliche Verordnung von "Spezialpräparaten mit hohen Jahrestherapiekosten oder mit erheblichem Risikopotenzial", für die "hinsichtlich der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolgs besondere Fachkenntnisse erforderlich sind", wurde 2007 im Wettbewerbsstärkungsgesetz das obligatorische Zweitmeinungsprinzip in den Alltag des deutschen Krankenversorgungssystems eingeführt (§ 73d SGB V). Der behandelnde Arzt ist bei der genannten Verordnung gehalten, sich mit "einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie" abzustimmen. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt die Einzelheiten des Verfahrens in Richtlinien.
Wie diese allerdings noch weitgehend unbekannte Neuerung bisher funktioniert und ob überhaupt, ist öffentlich nicht bekannt. Die bisher nicht veröffentlichten Ergebnisse einer im Herbst 2008 durchgeführten Versichertenbefragung des Bertelsmann-"Gesundheitsmonitors" zur Bewertung dieser Neuerung zeigte eine eher skeptische Grundeinstellung bzw. Uniformiertheit: In diesem ZUsammenhang wenige 21% der Befragten stimmten ihr voll und ganz oder eher zu, 64,5% lehnten das Einholen einer Zweitmeinung voll und ganz oder eher ab und 14,5 % konnten dies nicht beurteilen - hatten also mit großer Wahrscheinlichkeit noch gar nichts von dieser gesetzlichen Möglichkeit gehört.
Dennoch gab es vor ihrer Einführung gleichwohl Stimmen, die das Prinzip der obligatorisch einzuholenden Zweitmeinung auch auf andere schweren oder folgenreichen Behandlungen ausgedehnt wissen wollten.
Ob dies sinnvoll ist, d.h. wie groß der Nutzen einer breiteren Anwendung dieses Prinzips ist oder sein könnte, zeigt nun eine in Deutschland mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe durchgeführte und im Januar 2010 (zwischen-)veröffentlichte Studie über Zweitmeinungen bei der Behandlung von Patienten mit Hodenkrebs.
Hodenkrebs ist eine eher seltene Krebserkrankung. Rund 4.700 Männer erkranken jedes Jahr in Deutschland neu daran - vor allem jüngere Männer sind von dieser Krankheit betroffen.
In der Angebotsstruktur unterscheidet sich die Behandlung von Hodenkrebs insofern von der anderer Erkrankungen, als dass es hier bereits freiwillig so genannte Zweitmeinungszentren gibt. Diese Zentren sind Mitglied der Deutschen Studiengruppe zu Hodentumoren und nahezu an allen Universitätskliniken in Deutschland vertreten.
Für die Zweitmeinungsstudie wurden zwischen Februar 2006 und September 2008 die Diagnose- und Behandlungsgeschichte von 642 Männer (streng genommen handelte es sich um 642 Anfragen von 162 ambulant und stationär tätigen Urologen an eines der 18 Zweitmeinungszentren) mit einer Hodenkrebserkrankung mit Zweitmeinungsverfahren untersucht.
Die Zwischen-Ergebnisse dieser noch breiter angelegten Untersuchung zeigten:
• 32,3% der Hodenkrebs-Patienten bekam mit der Zweitmeinung eine abweichende Empfehlung für die Behandlung.
• Besonders in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien differierten der erste und der zweite Therapieansatz noch mehr, d.h. mehr Patienten bekamen abweichende Empfehlungen.
• In 71,8% der diskrepanten Fälle übernahm dann der erstdiagnostizierende und behandelnde Arzt den andersartigen Vorschlag des Zweitmeinungszentrums. 15,6% blieben bei ihrer Behandlung und in 7,1% der Fälle wurden die Patienten mit einer dritten Variante behandelt. Was beim Rest der Patienten passierte, konnte nicht ermittelt werden.
• Die Auswirkungen auf die Behandlungs- und Lebensqualität waren beträchtlich: Die neue Behandlung war in fast der Hälfte der Fälle weniger intensiv, was u.a. das Risiko für Komplikationen senkte.
• Bei einem Viertel der Patienten musste aber die begonnene Therapie nach Meinung der Zweitgutachter verstärkt werden.
• Die abweichende Zweitmeinung verhinderte bei Übernahme in 40,3% bzw. 26,5% der diskrepanten Fälle Überbehandlung oder Unterbehandlung.
• Um nicht einen zu positiven Eindruck vom Nutzen des Zweitmeinungsverfahrens zu erwecken, hier ein zweiter Blick mit dem Bezug auf alle 642 angefragten Fälle: Dann verhindert das Verfahren immer noch in 10,7% aller dieser Fälle Überbehandlung und Unterbehandlung in 16% aller Fälle. Fast jede sechste Zweitmeinung führte also zu einer relevanten Veränderung der Art und Weise der Behandlung.
• Ein wichtiger Grund für die abweichende Zweitmeinung war nach Feststellung der WissenschaftlerInnen, dass gerade einmal zwei Drittel der Ärzte, welche die erste Diagnose gestellt hatten, ihre Therapie an den aktuellen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Urologie ("European Consensus on Diagnosis and Treatment of Germ Cell Cancer") orientierten. Diese waren wiederum für die Ärzte des Zweitmeinungszentrums leitend.
Die wichtigsten Schlussfolgerungen lauten: Selbst die besten Leitlinien sind relativ wenig im Behandlungsalltag verbreitet und wirksam oder gar Standard. Zusätzliche Transfer- und Implementations- oder Durchsetzungsmethoden und -strategien sind nötig. Die Entwicklung und Nutzung von "second-opinion networks" sind für die AutorInnen dieser Studie ein notwendiges und auch wirksames Mittel.
Die Ergebnisse der Studie sind mit Sicherheit mehrfach verzerrt, und können daher weder für alle Hodenkrebspatienten und ihre Ärzte oder Behandlungen verallgemeinert werden. So sind die freiwillig teilnehmenden Urologen mit Sicherheit einerseits weniger von der absoluten wissenschaftlichen Richtigkeit und Stimmigkeit ihres Handelns überzeugt als die Nichtteilnehmer. Andererseits könnte die Teilnahme natürlich auch erfolgen, weil der Arzt der Meinung ist, seine Diagnose und Therapie hielten einer Zweitbegutachtung stand.
Was daher eine obligatorische Zweitmeinung nicht nur bei Spezialmedikamenten, sondern bei der meist massiv invasiven Therapie (im Beispiel Hodenkrebs die Entfernung der Hoden und eine dieser Operation meist folgende Chemotherapie) aller schwerwiegenden Erkrankungen für die Behandlungs- und anschließende Lebensqualität an Nutzen bringt und ob sie sogar zu mehr Wirtschaftlichkeit führt, wissen wir nicht. Eine solche konsequente Weiterentwicklung der Zweitmeinungsidee von vornherein als wirkungslos, "Kochbuchmedizin" und "bürokratische Kontrolle" abzulehnen, erscheint nach den Erfahrungen im Bereich der Hodenkrebsbehandlung voreilig. Dies umso mehr, wenn auch Studien über die Verbreitung und Anwendung fachlich anerkannter Behandlungsleitlinien in anderen Krankheitsbereichen erhebliche Defizite offenbaren.
Der "Article in press" "Burden or Relief: Do Second-Opinion Centers Influence the Quality of Care Delivered to Patients with Testicular Germ Cell Cancer?" von Mark Schrader, Lothar Weissbach, Michael Hartmann, Susanne Krege, Peter Albers, Kurt Miller und Axel Heidenreich in der Fachzeitschrift European Urology (doi: 10.1016/j.eururo.2009.10.032) ist bis zur endgültigen Printveröffentlichung kostenlos online erhältlich. Ein Abstract ist jetzt und evtl. später in 2010 auch kostenlos erhältlich.
Über die Annahmen, die Organisation und weitere Ergebnisse des von der urologischen Sektion der "Deutschen Hodentumor Studiengruppe (GTCSG)" getragenen Zweitmeinungsprojekt berichtet eine Projekt-Website.
Bernard Braun, 30.1.10
Gibt es Überversorgung bei Screeningangeboten? Beim "Pap-Test" neigen amerikanische Ärzte sogar gewaltig dazu.
 Ob es nicht bereits bei der ärztlichen Empfehlung eines so genannten "Pap-Testes" Mängel und vor allem medizinisch nicht notwendige Überversorgung gibt, untersuchte eine 2006 und 2007 in den USA bundesweit und repräsentativ durchgeführte Befragungsstudie von 1.212 Gynäkologen, Familienärzten und Internisten, die fast alle angaben, Pap-Tests durchzuführen und auszuwerten.
Ob es nicht bereits bei der ärztlichen Empfehlung eines so genannten "Pap-Testes" Mängel und vor allem medizinisch nicht notwendige Überversorgung gibt, untersuchte eine 2006 und 2007 in den USA bundesweit und repräsentativ durchgeführte Befragungsstudie von 1.212 Gynäkologen, Familienärzten und Internisten, die fast alle angaben, Pap-Tests durchzuführen und auszuwerten.
Der 1928 von dem griechischen Arzt George Papanicolaou entwickelte so genannte Pap-Test entnimmt am Muttermund der Frau einen Abstrich von Zellen. Nach der Einfärbung können damit möglicherweise unerwünschte Zellveränderungen bis hin zum Gebärmutterhalskrebs entdeckt werden. Er ist daher auch fester Bestandteil in Screeningprogrammen zur Früherkennung eines Gebärmutterhalskrebses. Seine Sensivität, d.h. die Wahrscheinlichkeit, mit ihm einen tatsächlich positiven, d. h. in diesem Zusammenhang krankhaften Sachverhalt durch ein positives Testergebnis zu erkennen, beträgt 51%. Seine Spezifität, d.h. die Wahrscheinlichkeit, einen tatsächlich negativen, also gesunden Sachverhalt auch durch ein negatives Testergebnis zu erkennen und nicht fälschlicherweise einen Hinweis auf eine Erkrankung zu erhalten beträgt 98%. Eine 2003 im "British Medical Journal (BMJ)" veröffentlichte Vergleichsstudie des Pap-Tests mit mehreren damals existierenden Alternativverfahren "Cross sectional study of conventional cervical smear, monolayer cytology, and human papillomavirus DNA testing for cervical cancer screening" von Coste et al. belegte seine insgesamt überlegene Qualität.
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) weist aber zur "Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung: Krebsvorstufen rechtzeitig finden und behandeln" und Pap-Test auf seiner Website auf eine zu beachtende Grenze der Aussagefähigkeit der Testergebnisse hin: "Durch diese Abstrichuntersuchung lassen sich auffällig veränderte Zellen des Gebärmutterhalses aufspüren, die sich unter Umständen zu Krebsvorstufen entwickeln können. Manchmal verwenden Gynäkologen für diesen Nachweis auch den Begriff "Krebsabstrich". Dieser ist allerdings irreführend: Ein auffälliger Pap-Befund ist nicht automatisch gleichzusetzen mit einer Krebserkrankung. In den meisten Fällen ist der Befund völlig harmlos und die meisten Veränderungen heilen von alleine wieder ab."
In der aktuell veröffentlichten Studie aus den USA wurde den Ärzten von den ForscherInnen vier hypothetische PatientInnen-Typen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Gesundheit und Screening-Vorgeschichten und -ergebnissen vorgestellt. Die Beispiel-PatientInnen reichten von einer 18-jährigen Frau ohne Sexualerfahrungen bis zu einer 66-jährigen Frau, die vorher keinen Pap-Testbefund hatte und akut an Lungenkrebs erkrankt war. Die befragten Ärzte sollten jeweils ageben, welche Empfehlungen bezüglich eines Pap-Tests sie der Patientin geben würden.
Für alle diese Personen gibt es in den USA seit 2000 revidierte medizinische Leitlinien, die klare Alters- und Gesundheitsindikatoren für den Erhalt oder Nichterhalt eines Pap-Tests formulierten und Überversorgung vermeiden wollten. Nach diesen von den medizinischen Fachgesellschaften "American Cancer Society" und "American College of Obstetricians and Gynecologists" sowie der "U.S. Services Task Force" verfassten und verbreiteten Leitlinien sollten Frauen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten nicht getestet werden und auch erst drei Jahre nach dem ersten Geschlechtsverkehr. Wenn drei Tests keinerlei Befund hatten, sollte bei über 30-Jährigen der Testabstand von einem auf mehr Jahre verlängert werden, um unnötige Ängste und Ausgaben zu vermeiden. Der Abstand kann bei Frauen über 60 Jahren noch länger werden, wenn dreimal kein Befund vorlag oder die Frau an einer lebensgefährlichen anderen Erkrankung leidet.
Nach einem Vergleich der von den Ärzten jeweils gemachten Empfehlungen an die hypothetischen Frauen mit diesen Leitlinien, ergab sich folgendes Bild:
• 22% aller Ärzte folgten bei allen vier Szenarien den Leitlinienempfehlungen.
• 50% der Ärzte hätten der 18-jährigen "Jungfrau" einen nicht durch Leitlinien begründeten Pap-Test empfohlen.
• Mehr als 40% der Ärzte hätten der 66-jährigen Lungenkrebspatientin, die vorher dreimal keinen Befund hatte, einen Pap-Test empfohlen und dann auch noch jährlich.
• 27% der Internisten folgten durchweg den Leitlinien. Dies machten auch noch 21% der Familien- und Allgemeinärzte aber lediglich 16% der Gynäkologen.
• Schließlich waren Ärzte, die jünger als 40 Jahre alt, zertifiziert und in einer größeren multidisziplinären Gruppenpraxis tätig waren, leitliniengetreuer als die jeweilige Vergleichsgruppe.
Über die Gründe dieser enormen Überversorgung eines Tests konnten die ForscherInnen relativ wenig sagen, wiesen aber auf den möglichen finanziellen Nutzen für die untersuchenden Ärzte und die Verwirrung von Ärzten hin, wenn Empfehlungen geändert würden.
Wem das Ergebnis nicht passt, kann gegen die Studie zusammen mit ihren VerfasserInnen einwenden, sie habe nur Hypothetisches erfasst, d.h. was die Ärzte tun würden und nicht wie sie ihre PatientInnen tatsächlich screenen. Dies zusätzlich zu untersuchen, erscheint möglich und machbar.
Von der Studie "Specialty Differences in Primary Care Physician Reports of Papanicolaou Test Screening Practices: A National Survey, 2006 to 2007" von Yabroff et al., die in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (November 3, 2009 vol. 151 no. 9 602-611) erschienen ist, gibt es kostenlos lediglich das Abstract. Dies gilt auch für das ebenfalls verfügbare und prinzipiell begrüßenswerte und zur Nachahmung empfohlene Summary for patients".
Bernard Braun, 8.11.09
Brustkrebs-Früherkennung durch Mammographie: Ein Drittel aller Karzinome ist harmlos und überdiagnostiziert
 Etwa jedes dritte Brustkrebs-Karzinom, das bei bevölkerungsweiten Screenings mithilfe der Mammographie entdeckt wird, ist nach Befunden einer Studie, die jetzt im British Medical Journal veröffentlicht wurde, überdiagnostiziert. Solche Tumore wachsen entweder nur sehr langsam oder sie bilden sich auch spontan zurück, so dass sie in keinem Falle gefährliche oder lebensbedrohliche Formen einnehmen. Die Patientinnen würden in diesem Falle an anderen Ursachen sterben. Ein Problem ist allerdings, dass die Medizin bis heute noch nicht vorhersagen kann, welche Tumore harmlos bleiben und welche sich zu einem tödlichen Risiko entwickeln. Von daher werden alle diagnostizierten Brustkrebs-Tumore medizinisch behandelt - mit der Folge einer Überdiagnostik und Überversorgung.
Etwa jedes dritte Brustkrebs-Karzinom, das bei bevölkerungsweiten Screenings mithilfe der Mammographie entdeckt wird, ist nach Befunden einer Studie, die jetzt im British Medical Journal veröffentlicht wurde, überdiagnostiziert. Solche Tumore wachsen entweder nur sehr langsam oder sie bilden sich auch spontan zurück, so dass sie in keinem Falle gefährliche oder lebensbedrohliche Formen einnehmen. Die Patientinnen würden in diesem Falle an anderen Ursachen sterben. Ein Problem ist allerdings, dass die Medizin bis heute noch nicht vorhersagen kann, welche Tumore harmlos bleiben und welche sich zu einem tödlichen Risiko entwickeln. Von daher werden alle diagnostizierten Brustkrebs-Tumore medizinisch behandelt - mit der Folge einer Überdiagnostik und Überversorgung.
Um das Ausmaß dieser Überversorgung zu erkennen, analysierten Karsten Jřrgensen und Peter Gřtzsche vom "Nordic Cochrane Centre" die Inzidenzraten (Häufigkeit neu auftretender Fälle) von Brustkrebs vor und nach der Einführung bevölkerungsweiter Screening-Programme in fünf Ländern: United Kingdom, Kanada, Australien, Schweden und Norwegen. Um Verzerrungen bei den Daten zu vermeiden, schlossen sie Zeiträume von zumindest sieben Jahren vor und nach der Einführung des Screenings ein. Überdies analysierten sie die Ergebnisse von Gruppen mit und ohne Mammographie und unterteilten diese auch in Altersgruppen. Auch andere Einflussfaktoren wurden berücksichtigt, so unter anderem sinkende Brustkrebsquoten bei älteren, schon gescreenten Frauen.
Heraus kam bei den Analysen eine Zunahme der Inzidenzquoten, die eng zusammenhing mit der Einführung des Screening. Dieser Befund ist jedoch zu erwarten, denn neben den klinisch relevanten werden auch kleinere Tumore entdeckt. Einige Jahre später sollte die Inzidenz jedoch wieder auf das ursprüngliche Niveau aus dem Zeitraum vor Einführung des Screenings zurückgehen. Dies jedoch war in keinem der untersuchten fünf Länder der Fall. Die Wissenschaftler schätzten dann das Ausmaß der Überdiagnostik folgendermaßen ein: United Kingdom etwa 57%, Manitoba (Kanada) 59%, New South Wales 53%, Schweden 46%, Norwegen 52%. Insgesamt schätzen sie die Überdiagnostik auf 52%. Dies schließt sog. Carcinome in-situ mit ein (eine Krebs-Vorstufe), die üblicherweise medizinisch auch behandelt werde. Für gravierende Krebsformen schätzten sie die Überdiagnostik auf 35%.
Diese Befunde, so schreibt Prof. H. Gilbert Welch in einem Editorial des British Medical Journal, stimmen überein mit einer wachsenden Evidenz aus vielen anderen Studien, die darauf hinweisen, dass die Einführung des Brustkrebs-Screening mit Mammographie eine gravierende Überdiagnostik bewirkt. Ohne Zweifel würde das Screening vielen Frauen helfen, bei anderen aber auch schwere Schäden im Gefolge der Therapie verursachen. Es gibt daher keine objektiv richtige Antwort auf die Frage: Zur Früherkennung gehen oder nicht? Dies sei eine persönliche Entscheidung jeder Frau. Allerdings müsse man diese besser informieren und ihnen auch quantitativ deutlich machen, welche Nutzen und welche Risiken sich aus der Früherkennungs-Untersuchung für sie ergeben.
• PDF der Studie: Karsten Juhl Jřrgensen, Peter C Gřtzsche: Overdiagnosis in publicly organised mammography screening programmes: systematic review of incidence trends
(BMJ 2009;339:b2587; doi:10.1136/bmj.b2587)
• Abstract der Studie
• Editorial von H Gilbert Welch: Overdiagnosis and mammography screening
Gerd Marstedt, 10.8.09
Schweiz: Nur 50% der Ärzte ist vom Nutzen des PSA-Tests überzeugt, aber 75% empfehlen ihn aus juristischen Erwägungen
 In einer Befragung Schweizer Allgemeinärzte und Internisten wurde deutlich, dass nur jeder zweite Arzt vom Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs überzeugt ist und davon, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Zugleich erklären jedoch drei von vier Befragungsteilnehmern, dass sie den Test den Älteren unter ihren Patienten empfehlen. Der Grund dafür ist nach Meinung der Forscher, deren Studie jetzt in der Zeitschrift "Journal of Evaluation in Clinical Practice" veröffentlicht wurde, nicht in finanziellen Anreizen zu sehen, sondern im Sicherheitsdenken der Ärzte. Solche Befürchtungen zukünftiger Klagen wegen eines Kunstfehlers, falls ein Patient später an Prostatakrebs erkrankt und der PSA-Test unterblieben ist, sind zwar extrem unwahrscheinlich, gleichwohl geben viele der Befragten an, sie würden den PSA-Test auch aus Gründen der juristischen Absicherung gegen spätere Klagen empfehlen.
In einer Befragung Schweizer Allgemeinärzte und Internisten wurde deutlich, dass nur jeder zweite Arzt vom Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs überzeugt ist und davon, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Zugleich erklären jedoch drei von vier Befragungsteilnehmern, dass sie den Test den Älteren unter ihren Patienten empfehlen. Der Grund dafür ist nach Meinung der Forscher, deren Studie jetzt in der Zeitschrift "Journal of Evaluation in Clinical Practice" veröffentlicht wurde, nicht in finanziellen Anreizen zu sehen, sondern im Sicherheitsdenken der Ärzte. Solche Befürchtungen zukünftiger Klagen wegen eines Kunstfehlers, falls ein Patient später an Prostatakrebs erkrankt und der PSA-Test unterblieben ist, sind zwar extrem unwahrscheinlich, gleichwohl geben viele der Befragten an, sie würden den PSA-Test auch aus Gründen der juristischen Absicherung gegen spätere Klagen empfehlen.
Dass die Risiken des PSA-Tests aufgrund von Biopsien und Nebenwirkungen therapeutischer Eingriffe (wie Impotenz, Inkontinenz) den Nutzen überwiegen, haben erst vor kurzem wieder Studien gezeigt (vgl. Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet). Gleichwohl ist die Empfehlungsquote für die Durchführung des PSA-Tests in den USA extrem hoch. Im Deutschen Ärzteblatt heißt es: "Die meisten Männer lassen dort ab dem 50. Lebensjahr jährlich einen PSA-Test durchführen. Auch 95 Prozent der Urologen sowie 78 Prozent der Allgemeinärzte lassen sich selbst testen, was belegt, dass sie vom Nutzen überzeugt sind - im Gegensatz zu den Fachgesellschaften." (vgl.: Prostatakarzinom: Studien bestätigen Zweifel am PSA-Test) Allerdings könnte es auch sein, dass nicht nur die Überzeugung der US-Ärzte maßgeblich ist für die große Verbreitung dort, sondern auch die größere Rechtsunsicherheit der Ärzte.
Im Jahre 1999 war es, als der US-amerikanische Familien-Arzt Dr. Daniel Merenstein, der gerade eine längere Weiterbildung in Evidence-Based Medicine machte, einen 53jährigen gesunden Patienten in die Klinik bekam, der sich nach Prostatakrebs und dem PSA-Test erkundigte. Merenstein erzählte ihm, was er in der Fortbildung gelernt hatte: Dass die Risiken des Tests hoch seien, der Nutzen durch Früherkennung vergleichsweise gering. So kam es, dass der Test nicht durchgeführt wurde. Leider erkrankte der Patient einige Jahre später unheilbar an Prostatakrebs und verklagte seinen Arzt. Dieser wurde in einem Zivilprozess zwar freigesprochen, die Fortbildungseinrichtung jedoch zu Schadensersatz in Höhe von 1 Million Dollar verurteilt.
Gedanken an solche Folgen ärztlicher Unterlassungen spielen vermutlich bei vielen Medizinern in den USA eine große Rolle, wenn sie den PSA-Test empfehlen. Dass sie auch bei Schweizer oder deutschen Ärzten maßgeblich sein könnten, erscheint jedoch wenig plausibel. Denn der Test ist keineswegs in einem solchen Maße wissenschaftlich anerkannt, dass das Unterlassen der Durchführung (außer bei Verdachtsmomenten auf eine Prostata-Erkrankung) als "Kunstfehler" gelten könnte. Gleichwohl ist dies bei vielen Ärzten der Fall, wie einer Schweizer Studie jetzt gezeigt hat. Befragt wurden dort 245 Allgemeinärzte und Internisten, die an einer beruflichen Fortbildung in der deutschsprachigen Schweiz teilnahmen. Das Durchschnittsalter war 52 Jahre, drei Viertel waren männlich, 68% Allgemeinärzte, 32% Fachärzte für Innere Medizin. In der Befragung wurde deutlich:
• Nur 56% der Allgemeinärzte und 53% der Fachärzte für Innere Medizin waren der Meinung, der PSA-Test sei zur Früherkennung nützlich und sein Nutzen würde die Risiken übersteigen.
• Gleichwohl gaben in beiden Gruppen jeweils 75% an, sie würden den Test Männern ab 50 regelmäßig empfehlen.
• 41% der Allgemeinärzte und 43% der Internisten nannten als Grund dafür juristische Überlegungen.
Ein Abstract der Studie ist hier verfügbar: Johan Steurer u.a.: Legal concerns trigger prostate-specific antigen testing (Journal of Evaluation in Clinical Practice, Volume 15 Issue 2, Pages 390 - 392, Published Online: 19 Mar 2009)
Dass der PSA-Test in Deutschland zwar nicht so häufig wie in den USA eingesetzt wird, trotzdem aber für ältere Männer fast schon eine standardmäßig durchgeführte Früherkennungsuntersuchung ist, hat unlängst eine deutsche Studie gezeigt. Dort heißt es in der Zusammenfassung: "In der vorliegenden Analyse werden Einflussfaktoren auf die Inanspruchnahme der Prostatakarzinom-Früherkennung (Prostata-KFU) in Deutschland untersucht. Eine repräsentative Stichprobe von 10659 Männer im Alter von 45 - 70 Jahren (M = 55.2) wurde nach ihrer Prostata-KFU-Inanspruchnahme befragt. (...) Zwei Drittel der Stichprobe gibt an, mindestens ein Mal eine DRU erhalten zu haben, knapp die Hälfte der Männer (48 %) hat bereits einen PSA-Test durchführen lassen. Die Anzahl der Männer, die regelmäßig an einer Prostata-KFU teilnehmen, ist deutlich geringer (44 % DRU, 33 % PSA)." (DRU = digital rektale Untersuchung, ein Abtasten des hinteren Dickdarms und der angrenzenden Organemit dem Finger)
Quelle: M. Sieverding u.a.: Prostatakarzinomfrüherkennung in Deutschland. Untersuchung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe, Der Urologe, Volume 47, Number 9 / September 2008
• Abstract
• PDF Volltext
Die Aufklärung von Patienten über Nutzen und Risiken des PSA-Tests war nach einem Experiment der Stiftung Warentest im Jahre 2003 überaus unbefriedigend. Von den 135 Berliner Urologen wurden 20 ausgewählt und im September und Oktober 2003 von einem 60-jährigen Probanden besucht, mit dem Wunsch, sich zum PSA-Test auf Prostatakrebs beraten zu lassen. Ergebnis: "Einige Urologen informierten den Patienten ausführlich und richtig über den PSA-Test. Doch die meisten Ärzte erläuterten die Problematik nur lückenhaft und einige sogar falsch. Kein einziger der besuchten Fachärzte sprach die in der wissenschaftlichen Leitlinie der urologischen Fachgesellschaften genannten Beratungsinhalte von sich aus an. Sie informierten nur ganz allgemein über den Eiweißstoff PSA, den Normalwert und den Sinn eines Tests. (…) Die getesteten Ärzte lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. Etwa ein Drittel der Urologen war mit "evidenzbasierter Medizin" vertraut - sie machten also die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zur Grundlage ihrer Beratung. Rund zwei Drittel von ihnen, die zweite Gruppe, hatte aber offenbar kein gesichertes Wissen über den Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen. Ihren Äußerungen zufolge glaubten sie daran, dass eine früh erkannte Erkrankung grundsätzlich die Heilungschancen verbessere." Gesamt-Ergebnis: 2mal sehr gut, 4mal befriedigend, 7mal ausreichend, 7mal mangelhaft
Quelle: Früherkennung. Folge 1. Dilemma. Urologen im Test. Zeitschrift test, 2/2004, S. 86-89
• PDF zum kostenlosen Download
• WWW-Seite
Gerd Marstedt, 23.3.09
"Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches.
 Der Kommentar des Bostoner Arztes Michael J. Barry zu den zusammen gerade im angesehenen "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Zwischenergebnissen zweier randomisierter kontrollierter Studien über den Nutzen der systematischen Bestimmung des PSA-Wertes (gemessen wird dabei ein prostataspezifisches Antigen) zur frühzeitigen Entdeckung von Prostatakrebs und der damit erhofften Senkung der spezifischen Sterberate, bringt das Dilemma und einen Teil der Lösung für die Leser beider Studien auf den Punkt: Die lange erwarteten Ergebnisse widersprechen sich diametral.
Der Kommentar des Bostoner Arztes Michael J. Barry zu den zusammen gerade im angesehenen "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Zwischenergebnissen zweier randomisierter kontrollierter Studien über den Nutzen der systematischen Bestimmung des PSA-Wertes (gemessen wird dabei ein prostataspezifisches Antigen) zur frühzeitigen Entdeckung von Prostatakrebs und der damit erhofften Senkung der spezifischen Sterberate, bringt das Dilemma und einen Teil der Lösung für die Leser beider Studien auf den Punkt: Die lange erwarteten Ergebnisse widersprechen sich diametral.
In der Interventionsgruppe der zwischen 1993 und 2001 laufenden "U.S. Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO)" mit 73.693 teilnehmenden Männern war die Prostatakrebs-Sterberate mit rund 2 Toten pro 10.000 Personenjahren insgesamt sehr niedrig. Vor allem aber unterschied sich die Sterberate der Screeningteilnehmer (n=38.343) nicht signifikant von der der Teilnehmer in der Kontrollgruppe (n=38.350). Unerwartet lag dann schließlich die Sterberate in der Interventionsgruppe mit 2 Toten über (!!) der von 1,7 Toten pro 10.00 Personenjahre (Rate 1,13) in der Kontrollgruppe, der Unterschied war aber nicht signifikant. Die Inzidenz von Prostatakrebs betrug in der Screeninggruppe 116 Erkrankte pro 10.000 Personenjahre und 95/10.0000 Personenjahre in der Kontrollgruppe (Rate=1,22). Der PSA-Test erhöht zwar die Anzahl der entdeckten Prostatakarzinome erhöht, erfüllt aber seinen insbesondere in Deutschland (interessanterweise beurteilen die us-amerikanischen Urologen das PSA-Screening viel zurückhaltender) propagierten Zweck, die Sterblichkeit zu senken, nicht.
Was die Ergebnisse etwas verwässert ist der Fakt, dass anders als in anderen klinischen Studien sich auch etwa die Hälfte der Kontrollgruppe ihren PSA-Wert bestimmen (Anstieg von 40 % auf 52 % im sechsten Studienjahr) und sich auch digital-rektal untersuchen (Anstieg von 41% auf 46 %) ließ. Trotzdem lag dieser Anteil in der Interventionsgruppe deutlich höher; nämlich bei 85 % für den PSA-Test und 86 % für die rektale Untersuchung. Dies Teilnehmer der Interventionsgruppe nahmen innerhalb der vergleichsweise langen Untersuchungsdauer von 7 bis 10 Jahren regelmäßig an einem PSA-Screening (jährlich über 6 Jahre) teil oder ließen eine digital-rektale Untersuchung (jährlich für vier Jahre) durchführen.
Die Ergebnisse der "European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC)" unterscheiden sich inhaltlich beträchtlich von denen der US-Studie. Ihre 162.243 Teilnehmer zwischen 50 und 74 Jahren aus sieben europäischen Ländern (ohne deutsche Teilnehmer) wurden in der Interventionsgruppe alle vier Jahre PSA-gescreent. Letztendlich akzeptierten 82 % der Männer dieses Angebot. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe nahmen keine Screeningleistung in Anspruch.
Die auch hier untersuchte Prostatakrebs-Sterberate sah deutlich anders aus als in den USA: Bei den Interventionsteilnehmern lag sie 20 % niedriger als bei den Kontrollgruppenteilnehmern (p = 0,04). Das Screening führt nach Meinung der Studienautoren dazu, dass nach 9 Jahren Laufdauer sieben Männer pro 10.000 Männer weniger starben als ohne PSA-Bestimmung mit anschließender Intervention. Um einen Todesfall zu verhindern, müssen mehr als 1.400 Männern ein PSA-Screening durchlaufen ("number to treat" oder "number to test"), und es müssen zusätzlich 48 Männer zum Teil aufwändig behandelt werden. Um den Nutzen erreichen zu können, muss man nach Meinung des bereits zitierten ärztlichen Kommentators also viel oder auch zu viel an Diagnostik und Therapie in Kauf nehmen. Dies bedeutet nicht nur einen finanziellen Mehraufwand, sondern birgt auch unterschiedliche Risiken in sich. Dies gilt etwa für die 17.000 Biopsien, die bei 73.000 Männern in der ERSPC-Studie gemacht wurden. Die WissenschaftlerInnen der europäischen Studie nennen selber im Abstract ihres Aufsatzes das Problem des "high risk of overdiagnosis" durch das PSA-Screening und mögliche Folgeaktivitäten.
Zumindest aktuell können keine offensichtlichen methodischen Schwächen einer der beiden Studien als Erklärung für ihren Kardinalunterschied und als Entscheidungsfaktor herangezogen werden.
Daraus folgt praktisch zweierlei:
• Der potenzielle Schaden durch zu umfassende und nicht notwendige Diagnostik oder Therapie muss gründlich gegen den Nutzen abgewogen werden.
• Zum anderen muss künftig aber noch mehr das berücksichtigt werden, was Barry für den Behandlungsalltag erneut nachdrücklich empfiehlt: "As a result, a shared decision-making approach to PSA screening, as recommended by most guidelines, seems more appropriate than ever." Dass dabei möglicherweise territoriale Präferenzen die entscheidende Rolle spielt ist unbefriedigend, aber immer noch besser als wenn behandelnde Urologen allein die europäischen Ergebnissen an ihre Patienten vermitteln würden.
Alle Beteiligten und Betroffenen bekommen aber evtl. durch zwei weitere, nicht abgeschlossene Studien, der "Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT)" in den USA und dem Projekt "Prostate Testing for Cancer and Treatment (PROTECT)" in Großbritannien einhelligere Entscheidungsdaten oder aber noch mehr Widersprüchliches. Die Diskussion um Sinn und Unsinn des PSA-Screenings bezogen auf die Sterblichkeit an Prostatakrebs dürfte deshalb noch einige Jahre anhalten.
Der Aufsatz "Mortality Results from a Randomized Prostate-Cancer Screening Trial" von Gerald L. Andriole und zahlreichen weiteren Mitgliedern des PLCO Projektteams ist im NEJM vom 18. März 2009 erschienen und als zehnseitige PDF-Datei kostenlos erhältlich.
Den Aufsatz "Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study" von Fritz H. Schröder et al. erhältlich man ebenfalls komplett kostenlos.
Der Kommentar von Michael J. Barry "Screening for Prostate Cancer — The Controversy That Refuses to Die" in der Ausgabe des NEJM vom 18. März 2009 ist als vierseitige PDF-Datei komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.09
Vitamine C und E, Selen und vermutlich viele antioxidative Stoffe ohne präventive Wirkung bei Prostatakrebs. PSA-Testprobleme!
 Männer, die Sorge haben, an einer der häufigsten Krebsarten bei Männern, dem Prostatakrebs zu erkranken und glauben, eine drohende Erkrankung durch den so genannten PSA-Test frühstmöglich entdecken zu können oder gar aktiv etwas mit Nahrungsergänzungsmitteln tun zu können, um ihr Risiko zu vermindern, haben es in diesen Tagen schwer. Unabhängig von den Details dreier dafür verantwortlichen Studien zeigen sich bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Dilemmata seriöser Versorgungsforschung.
Männer, die Sorge haben, an einer der häufigsten Krebsarten bei Männern, dem Prostatakrebs zu erkranken und glauben, eine drohende Erkrankung durch den so genannten PSA-Test frühstmöglich entdecken zu können oder gar aktiv etwas mit Nahrungsergänzungsmitteln tun zu können, um ihr Risiko zu vermindern, haben es in diesen Tagen schwer. Unabhängig von den Details dreier dafür verantwortlichen Studien zeigen sich bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Dilemmata seriöser Versorgungsforschung.
Zum einen geht es um die seit einiger Zeit in die Öffentlichkeit gelangenden Ergebnisse der zur Zeit weltweit größten Prostatakrebs-Studie "SELECT" (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), an der in den USA, Puerto Rico und Kanada 35.534 55-jährige und ältere Männer (unter den rund 15 % der Gruppe umfassenden afroamerikanischen Teilnehmern waren auch schon 50-Jährige, da das Prostatarisiko in dieser Subgruppe früher und häufiger auftritt) teilnehmen. Ausgangspunkt der Studie und daher auch der Namensgeber und die Ausgangspunkte für das Akronym, waren zwei Studien aus 1998 und 1996, die zeigten, dass mit der gezielten Ein- oder Aufnahme der beiden Ernährungsergänzungsmittel Selen und Vitamin E das Risiko, an Prostatkrebs zu erkranken um bis zu 32 oder gar sagenhafte 52 % Prozent gesenkt werden konnte.
Diese Ergebnisse wurden so ernst genommen, dass sie in einer seit 2001 wesentlich größeren und gezielt (in der 1998 in Finnland durchgeführten Studie bei 29.133 männlichen Rauchern sollte eigentlich nach der Präventivkraft von Vitamin E gegen Lungenkrebs geforscht werden; heraus kam u.a. die 32%-Reduktion von Prostatakrebs) gebildeten Studiengruppe und mit besserer Methodik im Rahmen der SELECT-Studie überprüft werden sollten. Diese Studie ist im Wesentlichen vom National Cancer Institute (NCI), einem der U.S. National Institutes of Health finanziert und wird von der international vernetzten Forschungsgruppe Southwest Oncology Group (SWOG) durchgeführt.
Das erste (Zwischen-)Ergebnis der Wirkungskontrolle der beiden einzeln oder kombiniert aufgenommenen Stoffe gegen verschiedene Placebogruppen gleicht daher einer sehr harten Landung auf dem Boden der Wirklichkeit. Es lautet: Für keinen der Stoffe gibt es im Vergleich mit Placebos einen nachweisbaren bzw. statistisch signifikanten Nutzen. Da es zusätzlich statistisch ebenfalls nicht signifikante Hinweise auf möglicherweise unerwünschte Effekte gibt, empfehlen die SELECT-Verantwortlichen ihren Teilnehmern, künftig auf den systematischen Verzehr dieser Stoffe zu verzichten. Zu den allerdings bisher durchweg nicht statistisch signifikanten unerwünschten Wirkungen zählt eine leichte Erhöhung des Prostatakrebsrisikos bei den Personen, die ausschließlich Vitamin E einnahmen und eine ebenfalls leichte Erhöhung eines neu auftretenden Diabetesrisikos in der nur Selen einnehmenden Teilnehmergruppe.
Die Wissenschaftler versandten darauf deutlich vor dem geplanten Ende der Studie eine schriftliche Mitteilung an die Studienteilnehmer, in der sie diese Ergebnisse erläuterten, ihnen rieten die Einnahme von Selen und Vitamin E zu stoppen und ihnen trotzdem die Teilnahme an weiteren Prostatauntersuchungen und PSA-Tests anboten.
Einer der Studienleiter, Eric Klein, fasste den nunmehr neu fokussierten Nutzen des Fortgangs der Studie so zusammen: "As we continue to monitor the health of these 35.000 men, this information may help us understand why two nutrients that showed strong initial evidence to be able to prevent prostate cancer did not do so."
In zwei großen peer-reviewten Publikationen in der neuesten Ausgabe des Medizinjournals JAMA vom 9. Dezember 2008 werden diese Ergebnisse zum einen voll bestätigt und inhaltlich noch beträchtlich erweitert.
Das kostenlos erhältliche Abstract des Aufsatzes "Effect of Selenium and Vitamin E on Risk of Prostate Cancer and Other Cancers: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)" von Scott M. Lippman; Eric A. Klein; Phyllis J. Goodman; M. Scott Lucia; Ian M. Thompson; Leslie G. Ford; Howard L. Parnes; Lori M. Minasian; J. Michael Gaziano; Jo Ann Hartline; J. Kellogg Parsons; James D. Bearden III; E. David Crawford; Gary E. Goodman; Jaime Claudio; Eric Winquist; Elise D. Cook; Daniel D. Karp; Philip Walther; Michael M. Lieber; Alan R. Kristal; Amy K. Darke; Kathryn B. Arnold; Patricia A. Ganz; Regina M. Santella; Demetrius Albanes; Philip R. Taylor; Jeffrey L. Probstfield; T. J. Jagpal; John J. Crowley; Frank L. Meyskens Jr; Laurence H. Baker und Charles A. Coltman Jr. endet eindeutig: "Selenium or vitamin E, alone or in combination at the doses and formulations used, did not prevent prostate cancer in this population of relatively healthy men."
Zusätzlich zum Ende eines vermuteteten Nutzens von Selen und Vitamin E erweisen sich aber auch weitere antioxidative und damit als präventiv wirkend anmutende und beworbene Vitamine als nutzlos für die Prävention von Prostatakrebs. Dies ist jedenfalls das ebenso klare wie eindeutige Ergebnisse einer Untersuchung im Rahmen einer der großen Mänbnergesundheitsuntersuchungen in den USA, der Phycisian Health Study II" zur präventiven Wirkung der Vitamine E und C.
Die Schlussfolgerung des ebenfalls kostenlosen Abstracts zum Aufsatz "Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total Cancer in Men: The Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial" von J. Michael Gaziano; Robert J. Glynn; William G. Christen; Tobias Kurth; Charlene Belanger; Jean MacFadyen; Vadim Bubes; JoAnn E. Manson; Howard D. Sesso und Julie E. Buring lautet unmissverständlich: "In this large, long-term trial of male physicians, neither vitamin E nor C supplementation reduced the risk of prostate or total cancer. These data provide no support for the use of these supplements for the prevention of cancer in middle-aged and older men."
In einem Kommentat der JAMA-Herausgeber heißt es zusammenfassend daher auch "physicians should not recommend selenium or vitamin E — or any other antioxidant supplements — to their patients for preventing prostate cancer."
Da in der Frühdiagnose der gut- oder bösartigen Veränderungen von Prostatakrebs die Messung des PSA-Wertes (Prostate specific antigen) eine große Rolle spielt und ein Screening mit dieser Messung immer wieder gefordert wird, sind die im Oktober 2008 im "Journal of the National Cancer Institute" der USA veröffentlichten Ergebnissen einer Beobachtungsstudie über die Effekte der Einnahme von Statinen auf die PSA-Werte geeignet, die auch schon zuvor im Forum-Gesundheitspolitik dokumentierten Zweifel an der Aussagefähigkeit und Sicherheit des PSA-Tests noch mehr zu schüren und entsprechende Verhaltensunsicherheiten zu fördern.
In dieser Studie wurden die PSA-Werte von rund 1.214 Männern, die alle in einem Gesundheitszentrum der Veteranen-Krankenversicherung in North Carolina behandelt wurden, und eine gesunde Prostata hatten, in den zwei Jahren vor der Verordnung von Statinen und ein Jahr nach nach dem Beginn der Einnahme dieses omnipotenten Wirkstoffs zur Reduktion von Herzkreiserkrankungen, Schlaganfällen, Lungenentzündungen, Thrombosen und Alzheimer ("the world's top-selling drugs") gemessen. Der PSA-Wert sank nach Beginn der Statineinnahme um rund 4%. Bevor nun Statine zum neuesten Wundermittel auch gegen das Risiko von Prostatakrebs erkoren werden, wiesen die Forscher darauf hin, dass ihr Ergebnis nicht kläre, ob Statine eine präventive oder therapeutische Wirkung auf dieses Risiko besäßen oder nur einfach auf unbekannte aber folgenreiche Weise den PSA-Wert beeinflussten.
Eines der mit diesem Ergebnis verbundenen praktischen Risiken fasste einer der Wissenschaftler so zusammen: "In a good proportion of these men, the PSA levels declined sufficiently to a point where physicians might not recommend a biopsy (dient zur Bestätigung des durch den PSA-Wert indizierten Krebsverdachts), so it's really important that we understand what's at work here, so we can be sure we're not missing cancers because of deceptively low PSA levels."
Erst eine randomisierte kontrollierte Studie mit histologischen Endpunkten könne klären, welche Zusammenhänge wirklich bestünden. Trotzdem müssen sich Männer, die Statine einnehmen und gleichzeitig einen PSA-Test durchführen fragen, was ihnen und ihrem behandelnden Arzt ein bestimmter PSA-Wert nun wirklich zu ihrem Prostatakrebsrisiko sagen.
Ausführliche Fragen und Antworten zur SELECT-Studie gibt es kostenlos auf der Projekt-Homepage.
Die aktuellen Ergebnisse der Studie finden sich in der NCI-Meldung "Review of Prostate Cancer Prevention Study Shows No Benefit for Use of Selenium and Vitamin E Supplements", die kostenfrei erhältlich ist.
Eine komplette Version des 13-Seiten-JAMA-Aufsatzes "Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total Cancer in Men. The Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial ist auch kostenlos erhältlich.
Die komplette Version des 14-seitigen JAMA-Aufsatzes "Effect of Selenium and Vitamin E on Risk of Prostate Cancer and Other Cancers. The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)" ist genauso wie das umfangreiche Editorial "Randomized Trials of Antioxidant Supplementation for Cancer Prevention First Bias, Now Chance—Next, Cause" zu den beiden Aufsätzen kostenlos zu erhalten
Über die ungeklärten Effekte der Einnahme von Statinen auf den Prostatakrebs-Risikowert PSA gibt es kostenfrei lediglich ein Abstract des Aufsatzes von Robert J. Hamilton, Kenneth C. Goldberg, Elizabeth A. Platz und Stephen J. Freedland The Influence of Statin Medications on Prostate-specific Antigen Levels im "Journal of the National Cancer Institute"
Bernard Braun, 10.12.08
Psychotherapeutische Hilfe nach Brustkrebs verbessert den Therapie-Erfolg und senkt sogar die Mortalität
 Hilft Psychotherapie auch bei der Bewältigung schwerwiegender Erkrankungen wie Brustkrebs? Und macht sich dies nicht nur bemerkbar in einem ausgeglicheneren, weniger angstbesetzten Lebensgefühl, sondern darüber hinaus auch in der Überlebensrate? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam der Ohio State University jetzt in einer randomisierten Studie nachgegangen, einer Studie also mit zufälliger Zuweisung der Teilnehmer entweder zur Psychotherapie-Gruppe oder zu einer Kontrollgruppe, in der nur der körperliche und seelische Gesundheitszustand überprüft wurde. Für ihre Hypothese, dass Psychotherapie tatsächlich hilft, fanden die Wissenschaftler überraschend deutliche Belege: In der Gruppe mit Therapie war sogar die Sterblichkeit erheblich niedriger, nämlich nur etwa halb so groß.
Hilft Psychotherapie auch bei der Bewältigung schwerwiegender Erkrankungen wie Brustkrebs? Und macht sich dies nicht nur bemerkbar in einem ausgeglicheneren, weniger angstbesetzten Lebensgefühl, sondern darüber hinaus auch in der Überlebensrate? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam der Ohio State University jetzt in einer randomisierten Studie nachgegangen, einer Studie also mit zufälliger Zuweisung der Teilnehmer entweder zur Psychotherapie-Gruppe oder zu einer Kontrollgruppe, in der nur der körperliche und seelische Gesundheitszustand überprüft wurde. Für ihre Hypothese, dass Psychotherapie tatsächlich hilft, fanden die Wissenschaftler überraschend deutliche Belege: In der Gruppe mit Therapie war sogar die Sterblichkeit erheblich niedriger, nämlich nur etwa halb so groß.
227 Patientinnen, die wegen der Diagnose von Brustkrebs (Mammakarzinom im Stadium II oder III) in medizinischer Behandlung waren, nahmen an der jetzt in der Zeitschrift "Cancer" online vorab veröffentlichten Studie teil. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip einer von zwei Gruppen zugeteilt: In einer Gruppe wurde lediglich der Gesundheitszustand regelmäßig überprüft, die Teilnehmer der anderen Gruppe erlernten unter psychologischer Anleitung Entspannungsübungen zur Stressbewältigung und Verbesserung des emotionalen Befindens. Diese Gruppensitzungen mit jeweils 8-12 Teilnehmerinnen fanden anfänglich einmal pro Woche statt und später dann nach etwa vier Monaten einmal im Monat. Neben den Entspannungsübungen bekamen die Frauen auch Tipps zu Sport und gesunder Ernährung und sie konnten den Psychologen bei Ängsten oder Sorgen im sozialen Umfeld oder bei körperlichen Beeinträchtigungen ansprechen.
Über einen Zeitraum von durchschnittlich 11 Jahren wurde dann der Werdegang aller Teilnehmerinnen verfolgt. Als Ergebnis zeigte sich:
• Bei 62 Frauen (29%) zeigten sich Rezidive, also wieder zurückkehrende Tumore, und 54 Frauen verstarben im Beobachtungszeitraum.
• Durch die psychotherapeutische Hilfe wurde einerseits die Quote der Rezidive gesenkt, sie war in der Therapiegruppe nur etwa halb so groß (Hazard Ratio HR 0,55).
• Darüber hinaus war sogar das Sterberisiko durch Brustkrebs deutlich niedriger, es war nicht einmal halb so groß wie in der Kontrollgruppe (HR 0,44)
• und auch die Gesamtsterblichkeit war nur halb so hoch wie in der Vergleichsgruppe (HR 0,51).
• Wiederkehrende Tumore traten bei den Teilnehmerinnen an Psychotherapie-Gruppen durchschnittlich 6 Monate später auf, wodurch sich die Überlebenszeit dieser Frauen von durchschnittlich 4,8 auf 6,1 Jahre verlängert.
Die Wissenschaftler weisen in der Diskussion ihrer Befunde darauf hin, dass eine unlängst veröffentlichte Meta-Analyse heraus fand, dass psychologischer Stress (etwa durch Ängste) bei Krebserkrankungen zu kürzeren Überlebensraten und höheren Mortalitätsraten führt (vgl.: Do stress-related psychological factors contribute to cancer incidence and survival? Nature Clinical Practice Oncology 2008; 5: 466-475) Offensichtlich ist es auch möglich, durch Psychotherapie das Stress-Niveau zu senken und damit einen positiveren Verlauf der Krebserkrankung zu bewirken.
Hier ist ein Abstract: Barbara L. Andersen u.a.: Psychologic intervention improves survival for breast cancer patients. A randomized clinical trial (Cancer, Published Online: 17 Nov 2008, doi: 10.1002/cncr.23969)
Gerd Marstedt, 20.11.08
USA: Ethnische Ungleichheiten in der Versorgungsplanung von Krebspatienten in den 6 letzten Monaten vor dem Tod.
 Selbst zwischen an Krebs erkrankten Patienten, die dachten, sie hätten nur noch weniger als 6 Monate zu leben, gibt es je nachdem ob es sich um Weiße, Afroamerikaner oder Hispanoamerikaner handelt, erhebliche Ungleichheiten der von ihnen artikulierten Präferenzen zu ihrer "end-of-life"-Versorgung. Geht man davon aus, dass solche Vorstellungen eine eher entlastende Bedeutung besitzen, stellt dies eine deutliche Schlechterstellung der nichtweißen Patienten dar.
Selbst zwischen an Krebs erkrankten Patienten, die dachten, sie hätten nur noch weniger als 6 Monate zu leben, gibt es je nachdem ob es sich um Weiße, Afroamerikaner oder Hispanoamerikaner handelt, erhebliche Ungleichheiten der von ihnen artikulierten Präferenzen zu ihrer "end-of-life"-Versorgung. Geht man davon aus, dass solche Vorstellungen eine eher entlastende Bedeutung besitzen, stellt dies eine deutliche Schlechterstellung der nichtweißen Patienten dar.
In einer Studie mit 468 Krebspatienten (83 Afroamerikaner, 73 Hispanics) eines Großkrankenhauses (Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston) wurde mit Interviews untersucht, welche Vorstellungen oder Pläne ("advance care planning [ACP]") die Sterbenskranken für ihre letzten Monate besaßen.
Die ethnisch differierenden Vorstellungen (durchweg mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit < 1%) sahen so aus:
• Afroamerikaner und Hispanics hatten zu rund einem Drittel weniger als Weiße planmäßige Vorstellungen über ihr restliches Leben oder eine klare Vorgabe, dass unnötige lebens- und leidensverlängernde Versorgungsangebote unterbleiben sollten.
• Während 80% der weißen Patienten ihre Präferenzen für ihr Lebensende entweder mit ihrem Arzt diskutiert hatten oder zumindest einen fertigen Plan parat hatten, war dies nur bei 47% der schwarzen oder hispanischen Patienten der Fall.
• Letztere wünschten auch wesentlich mehr aggressive lebensverlängernde Maßnahmen als Weiße (weiße Patienten: 14%; schwarze Patienten: 45%; hispanische Patienten: 34%). Zugleich war den Angehörigen der afroamerikanischer und hispanischer Bevölkerung in den USA ihre Religion wesentlich wichtiger als den weißen US-Amerikanern.
• Auch das Wissen um ihren terminalen Gesundheitszustand war unterschiedlich: Während 39% der weißen Patienten darüber gut Bescheid wussten, waren es in der hispanischen Patientengruppe nur 11% (Unterschied hochsignifikant) und bei den afroamerikanischen Patienten 27%.
• Die rassischen bzw. ethnischen Unterschiede existierten schließlich auch nach der Adjustierung der drei Gruppen nach klinischen und demographischen Faktoren, der Kenntnisse über die terminale Erkrankung, der Religiosität der befragten Patienten und der von ihnen bevorzugten Art und Intensität von Behandlung weiter. Für schwarze Patienten belief sich die um diese Faktoren bereinigte relativ Wahrscheinlichkeit eines ACP gegenüber weißen Patienten auf 0,64. Derselbe Indikator betrug bei Hispanics gegenüber Weißen 0,65.
Obwohl es also deutliche Unterschiede zwischen den beiden nicht-weißen und der weißen Patientengruppe bei der Gewissheit über die tödliche Erkrankung und bei der gewünschten Art von Behandlung gibt, erklären diese Faktoren nicht warum Afro- und Hispanoamerikaner deutlich seltener klare Vorstellungen und Plänen (ACP) für die letzte Lebenszeit besitzen.
Von dem im "Journal of Clinical Oncology" (Vol 26, No 25; 1. September 2008: 4131-4137) veröffentlichten Aufsatz "Racial and Ethnic Differences in Advance Care Planning Among Patients With Cancer: Impact of Terminal Illness Acknowledgment, Religiousness, and Treatment Preferences" von Alexander Smith, Ellen P. McCarthy, Elizabeth Paulk, Tracy A. Balboni, Paul K. Maciejewski, Susan D. Block und Holly G. Prigerson gibt es kostenfrei lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 12.11.08
Persönliche Charakteristika von Ärzten spielen Rolle bei der leitliniengerechten Brustkrebsbehandlung
 Geahnt haben es zwar immer schon einige Patienten oder meist Patientinnen: Art und Umfang der Behandlung bestimmter Erkrankungen hingen auch vom Geschlecht der behandelnden Person ab. Entsprechende Belege bestanden aber meist "nur" aus eigenen Erfahrungen oder einzelnen Erfahrungsberichten und nicht aus halbwegs validen Untersuchungen.
Geahnt haben es zwar immer schon einige Patienten oder meist Patientinnen: Art und Umfang der Behandlung bestimmter Erkrankungen hingen auch vom Geschlecht der behandelnden Person ab. Entsprechende Belege bestanden aber meist "nur" aus eigenen Erfahrungen oder einzelnen Erfahrungsberichten und nicht aus halbwegs validen Untersuchungen.
Für die Behandlung von Frauen mit Mammakarzinom, also eine der häufigeren schweren und auch hochsensiblen Erkrankungen von Frauen, hat sich dies durch eine jetzt im US-"Journal of the National Cancer Institute" (2008; 100:199-206) etwas geändert. Der Untersuchung lagen Daten der "Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)-Medicare database" für Frauen über 65 Jahren zugrunde, die zwischen 1991 und 2002 an Brustkrebs erkrankten und operiert wurden. Von den so identifizierten 29.760 Frauen hatten 22.207 (75%) Radiotherapie erhalten. Die Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass noch mehr persönliche Charakteristika der behandelnden Ärzte eine Rolle spielen und einige Einflussfaktoren trotz statistischer Signifikanz nur eine relativ schwache Bedeutung haben.
Dawn Hershman vom "Herbert Irving Comprehensive Cancer Center" an der New Yorker Columbia Universität legte seiner Untersuchung für die Behandlung eines im Frühstadium entfernten Mammakarzinoms in praktisch sämtlichen Leitlinien empfohlene Radiotherapie zugrunde. Diese Therapie erhöht dabei spürbar die Überlebenschance der Patientinnen. In einem zweiten Schritt stellte er fest, dass diese Form der Therapie in den USA trotzdem nur rund 75% der dafür in Frage kommenden Frauen angeboten wird. Der dritte Schritt bestand dann darin, auch nach Gründen für die Nicht-Anwendung der Leitlinie zu suchen, die in der Person oder Ausbildung der Onkologen liegen könnten. Denn obwohl sich auch hier zeigte, dass das Alter, die Hautfarbe, der Familienstand und die Entfernung zum Behandlungsort einen Einfluss auf Erhalt oder Nichterhalt der Radiotherapie besaßen, blieben immer noch unerklärte Teile des Geschehens über.
Die weiteren erklärenden Faktoren sind eine interessante Mischung:
• Weibliche Ärzte empfehlen ihren Patientinnen zu 13% häufiger eine Radiotherapie (Wahrscheinlichkeitsrate/odds ratio 1,13).
• Fast gleichauf (odds ratio 1,12) lag der Faktor, ob der Arzt in den USA ausgebildet wurde.
• An der Spitze lag aber der Einfluss eines Doktortitels (odds Ratio 1,55).
• Eine hohe Bedeutung hat auch die Dauer der Berufsausübung der Ärzte: Wer mehr als 15 Patientinnen nach brusterhaltender Therapie betreute, riet zu 18% häufiger zur Radiotherapie als Berufsjüngere.
Über die Gründe z. B. des Handelns weiblicher Ärzte lässt sich aber nach Meinung der ForscherInnen auch nach ihrer Studie weiterhin nur spekulieren. Für wahrscheinlich gehalten wird aber, dass zumindest beim Charakteristikum Geschlecht die bessere Einfühlunfähigkeit der weiblichen Ärzte in ihre Patientinnen eine entscheidende Rolle spielt. Um an diesen folgenschweren Handlungsbarrieren etwas ändern zu können, muss man sicherlich noch mehr über die Wirkmechanismus wissen, kann aber den gezeigten Spuren folgen.
Den Aufsatz "Surgeon Characteristics and Receipt of Adjuvant Radiotherapy in Women With Breast Cancer" von Dawn L . Hershman , Donna Buono , Russell B . McBride , Wei Yann Tsai , Kathy Ann Joseph ,
Victor R . Grann und Judith S . Jacobson aus dem "Journal of National Cancer Institute (JNCI)" (2008; 100: 199 - 206) gibt es als Abstract.
Bernard Braun, 17.2.2008
Kommunikation mit Krebspatienten über ihre Ängste: Den meisten Ärzten fehlen die rechten Worte
 Fachärzte für Tumorerkrankungen haben erhebliche Probleme, mit ihren schwer und zum Teil unheilbar erkrankten Patienten über deren Ängste und Sorgen zu sprechen. Wenn Patienten solche Gefühle im Gespräch enthüllen, wird dies nur in einem Fünftel aller Fälle auch vom behandelnden Arzt aufgegriffen und der Kranke zu weiteren Äußerungen ermuntert. Diese Defizite der Arzt-Patient-Kommunikation in besonders schwierigen und emotionsbesetzten Situationen hat jetzt eine US-amerikanische Forschungsgruppe festgestellt. Veröffentlicht wurde ihre Studie jetzt im "Journal of Clinical Oncology".
Fachärzte für Tumorerkrankungen haben erhebliche Probleme, mit ihren schwer und zum Teil unheilbar erkrankten Patienten über deren Ängste und Sorgen zu sprechen. Wenn Patienten solche Gefühle im Gespräch enthüllen, wird dies nur in einem Fünftel aller Fälle auch vom behandelnden Arzt aufgegriffen und der Kranke zu weiteren Äußerungen ermuntert. Diese Defizite der Arzt-Patient-Kommunikation in besonders schwierigen und emotionsbesetzten Situationen hat jetzt eine US-amerikanische Forschungsgruppe festgestellt. Veröffentlicht wurde ihre Studie jetzt im "Journal of Clinical Oncology".
Basis der Studie waren Audio-Mitschnitte von Arzt-Patient-Gesprächen, an denen 51 Onkologen und 270 Patienten mit unterschiedlichen Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium beteiligt waren. Diese Gespräche wurden später von zwei unabhängigen Wissenschaftlern darauf hin bewertet, ob Patienten ihre Gefühle äußerten und dem Arzt Gelegenheit gaben, darauf zu reagieren ("empathic opportunities"). Die Eindeutigkeit und Intensität dieser von Patienten artikulierten Gesprächsanstöße über ihre Emotionen wurde auf einer Skala von 0-10 eingestuft. Die beiden unabhängigen Bewertungen wurden später auf ihre Übereinstimmung geprüft, wobei sich eine sehr hohe Korrelation (0,70) ergab. In der Auswertung der Tonbandmitschnitte wurde weiterhin protokolliert, ob Ärzte auf diese Gesprächsanstöße ihrer Patienten eingehen oder sie negieren bzw. mit anderen Themen das Gespräch fortsetzen.
Insgesamt fand man in knapp 400 Gesprächen 292 solcher Gesprächsanstöße. Ihre Häufigkeit und Intensität wechselte von Patient zu Patient, in etwa jedem dritten Gespräch (37%) war zumindest eine Textpassage zu finden, in der Patienten ihre Sorgen oder Ängste äußerten und den Arzt mehr oder minder direkt zu einer Reaktion aufforderten. Tatsächlich zeigte sich jedoch, dass nur in jedem fünften Fall (22%) der Arzt auch darauf einging.
Bei der Auswertung zeigte sich weiterhin:
• Weibliche Patienten äußerten sehr viel häufiger ihre Gefühle, wenn sie mit einer Frau als behandelnde Onkologin sprachen.
• Jüngere Ärzte und solche, die sich selbst so charakterisiert hatten, dass sie stärker an der Arzt-Patient-Kommunikation als an medizinisch-technischen Fragen interessiert seien, gingen auch häufiger auf die Gefühlsäußerungen ihrer Patienten ein.
In der Diskussion der Ergebnisse betonen die Wissenschaftler, dass Fachärzte für Onkologie nicht grundsätzlich desinteressiert seien am Gemütszustand ihrer Patienten. Ihnen würden jedoch Kenntnisse und Fertigkeiten fehlen, um auf entsprechende Patienten-Äußerungen angemessen zu reagieren. In der Mediziner-Ausbildung kämen solche Qualifikationen entschieden zu kurz.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier: Kathryn I. Pollak u.a.: Oncologist Communication About Emotion During Visits With Patients With Advanced Cancer (Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 36 (December 20), 2007: pp. 5748-5752)
Bereits zuvor hatte eine Meta-Analyse wissenschaftlicher Veröffentlichungen gezeigt, dass die Kommunikation mit Krebs-Patienten eine für Ärzte besonders schwierige Anforderung ist, die sie oftmals nur sehr unzureichend bewältigen. Eine Folge dieser Kommunikationsbarrieren sahen die Wissenschaftler darin, dass viele unheilbare Krebspatienten sich auch noch im Endstadium für eine aggressive Chemotherapie entscheiden. Etwa ein Drittel ist nämlich der Meinung, dass Zielsetzung der Chemotherapie eine "Heilung" ihrer Krebserkrankung sei. Auch wurde festgestellt, dass Krebspatienten in vielen Fällen mehr über ihre Erkrankung von Mitpatienten erfahren als von ihrem behandelnden Arzt. vgl.: Chemotherapie am Lebensende: Krebspatienten erfahren über ihre Krankheit mehr von Mitpatienten als von ihrem Arzt
Gerd Marstedt, 31.12.2007
Gefahr von Unter- und Fehlversorgung bei langjähriger Therapienotwendigkeit: Das Beispiel Tamoxifen bei Brustkrebs.
 Eine der Stützen der Behandlung von estrogenrezeptorpositivem, d.h. hormonsensitivem Brustkrebs ist eine mindestens fünfjährige Behandlung mit Medikamenten, die den Wirkstoff Tamoxifen enthalten. Dieser so genannte selektive Estrogenrezeptormodulator ist nicht nur als Arzneistoff zur Therapie von Mammakarzinomen eingesetzt, sondern in den USA auch zur Prävention von Brustkrebs bei Frauen mit erhöhtem Risiko.
Eine der Stützen der Behandlung von estrogenrezeptorpositivem, d.h. hormonsensitivem Brustkrebs ist eine mindestens fünfjährige Behandlung mit Medikamenten, die den Wirkstoff Tamoxifen enthalten. Dieser so genannte selektive Estrogenrezeptormodulator ist nicht nur als Arzneistoff zur Therapie von Mammakarzinomen eingesetzt, sondern in den USA auch zur Prävention von Brustkrebs bei Frauen mit erhöhtem Risiko.
In mehreren, in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern durchgeführten Studien (siehe hierzu eine Zusammenfassung mit Verweisen auf die Originalstudien) mit Tausenden von brustkrebserkrankten Frauen, wurde der Nutzen von Tamoxifen nachgewiesen, das Brustkrebsrisiko von primär erkrankten Patientinnen zu verringern. In der "International Breast Cancer Intervention Studie (IBIS-II)" zeigte sich, dass nach 5 Jahren Einnahme eines Medikaments mit diesem Wirkstoff ein um 34% verringertes Risiko für eine Folgeerkrankung existierte. Eine über 20 Jahre in Großbritannien durchgeführte Studie zeigte sogar ein um 39% verringertes Risiko. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass eine fünfjährige Therapie einen höheren Nutzen brachte als eine zuvor auf 2 Jahre begrenzte Nachbehandlung. Außerdem gibt es Hinweise auf eine protektive Wirkung der Behandlung selbst nach einer Therapiebeendigung weit über die 5 Jahre hinaus.
Da es sich also um keine neuartige oder gar noch umstrittene Therapie handelt, fallen die Erkenntnisse einer am 10. Dezember 2007 online vorveröffentlichten und im Februar 2008 in gedruckter Form vorliegenden Studie von ForscherInnen mehrerer US-amerikanischer Universitätsforschungseinrichtungen unter Leitung von Cynthia Owusu besonders ins Gewicht.
Die Forschergruppe untersuchte in sechs Behandlungseinrichtungen das Therapieverhalten bzw. den Therapieverlauf von 961 Frauen, die älter als 65 Jahre waren, zwischen 1990 und 1994 primär an einem hormonpositiven Brustkrebs erkrankt waren und bei denen nach der Ersttherapie eine Behandlung mit Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln gestartet wurde. Mit Hilfe von Routinedaten und Rezepten wurde der Verordnungs- und Behandlungsverlauf dieser Frauen über 5 Jahre hinweg beobachtet.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• 49% der Frauen mit einer gestarteten Tamoxifen-Behandlung beendeten die Behandlung vor dem Ende der 5 Jahre.
• Frauen über 75 Jahre oder Frauen, die in den ersten drei Jahren der Tamoxifenbehandlung noch an anderen ernsteren Erkrankungen litten und die Frauen, die nach ihrer Brustoperation keine Bestrahlungstherapie erhielten, brachen ihre medikamentöse Behandlung mit höherer Wahrscheinlichkeit ab.
• Die Nichtfortsetzung der Behandlung resultiert in früheren möglichen Rückfällen oder auch einer erhöhten Brustkrebssterblichkeit.
Die jetzt zum ersten Mal konkreter bekannt gewordenen Umstände des vorzeitigen Abbruchs einer wirksamen Therapie können prädiktiv im künftigen primärärztlichen Behandlungs- oder Versorgungsmanagement oder zur besseren und gezielteren Information und Weiterbildung von Patientinnen genutzt werden.
Da es keinen Grund gibt zu glauben, in Deutschland gäbe es bei dieser Therapie nicht vergleichbare Verläufe oder Abbrüche, sollten entsprechende Überprüfungen gezielt stattfinden. Diese sollten nicht nur die Brustkrebstherapie, sondern alle Therapien einschließen, deren Wirksamkeit und Effizienz von einer langen und kontinuierlichen Therapie bzw. der Therapietreue der PatientInnen abhängig sind.
Die Ergebnisse der Studie sind in dem Aufsatz "Predictors of Tamoxifen Discontinuation Among Older Women With Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer" von Cynthia Owusu et al. in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Journal of Clinical Oncology" vom 10. Dezember 2007 zu finden, von dem es ein kostenfreies Abstract gibt.
Bernard Braun, 25.12.2007
Brustkrebs-Diagnosen durch Mammographie: Die Treffsicherheit von Ärzten ist extrem unterschiedlich
 Frühere Studien haben gezeigt, dass bei es bei Früherkennungsuntersuchungen für Brustkrebs erhebliche Unterschiede zwischen Ärzten gibt, was die Treffsicherheit der Diagnose anbetrifft. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun die Kompetenz von Radiologen überprüft, die nach einem Krebsverdacht bei Frauen Mammographien durchgeführt und ausgewertet haben. Sie fanden heraus, dass es auch bei dieser Gruppe spezialisierter Ärzte erhebliche Unterschiede gibt. Die Treffsicherheit, was die Quote richtig erkannter Brustkrebs-Erkrankungen anbetrifft, schwankte zwischen 27 und 100 Prozent.
Frühere Studien haben gezeigt, dass bei es bei Früherkennungsuntersuchungen für Brustkrebs erhebliche Unterschiede zwischen Ärzten gibt, was die Treffsicherheit der Diagnose anbetrifft. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun die Kompetenz von Radiologen überprüft, die nach einem Krebsverdacht bei Frauen Mammographien durchgeführt und ausgewertet haben. Sie fanden heraus, dass es auch bei dieser Gruppe spezialisierter Ärzte erhebliche Unterschiede gibt. Die Treffsicherheit, was die Quote richtig erkannter Brustkrebs-Erkrankungen anbetrifft, schwankte zwischen 27 und 100 Prozent.
Die Diagnosen von 123 Radiologen und 36.000 Mammographien waren Basis der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "Journal of the National Cancer Institute" veröffentlicht wurde. Die Diagnosen stammen aus den Jahren 1996 bis 2003 und wurden in insgesamt 72 Kliniken oder anderen Versorgungseinrichtungen aufgestellt. Die Wissenschaftler überprüften einerseits, ob die Diagnosen zutreffend waren oder ob Krebsknoten übersehen worden waren ("Falsch-Negativ-Befunde"). Andererseits untersuchten sie aber auch, ob es sich um irrtümliche, in späteren Untersuchungen korrigierte Urteile ("Falsch-Positiv-Befunde") handelte. Darüber hinaus versuchten sie schließlich auch, festzustellen, ob bestimmte berufliche Merkmale der Ärzte die Treffsicherheit der Diagnosen beeinflusst.
Als Ergebnis zeigte sich:
• Die durchschnittliche Trefferquote (zutreffende Diagnosen) lag bei 79%, d.h. 21% der Krebserkrankungen wurden übersehen.
• Die Quote korrekter Diagnosen variierte aber bei einzelnen Ärzten erheblich, sie lag zwischen 27% und 100%. D.h. Einzelne Radiologen beurteilten nur etwa jeden vierten Fall korrekt, andere waren durchweg treffsicher.
• Falsch-Positiv-Urteile (irrtümliche Krebs-Diagnosen) variierten zwischen 0 und 16% und lagen im Mittel bei 4.3%
• Radiologen in universitären Versorgungseinrichtungen zeigten eine deutlich höhere Treffsicherheit (88%) als Spezialisten in anderen Einrichtungen (76%).
• Eine höhere Diagnosesicherheit zeigten auch Radiologen, die mindestens 20 Prozent ihrer Arbeitszeit nur mit der Auswertung von Mammographien verwenden.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier zu finden: Diana L. Miglioretti u.a.: Radiologist Characteristics Associated With Interpretive Performance of Diagnostic Mammography (JNCI Journal of the National Cancer Institute, doi:10.1093/jnci/djm238)
Gerd Marstedt, 16.12.2007
Überleben allein ist nicht alles. Von der Wichtigkeit der Nachsorge für die Lebensqualität von jungen Krebspatienten!
 Eine Reihe von meist schweren Krankheiten sind mit ihrer Akutbehandlung nicht verschwunden. Und auch die Behandlung hat häufig Auswirkungen, die auch erst nach langer Zeit zur Geltung kommen können. Im Falle von vielen Krebserkrankungen ist das Risiko, dass sie nach vermeintlicher Heilung und trotz massiven chemotherapeutischen Interventionen metastasieren, Ärzten wie Patienten durchaus geläufig.
Eine Reihe von meist schweren Krankheiten sind mit ihrer Akutbehandlung nicht verschwunden. Und auch die Behandlung hat häufig Auswirkungen, die auch erst nach langer Zeit zur Geltung kommen können. Im Falle von vielen Krebserkrankungen ist das Risiko, dass sie nach vermeintlicher Heilung und trotz massiven chemotherapeutischen Interventionen metastasieren, Ärzten wie Patienten durchaus geläufig.
Umso verwunderlicher ist das Ergebnis zweier jetzt in den USA vom "Institute of Medicine (IOM)", einem Institut der offiziellen Vereinigung der amerikanischen Ärzteschaft, veröffentlichten Studien "Childhood Cancer Survivorship: Improving Care and Quality of Life" (Autoren: Maria Hewitt, Susan L. Weiner, and Joseph V. Simone, Editors, National Research Council) und "From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition" (Autoren: Maria Hewitt, Sheldon Greenfield, and Ellen Stovall).
Für alle Krebspatienten und darunter nochmals gesondert für an Krebs erkrankte Kinder stellen diese Reports u.a. folgende Defizite fest und Forderungen auf:
• Ein großer Prozentsatz der Kinder, die eine Krebserkrankung im Kindesalter überlebten, erhalten nicht die systematische Nachsorge, die sie eigentlich benötigten.
• Obwohl rund 80 % der Kinder ihre Erkrankung überleben, entwickeln sich bei zwei Dritteln von ihnen chronische gesundheitliche Erkrankungen, die mit ihrer Krebserkrankung und deren Behandlung zusammenhängen. 20% der Kinder, deren Brustkorb mit Bestrahlungen behandelt wurden, werden im weiteren Leben Brustkrebs bekommen und bis zu 50 % der Kinder, die mit Chemotherapie auf Basis des Wirkstoffs Anthracyclin behandelt wurden, werden Herzprobleme entwickeln.
• Wegen dieser Zusammenhänge empfehlen Experten, dass bei allen mit anthracyclinbasierten Chemotherapeutika behandelten Kinder alle 2 Jahre ein EKG durchgeführt wird und die früher bestrahlten Kinder bereits ab 25 jedes Jahr mammographisch untersucht werden, anstatt im generell empfohlenen Alter von 40-50 Jahren.
• Tatsächlich erhalten heute nur 28 % der potenziell Betroffenen EKGs und nur 49 % der davon betroffenen Frauen jährliche Mammographien.
• Da sich aber offensichtlich derartige Erkenntnisse weder spontan noch schnell verbreiten und umsetzen, empfehlen die IOM-Berichterstatter, für jeden Krebspatienten einen persönlichen "survivorship care plan" zu entwickeln in dem sowohl die Essentials seiner Behandlung als auch eine Beschreibung der langfristig notwendigen und wiederkehrenden Nachsorge stehen.
Erhältlich sind kostenlose Zusammenfassungen (PDF-Datei des Executive Summary oder Report in Brief) und Online-Lektüremöglichkeiten (nur mit schnellem Internetanschluss erträglich) der 224-seitigen Studie "Childhood Cancer Survivorship: Improving Care and Quality of Life" auf dieser Website und der 536 Seiten umfassenden Studie "From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition" auf dieser Website.
Auf beiden Seiten kann man aber auch die kompletten Publikationen kostenpflichtig (rd. 30 und 63 US-Dollar) bestellen.
Bernard Braun, 15.6.2007
Chemotherapie am Lebensende: Krebspatienten erfahren über ihre Krankheit mehr von Mitpatienten als von ihrem Arzt
 Warum wird bei einer Vielzahl von aussichtslos an Krebs erkrankten Patienten noch in den letzten Wochen vor dem Tod so oft eine Chemotherapie durchgeführt, eine Therapie also, die (vielleicht) das Leben um sehr kurze Zeitspanne verlängert, dies jedoch zum Preis einer massiv verschlechterten Lebensqualität? Bestehen Patienten so stark darauf, weil es ihre letzte Hoffnung ist oder drängen Ärzte dies Patienten eher auf, ohne sie hinreichend aufzuklären über die erheblichen Beiinträchtigungen? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam am "Massey Cancer Center of Virginia" in Richmond USA jetzt anhand einer Auswertung schon veröffentlichter Studien nachgegangen.
Warum wird bei einer Vielzahl von aussichtslos an Krebs erkrankten Patienten noch in den letzten Wochen vor dem Tod so oft eine Chemotherapie durchgeführt, eine Therapie also, die (vielleicht) das Leben um sehr kurze Zeitspanne verlängert, dies jedoch zum Preis einer massiv verschlechterten Lebensqualität? Bestehen Patienten so stark darauf, weil es ihre letzte Hoffnung ist oder drängen Ärzte dies Patienten eher auf, ohne sie hinreichend aufzuklären über die erheblichen Beiinträchtigungen? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam am "Massey Cancer Center of Virginia" in Richmond USA jetzt anhand einer Auswertung schon veröffentlichter Studien nachgegangen.
Sie fanden über 50 Artikel, die über einen Zeitraum von 20 Jahren weltweit veröffentlicht waren. Ein vorläufiges erstes Fazit der Wissenschaftler heißt: "Der Mangel an Entscheidungshilfen für Patienten und fundierte Informationen über Vor- und Nachteile, über Chancen und Nebenwirkungen der Therapie trägt mit dazu bei, dass Patienten noch sehr kurz vor ihrem absehbaren Lebensende sich für überaus aggressive Therapien entscheiden." Sie betonen jedoch auch, dass in Anbetracht des Forschungsstandes nicht vorhersehbar ist, ob Patienten sich gänzlich anders entscheiden würden, wenn solche Patienteninformation vorlägen.
Eine Studie ihrer Auswertung hat gezeigt, das bis zu 34% der Krebskranken noch in den letzten zwei Wochen ihres Lebens chemotherapeutisch behandelt werden. Patient ist jedoch nicht Patient. Man fand auch heraus, dass einige Patienten sogar für eine Lebensverlängerung von nur einer Woche die Qualen der Therapie auf sich nehmen würden, während andere selbst bei einer in Aussicht gestellten Lebensverlängerung um zwei Jahre dazu um keinen Preis bereit wären. Insofern lässt sich die Ursache zuletzt vermehrt eingesetzten Therapie auch bei aussichtslosen Krebserkrankungen nicht einseitig Ärzten oder Patienten zuweisen, es ist die derzeit unbefriedigende Arzt-Patient-Kommunikation und der Mangel an anderweitiger Patienteninformation.
Eines der überraschendsten Ergebnisse der Literaturstudie war nach Auffassung der Forscher, dass Patienten über den Fortgang ihrer Krankheit und ihre weitere Lebenserwartung sehr viel mehr von anderen Patienten im Warteraum der Klinik erfahren als von ihrem Onkologen. Dies fand eine Studie heraus, in der 35 an Lungenkrebs erkrankte Patienten gefragt wurden, woher sie am meisten über ihre Erkrankung erfahren haben. Es besteht ein massives Kommunikationsdefizit, stellt Dr. Matsuyama, einer der Autoren der Studie fest: "Ärzte haben eine verständliche Scheu, über den absehbaren Tod eines Patienten mit diesem zu sprechen und Patienten möchten dies nicht immer hören." So fanden zwei andere Studien unabhängig voneinander heraus, dass etwa ein Drittel von Lungenkrebspatienten annahm, dass die Chemotherapie zur "Heilung" des Krebses durchgeführt würde.
Ärzte überschätzen darüber hinaus die weitere Lebensdauer der von ihnen behandelten Krebspatienten ganz massiv, und zwar im Schnitt um etwa das Fünffache, auch dies geht aus einer Untersuchung hervor, während gleichzeitig nur etwa ein Drittel der Ärzte den Patienten eine zeitliche Prognose stellt, selbst, wenn diese darum bitten. Es scheint jedoch so zu sein, das die große Mehrzahl der Krebspatienten tatsächlich in dieser Hinsicht ein offenes Wort hören möchten: In einer Untersuchung mit 126 Patienten gaben über 90% an, sie möchten eine realistische Einschätzung von ihrem Arzt bekommen.
Solche Entscheidungshilfen und ehrliche Patienteninformationen haben einen deutlichen Einfluss auf die Therapieentscheidung. So zeigte sich, dass bei zwei Gruppen mit vergleichbarem Krankheitsbild und Krankheitsfortschritt in der einen Gruppe mit einer individuellen Prognose und Information über schädliche Nebenwirkungen der Therapie sich nur knapp 60% für eine Chemotherapie entschieden, während es in der zweiten Gruppe ohne solche Information fast 90% waren. "Allerdings," so betont Dr. Matsuyama , müssen Ärzte sich die Mühe machen herauszufinden, wie viel Information und welche Information Patienten tatsächlich wünschen.
Eine andere Wissenschaftlerin, Craig C. Earle, MD, MSc, Associate Professor of Medicine at Harvard Medical School, rät Onkologen: "Patienten können mit Unsicherheit durchaus umgehen. Machen Sie eine grobe Schätzung der Lebenserwartung, dies ist für Patienten überaus wichtig, um ihre Lebensplanung in Einklang mit eigenen Wünschen und Vorlieben zu bringen. Eine zu vage oder zu optimistische Prognose kann Patienten davon abhalten, ihr Lebensende realistisch zu planen. So mancher würde, wenn er die Wahrheit wüsste, wahrscheinlich eher einen letzten lustbetonten und persönlich bedeutungsvollen 'Trip' machen als sich für die Qual einer Chemotherapie entscheiden."
Zum Artikel der Forschergruppe "Matsuyama R, Reddy S, Smith TJ.: Why do patients choose chemotherapy near the end of life? A review of the perspective of those facing death from cancer."
• gibt es kostenlos leider nur ein Abstract in PubMed.
• In einem Aufsatz in der Zeitschrift oncology-times (www.oncology-times.com, No. 17, Sept. 10, 2006) sind allerdings alle Ergebnisse sehr ausführlich beschrieben: Charlene Laino: Near-Death Patients Often Accept Chemotherapy for Small Gains
Gerd Marstedt, 12.1.2007
"Remember that time is money": Umfang und finanzieller Wert der durch Krebsbehandlung "verlorenen Zeit"
 Wo anders als in den USA scheinen Wissenschaftler unbekümmert klären zu können, was der eingangs zitierte Merksatz Benjamin Franklins aus dem Jahre 1748 für Krebspatienten im 21. Jahrhundert bedeutet?
Wo anders als in den USA scheinen Wissenschaftler unbekümmert klären zu können, was der eingangs zitierte Merksatz Benjamin Franklins aus dem Jahre 1748 für Krebspatienten im 21. Jahrhundert bedeutet?
Wo mit dem Stichwort "Wartezeiten" oftmals nur bedauerndes Achselzucken ausgelöst wird, haben jetzt Wissenschaftler des nationalen Krebsinstituts der USA und einiger großer Krankenhäuser um R. Yabroff für 763.527 bei Medicare versicherte Patienten, die an 11 verbreiteten Krebsarten litten, ausgezählt, wie viele Stunden diese Menschen allein im ersten Jahr ihrer Behandlung in Warteräumen für Computertomografie-Untersuchungen oder mit dem Warten auf das Ende chemotherapeutischer Tropfs verbringen und wie viele Dollars es kosten würde, wenn dafür der Durchschnittslohn von rund 15 US-Dollar (2002) gezahlt würde (insofern fiktiv, weil viele der Patienten bereits nicht mehr erwerbstätige Rentner sind).
Nicht quantifiziert wurden die Lebenszeit-Verluste durch und Kosten von speziellen Erholzeiten z. B. nach einer Chemotherapie-Sitzung oder die Fahrtzeiten zu Behandlungen. Dieser zeitliche und nur zur Veranschaulichung monetarisierte Aufwand der Krebspatienten wurde mit dem zeitlichen Aufwand für die medizinische Versorgung von rund 1 Million von Medicare-Versicherten verglichen, die nicht an Krebs erkrankt waren. Diese Perspektive ist neu: Wenn über Kosten im Zusammenhang mit schweren Erkrankungen überhaupt gesprochen wird, dann meist nur über die der medizinischen Behandlung. Mit dieser Untersuchung entsteht also zumindest ein vollständigeres Bild.
Die Ergebnisse dieser Analysen mit dem Titel "Patient Time Costs Associated With Cancer Care" können kostenlos nur als Abstract der Veröffentlichung im "JNCI Journal of the National Cancer Institute" (2007 99(1):14-23) heruntergeladen werden.
Auch wenn ein kritisches Editorial von Kessler und Ramsey unter dem Titel "The Forest and the Trees: the Human Costs of Cancer" in derselben Ausgabe des Journals zu Recht darauf hinweist, dass Krebs mehr ist und kostet als Dollars für die Behandlung oder Wartezeiten, vermittelt diese Quantifizierung doch näherungsweise, was die Fülle der Krankheitslast und verlorenen Lebensgelegenheiten konkret für diese Patienten bedeutet.
Konkret ermitteln die Forscher dann z. B. folgende Sachverhalte:
• Der Behandlungszeit-Zoll beträgt unter den genannten Annahmen wenigstens 2,3 Milliarden US-$ pro Jahr.
• An Eierstockkrebs erkrankte Frauen verbringen im ersten Jahr nach der Diagnose 368 Stunden mit Warten, Lungenkrebserkrankte 272 Stunden und Nierenkrebskranke 193 Stunden.
• Wahrscheinlich ist, dass der Aufwand bezogen auf die gesamte, d.h. auch die mittelaltrige und jüngere Bevölkerung, auch auf der Basis dieser Untersuchung unterschätzt wird.
• Patienten, bei denen der Krebs früh diagnostiziert wurde, benötigen weniger Behandlungszeit. Dies werten die Autoren auch als Beleg, dass Forschung für eine bessere und frühe Entdeckung von Krebs "wirklichen Nutzen stiften" kann.
• Verglichen mit vergleichbaren Versicherten ohne Krebs verbringen Prostatakrebspatienten im ersten Jahr nach Diagnose 55 Stunden mehr mit medizinischer Versorgung. Bei Brustkrebserkrankten betrug diese Differenz 66 Stunden. Beide Untergruppen verbringen auch noch durchschnittlich 4 Tage im Krankenhaus.
Die beiden Editorial-Autoren weisen am Ende ihres Kommentars berechtigterweise auf die Notwendigkeit einer noch ganz anderen und wirklichkeitsnaheren "Kosten"analyse schwerer Erkrankungen hin: "Does this study complete the picture of the overall burden of cancer? We have left out the incalculable emotional suffering of the patient and his or her family and friends. Without such a count, we know we have greatly underestimated the true cost of this disease."
Bernard Braun, 3.1.2007
Über- und Fehlversorgung beim PSA-Screening für ältere Männer
 Die meisten spezifischen Leitlinien empfehlen nicht, älteren Männern ein Screening für das so genannte prostataspezifische Antigen (PSA) und die damit verfolgte Absicht, einen Prostatakrebs identifizieren zu können, anzubieten. Angesichts der zum Teil begrenzten Lebenserwartung drohen nämlich die unerwünschten und belastenden Folgen dieser Untersuchung (z.B. bei falsch-negativen Ergebnissen) die erwartbaren Vorteile zu überwiegen. Wie oft bei älteren Männer trotzdem PSA-Tests angeboten und durchgeführt werden, war bisher nicht an größeren Gruppen untersucht worden.
Die meisten spezifischen Leitlinien empfehlen nicht, älteren Männern ein Screening für das so genannte prostataspezifische Antigen (PSA) und die damit verfolgte Absicht, einen Prostatakrebs identifizieren zu können, anzubieten. Angesichts der zum Teil begrenzten Lebenserwartung drohen nämlich die unerwünschten und belastenden Folgen dieser Untersuchung (z.B. bei falsch-negativen Ergebnissen) die erwartbaren Vorteile zu überwiegen. Wie oft bei älteren Männer trotzdem PSA-Tests angeboten und durchgeführt werden, war bisher nicht an größeren Gruppen untersucht worden.
Diesen Zustand hat jetzt der von Louise C. Walter; Daniel Bertenthal; Karla Lindquist und Badrinath R. Konety in der Fachzeitschrift JAMA (2006;296:2336-2342)veröffentlichte Forschungsbericht "PSA Screening Among Elderly Men With Limited Life Expectancies" beendet.
Bei einer Analyse der Daten von knapp 600.000 70 Jahre alten und älteren Männern, die 2002/2003 beim US Departement of Veterans Affairs (VA) oder Medicare krankenversichert waren, zeigte sich folgende Screening-Wirklichkeit:
• 56 % der Gesamtkohorte erhielten innerhalb eines Jahres einen PSA-Test,
• die Screeningrate sank zwar mit zunehmendem Alter, aber immerhin wurden auch noch Männer, die 85 Jahre und mehr alt waren noch getestet - obwohl weniger als 10 % dieser Männer die nächsten 10 Jahre überleben werden und Leitlinien solche Tests nicht empfehlen, wenn die Lebenserwartung der Personen kürzer als 10 Jahre ist,
• die Screeningsrate hatte auch kaum etwas mit dem Gesundheitszustand der Männer zu tun: Bei den 85+-Personen erhielten 34 %, die sich bester Gesundheit erfreuten genauso wie die 36 %, deren Gesundheitszustand sehr schlecht war, den Test. In multivariaten Analysen hatten viele nichtklinischen Faktoren und Merkmale, wie etwa der Familienstand und die Region in einem Bundesstaat einen größeren Effekt auf die Duurchführung von PSA-Tests als der Gesundheitszustand.
Männern im fortgeschrittenen Alter und mit ernsten sonstigen Erkrankungen - so die Autoren - "should be told that PSA screening is more likely to harm them than to help them". Hier handelt es sich also neben der Überversorgung mit einem hinsichtlich seines Nutzens heftig umstrittenen Test auch um Fehlversorgung, wenn ein möglicher mentaler Folgeschaden größer ist.
Damit werden auch die Ergebnisse von drei bereits im Sommer veröffentlichten Studien in kleineren Gruppen von Männern bestätigt, deren Zusammenfassung der von den Herausgebern des renommierten "New England Journal of Medicine" getragene Medizin-Informationsdienst "Journal Watch. Medicine that matters" bereits im September veröffentlichte. Zum Hintergrund der Verbreitung des PSA-Tests bei älteren Männern aber auch in anderen Altersgruppen führten die Journal Watch-Autoren aus: "Many factors, including media hype, ambiguous messages from professional and advocacy groups, and physicians' fear of litigation, undoubtedly contribute to these trends."
Weitere kritische Anmerkungen zum Sinn und den Risiken des PSA-Tests aber auch anderer Früherkennungsuntersuchen stehen auf der Website Mythos Krebsvorsorge
Hier finden Sie das Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 15.11.2006
Brustkrebs: EU fordert Staaten zu mehr Anstrengungen bei der Früherkennung auf
 Weltweit erkrankt etwa eine Million Frauen pro Jahr an Brustkrebs, in Deutschland diagnostizieren die Mediziner jedes Jahr rund 51.000 neue Fälle. Für 19.000 Frauen unter ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Trotz aller Fortschritte: Brustkrebs ist für Frauen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren noch immer die häufigste Todesursache und hat einen Anteil von 24 % bei den Krebsneuerkrankungen der Frauen. (Detaillierte Informationen zum Vorkommen von Brustkrebs findet man im Gesundheitsbericht des Robert-Koch-Instituts "Themenheft 25: Brustkrebs"). Jetzt macht die Europäische Union Druck. Am internationalen Brustkrebstag veröffentlichte der Brüsseler Gesundheitskommissar Markos Kyprianou Leitlinien, in denen die EU den 25 Mitgliedsstaaten die Förderung des digitalen Screenings und den Aufbau eines landesweiten Brustzentren-Netzes empfiehlt.
Weltweit erkrankt etwa eine Million Frauen pro Jahr an Brustkrebs, in Deutschland diagnostizieren die Mediziner jedes Jahr rund 51.000 neue Fälle. Für 19.000 Frauen unter ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Trotz aller Fortschritte: Brustkrebs ist für Frauen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren noch immer die häufigste Todesursache und hat einen Anteil von 24 % bei den Krebsneuerkrankungen der Frauen. (Detaillierte Informationen zum Vorkommen von Brustkrebs findet man im Gesundheitsbericht des Robert-Koch-Instituts "Themenheft 25: Brustkrebs"). Jetzt macht die Europäische Union Druck. Am internationalen Brustkrebstag veröffentlichte der Brüsseler Gesundheitskommissar Markos Kyprianou Leitlinien, in denen die EU den 25 Mitgliedsstaaten die Förderung des digitalen Screenings und den Aufbau eines landesweiten Brustzentren-Netzes empfiehlt.
In Deutschland werden jedes Jahr rund fünf Millionen Mammographien gemacht. In den meisten Fällen meinen Experten jedoch, dass die Qualität mangelhaft ist, weil beispielsweise keine Doppelbefundung und keine Qualitätskontrolle gewährleistet ist. "In Deutschland könnte allein durch qualitätsgesichertes Screening pro Tag zehn Frauen das Leben gerettet werden", erklärte die Bremer SPD-Europaabgeordnete Karin Jöns, deren Parlamentsbericht aus dem Jahr 2003 die Grundlage für die EU-Leitlinien bildet. Die Empfehlungen zur flächendeckenden Ausdehnung der Mammographie (alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren sollen alle zwei Jahre zur Röntgenuntersuchung der Brust eingeladen werden) sind jedoch nicht unumstritten.
So weisen zum Beispiel Bremer Wissenschaftler darauf hin, dass "über den tatsächlichen Nutzen der Früherkennungsmammografie in der wissenschaftlichen Literatur keine Einigkeit herrscht." In einer Broschüre "Mammografie Screening - Was Multiplikatorinnen vor Ort wissen sollten" wird überdies auf den bislang oft unterbelichteten Aspekt der Beratung und sozialen Unterstützung betroffener Frauen hingewiesen: "Die Bedürfnisse der Frauen, für die ja eigentlich das Screening eingeführt wird, geraten dabei schnell aus dem Blick. Welche Informationen benötigen sie, um entscheiden zu können, ob sie das Screening in Anspruch nehmen wollen? Wo können sich Frauen vor oder nach dem Screening beraten lassen? Wie wird die Würde der Frau im Screening geachtet? Wie kann der Datenschutz gesichert werden? An wen kann sich eine Frau wenden, wenn sie Kritik oder Beschwerden über den Ablauf der Reihenuntersuchung hat?" Broschüre Mammographie-Screening, S. 4).
Gerd Marstedt, 18.10.2005