



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Alle Artikel aus:
Patienten
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr
Anwendungsbeobachtungen erhöhen die Arzneimittelausgaben
 Über Anwendungsbeobachtungen von Arzneimitteln, die von einem Hersteller veranlasst werden, haben wir mehrfach kritisch berichtet. Dieser Beitrag aus 2007 hat nach wie vor weitgehend Gültigkeit.
Über Anwendungsbeobachtungen von Arzneimitteln, die von einem Hersteller veranlasst werden, haben wir mehrfach kritisch berichtet. Dieser Beitrag aus 2007 hat nach wie vor weitgehend Gültigkeit.
Anwendungsbeobachtungen (AWB) sind eine Form der nichtinterventionellen Studien, die zumeist vom Hersteller der zu untersuchenden Substanz veranlasst und finanziert werden. Der Lobbyverband der forschenden Parma-Unternehmen bezeichnet AWB auch heute noch als "unverzichtbares Instrument für die Arzneimittelforschung" und ignoriert dabei Studien, wie die von Spelsberg et al. aus dem Jahr 2017. Eine Analyse von 558 AWBs konnte keinen nennenswerten Wissensgewinn für die Arzneimittelsicherheit entdecken; bemerkenswert war auch, dass weniger als 1% der Studien in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurden.
Eine neue Studie hat jetzt die lange gehegte Vermutung bestätigt, dass AWB sich auf das Verschreibungsverhalten der teilnehmenden Ärzte in dem Sinne auswirkt, dass sie das von ihnen in der AWB untersuchte Medikament nach Beendigung der AWB häufiger verschreiben als nicht teilnehmende Ärzte. Da in AWB vorzugsweise hochpreisige Medikamente untersucht werden, folgen daraus höhere Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung. Fehlender Erkenntnisgewinn aber erhöhte Verschreibung unterstreichen die Annahme, dass es sich bei Hersteller-gesponserten AWBs um ein Marketinginstrument handelt und nicht um seriöse wissenschaftliche Forschung.
In dieser Studie verglichen die Autoren das Verschreibungsverhaltens von 2354 Ärzten, die an einer von 24 AWBs teilgenommen hatten, mit 6996 Ärzten ohne Beteiligung an einer AWB. Die Daten wurden vom GKV-Spitzenverband zur Verfügung gestellt, an den jede AWB vor Beginn gemeldet werden muss mit dem Datum von Beginn und Ende, dem Ziel der Studie, den Namen und der lebenslangen Arztnummer der teilnehmenden Ärzte, dem Studienplan, der Vergütung der Ärzte und einem Vertragsmuster. Das arztindividuelle Verschreibungsverhalten wurde über die Arzneimittel-Schnellinformation für Vertragsärztinnen und -ärzte des GKV-Spitzenverbandes bestimmt.
Primärer Endpunkt war der Vergleich der Verschreibungen von AWB-ÄrztInnen mit den Verschreibungen der Vergleichsgruppe 1 Jahr vor, während und 1 Jahr nach der AWB.
Sekundärer Endpunkt war der Anteil der Verschreibungen für das Studienmedikament im Vergleich zu alternativen Medikamenten und der Umsatz, der durch die Verschreibungen generiert wurde.
In den 24 AWBs wurden am häufigsten Krebsmedikamente und Medikamente zur Beeinflussung des Immunsystems sowie Medikamente bei neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Ärzte, die an AWBs teilnahmen, verschrieben 8 bzw. 7% mehr von dem untersuchten Medikament während und ein Jahr nach Beendigung der Studie. Andere Medikamente für dieselbe Krankheit verschrieben sie seltener.
Die Autoren merken an, dass AWBs wenig reguliert sind, nur gemeldet aber nicht genehmigt werden müssen, keine Einverständniserklärung der einbezogenen Patienten erfordern aber die Behandlung der Patienten verändern. Erlaubt sollten nur solche Studien ein, die von der Zulassungsbehörde veranlasst werden bzw. über ein wissenschaftlich solides Design verfügen, das geeignet ist, Daten zu erheben, die für Patienten und ihre Sicherheit relevant sind.
Koch C, Schleeff J, Techen F, Wollschläger D, Schott G, Kölbel R, et al. Impact of physicians' participation in non-interventional post-marketing studies on their prescription habits: A retrospective 2-armed cohort study in Germany. PLOS Medicine. 2020;17(6):e1003151. Link
Spelsberg A, Prugger C, Doshi P, Ostrowski K, Witte T, Hüsgen D, et al. Contribution of industry funded post-marketing studies to drug safety: survey of notifications submitted to regulatory agencies. BMJ. 2017;356. Link
David Klemperer, 29.6.20
Senken langjährige Raucher ihr Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko durch Nichtmehrrauchen? Jein, selbst nach 15 Jahren nicht völlig!
 Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.
Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.
Wenig hilfreich oder letztlich nicht vertrauenerweckend war aber die bisher durch Studien gestützte Spannbreite von 2 bis 20 Jahren, in denen dieses Risiko für Raucher nach Beendigung des Rauchens auf das von ständigen Nichtrauchern gesunken ist. Weit in ambulanten Praxen verbreitete Risikokalkulatoren kommen zum Ergebnis, dass frühere Raucher nur noch für 5 Jahre nach Beendigung des Tabakkonsums ein erhöhtes Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko haben.
Die Ergebnisse einer aktuellen methodisch hochwertigen Teilstudie mit 8.770 TeilnehmerInnen der Framing Heart Study sind geeignet die Verbreitung zu optimistischer oder pessimistischer Erwartungen zu verhindern. Untersucht wurde deren Rauchverhalten und die Inzidenzen der Herz-/Kreislauferkrankungen für den Zeitraum 1971 bis 2015.
Bei zwei Risikovergleichen lauten die Ergebnisse unter Berücksichtigung einer Reihe von Confoundern folgendermaßen:
• Im Vergleich von Rauchern, die 20 oder mehr Jahre geraucht haben, ist das Herz-/Kreislauferkrankungs-Risiko der Personen, die das Rauchen aufgehört haben nach 5 Jahren deutlich geringer als das derjenigen Personen, die weiterrauchten (6,9 versus 11,6 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren).
• Beim Vergleich des Herz-/Kreislauferkrankungs-Risikos der Personen, die das Rauchen aufhörten mit den Personen, die nie geraucht haben, war aber das Risiko der ersteren auch nach 10 bis 15 Jahren höher (6,31 versus 5,09 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren), in einer Teilgruppe sogar auch noch nach 24 Jahren.
Auch wenn die Beendigung selbst mehrjährigen Rauchens sicherlich eine Entscheidung mit gesundheitlichem Nutzen ist, sollte dies weder von ÄrztInnen noch von Noch-Rauchern mit dem Argument oder der Erwartung eines sehr schnellen vollen Erfolgs verknüpft werden. Am besten ist, gar nicht mit dem Tabakrauchen anzufangen und dafür mit geeigneten Mitteln (z.B. vollkommenes Werbeverbot) zu sorgen.
Der Aufsatz Association of Smoking Cessation With Subsequent Risk of Cardiovascular Disease von "JAMA" (322(7):642-650) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.8.19
Verbessern finanzielle Anreize die Qualität gesundheitlicher Leistungen? Nein, und auch nicht wenn sie länger einwirken!
 Zu den immer wieder patentrezeptartig empfohlenen Mitteln die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern gehören finanzielle Anreize für das Erreichen bestimmter quantitativer und qualitativer Ziele der Prozess- und Ergebnisqualität. Eine Fülle derartiger Programme im Bereich der stationären und ambulanten Versorgung existieren und wirken insbesondere in den USA unter der Sammelüberschrift "pay-for-performance" oder P4P bereits seit den 1990er Jahren und wurden dort auch evaluiert.
Zu den immer wieder patentrezeptartig empfohlenen Mitteln die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern gehören finanzielle Anreize für das Erreichen bestimmter quantitativer und qualitativer Ziele der Prozess- und Ergebnisqualität. Eine Fülle derartiger Programme im Bereich der stationären und ambulanten Versorgung existieren und wirken insbesondere in den USA unter der Sammelüberschrift "pay-for-performance" oder P4P bereits seit den 1990er Jahren und wurden dort auch evaluiert.
Die wesentlichen Ergebnisse der Evaluationsstudien zu zwei wichtigen P4P-Programmen (die "Premier Hospital Quality Incentive Demonstration [HQID]" in den Jahren 2003 bis 2009 und das "Hospital Value-based Purchasing"-Programm [HVBP] seit 2010) lauten, dass sich P4P-Programme nur in sehr geringem Umfang auf wichtige Faktoren der Prozessqualität auswirken, den patientenbezogenen Outcome nicht verbessern und auch nichts zur Kostenreduktion beitragen. Wer sich genauer für diese Ergebnisse interessiert findet im Literaturverzeichnis des hier vorgestellten Aufsatzes 10 relevante Studien.
Trotz der Fülle der Belege für die eingeschränkten oder fehlenden Effekte des eingangs skizzierten Anreiz-Wirkungsmodells machen seine Protagonisten dafür aber die zu geringe Wirkungszeit der Anreize und/oder den zu geringen Umfang der Anreize verantwortlich. Um die gewünschten Effekte doch noch erreichen zu können, müssten also P4P-Programme länger laufen oder ihr Finanzvolumen größer sein.
Zumindest die Hoffnung auf die Wirkung längerer Einwirkungszeiten finanzieller Anreize erweist sich nach einer aktuellen Studie in den USA aber als irrig.
In dieser Studie werden für den Zeitraum von 2003 bis 2013 die Outcomes (Mortalität innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung und ein Scorewert für verschiedene Faktoren der Prozessqualität) von 1.371.364 Patienten, die 65 Jahre und älter waren und in der staatlichen Krankenversicherung Medicare versichert waren in 1.189 us-amerikanischen Kliniken verglichen. Eine Gruppe von 214 Kliniken behandelte ihre PatientInnen bereits seit 2003 und bis 2009 im Rahmen des P4P-Programms HQID und setzte ihre P4P-Praxis bis 2013 unter dem HVBP-Programm fort. Diesen so genannten "early adopters" von P4P mit einer Anreizdauer von runbd 10 Jahren stand eine Gruppe von 975 so genannten "late adopters" mit einer P4P-Dauer von drei Jahren (2010 bis 2013) gegenüber.
Trotz der enormen Unterschiede der Dauer mit der die finanziellen Anreize der P4P-Programme einwirken konnten gab es weder beim Gesamtwert für die Prozessqualität noch bei den Mortalitätstrends für ausgewählte Erkrankungen einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Krankenhausgruppen.
Die für die weitere Debatte entscheidende Erkenntnis ihrer Studie fassen die AutorInnen so zusammen: "Pay for performance programs as currently implemented are unlikely to be successful in the future, even if their timeframes are extended."
Trotz einiger methodischer Limitationen der Studie (z.B. Konzentration auf die Behandlung älterer Patienten, Vergleich zweier Beobachtungsstudien) sollten diese Ergebnisse den gesundheitspolitischen Akteuren, die auch in Deutschland über die Qualitätsverbesserung mittels P4P-Programmen nachdenken, zu denken geben. Ob höhere finanzielle Anreize dabei hilfreich sind oder ganz andere Anreize und Zielgrößen relevanter sind, sollte vor dem Start neuer Patentrezepturen gründlich geprüft werden.
Der Aufsatz Impact of Financial Incentives on Early and Late Adopters among US Hospitals: observational study von Igna Bonfrer, Jose F Figueroa, Jie Zheng, E John Orav und Ashish K Jha ist im Januar 2018 in der Fachzeitschrift "BMJ" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.1.18
Entgegen gesundheitsökonomischen Erwartungen: Selbstbehalte reduzieren nicht die Inanspruchnahme wertloser Gesundheitsleistungen
 Die Erwartung immer noch zahlreicher Gesundheitsökonomen durch materielle Anreize die Inanspruchnahme tatsächlich oder vermeintlich unnötiger Gesundheitsleistungen zu verhindern und damit u.a. Kosten zu sparen, wird in den allermeisten Fällen empirisch widerlegt oder geht mit so vielen unerwünschten Nebenwirkungen einher, dass das jeweilige Anreizmodell eingestellt wird. Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) war dies zuletzt bei der Praxisgebühr der Fall, wo u.a. auch notwendige Arztbesuche vermieden oder so weit verschoben wurden, dass die Kosten für zusätzlich notwendige Behandlungen die der einmal vermiedenen Behandlung überwogen - von Lebensqualitätsverlusten durch verschleppte Erkrankungen ganz abgesehen.
Die Erwartung immer noch zahlreicher Gesundheitsökonomen durch materielle Anreize die Inanspruchnahme tatsächlich oder vermeintlich unnötiger Gesundheitsleistungen zu verhindern und damit u.a. Kosten zu sparen, wird in den allermeisten Fällen empirisch widerlegt oder geht mit so vielen unerwünschten Nebenwirkungen einher, dass das jeweilige Anreizmodell eingestellt wird. Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) war dies zuletzt bei der Praxisgebühr der Fall, wo u.a. auch notwendige Arztbesuche vermieden oder so weit verschoben wurden, dass die Kosten für zusätzlich notwendige Behandlungen die der einmal vermiedenen Behandlung überwogen - von Lebensqualitätsverlusten durch verschleppte Erkrankungen ganz abgesehen.
Eine aktuelle Studie in den USA zeigt nun, dass auch Hoffnungen durch finanzielle Anreize die milliardenschwere Inanspruchnahme von Laboruntersuchungen oder bildgebenden Untersuchungen mit geringem Wert ("low value") zu verhindern, aufgegeben werden müssen.
Konkret geht es um eine quasiexperimentelle Studie mit den Versorgungsdaten von 376.091 Versicherte im Alter von 18 bis 63 Jahren eines großen us-amerikanischen Krankenversicherungsunternehmens, in dem die Studienangehörigen zwischen 2011 und 2013 versichert waren. 365.016 dieser Versicherten waren in einem traditionellen Vertrag versichert, 11.075 in einem so genannten "consumer-directed health plan (CDHP)". In CDHPs sollen die Versicherten durch entsprechend hohe Selbstbehalte und bestimmte steuerliche Anreize für Selbstzahlungen von Leistungen motiviert werden generell kostenbewusst zu handeln und z.B. unnötige Arztbesuche und entsprechende Kosten für ihre Krankenversicherung zu vermeiden. In der Studie wurde nun zusätzlich untersucht, ob diese Incentives Einfluss auf die Inanspruchnahme von nach Meinung von ärztlichen Fachgesellschaften oder Qualitätsinitiativen (z.B. Choosing wisely) geringwertigen oder wertlosen medizinischen Leistungen (z.B. ein routinemäßiges Elektroenzephalogramm (EEG) bei Kopfschmerzen, spinale Schmerzmittelinjektion bei Rückenschmerzen oder Stresstests bei stabiler Erkrankung der Herzkranzgefäße) gehabt hatten.
Die Ergebnisse sahen so aus:
— Die jährlichen Gesamtausgaben für die ambulante Versorgung lagen nach mehrfachen Adjustierungen nach Alter, Geschlecht etc. bei den CDHP-Versicherten 231,60 US-Dollar unter denen für die in traditionellen Versorgungsmodellen versicherten Personen.
— Wenn es um die jährlichen Ausgaben für die die 26 "low value"-Untersuchungen ging, gab es dagegen bei einem Minderbetrag von 3,64 US-Dollar bei den CDHP-Personen keinen signifikanten Unterschied zwischen den Versicherten beider Gruppen, also keinen der erhofften qualitativen aber auch finanziellen Effekte des Anreizes oder der drohenden Finanzbelastung durch Selbstbehalte bei Inanspruchnahme in CDHP-Versicherungsverhältnissen.
Welche praktische Bedeutung dieses Ergebnis hat, zeigen zwei empirische Sachverhalte: In den USA entfiel ein großer Teil der nach Schätzung der National Academy of Sciences jährlich für wertlose gesundheitsbezogene Leistungen bezahlten 750 Milliarden US-Dollar auf diese 26 Leistungen. Im Bereich der durch Arbeitgeber angebotenen Krankenversicherungsverträge wuchs der Anteil von CDHP-Verträgen innerhalb der letzten 10 Jahre von 4% auf 29%. Der CDHP-Anteil betrug bei den Personen, die ihren Versicherungsschutz auf den durch Obamacare geschaffenen Versicherungs-"Marktplätzen" erwarben, fast 90%.
In der Diskussion ihrer Ergebnisse weisen die bei der RAND Coporation und mehreren Universitäten beschäftigten AutorInnen zum einen darauf hin, dass manche Ergebnisse bereits aus anderen, jahrzehntealten Studien (z.B. dem Rand Health Insurance Experiment) bekannt sind. Zum anderen geben sie zu bedenken, dass "the most effective locus to spur value-conscious decisions may not be patients, but providers. Price transparency does not consistently result in patient price shopping, even for those in CDHPs. However, payment arrangements that give providers "skin in the game," like Blue Cross Blue Shield of Massachusetts' Alternative Quality Contract, have achieved cost savings by steering patients toward lower-priced services." Es könne also sein, "that appropriately targeted provider incentives have potential to reduce wasteful low-value spending."
Der Aufsatz Impact of Consumer-Directed Health Plans on Low-Value Healthcare von Rachel O. Reid, Brendan Rabideau und Neeraj Sood ist am 7. Dezember 2017 online first in der Fachzeitschrift "The American Journal of Managed Care" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.12.17
Handhygiene in Kliniken: "probably slightly reduces infection…and colonisation rates" aber "based moderate certainty of evidence"
 Eine Erhöhung der Häufigkeit und Gründlichkeit der Handhygiene aller Beschäftigten in Krankenhäusern reduziert nach zahlreichen weltweiten Studien sowohl die Keimbesiedlung als auch die Rate der oft schwerwiegenden Infektionen und Todesfälle. Da dies entgegen manchen Erwartungen an die Professionalität von Ärzten und Pflegekräften nicht automatisch zu den notwendigen Veränderungen von Einstellungen und Verhalten von Ärzten und Pflegekräften geführt hat, wurde die Erkenntnis in eine Vielzahl unterschiedlichster Interventionsvorschlägen integriert - darunter z.B. ein umfangreicher Handlungskatalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Eine Erhöhung der Häufigkeit und Gründlichkeit der Handhygiene aller Beschäftigten in Krankenhäusern reduziert nach zahlreichen weltweiten Studien sowohl die Keimbesiedlung als auch die Rate der oft schwerwiegenden Infektionen und Todesfälle. Da dies entgegen manchen Erwartungen an die Professionalität von Ärzten und Pflegekräften nicht automatisch zu den notwendigen Veränderungen von Einstellungen und Verhalten von Ärzten und Pflegekräften geführt hat, wurde die Erkenntnis in eine Vielzahl unterschiedlichster Interventionsvorschlägen integriert - darunter z.B. ein umfangreicher Handlungskatalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Ob diese Interventionen aber wirksam und ausreichend sind oder möglicherweise nicht, war das Thema eines bereits im Jahr 2004 gestarteten so genannten Cochrane Reviews, also eines Versuchs den Stand der Forschung möglichst auf der Basis von methodisch hochwertigen primären Interventionsstudien (vor allem randomisierte kontrollierte Studien) zu ermitteln.
In einer ersten Veröffentlichung über die Ergebnisse zweier Studien aus dem Jahr 2007 hieß es dann: "There is not enough evidence to be certain about what strategies improve hand hygiene compliance. 'One off' teaching sessions about hand hygiene may not improve hand hygiene, but again there is not enough evidence to be certain. More research is needed." (Dinah Gould, Jane H Chudleigh, Donna Moralejo, Nicholas Drey: Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care).
Nach einem zweiten Review im Jahr 2010 mit etwas mehr Studien, konnte die Reviewergruppe jetzt 2017 auf die Ergebnisse von 26 weltweit zwischen November 2009 und Oktober 2016 in verschiedenen Krankenhaustypen durchgeführte Studien zurückgreifen, darunter 14 randomisierte, zwei nicht-randomisierte und 10 andere klinische Studien (Vorher-Nachher-Analysen und "interrupted time series(ITS)"-Analysen).
Im Zentrum aller Studien und des Reviews stand die Frage, ob Handhygiene mit Seife oder alkoholhaltigen Mitteln oder beiden Stoffen und den verschiedensten Arrangements und Feedbacktechniken die Keimbesiedlung und die Infektions- oder gar Sterblichkeitshäufigkeit reduzierten oder nicht.
Trotz der im gesamten Zeitraum immer wieder betonten Relevanz der Handhygiene, der Vielzahl an Untersuchungen und des langen Beobachtungszeitraums sind die Ergebnisse sehr durchwachsen und schwächer als für die weitere Praxis erhofft.
Die trotzdem vorhandene Generaltendenz lässt sich an der Zusammenfassung der Interventionen auf Basis der WHO-Empfehlung ablesen. Hierzu heißt es: "Multimodal interventions that include some but not all strategies recommended in the WHO guidelines may slightly improve hand hygiene compliance (five studies; 56 centres) and may slightly reduce infection rates (three studies; 34 centres), low certainty of evidence for both outcomes."
Auch wenn Konsens besteht, dass komplexere Interventionen mehr bewirken als unimodale, kommt es auch durch sie nicht zum durchschlagenden Erfolg bei Keimbesiedlung und Infektionen und selbst diese Ergebnisse sind nicht hochevident und unbestreitbar.
So ähnelt die Zusammenfassung des 2017-er-Reviews auch nach rund 13-jähriger Arbeit am Forschungsstand sehr dem zitierten zehn Jahre alten ersten Ergebnis: "With the identified variability in certainty of evidence, interventions, and methods, there remains an urgent need to undertake methodologically robust research to explore the effectiveness of multimodal versus simpler interventions to increase hand hygiene compliance, and to identify which components of multimodal interventions or combinations of strategies are most effective in a particular context."
Zu dem am 1. September 2017 veröffentlichten Cochrane Review Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care von Gould DJ, Moralejo D, Drey N, Chudleigh JH, Taljaard M. gibt es kostenlos eine umfangreiche Zusammenfassung.
Bernard Braun, 13.9.17
Fortbildungspflicht für Ärzte: Umstritten, aber wirksam
 Verpflichtende Fortbildungen für Mediziner gelten als wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung in der Krankenversorgung. Auch in Deutschland müssen beispielsweise niedergelassene ÄrztInnen innerhalb von fünf Jahren 250 Fortbildungspunkte nachweisen. Bei MedizinerInnen sind diese Pflichtveranstaltungen eher unbeliebt, viele betrachten sie als unnötig bzw. überflüssig und bezweifeln die Wirksamkeit derartiger Fortbildungsprogramme. Drei ExpertInnen vom American Board of Internal Medicine, der us-amerikanischen Fachgesellschaft für innere Medizin mit Sitz in Philadelphia, sind der Frage nachgegangen, ob verpflichtenden Fortbildungsprogramme für Mediziner messbare Wirkungen zeigen. Die Ergebnisse ihrer Analyse haben Jonathan Vandergrift, Bradley Gray und Weifeng Wenig nun unter dem Titel Do State Continuing Medical Education Requirements for Physicians Improve Clinical Knowledge? online vorab in der Zeitschrift Health Services Research erschienen.
Verpflichtende Fortbildungen für Mediziner gelten als wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung in der Krankenversorgung. Auch in Deutschland müssen beispielsweise niedergelassene ÄrztInnen innerhalb von fünf Jahren 250 Fortbildungspunkte nachweisen. Bei MedizinerInnen sind diese Pflichtveranstaltungen eher unbeliebt, viele betrachten sie als unnötig bzw. überflüssig und bezweifeln die Wirksamkeit derartiger Fortbildungsprogramme. Drei ExpertInnen vom American Board of Internal Medicine, der us-amerikanischen Fachgesellschaft für innere Medizin mit Sitz in Philadelphia, sind der Frage nachgegangen, ob verpflichtenden Fortbildungsprogramme für Mediziner messbare Wirkungen zeigen. Die Ergebnisse ihrer Analyse haben Jonathan Vandergrift, Bradley Gray und Weifeng Wenig nun unter dem Titel Do State Continuing Medical Education Requirements for Physicians Improve Clinical Knowledge? online vorab in der Zeitschrift Health Services Research erschienen.
Die Autoren konnten dabei die Ergebnisse eines natürlichen Experiments auswerten, das Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der kontinuierlichen ärztlichen Fortbildung (continuing medical education - CME) erlaubt. Verschiedene Bundesstaaten der USA veränderten zeitlich versetzt die Anforderungen an die verpflichtende Fortbildung von ÄrztInnen. Dabei handelte es sich entweder um eine Erhöhung der jährlich zu absolvierenden Fortbildungsstunden oder um eine Verkürzung der Fristen, innerhalb derer eine bestimmte Punktzahl zu sammeln ist.
Anders als beispielsweise in Deutschland müssen ÄrztInnen in den USA nach dem Examen bzw. ihrer Approbation alle zehn Jahre ihre Berufsqualifikation in so genannten Maintenance-of-Certification (MOC) Prüfungen nachweisen, wenn sie ärztlich tätig bleiben wollen. Diese MOC-Programme liegen in der Zuständigkeit der zuständigen Fachgesellschaften, die damit die Eignung ihrer aktiven Mitglieder überprüfen und die Qualität der Versorgung sicherstellen wollen. Erfüllen MedizinerInnen die jeweiligen Anforderungen nicht, können sie ihre Berufszulassung verlieren. Neben der Aufrechterhaltung der medizinischen Approbation sollen die MOC-Prüfungen ÄrztInnen zu lebenslangem Lernen und einer kritischen Selbsteinschätzung bewegen, ihre klinischen Kenntnisse vertiefen und zur Verbesserung der Versorgungspraxis beitragen.
Bis zum Jahr 2015 waren die Prüfungen zur Aufrechterhaltung der Approbation dem Examen am Ende des Medizinstudiums sehr ähnlich und bedienten sich desselben Fragenpools. Unter Verwendung der Differenz-in-differenz-Methode untersuchten die Autoren nun, ob es regional und somit durch die jeweils geltenden Fortbildungsverpflichtungen bedingte Unterschiede zwischen den Ergebnissen des Abschlussexamens und der MOC-Prüfungen gab. Dabei konnten sie insgesamt 19.563 allgemein-internistisch tätige ÄrztInnen in ihre Studie einschließen, die zwischen 1996 und 2003 ihr medizinische Examen abgelegt und zwischen 2006 und 2013 an MOC-Prüfungen teilgenommen hatten.
Unter Berücksichtigung des möglichen Einflusses potenzieller Confounder wie bestimmter Eigenschaften der ÄrztInnen (Geschlecht, Berufserfahrung, Art der Praxis u. a.) und des Bezirks (z. B. Pro-Kopf-Einkommen) und anderer Indikatoren, die keiner erkennbaren zeitlichen Abhängigkeit unterworfen waren, ermittelten die AutorInnen durch lineare Regression ein um 0,119 (p < 0,001) verbessertes, standardisiertes MOC Prüfungs-Ergebnis in den Bundesstaaten, die zumeist durch Einführung zusätzlicher Vorgaben ihre CME-Anforderungen erhöht hatten, wo die ÄrztInnen also mehr CME-Punkte pro Jahr oder innerhalb von drei Jahren sammeln mussten. Die Verkürzung der Frist, innerhalb derer die vorgeschriebene Punktzahl zu erreichen war, hatte hingegen keine signifikanten Auswirkungen auf die Prüfungsergebnisse, denn sie korrelierten nur mit einer Verbesserung um 0.061 (p = 0,058). Insgesamt kommen die AutorInnen zu dem Ergebnis, dass die vergleichsweise strikten CME-Vorgaben der US-Bundesstaaten für MedizinerInnen sinnvoll sind und [stringentere Vorgaben zu einer Verbesserung qualitätsrelevanter klinischer Kenntnisse von KlinikerInnen beitragen können.
Dieses Ergebnis ist insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Debatte über Patientenbeteiligung und -verantwortung, shared decison making und letztlich auch über das "chosing-wisely-Konzept von großer Bedeutung. Die aktuelle Diskussion über eine stärkere Einbeziehung von PatientInnen als Ko-ProduzentInnen ihrer Gesundheit, als Mitentscheider im Zuge einer verbesserten Partizipation im Gesundheitswesen und als eigenverantwortliche Akteure drängt die Frage nach der Verantwortung des Gesundheitswesens in den Hintergrund. Es ist aber illusorisch, die Bringschuld des Versorgungssystems zu vernachlässigen und die erforderlichen Stellschrauben anzusetzen, damit dessen professionelle AkteurInnen nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen. Einen Ansatz zur Verbesserungh der Versorgungsqualität unterstreicht nun die Studie von Jonathan Vandergrift und seinen KollegInnen.
Die Studie Do State Continuing Medical Education Requirements for Physicians Improve Clinical Knowledge ist zunächst als Online-Version in Health Services Research erschienen. Das Abstract steht kostenfrei zum Download zur Verfügung; AbonnentInnen können den vollständigen Artikel als PDF direkt herunterladen.
Jens Holst, 28.4.17
Handy-Textbotschaften verbessern die Therapietreue bei chronisch kranken Personen: Ja, aber mit zahlreichen Einschränkungen.
 Die so genannte Therapietreue, Compliance oder Adhärenz von PatientInnen mit der langanhaltenden medikamentösen Behandlung einer chronischen Erkrankung ist schlecht. Zahlreiche Studien und ein Review der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommen zum Ergebnis, dass rund die Hälfte dieser PatientInnen die ihnen verordneten Medikamente entweder gar nicht oder nicht in der für ihre Wirkung notwendigen Menge oder Frequenz einnehmen. Dies kann erhebliche gesundheitliche Nachteile auslösen und stellt eine enorme finanzielle Verschwendung knapper Ressourcen dar.
Die so genannte Therapietreue, Compliance oder Adhärenz von PatientInnen mit der langanhaltenden medikamentösen Behandlung einer chronischen Erkrankung ist schlecht. Zahlreiche Studien und ein Review der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommen zum Ergebnis, dass rund die Hälfte dieser PatientInnen die ihnen verordneten Medikamente entweder gar nicht oder nicht in der für ihre Wirkung notwendigen Menge oder Frequenz einnehmen. Dies kann erhebliche gesundheitliche Nachteile auslösen und stellt eine enorme finanzielle Verschwendung knapper Ressourcen dar.
Daher untersuchten ebenfalls zahlreiche Studien immer wieder, ob es nicht Instrumente, Prozeduren oder Methoden gibt, diesen Anteil zu veringern. Meistens blieb deren Wirkung aber gering.
Mit der wachsenden Verbreitung und Nutzung von mobilen Telefonen und von mit ihnen zu empfangenden Textbotschaften, untersuchten weitere Studien, ob sie eines dieser Hilfsmittel sein könnten.
Eine im März 2016 veröffentlichte Meta-Analyse von 16 randomisierten kontrollierten Studien versuchte darauf belastbare Antworten zu geben. In 5 der Studien waren die Textbotschaften personalisiert, 8 erlaubten Zweiwegkommunikation und in 8 gab es tägliche Botschaften oder Hinweise. Die durchschnittliche Interventionsdauer betrug 12 Wochen und die Feststellung der Wirksamkeit auf die Therapietreue beruhte auf Selbsteinschätzung der PatientInnen.
Die Ergebnisse lauteten:
• Die Meta-Analyse der Effekte auf 2.742 PatientInnen zeigte eine signifikante Verbesserung der Therapietreue. Die Chance verdoppelte sich (odds ratio 2,11). Und verringerte sich nach einer rechnerischen Berücksichtung eines so genannten "publication bias" leicht auf den immer noch signifikanten Wert von 1,68.
• Die unterschiedlichen Kommunikationsweisen wirkten sich nicht auf die Wirkung der Intervention aus.
• Einschränkend weisen die AutorInnen darauf hin, dass sich der Anteil der therapietreuen PatientInnen durch die Textbotschaften per Smartphone lediglich von 50% auf 67,8% vergrößert und nachwievor über 30% noncompliant sind.
• Unklar bleibt außerdem, ob sich der Effekt nach einer längeren Interventionszeit weiter erhöht, stagniert oder sogar wieder abnimmt. Dies gilt auch dann, wenn die Interventionen aufhören.
• Die AutorInnen sind sich auch unsicger, ob sie sich gerade bei der Therapietreue auf die Selbstangaben der PatientInnen verlassen können, die u.U. dadurch als zu positiv angegeben werden, weil Therapetreue ein offensichtlich sozial erwünschtes Ergebnis ist.
• Offen bleibt schließlich, ob die verbesserte Therapietreue überhaupt einen positiven Einfluss auf die Behandlungsergebnisse hat.
Bevor diese offenen Fragen und Schwächen nicht in weiteren Studien eindeutig geklärt sind, sollten Textbotschaften per Mobiltelefon nicht als die Lösung für alle Therapietreueprobleme betrachtet werden.
Der Aufsatz Mobile Telephone Text Messaging for Medication Adherence in Chronic DiseaseA Meta-analysis von Jay Thakkar et al. ist im März 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" (176(3): 340-349) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.4.16
Je nach Thema bewirken auch Arzt-Ratschläge nichts: Das Beispiel Impfen.
 Entscheidungen für oder gegen eine gesundheitsbezogene Maßnahme (z.B. Auswahl eines Krankenhauses, Durchführung einer Früherkennungsuntersuchung) hängen oft von der Kommunikation mit Ärzten bzw. deren Empfehlungen ab. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, wo also gute Aufklärung durch Ärzte wirkungslos ist, zeigt eine gerade veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie über die Häufigkeit mit der Eltern zögern, ihre Kinder impfen zu lassen und die Selbstwirksamkeit von Ärzten.
Entscheidungen für oder gegen eine gesundheitsbezogene Maßnahme (z.B. Auswahl eines Krankenhauses, Durchführung einer Früherkennungsuntersuchung) hängen oft von der Kommunikation mit Ärzten bzw. deren Empfehlungen ab. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, wo also gute Aufklärung durch Ärzte wirkungslos ist, zeigt eine gerade veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie über die Häufigkeit mit der Eltern zögern, ihre Kinder impfen zu lassen und die Selbstwirksamkeit von Ärzten.
An der Studie im US-Bundesstaat Washington beteiligten sich 56 Kliniken und 347 jungen Mütter. Bevor die Mütter in der Interventionsgruppe unmittelbar nach der Geburt eines gesunden Kindes umfassend und mittels eines 45-minütigen persönlichen Gesprächs über den Nutzen und die Risiken von Impfungen informiert wurden bewegte sich der Anteil impfzögerlicher Mütter nach eigenen Angaben zwischen 9,8% und 7,5%. In der Kontrollgruppe bewegte sich dieser Anteil zwischen 12,6% und 8%. In einer zweiten Befragung nach rund 6 Monaten unterschieden sich die Anteile der Mütter, die zögerten ihre Kinder impfen zu lassen bzw. der Grad der Selbstwirksamkeit der Ärzte, nicht und bewegten sich in beiden Gruppen um die 8%.
Offensichtlich sind Vorbehalte und Befürchtungen vor dem Impfen so stark untermauert, dass selbst kognitive und motivationale Aufklärung durch Ärzte wirkungslos sind.
Von dem am 1. Juni 2015 online in der us-amerikanischen Fachzeitschrift "Pediatrics" veröffentlichten Aufsatz Physician Communication Training and Parental Vaccine Hesitancy: A Randomized Trial von Nora B. Henrikson et al. gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 1.6.15
Therapietreue und Wirkung bei Medicare-PatientInnen mit Statin-Generika signifikant besser als mit Originalpräparaten
 Auch bei hochwirksamen gesundheitlich notwendigen Arzneimitteln ist häufig die Therapietreue gering, d.h. bis zu 50% der Patienten nehmen das verordnete Arzneimittel gar nicht, nicht in der notwendigen Menge oder nicht im notwendigen Rhythmus ein. Dies ist auch bei den zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse (z.B. Herzinfarkt) eingesetzten Statinen der Fall.
Auch bei hochwirksamen gesundheitlich notwendigen Arzneimitteln ist häufig die Therapietreue gering, d.h. bis zu 50% der Patienten nehmen das verordnete Arzneimittel gar nicht, nicht in der notwendigen Menge oder nicht im notwendigen Rhythmus ein. Dies ist auch bei den zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse (z.B. Herzinfarkt) eingesetzten Statinen der Fall.
In einer jetzt veröffentlichten Studie, die erstmals mit den Routinedaten von 90.111 Medicare-Versicherten, also 65-Jährigen und Älteren, die zwischen 2006 und 2008 ein Statin verordnet bekommen hatten, udie Therapietreue und die Wirksamkeit der Behandlung untersuchte, gab es zwei mehr oder weniger unerwartete Ergebnisse:
• Von den im Durchschnitt 75,6 Jahre alten und zu 61% weiblichen Patienten erhielten 93% ein Statin-Generikum und nur 7% ein Originalpräparat. Die Zuzahlung betrug für die Generika im Durchschnitt 10 und für die Originalpräparate 48 US-Dollar. Der als Maß für Therapietreue gewählte Anteil der Tage an denen das Präparat eingenommen wurde, belief sich bei Originalpräparaten auf 71% und bei Generika auf signifikant höhere 77%. Hier taucht ein bereits mehrfach in den USA entdeckter Zusammenhang zwischen niedrigen oder fehlenden Zuzahlungen und besserer Therapietreue erneut auf (vgl. dazu u.a. die folgende Meldung im "forum-Gesundheitspolitik": Keine Zuzahlungen für die Arzneimittelbehandlung von Herzinfarkt-Patienten verbessert Therapietreue und reduziert Ungleichheit ).
• Unterschiede gab es zusätzlich bei einem aus der Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen oder Schlaganfällen, akuten koronaren Symptomen und Sterblichkeit gebildeten Outcome-Indikator. Die Häufigkeit dieser unerwünschten Ereignisse war bei den PatientInnen, die ein Statin-Generikum einnahmen um signifikante 8% geringer. Der absolute Unterschied betrug 1,53 Ereignisse pro 100 Personenjahre.
Die AutorInnen schränken die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse auf Personen mit anderen, eher besseren Einkommensverhältnissen und eventuell anderen Mustern der Arzneimittelbehandlung selber ein. Ohne dass dies erkennbar die Ergebnisse beeinzuflussen scheint, geben sie außerdem an, dass diese Untersuchung von einem Hersteller von Statin-Generika finanziert wurde. Angesichts der Brisanz der Ergebnisse ist eine weitere unabhängige Untersuchung in anderen Versicherten- und Patientengruppen wünschenswert. Dabei wäre den möglichen Ursachen für diese Ergebnisse aber noch gründlicher nachzugehen.
Von dem Aufsatz Comparative effectiveness of generic and brand-name statins on patient outcomes: A cohort study. von Gagne JJ et al., erschienen in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" vom 16. September 2014 (161: 400) ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.14
Je später der Tag desto mehr Antibiotikaverordnungen gegen Atemwegsinfekten oder "mach lieber mal 'ne Pause".
 Die mehrfach problematische Verordnung von Antibiotika bei akuten Atemwegserkrankungen erfolgt weltweit trotz einiger langfristiger Verbesserungen immer noch zu häufig. Zu den Verbesserungen, aber auch einer Reihe von weiterhin unerwünschten Aspekten der Entwicklung (zu starker Einsatz so genannter "Reserve-Antibiotika") zwischen 2008 und 2012 liefert die Studie der Wissenschaftler vom Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) Entwicklung der ambulanten Antibiotikaverordnungen im Zeitraum 2008 bis 2012 im regionalen Vergleich von Hering R, Schulz Mandy und Bätzing-Feigenbaum J. aktuelle Hinweise. Da es sich bei akuten Atemwegsinfekten meist um virale, d.h. überhaupt nicht mit Antibiotika beeinflussbare Erkrankungen handelt, bleiben nur unerwünschte Wirkungen wie Verdauungsprobleme, die Entstehung von mehrfach resistenten Bakterienarten und eine zunehmende Anzahl von aus diesen Gründen gescheiterten Behandlungen übrig.
Die mehrfach problematische Verordnung von Antibiotika bei akuten Atemwegserkrankungen erfolgt weltweit trotz einiger langfristiger Verbesserungen immer noch zu häufig. Zu den Verbesserungen, aber auch einer Reihe von weiterhin unerwünschten Aspekten der Entwicklung (zu starker Einsatz so genannter "Reserve-Antibiotika") zwischen 2008 und 2012 liefert die Studie der Wissenschaftler vom Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) Entwicklung der ambulanten Antibiotikaverordnungen im Zeitraum 2008 bis 2012 im regionalen Vergleich von Hering R, Schulz Mandy und Bätzing-Feigenbaum J. aktuelle Hinweise. Da es sich bei akuten Atemwegsinfekten meist um virale, d.h. überhaupt nicht mit Antibiotika beeinflussbare Erkrankungen handelt, bleiben nur unerwünschte Wirkungen wie Verdauungsprobleme, die Entstehung von mehrfach resistenten Bakterienarten und eine zunehmende Anzahl von aus diesen Gründen gescheiterten Behandlungen übrig.
Zu letzterem vermittelt eine am 23. September 2014 veröffentlichte Langzeitstudie aus Großbritannien wichtige Informationen: Antibiotic treatment failure in four common infections in UK primary care 1991-2012: longitudinal analysis von Craig J Currie et al., veröffentlicht im "Britrish Medical Journal (BMJ)" (349: g5493) - kostenlos-komplett).
Für die Beantwortung der letztlich immer noch nicht abschließend geklärten Frage warum Ärzte trotz des Wissens über Viren und Bakterien und trotz eindeutiger Behandlungsleitlinien bei akuten Atemwegsinfekten Antibiotika verordnen und Eltern dies trotz weit verbreiteter Vorbehalte gegenüber Antibiotika nach Ärzteberichten für sich und ihre Kinder hartnäckig fordern, gibt es nun aus einer am 6. Oktober 2014 veröffentlichten Auswertung von Behandlungsdaten eine weiteres interessantes Puzzleteil.
Dazu werteten us-amerikanische Wissenschaftler über 17 Monate lang die Abrechnungsunterlagen sowie die elektronischen Behandlungsdaten aus 23 verschiedenen Allgemeinarztpraxen aus. Dabei untersuchten sie speziell Diagnosen, Besuchszeiten im Verlauf des Tages (von morgens 8 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr), die Verordnung von Antibiotika und den sonstigen Gesundheitszustand von über 21.000 Kontakten von Ärzten mit Patienten, die an einem akuten Atemwegsinfekt litten. Ihr Fund: Die Häufigkeit von Antibiotikaverordnungen für dieselbe diagnostistizierte Erkrankung stieg im Laufe des Tages und insbesondere am Nachmittag an.
Am Ende der Nachmittagssprechzeit erhielten 5% mehr Patienten ein Antibiotikum verordnet als zu Beginn der morgendlichen Sprechstunden.
Auch wenn die AutorInnen vorschlagen, noch genauer nach den Ursachen zu forschen und dann eventuell Lösungsmöglichkeiten zu testen, formulieren sie folgende möglicherweise hilfreichen Ratschläge: "Remedies for this problem might include different schedules, shorter sessions, more breaks or maybe even snacks."
Von dem in der online first-Ausgabe der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" am 6. Oktober 2014 ertschienenen Aufsatz Time of Day and the Decision to Prescribe Antibiotics von Jeffrey A. Linder et al. gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 7.10.14
"Mindestens 2x täglich", aber wie am besten ist unklar oder evidenzbasierte Zähneputztechnik Fehlanzeige!
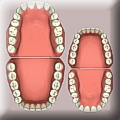 Wer hat nicht bereits seit Kindesbeinen an mit immer neuen und raffinierteren Techniken und mit von Zahnärzten, Gesundheitsratgebern und natürlich Herstellern empfohlenen Apparaten versucht, seine Zähne und Kiefer so gründlich zu reinigen, dass "Karius und Baktus" keine Chance hatten. Wie in kaum einem anderen gesundheitlichen Bereich gilt die richtige Eigenaktivität als entscheidende Voraussetzung fürs Gesundbleiben. Wer trotzdem an den Zähnen erkrankt oder sie gar verliert, hat sich dies selbst zuzuschreiben. Und folgerichtig sind weite Bereiche der gesundheitlichen Versorgung des Gebisses auch eine Art "GKV-freie" Zone, deren Finanzlücken durch private Zusatzversicherungen oder üppige, d.h. den GKV-Kassenzuschuss vielfach übertreffende "Zu"-Zahlungen gefüllt werden müssen.
Wer hat nicht bereits seit Kindesbeinen an mit immer neuen und raffinierteren Techniken und mit von Zahnärzten, Gesundheitsratgebern und natürlich Herstellern empfohlenen Apparaten versucht, seine Zähne und Kiefer so gründlich zu reinigen, dass "Karius und Baktus" keine Chance hatten. Wie in kaum einem anderen gesundheitlichen Bereich gilt die richtige Eigenaktivität als entscheidende Voraussetzung fürs Gesundbleiben. Wer trotzdem an den Zähnen erkrankt oder sie gar verliert, hat sich dies selbst zuzuschreiben. Und folgerichtig sind weite Bereiche der gesundheitlichen Versorgung des Gebisses auch eine Art "GKV-freie" Zone, deren Finanzlücken durch private Zusatzversicherungen oder üppige, d.h. den GKV-Kassenzuschuss vielfach übertreffende "Zu"-Zahlungen gefüllt werden müssen.
Eine am 8. August 2014 in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "British Dental Journal" veröffentlichte Studie zeigt nun aber, dass das weite Feld der händischen, elektrischen, vibrierenden, rotierenden, pulsierenden, kreisendenZahnputztechniken auch noch weitgehend evidenzfrei ist. Die meisten, oft aufwändigen und/oder teuren Techniken haben keinen nachgewiesenen gesundheitlichen Nutzen gegenüber einem einfachen, vorsichtigen horizontalen Bürsten. Die bunte Vielfalt der Empfehlungen ist durch ein großes Durcheinander sowie durch inter- und intranationale Widersprüche zwischen Fachgesellschaften, Putzgeräteherstellern oder Lehrbüchern geprägt.
Die Ergebnisse der britischen Dental-Gesundheitswissenschaftler basieren auf einer vergleichenden Untersuchung der von Zahnärzten oder sogar ihren "Ehefrauen" (so z.B. in einem im deutschen TV gezeigten Werbespot), Fachgesellschaften, Zahnbürstenherstellern und Lehrbuchautoren in 10 Ländern empfohlenen Zahnputztechniken.
Mit dem folgenden, in einem Artikel der "Süddeutschen Zeitung" über die britische Studie (Zähneputzen schwer gemacht von Werner Bartens am 11. August 2014) zitierten Votum eines Zahnmediziners handelt man wahrscheinlich nicht falsch: "Hauptsache gründlich. Nur dieses Wohlfühl-Putzen mit ein bisschen Schaum reicht nicht." Dies bedeutet freilich nicht, dass dies wissenschaftlich belegt ist.
Zum wiederholten Male stellt sich aber die Frage, warum die zahllosen und wortgewaltigen gesundheitsbezogenen Versprechen und geweckten Erwartungen auf Zahnbürsten und Geräten nicht erst dann zulässig sind, wenn sie belegt worden sind? Zu einem gesundheitsbezogenen Verbraucherschutz gehört es, dass dort wo "Gesundheit" draufsteht auch verlässlich und nachgewiesen "Gesundheit" bzw. Schadensfreiheit drin sein muss.
Wie viel patientenbezogene Fortschritte in diesem Gesundheitsversorgungsbereich noch gemacht werden können, verbirgt sich darin, dass ein Mensch mit durchschnittlicher Lebenserwartung sich mit jeder Menge Expertenhinweisen versehen zwar lebenslang rund 55.000mal (bei 2x täglich) oder noch öfter die Zähne putzt, ihm die Experten aber offensichtlich nicht eindeutig die richtige Methode empfehlen können.
Von dem Aufsatz An analysis of methods of toothbrushing recommended by dental associations, toothpaste and toothbrush companies and in dental texts von J. Wainwright und A. Sheiham, erschienen in der Zeitschrift "British Dental Journal" (217, E5) gibt es kostenlos ein kurzes Abstract.
Bernard Braun, 13.8.14
Ist der "brain drain" von Ärzten aus Ländern der Dritten Welt durch Einkommensverbesserungen zu stoppen? Das Beispiel Ghana.
 In der aktuellen Debatte über den Mangel an Ärzten und Pflegekräften zur Behandlung der Ebola-PatientInnen in den westafrikanischen Ländern, spielt auch das Argument eine Rolle, hier handle es sich um eine Folge des so genannten "brain drains" der Angehörigen dieser und anderer Berufe in europäische oder nordamerikanische Länder und Gesundheitssysteme. Als ein Grund für diese Mobilität gelten die Einkommensunterschiede zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern. Höhere Einkommen für Ärzte etc. in Ghana, Indonesien oder Honduras, so die Schlussfolgerung, würden die Abwanderung spürbar mindern.
In der aktuellen Debatte über den Mangel an Ärzten und Pflegekräften zur Behandlung der Ebola-PatientInnen in den westafrikanischen Ländern, spielt auch das Argument eine Rolle, hier handle es sich um eine Folge des so genannten "brain drains" der Angehörigen dieser und anderer Berufe in europäische oder nordamerikanische Länder und Gesundheitssysteme. Als ein Grund für diese Mobilität gelten die Einkommensunterschiede zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern. Höhere Einkommen für Ärzte etc. in Ghana, Indonesien oder Honduras, so die Schlussfolgerung, würden die Abwanderung spürbar mindern.
Ob dies stimmt und um welche Summen es dabei geht, untersuchte jetzt ein Wissenschaftler der RAND Corporation für den afrikanischen Staat Ghana genauer.
Dazu untersuchte er den Anteil afrikanischer Ärzte in 16 OECD-Ländern über 14 Jahre (1991 bis 2004). Er berücksichtigte dabei, dass es in Ghana im gesamten Zeitraum das staatliche Programm "Additional duty hours allowance (ADHA)" gab, das letztlich zu einer Erhöhung der dortigen Ärzteeinkommen beitrug. Obwohl für andere Zwecke geplant, stammte 2005 laut einer Studie knapp die Hälfte des Einkommens der ghanaesischen Ärzte aus dem ADHA-Topf.
Im Vergleich des "brain drain" aus Ghana mit dem aus den restlichen afrikanischen Staaten ohne vergleichbare Einkommensanreize zeigte sich bereits kurz nach dem Start und der Einwirkung von ADHA eine Abnahme bei den ghanaesischen Ärzten und nur bei diesen. Insgesamt zeigen die Analysen über den gesamten Zeitraum eine Abnahme der Emigration von Ärzten aus Ghana in die USA, Deutschland und vergleichbare Länder um 10%.
In der sehr intensiven Diskussion dieses Ergebnis, sind zwei Aspekte besonders interessant:
• In eine Weiterentwicklung des Analysemodells müssten u.a. auch die Entwicklung der Immigrationsbedingungen in den Aufnahmeländern und die sonstigen politischen und sozialen Entwicklungen in den Immigrationsländern berücksichtigt werden. Dies ist mit komplexen methodischen Anforderungen verbunden.
• Ein anderer Aspekt fasst der Autor so zusammen: "Even if the wage increase programme reduced physician migration, this does not automatically make it a good policy solution. An important question is whether the programme would pass a cost-benefit test." Dafür schätzt er die ADHA-Kosten im Untersuchungszeitraum für jeden in Ghana zusätzlich verbliebenen Arzt auf 167.000 US-Dollar. Für die Frage nach der "cost-effectiveness" stellt er dem die "cost of producing a new doctor" gegenüber, die auf 30.000 bis 70.000 US-Dollar geschätzt werden.
Auch wenn man weitere vom Autor skizzierte Limitationen hinzunimmt, handelt es sich um einen wichtigen ersten Versuch, mit einem künftig noch wachsenden Problem analytisch und konzeptionell umzugehen. Die professionell und immer aggressiver von allen "westlichen" Ländern weltweit in den so genannten Entwicklungsländern geführten Abwerbekampagnen für Beschäftigte im Gesundheitswesen könnte z.B. dazu führen, dass sich dort verstärkt tatsächlich oder vermeintlich gefährliche Erkrankungsereignisse bzw. Epidemien bilden, die mangels Personal und sonstiger Infrastruktur nicht mehr akut versorgt werden können. Speziell wenn es sich um ansteckende Erkrankungen handelt, stehen die entwickelten Länder vor der Herausforderung, mit Hunderten von Millionen Dollars oder Euros daran vor Ort etwas zu verändern. Ob dies dann nicht u.U. teurer wird als ADHA-Programme und gleichzeit nationale Ausbildungsprogramme für mehr Gesundheitspersonal in Europa oder Nordamerika, sollte in künftigen "brain drain"-Studien ebenfalls mitberücksichtigt werden.
Von dem materialreichen Aufsatz Do higher salaries lower physician migration? von Edward N Okeke, der am 26. Juli 2014 in der Zeitschrift "Health Policy Planning. (2014; 29 (5): 603-614) erschienen ist, gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 7.8.14
Unterschiedliche Prioritätensetzung erschwert gemeinsame Entscheidungsfindung: Das Beispiel Empfängnisverhütung.
 Zu den teilweise folgenreichen Fehlschlüssen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung gehört, dass PatientInnen und Leistungsanbieter wie Ärzte oder Apotheker bei gemeinsamen Gesprächen und Entscheidungen an denselben Aspekten der Leistung interessiert sind bzw. identische Interessenhierarchien oder Prioritäten haben. Dies kann dazu führen, völlig aneinander vorbei zu reden und angeblich gemeinsame Entscheidungen zu treffen, deren Inhalte manche PatientInnen bereits beim Verlassen der Praxis oder Apotheke als persönlich irrelevant vergessen haben bzw. die sie nicht befolgen.
Zu den teilweise folgenreichen Fehlschlüssen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung gehört, dass PatientInnen und Leistungsanbieter wie Ärzte oder Apotheker bei gemeinsamen Gesprächen und Entscheidungen an denselben Aspekten der Leistung interessiert sind bzw. identische Interessenhierarchien oder Prioritäten haben. Dies kann dazu führen, völlig aneinander vorbei zu reden und angeblich gemeinsame Entscheidungen zu treffen, deren Inhalte manche PatientInnen bereits beim Verlassen der Praxis oder Apotheke als persönlich irrelevant vergessen haben bzw. die sie nicht befolgen.
Die Tatsache dieses Problems hat eine aktuelle Befragungsstudie mit 417 Frauen zwischen 14 und 45 Jahren und 188 verschiedenen Anbietern von kontrazeptiven Leistungen in den USA erneut gut belegt. Beiden Gruppen sollten insgesamt 34 Fragen zu wichtigen, bei der Verordnung und Einnahme solcher Mittel zu beachtenden Aspekten bewerten.
Die Ergebnisse im Detail:
• Bei 18 Fragen waren sich die beiden Befragtengruppen einig. Bei den restlichen Gruppen traten deutliche Unterschiede auf.
• Die Hauptanliegen für die befragten Nutzerinnen von Empfängnisverhütung waren, wie wirksam und sicher die jeweilige Methode wie empfängnisverhütend wirkt. Die Hauptanliegen der Anbieter waren dagegen die Kosten-Nutzenrelation und wie oft die Patientin leitliniengerecht daran erinnert werden müssen, die Methode zu nutzen.
• Für 41,7% der Nutzerinnen gehörte die Sicherheit der Methode zu den drei Spitzenanliegen, ein Interesse, das aber umgekehrt nur 20,1% der Ärzte für besonders wichtig hielten.
• Zu den drei Hauptfragen der Nutzerinnen gehörte schließlich noch die nach den potenziellen Nebenwirkungen (26,3%), was wiederum nur für 16,3% der Anbieter zu den Hauptfragen gehörte.
Da es ein solches Auseinanderklaffen der Interessen zwischen Patienten und Ärzten etc. auch bei anderen Leistungen gibt oder geben könnte, sollte z.B. bei gravierender Häufung von fehlender Therapietreue oder Unzufriedenheit von Patienten zunächst an solche möglicherweise dafür ursächlichen Unterschiede gedacht werden.
Der Aufsatz What matters most? The content and concordance of patients' and providers' information priorities for contraceptive decision making von Kyla Z. Donnelly et al. ist am 1, Mai 2014 als "article in press" der internationalen Fachzeitschrift für reproduktive Gesundheit "Contraception" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.6.14
Keine Zuzahlungen für die Arzneimittelbehandlung von Herzinfarkt-Patienten verbessert Therapietreue und reduziert Ungleichheit
 In die mittlerweile lange Reihe von Interventionsstudien, die insbesondere in den USA nachgewiesen haben, dass die Verringerung oder Streichung von Zuzahlungen zu Gesundheitsleistungen zu positiven Verhaltensweisen (insbesondere mehr Therapietreue) und Gesundheitseffekten führt bzw. innere Zusammenhänge bestehen, passen jetzt die in der Fachzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Ergebnisse einer vergleichbaren Intervention bei Patienten mit einer nachakut behandlungsbedürftigen koronaren Herzerkrankung.
In die mittlerweile lange Reihe von Interventionsstudien, die insbesondere in den USA nachgewiesen haben, dass die Verringerung oder Streichung von Zuzahlungen zu Gesundheitsleistungen zu positiven Verhaltensweisen (insbesondere mehr Therapietreue) und Gesundheitseffekten führt bzw. innere Zusammenhänge bestehen, passen jetzt die in der Fachzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Ergebnisse einer vergleichbaren Intervention bei Patienten mit einer nachakut behandlungsbedürftigen koronaren Herzerkrankung.
Von den 5.855 randomisierten TeilnehmerInnen an der "Post-Myocardial Infarction Free Rx Event and Economic Evaluation (MI FREE)"-Studie bezahlten 2.845 Patienten für 36 Monate keine Zuzahlung für die zahlreichen sekundärpräventiv notwendigen Medikamente (z.B. Statine, Beta-Blocker, ACE-Hemmer), 3.010 andere TeilnehmerInnen mussten die gewöhnlichen Zuzahlungen leisten. Alle TeilnehmerInnen waren bei dem großen privaten Krankenversicherungsunternehmen Aetna versichert. Für die TeilnehmerInnen gab es umfassende soziodemografische Angaben, insbesondere zur ethnischen Aufteilung in weiße und nicht-weiße Personen. Hinzu kamen eine Vielzahl von Krankheits- und Behandlungsdaten.
Bekannt waren bereits vor dieser Studie, dass nichtweiße Patienten mit kardio-vaskulären Erkrankungen zwischen 10 bis 40% weniger sekundärpräventive Therapien wie z.B. Aspirin oder andere Blutverflüssiger und Beta-Blocker erhalten. Mit weißen Schlaganfallpatienten verglichen ist der Anteil der nichtweißen Erkrankten, die z.B. eine Beratung über den Rauchverzicht erhielten um 15% geringer. Dieser Unterschied zum Nachteil der nichtweißen Patienten beträgt beim Erhalt von antithrombotischer Medikation bei der Entlassung 16% und beinahe 10% bei der Lipidtherapie.
Aus früheren Studien ist ebenfalls bereits bekannt, dass eine Absenkung der Zuzahlungen für die medikamentöse Behandlung von Patienten mit Herzinfarkt sich spürbar, wenngleich nicht gewaltig, positiv auf die Therapietreue und das Behandlungsergebnis auswirkt.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie lauten:
• Der komplette Verzicht auf Zuzahlungen erhöhte sowohl bei weißen als auch bei nichtweißen Patienten die Therapietreue.
• Die Therapietreue bei der Einnahme spezifischer Medikamente (z.B. Statine) war bei nichtweißen signifikant geringer als bei weißen Patienten. Unerwünschte klinische Ereignisse (z.B. Re-Infarkt) waren dagegen bei den nichtweißen signifikant häufiger als bei weißen Patienten.
• Die Streichung von Zuzahlungen führte nach dem rechnerischen Ausschluss des Einflusses anderer Faktoren außerdem bei den nichtweißen Patienten zu einer Reduktion der Rate großer vaskulärer Ereignisse um 35% und reduzierte die gesamten Behandlungskosten um 70%.
• Da die Streichung von Zuzahlungen zu keinen vergleichbaren Effekten bei den weißen Patienten führte, stellt diese Intervention allein eine wirksame und gewichtige Methode dar, die rassische und ethnischen Ungleichheiten bei der Behandlung von Infarktpatienten zu reduzieren.
Für die USA resümieren die Verfasser daher: "The broader implementation of this change should be considered."
Ob die Effekte auch nach einem Verzicht auf Zuzahlungen in anderen Gesundheitssystemen mit zum Teil geringerer ethnischen Behandlungsungleichheit, also z.B. in Deutschland, ebenfalls auftreten, käme auf einen Versuch an.
Von dem Aufsatz Eliminating Medication Copayments Reduces Disparities In Cardiovascular Care von Niteesh K. Choudhry et al., 2014 erschienen in "Health Affairs" (33, no.5 (2014):863-870) ist kostenlos das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 5.6.14
… und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker - nur bekommen Sie die richtige Antwort und befolgen Ärzte wirklich Alarmhinweise?
 PISA-Tests mit Patienten über die richtige Einschätzung von Risiken und Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen sowie das Beklagen einer mangelnden "health literarcy" als einer Quelle von Fehlentscheidungen im Gesundheitswesen, werden international wie national häufig durchgeführt. Obwohl in einigen Untersuchungen auch Ärzte erhebliche Wissenslücken (in Einzelfällen sogar mehr als Patienten) und daraus resultierend auch Beratungs- und Behandlungsdefizite hatten, macht die Arzneimittelwerbung das korrekte Wissen von Ärzten und Apothekern unvermindert zum Allheilmittel bei möglichen Wissenslücken und Verhaltensunsicherheiten der Patienten.
PISA-Tests mit Patienten über die richtige Einschätzung von Risiken und Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen sowie das Beklagen einer mangelnden "health literarcy" als einer Quelle von Fehlentscheidungen im Gesundheitswesen, werden international wie national häufig durchgeführt. Obwohl in einigen Untersuchungen auch Ärzte erhebliche Wissenslücken (in Einzelfällen sogar mehr als Patienten) und daraus resultierend auch Beratungs- und Behandlungsdefizite hatten, macht die Arzneimittelwerbung das korrekte Wissen von Ärzten und Apothekern unvermindert zum Allheilmittel bei möglichen Wissenslücken und Verhaltensunsicherheiten der Patienten.
Dass daran Zweifel erlaubt sind, zeigte eine im Oktober 2013 im "Deutschen Ärzteblatt" veröffentlichte Studie über das Verständnis der durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)" standardisierten und kodierten Nebenwirkungsrisiken von Arzneimitteln in Beipackzetteln. Das BfArM hat die Wahrscheinlichkeit bzw. Häufigkeit von Nebenwirkungen mit den Begriffen "häufig", "gelegentlich" und "selten" beschrieben. Diesen Begriffen werden seit langem eindeutige numerische Werte zugeordnet. "Häufig" bedeutet eine Häufigkeit zwischen 1% und 10%, "gelegentlich" 0,1% bis 1% und "selten" 0,01% bis 0,1%. Eine Forschungsgruppe an der Universität Lübeck fragte insgesamt 1.000 Ärzte, Apotheker und Juristen postalisch zum einen nach ihrer numerischen Schätzung einer kontextfreien Liste von 20 verbalen Wahrscheinlichkeitsausdrücken. Zum anderen sollten die Befragten einem konkreten Arzt-Patient-Gesprächbeispiel in dem Nebenwirkungen thematisiert wurden, freie Prozentangaben für die BfArM-Begriffe zuordnen.
Die Ergebnisse zeigten insgesamt,
• dass nicht nur Patienten oder die Allgemeinbevölkerung die in der zitierten Weise kodierten Risiken deutlich überschätzen, sondern auch ärztliche, pharmazeutische und juristische Experten.
• Im Mittel gaben bei der kontextfreien Liste alle drei Experten als Wert von "häufig" 75% statt der richtigen 1% bis 10% an. Ähnliche Überschätzungen gab es auch bei "gelegentlich" und "selten".
• Bei der Wahrscheinlichkeitszuordnung zur Häufigkeit von Nebenwirkungen innerhalb eines Patientengesprächs wurden allgemein niedrigere und zum Teil auch korrekte Prozentwerte genannt. Trotzdem stimmen die Interpretationen von Ärzten nur selten mit den vom BfArM vorgegebenen tatsächlichen Risikowerten überein. Bei der Kodierung als "häufig" stimmten die Angaben von 3,5% aller befragten Ärzte, 5,8% aller Apotheker und 0,7% aller Juristen. Bei "gelegentlich" machten nur noch 0,3% der Ärzte, 1,9% der Apotheker und 0% der Juristen zutreffende Angaben. Noch weiter sank der Anteil von antwortenden Experten, wenn es um eine "seltene" Nebenwirkungen ging: 0,9% der Ärzte, 1,9% der Apotheker und 0,7% der Juristen lagen mit ihren Werten richtig.
• Angesichts des Risikos, dass falsche und auch noch durch Ärzte oder Apotheker stimulierte oder gestützteVorstellungen Risikowahrscheinlichkeiten die Therapietreue der Patienten beeinträchtigen können, schlagen die AutorInnen vor, die verbalen Umschreibungen in den Beipackzettel "eher dem umgangssprachlichen Verständnis von Wahrscheinlichkeiten" anzupassen. Welche Begriffe dies sein könnten, bleibt aber im Unklaren. Die Lücke zwischen den bei Ärzten für "häufig" genannten Werte und den tatsächlichen 1% bis 10% sprachlich zu schließen ist allerdings auch nicht ganz einfach.
Unter der Überschrift "Realitätsfernes Memorieren" versucht der Kommentator Matthias Wallenfels in der Online-Ausgabe der Ärzte Zeitung vom 17.10.2013 allerdings zumindest aufkommende Zweifel am Wissen und Handeln von Ärzten im Keim zu ersticken: "Welche Konsequenzen hat das für die Praxisroutine? Eigentlich gar keine! Denn vollkommen ausgeblendet wird im Zuge der Lübecker Studie die reale Praxissituation im Versorgungsalltag. So hat jeder Arzt in der Praxis via EDV, Web oder auch die klassische Rote Liste die Möglichkeit, schnell die spezifischen Angaben zu Nebenwirkungen eines Präparates inklusive absoluter Zahlen zu finden. Er muss nicht zwangsweise Werte memorieren. Nicht nur im Interesse einer belastbaren, intakten Arzt-Patienten-Beziehung wird er gewissenhaft recherchieren und den Patienten dann aufklären. Es geht auch um das Berufsethos."
Ob das ja eigentlich unschlagbare Duo von Technik und Ethos wirklich so segensreich ist und die Befragten ihr Gedächtnis lieber für andere Informationen geschont haben, ist leider nicht mit Daten deutscher Ärzte überprüfbar, sondern erfordert einen Blick in die USA und Großbritannien. Auch dort gibt es gedächtnisentlastende technische Hilfen und Ärzteethos, nur glaubt man dort nicht so naiv wie hierzulande, dass dies automatisch zu positiven Ergebnissen führt.
Bei 2.004.069 ambulanten Arzneimittelverordnungen in den USA meldete sich ein elektronisches Alarm- oder Unterstützungssystem ("clinical decision support (CDS)") in 157.483 Fällen, d.h. bei 7,9% aller Verordnungen. Zu den wichtigsten Warnungen gehörten die auf Doppelverordnungen (33% aller Warnungen), Patientenallergien (17%) und Wechselwirkungen von Medikamenten (16%).
Der Umgang mit diesen Hinweisen war keineswegs durch "Folgsamkeit" geprägt:
• 52,6% aller Warnhinweise oder Alarme wurden übergangen ("overridden").
• Am häufigsten setzten sich die verordnenden Ärzte über Warnhinweise zu gleich wirksamen Medikamenten mit einer anderen Zusammensetzung (bei 85% solcher Hinweise), altersbezogene Empfehlungen (79%), Empfehlungen für eine nierenschonende Medikation (78%) und Patientenallergien (77,4%) hinweg.
• Insgesamt waren 53% aller Fälle der Missachtung von Warnhinweisen medizinisch angemessen, 47% also nicht.
• Die Angemessenheit dieses Umgangs mit Warnhinweisen schwankte aber je nach Thema zwischen 12% bei Empfehlungen zur Nierenschonung und 92% bei Patientenallergien.
Die ForscherInnen empfahlen zur Reduktion der Alarmmüdigkeit qualitative und die Relevanz des Hinweises besser vermittelnde Verbesserungen der Alarmhinweise.
Dass dies u.U. aber den ignoranten Umgang mit Alarmhinweisen auch nicht sofort und vollständig verringert, zeigt eine nur wenige Monate ältere kleine Beobachtungs-Studie über die Nutzung eines computergestützten CDS innerhalb von 112 Arztkonsultationen in drei Praxen von acht britischen Allgemeinärzten. Bei 73 dieser Konsultationen wurden insgesamt 132 Arzneimittelverordnungen ausgestellt. Bei 61% der Verordnungen erhielt der Arzt mindestens einen Alarmhinweis. Bei insgesamt 117 Warnungen berücksichtigten die britischen Ärzte lediglich drei, was die Ausstellung des jeweiligen Rezepts aber nicht verhinderte.
Die entscheidenden Gründe für die völlige Nichtbeachtung der Warnungen des CDS brachten die britischen ForscherInnen auf die Formel "too much, too late". In den beobachteten Fällen lieferte das CDS seine Informationen erst zum Zeitpunkt der Ausstellung eines Rezepts am PC und damit viel zu spät bzw. am Ende eines langen "Arbeitsprozesses". Davor hatten sich die Ärzte mehr oder weniger aufwändig mit der Definition des gesundheitlichen Problems beschäftigt, hatten sich minutenlang die notwendige Behandlung überlegt, sie dem Patienten erklärt, andere Therapien ausgeschlossen, sich mit dem Patienten über das vorgeschlagene Vorgehen geeinigt, ihm Instruktionen für die Einnahme des geplanten Medikaments gegeben und evtl. ein dafür geeignetes schriftliches Merkblatt ausgehändigt. Würden Ärzte zu diesem späten Zeitpunkt auf den Alarm ihres CDS reagieren, müssten sie nicht nur mögliche Fehler und Schwächen eingestehen, sondern den beschriebenen Entscheidungs- und Vermittlungsprozess größtenteils erneut abarbeiten.
Die AutorInnen empfehlen daher eine Umorganisation des Entscheidungsprozesses von Ärzten, welche dafür sorgt, dass CDS-Hilfen wesentlich früher bzw. zu Beginn des Therapieentscheidungsprozess abgefragt und genutzt werden.
Ob diese und die bereits erwähnte Empfehlung wirklich dazu führen, dass fachlich korrekte elektronische Alarmhinweise wesentlich mehr als bisher berücksichtigt werden, muss erst untersucht werden. Und dann auch bei mehr Ärzten.
Sicher ist nur, dass blindes Vertrauen in die Ärzte und den Nutzen technisch verfügbarer Entscheidungsunterstützungssysteme unangebracht ist. Ohne die genannten und möglicherweise noch mehr kognitive und organisatorische Verbesserungen nutzen solche Systeme offensichtlich relativ wenig bzw. werden nicht praxisrelevant beachtet.
Nicht geglaubt oder erhofft, sondern untersucht werden müsste natürlich auch, ob deutsche Ärzte eventuell völlig anders mit ihren elektronischen Entscheidungshilfen oder mit "Roter Liste" und anderen potenziellen Hilfsmitteln umgehen.
Zu dem Aufsatz Overrides of medication-related clinical decision support alerts in outpatients von Karen C Nanji et al. - online erschienen am 28. Oktober 2013 in der Fachzeitschrift "Am Med Inform Association" ist kostenlos das Abstract zu erhalten.
Die Studie 'Too much, too late': mixed methods multi-channel video recording study of computerized decision support systems and GP prescribing von James Hayward et al. ist bereits am 7. März 2013 in derselben Fachzeitschrift erschienen. Auch hier gibt es das Abstract kostenlos.
Die Studie Verständnis von Nebenwirkungsrisiken im Beipackzettel: Eine Umfrage unter Ärzten, Apothekern und Juristen von Andreas Ziegler et al. ist 2013 im Deutschen Ärzteblatt (110(40): 669-73) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Der Kommentar zum Beipackzettel: Realitätsfernes Memorieren von M. Wallenfels ist in der Ärzte Zeitung vom 17. 10. 2013 erschienen.
Bernard Braun, 13.11.13
Wie kommt es zu mangelnder Therapietreue? Ergebnisse einer qualitativen Studie mit an rheumatoider Arthritis erkrankten Menschen
 Zu einer der langlebigsten Erklärungen oder Schuldzuweisungen durch Ärzte aber auch Krankenkassenvertreter, warum eine Krankenbehandlung nicht das gewünschte Ergebnis hat oder wodurch unnötig Kosten verursacht werden, gehört die Non-Compliance oder -Adherence bzw. die Therapieuntreue der Patienten. Wer nachdenkt statt Schuld zuzuweisen, stellt fest, dass zumindest ein Teil der "untreuen" oder "ungehorsamen" Patienten nicht aus Jux und Tollerei z.B. verordnete Medikamente gar nicht oder in einer anderen Dosierung einnimmt als es ihnen der Arzt oder Apotheker oder der Beipacktext möglicherweise gesagt hat und dabei u.a. gesundheitlich unerwünschte Folgen riskiert. Und auch die sporadisch transparent werdenden Medikamentenlager in den Badezimmerschränkchen mancher Menschen, entstehen nicht (allein) wegen der Sammelwut von Patienten.
Zu einer der langlebigsten Erklärungen oder Schuldzuweisungen durch Ärzte aber auch Krankenkassenvertreter, warum eine Krankenbehandlung nicht das gewünschte Ergebnis hat oder wodurch unnötig Kosten verursacht werden, gehört die Non-Compliance oder -Adherence bzw. die Therapieuntreue der Patienten. Wer nachdenkt statt Schuld zuzuweisen, stellt fest, dass zumindest ein Teil der "untreuen" oder "ungehorsamen" Patienten nicht aus Jux und Tollerei z.B. verordnete Medikamente gar nicht oder in einer anderen Dosierung einnimmt als es ihnen der Arzt oder Apotheker oder der Beipacktext möglicherweise gesagt hat und dabei u.a. gesundheitlich unerwünschte Folgen riskiert. Und auch die sporadisch transparent werdenden Medikamentenlager in den Badezimmerschränkchen mancher Menschen, entstehen nicht (allein) wegen der Sammelwut von Patienten.
Eine gerade veröffentlichte Studie von GesundheitswissenschaftlerInnen aus Bremen, Hannover und Kiel untersuchte jetzt diese Gründe für und mit PatientInnen, die langjährig unter behandlungsbedürftiger rheumatoider Arthritis litten. Die AutorInnen zeigen auf dem Boden leitfadengestützter Interviews mit 29 aus 900 bzw. 103 ausgewählten und interviewbereiten PatientInnen, dass es nicht weiterführt, von fehlender Compliance zu sprechen, wenn die Betroffenen verordnete Medikamente überhaupt oder vorübergehend nicht einnehmen. Diese chronisch Kranken sind trotz gelegentlicher "Noncompliance" außerordentlich an guter Medizin interessiert. Der häufige krankheitsbedingte Wechsel der Medikamente, das Verurteiltsein zu dauerhafter Medikation samt teils deutlicher Nebenwirkungen und häufig unzureichende Kommunikation ihrer ÄrztInnen sind wichtige Ursachen für die so genannte Noncompliance. Während die sozialwissenschaftliche Literatur dies seit gut 25 Jahren ergiebig thematisiert hat, wird im medizinischen Diskurs allen Bemühungen um "Modernisierung" des Compliance-Diskurses am Konzept der Folgsamkeit festgehalten. Eine Idee, die ohnehin nur dann gut wäre, wenn die verordneten Medikamente tatsächlich immer evidenzbasiert wären. Die Studie plädiert dafür, die Unterstützung für chronisch Kranke bei der Bewältigung ihrer langstreckigen Krankheitskarrieren zu verbessern statt ihnen de facto immer wieder mit Vorwürfen zu begegnen.
Was in einem modernen, d.h. nicht schuldzuweiserischen Compliance-Dialog zwischen Arzt und Patient zu beachten und zu erreichen ist, wird in der 26 Seiten umfassenden Studie durch ausführliche Zitate aus den Interviews anschaulich verdeutlicht.
Im Anhang findet sich der Frageleitfaden für die qualitativen Interviews, einige Hinweise zur Kodierung der transkribierten Interviews, eine Auflistung der Vielzahl erkrankungsspezifischer Medikamente und ein umfangreiches Literaturverzeichnis.
Die Studie Noncompliance: A Never-Ending Story. Understanding the Perspective of Patients with Rheumatoid Arthritis von Maren Stamer, Norbert Schmacke und Petra Richter erscheint im September 2013 im "Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research" (14 [3], Art. 7) und kann komplett kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 11.8.13
Beispiel Rückenschmerzen: Behandlungswirklichkeit verschlechtert sich in den USA trotz "gut etablierter"Leitlinien
 Die für immer mehr Krankheiten vorhandenen Leitlinien bestimmen nachwievor nicht verbindlich die Behandlung der jeweiligen Kranken. Dies liegt erstens und vor allem an ihrer unter Ärzten nicht leiser werdenden Diskreditierung als "Kochbuchmedizin" oder "Einheitsbehandlung". Hinzu kommt zweitens, dass die Qualität bzw. Evidenz von Leitlinien unterschiedlich ist und die Vielzahl der nationalen und internationalen Leitlinien fast schon wieder eine "Leitlinie" zur Orientierung bei den Leitlinien erfordert. Und drittens erfordert die Veralltäglichung von Leitlinien-Handeln gegen das traditionell eminenzlastige Denken gerade im ärztlichen und medizinischen Bereich wesentlich mehr Zeit als erwartet oder erhofft.
Die für immer mehr Krankheiten vorhandenen Leitlinien bestimmen nachwievor nicht verbindlich die Behandlung der jeweiligen Kranken. Dies liegt erstens und vor allem an ihrer unter Ärzten nicht leiser werdenden Diskreditierung als "Kochbuchmedizin" oder "Einheitsbehandlung". Hinzu kommt zweitens, dass die Qualität bzw. Evidenz von Leitlinien unterschiedlich ist und die Vielzahl der nationalen und internationalen Leitlinien fast schon wieder eine "Leitlinie" zur Orientierung bei den Leitlinien erfordert. Und drittens erfordert die Veralltäglichung von Leitlinien-Handeln gegen das traditionell eminenzlastige Denken gerade im ärztlichen und medizinischen Bereich wesentlich mehr Zeit als erwartet oder erhofft.
Ist es also nicht völlig überraschend, dass Leitlinien nicht sofort dazu beitragen den Erfolg einer Behandlung zu verbessern, sondern die Behandlung über längere Zeit beim Status quo ante verharrt, gibt es jetzt auch Belege, dass sich die Qualität der Behandlung verbreiteter Erkrankungen auch nach langjähriger Existenz und Verbreitung von Leitlinien sogar deutlich verschlechtert.
Dies zeigt eine Studie über die Entwicklung der Qualität des Managements und der Behandlung von Rückenschmerzen zwischen den Jahren 1999 und 2010. Mit den für die USA repräsentativen Daten aus dem "National Ambulatory Medical Care Survey" und dem "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey" untersuchte eine us-amerikanische Forschergruppe exemplarisch 23.918 Besuche (repräsentieren nahezu 440 Millionen Arztbesuche) bei ambulant tätigen Ärzten wegen eines Rückenschmerzproblems. Die ForscherInnen untersuchten das Behandlungsgeschehen mit Kriterien, die sie aus den langjährig vorhandenen und bekannten ("well-established") Leitlinien übernommen haben. Abgesehen von den wenigen akut schweren Fällen wird der frühzeitige Einsatz aufwändiger bildgebenden Untersuchungen, die Verordnung von Narkotika und die Überweisung zu einem anderen (Fach-)Arzt (hauptsächlich Chirurgen) als Nichtübereinstimmung ("discordant") mit den Leitlinien bewertet. Sofern nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimittel oder Paracetamol ("acetaminophen") (so genannte "first-line medications") verordnet wurden und eine Überweisung zu einer physikalischen Therapie erfolgte, galt dies als leitlinienkonform ("guideline concordant").
Die Behandlungswirklichkeit sieht nach einer Reihe von Adjustierungen (z.B. nach Alter, Ort und Gesamtbehandlungszeit) wie folgt aus:
• Die Chance bei einem Arztbesuch ein nichtsteroidales entzündungshemmendes Medikament oder Paracetamol verordnet zu bekommen sank von 1999 bis 2010 signifikant von 36,9% auf 24,5%. Ganz anders sah es bei den Narkotika aus: Deren Verordnung und Einnahme stieg im selben Zeitraum signifikant von 19,3% auf 29,1%.
• Die Überweisung zu einem Physiotherapeuten o.ä. veränderte sich im Untersuchungszeitraum nicht, d.h. schwankte um die 20%-Marke. Die Überweisung zu einem anderen Arzt stieg aber signifikant von 6,8% auf 14%.
• Zu beiden Zeitpunkten wurde im Rahmen von rund 17% der Arztbesuche ein Röntgenbild angefertigt. Die Anzahl der zusätzlich erstellten Computer- und der Magnetresonanztomographien stieg aber signifikant von 7,2% auf 11,3%.
Insbesondere in einem in derselben Ausgabe der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlichten Kommentar wird deutlich, dass die Veränderung eines derartigen Verhaltens mehrere Barrieren gleichzeitig beseitigen muss. Der Autor zählt als Faktoren, welche die Leitlinientreue der Ärzte beeinflussen Mängel beim Wissen, Mängel bei den Einstellungen (z.B. Mangel an Erwartungen zum Outcome und mangelnde Selbstwirksamkeitsüberzeugung) und Mängel bei den Verhaltensbedingungen (z.B. Zeitmangel, Verweigerung von Patienten, widersprüchliche Leitlinien) auf.
Der Aufsatz Worsening Trends in the Management and Treatment of Back Pain von John N. Mafi, Ellen P. McCarthy, Roger B. Davis und Bruce E. Landon ist in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" zuerst einmal online am 29. Juli 2013 erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der Kommentar Why Don't Physicians (and Patients) Consistently Follow Clinical Practice Guidelines? Comment on "Worsening Trends in the Management and Treatment of Back Pain von Donald Casey ist in derselben Online-Ausgabe der Zeitschrift erschienen. Hier ist nur ein kurzer Antext kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.7.13
"Renaissance der Allgemeinmedizin"? Ja, aber nicht nach dem Motto "weiter wie bisher" und "mehr Geld ins System"!
 Die aktuelle Debatte um die Lage und Zukunft der Allgemeinmedizin oder der hausärztlichen Versorgung werden vor allem durch oft empiriefreie Katastrophen-Szenarien über das Absterben oder lemmingehafte Auswandern von Ärzten, durch Überlegungen zu ausgeklügelten finanziellen Anreizen für Studierende und Praktiker oder durch technische Visionen ohne ausreichend belegten Nutzen (z.B. Telemedizin, E-health) beherrscht. Zu den wesentlichen praktischen Folgen dieser Art der Thematisierung eines Ärzte- oder Hausärztemangels gehört bisher nur, dass insbesondere ländliche Krankenhäuser und Apotheker und wahrscheinlich bald auch andere Gesundheitsberufe ähnliche Nachwuchskrisen entdecken und ebenfalls zusätzliche Gratifikationen anmelden.
Die aktuelle Debatte um die Lage und Zukunft der Allgemeinmedizin oder der hausärztlichen Versorgung werden vor allem durch oft empiriefreie Katastrophen-Szenarien über das Absterben oder lemmingehafte Auswandern von Ärzten, durch Überlegungen zu ausgeklügelten finanziellen Anreizen für Studierende und Praktiker oder durch technische Visionen ohne ausreichend belegten Nutzen (z.B. Telemedizin, E-health) beherrscht. Zu den wesentlichen praktischen Folgen dieser Art der Thematisierung eines Ärzte- oder Hausärztemangels gehört bisher nur, dass insbesondere ländliche Krankenhäuser und Apotheker und wahrscheinlich bald auch andere Gesundheitsberufe ähnliche Nachwuchskrisen entdecken und ebenfalls zusätzliche Gratifikationen anmelden.
Was stattdessen notwendig und vermutlich auch wirklich hilfreich ist, trägt ein im Januar 2013 abgeschlossenes Gutachten des Bremer Gesundheitswissenschaftlers und Mediziners Norbert Schmacke zusammen. Gestützt auf eine umfassende Analyse der internationalen und nationalen Literatur sowie eine Reihe von Interviews mit in- und ausländischen ExpertInnen sowie seine langjährigen Erfahrungen im Gesundheitswesen (z.B. im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, beim AOK-Bundesverband und im Gemeinsamen Bundesausschuss) enthält das Gutachten zahlreiche konzeptionelle und praktische "Potenziale", die es im Diskurs über die Zukunft der Allgemeinmedizin mit Vorrang zu nutzen oder zu stärken gilt.
Dabei sind u.a. folgende Aspekte wichtig:
• Vor der Thematisierung jedweden Mangels sollte "die Reflexion von Grundannahmen und Wissensbeständen" erfolgen, "die in das Verständnis der sehr unterschiedlich wahrgenommenen Verteilungsprobleme einfließen."
• Schmacke weist zum einen auf "Wissens- resp. Forschungsdefizite (hin), die bislang dafür verantwortlich sind, dass ein strategisches Planen in Sachen "ärztlicher Bedarf" in hohem Maß auf Vermutungen angewiesen ist." Dies ist vor allem deshalb folgenreich und möglicherweise völlig desorientierend, weil sich damit die Debatte und Praxis der Bedarfsplanung vorrangig auf "vorgefundene Verteilungsmuster" stützt, das bisherige System als gegeben und noch schlimmer als "bewährt" hingenommen oder bezeichnet wird.
• Wer wirklich an substantiellen Fortschritten für Ärzte und Patienten interessiert sei, müsse die Debatte mit "wünschenswerte(n) Ziele(n) der Versorgung und deren Erreichbarkeit" verknüpfen und als einen "nachhaltig intelligenten Suchprozess" organisieren.
• Dafür wäre aber das "massive Investitionsdefizit in versorgungsrelevante Forschung" abzubauen, die sich z.B. um Untersuchungen zur "angemesseneren Positionierung von Allgemeinmedizin in der Versorgungskette" oder die "Einflussfaktoren auf ärztliche Karrieren" kümmern müsse.
• Ferner gelte es nach erprobten internationalen Programmen "allgemeinmedizinische Karrieren … durch gezielte Rekrutierung und partielle finanzielle Unterstützung von motivierten Studierenden zu fördern", den "frühe(n) Kontakt von Medizinstudierenden mit der Allgemeinpraxis" und verlässliche "Weiterbildungsverbünde" zu fördern.
• In allen diesen Aktivitäten und Maßnahmen geht es neben vielen technischen Details auch darum, der Allgemeinmedizin eine "akademische Heimat" zu schaffen, die sich allein im Kontext der bisherigen medizinischen Fakultäten nicht finden lassen wird." Dafür gilt es nach Ansicht Schmackes die "immateriellen Anreize stärker zu gewichten" und einen "Stolz" aufzubauen, "der darin gründet, das eigene "Handwerkszeug" zu kennen und Nutzen stiftend einsetzen zu können". Dazu könnte oder müsste es aber erforderlich sein "von einem dogmatischen Ziel einer allerorten zeitnaher Erreichbarkeit der Generalisten (Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Gynäkologie) im bisherigen Verständnis Abschied zu nehmen."
• Vor der Lösung des aus internationaler Praxisperspektive gut zu bewältigenden "als "Hausarztmangel" beschriebene(n) Problem(s) einer ungleichen Verteilung medizinischer Ressourcen in Deutschland" hält Schmacke aber einen "Perspektivwechsel" für erforderlich: "Je länger das Denken dem Gewohnten und dem Status Quo verhaftet bleibt, desto schwerer werden sich erforderliche Kurskorrekturen realisieren lassen. Eine wichtige, breit zu diskutierende Aufgabe ist es, die Qualität und die Effizienz der Versorgung präziser und kleinräumiger als heute ermitteln zu können, um die Steuerung des Gesundheitswesens weniger auf den gesunden Menschenverstand und den Interessenausgleich der professionellen Akteure als auf nachvollziehbare Fakten und die gesundheitlichen Bedürfnisse der Kranken zu stützen."
Man darf gespannt sein, ob, wann und wie der Auftraggeber des Gutachtens, der GKV-Spitzenverband und damit die Gemeinschaft aller Gesetzlichen Krankenkassen, als erstes sein gewohntes Denken und Handeln aufgibt und im Rahmen der Gemeinsame Selbstverwaltung einen Perspektivwechsel propagiert. Zu wünschen wäre dies nach der jahrzehntelangen Status quo-Fixierung der Gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände, der Ignoranz von internationalen Reformmodellen (z.B. der "medical home"-Strukturen der Allgemeinärzte in den USA) oder dem oft phantasielosen Liegenlassen zahlreicher gesetzlicher Reformideen (z.B. zur integrierten Versorgung) allemal. Mit dem Gutachten verfügen die GKV und alle anderen Akteure über ein umfassendes Starthilfe-Paket.
Zu den "anderen Akteuren" gehören natürlich die Pflichtvereinigungen der niedergelassenen, also auch der Allgemeinärzte, die Kassenärztlichen Vereinigungen und ihre Verbände. Gegen oder ohne diese dürften die von Schmacke aufgezeigten "Chancen für eine Renaissance der Allgemeinmedizin" und der Versuch "die genannten Förderansätze in einem breiter werdenden gesellschaftlichen Konsens an Gewicht gewinnen" zu lassen weder heute noch in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden.
Welche Denk- und Handlungsbarrieren von den KVen überwunden werden müssten, lässt sich zuletzt an dem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung am 1. März 2013 veröffentlichten Papier Position zur Sicherstellung der ambulanten Gesundheitsversorgung ermessen. Diese schlägt dort vorrangig eine Vielzahl von organisatorischen Maßnahmen und finanziellen Umsteuerungen vor, nur nicht eine inhaltliche Renaissance der Allgemeinmedizin. Nach der berechtigten Kritik an dem trotz Wegfalls der Praxisgebühr wachsenden bürokratischen Aufwand zu Lasten der patientenbezogenen Arbeitszeit steht im Mittelpunkt dieses Positionspapiers ein Konstrukt von drei Wahltarifen, die unterschiedliche Mischungen von Sachleistung, Kostenerstattung, Selbstbeteiligung an Facharztbehandlungen darstellen und neben den sozialen Härten und Fehlsteuerungen von Kostenerstattung vor allem einen enormen zusätzlichen bürokratischen Aufwand erfordern.
Das 105-seitige Gutachten Die Zukunft der Allgemeinmedizin in Deutschland. Potenziale für eine angemessene Versorgung von Norbert Schmacke ist im Februar 2013 als Band 11 in der Schriftenreihe des "Instituts für Public Health und Pflegeforschung (IPP)" der Universität Bremen veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 11.3.13
Wie lange müssen für politische Schlussfolgerungen noch positive Wirkungen der Reduktion von Zuzahlungen nachgewiesen werden? Oft!
 Die lang anhaltende Einäugigkeit gehört zu den Eigenarten der Gesundheitspolitik in Deutschland. So, wenn nach Dutzenden von Studien und in monatelangen parteiübergreifenden Debatten eigentlich niemand mehr einen Nutzen der Praxisgebühr sah, sie aber trotzdem um Jahre zu spät abgeschafft wurde, und trotzdem die lange Reihe der Zuzahlungen trotz noch umfangreicherer Evidenz des Ausbleibens des erwarteten Effekts zur Senkung der Inanspruchnahme unangetastet bleibt.
Die lang anhaltende Einäugigkeit gehört zu den Eigenarten der Gesundheitspolitik in Deutschland. So, wenn nach Dutzenden von Studien und in monatelangen parteiübergreifenden Debatten eigentlich niemand mehr einen Nutzen der Praxisgebühr sah, sie aber trotzdem um Jahre zu spät abgeschafft wurde, und trotzdem die lange Reihe der Zuzahlungen trotz noch umfangreicherer Evidenz des Ausbleibens des erwarteten Effekts zur Senkung der Inanspruchnahme unangetastet bleibt.
Dabei gibt es speziell aus den USA immer mehr empirische Studien (vgl. dazu u.a. den Beitrag im Forum-Gesundheitspolitik "Streichung oder Senkung von Medikamenten-Zuzahlungen verbessern Therapietreue und damit Behandlungserfolg und Wirtschaftlichkeit."), die sogar entgegen den wundersamen Annahmen eines Großteils der deutschen Gesundheitsökonomen nachweisen, dass weniger Zuzahlungen gesundheitlich erwünschte Effekte ohne Kostennachteile bedingen.
Die neueste Studie verglich zwölf Monate lang die Behandlungskosten, das Einnahmeverhalten und die gesundheitlichen Effekte von 3.513 über ihren Arbeitgeber krankenversicherter Beschäftigten mit dem von 49.803 Beschäftigten in anderen Unternehmen. Während das erste Unternehmen den Beschäftigten, die wegen Gefäßerkrankungen eine evidenzbasierte Behandlung mit Statinen und Clopidogrel (einem Blutgerinnungshemmer) benötigten, einen Teil der dafür fälligen Zuzahlungen erließ, mussten die TeilnehmerInnen der Kontrollgruppe für dieselben Medikamenten die gesamte Zuzahlung aufbringen.
Nach 12 Monaten zeigte sich eine enge Assoziation zwischen den um 35% (Statine) und 28% (Clopidogrel) reduzierten Zuzahlungen und einer signifikant reduzierten Anzahl von Arztbesuchen (relative Änderung -20% bis -23%), Krankenhausaufenthalten (relative Änderung: -10%) und Noteinweisungen in ein Krankenhaus (relative Änderung: -11%), ohne dass es schwere Koronarereignisse gegeben hätte. Die Patienten mit Zuzahlungsreduktion lösten ihre Rezepte häufiger ein und befolgten auch wesentlich besser die Behandlungshinweise (z.B. Einnahmemenge und -weise). Die Reduktion der Zuzahlungen auf kardiovaskulär relevante Arzneimittel war nach Ansicht der ForscherInnen kostenneutral. So erhöhten sich die Gesamtausgaben für Statin-Patienten um 3%, die der Clopidogrel-Nutzer sanken aber um 6%. Dass es nach diesen 12 Monaten keine präventiven Effekte auf die Häufigkeit und Intensität von Herzattacken gab, führen die WissenschaftlerInnen hauptsächlich auf die kurze Laufzeit ihrer Studie zurück.
Für den großen Kreis der kardiovaskulär erkrankten und mit evidenzbasierten Arzneimitteln behandelten PatientInnen empfehlen die sie dann auch ohne die Klärung noch offener Fragen eine Reduktion von Zuzahlungen.
Richtig ist natürlich auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Studie, dass ihre Ergebnisse wegen der anderen Bedingungen des US-Krankenversicherungs- und Behandlungssystems nicht 1:1 in die GKV-Welt übertragen werden können. Nur, völlig bedeutungslos sind sie nicht und wer die Effekte in Deutschland für unmöglich hält, soll dies empirisch überprüfen. Die Ergebnisse eines ersten solchen Versuchs in Deutschland, der so genannten "Sanicare-Zuzahlungsstudie" des Bremer Forschungsinstituts BIAG werden 2013 veröffentlicht werden.
Leider ist in Deutschland aber wahrscheinlich auch bei den schlagendsten Belegen für die unerwünschten Wirkungen von Zuzahlungen (z.B. Verschleppung von Behandlung oder fehlerhafte Einnahme von notwendigen Arzneimitteln) bzw. für erwünschte Wirkungen einer Zuzahlungsreduktion oder -streichung nicht mit einer sofortigen oder raschen Beendigung dieser Praxis zu rechnen.
Zu dem im Oktober 2012 im "Journal of the American College of Cardiology" veröffentlichten Aufsatz "The Impact of Reducing Cardiovascular Medication Copayments on Health Spending and Resource Utilization" von N. K. Choudhry, M. A. Fischer, J. L. Avorn et al. (60 (18): 1817-24) gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 4.12.12
Einblicke in den Zusammenhang von finanziellen Anreizen und der Anzahl wie Art von Diagnosen bei schwedischen Ärzten
 In der langjährigen Kostendämpfungsdebatte in der deutschen Gesundheitspolitik, sei es bei den allgegenwärtigen Zuzahlungen für verordnete, gesundheitlich notwendige Leistungen oder bei der endlich wieder abgeschafften Praxisgebühr, spielte die Annahme eine große Rolle, dass vor allem gesetzlich krankenversicherte Personen einem so genannten "Freibiertrinker"-Syndrom erliegen und versuchen, ihren gezahlten Beitrag möglichst wieder vollständig durch die Inanspruchnahme möglichst vieler und teurer Leistungen "herauszuholen". Dabei, so diejenigen welche meinen, dieses auch als "moral hazard" bezeichnetes Verhalten gäbe es bezogen auf die meist gar nicht so angenehmen Gesundheitsleistungen, würden auch jede Menge gesundheitlich nicht notwendiger aber möglicherweise "irgendwie" angenehmen Leistungen nachgefragt - und oft auch freigiebig von Ärzten oder anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen verordnet.
In der langjährigen Kostendämpfungsdebatte in der deutschen Gesundheitspolitik, sei es bei den allgegenwärtigen Zuzahlungen für verordnete, gesundheitlich notwendige Leistungen oder bei der endlich wieder abgeschafften Praxisgebühr, spielte die Annahme eine große Rolle, dass vor allem gesetzlich krankenversicherte Personen einem so genannten "Freibiertrinker"-Syndrom erliegen und versuchen, ihren gezahlten Beitrag möglichst wieder vollständig durch die Inanspruchnahme möglichst vieler und teurer Leistungen "herauszuholen". Dabei, so diejenigen welche meinen, dieses auch als "moral hazard" bezeichnetes Verhalten gäbe es bezogen auf die meist gar nicht so angenehmen Gesundheitsleistungen, würden auch jede Menge gesundheitlich nicht notwendiger aber möglicherweise "irgendwie" angenehmen Leistungen nachgefragt - und oft auch freigiebig von Ärzten oder anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen verordnet.
Auch wenn in manchen Lehrbüchern der Gesundheitsökonomie nicht nur das "moral hazard"-Verhalten von Versicherten und Patienten vorkommt, sondern auch das von Ärzten etc, fehlt es meist an empirischen Belegen für deren Verhaltensweisen.
Deshalb verdient eine relativ kleine Studie über das Verhalten von 468 bis 627 Ärzten mit 76.546 bis 79.826 PatientInnen im Alter von 50 Jahren und mehr aus 22 öffentlichen Gesundheitszentren in einer schwedischen Region besondere Aufmerksamkeit. Über 5 Messpunkte im Zeitraum 2005 bis 2009 hinweg wurde die Wirkung eines neu eingeführten Diagnosekodiersystems auf die Diagnosegewohnheiten der Ärzte durch Vorher-Nachher-Analysen untersucht. Die Einführung der neuen Diagnosekodiervorgaben war mit einer Reform des Honorierungssystems der Ärzte verbunden. Die Höhe des Honorars hing zum einen von den Kodierungen von Diagnosen bei jedem Arzt-Patient-Kontakt und zum anderen in besonderem Maße von Diagnosen chronischer Erkrankungen ab. Erwartet wurde von den ForscherInnen ein Anstieg der dokumentierten Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Krebs und ein Rückgang der Unterschiede in der Neigung zu kodieren auf Arzt- und Behandlungszentrumsebene.
Die Ergebnisse einer Analyse der Diagnosedaten in der "Skaraborg primary care database" lauten u.a.:
• Nach der Einführung dieses Kodier- und Honorierungssystem stieg die u.a. altersadjustierte dokumentierte Prävalenz von Bluthochdruck und Krebs von 17,4% auf 32,2% bzw. von 0,79% auf 2,32%.
• Bei kaum veränderten Ärzte- und Patientenzahlen erhöhte sich die Anzahl der registrierten Diagnosen von 183.052 auf 327.781. Besonders kräftig nahm dabei die Anzahl gestellter Diagnosen bei indirekten Kontakten zwischen Ärzten und Patienten zu.
• Bei einer Reihe von meist akuten Erkrankungen wie z.B. der Tonsilitis veränderte sich die Prävalenz dagegen nicht, weil, so die ForscherInnen, es für diese Art von Erkrankungen keine finanziellen Anreize gab, ihre Diagnose zu dokumentieren.
Trotz des offenkundigen, freilich nicht kausal gesicherten Zusammenhangs finanzieller Anreize mit der Anzahl und Art der gestellten und dokumentierten Diagnosen, machen sich die schwedischen Autoren fast am meisten Sorgen über die Folgen für die Nutzung von Diagnose-Routinedaten für die Krankheitsforschung.
Angesichts der Tatsache, dass im Ausland aber auch in Deutschland keine 5 Jahre vergehen ohne dass es zu einer gravierenden Veränderung des Honorierungssystems niedergelassener Ärzte kommt, ist der in dieser Studie gezeigte Zusammenhang finanzieller Anreize und dokumentierter "Diagnose-Morbidität" von nicht zu unterschätzender qualitativer Bedeutung. Dabei gibt es in Deutschland Anzeichen, dass die zahlreichen Veränderungen bei der Behandlungsdokumentation und der Abrechnung ambulanter ärztlicher Leistungen u.a. dazu beigetragen haben, dass nicht wenige Ärzte verhaltensmäßig noch in der vorletzten Honorierungswelt leben und für Patienten und sich selber unsinnige Dinge machen. Dazu gehört z.B. die in Deutschland noch immer ausgeprägte Neigung, Patienten ohne medizinische Notwendigkeit kurzfristig wieder einzubestellen. Dies sind wahrscheinlich noch Relikte aus der Zeit von Einzelleistungsvergütungen und sollten dann, wenn der Arzt sein Honorarsystem aus Regelleistungsvolumina und zahlreichen Behandlungspauschalen verstehen würde, verschwunden sein.
Den Aufsatz "Increased registration of hypertension and cancer diagnoses after the introduction of a new reimbursement system" von Per Hjerpe et al. im "Scandinavian Journal of Primary Health Care" online veröffentlicht im September 2012 gibt es komplett kostenlos.
Wer sich noch etwas intensiver mit "moral hazard" und der Empirie von Patienten- wie Arztverhalten kann dies u.a. mit Beiträgen in diesem Forum: So z.B. den Beiträgen "Anreize zur Verhaltenssteuerung im Gesundheitswesen" und "Der homo oeconomicus im Gesundheitswesen".
Bernard Braun, 26.11.12
Patient, Konsument, Teilnehmer...!? Personen, die psychiatrische Leistungen nutzen, bevorzugen die Bezeichnung Patient oder Klient
 Wie die immer noch lesenswerte diskursanalytische Arbeit zum Bild vom "mündigen Patienten" von Anja Dieterich aus dem Jahr 2006 gezeigt hat, ist die Bezeichnung kranker Menschen nicht nur eine Etikettenfrage, sondern kann auch massive Nachteile für den Kranken mit sich bringen.
Wie die immer noch lesenswerte diskursanalytische Arbeit zum Bild vom "mündigen Patienten" von Anja Dieterich aus dem Jahr 2006 gezeigt hat, ist die Bezeichnung kranker Menschen nicht nur eine Etikettenfrage, sondern kann auch massive Nachteile für den Kranken mit sich bringen.
Der britische Sozialpolitikwissenschaftler McLaughlin hat in einem 2009 publizierten Aufsatz bereits in der Überschrift auf die anhaltende Bedeutung des "wording", "branding" oder "labeling" von Personen im Bereich der Sozialarbeit hingewiesen: "What's in a Name: 'Client', 'Patient', 'customer', 'Consumer', 'Expert by Experience', 'Service User' - What's Next?" Er zeigt ferner in kompakter Form, dass mit jedem dieser und künftiger Etiketten Annahmen und Erwartungen zum Verhalten von Personen verbunden sind, die letztlich dann auch das Verhalten anderer Personen gegenüber den Etikettierten beeinflussen. Auf was der Autor aber auch hinweist ist, dass man vor der Erfindung der nächsten Bezeichnung vielleicht einmal die Bezeichneten selbst fragen sollte, mit welchem Begriff sie sich am besten charakterisiert finden.
Diese Anregung wurde in einem 2012 publizierten systematischen Review von Einzelstudien aufgegriffen, die sich sämtlich damit beschäftigten, wie Menschen, die sich in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung befanden, sich selber bezeichnen und von anderen Personen bezeichnet wurden. Der Aufsatz enthält hierzu den Stand des Wissens in der internationalen Literatur.
In den zunächst recherchierten 13.765 Abstracts in englischer Sprache , den 69 Volltext-Aufsätzen und den schließlich kriteriengesteuert für den Review ausgewählten 11 Studien, wimmelte es von den bereits bekannten Begriffen. Und selbst Studien, die lediglich beabsichtigten die bevorzugten Bezeichnungen zu identifizieren, fügten ironischerweise eigene Bezeichnungen hinzu. So gelangten z.B. die Bezeichnungen "recipients" und "attendees (Teilnehmer)" in die Welt.
Das britische Autorenteam kam u.a. zu folgenden Ergebnissen:
• Für die Hypothese, die Fülle der Bezeichnungen von Menschen, die sich in einer psychiatrischen Behandlung befinden, hätte das Potenzial diese Personen zu stigmatisieren oder zu empowern, fanden sie wenig empirische Evidenz.
• Die "Nutzer" psychiatrischer Behandlung beschreiben sich selber gegenwärtig, je nach Herkunftsland, vorrangig als Patient oder Klient.
• Die untersuchten Studien weisen fast durchweg einen Mangel an Beteiligung von Angehörigen der untersuchten Krankengruppe am Studiendesign und der Planung angemessener Fragen z.B. nach der Selbstbezeichnung sowie bei sonstigen Inputs auf. Wer schon einmal selber versucht hat, Patienten nach ihrem Selbstbild zu fragen oder danach welche Bezeichnungen durch Dritte sie bevorzugen, weiß wie schwer solche Fragen zu formulieren sind und dass man immer mit Einflüssen der sozialen Erwünschtheit bestimmter Typisierungen zu kämpfen hat.
Von dem Aufsatz "A systematic review of the terms used to refer to people who use mental health services: User perspectives" von Geoff Dickens und Marco Picchioni - veröffentlicht im "International Journal of Social Psychiatry" (März 2012, vol. 58 no. 2: 115-122) ist der gesamte Text kostenlos erhältlich.
Von dem Aufsatz "What's in a Name: 'Client', 'Patient', 'Customer', 'Consumer', 'Expert by Experience', 'Service User'—What's Next?", verfasst von Hugh McLaughlin und 2009 veröffentlicht im "British Journal of Social Work" (Volume 39, Issue 6: 1101-1117) ist ebenfalls der gesamte Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.8.12
Zwei RCT-Studien zeigen keine positiven Wirkungen zweier Interventionen bei Typ 1 und Typ 2-DiabetikerInnen nach 3 und 1 Jahr!
 Der Diabetes mellitus Typ 2 ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen bei mittelaltrigen und älteren Menschen, deren Inzidenz je nach Mentalität der Prognostiker in den nächsten Jahren weiter zunehmen oder gar explodieren soll. Auf quantitativ niedrigerem Niveau gehört auch der Diabetes mellitus Typ 1, der überwiegend bei jüngeren Menschen auftritt, ebenfalls zu den häufigen Erkrankungen. Zu den Hauptursachen von Diabetes gehören gesundheitsbezogene Verhaltensweisen wie etwa Bewegungsmangel und einseitige Ernährung und u.a. als deren Folge Übergewichtigkeit bis hin zu Adipositas. Die Beeinflussung dieser und anderer Verhaltens- oder Lebensweisen gilt daher sowohl als primärpräventive Maßnahme aber auch als Maßnahme, die die Stoffwechselstörungen z.B. durch Gewichtsverluste selbst nach manifester Erkrankung beseitigen kann. Jahrzehntelange Erfahrungen zeigen aber ebenfalls, dass es nicht leicht ist, solche Veränderungen einzuleiten und zu verstetigen. Dies ist vor allem nicht durch einfache Appelle an den gesunden Menschenverstand oder durch die üblichen Arzt-Patient-Gespräche zu bewerkstelligen. Auch eindimensionale Programme, die entweder nur bei der Ernährung oder nur bei der körperlichen Bewegung ansetzen, gelten seit langem als spätestens mittel- und langfristig wirkungslos.
Der Diabetes mellitus Typ 2 ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen bei mittelaltrigen und älteren Menschen, deren Inzidenz je nach Mentalität der Prognostiker in den nächsten Jahren weiter zunehmen oder gar explodieren soll. Auf quantitativ niedrigerem Niveau gehört auch der Diabetes mellitus Typ 1, der überwiegend bei jüngeren Menschen auftritt, ebenfalls zu den häufigen Erkrankungen. Zu den Hauptursachen von Diabetes gehören gesundheitsbezogene Verhaltensweisen wie etwa Bewegungsmangel und einseitige Ernährung und u.a. als deren Folge Übergewichtigkeit bis hin zu Adipositas. Die Beeinflussung dieser und anderer Verhaltens- oder Lebensweisen gilt daher sowohl als primärpräventive Maßnahme aber auch als Maßnahme, die die Stoffwechselstörungen z.B. durch Gewichtsverluste selbst nach manifester Erkrankung beseitigen kann. Jahrzehntelange Erfahrungen zeigen aber ebenfalls, dass es nicht leicht ist, solche Veränderungen einzuleiten und zu verstetigen. Dies ist vor allem nicht durch einfache Appelle an den gesunden Menschenverstand oder durch die üblichen Arzt-Patient-Gespräche zu bewerkstelligen. Auch eindimensionale Programme, die entweder nur bei der Ernährung oder nur bei der körperlichen Bewegung ansetzen, gelten seit langem als spätestens mittel- und langfristig wirkungslos.
Sowohl für die DiabetespatientInnen als auch für die sie behandelnden Ärzte sind daher seit längerem spezielle gruppenbasierte Programme entwickelt worden, auf Dauer erfolgreich mit der eigenen Erkrankung umgehen zu können oder PatientInnen von der Notwendigkeit einer Verhaltensveränderung zu überzeugen.
Die Langzeit-Wirkungen zweier solcher Programme wurden nun in Großbritannien untersucht und erwiesen sich nach drei bzw. einem Jahr Wirkzeit als praktisch nicht (mehr) existent.
In der ersten Studie wurde das von Fachverbänden empfohlene und ihren Qualitätskriterien entsprechende so genannte DESMOND (diabetes education and self management for ongoing and newly diagnosed)-Programm untersucht. Es besteht in einem sechsstündigen Informations- und Übungsprogramm zum Selbstmanagement neu von Personen, die frisch als DiabetikerIn diagnostiziert wurden. In 207 Allgemeinarztpraxen in 13 allgemeinärztlichen Versorgungsregionen in Großbritannien wurden in einer multizentrischen randomisierten und kontrollierten Studie (Zufallsauswahl auch auf Praxisebene) für 731 Kranke der Effekt der Intervention im Vergleich mit der Standardbehandlung über 3 Jahre hinweg untersucht. Dazu wurden Körperwerte gemessen und eine Befragung durchgeführt. Als primäres Ergebnis wurde die Entwicklung des längerfristigen Blutzuckerwertes HbA1c untersucht. Das zweite untersuchte Ergebnis waren Veränderungen mehrerer Körperwerte (z.B. Blutdruck, Gewicht) und gesundheitsbezogener Verhaltensweisen (z.B. Rauchstatus, körperliche Aktivität, Depressivität, Lebensqualität und Arzneimittelgebrauch).
Nach drei Jahren sahen die adjustierten Ergebnisse so aus:
• In beiden Gruppen war der der HbA1c-Wert gesunken. Weder bei diesem Wert noch den anderen biomedizinischen Werten gab es signifikante Unterschiede zwischen den TeilnehmerInnen beider Gruppen. Dies gilt auch für die Einnahme von oralen Antidiabetika.
• Bei den sekundären Ergebnissen besaßen die TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe einen signifikant besseres Verständnis über ihre Erkrankung sowie ihre Ernsthaftigkeit und ihre Möglichkeiten, den Verlauf der Erkrankung zu beeinflussen. Keine signifikanten Unterschiede gab es aber bei der Lebensqualität, der Depressivität und anderen psychosozialen Aspekten.
Die Hoffnungen der WissenschaftlerInnen durch eine Verlängerung der Informations- und Übungszeiten, eine Erhöhung der Interventionshäufigkeit und eine noch längere Einwirkungszeit die biomedizinischen Effekte zu verbessern, wirken eher hilflos und zweckoptimistisch. Zu untersuchen, warum sich bestimmte Effekte nicht entwickeln oder ohne ständige Erneuerung in der Zeit verschwinden, wäre vordringlich, aber auch wesentlich schwieriger.
In dem zweiten Programm "Talking diabetes" wurde eine Interventionsgruppe von 13 Teams mit 79 Allgemeinärzten in pädiatrischen Diabeteszentren Großbritanniens mit insgesamt 359 4 bis 15 Jahre alten an Diabetes Typ 1 erkrankten Kindern speziell psychoedukativ geschult bei entsprechenden Konsultationen auf deren Verhalten einzuwirken. In der Kontrollgruppe mit 13 Teams waren 334 Kinder.
Die untersuchten Ergebniseffekte war auch hier primär der HbA1c-Wert und sekundär das bereits bekannte Bündel von Aspekten bzw. möglichen Effekten.
Die adjustierten Ergebnisse sahen hier nach einem Jahr so aus:
• Beim HbA1c-Wert gab es keinen signifikanten Effekt in der Gruppe mit speziell geschulten Behandlern. Dies galt auch für die Kinder bei sämtlichen sekundären Ergebnisse.
• Neben einem kurzzeitigen positiven Effekte beim Bewältigungsverhalten zeigten sich bei einigen Aspekten der Lebensqualität sogar negative Wirkungen oder Verschlechterungen.
• Während sich bei einigen Behandlern positive Veränderungen bei ihrer Einstellung zur Notwendigkeit einer dauerhaften Behandlung zeigten und sie sogar Visiten mit Spannung erwarteten, gab es bei den Kindern keine vergleichbaren Effekte.
Die Studienverantwortlichen empfehlen im Lichte der von ihnen gewonnenen Evidenz, solche Trainings für Ärzte etc. nicht in den Leistungskatalog des National Health Service aufzunehmen.
Der Aufsatz "Effectiveness of a diabetes education and self management programme (DESMOND) for people with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus: three year follow-up of a cluster randomised controlled trial in primary care" von Kamlesh Khunti et al. ist im "British Medical Journal (BMJ)" am 26. April 2012 (344:e2333) erschienen und als "open access"-Text komplett kostenlos erhältlich.
Ebenfalls kostenlos ist der Volltext des Aufsatzes "The effect of the Talking Diabetes consulting skills intervention on glycaemic control and quality of life in children with type 1 diabetes: cluster randomised controlled trial (DEPICTED study) von Mike Robling et al. erhältlich, der in derselben Ausgabe des BMJ (344:e2359) erschienen ist.
Bernard Braun, 12.5.12
Was hilft, das Gesundheitsverhalten von Diabetikern zu verbessern? Finanzielle Anreize: Nein! Persönliche Vorbilder: Ja!
 Die unbeirrbaren Anhänger des Glaubens, man könne mit Bonusprogrammen, Praxis- oder Arztbesuchsgebühren, Zuzahlungen oder andere finanzielle Anreize, mehrheitlich, verlässlich und nachhaltig menschliches Verhalten im Gesundheits- und anderen -bereichen steuern, werden auch das Ergebnis der hier vorgestellten Studie als Irrtum oder Ausrutscher der Wirklichkeit ignorieren (vgl. zur notorischen Unbeirrbarkeit des Mainstreams der deutschen Verbands-Gesundheitsökonomen). Trotzdem verdient diese Studie die Aufmerksamkeit aller jener, die bereits theoretisch wie empirisch an der allgemeinen Gültigkeit des an Grenznutzenkalkülen orientierten Menschen- und Verhaltensmodells à la "moral hazard" oder "rational choice" zweifelten.
Die unbeirrbaren Anhänger des Glaubens, man könne mit Bonusprogrammen, Praxis- oder Arztbesuchsgebühren, Zuzahlungen oder andere finanzielle Anreize, mehrheitlich, verlässlich und nachhaltig menschliches Verhalten im Gesundheits- und anderen -bereichen steuern, werden auch das Ergebnis der hier vorgestellten Studie als Irrtum oder Ausrutscher der Wirklichkeit ignorieren (vgl. zur notorischen Unbeirrbarkeit des Mainstreams der deutschen Verbands-Gesundheitsökonomen). Trotzdem verdient diese Studie die Aufmerksamkeit aller jener, die bereits theoretisch wie empirisch an der allgemeinen Gültigkeit des an Grenznutzenkalkülen orientierten Menschen- und Verhaltensmodells à la "moral hazard" oder "rational choice" zweifelten.
An der randomisierten kontrollierten Studie an einem medizinischem Zentrum der steuerfinanzierten Spezial-Krankenversicherung "Veteran Affairs" nahmen 118 schwarze diabeteskranke Veteranen der US-Streitkräfte im Alter von 50 bis 70 Jahren teil, die ihren hohen Blutzuckerwert (HbA1c-Wert >8%) hartnäckig nicht unter Kontrolle oder gar zum Sinken gebracht hatten. Ein Drittel der Teilnehmer wurde einer Kontrollgruppe mit der üblichen Behandlung durch Arztappelle etc. zugewiesen. Ein zweites Drittel war in einer Interventionsgruppe, die mehrfach von so genannten "peer mentors" beraten wurden. Dabei handelt es sich um ebenfalls diabeteskranke Personen, die es geschafft hatten, ihren Blutzuckerspiegel deutlich zu senken und die nun nach Alter und Rasse den Studienpersonen zugewiesen wurden. Darauf wurden sie in einer einstündigen Übung zu motivierenden Gesprächstechniken vorbereitet. Das dritte Drittel der TeilnehmerInnen wurde einer Gruppe zugewiesen, deren Teilnehmer für die Senkung ihres Blutzuckerspiegels je nach Umfang 100 oder 200 US-Dollar erhalten sollten.
Nach 6 Monaten Studienlaufzeit war der anfängliche durchschnittliche HbA1c-Wert von 9,7% in der Peer-Mentorengruppe signifikant um 1,07 Prozentpunkte gesenkt worden. Dies entspricht in etwa dem Wert, der auch mit oralen Antidiabetika erreichbar ist. Die Empfänger der üblichen Behandlung senkten diesen Wert lediglich um 0,01 Prozentpunkte und die der Gruppe mit finanziellem Anreiz um nicht signifikante 0,45 Prozentpunkte.
Obwohl sicher ist, dass allein die soziale Begleitung durch diabeteserfahrene Mentoren zu einer signifikanten Senkung des Blutzuckerwertes führte, nicht aber die finanziellen Anreize, sollte eine vergleichbare Studie mit mehr und repräsentativeren TeilnehmerInnen und vor allem mit einer längeren Interventions- und Beobachtungszeit so schnell wie möglich gestartet werden.
Was hält dann, wenn die kritischen Punkte zutreffend sind und beachtet werden, eine gesetzliche Krankenkasse eigentlich davon ab, eine inhaltlich vergleichbare Studie mit deutschen DiabetikerInnen und "peer mentors" mit einer Laufzeit von 2 bis 5 Jahren und unter Kontrolle ihrer gesundheitlichen Lebensweise durchzuführen?
Wie bedeutend die Argumente und/oder das Vorbild von Personen für Verhaltensentscheidungen sein können, zeigen im Übrigen auch Analysen über die für die Wahl eines Krankenhauses oder eines Arztes entscheidenden Faktoren oder Umstände. Bei einer Mehrheit der vor eine solche Wahl gestellten Personen sind dies nicht die "objektiven" Führer, Navigatoren oder Listen, sondern der "subjektive" Rat von Freunden, Bekannten oder Verwandten, bei denen risikoadjustierte Sterberaten keine, die Tatsache, dass sie ein Krankenhaus gut überlebt haben, aber eine zentrale Rolle spielen.
Den Aufsatz "Peer mentoring and financial incentives to improve glucose control in African American veterans: A randomized trial" von Long JA et al. aus den "Annals of Internal Medicine" vom 20. März 2012 (156 (6): 416-24) gibt es als Abstract und Volltext kostenlos.
Bernard Braun, 6.5.12
Zuzahlungen in der GKV 2005-2010: Jährlich rd. 5 Mrd. Euro, kaum erwünschte aber durchaus unerwünschte Steuerungswirkungen
 Die bunte Schar aller gesundheitspolitisch Verantwortlichen führte in einer Art größtmöglichen Koalition seit den 1970er Jahren für mittlerweile rund drei Viertel aller Leistungen Zuzahlungen ein und belegte mit der Praxisgebühr auch bereits den Zugang zu ambulanten ärztlichen Leistungen mit einem Zoll. Dies geschah weitgehend unbeeindruckt von wissenschaftlichen Warnungen vor dem Nichteintritt der erwünschten Steuerwirkungen und vor dem Eintritt unerwünschter Wirkungen wie z.B. der folgenreichen Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen durch Kranke. Am Ende waren Zuzahlungen auf ein süchtig machendes Instrument zur Einnahmeerhöhung der Krankenkassen auf Kosten von Kranken zusammengeschrumpft. Um die schlimmsten sozialen Belastungen zu dämpfen nahm auch die Anzahl und Komplexheit von Befreiungsmöglichkeiten und Belastungsgrenzen zu.
Die bunte Schar aller gesundheitspolitisch Verantwortlichen führte in einer Art größtmöglichen Koalition seit den 1970er Jahren für mittlerweile rund drei Viertel aller Leistungen Zuzahlungen ein und belegte mit der Praxisgebühr auch bereits den Zugang zu ambulanten ärztlichen Leistungen mit einem Zoll. Dies geschah weitgehend unbeeindruckt von wissenschaftlichen Warnungen vor dem Nichteintritt der erwünschten Steuerwirkungen und vor dem Eintritt unerwünschter Wirkungen wie z.B. der folgenreichen Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen durch Kranke. Am Ende waren Zuzahlungen auf ein süchtig machendes Instrument zur Einnahmeerhöhung der Krankenkassen auf Kosten von Kranken zusammengeschrumpft. Um die schlimmsten sozialen Belastungen zu dämpfen nahm auch die Anzahl und Komplexheit von Befreiungsmöglichkeiten und Belastungsgrenzen zu.
Da auch die Gesundheitspolitiker nicht zu wissen vorgaben, was die Effekte all dieser Regelungen sind, verpflichteten sie im § 62 Abs. 5 SGB V die Spitzenverbände der Krankenkassen "für das Jahr 2006 die Ausnahmeregelungen von der Zuzahlungspflicht hinsichtlich ihrer Steuerungswirkung" zu "evaluieren" und dem Deutschen Bundestag "spätestens bis zum 30.6. 2007 einen Bericht vor (zu (legen)." Nach langem Hin und Her, mehrmaligen Versuchen, an einem solchem Bericht doch noch vorbeizukommen, der Weigerung mancher Kassen, hierfür Daten zu liefern und der für eine ordentliche Studie nicht zu realisierenden aber methodisch angeblich notwendigen Anzahl von mindestens 700.000 GKV-Versicherten, legte der Spitzenverband Bund der Krankenkassen dann im November 2011 einen Bericht vor, der am 20. Februar 2012 zusammen mit anderen Texten als Drucksache des Deutschen Bundestages erschienen ist.
Damit liegt eine Reihe von vorher nicht leicht zugänglichen Daten zur Zuzahlungswirklichkeit in den Jahren 2005 bis 2010 vor:
• Die bereinigte Summe aller Zuzahlungen sank daher von 5,193 Milliarden (Mrd.( Euro im Jahr 2005 auf 4,837 Mrd. Euro im Jahr 2009 und stieg 2010 wieder auf 5,023 Mrd. Euro.
• Die durchschnittliche jährliche Zuzahlungsbelas¬tung je Versicherter im genannten Zeitraum beträgt rund 72 Euro.
• Die Anteile der Zuzahlungen für ärztliche Behandlung und Arzneimittel etc. waren absolut am höchsten, die für ergänzende Leistungen zur Rehabilitation und Empfängnisverhütung am niedrigsten.
• Von Zuzahlungen befreit waren insgesamt 6,986 Millionen Versicherte im Jahr 2005 und 7,852 Millionen im Jahr 2010.
Angesichts der genannten Schwierigkeiten der Datenbeschaffung für eine eigene GKV-repräsentative Untersuchung und wohl auch wegen der Zwickmühle in der die GKV als Nutznießer der Zuzahlungen objektiv sitzt, stützt sich der Spitzenverband der GKV zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, die Steuerungswirkung zu erkunden, auf sechs veröffentlichte empirische Studien. Zwei Studien widmen sich den Steuerungswirkungen der Selbstbeteiligungsregelungen bei Arzneimitteln einschließlich der Befreiungsregeln, die übrigen haben die Steuerungswirkungen der am 1. Januar 2004 eingeführten Praxisgebühr zum Gegenstand.
Die Erkenntnisse dieser Studien fasst der GKV-Spitzenverband so zusammen: "Bei der Untersuchung des Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Frage der Steuerungswirkungen von Zu¬zahlungen in der GKV konnten den zugrunde gelegten sechs Studien in der Gesamtbetrachtung keine eindeuti¬gen Hinweise auf nachhaltige Steuerungswirkungen der geltenden Zuzahlungsregelungen entnommen werden. So attestieren zwei Studien den Zuzahlungen bei Arzneimit¬teln nur sehr geringe Steuerungswirkungen, wobei die Aussagekraft einer Studie für die Gegenwart einge¬schränkt wird, da sie sich auf die Zeit vor dem 1. Januar 2004 bezieht. Die übrigen Studien haben die Auswirkun¬gen der Praxisgebühr im Rahmen von Befragungen unter¬sucht und kommen nicht zu einheitlichen Ergebnissen. So hat eine Studie für das Jahr 2004 feststellt, dass die Pra¬xisgebühr zur Konzentration auf die Inanspruchnahme gesundheitlich notwendiger Arztkontakte und zur Reduk¬tion nicht notwendiger Arztkontakte beigetragen hat, ohne die Inanspruchnahme von Personen mit einge¬schränkter Gesundheit, Schwerbehinderung, Pflegebe¬dürftigkeit oder niedrigem Einkommen einzuschränken. Zwei weitere Studien mit längerer Beobachtungszeit kommen demgegenüber zu dem Ergebnis, dass die Pra¬xisgebühr die Inanspruchnahme von Ärzten ab 2005 nicht signifikant bzw. nachhaltig gegenüber dem Niveau vor dem 1. Januar 2004 gesenkt hat. In den beiden Studien, in denen explizit nach der Vermeidung von Arztbesuchen wegen der Praxisgebühr gefragt wurde, gaben zwischen 13 und 18 Prozent der Befragten an, wegen der Praxisge-bühr einen subjektiv notwendigen Arztbesuch unterlassen zu haben. Die Studien stellen zudem fest, dass die Praxis¬gebühr insbesondere bei einkommensschwachen Versi¬cherten bei vorliegender Krankheit zu einer Verzögerung oder Vermeidung von subjektiv notwendigen Arztbesu¬chen geführt hat."
Wegen dieser Ergebnisse und weiterer etwas älterer aber auch aktuellerer wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse über die zweifelhaften Steuerungswirkungen von Zuzahlungen aus dem In- und Ausland sollte ernsthaft über die Abschaffung oder den raschen Abbau der Zuzahlungen und der Praxisgebühr nachgedacht werden und der Einnahmeverlust solidarisch oder durch den längst überfälligen und milliardenschweren Abbau von Über- und Fehlversorgung kompensiert werden. Das plötzliche Interesse an der Umverteilung der jüngst zu üppigen Einnahmen der GKV oder die Tatsache, dass die Verwaltung der Praxisgebühr allein schon 300 Millionen Euro pro Jahr kosten soll (das entspricht in etwa allen Ausgaben der GKV für Prävention!!!), sollte allenfalls eine verstärkende Rolle spielen.
Die Bundestagsdrucksache 17/8722 vom 10.2.2012 Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zur Evaluation der Ausnahmeregelungen von der Zuzahlungspflicht bzw. der Ergänzende Bericht des GKV-SV vom 15. November 2011 zu dem "Bericht der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Evaluation der Ausnahmeregelungen von der Zuzahlungspflicht nach § 62 Absatz 5 SGB V" gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 26.3.12
Amerikanische Kardiologen: Geld beeinflusst die Indikationsstellung für Belastungsuntersuchungen
 Ärzte reagieren in ihren diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen auf finanzielle Anreize. Dieser durch zahlreiche Studien (hier eine Arbeit aus 1990) belegte Sachverhalt wird erneut durch eine kürzlich erschienene Studie bestätigt.
Ärzte reagieren in ihren diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen auf finanzielle Anreize. Dieser durch zahlreiche Studien (hier eine Arbeit aus 1990) belegte Sachverhalt wird erneut durch eine kürzlich erschienene Studie bestätigt.
Untersucht wurde, inwieweit die Indikationsstellung für eine Belastungsuntersuchung bei Herzpatienten mit dem finanziellen Vorteil für den Arzt zusammenhängt. Abrechenbar und somit lukrativ ist die Durchführung der Untersuchung und ihre Befundung. Für beide Leistungen gibt es jeweils eine Abrechnungsziffer. Ein Arzt, der zur Untersuchung überweist und selbst weder durchführt noch befundet, kann dies nicht abrechnen - er verdient also nicht daran.
Der finanzielle Vorteil steigt in folgenden Stufen:
1) zur Untersuchung überweisen
2) Untersuchung befunden,
3) Untersuchung durchführen und befunden.
Bei den Patienten handelte es sich um Herzpatienten, die mindestens 90 Tage vor der Untersuchung eine koronaren Revaskularisation erhalten hatten, also einem Eingriff zur Überbrückung (Bypass) oder Aufdehnung (perkutane koronare Intervention, PCI) von Engstellen an den Herzkranzgefäßen. Die Studie prüfte, ob die Indikationsstellung zur Belastungsuntersuchung durch den Arzt mit dem Ausmaß des finanziellen Anreizes zusammenhängt.
Mit einer Belastungsuntersuchung soll der Blutfluss am Herzen und somit der Zustand der Herzkranzgefäße gemessen werden. Bei körperlicher oder durch ein Medikament hervorgerufener Belastung wird die Verteilung einer radioaktiven Substanz (z.B. Technetium 99) gemessen (Nuklearmedizinische Untersuchung) oder das Kontraktionsverhalten des Herzmuskels im Ultraschall beurteilt (Stress-Echokardiographie).
Die Daten von 17.847 Mitgliedern einer großen amerikanischen Krankenversicherung (United Healthcare) wurden ausgewertet, die zwischen November 2004 und Juni 2006 eine Belastungsuntersuchung nach Revaskularisation erhielten.
Insgesamt erhielten 12,2% der Patienten eine der beiden Belastungsuntersuchungen.
Ärzte der Stufe 3 stellten die Indikation für die Nuklearuntersuchung bei 12,6% ihrer Patienten, Ärzte der Stufe 2 bei 8,8% und Ärzte der Stufe 1 bei 5%. Diese "Dosis-Wirkungs-Beziehung" von finanziellem Anreiz und Durchführungsraten zeigte auch sich für die Stressechokardiographie mit 2,8%, 1,4% und 0,4%.
Auch die verfeinerten Auswertungen, die z.B. die Krankheitsschwere der Patienten berücksichtigten, bestätigten den Zusammenhang.
Das Fazit lautet, dass in dieser Studie die Ärzte die Indikation zur Belastungsuntersuchung nicht allein nach medizinischer Notwenigkeit stellen. Vielmehr folgen die Ärzte in der Indikationsstellung den finanziellen Anreizen.
Shah BR, Cowper PA, O'Brien SM, Jensen N, Patel MR, Douglas PS, et al. Association Between Physician Billing and Cardiac Stress Testing Patterns Following Coronary Revascularization. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2011;306:1993-2000 Abstract
David Klemperer, 22.11.11
Interventionen an den Herzkranzgefäßen - weniger ist mehr, wird aber nicht umgesetzt
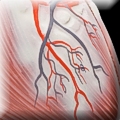 Im Jahr 2007 erregte die COURAGE-Studie große Aufmerksamkeit. In dieser Studie wurde belegt, dass eine sorgfältige und konsequente medikamentöse Behandlung von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit die besten Ergebnisse bringt. Die Vergleichsgruppe von Patienten, die zusätzlich zur medikamentösen Therapie noch Eingriffe an den Herzkranzgefäßen erhielten, erzielte keinerlei Vorteile - weder im Überleben noch in der Rate von Herzinfarkten. Auch der Anteil beschwerdefreier Patienten war gleich.
Im Jahr 2007 erregte die COURAGE-Studie große Aufmerksamkeit. In dieser Studie wurde belegt, dass eine sorgfältige und konsequente medikamentöse Behandlung von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit die besten Ergebnisse bringt. Die Vergleichsgruppe von Patienten, die zusätzlich zur medikamentösen Therapie noch Eingriffe an den Herzkranzgefäßen erhielten, erzielte keinerlei Vorteile - weder im Überleben noch in der Rate von Herzinfarkten. Auch der Anteil beschwerdefreier Patienten war gleich.
Die COURAGE-Studie hatte somit gezeigt, dass Eingriffe wie Aufdehnung von Engstellen an den Herzkranzgefäßen (PTCA) und Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent) bei Herzpatienten ohne Angina-pectoris-Beschwerden keinen Nutzen erbringt und somit unterlassen werden sollte. Jeder Patient hingegen sollte die optimale medizinische Therapie (OMT) aus Blutverdünnungsmittel wie Aspirin, Blutfettsenker und Betablocker erhalten, soweit keine Gegenanzeigen bestehen. Bei Patienten mit Beschwerden sind Eingriffe nur erforderlich, wenn die Beschwerden mit der OMT nicht ausreichend gelindert werden können und der Patient sich so beeinträchtigt fühlt, dass er den Eingriff wünscht.
Wünschenswert ist es natürlich, dass derartige wegweisende Erkenntnisse umgehend den Patienten zugute kommen, in diesem Fall, dass sie die nützliche Behandlung mit Arzneimitteln erhalten und vor nutzlosen Eingriffen bewahrt werden.
Amerikanische Wissenschaftler werteten jetzt Angaben aus einem nationalen Register aus, in dem die Behandlung von Patienten aus mehr als 1.000 Krankenhäusern mit Herzkrankheiten sorgfältig dokumentiert werden. Die Ergebnisse sind ernüchternd.
Zur Verfügung standen Daten von 467.211 Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit, die in einem umschriebenen Zeitraum vor (173.416 Patienten) bzw. nach (293.795 Patienten) Veröffentlichung der COURAGE-Studie einen Eingriff an den Herzkranzgefäßen (PTCA)erhielten. Gefragt wurde nach dem Anteil der Patienten die in der jeweiligen Periode die optimale medikamentöse Therapie (OMT) vor bzw. nach dem Eingriff erhielten
Vor Veröffentlichung der COURAGE-Studie am 27.3.2007 erhielten vor dem Eingriff 43,5% die OMT, nach dem Eingriff 63,5%. Nach der Veröffentlichung der Studie erhielten vor dem Eingriff 44,7% die OMT, nach dem Eingriff 66,0%.
Die Ergebnisse der COURAGE-Studie wurden somit von den amerikanischen Kardiologen nicht umgesetzt. Die konsequente Umsetzung hätte eine annähernd vollständige Versorgung der Patienten mit OMT erfordert, bevor ein Eingriff mit dem Ziel der Beschwerdelinderung mit den Patienten auch nur diskutiert wird.
Diese eindrucksvolle Studie belegt, dass auf Seiten der Anbieter die Anreize zur Durchführung der PTCA stärker wiegen als Evidenz und Ethik. Den Patienten wird die bestmögliche Therapie vorenthalten. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf ein - lange bekanntes - Systemversagen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Unabdingbar dürfte aber sein, Patienten dadurch zu stärken, dass sie aufgrund evidenzbasierter Informationen Entscheidungen unabhängig von den Anbieterinteressen treffen können.
Die Frage der Erbringung nutzloser PTCAs stellt sich auch für Deutschland, kann aber aufgrund fehlender Daten derzeit nicht beantwortet werden.
Borden WB, Redberg RF, Mushlin AI, Dai D, Kaltenbach LA, Spertus JA. Patterns and Intensity of Medical Therapy in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2011;305(18):1882-89.
Abstract
Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom 11.5.2011 Link
COURAGE-Studie:
Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, Hartigan PM, Maron DJ, Kostuk WJ, et al. Optimal Medical Therapy with or without PCI for Stable Coronary Disease. N Engl J Med 2007;356(15):1503-16 Link zum Volltext
David Klemperer, 20.7.11
Neues aus Oregon: Was passiert, wenn arme Menschen ohne Krankenversicherungsschutz ihn per Lotterie doch erhalten?
 Wer künftig über die Wirkungen von Krankenversicherung auf das Verhalten von Menschen nicht mehr nur zwischen "moral hazard"- und "Gutmenschen"-Annahmen herumspekulieren will, kommt um die ersten Ergebnisse eines aktuellen Oregon-Experiments nicht herum.
Wer künftig über die Wirkungen von Krankenversicherung auf das Verhalten von Menschen nicht mehr nur zwischen "moral hazard"- und "Gutmenschen"-Annahmen herumspekulieren will, kommt um die ersten Ergebnisse eines aktuellen Oregon-Experiments nicht herum.
In ihm geht es darum, welche ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Effekte es haben könnte, wenn ab 2014 geplant - sofern der "Patient Protection and Affordable Care Act" der Obama-Administration nicht doch noch scheitert - ein Großteil der bisher nicht krankenversicherten und geringverdienenden US-AmerikanerInnen einen obligatorischen Krankenversicherungsschutz erhält. Herausbekommen will dies eines der typischen us-amerikanischen sozialen Experimente, mit dessen Durchführung der gesundheits- und sozialpolitisch (vgl. dazu die aktuell wie historisch interessante Website zum so genannten Oregon Health Plan aus den 1990er Jahren) schon immer besonders experimentierfreudige Us-Bundesstaat Oregon eine Reihe von WissenschaftlerInnen (die so genannte "The Oregon Health Study Group") beauftragte. Die meisten ForscherInnen arbeiten an der Harvard University in Boston und sind langjährige ExpertInnen im "National Bureau of Economic Research (NBER)". Unter ihnen auch der mit dem ähnlich innovativen "RAND Health Insurance Experiment" aus den 1970er Jahren über die Effekte von Zuzahlungen bekannt gewordene Joseph Newhouse.
Als erstes wurden aus der nicht- oder nur episodisch krankenversicherten geringverdienenden und nicht vermögenden Bevölkerung mittels einer Lotterie 29.589 Personen für die Interventionsgruppe und weitere 28.816 Personen für eine Kontrollgruppe gewonnen. Die Intervention bestand in der Aufnahme in die von den Bundesstaaten getragene Armen-Krankenversicherung Medicaid, in der diese Personen trotz eines möglichen Anspruchs ohne diese Auswahl nicht versichert waren.
Für bisher ein Jahr wurde dann mit administrativen Daten der Krankenversicherung und mit Surveys untersucht, ob und wie die Personen mit Krankenversicherungsschutz im Vergleich zu den Nichtversicherten verschiedene Gesundheitsversorgungsleistzungen in Anspruch nehmen, wie sich ihre gesundheitliche, soziale und finanzielle Situation verändert.
Die substantiellen und statistisch signifikanten Wirkungen des Versicherungsschutzes sehen u.a. folgendermaßen aus:
• Die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhausaufnahme stieg um 30%
• Die Wahrscheinlichkeit, irgendein Medikament verordnet zu bekommen stieg um 15%
• Um 35% stieg die Wahrscheinlichkeit einer ambulanten Behandlung
• Die jährlichen Gesundheitsausgaben stiegen insgesamt um 25%.
• Erste Untersuchungen weisen darauf hin, dass es sich bei den Angehörigen der Interventionsgruppe um Personen handelt, die vorher unterversorgt waren und daher eventuell einen gewissen "Nachholbedarf" haben.
• Die erwünschte Inanspruchnahme präventiver Leistungen wie regelmäßige Mammographien oder Messungen des Cholesterinspiegels stieg deutlich an.
• Der Versicherungsschutz senkte die Häufigkeit der Erfahrungen mit durch Arztrechnungen bedingte Schulden und die Belastung durch "out-of-pocket"-Zahlungen für Medikamente etc. beträchtlich. Die Wahrscheinlichkeit, eine unbezahlte Arztrechnung zu haben, die der Gläubiger an eine Inkasso-Agentur geschickt hat, sank um 25%. Die Wahrscheinlichkeit irgendeiner "out-of-pocket"-Zahlung sank um 35%. Die ForscherInnen weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Entwicklung sowohl den Versicherten als auch den Ärzten oder Krankenhäuser nützt. Letztere hatten nämlich nur selten Erfolg, ihre finanziellen Ansprüche einzutreiben.
• Schließlich stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Versicherten ihren Gesundheitszustand als gut oder exzellent bewerteten um 25%. Ähnlich sieht es beim Niveau des Wohlbefindens aus. Und auch die Häufigkeit einer bisher nur kleinen untersuchten Anzahl von Erkrankungen scheint niedriger zu sein: 10% nahm beispielsweise die Häufigkeit von Depressionen ab.
Die WissenschaftlerInnen wehren sich zu Recht dagegen, bereits jetzt abschließende Folgerungen für die möglichen Effekte der flächendeckenden Verbesserung des Versicherungsschutzes durch das Gesundheitsreformwerk der Obama-Administration zu ziehen. Was aber bereits deutlich wird, ist die enorme Breite und inhaltlich Unterschiedlichkeit der gleichzeitig zu erwartenden direkten und indirekten (z.B. die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen geringerer Verschuldung aufgrund von Arztrechnungen) Wirkungen. Dies wird Prioritätensetzung und Abwägungen (z.B. Gesundheitsausgaben versus Gesundheitszustand) letztlich politischer und sozialer Art erfordern.
Ob sich die quantitativen und qualitativen Trends fortsetzen oder es sich beispielsweise bei einigen der Inanspruchnahme-Effekten um Nachhol- oder Starteffekte handelte und welche Assoziationen es z.B. zwischen dem Versicherungsschutz und der Inzidenz und Prävalenz weiterer einzelner Krankheiten gibt, will die Study-group mindestens noch in einem weiteren Jahr beobachten und analysieren. Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein.
Die Ergebnisse des ersten Jahres sind in zwei Arbeitspapieren zusammengefasst und zugänglich. Das NBER-Arbeitspapier 17190 THE OREGON HEALTH INSURANCE EXPERIMENT: EVIDENCE FROM THE FIRST YEAR von Amy Finkelstein, Sarah Taubman, Bill Wright, Mira Bernstein, Jonathan Gruber, Joseph P. Newhouse, Heidi Allen, Katherine Baicker gibt es kostenlos.
Kostenlos erhältlich ist ebenfalls ein über die gerade genannte NBER-Website erreichbarer 87-Seiten-Appendix in dem neben diversen methodischen Erläuterungen, zahlreiche unkommentierte Ergebnistabellen, Statistiken und z.B. die Survey-Fragebögen enthalten sind.
Bernard Braun, 9.7.11
Ärzte mit Erfahrung in wissenschaftlichen Studien behandeln nicht schlechter als ihre Kollegen ohne! Ob aber besser ist ungewiss.
 Bessere gesundheitliche Ergebnisse, größere Orientierung an Behandlungsempfehlungen und mehr Nutzung von evidenzbasierten Methoden und Interventionen in der Krankenversorgung: Dies erwarteten viele Patienten und VersorgungsforscherInnen von praktizierenden Ärzten und Behandlungsinstitutionen, die öfter oder regelmäßig methodisch hochwertige wissenschaftliche Behandlungsstudien durchführen. Bedenkt man, dass solche Studien egal ob man in der Interventions- oder Kontrollgruppe von PatientInnen aktiv ist, eine überdurchschnittlich gründliche Beschäftigung mit der Behandlung bestimmter PatientInnen und ihrer Erkrankung sowie eine umfangreichere und genauere Dokumentation der Behandlung umfasst und schließlich auch jedem Beteiligten klar ist, dass sein gesamtes Handeln im Rahmen der Studie mit hoher Aufmerksamkeit wahrgenommen wird, ist ein so genannter "trial effect" hochplausibel. Da es auf den ersten Blick wahrscheinlich ist, dass die beteiligten Ärzte und Institutionen dieses Wissen und diese Haltung nicht nach Ende einer Studie "vergessen", müssten also auch spätere PatientInnen mit ähnlichen Behandlungsbedarfen von dem Engagement in Studien profitieren. Die in Selbstdarstellungen von Kliniken und Arztpraxen immer häufiger zu findenden Hinweise, dass man in der Durchführung von wissenschaftlichen Studien involviert ist, versuchen implizit eine damit verbundene bessere und "up-to-date"-Behandlungsqualität zu suggerieren.
Bessere gesundheitliche Ergebnisse, größere Orientierung an Behandlungsempfehlungen und mehr Nutzung von evidenzbasierten Methoden und Interventionen in der Krankenversorgung: Dies erwarteten viele Patienten und VersorgungsforscherInnen von praktizierenden Ärzten und Behandlungsinstitutionen, die öfter oder regelmäßig methodisch hochwertige wissenschaftliche Behandlungsstudien durchführen. Bedenkt man, dass solche Studien egal ob man in der Interventions- oder Kontrollgruppe von PatientInnen aktiv ist, eine überdurchschnittlich gründliche Beschäftigung mit der Behandlung bestimmter PatientInnen und ihrer Erkrankung sowie eine umfangreichere und genauere Dokumentation der Behandlung umfasst und schließlich auch jedem Beteiligten klar ist, dass sein gesamtes Handeln im Rahmen der Studie mit hoher Aufmerksamkeit wahrgenommen wird, ist ein so genannter "trial effect" hochplausibel. Da es auf den ersten Blick wahrscheinlich ist, dass die beteiligten Ärzte und Institutionen dieses Wissen und diese Haltung nicht nach Ende einer Studie "vergessen", müssten also auch spätere PatientInnen mit ähnlichen Behandlungsbedarfen von dem Engagement in Studien profitieren. Die in Selbstdarstellungen von Kliniken und Arztpraxen immer häufiger zu findenden Hinweise, dass man in der Durchführung von wissenschaftlichen Studien involviert ist, versuchen implizit eine damit verbundene bessere und "up-to-date"-Behandlungsqualität zu suggerieren.
Ein zweiter Blick auf die Ergebnisse einer im britischen Cochrane Centre des "National Institute for Health Research" in Oxford durchgeführten systematischen Studie, die ihrerseits Studien zusammenfasst, welche aus der Plausibilität Gewissheit machen wollten, desillusioniert allerdings gewaltig. Der Blick streift insgesamt über 13 Studien (5 über das Verhalten von Ärzten und 8 von Institutionen wie Krankenhäuser), in denen bei ähnlich erkrankten PatientInnen verglichen wird, ob sie von Ärzten oder in Institutionen mit Studienerfahrung besser behandelt werden als dort wo diese Erfahrungen nicht vorliegen.
Die Ergebnisse lauten:
• Die stabilste Schlussfolgerung ("most robust conclusion") lautet, dass es gegenwärtig keine Evidenz gibt, dass Patienten, die von studienerfahrenen Ärzten und Institutionen behandelt werden, schlechter (!!) behandelt werden als von Ärzten und Institutionen ohne Studienerfahrung.
• Die meist methodisch sehr heterogenen Untersuchungen dieser Fragen liefern zum Teil diametral unterschiedliche Angaben über die Wirkungen auf das Sterblichkeitsrisiko, die Leitlinientreue der Ärzte oder die Evidenzbasierung und -orientierung ihres Handelns. Dies ist auch der Grund für den zögerlichen Duktus eines positiven Resumées: Danach gibt es in einigen der 13 Vergleichsstudien Andeutungen eines "trial effects" ("there might be"), dessen Konsequenzen für die Gesundheitheit der PatientInnen sind aber ungewiss.
Weitere Schlussfolgerungen waren den Reviewern deshalb nicht möglich, weil die Heterogenität der Studien keine Metaanalyse zuließ und auch in diesem Zusammenhang die meisten dieser Studien keine harten Outcome-Indikatoren der Behandlung dokumentierten. Künftige Untersuchungen sollten, so die ReviewerInnen weiter, auch noch genauer die Spezifika der "ähnlichen" Kranken und damit potenziell verzerrende Faktoren untersuchen und berücksichtigen.
Was übrig bleibt ist das Unbehagen und die Unklarheit darüber wie und wie nachhaltig ärztliches Verhalten bestimmt wird und welchen Aufwandes es eigentlich bedarf, um bestimmte erwünschte Verhaltens- und Behandlungsweisen in das berufliche Basisrepertoire von Ärzten zu bringen. Nicht eingefallen ist den AutorInnen dieses Reviews, dass vielleicht auch die ÄrztInnen welche nie an wissenschaftlichen Studien beteiligt waren, so erfolgreich handeln wie ihre Studien-KollegInnen. Wie wahrscheinlich dies ist, kann jedermann selber beantworten.
Der 10-seitige Review "Effects on patients of their healthcare practitioner's or institution's participation in clinical trials: a systematic review" von Mike Clarke und Kirsty Loudon ist am 20. Januar 2011 in der Fachzeitschrift "Trials" (2011, 12: 16) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Diese Zeitschrift gehört zu der wachsenden Anzahl von wissenschaftlich anspruchsvollen "open access"-Zeitschriften. Wer sich für methodische und inhaltliche Fragen der Planung, Durchführung, Bewertung und Ergebnis-Dissemination wissenschaftlicher bzw. randomisierter kontrollierter Studien interessiert, sollte "Trials" und sein Archiv regelmäßig besuchen.
Bernard Braun, 16.4.11
"Optimale" feste Selbstbeteiligungenn der ambulanten Versorgung - Nicht der Stein der Weisen!
 Ein kürzlich im European Journal of Health Economics veröffentlichter Artikel untersucht den Effekt von so genannten Selbstbehalten - also den Ausgabenanteilen, die Versicherungsunternehmen selbst behalten, weil sie Versicherte jedes Jahr erst einmal aus eigener Tasche aufwänden müssen, bevor ihre private Kasse einspringt. Die Auswertung beruht auf den Daten der Wahrscheinlichkeitstafeln der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die BaFin erfasst jährlich die anschaulich als Kopfschäden bezeichneten Leistungsausgaben der Privaten Krankenversicherung (PKV) nach Alter, Geschlecht und Art der Leistung und gruppiert sie nach jährlichen Selbstbeteiligungen.
Ein kürzlich im European Journal of Health Economics veröffentlichter Artikel untersucht den Effekt von so genannten Selbstbehalten - also den Ausgabenanteilen, die Versicherungsunternehmen selbst behalten, weil sie Versicherte jedes Jahr erst einmal aus eigener Tasche aufwänden müssen, bevor ihre private Kasse einspringt. Die Auswertung beruht auf den Daten der Wahrscheinlichkeitstafeln der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die BaFin erfasst jährlich die anschaulich als Kopfschäden bezeichneten Leistungsausgaben der Privaten Krankenversicherung (PKV) nach Alter, Geschlecht und Art der Leistung und gruppiert sie nach jährlichen Selbstbeteiligungen.
Die Berechnungen des Berliner Versicherungsmathematikers Karl Michael Ortmann von der Beuth Hochschule für Technik auf Grundlage der PKV-Daten weisen darauf hin, dass "optimale" absolute jährliche Festzuzahlungen oder Jahresfranchisen für ambulante Leistungen im gleichen Zeitraum die Inanspruchnahme und damit die Leistungsausgaben für die ambulante Versorgung insgesamt um bis zu 35 % verringern können. Optimal ist dabei in einem utilitaristischen Sinne als Summe des "Selbstbehalts" und Inanspruchnahme versicherter Leistungen im Sinne maximaler Kostenersparnis errechnet.
Auf den ersten Blick wirkt das Ergebnis tatsächlich bestechend: Mit Hilfe derartiger "optimaler" Selbstbeteiligungen lässt sich demnach mehr als ein Drittel der ambulanten Versorgungsausgaben einsparen. Im Fazit des Autors ist ein uneingeschränkter Glaube an segensbringende Wirkungen von Patientenzuzahlungen unübersehbar: "Sharing risk can establish a win-win situation for both parties. If both the insurer and the insured participate in paying claims the total financial burden may be reduced since everyone is interested in keeping costs at a minimum."
Allerdings schränkt der Autor selber das von ihm ermittelte phantastisch anmutende Einsparpotenzial gleich selber um fast die Hälfte ein, denn er habe ja leider aufgrund der Datenlage keine Unterteilung nach Inanspruchnahmeverhalten vornehmen können. Die so genannte Selbstselektion der Käufer von Gesundheitsleistungen führe dazu, dass Menschen mit höherer Nachrage geringere Selbstbeteiligungen bevorzugen. Im Klartext: Chronisch Kranke können eigentlich kaum ein Interesse an festen jährlichen Selbstbeteiligungen haben, da sie diese prinzipiell regelmäßig aufbringen müssen und schwerlich die Chance haben, hier zu sparen. Genau das ist aber ein Kernproblem der gesamten Zuzahlungs- und Moral-Hazard-Debatte, wie selbst deren Förderer Mark Pauly spät, aber dennoch eingestehen musste: Das Moral-Hazard-Theorem liefert bisher absolut keine Antwort auf das Problem kostspieligerer Versicherter - die bekanntlich 80 % der Gesundheitsausgaben verursachen.
Da Zuzahlungen offenbar zu den chronisch-rezidivierenden Themen der gesundheitspolitischen Debatte gehören, waren Selbstbeteiligungen schon immer wieder Thema im Forum Gesundheitspolitik. An dieser Stelle sei insbesondere auf die eher grundsätzlichen Beiträge zur Zuzahlungsproblematik hingewiesen, beispielsweise Was Sie schon immer über Zuzahlungen wissen wollten ..., Der unerschütterliche Glaube an Kostendämpfung durch Zuzahlungen, Womit können Therapietreue und Wirtschaftlichkeit verbessert werden?: "Weniger Zuzahlungen verbessern die Therapietreue!" oder Alte und neueste Ergebnisse der Forschung über erwünschte und unerwünschte Wirkungen von Zuzahlungen im Gesundheitsbereich.
Bemerkenswert bei dem Artikel von Ortmann die Nonchallance, mit der er als Versicherungsmathematiker über grundsätzliche Unterschiede zwischen der "Nachfrage auf dem Gesundheitsmarkt" und der nach "normalen Gütern" hinweg geht. So als wäre die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen nicht viel stärker vom gesundheitlichen oder medizinischen Bedarf bestimmt als vom Bedürfnis befriedigendem Konsumverhalten. Die wissenschaftliche Diskussion über optimierte Zuzahlungsbedingungen bezieht seit etlichen Jahren Wirksamkeitskriterien in die Betrachtung ein, so genanten value-based benefit plans versuchen, de evidenzbasierten medizinischen Bedarfskriterien durch gestaffelte Zuzahlungen in Abhängigkeit von der nachgewiesenen Wirksamkeit einer Therapie, aber auch von der Nutzung von Generika oder Markenpräparaten, zu berücksichtigen. Auch hierzu berichteten wir im Forum Gesundheitspolitik bereits mehrfach, z.B. in dem Beitrag Zuzahlungen im Krankheitsfall: Versorgungsforschung widerlegt zunehmend kostendämpfendes Potenzial. Der Artikel über die vermeintlich Segen bringendem Effekte von festen jährlichen Selbstbeteiligungen in der Peer-Review-Zeitschrift EJHE, das sich immerhin eines Impact-Faktors von 1,337 rühmt, hinkt deutlich hinter dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Debatte her und liefert allein daher kaum hilfreiche Hinweise für die gesundheitspolitische Debatte.
Auch andere grundlegende und für das modellierte Ergebnis wesentliche Selektionsbedingungen lässt Karl Michael Ortmann außer Acht. So beschränkt sich seine Betrachtung auf PKV-Versicherte, als auf mehrheitlich besser Verdienende oder zumindest in vergleichsweise stabilen Arbeitsverhältnissen beschäftigte BürgerInnen dieses Landes. Die Frage, ob und wie weniger privilegierte Personen, wie sie n der ((Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) anzutreffen sind, die teils nicht unerheblichen jährlichen Eigenbeteiligungen überhaupt aufbringen sollen. Für etwa vier Millionen Hartz-IV-EmpfängerInnen und rund sieben Millionen Niedriglohnempfänger in diesem Land wären die vorgeschlagenen Selbstbeteiligungsoptionen alles andere als optimal, sondern würden einen erheblichen Eingriff in die Haushaltskasse darstellen.
Überaus bedenklich ist die ausschließliche Betrachtung der Auswirkungen von "optimalen Zuzahlungen" für die ambulante Versorgung auf ambulante Leistungen. Dass der Autor dies nicht einmal als Einschränkung und potenzielles Problem seiner Analyse benennt, lässt nur den Schluss zu, dass er die aktuelle Evidenzlage in der Versorgungsforschung nicht kennt oder nicht zur Kenntnis nimmt. Die Zuzahlungsforschung weist immer wieder Auswirkungen von Selbstbeteiligungen für Medikamente, diagnostische und andere ambulante Leistungen auf andere Leistungsausgabensparten sowie außerhalb des Gesundheitswesens nach. Eine überwältigende Fülle von Forschungsergebnissen einschließlich etlicher Meta-Analyse weist darauf hin, dass nicht jede eingesparte Gesundheitsleistung gut ist, sondern häufig Komplikationen und damit komplexere und kostspieligere Leistungen nach sich ziehen, Verlagerungen in andere Bereiche wie stationäre Heimunterbringungen verursachen und wirtschaftliche Einbußen durch Produktionsausfälle bewirken können. Die beschränkte Betrachtung eingesparter ambulanter Leistungen wird dem Stand der wissenschaftlichen Debatte über das Thema Zuzahlungen im Krankheitsfall nicht ansatzweise gerecht.
Überhaupt liegt dieser Artikel voll im Trend der ökonomischen Annäherung an das Thema Zuzahlungen im Gesundheitswesen. So betrachtet dieser Artikel wie selbstverständlich das berühmte moral hazard als unumstößliche Gegebenheit obwohl es bisher weder klare, messbare Kriterien noch empirisch belastbare Hinweise auf seine Existenz oder gar seine Bedeutung gäbe. Und natürlich folgt auch dieser Artikel der unter Ökonomen anhaltend verbreiteten Auffassung, das zwischen 1971 und 1982 in den USA durchgeführte so genannte RAND Krankenversicherungsexperiment sei weiterhin die "prominenteste Studie auf dem Gebiet der Zuzahlungen im Krankheitsfall. Daran sind aber mittlerweile vielfache und begründete Zweifel aufgetaucht, folgte das RAND-Experiment doch einem sehr engen Fokus und lässt relevante Effekte völlig außer Acht, wie beispielsweise die Canadian Health Services Research Foundation (CHSRF) in ihren Myth busters aufzeigt. Das Zweifel an der Aussagekraft des RAND-Experiemnents schon länger bekannt sind, zeigt auch der Beitrag mit dem knackigen Titel Lies, Damned Lies, and Health Care Zombies: Discredited Ideas That Will Not Die von GesundheitswissenschaftlerInnen der Universität British Columbia aus dem Jahr 1998.
Von dem Beitrag Optimal deductibles for outpatient services steht Nicht-AbonentInnen nur das Abstract kostenfrei zur Verfügung.
Jens Holst, 13.4.11
Streichung oder Senkung von Medikamenten-Zuzahlungen verbessern Therapietreue und damit Behandlungserfolg und Wirtschaftlichkeit.
 Trotz der weitgehend fehlenden Wirkungslosigkeit der Zuzahlungen bei mittlerweile 75 % aller GKV-Leistungen auf die Inanspruchnahme dieser Leistungen und der übrig gebliebenen Funktion die Einnahmen im zweistelligen Milliardenbereich zu erhöhen, rührt in Deutschland immer noch kein Gesundheitspolitiker oder Krankenkassen-Manager einen Finger sie abzuschaffen.
Trotz der weitgehend fehlenden Wirkungslosigkeit der Zuzahlungen bei mittlerweile 75 % aller GKV-Leistungen auf die Inanspruchnahme dieser Leistungen und der übrig gebliebenen Funktion die Einnahmen im zweistelligen Milliardenbereich zu erhöhen, rührt in Deutschland immer noch kein Gesundheitspolitiker oder Krankenkassen-Manager einen Finger sie abzuschaffen.
Noch weniger wird darüber nachgedacht, ob ihre teilweise oder komplette Abschaffung nicht nur eine soziale Entlastung der Patienten mit sich bringen würde, sondern sogar möglicherweise die Wirksamkeit von Behandlungen verbessert und sie dadurch wirtschaftlicher macht.
Dies legt jedenfalls eine Reihe von Modellversuchen im us-amerikanischen Gesundheitssystem nahe, über die auch bereits im Forum-Gesundheitspolitik" berichtet wurde. Sie stellen auch einen Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Studie zusammen mit der Versandapotheke Sanicare dar, in der untersucht wird, ob und wie sich eine Halbierung der Zuzahlung auf Medikamente für eine Auswahl chronischer Erkrankungen auf die Adhärenz auswirkt.
Wer vielleicht dachte, bei den Ergebnissen in den USA hätte es sich um Einmal- oder Kurzzeiteffekte gehandelt, sollte sich angesichts der im Jahr 2010 veröffentlichten Ergebnisse eines aktuellen Modellversuchs anders besinnen.
Ausgangspunkt des in dem Technologieunternehmen Pitney Bowes durchgeführten Experiments war die abnehmende Therapietreue der dort beschäftigten und krankenversicherten Personen bei der Behandlung mit Statinen zur Senkung des Cholesterinspiegels.
Die durch eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen (vgl. dazu den folgenden deutschsprachigen Überblick) gestützte Annahme, dass die finanzielle Belastung durch Zuzahlungen ein Grund für mangelnde Therapietreue und weitere unerwünschte Effekte ist, war der Ansatzpunkt, diese für die Beschäftigten und Versicherten bei Pitney Bowes komplett zu streichen und WissenschaftlerInnen vom Brigham and Women's Hospital in Boston zu beauftragen, die Effekte in einer kontrollierten Studie zu untersuchen.
Dieser Studie liegt damit die im Vergleich zur deutschen Kassenwartmentalität völlig andere gesundheitsökonomische Grundorientierung zugrunde, ein so genanntes "value-based insurance design" anzubieten, "which lowers copayments for services with high value relative to their costs."
Die folgenden Effekte sind besonders hervorzuheben:
• Bei den 2.051 Beschäftigten, die u.a. an Diabetes oder Gefäßerkrankungen litten, stieg die Therapietreue bei der Einnahme von Statinen in der Interventionsgruppe der Nichtmehrzahler von Zuzahlungen bei Pitney Bowes unmittelbar nach dem Ende der Zuzahlungen um 2,8% gegenüber der Vergleichsgruppe von Patienten (N=38.174) an. Nach 12 Monaten war die Therapietreue-Rate in der Interventionsgruppe um 5 % höher als in der Kontrollgruppe.
• Nach einem Teilverzicht auf Zuzahlungen für das Medikament Clopidogrel, einem Mittel, das Blutverklumpungen verhindern soll, hatten die Angehörigen oder Nutznießer der Interventionsgruppe (N=779) eine um vier Prozent höhere Therapietreue-Rate aufzuweisen als die Angehörigen der Kontrollgruppe (N=11.627).
• Diese positiven Ergebnisse blieben auch dann erhalten, wenn man nur die Patienten betrachtete, die ihre Behandlung bereits vor dem Beginn der zuzahlungsfreien oder -reduzierten Phase begonnen hatten, also möglicherweise bereits unerwünschte Therapieroutinen verinnerlicht hatten.
• Inwieweit es sich bei der ebenfalls beobachteten Reduktion der nichtmedikamentösen Ausgaben um 17 % wirklich um dauerhafte finanzielle Effekte der Zuzahlungsreduktion handelt und wie hoch deren "return of investment" ist, müssen weitere Studien genauer klären.
• Zu Recht weisen die Autoren daraufhin, dass Therapietreue noch durch zahlreiche andere Faktoren beeinflusst wird. Statt weiterer Erhöhungen von Zuzahlungen oder anderer Kostendämpfungsversuche, lohnte es sich wahrscheinlich mehr, auch bei diesen Faktoren genau zu untersuchen, welche positiven Effekte weitere Interventionen auf die Adherenz und die Wirtschaftlichkeit von Behandlungen haben könnten.
Die Studie "At Pitney Bowes. Value-Based Insurance Design Cut Copayments and Increased Drug Adherence" von N. K. Choudhry, M. A. Fischer, J. Avorn et al. ist in der Novemberausgabe 2010 der gesundheitspolitischen Fachzeitschrift "Health Affairs" (29 (11): 1995-2001) erschienen und als Abstract oder in einer zweiseitigen Zusammenfassung des Commonwealth Fund kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.11.10
Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung
 Zwei Studien aus Kanada liefern überzeugende Hinweise auf die große Bedeutung der Adherence sowohl für das Auftreten und den klinischen Verlauf chronischer Krankheiten als auch für die Ausgabenentwicklung eines Gesundheitswesens. Adherence lässt sich im Deutschen am treffendsten als Therapietreue übersetzen und umfasst sowohl den Aspekt fortgesetzter Behandlung (Persistenz) als auch die Einnahme nach empfohlener Dosierung (Compliance). Nicht zuletzt die wachsende Diskrepanz zwischen medizinisch-pharmakologischem Fortschritt und der hinterher hinkenden Eindämmung der Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, koronare Herzkrankheit oder Schlaganfall lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Frage, wie Gesundheitssysteme den in vielfachen Studien erwiesenen Nutzen evidenzbasierter Behandlungen zuverlässig der wachsenden betroffenen Bevölkerung zukommen lassen kann. Die beiden kanadischen Studien bestätigen nicht nur unübersehbare Mängel bei der Einnahme wirksamer Medikamente, sondern untermauern vor allem eindrücklich, dass dabei der Therapietreue bzw. Adherence eine entscheidende Funktion zukommt.
Zwei Studien aus Kanada liefern überzeugende Hinweise auf die große Bedeutung der Adherence sowohl für das Auftreten und den klinischen Verlauf chronischer Krankheiten als auch für die Ausgabenentwicklung eines Gesundheitswesens. Adherence lässt sich im Deutschen am treffendsten als Therapietreue übersetzen und umfasst sowohl den Aspekt fortgesetzter Behandlung (Persistenz) als auch die Einnahme nach empfohlener Dosierung (Compliance). Nicht zuletzt die wachsende Diskrepanz zwischen medizinisch-pharmakologischem Fortschritt und der hinterher hinkenden Eindämmung der Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, koronare Herzkrankheit oder Schlaganfall lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Frage, wie Gesundheitssysteme den in vielfachen Studien erwiesenen Nutzen evidenzbasierter Behandlungen zuverlässig der wachsenden betroffenen Bevölkerung zukommen lassen kann. Die beiden kanadischen Studien bestätigen nicht nur unübersehbare Mängel bei der Einnahme wirksamer Medikamente, sondern untermauern vor allem eindrücklich, dass dabei der Therapietreue bzw. Adherence eine entscheidende Funktion zukommt.
Die Arbeitsgruppe um Sylvie Perreault von der Universität Montreal verwendete die umfangreiche öffentliche Krankenversicherungsdatenbank Régie de l'Assurance Maladie der Provinz Québec, die detaillierte Angaben zu den Versicherten, Abrechnungendaten sämtlicher ambulanten und stationären Therapien sowie Kodierung und Kosten aller Behandlungen beinhaltet, und die Med-Echo-Datenbank, die stationäre Akutbehandlungen erfasst, für eine retrospektive Beobachtungsstudie mit eingebetteter Fall-Kontroll-Untersuchung. Dafür suchten sie insgesamt 112.092 Patienten zwischen 45 und 85 Jahren (Durchschnittsalter 63 Jahre) heraus, die an keiner kardiovaskulären Krankheit litten und zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2004 eine Statintherapie begannen. 41 % der Personen waren männlich, 54 % von ihnen litten an Bluthochdruck und 26 % an Diabetes mellitus. Primärer Endpunkt war das Auftreten zerebrovaskulärer Erkrankungen (ischämischer oder hämorrhagischer Hirninfarkt, ICD 9: 431, 433, 434, 436, 437) zwischen dem Eintritt in die Kohorte und dem Ende der Studienperiode, dem 30. Juni 2005, wobei die mittlere Beobachtungszeit bei 2,95 Jahren lag.
3,5 % der Kohorte erlitten in diesem Zeitraum ein zerebrovaskuläres (1,2/100 Personenjahre) und 12,5 % ein kardiovaskuläres Ereignis (4.2/100 Personenjahre), 4,0 % erkrankten an chronischer Herzinsuffizienz (1,4/100 Personenjahre), 3,6 % am peripherer arterieller Verschlusskrankheit(1,2/100 Personenjahre), 10,6 % an anderen kardiovaskulären Erkrankungen (3.6/Personenjahre 100 Personenjahre) und 32,9 % nahmen Thrombozytenaggregationshemmer (11,1/100 Personenjahre) ohne vorhergehende Diagnose eine koronare Herzkrankheit. Die kardiovaskuläre Mortalität lag bei 0,4 % und die ursachenunabhängige Gesamtsterblichkeit bei 2,9 %.
Die Adherence erfassten die kanadischen ForscherInnen als Anteil der Therapietage, an denen den Versicherten laut Rezepteinlösung die verordneten Medikamente zur Verfügung standen (Medication Possession Ratio - MPR), die sie in 20er Schritten zwischen weniger als 20 und über 80 % einteilten. Nur gut die Hälfte der eingeschlossenen PatientInnen (55 %) wiesen eine gute Therapietreue mit einer MPR von 80 % oder mehr auf, wobei die durchschnittliche Adherence in dieser Gruppe im ersten Jahr nahezu 98 % und im Anschluss immerhin noch 95 % betrug; in der Gruppe mit eingeschränkter Therapietreue lag der Durchschnittswert im ersten Jahr bei 13 % und im weiteren Verlauf bei 9 %.
Mit Hilfe konditionaler logistischer Regressionsmodelle und Fall-Kontroll-Vergleiche zwischen PatientInnen mit sehr guter und mit schlechter Adherence ermittelten die ForscherInnen aus Montreal das relative Risiko zerebrovaskulärer Erkrankungen und adjustierten ihre Ergebnisse nach verschiedenen Kovariablen. Demnach senkt regelmäßige Einnahme von Statinen in empfohlener Dosierung (MPR ≥ 80 %) das relative Risiko des Auftretens zerebrovaskulärer Erkrankungen um 26 % (relative Rate 0,74; 95 % KI, 0,65 - 0,84) im Vergleich zu solchen PatientInnen, die nur geringe Therapietreue an den Tag legten (MPS < 20 %). Dies gilt allerdings nur für ischämische Schlaganfälle (RR 0,67; 95 % KI, 0,58-0,77), nicht aber für hämorrhagische Ereignisse (RR 0,97; 95 % KI, 0,59 - 1,58), was von pharmakologischer Wirkung und Pathogenese nachvollziehbar erscheint. Außerdem war die Risikominderung bei Personen unter 65 Jahren nicht signifikant (RR 0,80; 95 % KI, 0,65-1,00), wohl aber für über 65-Jährige (28 % Reduktion, RR 0,72; 95 % KI, 0,63 - 0,84). Kein nennenswerter Unterschied bestand dabei zwischen Hochrisiko-PatientInnen, die nicht nur an Hyperlipoproteinämie, sondern zugleich an Bluthochdruck und Diabetes mellitus litten (RR 0.71, 95% KI, 0.60-0.83) und solchen geringen Risikos (RR 0.72; 95 % KI, 0,58 - 0,89). Bemerkenswert auch im Hinblick auf andere Studien und die Untersuchung zwischen Adherence und klinischem Verlauf bei Lipidsenkern ist die Beobachtung, dass die positiven Effekte einer Statin-Therapie erst nach mindestens einem Jahr sichtbar werden. Insgesamt liefert diese kanadische Studie weitere Belege für die unzureichende Therapietreue gegenüber Statinens sowohl in der primär- als auch in der Sekundärprävention sowie Einblicke in die Ursachen mangelhafter Adherence (vgl. auch Bates et al. 2009, S. 2982).
Die gleiche kanadische Arbeitsgruppe, diesmal unter Federführung von Alice Dragomir, publizierteAnfang 2010die Ergebnisse einer weiteren großen Kohortenstudie auf Grundlage der Datenbanken Régie de l'Assurance Maladie der Provinz Québec und Med-Echo. Dabei analysierten sie die Daten von insgesamt 55.134 PatientInnen zwischen 45 und 85 Jahren ohne vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankung, die zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 30. Juni 2002 eine Statintherapie aufnahmen. Die Studienperiode begann am 1. Juli 2002 und erstreckte sich bis zum 30. Juni 2005; Endpunkte waren die Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen, relevante stationäre Aufnahmen wegen kardiovaskulärer Ereignisse sowie die dadurch verursachten Kosten. In dem dreijährigen Beobachtungszeitraum erfolgten 7.326 stationäre Behandlungen wegen akuter Koronar-, 2.189 wegen zerebrovaskulärer Ereignissen und 2.171 wegen chronischer Herzinsuffizienz.
Die Adherence erfassten die kanadischen ForscherInnen als Anteil der Tage, an denen den PatientInnen laut Rezeptausstellung Arzneimittel zur Verfügung standen, an der gesamten Beobachtungszeit und unterschieden zwischen therapietreuen Personen mit mindestens 80 % und mit weniger als 80 % eingenommen Medikamenten. Die mittlere Adherencerate lag bei den therapietreuen ProbandInnen bei 96 % und bei den nicht therapietreuen bei 42 %.
Eine nach diversen Unteraspekten durchgeführte logistische Analyse (polytomous logistic analysis) zeigte, dass gegenüber Statinen wenig therapietreue PatientInnen mit größerer Wahrscheinlichkeit an KHK (OR 1.07; 95 % KI, 1.01-1.13), zerebrovaskulären Ereignissen (OR 1.13; 95 % KI 1.03-1.25) und chronischer Herzinsuffizienz (OR 1.13; 95 % KI 1.01-1.26) erkrankten. Außerdem war eingeschränkte Therapietreue mit einem um 4 % erhöhten Risiko von Krankenhausaufnahmen (OR 1.04; 95 % CI 1.01-1.09) und in der dreijährigen Beobachtungszeit bei jedem/r stationär behandelten PatientIn durchschnittlich mit ca. 1.060 Kanadischen Dollar höheren Krankenhauskosten verbunden. Die durch schlechte Compliance verursachten zusätzlichen Kosten berechneten die kanadischen ForscherInnen auf 9,5 und die potenziellen Einsparungen durch gute Adherence auf 10,2 Millionen Kanadische Dollar. Damit liefern sie Belege dafür, dass eingeschränkte Therapietreue nicht nur das Auftreten von Krankheiten und Komplikationen fördert, sondern auch die Ausgaben steigen lässt.
Für Nicht-Abonnenten des American Journal of Medicine ist von der Studie von Sylvie Perreault, Laura Ellia, Alice Dragomir, Robert Côté, Lucie Blais, Anick Bérard und Lyne Lalonde Effect of statin adherence on cerebrovascular disease in primary prevention über die Ausgabe 122 (7) auf den Seiten 647-655 nur das Abstract kostenfrei zugänglich, während sich die Untersuchung von Alice Dragomir, Robert Côté, Michel White, Line Lalonde, Lucie Blais, Amik Bérard und Sylvie Perreault Relationship between Adherence Level to Statins, Clinical Issues and Health-Care Costs in Real-Life Clinical Setting aus Value in Health (13 (1), S. 87-94) als Volltext einsehen lässt.
Jens Holst, 15.8.10
Bremer Wissenschaftler fordern soziale Zuzahlungen nur für weniger kosteneffiziente Leistungen
 In einem Beitrag für die Zeitschrift für Sozialreform (Nr. 55 (1), S. 71-90) aus dem Jahr 2009 entwickeln Ralf Götze und Tina Salomon vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen die Idee einer einkommens- und morbiditätsadjustierten Selbstbeteiligung. Das klingt überzeugend, und dank des knackigen Namens fair fee auch verlockend.
In einem Beitrag für die Zeitschrift für Sozialreform (Nr. 55 (1), S. 71-90) aus dem Jahr 2009 entwickeln Ralf Götze und Tina Salomon vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen die Idee einer einkommens- und morbiditätsadjustierten Selbstbeteiligung. Das klingt überzeugend, und dank des knackigen Namens fair fee auch verlockend.
Zunächst zeichnen die AutorInnen die historischen Entwicklungen der Selbstbeteiligungen im deutschen Gesundheitswesen und ihre Rolle in Rahmen der Kostendämpfungspolitik nach, bevor sie den immanenten Konflikt zwischen Effizienz auf Grund der unterstellten Steuerungseffekte und sozialer Gerechtigkeit sowie erwünschte und unerwünschte Wirkungen diskutieren. Unter Verweis auf das in § 3 SGB V verankerte Solidarprinzip, wonach sich die Höhe der Finanzierungsbeiträge nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der BürgerInnen richten sollen, leiten die AutorInnen den Wunsch ab, Zuzahlungen mögen nicht die ärmeren und mit schlechterer Gesundheit geschlagenen Menschen benachteiligen. Dies geschähe aber zurzeit aufgrund aller geltenden Zuzahlungsregelungen, die eine regressive Wirkung entfalteten und insbesondere chronische Kranke stark belasteten. Die AutorInnen fordern zunächst das Verbot aller schädlichen und unnützen Gesundheitsleistungen und den Ausschluss von "Güter(n) und Leistungen ohne erkennbaren Nutzen" aus dem Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Ihr Vorschlag bezieht sich auf "das Segment der als medizinisch sinnvoll bewerteten Therapien, die sich für eine kollektive (Teil-)Finanzierung qualifizieren". Innerhalb dieser Gruppe sollen eine Güterabwägung nach individuellen Kosten-Nutzen-Erwägungen und die Zuordnung in einen Basis- und einen Wahlkatalog erfolgen mit unterschiedlichen Zuzahlungsmodalitäten: "Im Basisleistungskatalog hat die Selbstbeteiligung lediglich einen pauschalen Charakter, um einen statischen Moral Hazard in Form einer ungebremsten Mengenausweitung zu verhindern. Im Wahlleistungssegment nimmt sie dagegen zusätzlich den Charakter eines Indemnitätstarifs an. Durch die Beteiligung an den Mehrkosten einer teureren Therapieform wird der Patient dazu angehalten, seinen dynamischen Moral Hazard einzuschränken."
Vor allem im Wahlleistungsbereich würden die unterschiedlichen Einkommens- und Morbiditätsbedingungen zu unerwünschten Verzerrungen führen. Um dies zu verhindern, wäre eine Adjustierung der Selbstbeteiligungen nach Einkommen und Morbidität erforderlich - nach der schlichten Formel Zk = Aym (Zl + Zw) = Aym (Zl + (Kw - Kb)). Zwischen Finanzierern und Leistungserbringern ließe sich eine solche einkommens- und morbiditätsbezogene kombinierte Zuzahlung dank der elektronischen Gesundheitskarte und mit einer zertifizierten Anbietersoftware mühelos für jede Gesundheitsleistung ermitteln, mutmaßen die AutorInnen und liefern eine Matrix für die Berechnung der anfallenden Zuzahlungen mit. Insgesamt könne man so Steuerungswirkungen bei BezieherInnen hoher Einkommen verstärken und gleichzeitig die unerwünschten Wirkungen bei den unteren Einkommensgruppen abschwächen.
Diese Idee klingt auf den ersten Blick gut. Bei genauerem Lesen stellen sich aber mehr Fragen als die AutorInnen Antworten zu liefern in der Lage sind. Sehr praxisnah wirkt die Forderung nach "fair fees "nicht, zur Umsetzung ist eine erhebliche und zurzeit schwerlich absehbare IT-Nachrüstung des deutschen Gesundheitswesens erforderlich - einschließlich der wünschenswerten Vertraulichkeitsgarantien aller Daten. Und die Frage, wie sich ihr Vorschlag denn in die allgegenwärtige Forderung nach "Bürokratieabbau" einpassen soll, bleiben sie ebenfalls schuldig. Auffällig bei dem aufwändig entwickelten Vorschlag für gerechtere Zuzahlungen ist vor allem die Unterteilung nach unterschiedlichen Graden von Kosteneffizienz. Abgesehen davon, dass dies keineswegs so leicht zu ermitteln ist und unvermeidlich einen gewissen Grad an Willkür mit sich bringt, gestaltet sich das Differenzieren zwischen Basis- und Wahlleistungen ja bekanntlich in der Praxis als überaus schwierig. Unverständlich bleibt aber vor allem, warum gerade für Gesundheitsleistungen mit hohem Nutzen im Verhältnis zu den Kosten weiterhin pauschale und damit regressive Eigenbeteiligungen gelten sollten, und weshalb sich die soziale Nachjustierung auf Wahlleistungen mit schlechterer Kosten-Nutzen-Relation beschränken möge. Sich darüber derart ausgefeilte Gedanken zu machen erscheint nur dann sinnvoll, wenn man den Wahlleistungen eine ausgesprochen große Bedeutung zumisst. Das mag den Verfechtern des wachsenden - zweiten - Gesundheitsmarktes schmecken, erscheint aber zunächst nicht zwingend sinnvoll.
Nicht so offen, wie es die AutorInnen darstellen, ist auch "die Frage, ob durch die Zuzahlungen in der aktuell geltenden Praxis mehr als vereinzelte Individuen von der eigentlich notwendigen Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen abgeschreckt werden". Auch wenn die Auswirkungen der Praxisgebühr - abgesehen von den überschuldeten Haushalten, wie bereits im Forum Gesundheitspolitik in dem Artikel Zuzahlungen und Praxisgebühr führen zur eingeschränkten Inanspruchnahme auch medizinisch notwendiger Leistungen bei Überschuldeten nachzulesen war - bisher uneindeutig sind, sprechen Erfahrungen mit unterschiedlichen Zuzahlungsformen für verschiedene Gesundheitsleistungen in anderen Ländern eine sehr deutliche Sprache.
Erheblich unklarer ist indes die von den AutorInnen gar nicht gestellte Frage, ob und in welchem Maße nachfrageseitiges moral hazard - und nur diesem kann man durch Zuzahlungen effektiv begegnen - überhaupt im Gesundheitswesen relevant ist. Denn wer den engen Rahmen ökonomischer Modellrechnungen verlässt und klinisch-epidemiologische Erkenntnisse sowie solche aus der Versorgungsforschung in die Betrachtung von Zuzahlungswirkungen und moral hazard einbezieht, stößt auf unübersehbare Zweifel an der Vorstellung von sinnvoller Steuerung. Bisher ist nicht erwiesen, dass Zuzahlungen mehr Nutzen als Schaden anrichten. Vielmehr gibt es eine Vielzahl empirischer Hinweise - einschließlich der RAND-Studie -, die eher das Gegenteil nahe legen. Einer grundsätzlichen Fehlsteuerung können auch die ausgeklügelsten Zuzahlungsformen nicht entgegenwirken.
Dass die AutorInnen wesentliche Erkenntnisse aus der internationalen Zuzahlungsforschung nicht hinreichend zur Kenntnis genommen haben, zeigt sich an mehreren Stellen ihres Papers. So ist die Einschätzung bemerkenswert, die bis heute umfangreichste Studie zur Steuerungswirkung von Zuzahlungen sei das RAND Health Insurance Experiment. Mag diese Aussage für streng experimentelle Untersuchungen zutreffen, liegen doch mittlerweile etliche quasi-experimentelle Analysen mit weitaus mehr als den 5,500 Versuchspersonen des RAND-Experiments vor. Um an den wohlgemerkt ersten bzw. zunächst schlichten Schlussfolgerungen dieser Studie festhalten zu können, die bis heute maßgeblich den Glauben an sinnvoll steuernde Wirkungen von Zuzahlungen belegt, gehen die AutorInnen gar nicht auf den mittlerweile umfangreich diskutierten RAND-Irrtum ein, den sogar einige Studienautoren wie Joseph Newhouse im Nachhinein eingeräumt haben. Eine systematische Analyse der Beschränkungen, die zu großer Vorsicht bei der Verallgemeinerung der RAND-Befunde rät, liefern Raise Deber, Evely Forget und Leslie Roos in Ihrem Artikel Medical savings accounts in a universal system: wishful thinking meets evidence, der Anfang 2004 in Health Policy 70 (1) erschien Abstract. Bei den üblichen argumentativen Rückgriffen auf die RAND-Studie kommen die systematischen Unzulänglichkeiten regelmäßig zu kurz oder gar nicht zur Sprache.
Und noch ein Satz in der Abhandlung von Götze und Salomon lässt aufhorchen: "Zugrunde liegt beiden Ansätzen die Annahme, dass der Arztbesuch und die weiteren in Anspruch genommenen medizinischen Leistungen und Güter selbst nicht ausreichend unangenehm sind, um das Individuum dazu zu bewegen, seinen Konsum von Gesundheitsleistungen auf das zum Erhalt der Gesundheit notwendige Maß zu beschränken." Solche Aussagen können nur Menschen treffen, die bisher offenbar von schwerwiegenden Gesundheitsproblemen verschont geblieben sind und den "reichlich herben Genuss einer Bypass-Operation oder Chemo-Therapie" nicht kennen lernen durften, wie es Hartmut Reiners auf Seite 16 in seinem Aufsatz "Homo oeconomicus" so trefflich formuliert. Vor allem aber gehen die AutorInnen davon aus, es gäbe ein "zum Erhalt der Gesundheit notwendige(s) Maß" an Gesundheitsleistungen. Außerhalb universitärer Elfenbeintürme erweisen die klinische wie die Versorgungsforschung die unterstellte, der Zuzahlungsideologie grundsätzlich zu Grunde liegende klare Trennlinie in das Reich der Phantasie.
Die Zeitschrift für Sozialreform bietet keine Online-Volltexte im Internet ist nur das Abstract zu lesen. Allerdings hat das Pharma-Unternehmen Janssen-Cilag das Paper in seinem Sammelband Zukunftsideen für das Gesundheitssystem (Beiträge aus dem Hochschulwettbewerb "Perspektive 2020 - Gesundheit als Chance") nachgedruckt. Über diesen Umweg ist sich das gesamte Paper Fair Fee: Einkommens- und morbiditätsadjustierte Zuzahlungen für Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland von Götze und Salomon auch online zugänglich. Hier können Sie den Sammelband der Janssen-Cilag GmbH herunterladen, der besagte Beitrag findet sich auf den Seiten 109ff.
Jens Holst, 5.6.10
Studie zu Risiken und Nebenwirkungen von Zuzahlungen in Deutschland
 Welchen Einfluss haben Medikamenten-Zuzahlungen auf die Befolgung ärztlicher Einnahmevorschriften? Werden durch niedrigere Zuzahlungen möglicherweise sogar Therapieerfolge verbessert und damit Kosten im Gesundheitswesen gesenkt? Im Ausland gibt es hierzu bereits etliche Untersuchungen, für Deutschland untersucht diese Fragen jetzt das Bremer Forschungsinstitut "BIAG" in Kooperation mit der Versandapotheke Sanicare.
Welchen Einfluss haben Medikamenten-Zuzahlungen auf die Befolgung ärztlicher Einnahmevorschriften? Werden durch niedrigere Zuzahlungen möglicherweise sogar Therapieerfolge verbessert und damit Kosten im Gesundheitswesen gesenkt? Im Ausland gibt es hierzu bereits etliche Untersuchungen, für Deutschland untersucht diese Fragen jetzt das Bremer Forschungsinstitut "BIAG" in Kooperation mit der Versandapotheke Sanicare.
Arzneimittel-Zuzahlungen sollen nicht nur zur Finanzierung des Gesundheitssystems beitragen, sondern auch Patienten dazu bringen, ausschließlich medizinisch notwendige Leistungen in Anspruch zu nehmen und Arzneimittel im Sinne von "Adherence" oder "Therapietreue" verordnungsgemäß einzunehmen. In den letzten 40 Jahren ist das Volumen der Zuzahlungen in Deutschland von 8 auf 13 Prozent der gesamten GKV-Ausgaben gestiegen. Nach Schätzungen der BKK leisteten GKV-Versicherte 2006 Medikamenten-Zuzahlungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro.
Eigenbeteiligungen in der Gesundheitsversorgung waren schon mehrfach Thema im Forum Gesundheitspolitik, beispielsweise mit den Beiträgen Alte und neueste Ergebnisse der Forschung über erwünschte und unerwünschte Wirkungen von Zuzahlungen im Gesundheitsbereich und Selbstbeteiligungen und kein Ende: Was lange währt, ist keineswegs immer gut. Sinn und Zweck von Patientenzuzahlungen sind indes seit Langem umstritten. Kritiker verweisen darauf, dass Zuzahlungen häufig auch sinnvolle und medizinisch notwendige Leistungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen verhindern, wobei dies insbesondere Angehörige unterer Sozialschichten trifft und letztlich höhere Folgekosten statt Ersparnisse bewirkt. Wegen dieser empirisch belegten unerwünschten Effekte sind in den Niederlanden Ende der 1990er Jahre und jüngst in Irland Zuzahlungen abgeschafft worden.
Ein weiterer bisher eher vernachlässigter unerwünschter Effekt von Zuzahlungen, ist die mangelnde Therapietreue. Häufig reagieren Patienten auf Zuzahlungen, indem sie die Dosis verringern, um länger mit Medikamentenpackungen auszukommen, oder indem sie die Therapie ganz abbrechen. Dadurch werden im Gesundheitssystem nicht nur Gelder verschwendet, sondern auch zusätzliche Gesundheitsrisiken hervorgerufen durch Verschleppung und Chronifizierung von Krankheiten.
Eine Reihe von Studien in den USA zeigt nun eine überraschende Lösung für dieses Problem auf: Spürbare Senkung der Zuzahlungen! Wie beispielsweise in dem Artikel Impact Of Decreasing Copayments On Medication Adherence Within A Disease Management Environment, nachzulesen ist, der Anfang 2008 in Health Affairs erschien, ließ sich im Rahmen von Chronikerprogrammen ("Active Health Management") die Häufigkeit mangelnder Therapietreue im Bereich von fünf Medikamentengruppen für chronisch Kranke (z.B. Antidiabetika, Antihypertonika) ganz erheblich um 7 bis 14 Prozent verringern. In einer anderen Studie für DiabetikerInnen, in der man die Folgen einer Senkung der Arzneimittelzuzahlung beim großen Frankiermaschinen-Hersteller Pitney Bowes überprüfte, verbesserte sich nicht nur das Einnahmeverhalten wesentlich, sondern zugleich gingen die Zahl der Patienten, die eine Notfallstation aufsuchen mussten, um 26 Prozent und die durchschnittlichen Gesamtausgaben für Antidiabetika um 7 Prozent zurück, wie im Milliman Client Report 2008 nachzulesen ist. Zahlen über verbessertes Einnahmeverhalten und verringerte Gesundheitsausgaben in Folge der großzügigeren Kostenübernahme bei Diabetes-Medikamenten für Pitney-Bpowes-MitarbeiterInnen liefert auch ein Artikel von John Mahoney, der bereits im August 2005 im American Journal of Managed Care und kostenfrei unter dem Titel Reducing Patient Drug Acquisition Costs Can Lower Diabetes Health Claims zur Verfügung steht.
Ob derartige Wirkungen auch im deutschen Gesundheitswesen zu beobachten sind und damit Änderungen der Zuzahlungspolitik und -erwartungen notwendig sind, lässt die größte deutsche Versandapotheke Sanicare von Gesundheitswissenschaftlern aus Bremen und Berlin in einer breit angelegten Studie untersuchen. Bei über 6.000 Kunden der Versandapotheke, die regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen müssen, wird im Rahmen mehrerer Befragungen erfasst, ob sich die Therapietreue verändert, wenn diese Patienten die Hälfte der Zuzahlungen erstattet bekommen. In einem 24-seitigen Fragebogen mit über 50 Fragen geben diese mehrfach befragten Studienteilnehmer nicht nur Auskunft über ihre Medikamenten-Einnahme, sondern auch über viele andere Faktoren, die das Einnahmeverhalten mit beeinflussen. Ergänzend dazu erfolgt eine Aufarbeitung des internationalen Wissensstands über die positive Wirkung einer verbesserten Therapietreue auf die Behandlungserfolge und Kosten aufgearbeitet.
Einen Überblick über die bisher vorliegenden empirischen Erfahrungen und die Studienlage sowie über die Zielsetzung der Untersuchung geben die beteiligten Wissenschaftler in einem ausführlichen Artikel, der in der März-Ausgabe der Zeitschrift Die Ersatzkasse der Ersatzkassenverbands VDEK erschien. NutzerInnen des Forum Gesundheitspolitik steht der Artikel von Bernard Braun, Gerd Glaeske, Jens Holst und Gerd Marstedt aus "Die Ersatzkasse" (3/2010) kostenlos zum Download zur Verfügung: Steigerung der Therapietreue - Arzneimittelzuzahlungen sind eher Problem als Lösung.
Leider ist die zugehörige Literaturliste in diesem PDF-Dokument nicht korrekt verlinkt. Sie können die ausführlichen Literaturangaben zu dem Artikel aber hier direkt herunterladen.
Jens Holst, 28.4.10
Elektronisches Erinnerungssystem für Ärzte: Teure Versuch-und-Irrtum-Übung oder nützliche Vehaltenshilfe?
 Informationstechnik erscheint vielen Akteuren im Gesundheitswesen im Angesicht von Personalnot oder Qualifikationsmängeln von Ärzten und Pflegepersonal eine Art Allzweckwaffe und Erfolgsgarant zu sein. So verbreiten sich weltweit in Krankenhäusern oder Arztpraxen elektronische Systeme, die Daten aus der gesundheitlichen Versorgung dokumentieren und z.B. im Falle der Verordnung von Arzneimitteln auch qualitative Hinweise auf mögliche Kontraindikationen und preiswertere Mittel geben - kurz: das Verhalten von Ärzten und anderen Akteuren im Gesundheitswesen qualitativ beeinflussen oder steuern.
Informationstechnik erscheint vielen Akteuren im Gesundheitswesen im Angesicht von Personalnot oder Qualifikationsmängeln von Ärzten und Pflegepersonal eine Art Allzweckwaffe und Erfolgsgarant zu sein. So verbreiten sich weltweit in Krankenhäusern oder Arztpraxen elektronische Systeme, die Daten aus der gesundheitlichen Versorgung dokumentieren und z.B. im Falle der Verordnung von Arzneimitteln auch qualitative Hinweise auf mögliche Kontraindikationen und preiswertere Mittel geben - kurz: das Verhalten von Ärzten und anderen Akteuren im Gesundheitswesen qualitativ beeinflussen oder steuern.
Anders als Fachliteratur, Handbücher oder schriftliche Leitlinien wird mit elektronischen Informationssystemen die Erwartung verknüpft "just in time", d.h. in der konkreten Behandlungssituation am Krankenbett oder im Behandlungszimmer Zugriff auf eine "Patientenakte" mit sämtlichen relevanten Daten zu haben und sie unmittelbar und nur zum Nutzen der Patienten einzusetzen.
Noch ausgeklügelter und noch nützlicher versprechen dabei ausgeklügelte und intelligente Informationssysteme zu sein, die z.B. den Arzt in jeder denkbaren Versorgungssituation eines konkreten Patienten oder in der Vorbereitung auf einen Kontakt mit dem Patienten an notwendige Aktivitäten oder Abklärungen erinnern bzw. darauf hinweisen, etwas zu unterlassen.
Ob diese so genannten "point-of-care computer reminders" wirklich Einfluss auf das Handeln von Ärzten haben, wurde bisher aber nicht systematisch erforscht.
Um nicht der natürlich rundum positiven Bewertung aus Hersteller-Hochglanzprospekten ausgeliefert zu sein, führten kanadische und britische Wissenschaftler jetzt einen systematischen Review der zwischen 1950 und Mitte 2008 durchgeführten Forschungsarbeiten durch. Im Mittelpunkt des Reviews der am Ende 28 in das Reviewverfahren aufgenommenen randomisierten oder quasi-randomisierten Studien (insgesamt wurden 2.036 Studien gefunden, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt hatten) stand die Frage, wie großdie damit erreichten und nachgewiesenen Verbesserungen im Versorgungsprozess und der Einfluss auf das Verhalten von Ärzten waren. Klinische Ergebnisse standen dagegen nicht im Mittelpunkt der reviewten Studien.
Generell waren die Verbesserungen deutlich kleiner als die Erwartungen mit denen derartige elektroniscxhen Systeme angeschafft werden.
Im Einzelnen gab es folgende Ergebnisse:
• Die elektronischen Erinnerungen verbesserten die Therapietreue der Ärzte um durchschnittlich 4,2%.
• Die Verbesserungen waren interessanterweise nicht größer als bei den Ärzten, die in Papierform, also mehr oder weniger weit weg von konkreten Behandlungssituationen erinnert wurden.
• Wenn man bei jeder Studie nur das beste Ergebnis berücksichtigt, verbesserte sich die durchschnittliche Prozessqualität auch nur relativ wenig auf 5,6%.
• Eine Minderheit der Studien berichtete größere Wirkungen des Remindersystems. Trotzdem gab es mit einer Ausnahme weder in diesen noch den anderen Studien Charakteristika des Remindersystems oder ein bestimmtes methodisches Design, das die Größe des Effekts angezeigt hätte.
• Nur in einer Studie und dem dort untersuchten Krankenhaus-Informationssystem hab es wesentlich größere Verbesserungen als bei den anderen Konmstellationen. Dabei handelt es sich um die Effekte eines gutentwickelten und hauseigenen ("homegrown") Systems, das gegenüber der Normalbehandlung zu einer signifikanten Verbesserung um 16,8% führte.
• Schließlich ist der Effekt dort größer (12,9%) wo ein Erinnerungssystem im Einsatz ist, dessen Meldungen der Nutzer bestätigen muss.
Angesichts dieser Ergebnisse und der trotz des IT-Booms nicht gerade üppigen Forschungslage zur Wirkung dieses technischen Fortschritts, warnen die AutorInnen nachdrücklich davor, dass "these expensive technologies will constitute an expensive exercise in trial and error". Wahrscheinlich gilt dies auch für eine Reihe vergleichbarer medizinisch-technischen Neuerungen.
Untersucht werden sollte in weiteren Studien, warum sich Ärzte trotz verbreiteter Euphorie über die "Möglichkeiten der neuen Technik" diese Ressourcen offensichtlich nicht so stark wie erwartet für ihr Verhalten nutzen. Wenn es gelingt die Euphorie auf ein deutlich niedrigeres Niveau abzusenken, sollte überlegt werden, ob und mit welchen anderen Mitteln zusätzlich das Behandlungsverhalten bedarfsgenau und so zielstrebig wie möglich gesteuert werden kann.
Der Aufsatz "Effect of point-of-care computer reminders on physician behaviour: a systematic review von Kaveh G. Shojania, Alison Jennings, Alain Mayhew, Craig Ramsay, Martin Eccles und Jeremy Grimshaw ist im kanadischen Medizinjournal CMAJ (23. März 2010; 182 (5)) erschienen und kostenlos komplett erhältlich.
Bernard Braun, 24.3.10
Zuzahlungen und Praxisgebühr führen zur eingeschränkten Inanspruchnahme auch medizinisch notwendiger Leistungen bei Überschuldeten
 Anders als in internationalen Studien gab es bisher in Deutschland keinen empirischen Hinweis, dass die seit Jahrzehnten für mittlerweile 75 % der GKV-Leistungen existierenden Zuzahlungen oder die jüngere Praxisgebühr dauerhaft zu unerwünschten Unter- und folgeschweren Fehl-Inanspruchnahmen gesundheitlicher Leistungen insbesondere bei sozial Schwachen führen.
Anders als in internationalen Studien gab es bisher in Deutschland keinen empirischen Hinweis, dass die seit Jahrzehnten für mittlerweile 75 % der GKV-Leistungen existierenden Zuzahlungen oder die jüngere Praxisgebühr dauerhaft zu unerwünschten Unter- und folgeschweren Fehl-Inanspruchnahmen gesundheitlicher Leistungen insbesondere bei sozial Schwachen führen.
Dies stellt sich seit der jüngsten Untersuchung der Reaktion überschuldeter Personen aus Rheinland-Pfalz auf die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen mit Zuzahlungen deutlich anders dar.
Die ForscherInnen aus Mainz und Erlangen-Nürnberg beschäftigen sich seit einiger Zeit mit der stetig ansteigenden Gruppe überschuldeter Privathaushalte, die derzeit auf 3,13 Millionen geschätzt werden. Ob und wie die 666 TeilnehmerInnen im Alter von 18 bis 79 Jahren an dieser 2006/2007 in Rheinland Pfalz durchgeführten Studie aufgrund ihrer eindeutig feststehenden finanziellen Not nicht zum Arzt gingen oder verschriebene Medikamente nicht in der Apotheke abholten, wurde hier erstmalig untersucht.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• 65,2% der TeilnehmerInnen der Studie gab an, in den letzten 12 Monaten aus Geldmangel vom Arzt verschriebene Medikamente nicht gekauft zu haben und
• 60,8 % unterließen aufgrund ihrer Schuldensituation und der 10-Euro-Selbstbeteiligung einen Arztbesuch.
• Multivariat betrachtet haben Jüngere, Personen mit Kindern, Personen im Privatinsolvenzverfahren, mit vorhandenen gesundheitlichen Beschwerden und mit einer geringeren Aufmerksamkeit gegenüber der eigenen Gesundheit ein signifikant höheres Risiko einer reduzierten Inanspruchnahme medizinischer Leistungen.
Das hier nachgewiesene Risiko für zumindest aktuell und faktisch zu den unteren sozialen Schichten gehörenden Personen, ist u.a. deshalb ein Problem, weil diese Personen meist höhere Krankheitsprävalenzen haben und bei ihnen "die Verminderung der Inanspruchnahme von Arztbesuchen kontraproduktiv zur Gesundheitspflege und Behandlung von Erkrankungen sein (kann)."
Insgesamt stützen die Ergebnisse der Studie, die These, dass auch notwendige medizinische Behandlungen von überschuldeten Privatpersonen unterlassen werden könnten."
Das häufig an dieser Stelle in die Debatte geworfene Argument, die betreffenden Personen könnten die existierenden gesetzlichen Härtefallbefreiungen nutzen und gar keine oder nur geringe Zuzahlungen zahlen, läuft auch hier faktisch überwiegend ins Leere. Ähnlich wie bei früheren Überprüfungen der Befreiungswirklichkeit (z.B. hatten in einer AOK-Stichprobe im Jahr 2000 60% berechtigte Versicherte mangels Information keine Befreiung beantragt), wurde auch von den TeilnehmerInnen dieser Studie die Befreiungsmöglichkeit "nicht umfassend in Anspruch genommen, was vorrangig auf den mangelnden Bekanntheitsgrad, das Rückerstattungsprinzip und das bürokratische Antragsverfahren zurückzuführen sein kann."
Unabhängig von der Forderung mehr über die Wirkungen von Zuzahlungen und Befreiungsregelungen zu erforschen und dazu auch Studien durchzuführen, welche anders als Querschnittsstudien einen zeitlichen Zusammenhang von Einflussfaktor und Zielgröße nachzuweisen erlauben, sollten nach Ansicht der Autoren "aus sozialmedizinischer Sicht Zuzahlungen für Armutsgruppen und insbesondere für solche mit chronischen Erkrankungen und Beschwerden in Deutschland gestrichen werden."
Leider ist von dem interessanten und möglicherweise wegweisenden Aufsatz "Überschuldung und Zuzahlungen im deutschen Gesundheitssystem - Benachteiligung bei Ausgabenarmut" von Münster, Rüger, Ochsmann, Alsmann und Letzel in der Zeitschrift "Gesundheitswesen" (2010; 72: 67-76) kostenlos nur ein Abstract erhältlich.
Warum die Verlage der meisten deutschen Fachzeitschriften, hier der Thieme Verlag, nicht langsam dem Vorbild noch renommierterer Journals folgen und mehr Aufsätze zu Open Access-Beiträgen erklären, ist unverständlich, da ja auch die hier wesentlich liberaleren Verlage Gewinninteressen haben und realisieren.
Bernard Braun, 2.3.10
"Zauberlehrling oder Pontius Pilatus": Keine Rollen für die Protagonisten der Arztkontaktgebühr!
 Für die Autorin der Welt-Online-Ausgabe vom 19. Januar 2010 sind Ursache und Lösung der im internationalen Vergleich seit Jahren überdurchschnittlich hohen Anzahl von Arztkontakten klar: "Praxisgebühr-macht-Deutsche-zu-Arzt-Weltmeistern. Für zehn Euro im Quartal gibt es ein "All inclusive"-Paket. Damit gibt es einen Anreiz, sich für die zehn Euro möglichst viel aus dem System herauszuholen. In anderen Ländern zahlt der Patient dagegen bei jedem Arztbesuch. Eine derart gestaltete Eigenbeteiligung an den Kosten ist sinnvoller - und würde auch hierzulande das Patientenverhalten so steuern, dass manch unnötiger Arztbesuch wohl entfiele."
Für die Autorin der Welt-Online-Ausgabe vom 19. Januar 2010 sind Ursache und Lösung der im internationalen Vergleich seit Jahren überdurchschnittlich hohen Anzahl von Arztkontakten klar: "Praxisgebühr-macht-Deutsche-zu-Arzt-Weltmeistern. Für zehn Euro im Quartal gibt es ein "All inclusive"-Paket. Damit gibt es einen Anreiz, sich für die zehn Euro möglichst viel aus dem System herauszuholen. In anderen Ländern zahlt der Patient dagegen bei jedem Arztbesuch. Eine derart gestaltete Eigenbeteiligung an den Kosten ist sinnvoller - und würde auch hierzulande das Patientenverhalten so steuern, dass manch unnötiger Arztbesuch wohl entfiele."
Einer der öffentlich gehandelten Berater für einen Teil der Gesundheitsreform dieser Bundesregierung, der Kieler Gesundheitsökonom Thomas Drabinski, schlug im Januar 2010 in dieselbe Kerbe: "Die Praxisgebühr ist gescheitert. Sie hat keine abschreckende Wirkung. Überflüssige Arztbesuche konnten nicht wie erhofft begrenzt werden." Die Gebühr müsse abgeschafft werden und stattdessen solle es eine reduzierte Gebühr je Arztkontakt (2,50 bis fünf Euro) oder eine Zuzahlung je nach Höhe der Behandlungskosten geben.
Damit feiert eine Idee Wiederaufstehung, die regelmäßig von irgendeinem der vielen Hand- und Kopflanger der Anbieterseite ins Feld geführt wird, wenn Nachfrager "schuld" sind und mit der Privatisierung weiterer Leistungsarten "bestraft" werden sollen. In dieser langen bunten Reihe forderte erst im Mai 2009 der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Leonard Hansen, in einer rheinischen Zeitung für jeden einzelnen Arztbesuch 5 bis 10 Euro Gebühr. Damit würde die Hemmschwelle, ärztliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, steigen.
Welche nachweislich falschen Annahmen über das so genannte "moral hazard"-Verhalten von Versicherten oder Patienten hier zur Begründung für Steuerungsversuche herhalten müssen, die dann wie bei der Praxisgebühr empirisch noch nicht einmal das erwünschte Verhalten anreizen oder nur unerwünschte soziale und gesundheitliche Folgen produzieren, soll hier nicht weiter dargestellt werden. Vielmehr soll hinterfragt werden, ob es nicht bereits jetzt empirische Belege für die unerwünschte Wirkung dieser Lieblingssau der zitierten und vieler weiterer professioneller Gesundheitsreform-Vordenker gibt. Keiner von ihnen soll in ein paar Quartalen den überrollten Zauberlehrling spielen oder gar seine Hände in Unschuld waschen.
Zum Nachdenken gibt es nämlich jetzt eine Studie aus den USA, die sich mit dem Verhalten von Patienten beschäftigte, die dort bereits seit geraumer Zeit bei jedem Besuch eines ambulant tätigen Arztes eine Gebühr bezahlen müssen. Diese Art von Zuzahlungen oder "copayments" wurde in den USA auch in einer Reihe von Versicherungen ("plans") der staatlichen Krankenversicherung für ältere US-BürgerInnen, Medicare, eingeführt, und zwar mit enormen Schwung.
Das Geschehen in 36 dieser einzelnen Medicare-Versicherungspakete mit Zuzahlungen mit insgesamt 899.060 Versicherten wurde im Zeitraum von 2001 bis 2006 untersucht. Eine Reihe von ähnlichen Medicare-Versicherungsangeboten ohne eine Änderung in den Zuzahlungen diente als eine Art Vergleichsgruppe.
Der Anteil der Versicherten, die pro Arztbesuch mehr als 15 US-Dollar aus eigener Tasche zahlen müssen, hat sich in den 36 Medicare-"Plans" von 1993 bis 2003 von 0,3 auf 24 Prozent erhöht. Bei den Facharztbesuchen stieg der Anteil sogar von 1,2 auf 63 Prozent der Patienten. Dabei erhöhte sich nicht nur der Anteil der meist verrenteten und morbideren Senioren, der diese "Eintrittsgebühr" für jeden Arztbesuch bezahlen musste. Auch der jeweils zu bezahlende Betrag wuchs von durchschnittlich 7,38 auf 14,38 US-Dollar für Hausarzt- und von 12,66 auf 22,05 US-Dollar für Facharztbesuche. Bei den Vergleichsuntergruppierungen von Medicare blieben die Zuzahlungen für Haus- und Facharztbesuche mit 8,33 und 11,38 US-Dollar unverändert.
Und wie der an der Brown-University in Providence/Rhode Island tätige Gesundheitswissenschaftler Amal Trivedi und zwei seiner Kollegen in ihrer jetzt veröffentlichten Studie auch herausfanden, ging die Anzahl der Besuche eines ambulant tätigen Arztes bereits im ersten Jahr um 19,8 Prozent (minus 19,8 Arztbesuche pro 100 Versicherte) zurück.
Was er aber auch herausfand ist, dass es sich dabei nicht um den einzigen Effekt bei der Veränderung der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen handelte. Gleichzeitig stieg nämlich die Zahl der stationären Aufenthalte um 2,2 Prozent (plus 2,2 Aufenthalte pro 100 Versicherte) und die Klinikaufenthalte verlängerten sich um 13,4 zusätzliche Tage pro 100 Versicherte. Der Anteil der Versicherten, die gegenüber den Versicherten in den Kontroll-Medicare-Versicherungen hospitalisiert waren, stieg um 0,7 Prozent.
Diese empirischen Verhältnisse und Trends unterschieden sich zwischen Alt- und Neumitgliedern praktisch nicht. Die Effekte der Zunahme der Zuzahlungen im ambulanten Bereich tauchten besonders bei Versicherten aus Gegenden mit niedrigem Einkommen und Bildungsniveau auf. Versicherte mit Bluthochdruck, Diabetes und einer Herzinfarkt-Anamnese waren ebenfalls besonders davon betroffen.
Der zusätzliche Aufwand für die stationäre Therapie stellt nach Ansicht von Trivedi nicht nur einen unerwünschten Effekt dar, sondern konterkariert wegen der höheren Ausgaben für stationäre Behandlung sogar den Einspareffekt durch "copayments" zu einem spürbaren Teil oder gar völlig. In einer dem Aufsatz angehängten Modellrechnung sind die Mehraufwendungen sogar mehr als doppelt so hoch wie die Einsparungen. Aus der versprochenen "win-win"- wird damit sogar eine "lose-lose"-Situation.
Auch wenn diese Studie zu anderen Ergebnissen kommt als vor allem die größte Interventionsstudie zur Wirkung von Zuzahlungen auf die Inanspruchnahme von ambulanten und stationären Leistungen, dem so genannten RAND-Health Insurance-Experiment, und auch nur das Geschehen bei älteren Krankenversicherten untersucht wurde, zeigt sich in der Gesamtschau eine derartige Kumulation nachteiliger Folgen von dieser Art von Zuzahlungen bei jedem Arztbesuch, dass man dasselbe Realexperiment nicht unbedingt in aller Breite auch noch im deutschen Gesundheitssystem scheitern lassen sollte.
Der Aufsatz "Increased Ambulatory Care Copayments and Hospitalizations among the Elderly" von Amal N. Trivedi, Husein Moloo, und Vincent Mor erschien am 28. Januar 2010 in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)" (2010;362 (4): 320-8) und ist komplett und kostenlos erhältlich.
Ein dreiseitiges "Supplement" enthält schließlich noch einige grafische Darstellungen der analysierten Verschiebeeffekte.
Bernard Braun, 29.1.10
Lieber krank feiern als krank arbeiten oder umgekehrt!? Was fördert oder hemmt die beiden Umgangsweisen mit Krankheit?
 Die Abwesenheit von Arbeit aus Krankheitsgründen oder "sickness absenteeism" spielt bereits seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in Untersuchungen zum Zustand der Arbeitswelt. Seit den 1990er Jahren wächst parallel das systematische und empirische Interesse an der Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit, dem so genannten "sickness presenteeism".
Die Abwesenheit von Arbeit aus Krankheitsgründen oder "sickness absenteeism" spielt bereits seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in Untersuchungen zum Zustand der Arbeitswelt. Seit den 1990er Jahren wächst parallel das systematische und empirische Interesse an der Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit, dem so genannten "sickness presenteeism".
Trotz zahlreicher Nachweise der Existenz (vgl. dazu u.a. die drei Forumbeiträge aus den letzten 6 Jahren. Dazu gehören mehrere deutsche und internationale Studien aus den letzten 2 Jahren, diverse internationale Beiträge aus den Jahren 2005 bis 2009 und die Ergebnisse des WIdO-Monitors aus 2003 für Deutschland ) gibt es nur wenig differenzierte Einblicke, warum sich eine wachsende Anzahl von Beschäftigten krank zur Arbeit schleppt. Der Hinweis auf die prekäre Arbeitsplatzsituation vieler Beschäftigten ist sicherlich richtig und notwendig, aber für eine Erklärung nicht hinreichend.
Das Präsentismusverhalten ist auf Dauer weder für den so agierenden Arbeitnehmer noch für seinen Arbeitgeber von Nutzen oder nur mit geringen nachteiligen Effekten verbunden. Für den Arbeitnehmer steigt das Risiko, in mehr oder weniger kurzem Abstand schwerer und dann auch insgesamt länger und teurer arbeitsunfähig zu werden. Der Arbeitgeber riskiert u.a. Produktivitätsverluste durch Qualitätsmängel durch unkonzentriertes Arbeiten und mittel- bis langfristig den Verlust von Arbeitskräften.
Die genannte Erklärungslücke versuchte nun finnische Studie mit umfassenden Daten von 725 finnischen Gewerkschaftsmitgliedern in einem Survey durch einen Vergleich eines Bündels von soziodemografischen und Arbeitsfaktoren und -bedingungen (z.B. Arbeitszeitarrangements, Arbeitsplatzregeln aber auch Angaben zum Wirtschaftssektor und zur formalen Bildung und Ausbildung) der im Jahr 2008 absenten und präsenten Personen zu schließen.
Unter Kontrolle der Arbeitercharakteristika erwies sich das Präsentismusverhalten als wesentlich sensitiver gegenüber Arbeitszeit-Arrangemts als Absentismusverhalten. Ständige Vollzeitarbeit, eine Diskrepanz zwischen der gewünschten und tatsächlich erbrachten Anzahl von Arbeitsstunden, Schichtarbeit, und überlange Arbeitswochen auch mit anschließendem Freizeitausgleich erhöhen die Häufigkeit präsentiven Verhaltens. Regelmäßige Überstunden senken etwa die Prävalenz von Absentismus um 13%, während Schichtarbeit die Prävalenz von Absentismus um 8% erhöht. Zwischen beiden Formen des arbeitsbezogenen Umgangs mit dem Kranksein gibt es ein paar interessante Gemeinsamkeiten aber auch grundlegende Unterschiede: So erhöht die Teilnahme an Schichtarbeit sowohl die Absentismus- wie die Präsentismusrate. Anders sieht es bei den Wirkungen regelmäßiger Überstunden aus. Das Verhaltensmodell des Präsentismus wird dadurch um 12% erhöht, der Absentismus dagegen um 13% verringert.
Einige Ergebnisse der Studie weisen auch auf Möglichkeiten der betrieblichen Beeinflussung beider Verhaltensweisen hin. Die Möglichkeit der vorübergehenden Besetzung des Arbeitsplatzes durch Stellvertreter senkt z.B. die Prävalenz des Präsentismus um 11%, was auch als Zeichen für die Rolle des Sichverantwortlichfühlens von Erwerbstätigen interpretiert werden kann. Dort, wo es möglich ist, drei Tage ohne ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit bezahlt vom Arbeitsplatz fern bleiben zu können, sinkt der Präsentismus ebenfalls, und zwar um 8%. Den unverbesserlichen Anhängern der Vorstellung, solche Regelungen würden grenzenlos zum "Krankfeiern" missbraucht, nimmt schließlich noch die Tatsache Wind aus den Segeln, dass auch der Absentismus unter ihrer Geltung um rund 1% sinkt, und keineswegs ansteigt.
Auch wenn man die von den Autoren selbst aufgelisteten methodischen Grenzen der Untersuchung voll teilt,, also z.B. die Unmöglichkeit kausaler Analysen in Querschnittdaten oder die Nichtrepräsentativität von finnischen Gewerkschaftsmitgliedern für die finnische und andere Arbeitnehmerschaften, liefert die Studie wichtige Hinweise für die arbeitspolitische Praxis und künftige (Panel-)Studien zu beiden Verhaltenstypen oder Umgangsweisen.
Von der Studie "What makes you work while you are sick? Evidence from a survey of workers" von Petri Böckerman und Erkki Laukkanen, im Januar 2010 im European Journal of Public Health(2010; 20: 43-46) erschienen, ist lediglich das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.1.10
Evidente, situations- und patientenbezogene "point-of-care"-Empfehlungen für Hausärzte verbessern Sekundärprävention nicht.
 Für das weltweit existierende Problem der fehlenden, zu geringen oder um Jahre verzögerten Orientierung von Ärzten an wissenschaftlichen Behandlungs-Leitlinien gibt es eine Vielfalt von Erklärungsversuchen. Rasch erfolgversprechende oder wirksame Lösungsstrategien gibt es dagegen nur wenige. Die Erklärungsversuche, es liege an dem für ärztliche Praktiker zu großen Umfang vieler Leitlinien, diese wären situativ nicht präsent, bezögen sich viel zu wenig auf den individuellen Patienten und dessen Situation erfordere oft spontane Behandlungsschritte ohne Leitlinienabsicherung, sind zum Teil plausibel und nachzuvollziehen, aber empirisch kaum überprüft worden.
Für das weltweit existierende Problem der fehlenden, zu geringen oder um Jahre verzögerten Orientierung von Ärzten an wissenschaftlichen Behandlungs-Leitlinien gibt es eine Vielfalt von Erklärungsversuchen. Rasch erfolgversprechende oder wirksame Lösungsstrategien gibt es dagegen nur wenige. Die Erklärungsversuche, es liege an dem für ärztliche Praktiker zu großen Umfang vieler Leitlinien, diese wären situativ nicht präsent, bezögen sich viel zu wenig auf den individuellen Patienten und dessen Situation erfordere oft spontane Behandlungsschritte ohne Leitlinienabsicherung, sind zum Teil plausibel und nachzuvollziehen, aber empirisch kaum überprüft worden.
Dieser Zustand ist nun in zwei Städten der kanadischen Provinz Alberta, Edmonton und Calgary, mit einer randomisierten kontrollierten Studie über die Umsetzung von nachgewiesenermaßen wirksamen Sekundärpräventionsmaßnahmen durch niedergelassene Allgemeinärzte beendet worden. Zuvor war schon klar gewesen, dass sekundärpräventive Aktivitäten zu wenig eingesetzt werden und suboptimale gesundheitliche Ergebnisse und damit Nachteile für Patienten die Folge sind.
480 Erwachsene, die in insgesamt 252 Praxen wegen einer chronischen arteriellen Herzerkrankung in Behandlung waren, wurden für diese Studie in drei Gruppen aufgeteilt: Eine Kontrollgruppe, die wie bisher behandelt wurde. Eine Gruppe für deren Behandlung ihre Ärzte anlässlich der wahlweisen ersten Herzkatheterisierung einen allgemeinen Hinweis auf ein Bündel evidenter sekundärpräventiver Maßnahmen erhielten. Schließlich eine dritte Gruppe deren Primär-Ärzte dieselben Hinweise per Fax mit dem Unterschied erhielten, dass die Empfehlungen von einem örtlichen medizinisch-ärztlichen Meinungsführers oder Meinungsführerin unterschrieben waren. Inhalt des Faxes waren nicht nur die spezifischen Leitlinienempfehlungen, die Patienten mit Statinen in ausreichender, d.h. wirksamer Dosis zu behandeln samt expliziter und kompakter Darstellung ihrer Evidenz, sondern auch eine patientenbezogene Darstellung des Zustandes seiner Koronararterien.
Die Behandlungssituation dieser Patientengruppen sah so aus:
• Ein wider Erwarten hoher Anteil von 66% erhielt bereits Statine verordnet.
• Die meisten PatientInnen erhielten aber eine zu niedrige Dosis, d.h. im Durchschnitt eine Dosis, die einem Drittel der von der Leitlinie empfohlenen Dosis entsprach.
• Ihr LDL-Cholesterinspiegel, der als Risikofaktor gilt, war durchweg erhöht und lag durchschnittlich bei 3.09 mmol/L.
Sechs Monate nach der Kathederuntersuchung und der empfohlenen Intervention und Erinnerung zum als optimal angesehenen "point-of-care", sah die sekundärpräventiv empfohlene Behandlung mit Statinen so aus:
• In der Kontrollgruppe erhielten überraschenderweise 50% der Patienten, die vorher keine Statine verordnet bekommen hatten, sie jetzt.
• In der Gruppe von Patienten, deren Ärzte unsigniert Behandlungsempfehlungen erhalten hatten, hatte sich das Statin-Management bei 54% verbessert (Odds Ratio=1,18; nicht signifikant p=0,52).
• Die Ärzte, die Empfehlungen von einer fachlichen Autorität erhalten hatten, orientierten die Behandlung bei 60% der vorher nicht oder unzulänglich behandelten Patienten an diesen Leitlinienempfehlungen (Odds Ratio=1,51; nicht bzw. nur schwach signifikant p=0,09).
• Es gab also in allen drei Patientengruppen sekundärpräventive Verbesserungen, die aber mit Ausnahme einiger Subgruppen (z.B. bei Patienten, die nach der Untersuchung einen Facharzt als Behandler bevorzugten) so eng beieinander lagen, dass kein statistisch signifikanter Unterschied gefunden werden konnte. Bei den Unterschieden könnte es sich also um reine Zufälle handeln. Und eine Verbesserung der Behandlung erfolgte unabhängig davon, ob die Ärzte auf Leitlinienempfehlungen hingewiesen worden waren oder nicht.
Zwischen rund 25% und 40% der Patienten erhielten daher auch nach der gesamten INtervention nicht die evidente sekundärpräventive Behandlung.
• Die durchschnittlichen LDL-Cholesterinlevels der auf die drei Gruppen aufgeteilten Herzkranken unterschieden sich nur wenig.
Selbst der Versuch die eingangs genannten Gründe für die schlechte Nutzung von Leitlinienempfehlungen zu beseitigen oder einzuschränken, also situative, patientenbezogene, knappe und mit dem Überzeugungsgewicht einer örtlichen Behandlungsautorität ausgestattete Fax-Informationen zur Verfügung zu stellen, verbessert den Einsatz sekundärpräventiver Mittel bei Herzerkrankten durch ihre Allgemeinärzte gegenüber der Kontrollgruppe nicht oder nicht ausreichend.
Auch wenn damit erneut eine Hoffnung auf eine relativ unaufwändig zu initialisierende bessere Versorgung zerstoben ist, sollten künftige ForscherInnen sich intensiv mit den Motiven und Gründen der Ärzte aller Interventionsgruppen auseinandersetzen und möglicherweise zusätzlich notwendige Inhalte und Formen der Therapieverbesserung mit entwickeln.
Die 8 Seiten des elektronisch vorab publizierten Studienberichts "The Enhancing Secondary Prevention in Coronary Artery Disease trial von McAlister FA, Fradette M, Majumdar SR, et al. in der kanadischen Fachzeitschrift CMAJ (2009 Dec 8;181(12):897-904), sind komplett und kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 17.1.10
Womit können Therapietreue und Wirtschaftlichkeit verbessert werden?: "Weniger Zuzahlungen verbessern die Therapietreue!"
 Die regelmäßig provozierten und dann mit entsprechender öffentlichen Resonanz geführten Debatten über "Rationierung" bzw. die atmosphärisch angenehmere "Priorisierung" werden in vielfacher Hinsicht unseriös, einseitig und unter Vernachlässigung wichtiger Aspekte geführt. Dies fängt dort an, wo explizit oder implizit der Eindruck erweckt wird, "Rationierung" sei der Wegfall jeglicher, d.h. auch für die Gesundheit völlig unnötiger Leistung und nicht nur der medizinisch notwendigen.
Die regelmäßig provozierten und dann mit entsprechender öffentlichen Resonanz geführten Debatten über "Rationierung" bzw. die atmosphärisch angenehmere "Priorisierung" werden in vielfacher Hinsicht unseriös, einseitig und unter Vernachlässigung wichtiger Aspekte geführt. Dies fängt dort an, wo explizit oder implizit der Eindruck erweckt wird, "Rationierung" sei der Wegfall jeglicher, d.h. auch für die Gesundheit völlig unnötiger Leistung und nicht nur der medizinisch notwendigen.
Es endet dort, wo nicht ernsthaft die Verschwendung und Ineffizienz bilanziert und in Rechnung gestellt werden, die durch die medizinisch unnötige und ungerechtfertigte Über- oder Fehlversorgung mit medizinischen Leistungen und fehlerhafte Behandlungen entstehen. Rein monetäre Schätzungen reichen z.B. für die USA im Jahr 2007 (siehe dazu den Bericht "Waste and inefficiency in the health care system - Clinical care: A comprehensive Analysis in support of system-wide improvements" des Non-Profit-"New England Healthcare Institute") bis zu einem Drittel der laufenden Gesundheitsausgaben.
Ignoriert oder unterbewertet werden aber auch die gesundheitlichen und finanziellen Folgen der weit verbreiteten fehlenden oder mangelnden Therapietreue, Compliance oder Adherence zahlreicher PatientInnen.
In den USA nehmen nach aktuellen Schätzungen zwischen einem Drittel und der Hälfte der PatientInnen Arzneimittel so ein, wie es ihnen ihr Arzt empfohlen hat. Unabhängig von der Frage, warum sie dies machen, ob ihnen vom Arzt also ausreichend oder verständlich genug die Art und Umstände der Therapie erklärt wurden oder sie sich nach Lektüre von Beipackzetteln und Gesprächen mit anderen PatientInnen gegen die Einnahme eines Medikaments entschlossen haben, führt solches Verhalten im Arzneimittelbereich dazu, dass rund 13% aller Gesundheitsausgaben zum Teil buchstäblich in den Müll geworfen werden.
Mit welchen Strategien und Mitteln die Therapietreue bei gesundheitlich notwendigen Leistungen erreicht werden könnte und damit erst wirksame Leistungen finanziert würden, untersuchte nun das bereits erwähnte "New England Healthcare Institute". In der knappen Literaturübersicht "Thinking Outside the Pillbox" fasst das Institut die wesentlichen Erkenntnisse so zusammen:
• Es gibt keine einfachen Lösungen, da für die Therapietreue oder -untreue eine Menge von Faktoren und Bedingungen verantwortlich sind. Dazu zählen u.v.a. die Kosten, der Umfang der Einnahme von Medikamenten, das Krankheitsverständnis der Patienten, ihre Vergesslichkeit und kognitiven Fähigkeiten, kulturelle Einstellungen, mangelhafte Einnahmeregeln.
• Viele der empfohlenen oder praktizierten Mitteln zur Verbesserung der Therapietreue haben keinen wissenschaftlich seriösen Wirksamkeitsnachweis.
• Zu den Mitteln, deren Wirksamkeit bzw. Evidenz in randomisierten, kontrollierten Studie nachgewiesen wurden, zählen: technisch verbesserte Einnahmeregeln und -hilfen, eine hochwertige und mehrdimensionele Information und Weiterbildung für Patienten, die Integration von Adherence in Case Management-Systeme, eine stärkere Orientierung am Gesamtverhaltenstyp und den Präferenzen des individuellen Patienten, eine verbesserte Übersicht des Arztes über die Gesamtbehandlung seiner Patienten, vermehrter Einsatz von Erinnerungs- und Monitoringtechniken. Für die empirische Wirkung dieser Interventionen finden sich in der Übersicht einige Belege.
• Einen nachweisbar hohen und von den bisher genannten Faktoren weitgehend unabhängigen Einfluss haben die von den PatientInnen zu zahlenden Zuzahlungen. Hier gehen einige Ökonomen in den USA davon aus, dass höhere Kosten die Therapietreue verschlechtern und im Umkehrschluss, eine Senkung der z.B. durch Zuzahlungen entstehenden Kosten die Therapietreue verbessere und damit wirtschaftlich und gesundheitlich günstiger ist - ein insbesondere für die Kenner der gesundheitsökononomischen Erwartungen deutscher Experten und Politiker an die Steuerbarkeit der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch Zuzahlungen verblüffendes Argument. Und dass es sich dabei nicht um theoretische Spekulationen über die Preiselastizität der Nachfrage handelt, zeigt die Zusammenfassung der wenigen praktischen Versuche, diese Annahme zu verifizieren: "Many corporations are now seeking to improve adherence and reduce unnecessary medical spending by employing value based insurance design (VBID) plans that lower employee contributions and out-of-pocket costs for cost effective medications for chronic disease. Experts suggest that lowering medication co-payments for specific chronic conditions can be linked to improved medication possession ratios."
Einige Beispiele, dass mit diesem Mittel tatsächlich Verbesserungen der Adherence z.B. zwischen 7 und 14% erreichbar sind, findet sich in der 2008 in der Zeitschrift "Health Affairs" (Health Affairs, 27, no. 1 (2008): 103-112) veröffentlichten Studie "Impact Of Decreasing Copayments On Medication Adherence Within A Disease Management Environment" von Chernew et al. Von diesem Aufsatz gibt es allerdings kostenlos und für Nichtabonnenten der Zeitschrift nur ein Abstract. Für die Behandlung des Diabetes und einiger anderer chronischer Krankheiten stellt die u.a. durch ein Pharmaunternehmen gesponserte und komplett kostenlos erhältliche Studie "Value-Based Insurance Designs for Diabetes Drug Therapy" weitere empirische Ergebnisse vor.
Zum Kontext dieser Untersuchungen zum Zusammenhang von Zuzahlungen, Therapietreue und Behandlungsnutzen eignet sich auch der Forumsbeitrag "Selbstbeteiligungen und kein Ende: Was lange währt, ist keineswegs immer gut" sehr gut.
Der Literaturreview über die Herausforderungen und Mittel, die Therapietreue zu verbessern mit dem Titel "Thinking Outside the Pillbox. A System-wide Approach to Improving Patient Medication Adherence for Chronic Disease" ist im August 2009 als NEHI-Research erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.11.09
Antibiotika-Niedrigverbrauchsregion Ostdeutschland: Woran liegt es?
 Die schnelle bei vielen banalen bakteriellen Infekten nicht notwendige und bei viralen Infekten wenig hilfreiche Verordnung von Antibiotika und die damit verbundene wachsende Resistenz wirklich gefährlicher Erreger gegen Antibiotika stellen einen nicht geringen Teil des Bergs der Über- und Fehlversorgung in Gesundheitssystemen dar.
Die schnelle bei vielen banalen bakteriellen Infekten nicht notwendige und bei viralen Infekten wenig hilfreiche Verordnung von Antibiotika und die damit verbundene wachsende Resistenz wirklich gefährlicher Erreger gegen Antibiotika stellen einen nicht geringen Teil des Bergs der Über- und Fehlversorgung in Gesundheitssystemen dar.
Nach der langjährigen Debatte über diese Themen erschien im Oktober 2008 der aktuellste und einzige Bericht, der näherungsweise die Verordnungshäufigkeit von Antibiotika in Deutschland im human- und tiermedizinischen Bereich im internationalen Vergleich und die Intensität der Resistenzen zusammenstellte.
Der auf Initiative des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) von der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V. und der Infektiologie an der Universität Freiburg erstellte Bericht beruht auf Daten über den Antibiotikaverbrauch im ambulanten Bereich aus Untersuchungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), während die dargestellten Verbrauchsdaten für den stationären Bereich aus den Freiburger Surveillance-Projekten MABUSE-Netzwerk (Medical Antibiotic Use Surveillance and Evaluation) und SARI (Surveillance der Antibiotikaanwendung und der bakteriellen Resistenzen auf Intensivstationen) stammen. Das Datenmaterial zur Bestimmung der Resistenzsituation stammt zum Großteil aus der Resistenzstudie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie, den Erhebungen des German Network for Antimicrobial Resistance Surveillance (GENARS), dem SARI-Projekt sowie aus dem European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Weiterhin wurden die bei den nationalen Referenzzentren zur Überwachung wichtiger Infektionserreger verfügbaren Resistenzdaten analysiert.
Auf dieser Datenbasis fanden sich die folgenden Ergebnisse:
• Der aktuelle (2007) Antibiotikaverbrauch in der Humanmedizin lässt sich auf insgesamt 250 - 300 t pro Jahr schätzen. Dabei entfallen rund 85 % der Verordnungen auf den ambulanten Bereich. Im Jahr 2007 entsprach dies einem Verbrauch von 363 Mio. definierten Tagesdosen (DDD) oder knapp 15 DDD pro 1.000 Versicherte und Tag.
• Im Vergleich der europäischen Länder nimmt Deutschland mit seinem Antibiotikaverbrauch im ambulanten Bereich eine Position im unteren Drittel ein: zusammen mit den Niederlanden, Österreich, den skandinavischen Ländern, Slowenien, Russland und der Schweiz. Die Spitzengruppe bilden Griechenland, Zypern, Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg. In diesen Ländern ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Antibiotika z. T. mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Dabei haben sich die Größenordnungen in den letzten Jahren nur geringfügig geändert.
• Vor dem Hintergrund der verfügbaren Daten hat sich die Resistenzlage bei den meisten Erregern ambulant erworbener Infektionen während der letzten 10 - 15 Jahren wenig verändert, wobei hier nur sehr wenig zuverlässige und für den ambulanten Bereich repräsentative Informationen vorliegen.
Zu einer der wichtigsten und offensichtlich zeitstabilen Erkenntnisse dieses Reports gehört die innerhalb Deutschlands zwischen West und Ost ungleiche Häufigkeit der Antibiotikaverordnungen:
• Größere regionale Unterschiede im Antibiotikaverbrauch wurden für Deutschland erstmals 2001 beschrieben. Ärzte im Westen (alte Bundesländer) verordneten deutlich häufiger Antibiotika als Ärzte im Osten (neue Bundesländer). Dieser Unterschied war auch in den darauffolgenden Jahren zu beobachten. Im Jahr 2007 variierte die Verordnungsdichte in den südlichen und westlichen Bundesländern zwischen 13,1 DDD pro 1.000 Versicherten und Tag (DDD/1.000) (Baden-Württemberg) und 17 DDD/1.000 (Saarland). Diese Werte lagen deutlich über dem Verbrauch in den neuen Bundesländern (9,7 bis 11,5 DDD/1.000). Je GKV-Versichertem und Jahr streute der Antibiotikaverbrauch von 3,6 bis 6,4 DDD, d. h. im Jahr 2007 war der Pro-Kopf-Verbrauch in dem Bundesland mit dem höchsten Verbrauch um den Faktor 1,8 höher als in dem Bundesland mit dem niedrigsten Verbrauch.
Da sich der Bericht nur am Rande mit den möglichen Ursachen des Ost-Westgefälles gut 1 ½ Jahrzehnte nach dem Ende der DDR befasste, gab es nach seiner Veröffentlichung einige Interpretationsversuche in Massenmedien. Dazu gehört der eines WidO-Mitarbeiters, der in der Illustrierten "Stern" vom 3. November 2008 sinngemäß anmerkte, dabei handle es sich um unterschiedliche "Verbrauchsmentalitäten" in den beiden deutschen Staaten, um den Ausdruck der Mangelwirtschaft in der ehemaligen DDR und den dortigen bürokratischen Hemmnissen beim Einsatz von Antibiotika. Mit den Ergebnissen des Berichts und dieser Art von Interpretationsversuch befasste sich nun aktuell ein Aufsatz von Christian Tauchnitz im Heft 6/2009 des "Ärzteblatt Sachsens".
Der Aufsatz kam u.a. zu folgenden Erkenntnissen und Schlussfolgerungen:
• Für richtig wird im Allgemeinen die Aussage gehalten, die Wurzeln für das bessere Abschneiden der neuen Bundesländer wären bereits in DDR-Zeiten gelegt worden.
• Als irrig gilt dagegen die Erklärung durch Mangelwirtschaft. Obwohl diese zweifelsfrei existierte, "gab es damals keine bürokratischen Hemmnisse bei der ambulanten Antibiotika-Verordnung."
• Vielmehr handelt es sich nach Meinung des Ärzeblatt-Autoren um das Ergebnis aktiver Bemühungen während der letzten Jahre vor der politischen Wende. Einige ärztliche Antibiotika- Spezialisten und Pharmazeuten forderten demnach völlig ideologiefrei eine kritische Indikationsstellung für Antibiotika und Verzicht bei erwiesener Unwirksamkeit.
• Interessant für die Beurteilung der Qualitätssicherungspolitik im Gesundheitssystem der DDR und auch für die im vereinten Deutschland ist die Bemerkung, dass es schon damals bekannt war, dass ausschließlich fachliche Informationen für den kritischen Umgang mit Antibiotika nicht ausreichend sind.
• Von zentraler Bedeutung für die Überzeugungskraft der gegenüber der Verordnung von Antibiotika zurückhaltenden Therapieorientierung und deren Wirkung bis zum heutigen Tag waren demnach die in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Leipziger Bezirksarzt von einer Arbeitsgruppe erstellten bezirksärztlichen Richtlinien für den Umgang mit Antibiotika. Sie besaßen eine gewisse behördliche Autorität, und zwar dadurch, dass sie für verbindlich erklärt und Kontrollen angekündigt wurden. Im Einzelnen handelt es sich um allgemeine Grundsätze (1983), bakterielle Harnwegsinfektionen (1983), unspezifische Infektionen der tieferen Atemwege (1984), die Therapie von Gallenwegsinfektionen (1985) und die perioperative Ein-Dosis-Prophylaxe (1987). Allein durch die letztgenannte Richtlinie gingen in drei großen orthopädischen Kliniken im Bezirk Leipzig die Wundinfektionsraten nach alloplastischem Hüftgelenksersatz von 8 Prozent auf weniger als 1 Prozent zurück.
• Offensichtlich waren die Richtlinien so gut akzeptiert und führten zu so guten Erfahrungen, dass die Verordnungsgewohnheiten nach der politischen Wende bis mindestens 2007 beibehalten wurden und sogar an die nachrückenden Ärzte weitergegeben wurden.
Angesichts der Wichtigkeit eines zurückhaltenderen Verbrauchs von Antibiotika und trotz der aktuell eher wirkungslosen Versuche, den Verbrauch durch Leitlinien und Therapieempfehlungen zu senken, zeigen die hier vorgestellten Daten seine offensichtlich mögliche Beeinflussung durch eine Kombination von Maßnahmen. Die im "Ärzteblatt Sachsen" versuchte Erklärung sollte unabhängig davon, ob man ihr komplett folgt, Anlass für eine genauere Untersuchung der Beweggründe sein.
Die Schlussfrage des sächsischen Autoren, ob man angesichts der sicherlich auch kostenmindernden Verordnungsweise der sächsischen/ostdeutschen Ärzte nicht "als Gegenleistung ... wenigstens auf Arzneimittelregresse gegen sächsische Ärzte verzichten" solle, scheint allerdings wieder in den merkantilen Alltag der (west-)deutschen Ärzteschaft zurückzuführen.
Der 159 Seiten umfassende Bericht "GERMAP 2008. Antibiotika-Resistenz und -Verbrauch Bericht über den Antibiotikaverbrauch und die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der Human- und Veterinärmedizin in Deutschland" ist komplett kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für den zweiseitigen Aufsatz "Antibiotika-Verordnungen. Zu den Ursachen der großen regionalen Unterschiede von Antibiotika-Verordnungen durch Arztpraxen in Deutschland" von Christian Tauchnitz im "Ärzteblatt Sachsen 6/2009: 263-264".
Bernard Braun, 14.6.09
Selbstkontrolle des Blutzuckers und Selbstmanagement der Ergebnisse oder HbA1c-Messung - Schwarzer Tag für Teststreifenhersteller?
 Um eigenverantwortliches Handeln zu stärken und Patienten in diagnostische und therapeutische Prozesse einzubeziehen, galten die regelmäßige, d.h. nicht selten täglich mehrmalige Messung des Blutzuckerwertes und die zusätzliche Notwendigkeit Patienten zu qualifizieren, die gewonnenen Erkenntnisse bis zu einem bestimmten Punkt in ihr Behandlungs- und Verhaltenskonzept miteinzubeziehen als wirksam, um den Blutzuckerspiegel bei nicht mit Insulin behandelten DiabetikerInnen absenken und dauerhaft auf einem niedrigen Niveau halten zu können. Trotz des damit verbundenen auf Dauer kostspieligen Verbrauchs von Teststreifen - ob aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen oder direkt aus der eigenen Geldbörse der Kranken - oder der Anschaffung immer besserer, schmerzfreierer und genauerer Testgeräte, ging und geht es in der Debatte über die eigenaktive Messung und Steuerung des Blutzuckers überwiegend um die Kosten dieser Dauermessungen und nicht um deren Sinn und Nutzen.
Um eigenverantwortliches Handeln zu stärken und Patienten in diagnostische und therapeutische Prozesse einzubeziehen, galten die regelmäßige, d.h. nicht selten täglich mehrmalige Messung des Blutzuckerwertes und die zusätzliche Notwendigkeit Patienten zu qualifizieren, die gewonnenen Erkenntnisse bis zu einem bestimmten Punkt in ihr Behandlungs- und Verhaltenskonzept miteinzubeziehen als wirksam, um den Blutzuckerspiegel bei nicht mit Insulin behandelten DiabetikerInnen absenken und dauerhaft auf einem niedrigen Niveau halten zu können. Trotz des damit verbundenen auf Dauer kostspieligen Verbrauchs von Teststreifen - ob aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen oder direkt aus der eigenen Geldbörse der Kranken - oder der Anschaffung immer besserer, schmerzfreierer und genauerer Testgeräte, ging und geht es in der Debatte über die eigenaktive Messung und Steuerung des Blutzuckers überwiegend um die Kosten dieser Dauermessungen und nicht um deren Sinn und Nutzen.
An diesen gab es bereits seit längerem Zweifel, die von Warnungen über die technischen und vor allem Effektivitätsdefizite der Selbstmessung begleitet wurden. Unter den Schlagzeilen "Self management" bei Diabetes und Asthma kein Selbstläufer - Sachkundige Unterstützung und Überprüfung der Umsetzung erforderlich und Self-Monitoring des Blutzuckers ohne gesundheitlichen Zusatznutzen - Von den Grenzen der Patienten-Eigenaktivitäten gab es im Forum-Gesundheitspolitik auch bereits entsprechende Hin- und Nachweise.
Die im Februar 2009 in Großbritannien im Rahmen der "Diabetes Glycaemic Education and Monitoring (DiGEM)"-Studie abgeschlossene und als Health Technology Assessment-Bericht veröffentlichte Studie "Blood glucose self-monitoring in type 2 diabetes: a randomised controlled trial" wollte die immer noch wenig verbreiteten Annahmen über die inhaltlichen Grenzen dieser Methode randomisiert und kontrolliert untersuchen. Dazu wurden 435 Patienten im Alter über 25 Jahren aus 24 Allgemeinarztpraxen in Oxfordshire und 24 in South Yorkshire zufallsgesteuert und in etwa gleich stark auf eine von drei Interventions- oder Placebogruppen aufgeteilt. Die Patienten waren älter als 24 Jahre und hatten einen HbA1c-Wert (ein Messwert, der zuverlässig den Blutzuckerspiegel über einen längeren Zeitraum anzeigt oder das "Blutzuckergedächtnis") von 6,2 % und höher, der bislang nicht mit Insulin behandelt wurde.
Die erste Gruppe (n=152) der Patienten erhielt die Standardbehandlung, d.h. alle 3 Monate eine HbA1c-Bestimmung durch einen Arzt, die zweite Gruppe (n=150) bestimmten ihren Butzuckerwert selber und erhielten ein Patiententraining, das allerdings bei der Frage der Ergebnisinterpretation auf den Arzt fokussierte und die dritte Gruppe (n=151) maß ihren Blutzuckerwert ebenfalls selber und lernte außerdem, die Werte selber zu interpretieren und einzusetzen, um ihre Motivation und Stabilisierung eines gesunden Lebensstils zu erhöhen.
Nach 12 Monaten Dauer der unterschiedlichen Behandlungs- bzw. Überwachungskonzepte wurde der Zustand der Patienten umfassend überprüft. Dies umfasste u.a. eine Messung des Blutdrucks, der Fettstoffe, der möglicherweise durchlebten Unterzuckerungen, der Lebensqualität im Allgemeinen mittels des EuroQol 5, des gesundheitlichen Wohlbefindens, der gesundheitsbezogenen Lebensweisen (z.B. Ernährung und Bewegung), der Inanspruchnahme von gesundheitlicher Versorgung ebenso wie die Erhebung der Überzeugungen zur Selbstmessung des Blutzuckers. Das Ganze wurde schließlich mit einer Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Methoden abgerundet.
Die Ergebnisse sahen u.a. so aus:
• Die HbA1c-Werte in den drei Patientengruppen (die Werte waren bezüglich der unterschiedlichen Ausgangswerte adjustiert) unterschieden sich nicht statistisch signifikant.
• Die nichtadjustierte durchschnittliche Veränderung des HbA1c-Wertes zwischen den TeilnehmerInnen in der standardmäßig behandelten (Kontroll-)Gruppe und jenen in der gemäßigten Selbstmessgruppe betrug -0,14% und gegenüber der intensiven Selbstmessgruppe -0,17%. Beide Werte waren statistisch nicht signifikant.
• Auch wenn man die Gruppen in Subgruppen aufteilte, die sich nach der Dauer der Diabeteserkrankung, der bisherigen Therapie oder der bisherigen diabetesassoziierten Komplikationen unterschieden, gab es keine Evidenz für einen signifikanten Unterschied der Wirkung des Selbsttestens.
• Die ökonomische Analyse bestätigte lediglich, dass zusätzliche Ausgaben entstünden und ein Routineeinsatz von Selbstmonitoring unwahrscheinlich kosteneffektiv wäre.
• Bei einer Reihe von Patienten wirkte sich das Selbstmessen negativ auf die Lebensqualität aus.
• Eine Reihe anderer Patienten gaben in Intensivinterviews aber an, die Selbstmessung sei für sie hilfreich gewesen, ernsthafte Folgen ihrer Diabeteserkrankung zu verhindern und ihr Verhalten anzupassen.
• Sollte der HbA1c-Wert ständig über 8% liegen, könnte die regelmäßige Selbstmessung geeignet sein, einen ständigen Druck auf diese PatientInnen auszuüben, sich an Behandlungsempfehlungen zu halten und möglicherweise auch eine Insulinbehandlung zu bevorzugen.
• Umgekehrt war aber trotz Qualifizierung anderen TeilnehmerInnen der Zusammenhang zwischen den Tests und ihrem Verhalten am Ende des Versuchs nicht klar.
Auch wenn die Studie nicht ausschloss, dass die Selbstmessung des Blutzuckerwerts mit oder ohne Qualifizierung für bestimmte PatientInnen Vorteile bietet, lautet die Schlussfolgerung und Empfehlung der ForscherInnen, dass "there was no convincing evidence to support a recommendation for routine self-monitoring of all patients and no evidence of improved glycaemic control in predefined subgroups of patients."
Den 88-seitigen HTA-Bericht "Blood glucose self-monitoring in type 2 diabetes: a randomised controlled trial" von Farmer A, Wade A, French D et al. (Health Technol Assess. 2009 Feb;13(15): 1-72 kann man umsonst als PDF-Datei herunterladen.
Bernard Braun, 13.4.09
Finanzlasten durch medizinische Behandlung, schwindendes Patientenvertrauen und schlechtere Erwartungen zur Behandlungsqualitität
 Die zunehmende Merkantilisierung der Kontakte zwischen Ärzten und Patienten und das zunehmend Basarhafte in der gesundheitlichen Versorgung z. B. durch Zuzahlungen, Individuelle Gesundheitsleistungen (IgeL), Bonus- und Selbstbehaltprogramme führt nicht "nur" zu einer zügigen Erhöhung des zweiten Beitragssatzes, sondern hat auch unerwünschte und langfristige kulturelle, soziale und auch ökonomische Effekte.
Die zunehmende Merkantilisierung der Kontakte zwischen Ärzten und Patienten und das zunehmend Basarhafte in der gesundheitlichen Versorgung z. B. durch Zuzahlungen, Individuelle Gesundheitsleistungen (IgeL), Bonus- und Selbstbehaltprogramme führt nicht "nur" zu einer zügigen Erhöhung des zweiten Beitragssatzes, sondern hat auch unerwünschte und langfristige kulturelle, soziale und auch ökonomische Effekte.
Dies bestätigt und quantifiziert eine gerade veröffentlichte Querschnitts- und Haushaltsstudie in den USA mit 32.210 Erwachsenen, die im Jahr 2003 nach Angaben im "Community Tracking Study Household Survey" bei einem Arzt in ständiger Behandlung waren. Den Autor, Peter Cunningham vom "Center for Studying Health System Change", interessierten dabei hauptsächlich die Zusammenhänge zwischen den in den USA schon länger durch die medizinische Versorgung verursachten hohen finanziellen Lasten der Privathaushalte, dem Vertrauen der Patienten und der von ihnen erwarteten Versorgungsqualität.
Zunächst aber zeigte der Telefon- und Interview-Survey, dass insgesamt 27 % aller us-amerikanischen Erwachsenen mit einem sie fest versorgenden Arzt in Familien mit hohen medizinischen Kosten lebten. 18 % der antwortenden Personen haben im Verhältnis zu ihrem Einkommen hohe Zuzahlungen und 14 % haben Probleme, ihre Arztrechnungen zu bezahlen. Erwartungsgemäß haben verhältnismäßig mehr unversicherte Personen hohe Behandlungskosten-Lasten, nämlich 40 %. Bei Patienten mit einer privaten oder öffentlichen Krankenversicherung betrug dieser Anteil 25 % und weniger.
Auf diesem Hintergrund gab es eine Reihe zunächst "weicher" und "harter" Effekte:
• Rund 6 % aller befragten Patienten mit hohen Geldlasten durch Arztrechnungen etc. glaubten nicht, dass ihr Arzt ihre Bedürfnisse über alles stellt und 13 % bzw. 14 % glauben ebenfalls, ihr Arzt führe nicht notwendige Tests durch (odds ratio: 1,42) oder versage bei der Überweisung zu einem Facharzt (odds ratio: 1,39).
• Personen mit hohen Behandlungskosten haben wesentlich häufiger als solche ohne derartige Lasten einen Mangel an Vertrauen (odds ratio: 1,43) in die medizinische Entscheidungsfindung des Arztes und liefern negative Bewertungen ihres Zusammentreffens mit ihrem Arzt. Diese Differenz war bei Personen mit hohem Einkommen etwas größer.
• Die Daten belegen eine Art "Kulturbruch" im Arzt-Patientverhältnis mit ungewissem, aber wahrscheinlich sozial und ökonomisch folgenreichen Ende: "Patients with high medical cost burdens are more likely to view their medical encounters in terms of financial transachtions and medical providers as economic actors." Welche Verhaltensweisen der hier beschriebene Vertrauenszerfall und der Wandel der Arztrolle bei Patienten auslösen (z.B. Noncompliance) untersuchen die Autoren der Studie nicht ausdrücklich, sehen damit aber wichtige Bedingungen für eine wirksame Behandlung gefährdet. Letztlich sind damit weder kostentreibende noch der Gesundheit abträgliche Reaktionen auszuschließen.
• Die negative Assoziation zwischen hohen Behandlungskosten, Patientenvertrauen und erwarteter Behandlungsqualität ist in den USA am stärksten bei den privat versicherten Personen konzentriert.
Auch wenn manche der hier beschriebenen Wirkungen hoher finanzieller Lasten durch die medizinische Versorgung erwartbar waren, liegen immerhin jetzt so harte Daten vor, dass auch in Deutschland bedacht werden sollte, wie lange Patienten das aktuelle Gerangel ihrer Ärzte über ihre REgelleistungsvolumina und die Versuche, sie dies durch Vorauszahlungen ausbaden zu lassen, noch ohne vergleichbare unerwünschte Reaktionen hinnehmen.
Von dem Aufsatz "High Medical Cost Burdens, Patient Trust, and Perceived Quality of Care" von Peter J. Cunningham, im "Journal: Journal of General Internal Medicine",(2.Februar 2009) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 16.3.09
§ 73 Abs. 8 SGB V: Umfassende Arzneimittel-Informationspflichten von Kassenärztlichen Vereinigungen und GKV gegenüber Ärzten.
 Der § 73 Abs.8 SGB V verpflichtet "die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die Vertragsärzte auch vergleichend über preisgünstige verordnungsfähige Leistungen und Bezugsquellen, einschließlich der jeweiligen Preise und Entgelte zu informieren sowie nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse Hinweise zu Indikation und therapeutischen Nutzen zu geben. ... In den Informationen und Hinweisen sind Handelsbezeichnung, Indikationen und Preise sowie weitere für die Verordnung von Arzneimitteln bedeutsame Angaben insbesondere auf Grund der Richtlinien (des Gemeinsamen Bundesausschuss) nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in einer Weise anzugeben, die unmittelbar einen Vergleich ermöglichen; dafür können Arzneimittel ausgewählt werden, die einen maßgeblichen Anteil an der Versorgung der Versicherten im Indikationsgebiet haben. Die Kosten der Arzneimittel je Tagesdosis sind nach den Angaben der anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikation anzugeben."
Der § 73 Abs.8 SGB V verpflichtet "die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die Vertragsärzte auch vergleichend über preisgünstige verordnungsfähige Leistungen und Bezugsquellen, einschließlich der jeweiligen Preise und Entgelte zu informieren sowie nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse Hinweise zu Indikation und therapeutischen Nutzen zu geben. ... In den Informationen und Hinweisen sind Handelsbezeichnung, Indikationen und Preise sowie weitere für die Verordnung von Arzneimitteln bedeutsame Angaben insbesondere auf Grund der Richtlinien (des Gemeinsamen Bundesausschuss) nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in einer Weise anzugeben, die unmittelbar einen Vergleich ermöglichen; dafür können Arzneimittel ausgewählt werden, die einen maßgeblichen Anteil an der Versorgung der Versicherten im Indikationsgebiet haben. Die Kosten der Arzneimittel je Tagesdosis sind nach den Angaben der anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikation anzugeben."
Nachdem Arzneimittel sowohl einen größeren Teil der Leistungsausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung kosten als die direkten Leistungen der niedergelassenen Ärzte (Anteil Arzneimittel 2007=19,2 % und Leistungen ambulant tätiger Ärzte=16 %) als auch eine Fülle von Wirksamkeitsschwächen oder gar unerwünschten Wirkungen mit sich bringen, ist jeder Beitrag zur kritischen und praxisgeeigneten Transparenz für verordnende Ärzte von großer finanzieller und gesundheitlicher Bedeutung.
Dazu zählt daher auch das im Internet von allen Interessenten nutzbare Angebot "Wirkstoff AKTUELL", das die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Zusammenarbeit mit der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft erstellt. Mit "Wirkstoff AKTUELL" kommt die KBV ihrem "gesetzlichen Auftrag nach, in dem wir Empfehlungen zur wirtschaftlichen Verordnungsweise unter Bewertung des therapeutischen Nutzens des jeweiligen Arzneimittels aussprechen. Unseren Hinweisen liegt eine Bewertung von für das Arzneimittel relevanten Studien und Leitlinien zugrunde."
Diese Hinweise erfolgen in sehr knapper Weise. Dies gilt z.B. auch für die jüngste Wirkstoff-Information zu "Strontiumranelat (Protelos®)", die ihre 2 Seiten mit der folgenden Empfehlung enden lässt: "Für den Wirkstoff Strontiumranelat ist, auch unter Berücksichtigung des anderen Wirkmechanismus, für die Behandlung der kein zusätzlicher Nutzen hinsichtlich der fraktursenkenden Wirkungen im Vergleich zu den Bisphosphonaten belegt."
Angesichts der vielen gleichzeitig in einschlägigen nationalen und internationalen Empfehlungen (hier ist z.B. an die Empfehlungen der "Food and Drug Administration (FDA)" der USA zu denken) enthaltenen Hinweisen auf problematische Wirkstoffe oder Arzneimittel, fällt die bisherige Anzahl von Hinweisen auf der KBV-Seite recht karg aus, ohne dass dafür eine Erklärung gegeben wird. Dies birgt das Risiko in sich, dass informationssuchende Ärzte "für alle Fälle" auch noch in drei, vier anderen Quellen recherchieren müssen, um das Gefühl zu erhalten halbwegs den Überblick über potenziell problematische Verordnungen zu besitzen. Es birgt aber auch das Risiko in sich, dass Ärzte angesichts ihrer knappen Zeitressourcen in gar keiner Infoquelle mehr systematisch und regelmäßig suchen.
Über die Home-Seite von "Wirkstoff AKTUELL" gelangt man leicht zu den chronologisch geordneten und kostenlosen Einzelbeiträgen wie etwa dem über den bei postmenopausaler Osteoporose nicht zusätzlich nützlichen Wirkstoff Strontiumranelat.
Bernard Braun, 27.1.09
Forschung von 25 Jahren: Die mangelnde klinische Gleichwertigkeit von Generika und Original ist oft ein gut gepflegtes Phantom.
 Gegen die Verordnung und Einnahme von sogenannten Generika, d.h. Arzneimitteln, die nach Beendigung des Patentschutzes eines Originalpräparats, meist preisgünstiger "nachgebaut" werden und aus Kostengründen auch immer häufiger verordnet werden sollen oder müssen, wurden und werden von Originalherstellern und ihnen nahe stehenden Kopflangern Sicherheitsbedenken und Warnungen vor möglichen unerwünschten gesundheitlichen Wirkungen geäußert. Diese machen sich an der Bioäquivalenz, d.h. einer qualitativ gleichwertigen Zusammensetzung und Wirkung der Generika fest. Hier könnten, so die Warner vor allzu intensiver Verordnung von Generika, kleine Unterschiede erhebliche negative Einflüsse auf die erwünschte gesundheitliche Wirkung darstewllen.
Gegen die Verordnung und Einnahme von sogenannten Generika, d.h. Arzneimitteln, die nach Beendigung des Patentschutzes eines Originalpräparats, meist preisgünstiger "nachgebaut" werden und aus Kostengründen auch immer häufiger verordnet werden sollen oder müssen, wurden und werden von Originalherstellern und ihnen nahe stehenden Kopflangern Sicherheitsbedenken und Warnungen vor möglichen unerwünschten gesundheitlichen Wirkungen geäußert. Diese machen sich an der Bioäquivalenz, d.h. einer qualitativ gleichwertigen Zusammensetzung und Wirkung der Generika fest. Hier könnten, so die Warner vor allzu intensiver Verordnung von Generika, kleine Unterschiede erhebliche negative Einflüsse auf die erwünschte gesundheitliche Wirkung darstewllen.
Dagegen gerichtet gab es schon immer bei einzelnen besonders umstrittenen Generika - meist bei denen für die der Markt relativ groß war - schlüssige Gegenargumente und Belege für eine hinreichend gleiche Bioäquivalenz von Original und Generika.
Für eine der quantitativ und qualitativ bedeutendsten Arzneimittelgruppen, die der vielfältigen Mittel gegen kardiovaskuläre Risikofaktoren, Beschwerden und Erkrankungen (z.B. Betablocker oder Diuretika) erschien nun in der neuesten Ausgabe des US-Medizinjournals JAMA (JAMA 3.12.2008;300(21): 2514-2526) ein systematischer Review der in den letzten 25 Jahren durchgeführten und publizierten 47 Studien (darunter 38 randomisierte kontrollierte Untersuchungen [RCT]) zur Bioäquivalenz bzw. klinischen Gleichwertigkeit der dort existierenden Original- und Generika-Mittel.
Die Quintessenz der Reviewer lautet kurz und knapp: "No evidence of superiority" der klinischen Gleichwertigkeit ("clinical equivalence") der Originalpräparate gegenüber ihren jeweiligen Generika. Dabei stand im Mittelpunkt des Interesses der klinische Outcome der Behandlung mit Arzneimitteln aus 9 Unterklassen dieser Medikamentengruppe. Zum Outcome wurden das Auftreten unerwünschter Wirkungen, Laborwerte und eine Reihe von behandlungsassoziierten Vitalzeichen. Nur bei 2 der 9 untersuchten Untergruppen wurde die klinische Gleichwertigkeit nicht in allen reviewten Studien festgestellt. Aber auch dort stellten 91 bzw. 71 % der Studien sie fest.
Die in den reviewten Studien gefundenen Ergebnisse rechtfertigen, so die Autoren des Review "that it is reasonable for physicians and patients to rely on FDA bioequivalence rating as a proxy for clinical equivalence among a number of important cardiovascular drugs."
Wie hartnäckig sich Vorurteile selbst dort halten wo ausdrücklich keinerlei Beleg für eine Minderwertigkeit von Generika gefunden wurde, zeigen die in 43 der 47 Studien-Zeitschriften veröffentlichten Editorials: In 23 Fällen äußerten sich die jeweiligen Herausgeber gegen die Ergebnisse ihrer Autoren negativ darüber, Originalarzneimittel durch Generika zu ersetzen. Es ist zu befürchten, dass angesichts des ökonomischen Potenzials des Arzneimittelmarktes auch weiterhin Ärzte, Apotheker und vor allem auch Patienten mit Vorsatz erschreckt werden und sich für eine nur für die Hersteller ökonomisch vorteilhaftere Behandlung mit Originalpräparaten entscheiden.
Hier findet sich das kostenlose Abstract des Aufsatzes "Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease A Systematic Review and Meta-analysis" von Aaron S. Kesselheim, Alexander S. Misono, Joy L. Lee, Margaret R. Stedman, M. Alan Brookhart, Niteesh K. Choudhry und William H. Shrank.
Bernard Braun, 3.12.08
Höhere Zuzahlungen senken Einnahme essenzieller Medikamente vor allem bei sozial Schwachen
 In der Novemberausgabe des Journals Pharmacology and Drug Safety (Nr. 17 (11)) erschien ein weiterer interessanter Artikel zum Thema Zuzahlungen im Gesundheitswesen. Darin gehen die Autoren aus Perth, Sydney und Adelaide der Frage nach, welche Auswirkungen eine Erhöhung von Medikamentenzuzahlungen auf die Verschreibung und Einnahme von Arzneimitteln hat.
In der Novemberausgabe des Journals Pharmacology and Drug Safety (Nr. 17 (11)) erschien ein weiterer interessanter Artikel zum Thema Zuzahlungen im Gesundheitswesen. Darin gehen die Autoren aus Perth, Sydney und Adelaide der Frage nach, welche Auswirkungen eine Erhöhung von Medikamentenzuzahlungen auf die Verschreibung und Einnahme von Arzneimitteln hat.
Wie überall auf der Welt sind auch in Australien die Arzneimittelkosten beständig angestiegen. Diese Entwicklung stellt auch das dortige Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) vor finanzielle und Nachhaltigkeitsprobleme. Anfang 2005 schlug dieses nahezu universelle Versicherungsprogramm für Medikamente, das über 90 % der Verordnung in Down-under abwickelt, den üblichen Weg ein, um die Ausgabensteigerungen aufzufangen. Es verlagerte einen höheren Anteil der Kosten auf die PatientInnen und erhöhte im Januar 2005 die Selbstbeteiligungen um nahezu ein Viertel (24 %). Explizit stiegen die Medikamentenzuzahlungen für GeringverdienerInnen und RentnerInnen von 3,70 auf 4,60 australische Dollar (AUD) und für "normale" Versicherte von 23,10 auf 28,60 AUD; gleichzeitig hob PBS die Belastungsgrenze um gut 20 % an, nämlich für ärmere und ältere BürgerInnen von 197,60 auf 239,20 und für alle anderen Versicherten von 726,80 auf immerhin 874,90 AUD an.
Die nun veröffentlichte australische Studie erfasste die Auswirkungen erhöhter Zuzahlungen für insgesamt 17 Substanzklassen zur Behandlung sehr unterschiedlicher Erkrankungen, die einen Anteil von 3,2-10,9 % an den über PBS abgerechneten Verschreibungen ausmachen. Sie erfassten die Rezepteinlösungen vor und nach Erhöhung der Eigenbeteiligungen bei Antiepileptila, Medikamenten gegen Gicht Parkinson, Angst lösende und andere atypischen Antipsychotika, Beta-Blocker (eher beim Einsatz gegen Herzinsuffizienz als gegen Bluthochdruck), Asthmakombinationspräparate, Augentropfen, Glaukom- und Schlafmittel, Insulin, Muskelrelaxantien, Blutgerinnungshemmer außer Aspirin, Osteoporosemedikamente, Protonenpumpenhemmer, Statine und Schilddrüsenhormone.
Der Beobachtungszeitraum erstreckte sich auf nahezu sieben Jahre (Januar 2000 bis September 2007) und es erfolgte im Wesentlichen ein Vergleich des Verschreibungsvolumens vor und nach der Zuzahlungserhöhung im Januar 2005 an von Daten über die landesweit aggregierte monatliche Abgabemenge der oben genannten Arzneimittel. Derartige Zeitreihenvergleiche der Situation vor und nach einer gesundheitspolitischen Intervention eignen sich recht gut Anwendung zur Erfassung der Auswirkungen bestimmter Maßnahmen.
Bei 12 der 17 Medikamentenklassen waren bei älteren und ärmeren Versicherungen Rückgänge bei der Verschreibungshäufigkeit und dem monatlichen Verschreibungstrend zu beobachten. Keine Senkung war interessanterweise bei Psychopharmaka sowie bei Gichtmitteln und Beta-Blockern festzustellen, was die Autoren jedoch bei letzteren auf spezifische Bedingungen am australischen Markt zurückführen. Der stärkste Rückgang war zwar bei frei verkäuflichen Präparaten zu beobachten, aber auch bei essenziellen Medikamenten mit vielfach empirisch belegter Therapieevidenz gab es teilweise deutliche Rückgänge bei der Verschreibungstendenz und -häufigkeit. Diese Effekte waren anhaltend und zeigten eine deutliche soziale Diskriminierung, da sie bei Arnen und Alten wesentlich stärker ausgeprägt sind.
Die Zusammenfassung der AutorInnen Anna Hynd, Elizabeth E. Roughead, David Preen, John Glover, Max Bulsara und James Semmens widerlegt einmal mehr lange gehegte Mythen über Zuzahlungen im Gesundheitswesen: "The study findings suggest that the recent rise in Australian PBS co-payments and subsequent changes to the safety net have had a significant effect on dispensings of a range of discretionary and essential medicines. The impact of the co-payment increase varied by beneficiary group, with social security beneficiaries most impacted by increased pharmaceutical costs."
Kostenfrei ist nur das Abstract des Artikels The impact of co-payment increases on dispensings of government-subsidised medicines in Australia zugänglich.
Jens Holst, 28.11.08
"Trust in Medical Researcher": Warum auch randomisierte Studien Probleme mit dem Einschluss von Minderheiten-Patienten haben?
 Angesichts der oft nach sozialen, ethnischen oder rassischen Kriterien ungleich verteilten Gesundheitsrisiken oder auch ungleicher Behandlungschancen hängt die Aussagekraft oder auch die Machbarkeit evidenzbasierter wissenschaftlicher Studien über die Behandlung von Krankheiten erheblich von der ausreichenden Beteiligung von Patienten aus diesen Risikogruppen ab.
Angesichts der oft nach sozialen, ethnischen oder rassischen Kriterien ungleich verteilten Gesundheitsrisiken oder auch ungleicher Behandlungschancen hängt die Aussagekraft oder auch die Machbarkeit evidenzbasierter wissenschaftlicher Studien über die Behandlung von Krankheiten erheblich von der ausreichenden Beteiligung von Patienten aus diesen Risikogruppen ab.
Was dies bedeutet zeigten gerade zwei Anläufe im Rahmen des "NIH Exploratory Trial in Parkinson's Disease Network (NET-PD)" in den USA. In dieser Studie, die auf Stadt- und Regionsbasis durchgeführt werden sollte, waren 91 % der von den örtlichen ÄrztInnen geworbenen oder zugewiesenen TeilnehmerInnen weiße BürgerInnen, obwohl bekanntermaßen die Inzidenz und Prävalenz von Parkinson mindestens so häufig bei Afroamerikanern und Latinos aussieht wie bei ihren weißen MitbürgerInnen. Ergebnisse einer Studie mit dieser Zusammensetzung sind letztlich nutzlos oder nur sehr bedingt brauchbar.
Da hinter dieser völlig unrepräsentativen Zusammensetzung der Studienpopulation u.a. den Einfluss der jeweiligen örtlichen Ärzte vermutet wurde, starteten die ForscherInnen selber eine Studie, in der sie 200 Ärzte aus 1.250 Angeschriebenen (die Größe der Untersuchungsgruppe beruht auf Zeit- und Geldrestriktionen) in den Studienregionen der NET-PD im Jahre 2006 nach ihren Einstellungen und Überzeugungen über das Gewinnen und die Zuweisung von Patienten rassischer Minoritäten für klinische Studien fragten. Die Auswahl der Ärzte konzentrierte sich auf solche, die vorrangig in der Nähe von Gebieten mit einem Anteil von 40 % und mehr afrikanischer und hispanischer US-AmerikanerInnen praktizierten. Aus den Antworten auf 12 Fragen generierten die ForscherInnen einen so genannten "Trust in Medical Researchers Scale (TIMRS)". Mittels logistischer Regressionen identifizierten die ForscherInnen dann Charakteristika der Ärzte, die mit einem aktiven Gewinnen und Überweisen ihrer Patienten zu Studien assoziiert waren.
Zu den wesentlichen hemmenden und fördernden Faktoren dieses Verhaltens gehörten:
• Der TIMRS-Wert war unter afroamerikanischen Ärzten und bei Ärzten, die einen hohen Anteil von Minderheiten-Patienten betreuten, geringer. Hinsichtlich ihres tatsächlichen Verhaltens bei der Rekrutierung von Patienten unterschieden sich die Ärzte-Gruppen aber nicht.
• Die Wahrscheinlichkeit, einen Patienten für eine Studie zu motivieren oder ihn zuzuweisen hing stark davon ab, ob der Arzt bereits in der Vergangenheit hier engagiert war (Odds ratio=4,24) und bei einem hohen TIMRS-Wert (OR=1,06).
• Da offensichtlich Erfahrungen und Verhalten der Ärzte in der Vergangenheit ein großes Gewicht besaßen, auch heute Patienten für Studien gewinnen zu wollen und zu können, wurde eine Gruppe von Ärzte ohne solche Erfahrungen getrennt analysiert: Nur der TIMRS-Wert (OR=1,14) und ob der Arzt ein Internist (OR=4,59) war steuerten statistisch signifikant das Zuweisungsverhalten.
• Ärzte, die glaubten, Forschung wäre zu teuer, die Forschungsprotokolle seien zu persönlich oder die Angst davor hatten, unfähig zu sein, Patientenfragen zu beantworten, hatten einen niedrigeren TIMRS-Wert.
• Unerwartet hatten auch Hausärzte, Geriater und Neurologen, also Facharztgruppen, die an der Behandlung von Parkinsonpatienten maßgeblich beteilgt sind, relativ wenige Erfahrung mit der Teilnahme ihrer Patienten an einer Studie.
Trotz einiger methodischer und inhaltlicher Limits ihrer eigenen Studie, ist den Forschern zuzustimmen, wenn sie auf die hohe Bedeutung der Entwicklung einer Vertrauensbeziehung zwischen Forschern und örtlichen Ärzten für künftige community-Studien hinweisen.
Die komplette sechsseitige Version der Studie "Factors Influencing Physician Referrals of Patients to Clinical Trials" von Arch G. Mainous III, Daniel W. Smith, Mark E. Geesey und Barbara C. Tilley ist im "Journal of the National Medical Association" der USA am 11. November 2008 (Vol. 100: 1298-1303) erschienen und dort kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.11.08
Engagement von US-Ärzten, Medicaid-Patienten zu versorgen, hängt stark davon ab, wie hoch und schnell erhältlich das Honorar ist!
 Die Behandlung von Medicaid-Patienten, also von Personen mit geringem Einkommen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, die seit 1965 in den USA in einem speziellen, durch die Bundesregierung und die Bundestaaten halbparitätisch finanzierten öffentlichen Krankenversicherungsystem versichert sind, galt schon immer als nicht besonders attraktiv für Ärzte. Damit war bereits lange im Grundsatz unbestritten, dass Ärzte in den USA sich bei der Behandlung von behandlungsbedürftigen Patienten nicht ausschließlich nach dem Bedarf und der Bedürftigkeit der Patienten richten, sondern anders als im idealtypischen Verständnis ärztlicher Behandlungsethik auch u.a. finanzielle Kalküle eine mitentscheidende Rolle spielen.
Die Behandlung von Medicaid-Patienten, also von Personen mit geringem Einkommen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, die seit 1965 in den USA in einem speziellen, durch die Bundesregierung und die Bundestaaten halbparitätisch finanzierten öffentlichen Krankenversicherungsystem versichert sind, galt schon immer als nicht besonders attraktiv für Ärzte. Damit war bereits lange im Grundsatz unbestritten, dass Ärzte in den USA sich bei der Behandlung von behandlungsbedürftigen Patienten nicht ausschließlich nach dem Bedarf und der Bedürftigkeit der Patienten richten, sondern anders als im idealtypischen Verständnis ärztlicher Behandlungsethik auch u.a. finanzielle Kalküle eine mitentscheidende Rolle spielen.
Bisherige Untersuchungen zeigten daher auch bereits erhebliche Unterschiede der Bereitschaft, unterschiedlich lukrativ versicherte neue Patienten zu behandeln: Rund 50 % aller Ärzte waren dazu bei Medicaid-Versicherten bereit, über 70 % waren es bei Medicare- und privat Krankenversicherten. Ein Vergleich der Akzeptanzraten der Medicaid-Versicherten nach Bundestaaten (jeder Bundesstaat kann einen eigenen Betrag festlegen) zeigte außerdem, dass diese stark von der absoluten Höhe der Vergütung der Leistungen abhängen.
Die Ergebnisse einer gerade in der Zeitschrift "Health Affairs" (Health Affairs 28, no. 1 2009: 17-28. Online publiziert am 18. November 2008) veröffentlichten Studie des "Center for Studying Health System Change (HSC)" zeigten nun die große Bedeutung eines weiteren Faktors für die Akzeptanz von Patienten, nämlich der Zeit, die je nach Bundesstaat verstreicht, bis der Arzt sein Honorar für die Behandlung seiner Patienten erhält.
Die Studie beruht auf Daten aus dem "2004-05 Community Tracking Study (CTS) Physician Survey", der in sechzig zufällig ausgewählten repräsentativen Regionen in 21 Bundesstaaten ( u.a. New York, California, Texas, Florida, Illinois, Pennsylvania und Michigan) der USA durchgeführt wurde. Mit insgesamt 6.600 Primär- und Fachärzten dieser Regionen mit mindestens 20 Wochenstunden Patientenversorgung wurden Telefoninterviews durchgeführt, zu denen sich insgesamt 4.900 oder 52 % bereit erklärten.
Die Studie zeigt, dass Zahlungsverspätungen, welche die mit der Honorierung der für Medicaid-Versicherte erbrachten Leistungen beauftragte Athenahealth Inc. Zu verantworten hat, sogar Effekte einer höheren Bezahlung von Medicaid-Patienten eliminieren können, d.h. sich hemmend auf die Beteiligung von Ärzten an der Behandlung dieser Versichertengruppe auswirken. In der Zusammenfassung der Ergebnisse ihrer Studie weist einer der Autoren, Peter J. Cunningham, darauf wie folgt hin: "Medicaid payment rates matter, but the hassle factor also matters, and this study strongly suggests that higher Medicaid fees won't have the desired effect of increasing access if physicians have to wait months to get paid."
Zu den weiteren mit der Studie möglichen Einblicken in die Wirklichkeit der Versorgung von Medicaid-Versicherten gehören u.a.:
• Die durchschnittliche Wartezeit auf die Bezahlung für Medicaid-Behandlungen schwankte zwischen durchschnittlich und adjustierten 36,9 Tagen in Kansas und 114,6 Tagen in Pennsylvania.
• Die relative Höhe des Honorars für Medicaid-Behandlungen, als ein Prozentsatz des Honorars für die inhaltlich identische Behandlung eines Medicare-Versicherten, schwankt ebenfalls beträchtlich, und zwar von 36% in New York und 100% in North Carolina.
• Eine Aufteilung der Ärzte auf vier Typen von Medicaid-Honorierungssystemen (Ärzte mit hohen Honoraren, die schnell bezahlt werden, Ärzte mit hohen Honoraren, die aber langsam bezahlt werden, Ärzte mit niedrigen Honoraren aber schneller Bezahlung und Ärzten mit niedrigen Honoraren und langsamer Erstattung) erbrachte folgende Ergebnisse: 64% der Ärzte des ersten Typs akzeptierten neue Medicaid-Patienten ohne Zögern. Wenn dagegen hohe Honorare mit schlechter Zahlungsmoral gepaart auftraten sank der Prozentsatz der Ärzte, die bereit waren Medicaid-Versicherte zu behandeln, auf 50,9%. In Staaten, wo niedrige Honorare mit schneller Zahlung zusammen auftraten, waren 48,4% der Ärzte bereit Medicaid-Versicherte zu behandeln, in Staaten mit niedrigem Honorar und langsamer Überweisungsgeschwindigkeit sank der Anteil behandlungsgewillter Ärzte auf 43,2%. In Staaten mit niedrigem Honorarniveau spielt also scheinbar die Bezahlungsgeschwindigkeit nur noch eine relative geringere Rolle.
Wenn es auch in Deutschland keine derartigen Unterschiede zwischen Versichertengruppen gibt, entstehen in den letzten Jahren im Zusammenhang mit einzelnen Versicherten- oder Patientengruppen (z.B. DMP- und Hausarztpatienten) unterschiedliche hohe Verwaltungslasten für Ärzte und außerdem generelle Verzögerungen bei der Bezahlung von ärztlichen Leistungen bzw. der definitiven Kenntnis der Höhe des erzielten Einkommens. Löst man sich faktisch auch in Deutschland vom Ideal des allein am gesundheitlichen Wohl seiner Patienten interessierten Arzt, könnten diese Aufwendungen sehr schnell zu vergleichbaren Verweigerungs- oder Vermeidungsverhaltensweisen führen.
Von der Studie "Do Reimbursement Delays Discourage Medicaid Participation By Physicians? Simply raising fees might not be enough to entice physicians to take Medicaid patients, if they have to wait too long to receive payment for services rendered" von Peter J. Cunningham und Ann S. O'Malley gibt es ein Abstract und die 12-seitige Komplettversion kostenlos.
Bernard Braun, 19.11.08
Die Praxisgebühr beeinträchtigt Verhaltensspielräume chronisch Erkrankter im Gesundheitssystem - aber nur bei niedrigem Einkommen
 Ob die Einführung der Praxisgebühr tatsächlich eine Steuerungsfunktion im Gesundheitssystem innehatte, und zwar derart, dass "unnötige" Arztbesuche vermieden werden (wie auch immer man dies definiert), dafür gab es bislang widersprüchliche Hinweise. Eine neue Studie, die auf repräsentativen Befragungsdaten des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung basiert, hat nun aber zumindest belegt, dass chronisch erkrankte Patienten deutlich häufiger einen Arztbesuch zeitlich verschieben oder sogar gänzlich vermeiden, wenn ihr Einkommen sehr niedrig ist.
Ob die Einführung der Praxisgebühr tatsächlich eine Steuerungsfunktion im Gesundheitssystem innehatte, und zwar derart, dass "unnötige" Arztbesuche vermieden werden (wie auch immer man dies definiert), dafür gab es bislang widersprüchliche Hinweise. Eine neue Studie, die auf repräsentativen Befragungsdaten des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung basiert, hat nun aber zumindest belegt, dass chronisch erkrankte Patienten deutlich häufiger einen Arztbesuch zeitlich verschieben oder sogar gänzlich vermeiden, wenn ihr Einkommen sehr niedrig ist.
Dieser Befund widerlegt damit ältere Annahmen: Eine gemeinsame Untersuchung des Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung und der TU Berlin hatte für 2004 einen signifikanten Rückgang der Arztbesuche im Vergleich zum Vorjahr 2003 festgestellt und aufgrund der Berechnung von zwei Modellen gefolgert, dass gesundheitlich notwendige Arztbesuche unverändert erfolgt seien und es nicht zu sozialer Benachteiligung von Geringverdienern gekommen sei. (vgl.: Exportschlager Praxisgebühr?). Allerdings blieb diese Schlussfolgerung aufgrund der wenig fundierten empirischen Basis nicht unwidersprochen.
Die jetzt in der Open-Access-Zeitschrift "BMC Health Services Research" veröffentlichte Studie referiert zunächst den Forschungsstand und zeigt die wesentlichen Befunde auf, die unterschiedliche Befragungen zur Praxisgebühr erbracht haben, unter anderem eine Analyse des Sozio-ökonomischen Panel (vgl. Praxisgebühr - und kein bisschen weise) sowie Erhebungen des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WidO) (vgl. Das Arzt-Inanspruchnahmeverhalten nach Einführung der Praxisgebühr).
Sodann werden eigene Datenanalysen vorgestellt, die auf Repräsentativbefragungen des "Gesundheitsmonitor" in den Jahren 2004 bis 2006 basieren. Berücksichtigt wurden dabei Aussagen von insgesamt 7.769 Männern und Frauen im Alter von 18-79 Jahren. Zentrale abhängige Variable war dabei die Antwort auf die Frage, ob man im letzten Quartal einen Arztbesuch wegen der Praxisgebühr in Höhe von 10 Euro entweder aufgeschoben (z.B. das nahe Ende eines Quartals abgewartet habe) oder einen Arztbesuch vermieden (und sich statt dessen ohne ärztliche Hilfe auskuriert) habe.
Im Rahmen einer multivariaten Analyse, in der eine Vielzahl potentieller Einflussfaktoren kontrolliert wurde (unter anderem Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, gesundheitsbewusstes Alltagsverhalten, chronische Erkrankung, Haushaltseinkommen) zeigte sich dann:
• Jüngere Befragte und solche, die ihren Gesundheitszustand eher positiv bewerten, geben öfter an, einen Arztbesuch aufgeschoben oder vermieden zu haben. Die sogenannte Odds-Ratio (OR) hierfür beträgt 3,46. Das heißt: Unter 30jährige geben - im Vergleich zu Älteren - dreieinhalb mal so oft an, dass sie wegen der Praxisgebühr einen Arztbesuch verschoben oder darauf verzichtet haben.
• Betrachtet man Befragungsteilnehmer mit einer chronischen Erkrankung, dann wird eine Steuerungsfunktion der Praxisgebühr bei Personen mit sehr niedrigem Einkommen deutlich. Chronisch Erkrankte mit einem monatlichen Einkommen von unter 600 Euro geben etwa zweieinhalb mal (OR: 2,45) so oft an, wegen der 10 Euro Praxisgebühr einen Arztbesuch verschoben oder vermieden zu haben.
Die Studie kann zwar nicht eindeutig belegen, dass in dieser Gruppe durchweg gesundheitlich relevante Arztbesuche verhindert worden sind und es damit möglicherweise auch zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands gekommen ist oder zu einer Chronifizierung von Beschwerden. Sie macht jedoch zumindest deutlich, dass die Praxisgebühr die gesundheitliche Ungleichheit tendenziell verschärft, indem Verhaltensspielräume chronisch Erkrankter aus ärmeren Schichten deutlich beeinträchtigt werden, während dies bei wohlhabenderen Patienten nicht der Fall ist.
Hier findet man ein Abstract und auch den Volltext der Studie: Ina-Maria Rückert, Jan Böcken, Andreas Mielck: Are German patients burdened by the practice charge for physician visits ('Praxisgebuehr')? A cross sectional analysis of socio-economic and health related factors (BMC Health Services Research 2008, 8:232; doi: 10.1186 / 1472-6963-8-232).
Eine deutschsprachige Zusammenfassung der Studienergebnisse veröffentlichte Anfang 2009 auch das Deutsche Ärzteblatt sowie die Frankfurter Rundschau.
Gerd Marstedt, 15.11.08
Keine oder nur geringe Wirkung von Warnungen vor der Verschreibung gefährlicher Arzneimittel für Ältere und und Jugendliche
 Zum Standardrepertoire vieler Arzneimittelzulassungsbehörden oder ärztlicher wie medizinischer Einrichtungen, die sich mit den möglichen unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln beschäftigen, gehören eindeutige und nicht selten auch mehrfache schriftliche Warnungen aller oder großer Teile der Ärzte.
Zum Standardrepertoire vieler Arzneimittelzulassungsbehörden oder ärztlicher wie medizinischer Einrichtungen, die sich mit den möglichen unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln beschäftigen, gehören eindeutige und nicht selten auch mehrfache schriftliche Warnungen aller oder großer Teile der Ärzte.
Ähnlich wie bei anderen Versuchen, die Qualität der gesundheitlichen Versorgung durch evidenzbasierte Leitlinien oder Behandlungsstandards zu beeinflussen oder gar zu steuern, stellt sich auch hier die Frage nach der Wirksamkeit derartiger Fachinformationen. Zu den Schwierigkeiten und der häufigen relativen Erfolglosigkeit der kurzfristigen Behandlungssteuerung und Qualitätssicherung durch Leitlinien gibt es bereits ausreichende gesicherte empirische Belege.
Ob und wie Arzneimittelwarnungen die Anzahl der Verordnungen des Medikaments nachhhaltig beeinflussen dessen Verschreibung im Lichte meist aktueller wissenschaftlich gesicherter Forschungsergebnisse gefährlich, unwirksam oder obsolet erscheint, ist dagegen weniger bekannt.
Daran etwas geändert hat nun eine aktuell durchgeführte Untersuchungen im kanadischen Gesundheitswesen: Es ging um den Effekt dreier Warnung vor der Verordnung von konventionellen und atypischen antipsychotischen Arzneimitteln zur Behandlung von Verhaltensunruhen bei dementen Patienten. Abgesehen von einem nachwievor fehlenden seriösen Nachweis der Wirksamkeit dieser Medikamente für diese Indikation ist seit kurzem aber gesichert, dass diese Behandlung ein signifikant erhöhtes Sterberisiko in sich birgt.
Bevor dies bekannt wurde und vor der ersten Warnung an alle kanadischen Ärzte, diese Medikamente für derartig Erkrankte zu verordnen, stieg die Verordnungshäufigkeit für die zur Behandlung von Demenz genutzten Antipsychotika stark und trug maßgeblich zum Anstieg des Gesamtvolumens verordneter Antipsychotika bei.
Die dafür zuständige staatliche Einrichtung "Health Canada" informierte alle Ärzte in Kanada über die mit der Verordnung von Risperidone, Olanzapine oder Quetiapine für ältere demente Personen verbundenen Risiken am 11. Oktober 2002, am 10. März 2004 und am 22. Juni 2005.
Die VersorgungsforscherInnen untersuchten nun auf der Basis von Routinedaten zur Medikamentenverordnung aus der Provinz Ontario und mittels einer Zeitreihenanalyse im Zeitraum zwischen dem 1. Mai 2000 und dem 28. Februar 2007 die Häufigkeit der Verordnungen vor und nach den drei Warnungen.
Die Ergebnisse sind eindeutig und offenbaren ein fundamentales Versagen der Form der Warnhinweise. Dies stützt sich auf folgende Ergebnisse:
• Jede Warnung zog lediglich eine leichte Abnahme des geschätzten Wachstums der Verordnungshäufigkeit der Antipsychotika nach sich: eine 5 %-Abnahme nach der ersten, eine 4,9 %-Abnahme nach der zweiten und nur noch eine 3,2 %ige Abnahme nach der dritten Warnung (p< 0,05). Zu keinem Zeitpunkt wurde dadurch das bereits erreichte Niveau der Verordnungshäufigkeit unterschritten.
• Die gesamte Verordnungsrate antipsychotischer Medikamente für an Demenz leidenden Personen stieg daher von 1.512 Verordnungen pro 100.000 ältere Patienten im September 2002, also dem Monat vor der ersten Warnung, auf 1.813 Verordnungen pro 100.000 im Februar 2007, also 20 Monate nach der letzten Warnung.
Um die Arzneimittelsicherheit auch nach der Zulassung von Medikamenten gewährleisten zu können, sind nach Ansicht der kanadischen ForscherInnen wesentlich wirksamere und auch komplexere Interventionen notwendig.
Einige andere Studien, die in der Studie von Valiyeva et al. genannt sind, bestätigen die aktuellen Erkenntnisse entweder vollständig oder zum großen Teil:
• Eine kürzlich ebenfalls an alle kanadischen Ärzte versandte Warnung vor der Verordnung von Antidepressiva für Kinder und Heranwachsende hatte zwar den erwünschten Effekt, senkte aber zusätzlich die Verordnungshäufigkeit für andere Altersgruppen wie etwa die der jungen Erwachsenen, die möglicherweise von dieser Verordnung profitieren könnten. Die Studie "Effect of regulatory warnings on antidepressant prescription rates, use of health services and outcomes among children, adolescents and young adults" von Laurence Y. Katz, Anita L. Kozyrskyj, Heather J. Prior, Murray W. Enns, Brian J. Cox und Jitender Sareen (CMAJ. 2008 April 8; 178(8): 1005-1011) kommt daher auch zu einer eher zwiespältigen Schlussfolgerung: "Health advisories and warnings issued by regulatory bodies may have unintended consequences on the provision of care, delivery of health services and clinical outcomes. Further efforts are required to ensure that health warnings do not result in unexpected harm."
• Andere Studien zur Wirkung von Warnungen vor der Verordnung anderer Arzneimittel wie etwa über den "Impact of mailed warning to prescribers on the co-prescription of tramadol and antidepressants" von Deborah Shatin, Jacqueline S. Gardner, Andy Stergachis, David Blough und David Graham (veröffentlicht 2005 in der Zeitschrift "Pharmacoepidemiology and Drug Safety" [Volume 14 Issue 3: 149-154]) oder die Studie "Contraindicated Use of Cisapride Impact of Food and Drug Administration Regulatory Action von Walter Smalley, Deborah Shatin, Diane K. Wysowski, Jerry Gurwitz, Susan E. Andrade, Michael Goodman, K. Arnold Chan, Richard Platt, Stephanie D. Schech und Wayne A. Ray (JAMA 2000; 284: 3036-3039) haben ebenfalls lediglich geringe oder gar keine Effekte der etablierten Warnverfahren nachgewiesen
Auch wenn in den älteren Studien schon betont wurde, es bedürfe künftig anderer Methoden der Warnung und Information, finden sich in der aktuellen Studie mehr oder weniger ähnlich allgemeine Ideen hierfür: So wird empfohlen, den Ärzten statt der Angaben über absolute und relative Risiken Berechnungen über die "number needed to harm" mitzuteilen. Außerdem sollten Warnungen möglichst auch Angaben zu praktischen Alternativen und deren gesicherte Wirksamkeit und Sicherheit enthalten. Dies müsse auch Hinweise auf nichtpharmakologische Interventionen einschließen. Der Vorschlag, mehr Evaluationen und prospektive Überlegungen über Aktivitäten im Falle der Nichtbeachtung solcher Warnungen durchzuführen, runden den anspruchsvollen Katalog ab.
Ähnliche und einige zusätzliche praktischen Überlegungen enthält auch noch der Kommentar "Concerns about health care warnings and their impact on prescribing behavior" von Laurence Y. Katz zu dem Aufsatz von Valiyeva et al. in derselben Ausgabe des kanadischen Fachjournals (CMAJ 26. August 2008: 179 (5).
Die neun Druckseiten umfassende Studie "Effect of regulatory warnings on antipsychotic prescription rates among elderly patients with dementia: a population-based time-series analysis" von Elmira Valiyeva, Nathan Herrmann, Paula A. Rochon, Sudeep S. Gill, und Geoffrey M. Anderson (CMAJ 2008;179 438-446) ist wie fast alle anderen hier zitierten Texte als PDF-Datei kostenlos zu erhalten.
Bernard Braun, 27.8.2008
Krankenversicherungs- Verträge mit hoher Selbstbeteiligung bewirken kein größeres Kostenbewusstsein, wohl aber Gesundheitsrisiken
 Versicherte in den USA, die über ihren Betrieb eine Krankenversicherung mit hoher Selbstbeteiligung abgeschlossen haben, zeigten im Rahmen einer jetzt veröffentlichten Studie, dass sie bestimmte Medikamente, und zwar solche zur Senkung von Blutdruck oder Blutfetten, sehr viel eher absetzen als andere Versicherte ohne solche Selbstbeteiligung. Darüber hinaus ergab die Studie, dass die Intention der Selbstbeteiligungs-Tarife, nämlich ein marktorientiertes und preisbewusstes Verhalten zu stärken, ganz und gar nicht erreicht wird. Die Teilnehmer hätten durch einen Umstieg auf Generika bei den verschriebenen Arzneimitteln sehr viel Geld sparen können - tatsächlich geschah dies jedoch kaum einmal.
Versicherte in den USA, die über ihren Betrieb eine Krankenversicherung mit hoher Selbstbeteiligung abgeschlossen haben, zeigten im Rahmen einer jetzt veröffentlichten Studie, dass sie bestimmte Medikamente, und zwar solche zur Senkung von Blutdruck oder Blutfetten, sehr viel eher absetzen als andere Versicherte ohne solche Selbstbeteiligung. Darüber hinaus ergab die Studie, dass die Intention der Selbstbeteiligungs-Tarife, nämlich ein marktorientiertes und preisbewusstes Verhalten zu stärken, ganz und gar nicht erreicht wird. Die Teilnehmer hätten durch einen Umstieg auf Generika bei den verschriebenen Arzneimitteln sehr viel Geld sparen können - tatsächlich geschah dies jedoch kaum einmal.
Betriebe in den USA bieten ihren Beschäftigten in letzter Zeit immer häufiger Krankenversicherungen, bei denen ein Teil der anfallenden Kosten für Ärzte, Kliniken oder Arzneimittel bis zu einer Höchstgrenze (Selbstbehalt) selbst bezahlt werden muss. Man erhofft sich von solchen Verträgen ein preisbewussteres Verhalten und damit auch Einsparungen in der Versorgung. Der Patient soll auch medizinische Leistungen bewusster konsumieren und auf Überflüssiges verzichten. Zwar hatte das RAND Krankenversicherungs-Experiment gezeigt, dass bei höheren Selbstbeteiligungsgrenzen Versicherte auf viele medizinische Versorgungsleistungen verzichten, leider aber auch auf solche, die zur Krankheitsbehandlung unverzichtbar sind. (vgl. hierzu die Zeitschrift Health Services Research, Volume 39 Issue 4p2 mit vielen Aufsätzen).
In einer neuen Studie mit über 6.000 Versicherten ist nun eine amerikanische Forschungsgruppe mehreren Fragestellungen nachgegangen. Sie wollten wissen, ob unterschiedliche Selbstbeteiligungs-Tarife einen Einfluss haben auf die Therapietreue ("Adherence", also die Einnahme von Medikamenten so wie vom Arzt verordnet), auf das eigenständige und mit dem Arzt nicht abgesprochene Absetzen von Medikamenten und auf ein preisbewussteres Verhalten durch einen Umstieg auf preisgünstigere Generika.
In der Studie berücksichtigt war ein Tarif mit hoher Selbstbeteiligung (3.000 $, 1.500 $ zahlte der Arbeitgeber ein), mit mittlerer (2.000 $, ebenfalls 1.500 $ Einzahlung durch den Arbeitgeber) sowie ein sog. "Three-tier copay "-Tarif, der Zuzahlungen für Medikamente abdeckte. Insgesamt wurde für fünf verschiedene Medikamente die Therapietreue, das eigenständige Absetzen und der Umstieg auf Generika untersucht: Antihypertonika (zur Blutdrucksenkung), Medikamente zur Lipidsenkung im Blut, Antidepressiva, sog. Asthma-Controller (Entzündungshemmer für die Atemwege) und Ulkustherapeutika (gegen Magen- oder Darmgeschwüre).
Herangezogen wurden dabei nicht Aussagen der Versicherten, sondern Unterlagen der Krankenversicherung. Alls Ergebnis zeigte sich dann:
• Für das mit den Selbstbeteiligungs-Regelungen verbundene Ziel, ein größeres Preisbewusstsein bei Arzneimittel-Konsumenten herzustellen, fanden sich keinerlei Hinweise. Der Gebrauch von preisgünstigen Generika anstelle der vom Arzt verschriebenen Original-Produkte war völlig unabhängig vom Versicherungs-Tarif.
• Bei hoher Selbstbeteiligung neigen Versicherte sehr stark dazu, unspezifisch wirksame Medikamente abzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Blutdruck- oder Lipidsenker nach etwa einem halben Jahr nicht mehr gekauft und eingenommen werden, steigt bei hoher Selbstbeteiligung etwa auf das 2-3fache - dies zeigt eine multivariate Analyse, in der auch viele andere Faktoren (Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Erkrankungen usw.) mitberücksichtigt wurden.
• Für spezifisch wirksame Medikamente hingegen (Antidepressiva, Asthma-Controller, Ulkustherapeutika) zeigt sich dieser Zusammenhang nicht.
• Bei denjenigen Versicherten, die ihre Medikamente nicht nach einem halben Jahr absetzen, sondern weiter einnehmen, zeigt sich eine recht hohe "Adherence", ganz unabhängig vom Versicherungstarif.
Die Wissenschaftler fassen ihre Ergebnisse so zusammen, dass sie keinerlei Hinweise gefunden haben, dass Consumer Directed Health Care mit Selbstbeteiligungsregelungen nun zu einem größeren kostenbewussteren Verhalten hinsichtlich medizinischer Leistungen führt. Auf der anderen Seite finden sich jedoch Belege für Effekte, die gesundheitlich überaus problematisch sind. Durch das Absetzen verordneter Medikamente kommt es, wie andere Studien gezeigt haben, langfristig zu Verschlechterungen im Gesundheitszustand und auch höheren Therapiekosten.
Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: Jessica Greene u.a.: The Impact Of Consumer-Directed Health Plans On Prescription Drug Use (Health Affairs 27, no. 4 (2008): 1111-1119)
Gerd Marstedt, 9.7.2008
Bundesgerichthof zu Grenzen der Freiheit der ärztlichen Befunderhebung und der Würdigung von Fakten in medizinischen "Gut"achten
 Höchste deutsche Bundesgerichte, in diesem Fall der Bundesgerichtshof (BGH), können im Streit- oder gar Schadensfall auch auf Mindesterfordernisse ärztlichen Handeln und medizinischen Gutachtens hinweisen oder dringen.
Höchste deutsche Bundesgerichte, in diesem Fall der Bundesgerichtshof (BGH), können im Streit- oder gar Schadensfall auch auf Mindesterfordernisse ärztlichen Handeln und medizinischen Gutachtens hinweisen oder dringen.
In einem am 16. Oktober 2007 veröffentlichten Urteil (VI ZR 229/06) formulierte der BGH in einem bereits durch alle Vorinstanzen zu Ungunsten eines klagenden Patienten geführten Verfahren folgenden Urteils-Leitsatz: "Ein Arzt im vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst kann bei differentialdiagnostischen Anzeichen für eine coronare Herzerkrankung (hier: einen akuten Herzinfarkt) zur Befunderhebung (Ausschlussdiagnostik) und damit zur Einweisung des Patienten in ein Krankenhaus verpflichtet sein." Damit verwies er das Verfahren erneut zu einer anderen Entscheidung als der bisherigen an das Berufungsgericht, das Oberlandesgericht (OLG) München, zurück.
Im bis vor den BGH getragenen Rechtsstreit ging es um das Verhalten eines Arztes im Notfalldienst gegenüber einem Patienten, der 1996 an einer Vielzahl von massiven Symptomen für einen Herzinfarkt litt (Durchfall, Erbrechen, Schwindel und Übelkeit, sehr hoher Blutdruck sowie Schmerzen im Brustbereich. Die Ehefrau des Klägers wies den Beklagten außerdem darauf hin, dass in der Familie des Klägers eine Herzinfarktgefährdung bestehe)und trotzdem wegen der Diagnose eines grippalen Infekts sowie eines Durchfallleidens u.a. nur mit Schmerzmitteln behandelt wurde, die er gleich mehrmals erbrach. Vom Arzt unwidersprochen blieb der so leidende Patient lieber im häuslichen Bett und ging nicht ins Krankenhaus.
Als der Patient schließlich leblos von einer Angehörigen gefunden wurde und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte er eindeutig einen Hinterwandinfarkt erlitten. Als eine Folge des Infarkts leidet der überlebende Patient seitdem an einem Hirnschaden, der ihn erheblich behindert.
Die weiteren Schritte des Klägers/Patienten fasst der BGH in seinem Urteil so zusammen: "Der Kläger ist der Ansicht, der Beklagte habe die Möglichkeit eines Herzinfarkts abklären müssen. Dann wäre der Infarkt vermieden worden und der Hirnschaden nicht eingetreten oder deutlich geringer ausgefallen. Der Kläger verlangt vom Beklagten über den von dessen Haftpflichtversicherung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bezahlten Betrag von 60.000 DM hinaus ein weiteres angemessenes Schmerzensgeld von mindestens 122.710,05 €, Verdienstausfall für Vergangenheit und Zukunft bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres (der Kläger war 1996 34 Jahre alt) sowie die Feststellung der Ersatzverpflichtung des Klägers für sämtliche weiteren materiellen und immateriellen Schäden, die aufgrund der fehlerhaften Behandlung entstanden seien." Diese Klage wurde in den Vorinstanzen auf der Basis diverser medizinischer Gutachten abgelehnt.
Der BGH kassierte diese Urteile u.a. mit folgenden Feststellungen:
• "Diese Gutachten berücksichtigten Symptome, die der Kläger am 6. März 1996 nach seinem Prozessvortrag aufwies, nicht erkennbar in der erforderlichen Weise." Dabei handelt es sich um die Nichtbeachtung oder -würdigung der Tatsache, der Kläger sei "schweißgebadet gewesen und habe unter Schwindel gelitten, über starke Schmerzen im Nacken- und Brustbereich sowie darüber geklagt, dass er fast keine Luft bekomme. Sie berücksichtigen die Schwindelgefühle und die Atemnot des Klägers nicht in nachvollziehbarer Weise."
• In einem der ärztlichen Gutachten drückt sich der Gutachter auch darum herum zu würdigen, ob es sich bei diesen Symptomen um Anzeichen eines Infarkts handelt oder nicht - etwas was mittlerweile jeder Laienbroschüre zur Erkennung eines Herzinfarkts zu entnehmen ist.
• Da das OLG dieser Art von "Gut"achten gefolgt ist, hebt der BGH das Urteil auf und verweist den Fall unter Beachtung der folgenden Punkte zurück an das OLG: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Berufungsgericht bei der gebotenen Berücksichtigung der Angaben der Ehefrau des Klägers durch die Sachverständigen zu einer anderen Beurteilung des Falles gekommen wäre. Insbesondere kann die Kausalität der Behandlung für den Schaden des Klägers nach den derzeitigen Feststellungen nicht verneint werden. Hätte der Beklagte die differentialdiagnostische Möglichkeit eines akuten Herzinfarkts als naheliegend berücksichtigen müssen, hätte er sie entweder selbst ausschließen oder den Kläger umgehend in ein Krankenhaus einweisen müssen, damit die für einen Ausschluss erforderlichen Befunde erhoben worden wären. Dann wären möglicherweise der Eintritt eines Herz- und Kreislaufstillstands oder doch die Folge einer hypoxischen Schädigung bei der zu unterstellenden ordnungsgemäßen Behandlung vermieden worden."
• Auch der listenreiche Versuch des beklagten Arztes und des ihm darin folgenden Berufungsgerichts, dem klagenden Patienten das "Argument" und die Beweislast dafür zuzuschieben, der gesundheitliche Schaden wäre auch bei einer pflichtgemäßen Einweisung des Patienten ins Krankenhaus eingetreten und insofern hätte das konkrete Verhalten des Arztes keinen zusätzlichen Nachteil erbracht, weist der BGH entschieden zurück: "Das Berufungsgericht wird ferner seine Ansicht überprüfen können, der Kläger sei beweisbelastet dafür, dass der Hirnschaden durch einen dringlichen Rat des Beklagten, eine Abklärung im Krankenhaus zu suchen, habe verhindert werden können. Ist Primärschädigung der behauptete Schaden in seiner konkreten Ausprägung und damit hier der Herz- und Kreislaufstillstand, ist für die behaupteten Folgen des Stillstands das Beweismaß des § 287 Abs. 1 ZPO ausreichend. Soweit das Berufungsgericht dem Kläger die Beweislast auferlegt dafür, dass die Schädigung in gleicher Weise bei pflichtgemäßem Verhalten des Beklagten erfolgt wäre, begegnet das rechtlichen Bedenken. In einem Fall rechtmäßigen Alternativverhaltens muss der Arzt beweisen, dass der gleiche Schaden auch bei rechtmäßigem Vorgehen eingetreten wäre."
Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist komplett über die Homepage des BGH kostenlos erhältlich. Da dasselbe Urteil auf den Urteilsseiten einiger Anbieter nur kostenpflichtig erhältlich ist, sei hier empfohlen, in jedem Fall bei der Suche nach Urteilen und deren Begründungen auf den Homepages der verschiedenen höchsten Bundesgerichte nach einer kostenlosen Textversion zu suchen. In den meisten Fällen wird man hier fündig.
Bernard Braun, 20.6.2008
Praxisgebühr - und kein bisschen weise
 Eine weitere, diesmal englischsprachige Studie zur Praxisgebühr in Deutschland liegt seit kurzem vor. Jonas Schreyögg vom Fachbereich Gesundheitsmanagement der TU Berlin und Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin publizierten in Copayments for Ambulatory Care in Germany: A Natural Experiment Using a Difference-in-Difference Approach die Ergebnisse ihrer Auswertung von Daten des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP), einer repräsentativen Längsschnittsbefragung von rund 22.000 in Privathaushalten lebenden Personen über 16 Jahre.
Eine weitere, diesmal englischsprachige Studie zur Praxisgebühr in Deutschland liegt seit kurzem vor. Jonas Schreyögg vom Fachbereich Gesundheitsmanagement der TU Berlin und Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin publizierten in Copayments for Ambulatory Care in Germany: A Natural Experiment Using a Difference-in-Difference Approach die Ergebnisse ihrer Auswertung von Daten des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP), einer repräsentativen Längsschnittsbefragung von rund 22.000 in Privathaushalten lebenden Personen über 16 Jahre.
Dabei nehmen die Autoren einen Zeitreihenvergleich vorher-nachher (difference-in-difference) der Arztbesuche vor (2000-2003) und nach Einführung der Praxisgebühr (2005-2005) vor. Insbesondere erheben sie Vergleichsdaten zwischen GKV-Mitgliedern, auf die sich die Einführung der Praxisgebühr beschränkte, und PKV-Versicherten, die davon gar nicht betroffen waren und sind. Zusätzlich vergleichen sie die Zahl der Arztbesuche zwischen chronisch kranken und von armen GKV-Mitgliedern sowie insbesondere von SozialhilfeempfängerInnen mit denen der PKV-Versicherten. Dabei kontrollieren die Autoren die verschiedenen Indikatoren unter anderem an Hand der subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustands. Die Autoren räumen mögliche Ungenauigkeiten bei der Erfassung der Personen mit chronischen Erkrankungen an Hand des SOEP ein, beschreiben aber nicht, wie sie andere Quellen für Bias abschätzen, beispielsweise die Beobachtung, dass Angehörige unterer sozioökonomischer Schichten ihre Gesundheit tendenziell schlechter einschätzen als besser Gestellte.
In der Tat gehört Deutschland zu den Spitzenreitern bei der Zahl der Arztkontakte, wobei allerdings die Kosten für ambulante Versorgungsleistungen im internationalen Vergleich nicht sonderlich hoch sind. Dies zeigt die Auswertung von Datensätzen einer großen deutschen Ersatzkasse, die im Übrigen kostenfrei zugänglich im Internet zur Verfügung stehen: GEK-Report zur ambulaten Versorgung 2007 einschließlich des statistischen Anhangs.
Die Autoren der DIW-TU-Studie sehen die wahrscheinlichste Ursache im berühmten Mitnahmeverhalten der Versicherten, das für öffentliche Systeme typisch sei. Auf Anbieterseite mögen sie keine Gründe für die vergleichsweise hohe Zahl der Arztkontakte sehen. Doch ist die Interpretation des Inanspruchnahmeverhaltens als ausschließliche Sache der Nachfrager ebenso in der gesundheitsökonomischen Theorie verbreitet wie unbewiesen und unwahrscheinlich. Schließlich pflegt ein deutscher Hausarzt kranke PatientInnen damit zu verabschieden, sie mögen in zwei Tagen wiederkommen, während britische General Practitioners eher empfehlen, in einer Woche wiederzukommen, wenn es nicht besser geworden sei. Doch wenn man derartige Betrachtungen einbezieht, verliert der Ansatz nachfrageseitiger Steuerung durch Zuzahlungen natürlich viel an Bedeutung.
Allerdings ist in den letzten mehr als zehn Jahren ohnehin ein kontinuierlicher Rückgang der Zahl der Arztbesuche in Deutschland zu beobachten. Die Einführung der Praxisgebühr scheint keinen erkennbaren Einfluss auf diese Entwicklung gehabt zu haben. Zwar gab es, wie die Analyse der Daten des SOEP zeigt, unmittelbar nach der Einführung der Praxisgebühr zum Jahresanfang 2004 einen deutlichen Rückgang der Zahl der Praxisbesuche, aber dabei sind zwei Phänomene besonders erwähnenswert: Dieser Effekt war nur von sehr kurzer Dauer und er war bei GKV-Mitglieder gleichermaßen zu beobachten wie bei PKV-Versicherten, für die überhaupt keine Praxisgebühr anfiel. Die kurzfristige Wirkung der Praxisgebühr ist, wie die Autoren nicht diskutieren, sicherlich auf eine Mischung aus allgemeiner Verunsicherung sowie der Vorwegnahme und Verschiebung von Praxisbesuchen zurückzuführen und im Übrigen typisch für die Einführung neuer Zuzahlungsregelungen.
Die Erklärung des gleichsinnigen Effekte auf betroffene GKV- und nicht betroffene PKV-Versicherte mit der starken Debatte und medialen Präsenz und Verunsicherung der BürgerInnen mag eine Rolle gespielt haben. Gänzlich unerwähnt lassen die Autoren indes mögliche und wahrscheinliche andere Faktoren und insbesondere mögliche Einflüsse von Seiten der Anbieter. So weisen Hartmut Reiners und Melanie Schnee in ihrer Analyse für die Bertelsmann-Stiftung Hat die Praxisgebühr eine nachhaltige Steuerungswirkung?, Gesundheitsmonitor 2007, S.133-154 (leider nicht online zugänglich) auf wahrscheinliche Überlappungseffekte durch die ein Jahr nach Einführung der Praxisgebühr geänderten Budgetregelungen und der Honorierungsverteilung für die niedergelassenen Kassenärzte hin. Wenn man über den engen Tellerrand der nachfrageseitigen Steuerung hinausschaut, ergeben sich bisweilen interessante Zusammenhänge. Dass derartige Überlegungen keine Erwähnung finden, mag in der Logik der ökonomischen Zuzahlungstheorie konsequent erscheinen, offenbart aber zugleich grundlegende Schwächen dieses Ansatzes.
Abgesehen von einer generell niedrigeren Inanspruchnahmerate von privat versicherten BundesbürgerInnen, die man zwanglos mit dem durchschnittlich besseren Einkommen und Gesundheitszustand dieser Bevölkerungsgruppe erklären kann, ergaben alle weiteren Vergleiche zwischen verschiedenen Untergruppen keine signifikanten und nach Berechnungsart differierende Ergebnisse. Insgesamt zeigt die Auswertung der SOEP-Daten aber einen tendenziell stärkeren Rückgang der Praxisbesuche bei unteren Einkommensgruppen und bei chronisch Kranken im Vergleich zur Gesamtpopulation der GKV- und PKV-Versicherten.
Die Autoren fassen ihre Untersuchungsergebnisse folgendermaßen zusammen: "... we did not observe a deterrent effect among vulnerable individuals. Thus, the copayment has failed to reduce the demand for physician visits. It is likely that this result is due to the design of the copayment scheme, as the copayment is low and is paid only for the first physician visit per quarter." Eine mögliche Erklärung für ihre Ergebnisse sehen die Autoren im Sinne ihres nachfragefokussierten Ansatzes im Design der Praxisgebühr, das jeden weiteren Arztbesuch nach einmaligem Kontakt kostenfrei macht. Gängige Forderungen zielen denn auch wahlweise auf eine Erhöhung vermeintlich zu niedriger Zuzahlungsbeträge oder die Einführung von Selbstbeteiligungen für jede Leistung bzw. jeden Arztbesuch ab.
Dieser Ansatz bringt den Aufenthalt in meist vollen Wartezimmern und alle Dienste von Ärzten in die Nähe von Konsumgütern und Vergnügen, die jedermann/frau auszunutzen neigt, wenn sie preiswert oder gar umsonst zu haben sind. Außerdem finden andere Untersuchungen wie die bereits erwähnte Analyse der Bertelsmann-Stiftung keine Belege für derartige Mitnahmeeffekte. Viel wahrscheinlicher ist, dass der nur kurzfristige Effekt der Praxisgebühr in Deutschland die vielfach reproduzierte internationale Erfahrung bestätigt, dass Zuzahlungswirkungen immer von kurzer Dauer sind.
Unerwähnt bleibt auch, dass die Datenerhebung im Rahmen des SOEP Informationen über nicht in privaten Haushalten lebende Personen ausblendet. Insbesondere erfasst sie weder Angaben über die Lage von Menschen in Pflegeeinrichtungen noch über die nicht unerhebliche Zahl von Obdachlosen in Deutschland. Beide gehören zweifellos zu den vulnerablesten Bevölkerungsgruppen, und insbesondere die Probleme von Heiminsassen nach Einführung der Praxisgebühr bei gleichzeitiger Erhöhung anderer Zuzahlungen zeigten zumindest in der Anfangsphase erhebliche Verwerfungen. Allerdings erfasst bisher keine Zuzahlungsstudie aus Deutschland die Auswirkungen auf solche Randgruppen.
Als "Einschränkungen" (sic!) ihrer Studie benennen die Autoren lediglich die Schwierigkeit, die Auswirkungen des zeitgleich mit der Praxisgebühr erfolgten Ausschlusses von etlichen frei verkäuflichen Arzneimitteln aus dem GKV-Leistungskatalog. Auf die genannten anbieterseitigen oder andere mögliche Ursachen gehen sie überhaupt nicht ein. Aber gänzlich unbeirrt von den genannten und ungenannten Einschränkungen ihrer Studie leiten sie einmal mehr "wichtige politische Konsequenzen für Entscheidungsträger in Deutschland und anderen Ländern" ab. Wolle man dem "Moral-Hazard-Verhalten wirksam begegnen, brauchte es eine Praxisgebühr für jeden Arztbesuch nach us-amerikanischem Vorbild. Beachtenswert ist der weitere Vorschlag, Präventionsprogramme aufzulegen, die insbesondere bei vulnerablen Gruppen die Wahrscheinlichkeit von Arztbesuche senken. Offenbar ist den Autoren entgangen, dass gerade in den USA die Zweifel an Kosten senkenden Effekten der Prävention durch empirische Untersuchungen untermauert sind, jüngst nachzulesen im New England Journal of Medicine. Dabei ist der lesenswerte Artikel Does Preventive Care Save Money? kosten- und anmeldungsfrei als Volltext zugänglich.
Hier können Sie kostenlos die englischsprachige Studie über Auswirkungen der Praxisgebühr vom DIW und der TU Berlin herunterladen: Copayments for Ambulatory Care in Germany: A Natural Experiment Using a Difference-in-Difference Approach
Jens Holst, 7.6.2008
Effizienzsteigerung durch Arzneimittelzuzahlungen? Ein gängiger Mythos geht baden
 Zuzahlungen im Gesundheitswesen gehören nicht nur zu den Dauerbrennern von Gesundheitsreformen in allen Ländern mit umfassender sozialer Sicherung. Ihr Anteil an der Gesundheitsfinanzierung nimmt auch in allen Industrieländern kontinuierlich zu. Der Griff in das eigene Portemonnaie, so lautet die übliche Begründung, soll die BürgerInnen zu einer "vernünftigeren" Inanspruchnahme medizinischer Leistungen bewegen und somit ungerechtfertigter Nutzung entgegenwirken. Nach ökonomischer Theorie sollen Selbstbeteiligungen ein geeignetes Mittel sein, die Fehlnutzung durch die BürgerInnen einzuschränken, die typischerweise alles in Anspruch nehmen möchten, was es umsonst gibt - zumindest nach vorheriger Zahlung der Krankenkassenbeiträge. Somit führten Zuzahlungen im Krankheitsfall zu einer sinnvollen Steuerung im Gesundheitswesen und vor allem zur Effizienzsteigerung und Kostendämpfung.
Zuzahlungen im Gesundheitswesen gehören nicht nur zu den Dauerbrennern von Gesundheitsreformen in allen Ländern mit umfassender sozialer Sicherung. Ihr Anteil an der Gesundheitsfinanzierung nimmt auch in allen Industrieländern kontinuierlich zu. Der Griff in das eigene Portemonnaie, so lautet die übliche Begründung, soll die BürgerInnen zu einer "vernünftigeren" Inanspruchnahme medizinischer Leistungen bewegen und somit ungerechtfertigter Nutzung entgegenwirken. Nach ökonomischer Theorie sollen Selbstbeteiligungen ein geeignetes Mittel sein, die Fehlnutzung durch die BürgerInnen einzuschränken, die typischerweise alles in Anspruch nehmen möchten, was es umsonst gibt - zumindest nach vorheriger Zahlung der Krankenkassenbeiträge. Somit führten Zuzahlungen im Krankheitsfall zu einer sinnvollen Steuerung im Gesundheitswesen und vor allem zur Effizienzsteigerung und Kostendämpfung.
Eine Meta-Analyse von insgesamt 173 Studien aus verschiedenen Industrieländern widerlegt nun allerdings diese Grundannahme gängiger gesundheitsökonomischer und -politischer Argumentationen gründlich. Die Auswertung verschiedener Untersuchungen zeigt eindrücklich, dass es mit der Steigerung der Effizienz durch Patientenzuzahlungen nicht weit her ist. Zumindest unter Verwendung eines vernünftigen Effizienzbegriffs, der einen expliziten Bezug zum externen Kriterium einer verbesserten Gesundheit aufweist.
Ein potenziell strittiger Punkt ist nämlich die Frage, was man unter "Effizienz" verstehen mag. Nach engen ökonomischen Überlegungen beruhen auf der so genannten allokativen Effizienz: Demnach gelten Ressourcen dann als effizient eingesetzt, wenn Personen für ein Gut bzw. eine Leistung einen Preis aufwenden, der die marginalen Kosten ihrer Erzeugung widerspiegelt. Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen, wie die Autoren der Meta-Analyse ausführen. Nur wer bereit (oder in der Lage) ist zu bezahlen, sollte Zugang zu einer Leistung haben. Und zweitens ist die Produktion einer wirkungslosen oder gar gefährlichen Leistung für jene, die dafür zu bezahlen bereit sind, effizient, während die Erzeugung einer wirksamen und vorteilhaften Leistung für Leute, die nicht dafür zahlen können, als ineffizient zu werten ist. Mehr noch, aus orthodoxer ökonomischer Sicht trägt die verringerte Nutzung von Gesundheitsleistungen auf Grund von Selbstbeteiligungen automatisch zur Verbesserung der allokativen Effizienz, unabhängig von den gesundheitsbezogenen Folgen oder Verteilungswirkungen.
Allerdings stellt sich in der realen Welt des Gesundheitswesens die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Effizienzbegriffs, der in keiner Weise das Objekt oder Ziel des Ressourceneinsatz berücksichtigt. Die ÖkonomInnen müssen sich die Frage gefallen lassen, inwieweit ein theoretisch-abstraktes Effizienzverständnis geeignet ist, normativ gesundheitspolitische Empfehlungen abzuleiten und Entscheidungen zu begründen, die überaus spürbare Konsequenzen für Individuen und Gesellschaft haben. "We might ask" -fragen die AutorInnen süffisant -"what relevance allocative efficiency has for policy making in health care. If it is to be understood as a normative concept, then we must assume either that the distributional and health consequences are of no importance or, if they are important, that all individuals in a given society share the same level of income, the same tastes and preferences, and the same risk of ill health, etc.".
Immerhin 63 der untersuchten Studien untersuchten die Auswirkungen von Selbstbeteiligungen auf die gesamten oder die Direktzahlungen für Medikamente, wobei teilweise aggregierte (d.h. auf der Makroebene gewonnene und keine Information über einzelne Haushalte enthaltende) und teilweise nicht-aggregierte Daten zu Grunde liegen. Die genannten Papers gingen sowohl den Auswirkungen fester (die zwischen 0,50 und35 US-$ variierten) als auch anteiliger Zuzahlungen (Streuung zwischen 0 und 95 %) nach. Bei den meisten Untersuchungen zeigte sich eine Senkung der Gesamtausgaben für Arzneimittel (zwischen minimalen 0,04 und immerhin 58 %), wobei das Ausmaß der Einsparung nicht nur vom Umfang der Zuzahlungen abhing, sondern auch von der Art der Medikamente und der betroffenen Bevölkerungsgruppe. Insgesamt, so schlussfolgern die AutorInnen der Meta-Analyse, bestehe eine gewisse Evidenz für die Annahme, dass Eigenbeteiligungen zu geringfügig niedrigeren Gesamtausgaben für Arzneimittel führen oder die Zunahme der Arzneimittelkosten bremsen. Darüber hinaus zeigt sich, dass Festpreise oder anderweitige Preisbindungen allenfalls kurzfristige Effekte zeigen, die nach einem oder spätestens zwei Jahren nicht mehr nachweisbar sind.
Die zumeist geringfügige Senkung der Medikamentenausgaben ist allerdings nur dann als positiver Steuerungseffekt anzusehen, wenn sie auch zu einer Reduzierung der gesamten Gesundheitsausgaben beiträgt, als keine kompensatorischen Mehrausgaben auf anderen Feldern des Gesundheitswesens eintreten. Abgesehen von den Fällen, wo Selbstbeteiligungen auf die Verwendung kostengünstigerer Medikamente abzielten, zeigte die Auswertung der diversen vorliegenden Studien allerdings, dass dies üblicherweise nicht der Fall ist: Die Ergebnisse für ambulante, stationäre und Notfallbehandlungen sind ausgesprochen konsistent, fassen die AutorInnen ihre Befunde zusammen: "These findings reveal two things. First, prescription drug charges are unlikely to lower total health care expenditure and may in fact increase spending overall. Although a decline in the use of services that complement prescription drugs (doctor visits) may lead to cost savings, any savings are likely to be outweighed by increased use of the highly resource-intensive services that substitute for prescription drugs (inpatient, emergency and long-term care). Second, the design of a cost sharing policy can mitigate this potentially explosive effect on total health care expenditure. Policies that give patients incentives to switch to lower-cost drugs and policies that protect lowincome groups may prevent inefficient patterns of health care use which, while more accessible to patients, are more costly to the health system."
In Bezug auf die Medikamenteneinnahme zeigt sich insgesamt ein Rückgang in Folge von Zuzahlungen, der allerdings nicht besonders groß erscheint. Die AutorInnen folgern daraus, dass PatientInnen nicht sehr sensitiv auf Arzneimittelkosten reagieren. Interessant ist dabei insbesondere, dass Selbstbeteiligungen bei essenziellen und nicht-essenziellen Mitteln gleichermaßen wirken. Wenn GesundheitspolitikerInnen das Allgemeinwohl und die Gesundheit der Bevölkerung im Auge haben, sollten sie, so die überzeugte Empfehlung, nicht darauf vertrauen, dass die PatientInnen "richtige" Entscheidungen treffen.
Überhaupt kommen die meisten in die Meta-Analyse einbezogenen Zuzahlungsstudien zu dem Ergebnis, dass Eigenbeteiligungen für Arzneimittel tendenziell den Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtern; dieser Effekt ist bei Angehörigen der unteren Einkommensgruppen am stärksten ausgeprägt und ist auch bei bestehenden jährlichen Zuzahlungsobergrenzen beobachten. Dieser Befund unterstreicht die negativen Auswirkungen der per se regressiven Patientenzuzahlungen auf die soziale Gerechtigkeit. Insgesamt aber wecken die bedenklichen Auswirkungen von Arzneimittelzuzahlungen auf den Gesundheitszustand in Verbindung mit den vielfach beobachteten Kostensteigerungen grundsätzliche Zweifel an der gesundheitspolitischen Effizienz von Selbstbeteiligungen. Zumindest dann, wenn man Effizienz nicht als wirtschaftstheoretischen Selbstzweck begreifen will.
Eine zusammenfassende Würdigung dieser Studie veröffentlichte die Frankfurter Rundschau in Ihrer Ausgabe vom 26. Juli 2008. Dieser Artikel im FR-Wirtschaftsteil ist hier kostenlos herunterzuladen.
Hier finden Sie den Volltext des überaus empfehlenswerten Artikels aus dem International Journal for Equity in Health.
Jens Holst, 1.6.2008
Wie oft und warum verpassen Herzinfarktpatienten die "goldene Stunde" für den Beginn der Krankenhausbehandlung?
 Eine möglichst kurze Zeit bis zur Akutbehandlung in einem Krankenhaus ist bei Menschen mit Verdacht auf einen Myokard- oder Herzinfarkt lebensrettend oder bewahrt einen Teil ihrer Lebensqualität. Obwohl es einige untrügliche Anzeichen für Herzinfarkt gibt, zeigen diverse Studien, dass dies nur 22 bis 44% dieser Patienten innerhalb einer Zwei-Stunden-Grenze ("goldene Stunde") schaffen.
Eine möglichst kurze Zeit bis zur Akutbehandlung in einem Krankenhaus ist bei Menschen mit Verdacht auf einen Myokard- oder Herzinfarkt lebensrettend oder bewahrt einen Teil ihrer Lebensqualität. Obwohl es einige untrügliche Anzeichen für Herzinfarkt gibt, zeigen diverse Studien, dass dies nur 22 bis 44% dieser Patienten innerhalb einer Zwei-Stunden-Grenze ("goldene Stunde") schaffen.
Zusammengefasst werden nun die dazu vorliegenden deutschen und internationalen Erkenntnisse in dem Aufsatz "Patientenbezogene Determinanten der prähospitalen Verzögerung beim akuten Myokardinfarkt" von C. Gärtner, L. Walz, E. Bauernschmitt und K.-H. Ladwig, der im Deutschen Ärzteblatt vor kurzem erschienen ist (Deutsches Ärzteblatt v. 11.4.2008: 286-291).
Dabei zeigen sich für die Bewertung der Bedeutung von Wissen und seiner problemnahen Vermittlung eine Fülle praktischer und möglicherweise systematischer Schwierigkeiten. Die Wirksamkeit von einfachen "Nürnberger-Trichter"-Patientenbildungsstrategien oder Wissensbroschüren muss danach systematisch bezweifelt werden. Sich auf solche Hilfsmittel zu konzentrieren wäre nicht hilfreich und reine Geldverschwendung.
Die Kernaussagen des Überblicksaufsatzes lauten:
• Obwohl zahlreiche Krankenkassenbroschüren, Faltblätter in Arztpraxen, die Massenmedien und natürlich auch die behandelnden Ärzte seit Jahren mit zunehmender Tendenz auf die Bedeutung weicher und harter aber nicht immer genügend scharfen und spezifischen Indikatoren (zwischen Unwohlsein und Todesangst) sowie die unbedingt zu beachtende "goldene Stunde" hingewiesen haben, nahm die mittlere so genannte PHZ (Prähospitalzeit) in Deutschland sogar von 1994 auf 2002 von 166 auf 192 Minuten zu.
• Das Wissen zum Thema ist konstant gering.
• Ältere, weibliche und Angehörige unterer Einkommens- und Bildungsschichten haben eine längere PHZ
• Die statt des sofortigen Versuchs, ein Krankenhaus zu erreichen, oftmals bevorzugten Hausarztkontakte oder die Konsultation von Laien verlängern die PHZ wesentlich
• Wer die folgenreiche Vernachlässigung der PHZ der Unerfahrenheit eines Patienten mit dieser Situation zuschreiben will, muss sich eines Besseren belehren lassen: Vorerfahrungen, also ein bereits erfahrener und überlebter Herzinfarkt, verkürzen nämlich die PHZ nicht.
• Zu den ausführlich aus Studien gewonnenen Faktoren, welche die davon betroffenen Patienten trotz einer mehr oder weniger dramatischen Symptomatik vom sofortigen Aufsuchen eines Krankenhauses abhält, zählen beispielsweise: Problemverleugnungen, Schwierigkeiten, Probleme wahrzunehmen und ausdrücken zu können, eine generelle Zurückhaltung vor der Inanspruchnahme von Leistungen, die Angst vor den Konsequenzen des Hilfeholens, es als unangenehm oder peinlich zu erleben, medizinische Hilfe anzufordern oder der Meinung zu sein, es wäre richtig, den Hausarzt anzurufen, der dann den Rettungsdienst verständigen würde.
• Ähnliches gilt für die Hoffnung, diese Situation einfach und schnell durch vermehrte Schulungen der "Risikopatienten" beheben zu können: Bei 4 von 10 veröffentlichten Untersuchungen der Effekte von Schulungen zeigten sich verkürzte PHZ, bei 6 war trotz gemessener besserer spezifischen Information der Patienten über die Symptome eines Herzinfarkts und den Umgang mit ihnen keine Veränderung des vorstationären Verhaltens bzw. Verzögerns zu beobachten. Wie die genannten und auch die weiteren genannten Gründe zeigen, die zur Verlängerung der PHZ führen, müssten auf Erfolg bedachte Schulungen auch ein sehr komplexes Bündel von kognitiven aber vor allem auch nichtkognitiven Faktoren berücksichtigen.
Zuzustimmen ist angesichts der Problemlandschaft der allgemeinen These der VerfasserInnen: "Gegenwärtig fehlt ein theoretisch begründetes und empirisch abgesichertes Konzept, das das Entscheidungsverhalten der Patienten verstehbar … machen könnte."(290)
Hinzuzufügen bliebe, dass dies nicht nur für die PHZ bei Herzinfarktspatienten richtig ist. Dies sollte ebenso bei zahlreichen anderen Indikationen und den dort immer wieder als Problemlöser genannten vorrangig kognitiv orientierten Simpelst-Schulungsmodellen beachtet werden.
Den Aufsatz "Patientenbezogene Determinanten der prähospitalen Verzögerung beim akuten Myokardinfarkt" kann man komplett kostenfrei auf der Website des Deutschen Ärzteblatts herunterladen.
Bernard Braun, 11.5.2008
Wissen=Handeln? Sehr gemischtes, zum Teil paradoxes oder gegenläufiges Bild der Wirkungen von öffentlichen Qualitätsvergleichen
 Zu den berechtigten Kritikpunkten an den auch nur langsam häufiger erstellten und veröffentlichten Berichten über ausgewählte Aspekte der gesundheitlichen Versorgung im deutschen Gesundheitswesen gehören seit langem die dort fehlenden, reduzierten oder anonymisierten Informationen über die Ergebnisqualität.
Zu den berechtigten Kritikpunkten an den auch nur langsam häufiger erstellten und veröffentlichten Berichten über ausgewählte Aspekte der gesundheitlichen Versorgung im deutschen Gesundheitswesen gehören seit langem die dort fehlenden, reduzierten oder anonymisierten Informationen über die Ergebnisqualität.
Berichte wie die jedem Krankenhaus gesetzlich vorgeschriebenen "Krankenhaus-Qualitätsberichte" enthalten bisher meist nur Angaben zur Struktur- und Prozessqualität und keine Angaben über die Anzahl im Krankenhaus verstorbenen Patienten, unerwünschte Komplikationen oder die Häufigkeit von Krankenhausinfektionen, die methodisch und inhaltlich verlässliche Vergleiche zwischen Kliniken erlauben würden. Da wo es zumindest einen Teil dieser harten Indikatoren gibt, werden sie, wie im Falle der Berichte der "Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS)" weder flächendeckend noch nicht-anonym veröffentlicht.
Bevor man meint, mit der Forderung nach deutlichen Verbesserungen in diesen Sachmerkmalen, wirklich Berichte zu erhalten, die dem nach Behandlungsorten suchenden Patienten bei u.U. lebensrelevanten Entscheidungen helfen, sollte aber auch noch zum wirklichen und massenhaften Nutzen der Berichte gefragt werden. Ziehen also überhaupt entscheidungsfähige Patienten Berichte über die Qualität einer Krankenhausbehandlung heran und fällen ihre Entscheidung auf dieser Informationsbasis?
Folgt man den Ergebnissen einer Ende 2007 in der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift" veröffentlichten Sekundäranalyse von über 40 veröffentlichten Studien zu diesen Fragen, lautet die Antwort auf beide Fragen fast uneingeschränkt "nein".
Diese klaren und etwas deprimierenden Ergebnisse lauten beispielsweise so:
• "Die Mehrzahl der empirischen Untersuchungen zeigen, dass die Publikation von Qualitätsdaten nahezu keinen Einfluss auf das Verhalten von Patienten, z. B. die Wahl des Krankenhauses, hat. Analysen nach der Veröffentlichung von Mortalitäts- und Komplikationsraten aus den USA zeigen, dass selbst bei umfangreicher Publikation der Daten allenfalls sporadische, inkonsistente und geringfügige Zu- bzw. Abnahmen der Leistungsmengen in Krankenhäusern mit 'Ausreißer'-Status, also besonders guten oder besonders schlechten Ergebnissen, zu beobachten sind." (2639) Und: "Die Validität von Qualitätsvergleichen muss vielfach bezweifelt werden. Für viele der geäußerten positiven Erwartungen existiert keine, oder sogar nachteilige Evidenz."
• "...hatten die Informationen (eines Bypass-Infoportals in Pennsylvania) nur bei 2% der Patienten einen 'gewissen Einfluss' auf ihre Entscheidung für ein Krankenhaus. 1% der Patienten konnte das Rating des Krankenhauses, in dem sie behandelt wurden, korrekt wiedergeben." (ebd.)
• Was beobachtet werden kann und plausibel wirkt, sind "positive Effekte auf die Qualitätsbemühungen von Leistungsanbietern". Dem gegenüber fürchten die Autoren "gleichzeitig "starke Selektionseffekte, bei denen durch strategische Veränderungen in den Patientengruppen bessere Qualitätsdaten erzielt werden sollen."
• Und die krönende abschließende Bewertung lautet dann: "Dennoch mag die Offenlegung in der derzeitigen Situation wichtig sein, um Vertrauen zwischen Krankenhäusern und der Bevölkerung und eine Atmosphäre der Offenheit und Verantwortlichkeit herzustellen. Die Tatsache, dass überhaupt offengelegt wird, mag in dieser Hinsicht wichtiger sein als das, was durch eine Offenlegung an positiven Wirkungen erwartet werden kann."
Von dem dreiseitigen Aufsatz "Offenlegen oder nicht? Chancen und Risiken der Veröffentlichung von medizinischen Qualitätsvergleichen" von David Schwappach und H.-J. Schubert in der "DMW" (132: 2633-2636) gibt es kostenfrei leider nur eine kurze Zusammenfassung. Die PDF-Datei des kompletten Beitrags kostet den stolzen Betrag von 25 US-Dollar.
Bernard Braun, 7.5.2008
Zuzahlungen im Krankheitsfall: Versorgungsforschung widerlegt zunehmend kostendämpfendes Potenzial
 Einmal mehr geht die bei Blackwell-Synergy erscheinende Fachzeitschrift Health Services Research in ihrer jüngsten Ausgabe auf das Thema von Zuzahlungen im Gesundheitswesen ein. Die Artikel ergänzen eine beständig wachsende Reihe von Studien, die herkömmliche gesundheitsökonomische Ansätze in Frage stellen. Nicht allein die Erkenntnisse aus Epidemiologie und Versorgungsforschung, sondern auch umfassendere Kalkulationsansätze zeigen, dass Selbstbeteiligungen allzu oft unerwünschte Wirkungen entfalten.
Einmal mehr geht die bei Blackwell-Synergy erscheinende Fachzeitschrift Health Services Research in ihrer jüngsten Ausgabe auf das Thema von Zuzahlungen im Gesundheitswesen ein. Die Artikel ergänzen eine beständig wachsende Reihe von Studien, die herkömmliche gesundheitsökonomische Ansätze in Frage stellen. Nicht allein die Erkenntnisse aus Epidemiologie und Versorgungsforschung, sondern auch umfassendere Kalkulationsansätze zeigen, dass Selbstbeteiligungen allzu oft unerwünschte Wirkungen entfalten.
In ihrem Leitartikel zur Aprilausgabe 2008 von Health Services Research (43 (2), S. 451-457) formulieren es Michael Chernew und Mark Fendrick so: "When consumers pay a greater share of the cost of prescription drugs they consume less (Gilman and Kautter 2008; Reed et al. 2008; Wallace et al. 2008; Simoni-Wastila et al. 2008). In standard economic models, this reduction in use of prescription drugs due to higher out-of-pocket costs would be expected and interpreted as a sign of efficiency. It would be assumed that the value of health foregone by this price-related reduction in use was below the cost of care to the patient, and that therefore the greater cost sharing would lead to a more efficient system." Das Editorial Value and Increased Cost Sharing in the American Health Care System steht leider nur AbonnentInnen zur Verfügung.
Doch soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass die zunehmende Evidenz für die zumindest fragwürdige, vielfach aber auch bedenkliche Auswirkung von Arzneimittel- und anderen Zuzahlungen den Glauben an grundsätzlich heilsame Effekte von Marktmechanismen im Gesundheitswesen im Grundsatz unerschüttert lässt. Die neuste Tendenz in diesem Sinne zeichnet sich in den letzten Jahren unter dem Begriff "value-based insurance design" ab. Selbstbeteiligungen sollen dabei die Wirksamkeit von therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen berücksichtigen, um das Patientennachfrageverhalten im gewünschten Sinne zu medizinischen Leistungen hoher und nachgewiesener Effektivität zu lenken. Die beiden Autoren des Leitartikels haben sich schon früh im Rahmen der Debatte über managed care für "werte-basierte" Versicherungsverträge eingesetzt und gehören fraglos zu deren überzeugtesten BefürworterInnen, nachzulesen beispielsweise in zwei kostenfrei als Volltexte zugänglichen Artikeln des American Journal of Managed Care: A Benefit-Based Copay for Prescription Drugs: Patient Contribution Based on Total Benefits, Not Drug Acquisition Cost und Value-based Insurance Design: Aligning Incentives to Bridge the Divide Between Quality Improvement and Cost Containment sowie im Journal of in dem ebefalls frei zugänglichen Artikel Value-Based Insurance Design: A "Clinically Sensitive, Fiscally Responsible" Approach to Mitigate The Adverse Clinical Effects of High-Deductible Consumer-Directed Health Plans.
Bereits erheblich früher begann die Einführung gestaffelter Zuzahlungen ohne Berücksichtigung von Wirksamkeitsparametern allein in Abhängigkeit vom Preis von Arzneimittel sowie von der Kosteneffektivität anderer Versorgungsleistungen. Unterschiedliche Kostenübernahmesätze für Markenprodukte und Generika soll die Nachfrage nach letzteren steigern und PatientInnen zum Verbrauch preisgünstigerer Arzneimittel bewegen. In der genannten Ausgabe von Health Services Research stellen Reed et al. Fest, dass mehrfach gestaffelte Selbstbeteiligungen (multiple-tiered), wo sich die Zuzahlungshöhe zusätzlich zwischen beliebigen und vertraglich empfohlenen Mitteln unterscheidet, bei Medicaid-Versicherten sowohl die Anzahl der Verschreibungen als auch die Gesamtausgaben im Vergleich zu weniger differenziert gestaffelten Zuzahlungsbedingungen verringern. Dabei stellten die AutorInnen fest, dass Versicherte mit dreifach gestaffelter Zuzahlungen im Durchschnitt pro Jahr fast sechs Rezepte mit Markenprodukten und ein Generika-Rezept weniger in Anspruch nehmen als Medicaid-Versicherte mit einheitlichen Zuzahlungsbedingungen. Zusätzlich zeigt sich, dass eine "aggressivere Zuzahlungsstrategie" zu Reduzierung sowohl von Markenprodukten als auch von Generika führt, dabei aber eine Verlagerung hin zu Nachahmerprodukten zu beobachten ist. Die Senkung der Gesamtausgaben fällt jedoch vornehmlich auf die Versicherten in Verträgen mit gestaffelter Kostenübernahme zurück: Sie müssen fast 60 % mehr aus eigener Tasche zuzahlen als Medicaid-Versicherte mit einheitlichen Selbstbeteiligungssätzen.
Diese Tendenz zeigte sich auch bei der Dauertherapie von Personen mit chronischen Krankheiten, die weniger auf Zuzahlungserhöhungen ansprechen und ggf. eher zu Generika greifen. Ein Abstract der Studie Im Unterschied zu den anderen Studien zeigt diese Untersuchung somit also ein Verhalten im Sinne der ökonomischen Theorie, wenn PatientInnen bei der Inanspruchnahme von Arzneimitteln zur Behandlung chronischer Krankheiten nicht so stark auf Preisanreize reagieren wie solche ohne erforderliche Dauermedikation. Die gesamte Untersuchung, von der nur das Abstract unter dem Titel Impact of Multitiered Copayments on the Use and Cost of Prescription Drugs among Medicare Beneficiaries kostenfrei zur Verfügung steht, muss indes die Frage letztlich unbeantwortet lassen, ob die beobachteten Effekte tatsächlich Effizienzgewinne belegen oder Folge von Zugangsbarrieren sind.
Eine weitere Studie geht den Auswirkungen der Deckelung der Kostenübernahme für Arzneimittel nach, wie sie zum Beispiel das Anfang 2006 in Kraft getretene Medicare Part D Programm in den USA mit sich brachte. Dabei untersuchten die Forscher die Auswirkungen von finanziellen Deckungslücken auf das Therapieverhalten von Versicherten mit schwerer psychiatrischer Erkrankung (Schizophrenie und anderen psychotische Störungen, manischer und bipolarer Erkrankung und schwerer Depression) unter besonderer Berücksichtigung der Einnahme von Antipsychotika und Antidepressiva. Dabei zeigte sich, dass ausgeschöpfter Versicherungsschutz zu einem drastischen Rückgang der Medikamenteneinnahme führte, während Unterbrechung der Kostenübernahme vor allem die Anzahl der verschriebenen und eingenommenen Psychopharmaka senkte. Die Autoren kommen zu folgendem Schluss: "Severely mentally ill Medicare beneficiaries may be particularly vulnerable to the Medicare Part D drug benefit design and, as such, warrant close evaluation and monitoring to insure adequate access to and utilization of medications used to manage mental illness." Diese Zusammenfassung sowie ein kurzer Überblick sind kostenfrei nachzulesen im Abstract des Artikels Drug Use Patterns in Severely Mentally Discontinuities in Drug Coverage.
Die Studien von Gilman und Kautter sowie von Simoni-Wastila et al. bestätigen einmal mehr den generellen und bereits vielfach nachgewiesenen Effekt, dass Arzneimittelzuzahlungen die Einnahme von Medikamenten fraglichen Nutzens gleichermaßen senken wie die Therapietreue gegenüber hoch wirksamen Behandlungen. Die Tatsache, dass Selbstbeteiligungen auch die Einnahme erwiesenermaßen sinnvoller und wirksamer Mittel verringern, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Übertragbarkeit (mikro-)ökonomischer Modelle auf das Gesundheitswesen und insbesondere auf das Verhalten Kranker wenig tauglich ist, um daraus gesundheitspolitische Entscheidungen abzuleiten. Schließlich geht die gesundheitsökonomische Theorie davon aus, dass Preiseffekte bei "rationalen NachfragerInnen" am ehesten bei wenig wirksamen oder sinnvollen Maßnahmen einträten.
Mary Reed und ihre KollegInnen gingen der Fragestellung nach, was Versicherte über ihre Zuzahlungsbedingungen wissen und wie PatientInnen mit Selbstbeteiligungen umgehen. Dabei zeigte sich interessanterweise, dass die Kenntnis über fällige Zuzahlungen mit der Art der Medikamente zusammenhängt: Während zwei Drittel der Befragten genau wissen, wie viel sie bei Generika aus eigener Tasche zahlen müssen (bei über 65-Jährigen sind es sogar über 70 %), sind es bei Markenerzeugnissen nur zwei von fünf Versicherten. Für die Geldbeutel der Betroffenen relevanter ist die Beobachtung, dass viel mehr Befragte die Zuzahlungen für die teureren Markenprodukte unterschätzen (42,9 %!) als bei den kostengünstigeren Generika (nur 10,1 %); das Risiko der Überschätzung ist insgesamt und vor allem brand products deutlich geringer (16,1 % bei Marken- und 24,7 % bei Nachahmerprodukten). Insgesamt kommen die Wissenschaftler zu der Erkenntnis, dass Patienten recht wenig über die Zuzahlungsbedingungen wissen und sich die Kenntnis mit der Komplexität der Regelungen abnimmt: Bei gestaffelten Eigenbeteiligungen und der Kombination von Zuzahlung und Obergrenze nimmt das Wissen der Betroffenen deutlich ab. Dies ist ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass die Anwendung üblicher ökonomischer Anreizmechanismen im Gesundheitswesen problematisch ist, erfordert sie doch ausreichende Vorkenntnis auch auf Nachfragerseite.
Des Weiteren bestätigt die Studie von Reed et al. frühere Hinweise und ergänzt die bisher bekannte Liste der auf Ausweichstrategien der Versicherten bzw. PatientInnen. Zwar verhielten sich 10,6 % der Befragten im erwünschten Sinne und wechselten zu kostengünstigeren Präparaten, 2,6 % kauften ihre Medizin bei einer günstigeren Apotheke und 1,9 % sogar außerhalb der USA, aber in keinem Fall per Internet. Gleichzeitig aber verzichteten 9,2 % auf ein neues Rezept, 8,0 % brachen die Medikamentenbehandlung ab und 5,6 % nahmen eine geringere als die verordnete Dosis ein und 4,6 % teilten einfach ihre Tabletten; darüber hinaus liehen sich 4,5 % Arzneimittel bei Angehörigen oder FreundInnen, 7,8 % liehen sich Geld, um Ihre Medikamentenzuzahlung aufbringen zu können, 3,3 % kamen in den Genuss kostenloser Proben und 0,5 % nahmen das Medikamentenhilfsprogramm in Anspruch.Auch diese Studie ist für Nicht-AbonnentInnen kostenpflichtig, mit Ausnahme des Abstracts vonCoping with Prescription Drug Cost Sharing: Knowledge, Adherence, and Financial Burden.
Auch der allseits erhofften Einsparungen bei den Gesundheitsausgaben durch nachfrageseitige Steuerung über Einschränkungen der Kostenübernahme widmet sich ein Artikel der April-Ausgabe von Health Services Research. Etwa ein Viertel der Medicaid-Versicherten im Bundesstaat Orgeon musste in den so genannten Oregon Health Plan (OHP) wechseln, der fixe Zuzahlungen für bestimmte Gesundheitsleistungen vorsah und andere von der aus dem Leistungspaket herausnahm. Die Einschränkung der Kostenübernahme sollte die öffentliche Versicherungsstruktur von steigenden Ausgaben entlasten.
Doch dieser Ansatz erwies sich einmal mehr als Milchmädchenrechnung. Zwar zeigte sich bei Arzneimitteln ein stärkerer Rückgang der Inanspruchnahme in der OHP-Gruppe gegenüber den anderen Versicherten, und sanken die Pro-Kopf-Ausgaben bei den OHP-Versicherten deutlich, was insgesamt zu einer deutlichen Verringerung der Medikamentenausgaben führte. Doch gleichzeitig stiegen die Ausgaben für alle anderen ärztlichen Leistungen mindestens drei Mal so stark wie die Inanspruchnahme zurückging, so dass die Einschränkung der Kostenübernahme mit erhöhter Eigenbeteiligung der PatientInnen insgesamt zu einer deutlichen Erhöhung der Pro-Kopf-Ausgaben von Medicaid für die OHP-Gruppe führten.
Die AutorInnen fassen ihre Ergebnisse prägnant in einer Warnung an politische EntscheidungsträgerInnen zusammen: "In the Oregon Medicaid program applying copayments shifted treatment patterns but did not provide expected savings. Policy makers should use caution in applying copayments to low-income Medicaid beneficiaries." Zumindest das Abstract der lesenswerten StudieHow Effective Are Copayments in Reducing Expenditures for Low-Income Adult Medicaid Beneficiaries? Experience from the Oregon Health Plan steht kostenfrei für Nicht-AbonnentInnen zur Verfügung.
Jens Holst, 14.4.2008
Wasserspender versus Patienteninteressen und Vertrauensverhältnis Arzt-Patient - Sind Werbegeschenke an Ärzte unlauter?
 Bei manchen rechtlichen Auseinandersetzungen und Klärungen stellt sich die Frage, ob man sich über das (vorübergehende) Ergebnis freuen oder darüber ärgern soll, dass es überhaupt einer Entscheidung eines Gerichts bedurft hat. Dies gilt z. B. über die vielfach bis zur höchsten Instanz durchgestrittene Frage, ob Batterien für ein von der gesetzlichen Kasse gezahltes Hörgerät auch von ihr übernommen oder als Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens vom schwerhörigen Versicherten aus eigener Tasche gezahlt werden müssen.
Bei manchen rechtlichen Auseinandersetzungen und Klärungen stellt sich die Frage, ob man sich über das (vorübergehende) Ergebnis freuen oder darüber ärgern soll, dass es überhaupt einer Entscheidung eines Gerichts bedurft hat. Dies gilt z. B. über die vielfach bis zur höchsten Instanz durchgestrittene Frage, ob Batterien für ein von der gesetzlichen Kasse gezahltes Hörgerät auch von ihr übernommen oder als Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens vom schwerhörigen Versicherten aus eigener Tasche gezahlt werden müssen.
Gelten tut dies aber auch für den Gegenstand einer vor der 1. Handelskammer des Landgericht Münchens verhandelten Klage, ob Pharmaunternehmen Ärzten teure Geschenke machen dürfen oder nicht. Nach dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Gerichtes vom 31. 1. 2008 (Az. 1 HK O 13279/07), das am 8. Februar 2008 veröffentlicht wurde, darf dies nicht sein.
Geklagt hatte nicht etwa ein Spitzenverband der GKV oder ein Patientenverband, sondern ein Verband von Arzneimittelherstellern, der sich der Lauterkeit des Verhaltens der pharmazeutischen Industrie bei der Zusammenarbeit mit Ärzten angenommen hat. Die Klage richtete sich gegen ein großes Pharma-Unternehmen, das Ärzten im Internet nicht nur einen 700 € teuren Wasserspender zum "exklusiven Vorzugspreis" - einer Ersparnis von bis zu 40 % bei Anschaffung und Wartung -, sondern auch kostenlose Beratungsleistungen externer Unternehmensberater (etwa zum Thema "betriebswirtschaftliches Praxismanagement") anbot. Dies hielt die Klägerin für unlauter, da ein nicht unwesentlicher Teil der angesprochenen Ärzte motiviert werde, als Gegenleistung für das kostenlose Beratungsangebot die Medikamente der Beklagten zu verschreiben. Die Beklagte bestritt eine derartige Beeinflussbarkeit der Ärzte und verwies darauf, dass das Zuwendungsverbot des Heilmittelwerbegesetzes nur für produktbezogene Werbung, nicht aber für reine Imagewerbung gelte.
Dem folgte das Landgericht München I nicht und untersagte der Beklagten derlei Angebote. Das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient gebiete es - so die Richter -, dass der Arzt sich bei der Verschreibung von Medikamenten allein von den Interessen des Patienten leiten lasse und dabei nicht einmal in den Verdacht einer unsachlichen Beeinflussung durch die Hersteller der Medikamente kommen dürfe. Mit den Zuwendungen der Beklagten, die das Gericht mit mehreren hundert Euro bewertete, beeinflusse diese die Entscheidung der Ärzte bei der Medikamention unangemessen und unsachlich und verstoße somit gegen § 4 Nr. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Das hohe Gut des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient rechtfertige es, bereits Handlungen, die geeignet seien, den bösen Schein einer unsachlichen Einflussnahme nahezulegen, als nicht mehr mit den guten Sitten im Wettbewerb vereinbar anzusehen.
Im Übrigen - so das Gericht - entspreche das Verbot von mehr als geringfügigen unentgeltlichen Zuwendungen an Ärzte inzwischen auch den Vorstellungen der Pharmaindustrie selbst, und zwar auch dann, wenn es nicht um produktbezogene Zuwendungen, sondern um bloße Imagewerbung gehe. Dies ergebe sich nicht nur aus dem vom Kläger aufgestellten "Kodex zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Arzneimittelindustrie", sondern auch aus den "Verhaltensempfehlungen für die Zusammenarbeit der pharmazeutischen Industrie mit Ärzten".
Diese Selbstverpflichtungen der Pharmaindustrie sind einerseits zu begrüßen, werden aber andererseits immer wieder umgangen und zweckgerichtet modifiziert. Auch die Pharmaindustrie gehe also davon aus, dass nach den "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel" Geschenke, die über geringwertige produktbezogene Werbegaben hinausgehen, nicht gewährt werden dürfen.
Bleibt zu wünschen, dass das Urteil rechtskräftig wird und nicht weiter durch die Instanzen getrieben wird und diese Maßstäbe auch in anderen Bereichen von Ärztepraxen und -Handlungsbereichen bestimmend werden.
Bleibt ferner zu wünschen, dass derartige Industrieinitiativen künftig vor allem am Desinteresse der Ärzte scheitern, die ihr besonderes Vertrauensverhältnis zum Patient und dessen Interessen so hoch achten, dass sie auch ein Wasserspender nicht beeindrucken kann und nicht erst eine Handelskammer sie an diese zentrale Grundlage ihres professionellen Handelns erinnern muss.
Die hier auch ausgiebig zitierte offizielle Presseerklärung des Landgerichts München zum Urteil ist die bisher einzige Informationsquelle zum Urteil.
Bernard Braun, 9.2.2008
Gefahr von Unter- und Fehlversorgung bei langjähriger Therapienotwendigkeit: Das Beispiel Tamoxifen bei Brustkrebs.
 Eine der Stützen der Behandlung von estrogenrezeptorpositivem, d.h. hormonsensitivem Brustkrebs ist eine mindestens fünfjährige Behandlung mit Medikamenten, die den Wirkstoff Tamoxifen enthalten. Dieser so genannte selektive Estrogenrezeptormodulator ist nicht nur als Arzneistoff zur Therapie von Mammakarzinomen eingesetzt, sondern in den USA auch zur Prävention von Brustkrebs bei Frauen mit erhöhtem Risiko.
Eine der Stützen der Behandlung von estrogenrezeptorpositivem, d.h. hormonsensitivem Brustkrebs ist eine mindestens fünfjährige Behandlung mit Medikamenten, die den Wirkstoff Tamoxifen enthalten. Dieser so genannte selektive Estrogenrezeptormodulator ist nicht nur als Arzneistoff zur Therapie von Mammakarzinomen eingesetzt, sondern in den USA auch zur Prävention von Brustkrebs bei Frauen mit erhöhtem Risiko.
In mehreren, in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern durchgeführten Studien (siehe hierzu eine Zusammenfassung mit Verweisen auf die Originalstudien) mit Tausenden von brustkrebserkrankten Frauen, wurde der Nutzen von Tamoxifen nachgewiesen, das Brustkrebsrisiko von primär erkrankten Patientinnen zu verringern. In der "International Breast Cancer Intervention Studie (IBIS-II)" zeigte sich, dass nach 5 Jahren Einnahme eines Medikaments mit diesem Wirkstoff ein um 34% verringertes Risiko für eine Folgeerkrankung existierte. Eine über 20 Jahre in Großbritannien durchgeführte Studie zeigte sogar ein um 39% verringertes Risiko. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass eine fünfjährige Therapie einen höheren Nutzen brachte als eine zuvor auf 2 Jahre begrenzte Nachbehandlung. Außerdem gibt es Hinweise auf eine protektive Wirkung der Behandlung selbst nach einer Therapiebeendigung weit über die 5 Jahre hinaus.
Da es sich also um keine neuartige oder gar noch umstrittene Therapie handelt, fallen die Erkenntnisse einer am 10. Dezember 2007 online vorveröffentlichten und im Februar 2008 in gedruckter Form vorliegenden Studie von ForscherInnen mehrerer US-amerikanischer Universitätsforschungseinrichtungen unter Leitung von Cynthia Owusu besonders ins Gewicht.
Die Forschergruppe untersuchte in sechs Behandlungseinrichtungen das Therapieverhalten bzw. den Therapieverlauf von 961 Frauen, die älter als 65 Jahre waren, zwischen 1990 und 1994 primär an einem hormonpositiven Brustkrebs erkrankt waren und bei denen nach der Ersttherapie eine Behandlung mit Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln gestartet wurde. Mit Hilfe von Routinedaten und Rezepten wurde der Verordnungs- und Behandlungsverlauf dieser Frauen über 5 Jahre hinweg beobachtet.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• 49% der Frauen mit einer gestarteten Tamoxifen-Behandlung beendeten die Behandlung vor dem Ende der 5 Jahre.
• Frauen über 75 Jahre oder Frauen, die in den ersten drei Jahren der Tamoxifenbehandlung noch an anderen ernsteren Erkrankungen litten und die Frauen, die nach ihrer Brustoperation keine Bestrahlungstherapie erhielten, brachen ihre medikamentöse Behandlung mit höherer Wahrscheinlichkeit ab.
• Die Nichtfortsetzung der Behandlung resultiert in früheren möglichen Rückfällen oder auch einer erhöhten Brustkrebssterblichkeit.
Die jetzt zum ersten Mal konkreter bekannt gewordenen Umstände des vorzeitigen Abbruchs einer wirksamen Therapie können prädiktiv im künftigen primärärztlichen Behandlungs- oder Versorgungsmanagement oder zur besseren und gezielteren Information und Weiterbildung von Patientinnen genutzt werden.
Da es keinen Grund gibt zu glauben, in Deutschland gäbe es bei dieser Therapie nicht vergleichbare Verläufe oder Abbrüche, sollten entsprechende Überprüfungen gezielt stattfinden. Diese sollten nicht nur die Brustkrebstherapie, sondern alle Therapien einschließen, deren Wirksamkeit und Effizienz von einer langen und kontinuierlichen Therapie bzw. der Therapietreue der PatientInnen abhängig sind.
Die Ergebnisse der Studie sind in dem Aufsatz "Predictors of Tamoxifen Discontinuation Among Older Women With Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer" von Cynthia Owusu et al. in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Journal of Clinical Oncology" vom 10. Dezember 2007 zu finden, von dem es ein kostenfreies Abstract gibt.
Bernard Braun, 25.12.2007
Wie ausschließlich können und dürfen sich Ärzte im Bonus-,Malus- oder Rabatt-Zeitalter noch um das Wohl der Patienten kümmern?
 "Patientinnen und Patienten sollen darauf vertrauen können, dass bei allen ärztlichen Entscheidungen die Unabhängigkeit des Arztes gewahrt bleibt. Ärztinnen und Ärzte müssen daher unabhängig und unbeeinflusst von wirtschaftlichen Interessen Dritter ihrer Tätigkeit nachgehen. Die Unabhängigkeit ist in Gefahr, wenn der Arzt von einer bestimmten Behandlungsmethode, Verordnung oder Überweisung einen finanziellen Vorteil hat. Solche Praktiken gefährden das Grundvertrauen der Patienten in die ärztliche Tätigkeit, weil sie Zweifel daran wecken, dass die Behandlung einzig und allein am Wohl der Patienten ausgerichtet ist."
"Patientinnen und Patienten sollen darauf vertrauen können, dass bei allen ärztlichen Entscheidungen die Unabhängigkeit des Arztes gewahrt bleibt. Ärztinnen und Ärzte müssen daher unabhängig und unbeeinflusst von wirtschaftlichen Interessen Dritter ihrer Tätigkeit nachgehen. Die Unabhängigkeit ist in Gefahr, wenn der Arzt von einer bestimmten Behandlungsmethode, Verordnung oder Überweisung einen finanziellen Vorteil hat. Solche Praktiken gefährden das Grundvertrauen der Patienten in die ärztliche Tätigkeit, weil sie Zweifel daran wecken, dass die Behandlung einzig und allein am Wohl der Patienten ausgerichtet ist."
Und damit niemand im Zweifel gelassen wird, dass es sich bei diesen Einleitungszeilen einiger "Hinweise und Erläuterungen" der "Berufsordnungsgremien der Bundesärztekammer (BÄK)" zum Thema "Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit Umgang mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens" nicht um Sonntagsgerede handelt, folgt wenige Zeilen danach der Hinweis auf den § 34 Abs. 1 der Musterberufsordnung (MBO) für Ärzte.
Dieser lautet: "Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, für die Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder Medizinprodukten eine Vergütung oder andere Vorteile für sich oder Dritte zu fordern, sich oder Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen."
Dies soll, so die Berufsordnungsgremien der BÄK, "…verhindern, dass z. B. Arzneimittelhersteller Ärzten Geld oder sonstige Vorteile mit der Absicht zuwenden, die Verordnungen eigener Präparate gezielt zu steigern. Danach würde die Freiheit des Arztes in Bezug auf die Wahl des für den Patienten am besten geeigneten Arzneimittels eingeschränkt."
Nun haben es aber Ärzte zwar aktuell auch beispielsweise mit Arzneimittelherstellern zu tun, die nichts unversucht lassen, um mit materiellen und immateriellen Anreizen das Verordnungsverhalten von Ärzten zu ihren Gunsten - und das immer wieder mit Erfolg - zu beeinflussen, aber dies soll hier nicht im Mittelpunkt stehen.
Vielmehr geht es in der Hauptsache um die durch mehrere gesetzliche Regelungen der letzten Jahre (z. B. das Arzneimittelverordnungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz von 2006 und verschiedene Regelungen im SGB V zu Bonuszahlungen für das Unterschreiten von Verordnungsvolumina, Rabattvereinbarungen etc.) ermöglichten materiellen Vor- aber auch Nachteile (durch Malusregelungen für das Nichterreichen von Zielgrößen) für Ärzte bei der Art und Menge von Arzneimittelverordnungen.
Recht schnell wird klar, dass die "Hinweise" letztendlich keinen unauflösbaren Gegensatz zwischen der in der Berufsordnung festgeschriebenen Identität von Ärzten als ausschließlich dem Wohl ihrer Patienten verpflichtete Profession und dem Mitmachen an gesundheitspolitischen Bonus,- Malus- oder Rabattsystemen sieht, sondern dieses Mitmachen lediglich erleichtern bzw. entproblematisieren wollen.
Dies geschieht über mehrere argumentative Stufen:
• Nach einem kurzen kritischen Unterton in Richtung "Dogma der Beitragssatzstabilität" heißt es grundsätzlich: "Die in jüngster Zeit eingeführten kostensteuernden Instrumente wie Boni oder Rabatte korrespondieren mit der politischen gewollten Umwandlung des Gesundheitssystems in einen mehr und mehr marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaftszweig. Die durch das Vertragsarztrecht ausgeweitete finanzielle Anreizstruktur hebt ab auf die ökonomische Mitverantwortung des Arztes in der Behandlung. Dieser Verantwortung kann und will sich die Ärzteschaft nicht völlig verweigern, auch wenn sie finanzielle Anreize unverändert für problematisch hält."
Problematisch finden die BÄK-Hüter der Berufsordnung aber ab dann eigentlich außer Details nichts mehr bzw. sie formulieren so lange an den Problemen herum bis sie sich in Wohlgefallen aufgelöst haben.
• Dies beginnt mit einer feinsinnigen Differenzierung zwischen "ganz bestimmten", "ähnlichen" oder "preisgünstigen Präparaten": "Bei der Bonuszahlung gemäß § 84 Abs. 7a SGB V an wirtschaftlich verordnende Vertragsärzte und bei der Beteiligung von Vertragsärzten an Rabatten gemäß § 130a SGB V verfolgen die Vereinbarungen aber nicht den von den § 34 Abs. 1 MBO missbilligten Zweck, Ärzte zur Verordnung eines ganz bestimmten Arzneimittels zu bewegen. Absicht ist in diesen Fällen vielmehr, den Arzt gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu einem wirtschaftlichen Verordnungsverhalten in dem Sinne zu veranlassen, dass unter mehreren Arzneimitteln, die im Einzelfall für den Patienten in ähnlicher Weise geeignet sind, nach Möglichkeit das preisgünstigste Präparat verordnet wird. In diesem Fall fehlt es an dem Unrechtsgehalt der Vorteilsgewährung." Auch wenn der Arzt also unbestritten "motiviert" wird, bestimmte medizinische Entscheidungen zu treffen oder nicht zu treffen, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen oder Nachteile zu verhindern, verstößt er aus Sicht der "Hinweise"-Autoren so lange nicht gegen die Berufsordnung, so lange es sich um wirtschaftlichere Medikamente handelt.
• Dass damit die Gefahr besteht, dass Ärzte letztlich zu ihrem materiellen Vorteil eine Art "Verordnungsautomat" der von der Politik oder den Krankenkassen als wirtschaftlich angesehenen wirtschaftlichen Mitteln wird, erkennen die Autoren der BÄK auch und proklamieren daher: "Dem Arzt muss in jedem Behandlungsfall ein Entscheidungsspielraum zugunsten der Wahl eines von den Vereinbarungen nicht erfassten Arzneimittels verbleiben." Zwei der juristischen Kommentatoren dieser "Hinweise", die Frankfurter Rechtsanwälte Thomas Schlegel und Henriette Marcus, haben in ihren Ausführungen auf das Absurde dieser Art von "Argumentation" hingewiesen: "Das dürfte in der Realität schwierig sein, denn dann muss explizit ein Präparat als 'Alibi' von der Rabattvereinbarung ausgeklammert werden - auch wenn es wirtschaftlich ist. Darüber hinaus lässt auch dieser Satz erkennen, dass am Kern der Regelung des § 34 Abs. 1 MBO vorbeiargumentiert wird, denn konsequenterweise würde dies bedeuten, dass der Arzt sich nur dann berufsrechtlich konform verhält, wenn er gerade dieses Präparat verordnet - dann erhält er aber gar keinen finanziellen Vorteil und eine Stellungnahme hierzu ist überflüssig."
• Bei Rabattzahlungen an Ärzte besteht die berufsrechtlich entlastende Argumentation der BÄK-Hinweiser ganz einfach in einem Appell an eine möglichst verschleiernde Darstellung und die zumindest kurzfristige "Trotteligkeit" der Ärzte. Nicht anders lässt sich nämlich der Hinweis interpretieren, dass solche wirtschaftlichen Vorteile nur dann berufsrechtlich unzulässig sind, wenn der Arzt "bei der Verordnung bereits die Höhe seines Rabattanteils berechnen kann. Damit würde … ein zu großer Anreiz geboten, durch gezieltes Verordnungsverhalten Boni und Rabattanteile in einer gewünschten Höhe zu erlangen."
• Auch eines der 8 von den BÄK-Autoren zum Ende ihrer Hinweise vorgeschlagenen Kriterien, die bei der Prüfung von Einzelfällen angelegt werden sollen, ob finanzielle Anreize für ärztliches Verhalten zulässig sind, fordert geradezu dazu auf, es zu unterlaufen: "Finanzielle Anreize müssen in ihrer Höhe so ausgestaltet sein, dass sie nicht insgesamt einen maßgeblichen Teil der Einkünfte des Arztes ausmachen und auf diese Weise bestimmenden Einfluss auf sein Verhalten erlangen."
• Ähnlich bewusst realitätsfern formuliert sind Hinweise, wie Ärzte z. B. mit dem im § 34 Abs. 5 ihrer Berufsordnung verankerten Verbot umgehen, "Patientinnen und Patienten (nicht) ohne hinreichenden Grund an bestimmte Apotheken, Geschäfte oder Anbieter von gesundheitlichen Leistungen zu verweisen." Er darf danach und in Übereinstimmung mit der "Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs", den Patienten durchaus "auf die Möglichkeit des Bezuges über eine bestimmte Apotheke", d.h. auch eine Versandapotheke hinweisen und muss dabei nur die "Interessen des Patienten" bzw. das Ziel einer "im Interesse des beitragzahlenden Patienten bzw. Versicherten liegende wirtschaftliche Arzneimittelverordnung" beachten. Unzulässig ist dann nur noch die Verteilung von Freiumschlägen oder Gutscheine dieser Apotheken.
• Arbeiten Ärzte mit "arztnahen" Dienstleistungsunternehmen zusammen, die ihrerseits über Verträge z. B. mit der Pharmaindustrie den Absatz von Arzneimitteln fördern sollen, dürfen sie nur keine Gesellschafter dieser Unternehmnen sein, auf deren Geschäfte Einfluss nehmen können oder an deren Gewinnen beteiligt sein. Sollte jetzt aber der Onkel eines Arztes ein "arztnahes" Unternehmen gründen und mit seinem Neffen beratend in Kontakt treten, gibt es keinen wirtschaftlichen Vorteil für den Arzt und damit auch kein Problem mehr. Dies träfe auch auf Golfpartner zu.
• Der einzig grundsätzlich richtig kritisch bewertete finanzielle Anreiz ist schließlich die "Motivationspauschale" einiger Krankenkassen, die Vertragsärzte erhalten sollten, wenn sie veranlassen, "dass eine ambulante Operation durch einen anderen Vertragsarzt und nicht durch ein Krankenhaus erbracht wird." Dies verstoße gegen mehrere Paragraphen der Berufsordnung und gefährde vor allem die Arztwahlfreiheit des Patienten. Bei Empfehlungen des Arztes für ein Krankenhaus, das nach Meinung der Krankenkasse geeignet ist und einer dafür erhältlichen Extravergütung muss der Arzt nur sicherstellen, "dass die Wahlmöglichkeiten des Patienten nicht zu sehr auf bestimmte Krankenhäuser verengt werden."
Wie es sich bei all diesen spitzfindigen Gestaltungstipps noch gewährleisten lässt, "dass sich der Arzt nicht von kommerziellen Interessen, sondern ausschließlich (!!! - Hervorhebung vom Verfasser) von der medizinischen Notwendigkeit leiten lässt", wird in den gesamten "Hinweisen" nicht klar.
So berechtigt es ist, dass auch die Ärzte dazu beitragen müssen "durch wirtschaftlichen Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen ein leistungsfähiges Gesundheitswesen auf hohem Niveau zu erhalten", so wichtig ist für die ärztliche Profession selber und die Leistungsfähigkeit eines sozialen Gesundheitswesens, die uneingeschränkte Orientierung ihres Handelns am Wohle des Patienten.
Die unbedingt lesenswerten und breit diskussionsbedürftigen "Hinweise und Erläuterungen" "Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit. Umgang mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens" sind in Gänze im Deutschen Ärzteblatt" am 1. Juni 2007 (Jg. 104, Heft 22: A-1607-A1612) erschienen und herunterladbar.
Die kritische rechtliche Würdigung "Zuwendungen. Unbestechlich mit Bonus, Malus, Rabatt & Co" von Schlegel und Marcus findet sich auf der Medizinrecht-Website "medizin.recht.de" und kann kostenpflichtig heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 3.12.2007
Was Sie schon immer über Zuzahlungen wissen wollten ...
 ... und nie zu denken gewagt haben! Das finden Sie nun in einem kürzlich veröffentlichten Diskussions-Papier des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin (WZB). Die Beteiligung der PatientInnen an den Kosten ihrer medizinischen Behandlungen ist fast so alt wie die Einführung der sozialen Krankenversicherung, deren zentrales Ziel es bekanntlich ist, akut bei Krankheit anfallende hohe Kosten durch regelmäßige und kalkulierbare Vorauszahlungen zu ersetzen. Selbstbeteiligungen der PatientInnen bedeuten in Sozialstaaten die Rückverlagerung zumindest eines Teils der Behandlungskosten aus der Vorfinanzierung auf Direktzahlungen (out-of-pocket payments). Unter der Annahme, dass der Mensch gerne lange Stunden in überfüllten Wartezimmern herumlungert, jede zusätzliche Spritze und Röntgenbestrahlung genießt und weidlich jede angebotene Operationsmöglichkeit ausnutzt, nur weil all das "umsonst" zu haben ist, propagieren konservative und v.a. liberale PolitikerInnen, UnternehmerInnen, mainstream-ÖkonomInnen und auch etliche MedizinerInnen bei jeder Gelegenheit Selbstbeteiligungen. Das passt wunderbar zur allgegenwärtigen Eigenverantwortlichkeitsideologie und lässt sich als Ausdruck von wirtschaftlicher Freiheit feiern. Vor allem sollen Zuzahlungen gegen die gefühlte Übernutzung des Gesundheitswesens steuern, indem sie die Menschen zur "vernünftigen" Inanspruchnahme anleiten und von "überflüssigen" Arztkontakten abhalten.
... und nie zu denken gewagt haben! Das finden Sie nun in einem kürzlich veröffentlichten Diskussions-Papier des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin (WZB). Die Beteiligung der PatientInnen an den Kosten ihrer medizinischen Behandlungen ist fast so alt wie die Einführung der sozialen Krankenversicherung, deren zentrales Ziel es bekanntlich ist, akut bei Krankheit anfallende hohe Kosten durch regelmäßige und kalkulierbare Vorauszahlungen zu ersetzen. Selbstbeteiligungen der PatientInnen bedeuten in Sozialstaaten die Rückverlagerung zumindest eines Teils der Behandlungskosten aus der Vorfinanzierung auf Direktzahlungen (out-of-pocket payments). Unter der Annahme, dass der Mensch gerne lange Stunden in überfüllten Wartezimmern herumlungert, jede zusätzliche Spritze und Röntgenbestrahlung genießt und weidlich jede angebotene Operationsmöglichkeit ausnutzt, nur weil all das "umsonst" zu haben ist, propagieren konservative und v.a. liberale PolitikerInnen, UnternehmerInnen, mainstream-ÖkonomInnen und auch etliche MedizinerInnen bei jeder Gelegenheit Selbstbeteiligungen. Das passt wunderbar zur allgegenwärtigen Eigenverantwortlichkeitsideologie und lässt sich als Ausdruck von wirtschaftlicher Freiheit feiern. Vor allem sollen Zuzahlungen gegen die gefühlte Übernutzung des Gesundheitswesens steuern, indem sie die Menschen zur "vernünftigen" Inanspruchnahme anleiten und von "überflüssigen" Arztkontakten abhalten.
Diesen weit verbreiteten Annahmen geht das WZB-Diskussionspapier gründlich nach und analysiert systematisch ihre theoretischen Grundlagen und vor allem ihre praktische Evidenz. Der Titel fasst die Kernaussage der umfangreichen Arbeit treffend zusammen: Kostenbeteiligung für Patienten- Reformkonzept ohne Evidenz. Die Überschrift verspricht eine Generalabrechnung mit dem ebenso unverwüstlichen wie unbelegten Reform- und Kostendämpfungsinstrument der Eigenbeteiligung im Krankheitsfall, das sich hartnäckig in viele Hirne eingebrannt hat und in keiner Gesundheitsreformdebatte fehlt. Dabei fußt nicht nur die theoretische Grundlage auf dem dünnen Eis eines uneingeschränkten Glaubens an den homo oeconomicus, dessen Nutzen maximierender Impetus das Kernmerkmal menschlichen Daseins ausmacht. Vor allem aber entlarven die in letzter Zeit massenhaft publizierten empirischen Untersuchungen über Auswirkungen verschiedener Formen von Selbstbeteiligungen im Gesundheitswesen das Kalkül der Kostendämpfung als Milchmädchenrechnung.
Mit akribischer Genauigkeit hat der Autor die vermutlich vollständigste Sammlung von Materialien zum Thema Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen zusammengetragen, größtenteils einschließlich der jeweiligen URL bei elektronisch verfügbaren Publikationen. Damit setzt das Paper einen unübersehbaren Gegenakzent gegen Dünnbrett bohrende Autoren und Herausgeber wirtschaftswissenschaftlicher Lehrbücher, die mit sehr übersichtlicher Literatur auszukommen glauben, die vorrangig den eigenen ideologischen Dunstkreise reproduzieren und anders denkende Schulen gerne verschweigen - gar nicht zu reden von der ignoranten Arroganz (oder handelt es sich um ignorante Arroganz?), die Erkenntnisse aus anderen Wissenschaftsdisziplinen gänzlich zu übergehen.
Auffällig ist bei der intensiven Literaturrecherche vor allem eins: Allenfalls Modellberechnungen unter bestimmten, oftmals die Wirklichkeit nicht annähernd adäquat widerspiegelnden Annahmen können zeigen, dass Zuzahlungen das Patientenverhalten in die gewünschte Richtung steuern. Verlässt man den Boden ökonomischer Glaubenssätze und bezieht klinisch-epidemiologische Effekte ein, zeigt sich ein anderes Bild. Bisher ist es nirgends auf der Welt gelungen, mit Hilfe von Kostenbeteiligungen der Patienten zielsicher zwischen der regelmäßig angeführten überflüssigen und der überaus sinnvollen Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen zu unterscheiden: Zuzahlungen halten die Menschen eben nicht nur von den unnötigen Arztbesuchen und Tabletteneinnahmen ab, sondern dummerweise auch immer von sinnvollen und nutzbringenden Behandlungen. Das wiederum produziert überflüssiges Leid und erhebliche vermeidbare Kosten für das Gesundheitswesen. Das Fazit kann nur lauten: Die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen kann gar nicht so "leichtfertig sein wie das Gerede darüber!
Auf der Homepage des WZB steht mit dem Discussion Paper SP I 2008-305 eine überarbeitete Fassung des Discussion Paper SP I 2007-304 kostenfrei als Download zur Verfügung.
The WZB Discussion Paper is also available in English as Patient Cost Sharing - Reforms Without Evidence or can be directly downloaded clicking here.
Jens Holst, 5.11.2007
Mehr Kaiserschnitt-Geburten, weniger Sonntagskinder - aufgrund ökonomischer Klinik-Kalküls
 Der Trend ist Experten bereits seit längerem bekannt: Die Zahl der Vaginalgeburten sinkt in vielen Ländern, während gleichzeitig die geplanten (also nicht aufgrund eines Notfalls während der Geburt spontan beschlossenen) Kaiserschnitte deutlich ansteigen. In Deutschland lag die Quote im Jahr 2003 etwa bei 26%, in den USA bei 30%, also noch deutlich unter Quoten wie sie etwa aus Griechenland oder Brasilien bekannt sind, wo dies bei zwei Dritteln aller privat versicherten Mütter der Fall ist. Alexander Lerchl, Professor an der "Jacobs University Bremen", hat nun noch einmal Daten für Deutschland und die Schweiz detailliert analysiert.
Der Trend ist Experten bereits seit längerem bekannt: Die Zahl der Vaginalgeburten sinkt in vielen Ländern, während gleichzeitig die geplanten (also nicht aufgrund eines Notfalls während der Geburt spontan beschlossenen) Kaiserschnitte deutlich ansteigen. In Deutschland lag die Quote im Jahr 2003 etwa bei 26%, in den USA bei 30%, also noch deutlich unter Quoten wie sie etwa aus Griechenland oder Brasilien bekannt sind, wo dies bei zwei Dritteln aller privat versicherten Mütter der Fall ist. Alexander Lerchl, Professor an der "Jacobs University Bremen", hat nun noch einmal Daten für Deutschland und die Schweiz detailliert analysiert.
In Deutschland wurden alle 706.000 Geburten des Jahres 2003 näher unter die Lupe genommen. Es zeigte sich, dass Kaiserschnitt-Geburten ganz überwiegend an Werktagen (Montag bis Freitag) stattfinden, am Wochenende liegt die Quote um etwa 15% unter dem zu erwartenden Wert. Im Durchschnitt liegt die Quote der Kaiserschnittgeburten bei 25.5%, mit einem Minimum von 19% in Sachsen und Sachsen-Anhalt und einem Maximum von 31% im Saarland. Zwischen der Kaiserschnittquote (als Anteil an allen Geburten) und dem Wochentag der Geburt (Werktag oder Wochenende) zeigt sich dabei ein sehr enger statistischer Zusammenhang. In ähnlicher Weise ist auch die Zahl der Geburten durch eine Hebamme dann besonders niedrig, wenn die Kaiserschnittquote in einem Bundesland hoch ausfällt.
Ähnliche Befunde zeigen sich auch für die Schweiz, wo die Quote der Kaiserschnittgeburten in nur einem Jahr fast um die Hälfte gestiegen ist, nämlich von 20.5% im Jahr 2004 auf 29.2% im Jahr 2005. Für die Schweiz konnte Lerchl noch einen anderen Zusammenhang finden, als er die Daten der Jahre 1970-2005 verglich. Dort zeigt sich ein sehr hoher Zusammenhang zwischen der Zahl jährlicher Geburten und der "Wochenend-Vermeidungsquote". Die in der Schweiz sinkende Zahl der Geburten (von jährlich 100.000 im Jahr 1970 auf etwa 70.000 in 2005), und die damit sinkenden Klinik-Einnahmen werden von Krankenhäusern wettgemacht durch eine höhere Zahl von Kaiserschnitt-Eingriffen - so die Interpretation des Wissenschaftlers.
Aber auch für Deutschland erkennt Lerchl hinter dem neuen Trend zumindest teilweise ökonomische Kalküls der Kliniken und weniger andere Gründe wie eine generelle Verschlechterung des Gesundheitszustands werdender Mütter oder einen kulturellen Wandel, der zu vermehrten Wünschen geführt hat nach einer zeitlich planbaren Kaiserschnittgeburt anstelle einer schwer berechenbaren Vaginalgeburt. Krankenhaus-Arbeit, so seine Argumentation, ist am Wochenende und besonders sonntags, aber auch nachts erheblich teurer als an Werktagen. An Sonntagen sind hier für die Beschäftigten Einkommens-Zuschläge von 25 Prozent fällig, was den ökonomischen Wunsch von Klinik-Verwaltungsdirektoren nach mehr Geburten montags bis freitags tagsüber nachvollziehbar macht.
Dass dieser Trend zur Kostensenkung medizinischer Eingriffe gesundheitlich nicht unproblematisch ist, wird von Lerchl ausführlich erörtert. Auch zwei neuere Studien aus den USA und Kanada deuten darauf hin, dass die gesundheitlichen Risiken deutlich höher sind als bislang unterstellt. (vgl. Geplante Kaiserschnitt-Geburten: Höhere Risiken als bislang angenommen)
Für beide Studien von Prof. Lerchl ist kostenlos leider nur ein Abstract verfügbar:
• Alexander Lerchl, Sarah C. Reinhard: Where are the Sunday babies? II. Declining weekend birth rates in Switzerland doi: 10.1007/s00114-007-0305-4
• Alexander Lerchl: Where are the Sunday babies? III. Caesarean sections, decreased weekend births, and midwife involvement in Germany doi: 10.1007/s00114-007-0306-3
Gerd Marstedt, 12.10.2007
Welcher Arzt-Typ verordnet unangemessen viel Antibiotika gegen virale und bakterielle Infektionen? - Hinweise aus Kanada
 Zu einer der mittlerweile weit verbreiteten und konsensualen Gewissheiten gesundheitswissenschaftlicher Forschung gehört, dass der unangemessene oder inhaltlich nicht notwendige Einsatz von Antibiotika die Entstehung von Erregern fördert, die auf keines dieser Mittel mehr reagieren. Die Existenz multiresistenter Erreger (Stichwort: MRSA) ist einer der neuesten Schrecken hochmoderner Gesundheitseinrichtungen.
Zu einer der mittlerweile weit verbreiteten und konsensualen Gewissheiten gesundheitswissenschaftlicher Forschung gehört, dass der unangemessene oder inhaltlich nicht notwendige Einsatz von Antibiotika die Entstehung von Erregern fördert, die auf keines dieser Mittel mehr reagieren. Die Existenz multiresistenter Erreger (Stichwort: MRSA) ist einer der neuesten Schrecken hochmoderner Gesundheitseinrichtungen.
Angesichts der wachsenden Bekanntheit dieser Zusammenhänge stellt sich die Frage, warum es dann nicht zu einem kräftigen Rückgang des ja zwingend eine ärztliche Verordnung voraussetzenden unangebrachten Gebrauchs von Antibiotika kommt?
Zur Beantwortung der Frage gehörte auch, beispielsweise zu wissen, welche Ärzte in welchen Situationen und mit welchen Argumenten trotzdem "bei jeder Gelegenheit" ein Antibiotikum einsetzen. Doch selbst darüber weiß bzw. wusste man bis vor kurzem nichts.
Dies beenden die Erkenntnisse einer gerade in Kanada beendeten Studie zu den persönlichen und institutionellen Charakteristika von Ärzten, die möglicherweise ihre Verordnungsweise beeinflussen. Das Ziel der Studie war es zu bewerten, ob das Wissen der Ärzte, ihre Berufserfahrung, der Ausbildungsort oder der Umfang ihrer ärztlichen Praxis die Unterschiede der Antibiotika-Verordnung erklären.
Dazu untersuchte eine Wissenschaftlergruppe um Genevieve Cadieux eine historische Kohorte von 852 Primärärzten in der kanadischen Provinz Quebec, die ihren Ausbildungsabschluss zwischen 1990 und 1993 gemacht hatten hinsichtlich ihrer ärztlichen Praxis in den Jahren 1990 bis 1998. Dabei wurde gezielt die inhaltlich unangemessene Verordnung von verschiedenartigster Antibiotika gegen virale und bakterielle Infektionen betrachtet.
Bei allen Analysen der 104.230 Patienten mit viralen Infektionen und der 65.304, bei denen eine bakterielle Infektion diagnostiziert wurde, wurde neben dem Einfluss der bereits genannten Merkmale der Einfluss des Geschlechts der Ärzte und der zeitlichen Lage der Verordnungstermine sowie das Alter, Geschlecht, die Bildung, das Einkommen und regionale Zugehörigkeit der Patienten kontrolliert.
Die Studie belegte einen statistisch signifikanten Einfluss folgender Merkmale:
• Absolventen internationaler medizinischer Ausbildungsstätten verordneten mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit (risk ratio[RR]=1,78) Antibiotika gegen virale Atemwegserkrankungen als Ansolventen der Universität in Montreal.
• Unangebrachte Verordnungen von Antibiotika nahmen mit zunehmender Berufserfahrung zu (nach 5 Jahren RR=1,04).
• Ärzte mit einer großen Praxis setzten wesentlich häufiger Antibiotika gegen virale Atemwegserkrankungen ein als ihre Kollegen mit einem niedrigen Arbeitsvolumen (RR=1,27). Dies trifft auch für die Verordnung bestimmter Mittel zur vorrangigen Behandlung bakterieller Erkrankungen (so genannte "second- and third-line antibiotics") zu. Hier gibt es also Anzeichen für die Gültigkeit der Hypothese zu geben, dass große Teile des gesamten Verordnungsgeschehens durch Zeitmangel gesteuert werden und zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe genutzt werden.
• Anders als in anderen Untersuchungen ärztlichen Handelns förderte diese Studie keinen Zusammenhang des Noten- und Qualitätsniveaus der Ausbildung und Prüfungen der Ärzte mit ihrem späteren Verhalten zutage.
Für die gezielte Intervention gegen den unangebrachten Einsatz von Antibiotika müssen mit Sicherheit noch genauere Kenntnisse über die Mechanismen erlangt werden, welche diesen Prädiktoren zugrundeliegen. Trotzdem wird schon jetzt klar, dass einseitige und einmalige Appelle oder Informationsschritte schwerlich gegen die offensichtliche Ursachen- und Motivvielfalt der problematischen Verordnungsweise nutzen. Vermutet werden kann aber, dass das Verhalten der deutschen Antibiotika-Verordner ähnlich komplex gesteuert wird und daher auch nicht einfach beeinflusst werden kann.
Der komplette Aufsatz "Predictors of inappropriate antibiotic prescribing among primary care physicians" von Genevieve Cadieux, Robyn Tamblyn, Dale Dauphinee und Michael Libman ist in der aktuellen Ausgabe des "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" (2007; 9. Oktober, 177 [8]: 877-83) erschienen und steht, wie alle CMAJ-Beiträge, als PDF-Datei kostenfrei zum Abruf bereit.
Bernard Braun, 9.10.2007
KBV will Qualitätsbewertungen niedergelassener Ärzte auch zur Neubestimmung der Honorare nutzen
 Im April 2007 kündigte die Kassenärztliche Bundesvereinigung an, Qualitätsindikatoren für die Arbeit niedergelassener Ärzte in Deutschland zu ermitteln und sie in Pilotpraxen testen zu lassen (vgl. KBV kündigt den "Ärzte-TÜV" für niedergelassene Haus- und Fachärzte an). Jetzt wurden auf der Website der KBV neue Informationen zum Projekt "Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen - AQUIK" mitgeteilt. Danach ist sogar daran gedacht, das noch zu entwickelnde Indikatorensystem dafür zu nutzen, um zumindest einen Teil der Honorare für ambulant tätige Ärzte von der jeweils ermittelten Versorgungsqualität abhängig zu machen.
Im April 2007 kündigte die Kassenärztliche Bundesvereinigung an, Qualitätsindikatoren für die Arbeit niedergelassener Ärzte in Deutschland zu ermitteln und sie in Pilotpraxen testen zu lassen (vgl. KBV kündigt den "Ärzte-TÜV" für niedergelassene Haus- und Fachärzte an). Jetzt wurden auf der Website der KBV neue Informationen zum Projekt "Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen - AQUIK" mitgeteilt. Danach ist sogar daran gedacht, das noch zu entwickelnde Indikatorensystem dafür zu nutzen, um zumindest einen Teil der Honorare für ambulant tätige Ärzte von der jeweils ermittelten Versorgungsqualität abhängig zu machen.
Bis zu 30 Prozent der vertragsärztlichen Vergütung von Vertragsärzten könnten nach Aussage von KBV-Chef Dr. Andreas Köhler künftig in Abhängigkeit von der jeweils erbrachten Qualität der ärztlichen Leistung festgelegt werden. Nach einem Bericht der Ärzte-Zeitung ("Bis zu 30 Prozent der Vergütung nach Qualität") geht dies aus Köhlers Aussagen bei der 2. Nationalen Qualitätskonferenz des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) in Berlin hervor: "Wir müssen lernen, dass wir nicht mehr alle Ärzte gleich lieb haben dürfen." Bei der vertragsärztlichen Vergütung sei ein grundlegendes Umdenken erforderlich. Zwar hätten sich bisherige Qualitätssicherungsmaßnahmen im ambulanten Bereich, wie Mindestmengen oder Mindestqualifikationen bewährt, doch jetzt sei ein weiterer Schritt erforderlich, die Verknüpfung der Qualität mit der Vergütung. Er verwies dabei auch auf Großbritannien, wo rund 30 Prozent der Arzt-Honorare indikatorenbasiert und damit von der Erbringung qualitätsgesicherter Leistungen abhängig seien.
Ziel des Projekts AQUIK ist nach Darstellung der KBV "die Etablierung eines validen, transparenten Satzes von Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für die vertragsärztliche Versorgung. Mit der Messung von Versorgungs-Outcomes (Ergebnisqualität) soll die noch bestehende Lücke im Portfolio der Qualitätsinstrumente der KBV (bisher: Struktur- und Prozessqualität) geschlossen werden. Mit einem definierten und abgestimmten Set valider Qualitätsindikatoren kann der erreichte Grad der Versorgungsqualität nicht nur abgebildet werden, sondern es wird die Möglichkeit eröffnet, Vergütung an Qualitätsindikatoren zu koppeln."
Für diese Aufgabe wurde eine Projektgruppe eingerichtet, die international schon erprobte Indikatorensets erfasst und auf ihre Verwendbarkeit im deutschen Gesundheitssystem überprüft. Darüber hinaus wurden rund 200 Organisationen, darunter 62 Berufsverbände, 126 Fachgesellschaften und 8 Patientenorganisationen, darum gebeten, ihre Stellungnahme zur Bedeutung von Qualitätsindikatoren, zu diagnoseabhängigen und -unabhängigen, organisatorischen und befragungsbasierten Indikatoren sowie zum Benchmarking abzugeben. Ein erster Vorschlag für einen Indikatorenset soll 2008 vorgelegt werden. Eine Beschreibung des Vorhabens wird von der KBV hier als PDF-Datei angeboten: AQUIK-Projektbeschreibung.
Über die internationalen Erfahrungen mit Pay-For-Performance Systemen und den zugrunde liegenden Qualitätsbewertungen hat unlängst der Sachverständigenrat in seinem Gutachten 2007 "Kooperation und Verantwortung - Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung" sehr ausführlich berichtet. (Kapitel 5.3.3 Qualitäts-bezogene Vergütung (pay for performance, P4P): finanzielle Anreize für Qualitätsverbesserung, Langfassung des Gutachtens, S. 581-603).
Der SVR kommt dort zu der Feststellung, dass die bislang vor allem in den USA und im UK erprobtem System sehr heterogen sind und dementsprechend auch Evaluationsbefunde über Verbesserungen der Qualität durch P4P sehr widersprüchlich sind. Im Fazit werden zur Vermeidung von Fehlentwicklungen einige Anregungen formuliert.
• So sollten "Vergütungsanreize sich wegen der großen Bedeutung von Systemfaktoren in erster Linie an Organisationen und nicht einzelne Ärzte richten. Im Bereich der ambulanten Versorgung ist es zwar nicht zu vermeiden, auch einzelne Ärzte anzusprechen, die Einbeziehung von Ärztenetzen, Verbünden und anderen organisatorischen Konstruktionen ist jedoch vorzuziehen."
• "Die Vergütungsanreize sollten regelhaft mit anderen Anreizen und Methoden kombiniert werden, vor allem mit der Veröffentlichung von Qualitätsdaten (public disclosure), aber auch mit Feedback-Verfahren"
• "Die verwendeten Indikatoren sollten eine Kombination von Prozess- und Ergebnisindikatoren mit einzelnen Strukturindikatoren und eine sinnvolle Kombination von Routine- und klinischen Daten enthalten. Die Aufnahme von Effizienzkriterien ist grundsätzlich möglich und sinnvoll."
• "Der Gefahr einer Risikoselektion und der Benachteiligung vulnerabler Gruppen, insbesondere aber einer Verschlechterung der Versorgung multimorbider chronisch erkrankter Patienten ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es müssen in den Projekten erkennbare Ansätze enthalten sein, wie diesen unerwünschten Auswirkungen entgegengewirkt wird."
Hier findet man das SVR-Gutachten 2007 "Kooperation und Verantwortung - Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung" (PDF, 903 Seiten)
Gerd Marstedt, 7.10.2007
Aktivierung chronisch kranker Menschen zu gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen möglich: Mit und ohne Programm!?
 Sowohl GesundheitswissenschaftlerInnen als auch GesundheitspolitikerInnen sollten sich stets des wichtigen sozialmedizinischen Grundsatzes erinnern, dass sie es nicht mit Gesundheit oder Krankheiten, sondern mit kranken Menschen zu tun haben. Diese sind weder "Automaten auf zwei Beinen" noch "Robinsone", sondern soziale Wesen und reagieren daher oft anders auf Interventionen, die dies manchmal nicht nur semantisch vernachlässigen. Das aktuelle Beispiel sind in Deutschland die "Disease Management-Programme", denen nicht die Krankheiten, sondern die Kranken "verloren gehen".
Sowohl GesundheitswissenschaftlerInnen als auch GesundheitspolitikerInnen sollten sich stets des wichtigen sozialmedizinischen Grundsatzes erinnern, dass sie es nicht mit Gesundheit oder Krankheiten, sondern mit kranken Menschen zu tun haben. Diese sind weder "Automaten auf zwei Beinen" noch "Robinsone", sondern soziale Wesen und reagieren daher oft anders auf Interventionen, die dies manchmal nicht nur semantisch vernachlässigen. Das aktuelle Beispiel sind in Deutschland die "Disease Management-Programme", denen nicht die Krankheiten, sondern die Kranken "verloren gehen".
Welche Überraschungen in Interventionsstudien auftreten und wie schwierig es ist, diese zu erklären und in Gesundheitsprogrammen zu berücksichtigen, zeigen die unerwarteten Ergebnisse einer randomisierten und kontrollierten us-amerikanischen Studie, die in der Augustausgabe Zeitschrift "Health Services Research" (Volume 42, Nummer 4, August 2007: 1443-1463) veröffentlicht wurden.
In der von Judith Hibbard, Eldon Mahoney, Ronald Stock und Martin Tusler an 479 chronisch kranken Personen durchgeführten Studie ging es um die Frage "Do increases in Patient Activation Result in Improved Self-Management Behaviors?".
Bei dem in der Untersuchung eingesetzten Aktivierungsprogramm handelt es sich um das an der Stanford Universität entwickelte, getestete und gut dokumentierte "Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP)", das aus einem wöchentlichen Workshop von 2 ½ Stunden besteht, der über 6 Wochen im kommunalen Raum stattfindet.
Mit professionellen Helfern werden u.a. Techniken eingeübt mit Frustration, Müdigkeit oder Schmerz umzugehen, flexibler zu handeln, angemessen mit Medikamenten umzugehen, wirksam mit Akteuren im sozialen Umfeld und Gesundheitsprofis zu kommunizieren und gelernt, neue Behandlungen zu bewerten. Die Sitzunge sind hoch-aktivierend und interaktiv. Zusätzlich erhalten die TeilnehmerInnen schriftliche und audiovisuelle Hilfsmittel zu den bearbeiteten Techniken. Den der Kontrollgruppe zugewiesenen Patienten wurde im übrigen angeboten, am Ende der Forschungsphase auch einen CDSMP-Kurs zu besuchen. Während der Laufzeit der Studie erhielten sie aber keine besondere Leistungen.
Die Einflüsse der Intervention wurden mit dem "Patient Activation Measure (PAM)" gemessen, und zwar zu Beginn, 6 Wochen nach Beginn der Aktivierung und ein drittes Mal 6 Monate nach Interventionsbeginn.
Die Ergebnisse zahlreicher einfacher und multivariater Analysen lauten:
• Das zu Beginn der Studie zwischen Interventions- und Kontrollgruppenangehörigen nahezu identische (Wert: 59,9 und 59,8 Punkte) Niveau der Aktivierung (gemessen mit einem so genannten "Patient Activation Score") nahm mit der Zeit deutlich zu.
• Das Unerwartete ist, dass die Aktivierung in beiden Gruppen zunahm. Dies erfolgte innerhalb der ersten 6 Wochen stärker in der Interventions- als in der Kontrollgruppe, was dazu führte, dass die Aktivierung zu diesem Zeitpunkt statistisch hoch-signifikant unterschiedlich war. Danach nahm aber die Aktivierung der Kontrollgruppe so stark zu, dass sowohl der signifikante Unterschied verschwand und sich die Scorewerte absolut wieder relativ nahe waren (64,6 in der Intervention- und 63,1 in der Kontrollgruppe).
• Eine höhere Aktivierung führt auch zu anhaltenden (jedenfalls in der Beobachtungszeit) Veränderungen einer Vielzahl von gesundheitsbezogener Verhaltensweisen. Dabei gibt es keinen "Einheits- oder Königsweg", sondern mehrere Veränderungs-Pfade ("change trajectories").
• Bei einigen Elementen des Self-Managements gibt es sogar in der Kontrollgruppe größere Zuwächse als in der Interventionsgruppe.
• Selbstbescheiden ziehen die ForscherInnen den Schluss, dass sie zwar zeigen konnten, dass man die Aktivitätslevels von Patienten innerhalb gewisser Zeiten verändern bzw. beeinflussen kann und damit auch Verhaltensweisen verbessern kann. Ihre Ergebnisse aber "did not show that the intervention used in the study, was effective in increasing activation over the gains observed in the control group." Streng genommen steht daher immer noch die Frage im Raum, mit welchen Mitteln und Angeboten man Patienten aktivieren kann.
Die Absicht des Forschungsteams, ihre Studie in einer größeren Population zu replizieren ist sicher sinnvoll. Zugleich sollte aber darüber nachgedacht werden, ob bei der Aktivierung von Patienten zu mehr Eigenaktivität und "gesundem Verhalten" nicht möglicherweise sehr weiche persönliche Faktoren wie das Gefühl ernst genommen zu werden oder "im Mittelpunkt" von Aufmerksamkeit zu stehen eine viel stärkere Bedeutung haben als sich das stark kognitive Programme vorstellen.
Zu prüfen ist dabei aber ebenfalls, ob auch und gerade in wissenschaftlich begleiteten gesundheitswissenschaftlichen Studien der aus der Industriesoziologie bzw. -psychologie bekannte Hawthorne-Effekt eine Rolle spielt: "Beim Hawthorne-Effekt handelt es sich um eine unspezifische Reaktionsverzerrung, die dann auftritt, wenn das Verhalten der Versuchsperson allein dadurch beeinflusst wird, dass sie an einer Untersuchung teilnimmt. D.h. wenn sie z.B. weiß, dass sie von einem Versuchsleiter beobachtet wird, oder es für bemerkenswert hält, dass gerade sie ausgewählt wurde, an der Untersuchung teilzunehmen. Menschen verändern also ihr Verhalten manchmal allein deshalb, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden."
Zum Aufsatz "Do increases in Patient Activation Result in Improved Self-Management Behaviors?" von Hibbard et al. gibt es hier ein kostenfreies Abstract. Kaufen kann man den Aufsatz auch einzeln: Allerdings nur für die im Open Access-Zeitalter schon enorme Summe von 43,19 US-$ - "plus tax".
Bernard Braun, 9.9.2007
Von der Einfachheit des medizinisch-technischen Fortschritts - Wie verlängere ich die Dauer des Stillens?
 Das möglichst sofort nach der Geburt beginnende und möglichst lange Stillen mit Muttermilch gilt als eine der besten Ernährungsmöglichkeiten für Neugeborene und Babies und bringt auch zahlreichen gesundheitlichen Nutzen für Kinder und Mütter.
Das möglichst sofort nach der Geburt beginnende und möglichst lange Stillen mit Muttermilch gilt als eine der besten Ernährungsmöglichkeiten für Neugeborene und Babies und bringt auch zahlreichen gesundheitlichen Nutzen für Kinder und Mütter.
Deshalb findet sich unter den nationalen Gesundheitszielen vieler Länder auch das einer möglichst hohen Quote stillender Mütter. In den USA wird beispielsweise angestrebt, dass 75 % aller Mütter mit Stillen beginnen, in den ersten drei Monaten eine Rate ausschließlich mit Brustmilch stillender Mütter von 60 % erreicht wird und auch noch innerhalb der ersten 6 Monate eine Stillquote von 50 % erreicht wird (darunter exklusiv 25 % mit Brustmilch Stillende). Weltweit gibt es aber trotzdem wesentlich niedrigere Raten.
Zwei Aufsätze in der aktuellen Septemberausgabe der Fachzeitschrift "Birth" stellen Ergebnisse zweier empirischer Studien zu den Gründen niedriger Stillraten und den Möglichkeiten, sie zu verbessern vor.
Die Studie "Factors Associated with Low Incidence of Exclusive Breastfeeding for the First 6 Months" von Lilian Cordova do Espírito Santo, Luciana Dias de Oliveira und Elsa Regina Justo Giugliani (Volume 34 Issue 3 Page 212-219, September 2007) untersuchte bei einer Kohorte von 220 gesunden jungen Müttern in Brasilien deren Werdegang und "Stillkarriere" in den ersten 6 Monaten nach der Entbindung.
Dabei identifizierten sie folgende Faktoren, die die Beendigung des exklusiven Stillens vor Erreichen des Endes des Untersuchungszeitraums statistisch signifikant förderten: Mutter war eine Heranwachsende, Besuch von weniger als 6 Beratungen/Untersuchungen in der Schwangerschaft, Benutzung eines Schnullers im ersten Lebensmonat des Kindes und schlechtes Anlegen ("poor lath-on") des Kindes an die Brust. Die brasilianischen Forscherinnen schlagen daher eine gezielte Förderung und Ratschläge für die erkennbar zu früh abstillenden Mütter vor.
Über die empirisch untersuchte Wirksamkeit eines 5-Punkteprogramms zur Förderung des Stillens berichten die amerikanischen Forscherinnen Erin K. Murray, Sue Ricketts und Jennifer Dellaport in ihrem Aufsatz "Hospital Practices that Increase Breastfeeding Duration: Results from a Population-Based Study" (Volume 34 Issue 3 Page 202-211, September 2007).
Es handelt sich dabei um Ergebnisse einer Studie mit Daten des "Pregnancy Risk Assessment Monitoring System" im US-Bundesstaat Colorado, mit denen die Dauer der Stillzeit aller jungen Mütter der Jahre 2002 und 2003 in diesem Bundesstaat bestimmt werden konnte. Dabei konnte die Stilldauer von Müttern, die ein spezifisches 5-Punkteprogramm vermittelt bekamen, mit der von Müttern verglichen werden, die dieses Programm nicht angeboten bekamen bzw. nicht nutzten.
Dieses, auch in den USA nicht besonders weit verbreitete Programm (angeblich nur in bundesweit 56 Krankenhäusern und Geburtszentren) umfasst folgende Elemente:
• Das Stillen wird innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt initiiert,
• Die Neugeborenen bleiben im Zimmer der Mutter,
• Im Krankenhaus werden die Kinder nur mit Muttermilch gestillt und es erfolgt keinerlei Ergänzung mit Wasser oder sonstiger Milch,
• Schnuller sind im Krankenhaus untersagt und
• Die Mütter erhalten bei ihrer Entlassung eine Telefonnummer bzw. die Adresse einer erfahrenen Kontaktperson, die nach der Krankenhaus-Entlassung Ratschläge für das Stillen erteilen kann.
Mit diesem Programm verbessert sich die Rate der möglichst lang stillenden Mütter signifikant: Nahezu zwei Drittel der Mütter, die dieses Programm nutzten, stillten noch 4 Monate nach ihrer Entlassung. In der Kontrollgruppe ohne dieses Programm betrug dieser Anteil noch rund 50 %. Die Verbesserung der Stilldauer aufgrund des Programms wurde auch nicht vom sozioökonomischen Status der Mutter beeinflusst.
Hier erhalten Sie das kostenfreie Abstract des Aufsatzes "Factors Associated with Low Incidence of Exclusive Breastfeeding for the First 6 Months" von Cordova et al..
Und hier können sie ebenfalls das Abstract des Aufsatzes "Hospital Practices that Increase Breastfeeding Duration: Results from a Population-Based Study" von Murray et al. herunterladen.
Bernard Braun, 2.9.2007
Big Pharma's Data Collectors versus Maine, Vermont and New Hampshire - Wie viel dürfen Pharmafirmen über Ärzte wissen?
 Weltweit sammeln darauf spezialisierte Firmen Daten über die konkret von Ärzten verordneten Medikamente und verkaufen diese Informationen mit genauen Angaben zum Arzt an die Hersteller dieser Medikamente. Diese Informationen werden dann für gezielte Marketingaktivitäten bei diesen Ärzten benutzt.
Weltweit sammeln darauf spezialisierte Firmen Daten über die konkret von Ärzten verordneten Medikamente und verkaufen diese Informationen mit genauen Angaben zum Arzt an die Hersteller dieser Medikamente. Diese Informationen werden dann für gezielte Marketingaktivitäten bei diesen Ärzten benutzt.
Die Ärzte, die ein bestimmtes Medikament der Firma X nicht oder wenig verordnen, werden gezielt von entsprechend munitionierten Pharmavertretern besucht und über die vermeintlichen Vorteile einer häufigeren Verordnung des Medikaments informiert. Dass dabei auch ein Bündel von Werbeanreize eine Rolle spielen kann, ist hinlänglich bekannt. So genannte A-Ärzte, d.h. Ärzte, die ein bestimmtes Präparat der Firma X schon häufig verordnen, werden weniger besucht, dafür kann dort der Kollege der Firma Y aufgrund von Hinweisen aus demselben Datenfundus auftauchen.
Wer in etwas lockerer Form hören will, wie diese Praxis und auch alle weiteren Marketingaktivitäten der Pharmaindustrie bei Ärzten ablaufen, kann jetzt die von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und der AOK Hessen produzierte und schon an alle 8.000 hessischen Ärzte versandte CD "Pharmamarketing" auch als Nichtarzt und außerhalb Hessens im Handel erhalten (ISBN 978-3-00-021057-0).
Über die Zulässigkeit dieser systematischen und nicht-anonymisierten Datensammlung haben sich die Politiker in den US-Bundesstaaten Maine und Vermont über eine Informations-CD hinaus so viel Gedanken gemacht, dass sie beide Gesetze (so genannte "Physician Prescription Confidentiality Laws") verabschiedeten, die diese Praxis im Prinzip unterbinden und am 1. Januar 2008 in Kraft treten sollen.
Drei der teilweise auch in Deutschland auf diesem Feld aktiven Firmen, IMS Health, Wolters Kluwer Health und Verispan, haben jetzt mit dem Ziel, ihr Inkrafttreten zu verhindern, vor einem Bundesgericht Klagen bzw. Rechtsbeschwerden gegen diese Gesetze und die Bundesstaaten erhoben.
Die Beschwerdeführer sind der Überzeugung, dass diese Gesetze wie ein ähnliches im Bundesstaat New Hampshire verfassungswidrig sind, und vor allem gegen das "First Amendment" der US-Verfassung verstoßen, indem sie die Weitergabe legal erlangter Information verböten und außerdem gegen das "14th Amendment" verstoßen, indem sie den interstaatlichen Handel erschwerten.
Ohne die Möglichkeit Daten zu haben, die einem identifizierbaren Verordner zugewiesen werden könnten, würde die Gesellschaft ein mächtiges Instrument verlieren, um einen Überblick über die Sicherheit neuer Arzneimittel zu bekommen und sicher sein zu können, dass Patienten, die Arzneimittel einnehmen nicht davon geschädigt würden - so die drei Datensammler und -vermarkter.
Gegen das Gesetz in New Hampshire war bereits im Frühjahr 2007 erfolgreich von denselben Interessenten geklagt und ein erster Sieg errungen worden: Ein Bundesrichter sah das Verfassungsrecht auf freie Rede gefährdet und gab den Klägern recht. Das durch New Hampshire beantragte Berufungsverfahren ist noch nicht entschieden.
In Vermont erzeugte aber der erste Richterspruch immerhin den Effekt, dass dort trotz des Gesetzes solche Daten gesammelt und den Arzneimittelfirmen weiterverkauft werden dürfen, wenn es der einzelne Arzt erlaubt.
Trotz der Klageeinreichung der drei Pharmadatenhändler hält der geschäftsführende Direktor der "Vermont Medical Society", Paul Harrington, am Gesetz mit folgenden Argumenten fest: "We feel the laws are appropriate in that they keep the physicians' prescribing information out of the hands of the drug company marketers and curtail the drug companies being able to effectively go into the physicians' offices, having the prescribing information and tailoring their marketing, knowing what the physician is prescribing."
Wen die Legitimität des weitgehend unbekannten aber legalen Treiben dieser Firmen auch in Deutschland interessiert und stört, findet sicherlich in den kommenden Verfahren gegen die drei Bundesstaaten eine Menge Pro- und Contra-Argumente zum bisher offenherzigen Umgang mit individuellen Daten in dem ansonsten beispielsweise für eine umfassende Versorgungsforschung strikt anonym gehaltenen Gesundheitswesen Deutschlands. Ob das Grundgesetz, das SGB V und weitere Gesundheitsgesetze diese extrem interessengebundene Art von Datensammlung und -handel gegen jegliche Änderungsabsicht immunisieren, sollte dabei auch mal geprüft werden!?
Auf der Website der "Kaiser Family Foundation" findet sich mit Stand vom 31. August 2007 ein Überblick zu dem Komplex und der inneramerikanischen Berichterstattung "Prescription Drugs - Medical Data Collection Firms File Suits in Maine, Vermont over Physician Prescription Confidentiality Laws".
Wer sich für die O-Töne der drei Beschwerdeführer interessiert, findet hier die Gemeinsame Presserklärung von IMS Health, Wolters Kluwer Health and Verispan "Challenge State Laws Restricting Access to Critical Healthcare Information Prescribing Information Vital to Improving Healthcare Quality and Patient Safety; Similar Law in New Hampshire Ruled Unconstitutional". In dieser Erklärung finden sich noch einige Daten über die drei klagenden Firmen und ihre Tätigkeit.
Bernard Braun, 1.9.2007
"Health literacy", wer hat sie, was ist das und wie bekommt man sie?
 Zahlreiche Untersuchungen über die Wirksamkeit von Gesundheitsangeboten und die dafür als notwendig erachteten Mitwirkung von Patienten heben in den letzten Jahren hervor und belegen dies empirisch, dass es zur effektiven Mitwirkung einer speziellen Fähigkeit der Patienten bedarf: der "health literacy" oder Gesundheitskompetenz.
Zahlreiche Untersuchungen über die Wirksamkeit von Gesundheitsangeboten und die dafür als notwendig erachteten Mitwirkung von Patienten heben in den letzten Jahren hervor und belegen dies empirisch, dass es zur effektiven Mitwirkung einer speziellen Fähigkeit der Patienten bedarf: der "health literacy" oder Gesundheitskompetenz.
Im August 2006 widmete die bei Blackwell erscheinende Zeitschrift Journal of General Internal Medicine (JGIM) dem Thema Health Literacy eine ganze Ausgabe. Diese Thematik ist vor allem im Hinblick auf bestehende soziale Ungleichheiten und deren Überwindung von großer Bedeutung. So zeigen die verschiedene Beiträge aus JGIM 21, Heft 8 unter anderem, dass die Sterblichkeit bei älteren Patienten mit geringer Gesundheitskompetenz fast doppelt so hoch ist wie bei gebildeteren Personen. Außerdem führt eine bessere Health Literacy bei verschiedenen Erkrankungen zu Verbesserungen bei der Annahme von Präventionsangeboten, der Adhärenz (bzw. "Compliance"), der Behandlungsergebnisse und teilweise sogar des Gesundheitzustands der Betroffenen. Sämtliche Artikel der August 2006-Ausgabe des Journal of General Internal Medicine sind kostenfrei als Volltext herunterzuladen.
Bernard Braun, 12.8.2007
Cochrane-Review: Wenig oder unzureichende Evidenz für den Nutzen von Kontrakten zur Verbesserung der Therapietreue
 Im Wandel der Arzt-Patientbeziehung von einer paternalistischen Einbahnstraße zu einer partizipativen Wechselbeziehung (Stichwort: informed consent oder shared decision making) oder im Umkreis dieses Wandels gibt es auch Überlegungen und Instrumente, die die Verbindlichkeit des Verhaltens der gut informierten und in Therapieentscheidungen einbezogenen Patienten herstellen oder möglichst auf hohem Niveau erhalten sollen.
Im Wandel der Arzt-Patientbeziehung von einer paternalistischen Einbahnstraße zu einer partizipativen Wechselbeziehung (Stichwort: informed consent oder shared decision making) oder im Umkreis dieses Wandels gibt es auch Überlegungen und Instrumente, die die Verbindlichkeit des Verhaltens der gut informierten und in Therapieentscheidungen einbezogenen Patienten herstellen oder möglichst auf hohem Niveau erhalten sollen.
Eines der Mittel sind schriftliche oder mündliche Kontrakte, die der Patient mit sich selbst, seinem behandelnden Arzt oder anderen Leistungserbringern über mehr oder weniger viele Einzelheiten und Umstände der aktiven Inanspruchnahme von Leistungen abschließt. Dabei geht es um Vereinbarungen, welche die Therapietreue des Patienten gewährleisten sollen und ihn zum Einhalten einer Reihe von Verhaltensweisen in Behandlungen oder Gesundheitsförderungsprogrammen verpflichten. Dabei handelt es sich natürlich um freiwillige und mit keinerlei materiellen Vergütungen oder Sanktionen belegte Vereinbarungen.
Diese, wie gleich klar wird, auch mittlerweile nicht mehr exotischen Kontrakte, konnten bislang zwar einen Art "Wohlfühl-Effekt" für sich beanspruchen, mehr aber streng genommen auch nicht.
Mit dem Erscheinen eines systematischen Cochrane-Reviews in der Cochrane Library im April 2007 lässt sich aber mehr über den Nutzen dieser Art von Vereinbarungen für eine Verbesserung der Therapietreue und der Mitwirkung von Kontrakt-Patienten an Programmen zur Gesundheitsförderung sagen. Unter Nutzen wird dabei ein Spektrum von Teilnutzen gefasst, das von der Zufriedenheit von Patienten und Leistungserbringern über Kosten, berichtete unerwünschte Effekte bis zur Gesundheit reicht.
Nach Sichtung der Ergebnisse von 30 randomisierten und kontrollierten Studien aus den Bereichen Suchttherapie (10 Studien), Blutdrucksenkung (4 Studien), Gewichtskontrolle (3 Studien) sowie einer Fülle weiterer Bereiche (13 Studien) zum Thema, mit insgesamt 4.691 TeilnehmerInnen kommen die Cochrane-Reviewer zu folgenden ernüchternden Ergebnissen:
• Es gibt lediglich eine begrenzte Evidenz dafür, dass Kontrakte potenziell die Therapietreue verbessern können. Wenn die Effekte über längere Zeit gemessen wurden, gab es keine mehr.
• Vor allem große und qualitativ hochwertige Studien liefern aber nur unzureichende Evidenz für eine Empfehlung Kontrakte zur Verbesserung von Therapietreue im Bereich der medizinischen Behandlung von Krankheiten und präventiver Programme routinemäßig einzusetzen. Die Nichtempfehlung beruht vor allem darauf, dass nicht genug "reliable evidence available" also Evidenz für die Wiederholbarkeit von Effekten vorhanden ist.
Die Ergebnisse müssen nicht bedeuten, dass Kontrakte oder Vereinbarungen und Verabredungen zwischen Patienten und Leistungserbringern nicht in der einen oder anderen Situation sinnvoll und sogar nützlich sein können. Diese Instrumente dürfen aber nicht mit der Erwartung eines fast automatisch verbundenen verbreiteten Nutzens propagiert werden. Um eine gewisse Therapietreue zu erreichen bedarf es daher noch wesentlich phantasievollerer, kontinuierlicherer und interaktiverer Mittel und Wege und der damit ohne Zweifel notwendigen Mühen.
Wie andere Voll-Texte aus der Cochrane Library erhält man auch diesen Text nicht kostenlos, sondern nur über einen entsprechend gezahlten Bibliothekszugang.
Hier erhalten Sie aber kostenlos ein ausführliches Abstract des Reviews von Bosch-Capblanch X, Abba K, Prictor M, Garner P. (2007): Contracts between patients and healthcare practitioners for improving patients' adherence to treatment, prevention and health promotion activities. Cochrane Database of Systematic Reviews (2007, Issue 2. Art. No.: CD004808. DOI: 10.1002/14651858.CD004808.pub3).
Bernard Braun, 11.7.2007
"Wehe, Du hast nur eine Krankheit!" oder: Wer viele Krankheiten hat, bekommt eine qualitativ bessere Behandlung
 Auf diesen platten Nenner lässt sich das unerwartete Ergebnis einer Studie bei drei verschiedenen Patientengruppen mit insgesamt 7.680 Erwachsenen im angesehenen Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" bringen. Die drei Kohorten stammen aus der "Community Quality Index Study", der "Assessing Care of Vulnerable Elders Study" und dem "Veterans Health Administration Project". Ausgewertet wurden Qualitätsindikatoren zum Erhalt der empfohlenen Behandlungselemente in den Datensätzen.
Auf diesen platten Nenner lässt sich das unerwartete Ergebnis einer Studie bei drei verschiedenen Patientengruppen mit insgesamt 7.680 Erwachsenen im angesehenen Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" bringen. Die drei Kohorten stammen aus der "Community Quality Index Study", der "Assessing Care of Vulnerable Elders Study" und dem "Veterans Health Administration Project". Ausgewertet wurden Qualitätsindikatoren zum Erhalt der empfohlenen Behandlungselemente in den Datensätzen.
Die Forscher untersuchten die Beziehung zwischen dem Anteil mehrerer gut ausfallenden Qualitätsindikatoren und der Anzahl von Erkrankungen (nicht weiter differenziert nach ihrer Schwere), die bei jedem Patienten vorlagen.
Das Ergebnis lautete: Die mit diesen Indikatoren gemessene Qualität steigt mit jeder zusätzlichen Erkrankung um mehrere Prozent, also mit der Komplexität der Behandlung aber natürlich auch der Vertrautheit mit dem Patienten.
Der Wert differierte in den drei Untersuchungsgruppen zwischen 2,2 % in der "Community Quality Index cohort", 1,7 % in der "Assessing Care of Vulnerable Elders cohort" und in der "Veterans Health Administration cohort". Diese Beziehung blieb auch noch erhalten nachdem die Patienten nach ihren wichtigsten Charakteristika adjustiert wurden, wenngleich die absoluten Werte sanken.
Der Ausgangspunkt der Studie war die sehr praktische Annahme oder Befürchtung, ob bei den insbesondere in den USA stark zunehmenden "Pay-for-performance"- oder P4P-Programme, welche die Bezahlung ärztlicher Tätigkeit davon abhängig machen, ausgewählte Qualitätsparameter erreicht werden. Konkret bestand die Befürchtung darin, dass Ärzte, die multimorbide und auch meist chronisch kranke PatientInnen behandeln, es schwer oder schwerer hätten eine qualitativ hochwertige Behandlung hinzubekommen.
Überprüfungen mehrerer möglicher Einflussfaktoren auf das gegenteilige Ergebnis, die von individuellen bis zu versorgungsorganisatorischen Merkmalen reichten, lieferten keine schlüssigen oder vollständigen Erklärungen. Auch beim Hinweis auf die Rolle der Vertrautheit zwischen chronisch Kranken und ihren Ärzten oder der Möglichkeit, dass sich Ärzte bei diesen Patienten erst richtig "herausgefordert" fühlen, sind spekulativer Art bis zu einer wissenschaftlichen Überprüfung.
Ein Abstract des Aufsatzes "Relationship between Number of Medical Conditions and Quality of Care" von Takahiro Higashi, Neil S. Wenger, John L. Adams, Constance Fung, Martin Roland, Elizabeth A. McGlynn, David Reeves, Steven M. Asch, Eve A. Kerr und Paul G. Shekelle im NEJM (Volume 356 2007:2496-2504) können Sie hier einsehen.
Bernard Braun, 6.7.2007
Medikamentenzuzahlungen: Weniger Ausgaben für Arzneimittel, aber mehr Kosten für Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte
 Zuzahlungen im Krankheitsfall gehören überall auf der Welt zu den Dauerbrennern in der gesundheitspolitischen Reformdebatte. Auch in Deutschland ist die übliche Forderung nach mehr Eigenverantwortung auf das Engste mit der nach höheren Selbstbeteiligungen verbunden. Patientenzuzahlungen im Krankheitsfall haben zwei verschiedene Aufgaben zu erfüllen: Sie sollen zusätzliches Geld in das Gesundheitssystems bringen bzw. die Ausgabenbelastung der Kostenträger verringern und das Inanspruchnahmeverhalten der Bürger, Versicherten oder Patienten steuern.
Zuzahlungen im Krankheitsfall gehören überall auf der Welt zu den Dauerbrennern in der gesundheitspolitischen Reformdebatte. Auch in Deutschland ist die übliche Forderung nach mehr Eigenverantwortung auf das Engste mit der nach höheren Selbstbeteiligungen verbunden. Patientenzuzahlungen im Krankheitsfall haben zwei verschiedene Aufgaben zu erfüllen: Sie sollen zusätzliches Geld in das Gesundheitssystems bringen bzw. die Ausgabenbelastung der Kostenträger verringern und das Inanspruchnahmeverhalten der Bürger, Versicherten oder Patienten steuern.
Die Anwendung von Direktzahlungen im Gesundheitswesen beruht auf einer Reihe von Annahmen aus der ökonomischen Theorie, denn die nachfrageseitige Steuerung setzt bestimmte Bedingungen bei den "Konsumenten" von Gesundheitsleistungen voraus: Sie müssen sich rational verhalten, über ausreichende Information für ihre Entscheidungen verfügen und sich immer der Folgen ihrer Entscheidung bewusst werden. Doch die Gültigkeit der genannten Annahmen auf dem Gesundheitsmarkt überaus fragwürdig. Vor diesem Hintergrund ist es keineswegs überraschend, dass die empirischen Beobachtungen über die Auswirkungen von Zuzahlungen eine Reihe unerwünschter und gesundheitspolitisch kontraproduktiver Wirkungen offenbaren.
Dies zeigt auch eine soeben im Journal of the American Medical Association (JAMA) publizierte Meta-Analyse. Dort wurden insgesamt 132 englischsprachige PubMed-Artikel ausgewertet, die Folgen von Kostendämpfungsmaßnahmen bei Medikamentenverschreibungen bzw. -zuzahlungen nachgehen. Als Outcome-Faktoren erfassten die herangezogenen Studien den Arzneimittelverbrauch, die Inanspruchnahme nicht-medikamentöser medizinischer Leistungen, die Gesundheitsausgaben insgesamt und gesundheitliche Folgeerscheinungen.
Diese Meta-Analyse zeigte, dass die Beteiligung der PatientInnen an den Arzneimittelkosten zu einem Rückgang der Verschreibungen bzw. Rezepteinlösungen, zu schlechterem Einnahmeverhalten und zu häufigeren Therapieabbrüchen führt. Demnach sinken die Arzneimittelausgaben für verordnete Arzneimittel pro zehnprozentiger Erhöhung der Eigenbeteiligungen in Abhängigkeit von der Art der Medikamente und dem Zustand der PatientInnen um 2-6 %; dabei war es unerheblich, ob die Kostenübernahme auf einen Höchstbetrag oder eine bestimmte Anzahl von Rezepten (pro Monat oder Jahr) beschränkt war.
Doch die die Einsparung bei den Arzneimitteln hat ihren Preis: "Bei einigen chronischen Erkrankungen fanden wir heraus, dass höhere Zuzahlungen für verschriebene Arzneimittel zu einer verstärkten Inanspruchnahme teurerer medizinischer Leistungen führten," fassen die Untersucher ihr Ergebnisse zusammen. Bei chronischen Krankheiten wie Herzinsuffizienz, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus, Schizophrenie und vermutlich auch für Bronchialasthma führt ein Anheben der Medikamentenzuzahlungen zu erhöhter Inanspruchnahme kostspieligerer medizinischer Versorgungsleistungen.
Medikamentenzuzahlungen führen zu verringerter Einnahme, und die mittel- und langfristigen Folgen auf die Gesundheit der Betroffenen sind bedenklich. Die vollständige Kostenübernahme für Arzneimittel, so schlussfolgern die AutorInnen, ist demnach ein entscheidender gesundheitswissenschaftlicher Ansatz zur Verbesserung des Einnahmeverhaltens, der Behandlungsqualität und vermutlich auch des Krankheitsverlaufs.
"Die Herausforderung besteht sowohl für öffentliche Krankenkassen als auch für private Versicherungspolicen darin, die Patienten für die Behandlungskosten zu sensibilisieren, ohne sie davon abzuhalten, wirksame Therapien fortzusetzen," fassen die JAMA-AutorInnen die politischen Konsequenzen ihrer Metaanalyse zusammen. "Dafür muss man wissen, wie Patienten auf verschiedene Anreizformen reagieren und den Netto-Gewinn verschiedener Behandlungen systematisch zu erfassen; dies gilt nicht allein für den Gesundheitszustand, sondern auch für derzeitige und zukünftige Gesundheitsausgaben und den Nutzen für die Patienten."
Das ist keineswegs verwunderlich, schließlich liegt mittlerweile eine Vielzahl von Studien vor, die nicht nur zeigen, dass die Beteiligung der Patienten an den Kosten für ihre Medikamenten die Therapietreue negativ beeinträchtigt, sondern auch beachtliche vermeidbare Folgekosten verursachen, weil die Betroffenen wegen unterlassener oder eingeschränkter Tabletteneinnahme häufiger zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, aufwändige Eingriffe über sich ergehen lassen müssen oder gar vermehrt in Pflegeheime eingewiesen werden. Die vor allem von Ökonomen geforderte zunehmende Kostenbeteiligung der Patienten entpuppt sich bei genauerem Hinsehen leicht als Milchmädchenrechnung.
Die Ergebnisse der Studie Increase in Prescription Drug Cost Sharing Associated With Lower Rates of Drug Treatment, Adherence von Dana Goldman, Geoffrey Joyce und Yuhui Zheng im JAMA 298 (1), S. 61-69, bestätigen eine Erhebung zu kostenbedingten Compliance- bzw- Adherence-Problemen, die kürzlich unter der Überschrift "Selbstbestimmte Rationierung durch eigenverantwortliche Patienten?" auf der Website des Forum Gesundheitspolitik zusammengefasst waren.
Für jederman steht das Abstract der Studie kostenlos zur Verfügung Prescription Drug Cost Sharing.
Jens Holst, 4.7.2007
Höhere Medikamenten-Zuzahlungen: Sinkende Therapietreue und mehr krankheitsbedingte Fehlzeiten
 Viele US-amerikanische Firmen mit einer betriebseigenen Krankenversicherung mussten in der letzten Zeit erhebliche Kostensteigerungen für Medikamente hinnehmen. Eine Reihe von Betrieben hat daher versucht, diese zusätzlichen Kosten ganz oder teilweise abzuwälzen auf die Beschäftigten, die aufgrund ihrer Krankheit dauerhaft Medikamente einnehmen müssen. Eine Studie hat jetzt jedoch gezeigt, dass diese Erhöhung der Zuzahlungsregelungen einen Bumerang-Effekt aufweist. Erkrankte Beschäftigte, denen Medikamente verschrieben wurden, erwerben diese aufgrund der höheren Selbstbeteiligung gar nicht mehr oder nur für einen sehr viel kürzeren Zeitraum als medizinisch notwendig ist. Als Bumerang erweist sich dies für die Arbeitgeber, weil eine Absetzung der Medikamente unter dem Strich zu höheren Kosten führt als durch die Zuzahlungsregelung eingespart wurde: Denn der Verzicht auf die Arzneien führt bei den Betroffenen, auch dies hat die Studie gezeigt, zu häufigeren Krankschreibungen und auch zu arbeitsbedingten Fehlzeiten mit einer längeren Zeitdauer.
Viele US-amerikanische Firmen mit einer betriebseigenen Krankenversicherung mussten in der letzten Zeit erhebliche Kostensteigerungen für Medikamente hinnehmen. Eine Reihe von Betrieben hat daher versucht, diese zusätzlichen Kosten ganz oder teilweise abzuwälzen auf die Beschäftigten, die aufgrund ihrer Krankheit dauerhaft Medikamente einnehmen müssen. Eine Studie hat jetzt jedoch gezeigt, dass diese Erhöhung der Zuzahlungsregelungen einen Bumerang-Effekt aufweist. Erkrankte Beschäftigte, denen Medikamente verschrieben wurden, erwerben diese aufgrund der höheren Selbstbeteiligung gar nicht mehr oder nur für einen sehr viel kürzeren Zeitraum als medizinisch notwendig ist. Als Bumerang erweist sich dies für die Arbeitgeber, weil eine Absetzung der Medikamente unter dem Strich zu höheren Kosten führt als durch die Zuzahlungsregelung eingespart wurde: Denn der Verzicht auf die Arzneien führt bei den Betroffenen, auch dies hat die Studie gezeigt, zu häufigeren Krankschreibungen und auch zu arbeitsbedingten Fehlzeiten mit einer längeren Zeitdauer.
Die Studie wurde durchgeführt vom gemeinnützigen, nicht-kommerziellen "Integrated Benefits Institute (IBI)" und basiert auf Daten von etwa 5.500 Beschäftigten mit rheumatoider Arthritis. Informationen über diese chronisch erkrankten Erwerbstätigen stammen aus einem Datensatz von über 1 Million Arbeitnehmern in 17 Großunternehmen aus allen Teilen der USA. Beschäftigte mit der Diagnose rheumatoider Arthritis wurden einerseits ausgewählt, weil es nach Angaben der Wissenschaftler "klare evidenz-basierte Leitlinien gibt für die Arzneimitteltherapie gibt und zum anderen einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Therapietreue, also vorschriftsmäßigen Einnahme der Medikamente und krankheitsbedingten Fehlzeiten." Beschäftigte mit dieser Erkrankung verursachen nicht selten dreimal so hohe Arzneimittelkosten wie Vergleichsgruppen, müssen doppelt so oft in eine stationäre Behandlung überwiesen werden und weisen eine etwa zehnmal so hohe Quote von Arbeitsunfähigkeits-Fällen auf.
Die Therapietreue der erkrankten Arbeitnehmer wurde in der Studie dadurch überprüft, indem man anhand der vorliegenden Daten prüfte, ob und über welche Zeiträume die Betroffenen Medikamente erworben hatten, die ihnen verschrieben worden waren. Dabei konzentrierte man sich auf zwei, aufgrund von Therapie-Leitlinien empfohlenen Wirkstoffe, ein anti-rheumatisches Mittel und ein schmerz- und beschwerdelinderndes Mittel. Kontrolliert wurde dann, in welchem Umfang die Höhe der Medikamentenzuzahlung den Erwerb der Medikamente beeinflusste - woraus man auf deren Einnahme zurückschloss.
Für die Gesamtgruppe aller chronisch erkrankten Arbeitnehmer zeigte sich bereits, dass nur etwa 30 Prozent aller Betroffenen tatsächlich auch die Arzneitherapie befolgte. Das Besorgnis erregende zentrale Ergebnis der Analyse war dann jedoch: Je höher die vom jeweiligen Betrieb festgelegten Medikamenten-Zuzahlungen ausfallen, umso seltener nehmen Betroffene auch die Medikamente ein bzw. erwerben sie in der Apotheke. Eine Erhöhung der Zuzahlung um 20 Dollar führt dazu, dass der Erwerb anti-rheumatischer Mittel um 35 Prozent sinkt und der von schmerzlindernden Arzneien um 84 Prozent.
Die Wissenschaftler errechneten darüber hinaus dann auch noch, dass die von den US-amerikanischen Arbeitgebern intendierten Kosteneinsparungen durch Überwälzung von Arzneimittelkosten auf ihre chronisch erkrankten Beschäftigten sich ganz und gar nicht rechnet, denn die Befolgung oder Nicht-Befolgung der Medikamentenverordnung hatte unmittelbare Auswirkungen auf das Ausmaß der Arbeitsunfähigkeitsfälle und -dauer bei den Beschäftigten mit rheumatoider Arthritis.
• Hier ist die Pressemitteilung des IBI: New Integrated Benefits Institute Report Finds Pharmaceutical Cost Shifting Leads to Increased Disability and Lost Productivity
Gerd Marstedt, 29.6.2007
Unerwünschte Wirkungen "geringfügiger" Medikamentenzuzahlungen
 Die soeben im "Forum-Gesundheitspolitik" unter der Überschrift Selbstbestimmte Rationierung durch eigenverantwortliche Patienten? vorgestellte Übersicht zur komplexen Problematik von Non-Compliance bzw. Non-Adherence gegenüber verschriebenen Arzneimitteltherapien ergänzt eine aktuelle Studie aus Italien.
Die soeben im "Forum-Gesundheitspolitik" unter der Überschrift Selbstbestimmte Rationierung durch eigenverantwortliche Patienten? vorgestellte Übersicht zur komplexen Problematik von Non-Compliance bzw. Non-Adherence gegenüber verschriebenen Arzneimitteltherapien ergänzt eine aktuelle Studie aus Italien.
Das südeuropäische Land ist von besonderer Relevanz, weil eng aufeinander folgende Gesundheitsreformen Anfang dieses Jahrzehnts eine Art "natürliches Experiment" erzeugten und wichtige Hinweise auf Auswirkungen von Patientenselbstbeteiligungen lieferten.
Nach einer vorübergehenden Abschaffung der Arzneimittelzuzahlungen von etwa 1,50 € pro Verschreibung am 1. Januar 2001 erfolgte am 30. September desselben Jahres zunächst eine Beschränkung der Medikamentenzahl von sechs auf drei pro Rezept; wenige Monate später führte die italienische Regierung am 1. März 2002 erneut Medikamentenzuzahlungen von 1 € pro Rezept ein. Ziel der Wiedereinführung der Eigenbeteiligungen waren die finanzielle Entlastung des öffentlichen Haushalts und die Verringerung "unnötigen Verbrauchs".
Unmittelbar nach Abschaffung der Rezeptgebühren zeigte sich bei PatientInnen, die an Bluthochdruck leiden und vorwiegend mit ACE-Hemmern behandelt waren, bereits innerhalb eines Vierteljahres eine Verbesserung der Compliance. Dieser Effekt war bei Menschen, die ein vermindertes Einnahmeverhalten an den Tag legten, besonders stark ausgeprägt. Entsprechend verschlechterte sich das Einnahmeverhalten nach Wiedereinführung der Ein-Euro-Rezeptgebühr wieder im gleichen Zeitraum, wobei der Effekt wegen des kleineren Betrags geringer ausfiel als eineinviertel Jahre vorher.
Besonders bemerkenswert ist die messbare Auswirkung des Einnahmenverhaltens auf die Hospitalisierungsraten und die Sterblichkeit. Nach Abschaffung der Medikamentenzuzahlungen ging die Zahl der Krankenhausaufnahmen der HochdruckpatientInnen mit schlechtem Einnahmeverhalten um 0,8 Prozentpunkte zurück, während sie bei solchen mit guter Compliance unverändert blieb. Weniger ausgeprägt war der Effekt auch bei der Sterblichkeit dieser PatientInnen, die um 0,2 Prozentpunkte sank. Und nach Wiedereinführung der Rezeptgebühr stiegen beide Indikatoren erneut an.
Die Studie Drug compliance, co-payment and health outcomes: evidence from a panel of Italian patients von Vincenzo Atella et alii veröffentlichte die Zeitschrift Health Economics in ihrer Septemberausgabe von 2006 (Ausg. 15 (9), S. 875-892), die einen weiteren Beleg für unerwünschte Wirkungen selbst so genannten geringfügiger Zuzahlungen liefert. Auf der Homepage von "Health Economics" finden Sie ein kostenloses Abstract des Artikels.
Jens Holst, 6.5.2007
Wie viele Ärzte sind an der Behandlung eines Patienten beteiligt oder Grenzen von P4P-Programmen?!
 Die Grundidee der sich in den USA seit einiger Zeit verbreitenden Honorierungsform des "Pay-for-Performance (P4P)" ist einfach und verspricht viel: Die Honorierung der Behandlung oder Zuschläge zu einem Basishonorar von insbesondere chronisch erkrankten Menschen wird davon abhängig gemacht, ob ein vorher vereinbarter Behandlungsstandard und -erfolg erreicht wird. Die P4P-Programme erschienen nahezu als Quadratur des Kreises, da sie versprachen, Kostensteuerung mit Qualitätssicherung zu verknüpfen.
Die Grundidee der sich in den USA seit einiger Zeit verbreitenden Honorierungsform des "Pay-for-Performance (P4P)" ist einfach und verspricht viel: Die Honorierung der Behandlung oder Zuschläge zu einem Basishonorar von insbesondere chronisch erkrankten Menschen wird davon abhängig gemacht, ob ein vorher vereinbarter Behandlungsstandard und -erfolg erreicht wird. Die P4P-Programme erschienen nahezu als Quadratur des Kreises, da sie versprachen, Kostensteuerung mit Qualitätssicherung zu verknüpfen.
Auf ein Problem, das zumindest die rasche und problemlose Verbreitung dieser Programme unter den Bedingungen eines aus vielen Allgemein- und Fachärzten bestehenden Versorgersystems behindern dürfte, weisen die in der Ausgabe des "New England Journal of Medicine" vom 15. März 2007 ( Volume 356. Heft 11: 1130-1139) veröffentlichten Ergebnisse einer Studie im Bereich des staatlichen Medicare-Systems der USA hin.
Forscher des "Center for Studying Health System Change (HSC)" und des "Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)" hatten zwei der Grundbedingungen für funktionierende P4P-Programme untersucht: Erstens müssten es die Daten von Medicare retrospektiv ermöglichen, Patienten einzelnen Ärzten und Praxen zuzuordnen, die die primäre Verantwortung für deren Behandlung getragen haben. Zweitens müssten Ärzte für die Behandlung eines bedeutsamen Teil der von ihnen behandelten und abgerechneten Patienten verantwortlich sein bzw. gemacht werden können.
Die Studie über "Care Patterns in Medicare and Their Implications for Pay for Performance" von Pham et al. basiert auf dem vom HSC für die Jahre 2000 bis 2002 repräsentativ erhobenen "Community Tracking Study Physician Survey" mit den Daten von 8.604 Ärzten und 1.787.454 älteren Medicare-Patienten.
Die Wirklichkeit sah aber deutlich anders aus:
• So sind an der Versorgung der älteren Medicare-Patienten meist viele verschiedene Ärzte und Praxen beteiligt. Der durchschnittliche Medicare-Patient wurde in einem gegebenen Jahr von sieben verschiedenen Ärzten in vier verschiedenen medizinischen Praxen behandelt.
• Zu identifizieren, welcher Leistungsanbieter für die Behandlung welchen Patienten verantwortlich ist, erwies sich als sehr schwierig. Nur rund 35 % aller Arztkontakte mit Leistungen der untersuchten Patienten fanden bei dem Arzt statt, der nach der P4P-Methodik den verantwortlichen Versorger darstellt. Außerdem wechseln 33 % der Nutznießer von P4P-Programmen jährlich ihre Ärzte oder Praxen.
• Für Ärzte ist es unter diesen Umständen unwahrscheinlich, für einen nennenswerten Teil ihrer Patienten die von diesen Programmen erwünschte primäre Verantwortung aufbauen zu können. Wenn Ärzte nicht wissen, dass sie für eine kritische Masse von Patienten für eine gewisse Zeit, mit Sicherheit eine mehrjährige Verantwortung tragen können oder müssen, "then it is hard to envision how P4P incentives will motivate phycisians to improve the quality of care they deliver" - so die Autoren der Studie.
• Ironischerweise sieht dies bei den chronisch Kranken, also den Patienten, bei denen eine Qualitätssteuerung mit solchen Anreizen das größte Potenzial haben könnte, noch schwieriger aus: Chronisch Kranke haben nämlich mit noch mehr Ärzten und Praxen Kontakt als ein durchschnittlicher Patient: Bei Herzkranken sind im Durchschnitt 10 Ärzte in sechs verschiedenen Praxen beteiligt, während es bei Diabetikern "nur" acht Ärzte in 5 verschiedenen Praxen sind. Multimorbide Patienten mit sieben oder mehr Erkrankungen oder Beschwerden sahen in einem Jahr 11 Ärzte in sieben Praxen, wohingegen Patienten mit drei Beschwerden gerademal drei Ärzte in zwei Praxen in Anspruch nahmen. Welche "Köche" hier die Qualität sichern, ist kaum zu ermitteln, führt schnell zu Streitigkeiten und mindert den theoretischen Anreiz der P4P-Programme gerade hier nachhaltig.
In ihren Überlegungen wie diese sehr bewegten Verhältnisse zwischen Ärzten und Patienten etwas stabiler gestaltet werden und damit überhaupt wirksame und effiziente P4P-Programme funktionieren können, sprechen die Forscher offen die Folge an, dass dies "implies some limitation for the freedom of both patients and physicians to choose the physician with whom they work."
Hier erhalten Sie die vollständige Fassung des Aufsatzes "Care Patterns in Medicare and Their Implications for Pay for Performance" von Pham et al. auch kostenlos als PDF-Datei.
Bernard Braun, 20.4.2007
Erkennung und Behandlung von Schmerzen hängt entscheidend von wirksamer Arzt-Patienten-Kommunikation ab
 Die richtige und rechtzeitige Erkennung von neuropathischen Schmerzen - meist starke, chronische und erheblich beeinträchtigende Nervenschmerzen - und ihre Unterscheidung von anderen Schmerzzuständen ist einerseits die Voraussetzung für die notwendige spezifische Therapie und andererseits in zahlreichen Ländern nicht ausreichend gesichert.
Die richtige und rechtzeitige Erkennung von neuropathischen Schmerzen - meist starke, chronische und erheblich beeinträchtigende Nervenschmerzen - und ihre Unterscheidung von anderen Schmerzzuständen ist einerseits die Voraussetzung für die notwendige spezifische Therapie und andererseits in zahlreichen Ländern nicht ausreichend gesichert.
Dies ist ein Ergebnis einer vom "Neuropathic Pain Network (NPN)", einem Zusammenschluss von Patientenorganisationen und anderen Institutionen, die sich mit Schmerztherapie beschäftigen, und dem Pharmaunternehmen Pfizer im Sommer 2006 in Auftrag gegebenen Befragung von 700 Schmerz-Patienten und ihren behandelnden Ärzten in Finnland, Deutschland, Südkorea, Italien, Mexiko, Spanien und Großbritannien. Die nicht repräsentative Studie förderte für die Schmerzerkrankten u.a. folgende Versorgungssituationen und -probleme zutage:
• Rund ein Drittel aller Befragten gab an, dass sich neuropatischer Schmerz auf tagtägliche Aktivitäten wie Kochen, Einkaufen, Sport und sogar das Familienleben auswirkt. Mindestens einer von vier Umfrageteilnehmern in den meisten Ländern fühlt sich - wenn der Schmerz besonders stark ist-, "unruhig", "verzweifelt" und "völlig außer Stande, so weiter zu leben" Ausserdem leiden ein Drittel aller Befragten laut eigenen Angaben aufgrund von chronischem neuropatischem Schmerz unter Schlafstörungen.
• Die Mehrheit aller Befragten gab an, dass sie ca. zwei bis drei Jahre lang an neuropatischen Schmerzen gelitten haben. In den meisten Ländern haben Patienten mindestens zwei bis drei Ärzte konsultieren müssen, bis sie eine korrekte Diagnose erhielten.
• Die Patienten warteten durchschnittlich zwischen 5,7 bis 19,5 Monate nach dem ersten Auftreten der Beschwerde, bevor sie einen Arzt aufsuchen, da die meisten von ihnen glauben, der Schmerz verschwände schon "von alleine" wieder.
• Nachdem Patienten einen Arzt wegen ihrer Schmerzen konsultiert haben, kann eingeschränkte oder ineffektive Kommunikation das Erkennen des neuropathischen Schmerzes weiter verzögern. Um die Kommunikation zu verbessern gibt es zahlreiche einfache Tools für Ärzte und Patienten wie z. B. einen Fragebogen, der im Wartezimmer ausgefüllt werden kann oder Vorschläge für gezielte Fragen und Bitten des Arztes, die Beschwerden so konkret wie möglich zu beschreiben, nach der Krankengeschichte und nach der genauen Lokalisation des Schmerzes. Bei Ärzten, die dies machten, war die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Diagnose deutlich höher.
• Obwohl die meisten befragten Ärzte ein erklärtes Interesse bekunden, mehr zu erfahren wie sie schnell zu einer zutreffenden Diagnose kommen, nutzt lediglich in Mexiko mehr als die Hälfte der befragten Ärzte ein solches Hilfsmittel.
• Während 65 bis 89 Prozent aller Umfrageteilnehmer zum Zeitpunkt der Umfrage mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln behandelt wurden, gaben 16 bis 44 Prozent an, dass ihre Arzneimittel nur wenig oder keine Wirkung zeigten. Diese Zahlen waren noch höher bei Patienten, die rezeptfreie Medikamente einnahmen.
Die Ergebnisse der Befragung sind bisher nur am 1. März 2007 mit einer umfangreichen Presseerklärung veröffentlicht worden.
Bernard Braun, 19.4.2007
Existenz und Hartnäckigkeit medizin-ärztlicher "Risikomentalitäten" als Ursache von Über- und Fehlversorgung am Beispiel der Antibiotika
 Das in der Medizin weit verbreitete "Null-Risiko"-Denken (Harald Abholz 1984) und ein entsprechend orientiertes Handlungsmuster bei Ärzten ist offensichtlich hartnäckiger und folgenträchtiger im Sinne von Über- und Fehlversorgung als vermutet. Dies gilt offensichtlich auch dort, wo dieser "Mentalität" verpflichtete Therapieweisen enorme gesundheitliche Folgeprobleme und Risiken auslösen und selbst dann, wenn einfache und zuverlässige diagnostische Möglichkeiten zum Ausschluss der Ausgangs-Risikokonstellation existieren und genutzt werden.
Das in der Medizin weit verbreitete "Null-Risiko"-Denken (Harald Abholz 1984) und ein entsprechend orientiertes Handlungsmuster bei Ärzten ist offensichtlich hartnäckiger und folgenträchtiger im Sinne von Über- und Fehlversorgung als vermutet. Dies gilt offensichtlich auch dort, wo dieser "Mentalität" verpflichtete Therapieweisen enorme gesundheitliche Folgeprobleme und Risiken auslösen und selbst dann, wenn einfache und zuverlässige diagnostische Möglichkeiten zum Ausschluss der Ausgangs-Risikokonstellation existieren und genutzt werden.
Konkret geht es um den Einsatz von Antibiotika bei Patienten mit Influenza bzw. grippalem Infekt. Akute Atemwegserkrankungen können bakterieller oder viraler Art sein. Der Einsatz von Antibiotika macht - vereinfacht gesagt - nur bei einer vorliegenden bakteriellen Erkrankung Sinn oder dann, wenn eindeutig eine bakterielle Folgeerkrankung droht. Bei durch Viren verursachten Atemwegserkrankungen leistet der Einsatz von Antibiotika keine ursächliche Hilfe. Wie zahlreiche Studien zeigen, trägt aber der unnötige Einsatz von Antibiotika mit zur Schaffung und Verbreitung multiresistenter Erreger bei, die im Ernstfall nicht mehr mit einfachen Antibiotika oder im Extremfall gar nicht mehr behandelbar sind. Der unnötige Antibiotikaeinsatz ist also nicht "nur" Ausdruck von Wissensmängeln, sondern stellt ein eigenes gesundheitliches Risiko und ein mittelbar sehr kostensteigerndes Verhalten dar. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Virusinfektion zu lange und ausschließlich mit unwirksamen Antibiotika behandelt wird, also un- oder unterversorgt bleibt und keine ursächliche, d.h. antivirale Behandlung erfolgt.
Eine in der Vergangenheit häufig zu hörende Begründung für diese Über- und Fehlversorgung war die Schwierigkeit, bakterielle von viralen Infektionen schnell und zuverlässig unterscheiden zu können. Wenn dies möglich wäre, so der erzeugte Eindruck, würde natürlich ursachengerecht therapiert und interveniert.
Eine erste retrospektive Studie (für die Wintermonate 1999 bis 2003) über den Einsatz eines Testverfahrens bei erwachsenen Patienten im "Rochester General Hospital" in Rochester (USA), das dem Arzt innerhalb einer Viertelstunde zeigt, ob eine virale Atemwegserkrankung vorliegt oder nicht, er also Antibiotika einsetzen muss oder nicht, dämpft die Hoffnung, das Problem technisch lösen zu können, erheblich.
Die in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" vom 22. Januar 2007 veröffentliche Studie "Impact of Rapid Diagnosis on Management of Adults Hospitalized With Influenza" von Falsley et al. zeigt nämlich, dass die "Ärzte sich in den meisten Fällen nicht trauen, die Ergebnisse des Schnelltests umzusetzen" (Deutsches Ärzteblatt) bzw. sie in einer sehr eigentümlichen, selektiven Art nutzten.
Dies zeigt sich an folgenden Konstellationen:
• Von den Patienten ohne einen derartigen Test oder bei denen eine virale Verursachung ausgeschlossen werden konnte, wurden 99 % mit Antibiotika behandelt.
• Von allen Patienten, die mit einer Atemwegserkrankung ins Krankenhaus kamen und bei denen mit dem Test ein viraler Hintergrund nachgewiesen wurde, bekamen aber immer noch 86 % weiter Antibiotika verordnet.
• Selbst wenn man nur die Patienten betrachtet, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen (Folge-)Infektion niedrig war (die also nicht alt oder nicht durch Komorbidität geschwächt waren), bekamen 61 % von ihnen Antibiotika.
• Von den Patienten, die nachgewiesenermaßen eine virale Influenza hatten, wurden aber dann auch 73 % mit antiviralen Mitteln behandelt. Immerhin noch 8 % der Patienten, die einen negativen Test hatten oder bei denen kein Test erfolgte, bekamen auch eine antivirale Therapie verordnet.
• Noch etwas verwirrender werden diese bei erwachsenen Patienten gewonnenen Erkenntnisse, wenn frühere Studien über den Umgang mit den Ergebnissen dieses Tests bei fiebernden Kindern eine problemadäquatere Therapie auslöste, die auch zur Verkürzung von Krankenhausaufenthalten führte.
So richtig die Forderung ist, diese Studie auf breiterer quantiativer Basis und prospektiv randomisiert-kontrolliert zu wiederholen, und so wichtig auch die von den Autoren angestrebte technische Verbesserung der Aussagekräftigkeit des Tests sein mag, so wichtig sind Überlegungen wie man die offenkundige und jenseits der kognitiven Ebene liegende "Für-alle-Fälle-Therapieren"-Einstellung und Mentalität von Ärzten verändern kann.
Eine zusätzliche Befragung von 150 Ärzten über mögliche Gründe für ihre Weiterverordnung von Antibiotika bei positivem Virentest unterstreicht diese komplexe Situation: Kein einziger der 97 antwortenden Ärzte zweifelte an der Akkuratheit der Testergebnisse und nur 7 % bezweifelten die Validität des Tests. 62 % befürchteten aber eine zweite, dann bakterielle Infektion und 27 % wollten zur Verbesserung der Häufigkeit von Lungenentzündungen beitragen.
Hier können Sie die Online-Version der 7 Seiten umfassenden Studie "Impact of Rapid Diagnosis on Management of Adults Hospitalized With Influenza" erhalten.
Bernard Braun, 24.1.2007
Alte und neueste Ergebnisse der Forschung über erwünschte und unerwünschte Wirkungen von Zuzahlungen im Gesundheitsbereich
 Solange Zuzahlungen als Mittel zur Steuerung der Inanspruchnahme von gesundheitlichen Leistungen durch Patienten eingesetzt werden und keine eigenen aktuellen Untersuchungen zur beabsichtigten und unerwünschten Wirkungen durchgeführt werden (dies gilt in starkem Maße für Deutschland), sind Auswertungen der Ergebnisse des in den 1970er Jahren in den USA durchgeführten "RAND Health Insurance Experiment (HIE)" immer noch eine der wichtigsten Erkenntnisquellen zu diesen Fragen.
Solange Zuzahlungen als Mittel zur Steuerung der Inanspruchnahme von gesundheitlichen Leistungen durch Patienten eingesetzt werden und keine eigenen aktuellen Untersuchungen zur beabsichtigten und unerwünschten Wirkungen durchgeführt werden (dies gilt in starkem Maße für Deutschland), sind Auswertungen der Ergebnisse des in den 1970er Jahren in den USA durchgeführten "RAND Health Insurance Experiment (HIE)" immer noch eine der wichtigsten Erkenntnisquellen zu diesen Fragen.
Dies gilt auch für eine im Oktober 2006 erschienene Studie über "The Role of Consumer Copayments for Health Care: Lessons from the RAND Health Insurance Experiment and Beyond", die Jonathan Gruber (Massachusetts Institute of Technology und National Bureau of Economic Research für die Kaiser Family Foundation erstellte.
Seine Ergebnisse zur Wirkung von Zuzahlungen stützen sich also auf meist bereits bekannte und auch in diesem Forum mehrfach erwähnten Analysen des HIE, werden aber zum Teil noch durch neuere und neueste Teiluntersuchungen bestätigt und untermauert.
Die wesentlichen "lessons" lauten nach Gruber so:
• Zuzahlungen senken die Inansdpruchnahme relativ konstant in allen Leistungsbereichen,
• Zuzahlungen haben für die durchschnittlich kranken Personen keine negativen gesundheitlichen Konsequenzen,
• Zuzahlungen haben aber für schwerkranke Personen mit zusätzlich niedrigem Einkommen schwere gesundheitliche Folgen. Umgekehrt haben Angehörige dieser Gruppe den größten Nutzen von zuzahlungsfreier Versorgung.
In den Worten Grubers lautet das Fazit: "For individuals who were not already high-risk, there was little Benefit to health from free care. For high-risk individuals, however, particulary if they were low income, there were important benefits to health from free care."
Die kurz referierte neuere Forschungsliteratur zum Thema bestätigt laut Gruber die Hauptschlussfolgerungen des HIE. Leider haben sich diese Studien aber gar nicht oder nicht so umfassend mit den Auswirkungen der Zuzahlungen auf die Gesundheit der Zahler befasst. Die wenigen Ausnahmen zeigen aber unerwünschte Konsequenzen vor allem durch die dadurch reduzierte Verordnung von Arzneimittel für chronisch Kranke. Zusätzlich werden Studienergebnisse der Folgen einer harten Zugangsbarriere zu Arzneimittelverordnungen dargestellt: Solche "hard caps" führen einerseits zu einer deutlichen Absenkung der Arzneimittelverordnungen und können zu wichtigen unerwünschten gesundheitlichen Effekten führen. Die dadurch aber erzielte Kostenersparnis wurde in einem genau untersuchten Beispiel fast komplett durch die parallele Zunahme der Inananspruchnahme von Notfallabteilungen oder Krankenhäusern kompensiert.
Hier finden Sie die 18-seitige PDF-Datei der Consumer Copayments-Studie.
Bernard Braun, 28.11.2006
Ohne Härtefallregelungen im Arzneimittelbereich keine bedarfsgerechte Versorgung möglich
 Der in der "Volkswirtschaftlichen Diskussionsreihe" der Universität Augsburg im Juni 2006 veröffentlichte Beitrag "Steuerung des GKV-Arzneimittelmarktes - Auswirkungen von Selbstbeteiligungen und Härtefallregelungen" von B. Langer, A. Pfaff und A. O. Kern untersucht u.a., ob sich Härtefälle und Nicht-Härtefälle in diesem Versorgungsbereich bei der Inanspruchnahme und den Ausgaben vor und nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 unterscheiden.
Der in der "Volkswirtschaftlichen Diskussionsreihe" der Universität Augsburg im Juni 2006 veröffentlichte Beitrag "Steuerung des GKV-Arzneimittelmarktes - Auswirkungen von Selbstbeteiligungen und Härtefallregelungen" von B. Langer, A. Pfaff und A. O. Kern untersucht u.a., ob sich Härtefälle und Nicht-Härtefälle in diesem Versorgungsbereich bei der Inanspruchnahme und den Ausgaben vor und nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 unterscheiden.
Dabei kommen sie zu einer Reihe von interessanten Erkenntnissen:
• Die beiden Gruppen unterscheiden sich deutlich. Härtefälle wären ohne Befreiungsregelungen durch enorme Zuzahlungen belastet.
• Personen, die als Härtefälle anerkannt sind, sind im Durchschnitt weniger gesund als Nicht-Härtefälle. Zuzahlungen ohne vollständige oder partielle Befreiung würden also hochwahrscheinlich eine bedarfsgerechte Behandlung dieser Personen verhindern.
• Sofern man von Zuzahlungsregelungen relevante Wirkungen auf die Inanspruchnahme von Arzneimitteln erwartet, vermindern aber Härtefallregelungen diese deutlich.
Hier finden Sie die PDF-Datei: Diskussionsbeitrag Härtefallregelungen im Arzneimittelmarkt
Bernard Braun, 12.11.2006
Anreize zur Verhaltenssteuerung im Gesundheitswesen
 Die zahlreichen gesundheitspolitischen Reformbemühungen zwischen dem ersten Kostendämpfungsgesetz im Jahre 1977 und dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) im Jahr 2004 umfassten aber jeweils auch Elemente, mit denen das Anbieterverhalten in die Richtung von politisch erwünschten Zielen gelenkt werden sollte. Erst allmählich berücksichtigte die Politik, dass ein Teil der Überinanspruchnahme auch Leistungen mit begrenztem bzw. gar keinem gesundheitlichen Nutzen betraf oder Leistungen mit überwiegend schädigenden Wirkungen umfasste. Dies wurde Anfang dieses Jahrzehnts unter den Schlagworten "Über-, Unter- und Fehlversorgung" breit thematisiert.
Die zahlreichen gesundheitspolitischen Reformbemühungen zwischen dem ersten Kostendämpfungsgesetz im Jahre 1977 und dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) im Jahr 2004 umfassten aber jeweils auch Elemente, mit denen das Anbieterverhalten in die Richtung von politisch erwünschten Zielen gelenkt werden sollte. Erst allmählich berücksichtigte die Politik, dass ein Teil der Überinanspruchnahme auch Leistungen mit begrenztem bzw. gar keinem gesundheitlichen Nutzen betraf oder Leistungen mit überwiegend schädigenden Wirkungen umfasste. Dies wurde Anfang dieses Jahrzehnts unter den Schlagworten "Über-, Unter- und Fehlversorgung" breit thematisiert.
Die Bertelsmann-Stiftung hat zusammen mit dem Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen im Projekt "Gesundheitsmonitor" diese Thematik aufgegriffen und präsentiert in einem 75seitigen Chartbook "Anreize zur Verhaltenssteuerung im Gesundheitswesen - Effekte bei Versicherten und Leistungsanbietern" zahlreiche Forschungsbefunde und Ergebnisse aus Bevölkerungsumfragen.
Kapitel der Broschüre sind:
• Theoretische wie empirische Evidenz des "moral hazard"-Modells als Grundlage zum Einsatz der meisten Anreizinstrumente
• Überblick über die gesetzlichen Normen zur Verhaltenssteuerung von Nachfragern und Anbietern
• Beispiele aus ausgesuchten Industrieländern zu dort präferierten und angewandten Anreizmethoden und die damit verfolgten Ziele
• Im Mittelpunkt des Chartbooks steht die Darstellung des nationalen wie internationalen Wissensstandes über Anreizmodelle. Dieser Teil befasst sich mit den Erwartungen der Versicherten, der praktischen Relevanz der Modelle und den empirisch nachweisbaren erwünschten und unerwünschten Wirkungen und auch Rahmenbedingungen (z. B. Informiertheit der Patienten) ein. Im Vordergrund stehen Beispiele, die im deutschen Gesundheitswesen konzipiert oder realisiert sind.
Chartbook: Anreize zur Verhaltenssteuerung im Gesundheitswesen
Gerd Marstedt, 7.11.2006
Der homo oeconomicus im Gesundheitswesen
 Die deutschen Lehrbücher für Gesundheitsökonomie basieren mehr oder weniger auf dem Menschenbild des homo oeconomicus. Dieses grundlegende Paradigma der neoklassischen Ökonomie ist entweder trivial in dem Sinn, dass die Menschen immer versuchen, das Beste aus einer jeden Situation zu machen; oder sie hat nur sehr begrenzte empirische Evidenz, wie man anhand Mark Paulys "moral hazard"-Postulat zeigen kann. Es besagt, dass die öffentliche Finanzierung von Gesundheitsdiensten falsche Anreize setzt, weil die Nutzer versuchen würden, mehr Leistungen als erforderlich zu bekommen. Diese systematische Überkonsumtion medizinischer Leistungen könne nur durch Zuzahlungen etc. beschränkt werden. Eigentlich unterstellt Pauly, dass medizinische Behandlungen ein reines Vergnügen sind, von dem man gar nicht genug haben kann - eine äußerst unrealistische Annahme. Zuzahlungen haben nur dann eine rationale Wirkung auf die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen, wenn die Patienten eine wirkliche Wahl haben, etwa im Festbetragssystem für Arzneimittel.
Die deutschen Lehrbücher für Gesundheitsökonomie basieren mehr oder weniger auf dem Menschenbild des homo oeconomicus. Dieses grundlegende Paradigma der neoklassischen Ökonomie ist entweder trivial in dem Sinn, dass die Menschen immer versuchen, das Beste aus einer jeden Situation zu machen; oder sie hat nur sehr begrenzte empirische Evidenz, wie man anhand Mark Paulys "moral hazard"-Postulat zeigen kann. Es besagt, dass die öffentliche Finanzierung von Gesundheitsdiensten falsche Anreize setzt, weil die Nutzer versuchen würden, mehr Leistungen als erforderlich zu bekommen. Diese systematische Überkonsumtion medizinischer Leistungen könne nur durch Zuzahlungen etc. beschränkt werden. Eigentlich unterstellt Pauly, dass medizinische Behandlungen ein reines Vergnügen sind, von dem man gar nicht genug haben kann - eine äußerst unrealistische Annahme. Zuzahlungen haben nur dann eine rationale Wirkung auf die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen, wenn die Patienten eine wirkliche Wahl haben, etwa im Festbetragssystem für Arzneimittel.
Aber wenn es so wenige Belege für die Rationalität von Zuzahlungen gibt, weshalb war dann dieses Instrument in jedem Kostendämpfungsgesetz der letzten 30 Jahre in Deutschland enthalten? Die Gesundheits- und Sozialpolitik wird in Deutschland von einer hoch ideologischen Debatte über Lohnkosten und deren Wirkung auf Deutschlands Stellung im globalen Wettbewerb dominiert. Krankenkassenbeiträge werden als Lohnnebenkosten definiert und für die hohe Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht. Leistungskürzungen in der Gesundheitsversorgung sollen ein Impuls für wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung sein. Es gibt keine belastbaren Belege für diese Behauptung, aber sie beherrscht die veröffentlichte Meinung.
Ein anderes Paradigma der neoklassischen Ökonomie ist die umfassende Nützlichkeit des Wettbewerbs. Jedoch gibt es zwei verschiedenen Denkschulen, deren Protagonisten Walter Eucken und F. A. von Hayek sind. Während Eucken der freien Marktwirtschaft eine suizidale Tendenz zum Monopolismus unterstellt und deshalb für einen regulierten Wettbewerb plädiert, nimmt Hayek eine dogmatische Haltung zum freien Markt ein und weist jede politische Einflussnahme ab. Diese unterschiedlichen Grundsätze bestimmen auch heute noch die deutsche Debatte über den Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es ist evident, dass ein solches System nur mit einem Risikostrukturausgleich vernünftig funktionieren kann. Andernfalls entstünde ein total verzerrter Wettbewerb zu Lasten jener Krankenkassen, die chronisch Kranke und sozial Schwache versichern.
Die 36-seitige Studie des Ökonomen Hartmut Reiners stellt beide Paradigmen dar und kritisiert sie aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive. Die Ergebnisse liegen als Forschungspapier des WZB vor.
Hier finden Sie die PDF-Datei des Forschungspapers.
Bernard Braun, 5.11.2006
Früherkennungsuntersuchungen: Nicht-Teilnahme soll finanziell bestraft werden
 Im neuen Gesundheitsreform-Vorhaben der Großen Koalition ist geplant, Zuzahlungen bei späteren chronischen Erkrankungen dann zu erhöhen, wenn zuvor nicht an entsprechenden Früherkennungsuntersuchungen teilgenommen wurde. Zwar sind Details im Referentenentwurf zum "Wettbewerbsstärkungsgesetz" noch offen, fest steht jedoch, dass bei bestimmten (noch nicht abschließend festgelegten) chronischen Erkrankungen die Betroffenen bis zu 2 Prozent (statt ansonsten 1 Prozent) ihres Bruttoeinkommens für Zuzahlungen leisten müssen, wenn sie zuvor nicht an Früherkennungsuntersuchungen für diese Erkrankung teilgenommen haben. Das Vorhaben hat vielfältige Kritik hervorgerufen, unter anderem deshalb, weil Tauglichkeit und Zuverlässigkeit vieler Früherkennungsuntersuchung ungesichert sind.
Im neuen Gesundheitsreform-Vorhaben der Großen Koalition ist geplant, Zuzahlungen bei späteren chronischen Erkrankungen dann zu erhöhen, wenn zuvor nicht an entsprechenden Früherkennungsuntersuchungen teilgenommen wurde. Zwar sind Details im Referentenentwurf zum "Wettbewerbsstärkungsgesetz" noch offen, fest steht jedoch, dass bei bestimmten (noch nicht abschließend festgelegten) chronischen Erkrankungen die Betroffenen bis zu 2 Prozent (statt ansonsten 1 Prozent) ihres Bruttoeinkommens für Zuzahlungen leisten müssen, wenn sie zuvor nicht an Früherkennungsuntersuchungen für diese Erkrankung teilgenommen haben. Das Vorhaben hat vielfältige Kritik hervorgerufen, unter anderem deshalb, weil Tauglichkeit und Zuverlässigkeit vieler Früherkennungsuntersuchung ungesichert sind.
Gegen dieses Vorhaben hat jetzt das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. eine Pressemitteilung herausgegeben, in der die Regelung aus medizinischen, aber auch gesundheitsökonomischen Gründen abgelehnt wird. Die Mitteilung ist hier zu finden: Krebsfrüherkennung ist kein Weg, Kosten zu sparen.
Erwähnt wird dort auch die Stiftung Warentest, die 46 gängige Früherkennungsverfahren untersucht hat. Das Ergebnis unter dem Strich lautete: "Die meisten Methoden sind für die Krebsfrüherkennung nicht oder nur wenig geeignet." Als ungeeignet wurde ein Verfahren dabei eingestuft, wenn es zu viele "Falsch-Negativ-Befunde" liefert (der Tumor ist bereits vorhanden, wird aber mit der Methode nicht erkannt) oder auch zu viele "Falsch-Positiv-Befunde" (Das Testergebnis sagt, es gäbe einen Tumor, obwohl dies nicht der Fall ist). Für die Studie wurde internationale Fachliteratur und Studien gesichtet. Die Ergebnisse wurden jetzt in einer Buchveröffentlichung zusammen gestellt, mit insgesamt 50 Bewertungen zu den gängigsten Verfahren. Insgesamt fällt die Bilanz eher erschreckend aus. Nur die Mammografie ist bei Frauen zwischen 50 und 70 Jahren zur Krebsvorsorge geeignet, weitere 13 Methoden sind nur wenig oder mit Einschränkung geeignet und 36 Verfahren eignen sich überhaupt nicht zur Krebsfrüherkennung.
Als Negativbeispiel führt die Stiftung Warentest den sog. HPV-Test an. "Dieser soll als Früherkennungsmethode für Gebärmutterhalskrebs Infektionen der Muttermundschleimhaut mit bestimmten Warzenviren nachweisen. Einige dieser Viren können auch Jahre nach einer Infektion ein Krebswachstum begünstigen. Für den Test benötigt der Frauenartz einen Abstrich vom Gebärmuttermund. Dieser ist einfach und gefahrlos zu entnehmen. Doch bei vielen Frauen führt die Untersuchung zu falschen Verdachtsbefunden. Die Folge: Ängste und sogar unnötige Operationen. Zudem gibt es kaum zuverlässige Studien, die belegen, dass die Untersuchung das Risiko senkt, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Der HPV-Test ist daher als Früherkennungsmethode nicht geeignet."
Das Buch (290 Seiten) ist im Handel für 19,90 Euro erhältlich oder kann bei der Stiftung Warentest bestellt werden: Ratgeber Krebsfrüherkennung.
Unter dem Motto ""Wer nicht zur Krebs-Früherkennung geht, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben" berichtet auch eine andere Buchveröffentlichung über den "Mythos Krebsvorsorge". Christian Weymayr und Klaus Koch berichten in ihrer sorgfältig recherchierten Veröffentlichung (im Eichborn Verlag) über Schaden und Nutzen der Früherkennung. Im Klappentext heißt es: "Dies ist ein kritisches, aber kein polemisches Buch. Wir entwerfen keine Antithese zur gängigen Vorstellung 'Rechtzeitig erkannt - geheilt'. Wir beleuchten vielmehr Schaden und Nutzen der einzelnen Früherkennungsmethoden. Mit der pauschalen Ablehnung der Vorsorge würden wir in dieselbe Vereinfachungsfalle tappen wie deren Befürworter. [...] Der Präventionsgedanke gilt als der heilige Gral der Krebsmedizin. Die Eckpunkte der Argumentation: Rechtzeitig erkannte Tumoren lassen sich im Keim ersticken. Früherkennung ist harmlos und schadet nicht. Das Gesundheitssystem wird finanziell entlastet. Doch so einfach ist es nicht. Wir zeigen in diesem Buch, dass keines der Argumente wirklich stimmt. Dass die Befürworter sie dennoch mit soviel Vehemenz vortragen, macht das Mythische der Früherkennung aus."
Auf der Website Mythos Krebsvorsorge wird das detaillierte Inhaltverzeichnis der Buchveröffentlichung gezeigt und es gibt ausführliche Leseproben (mehrere Kapitel, u.a.: Leben mit der Angst vor Krebs - Wie man sich fühlt, wenn man zur Früherkennung geht - Unnötige Sorgen - Wenn ein Verdacht zur Sicherheit wird - Wie man sich fühlt, wenn man nicht zur Früherkennung geht - Vom Gesunden zum Patienten).
Gerd Marstedt, 30.10.2006
Kaiserschnitt-Geburt: Kein Wunsch von Frauen
 Die auffällige Zunahme von Kaiserschnitt-Geburten in deutschen Krankenhäusern ließ den Verdacht aufkommen, die Frauen selbst würden den Anstieg der Rate verursachen. Prominenten Vorbildern folgend, würden werdende Mütter einen Kaiserschnitt einfordern, auch wenn keine medizinische Indikation vorliegt: völlig falsch. Das belegt jetzt eine Studie, die Professorin Petra Kolip vom Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) im Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen (IPP) im Auftrag der Gmünder ErsatzKasse GEK erstellt hat. Die Ergebnisse sind am gestrigen Mittwoch (26. April 2006) der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Danach wollen nur zwei Prozent der Frauen einen Wunsch-Kaiserschnitt. Fast 90 Prozent der Frauen, die eine Kaiserschnitt-Geburt hinter sich haben, sind der Ansicht, dass dieser nur im Notfall durchgeführt werden sollte.
Die auffällige Zunahme von Kaiserschnitt-Geburten in deutschen Krankenhäusern ließ den Verdacht aufkommen, die Frauen selbst würden den Anstieg der Rate verursachen. Prominenten Vorbildern folgend, würden werdende Mütter einen Kaiserschnitt einfordern, auch wenn keine medizinische Indikation vorliegt: völlig falsch. Das belegt jetzt eine Studie, die Professorin Petra Kolip vom Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) im Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen (IPP) im Auftrag der Gmünder ErsatzKasse GEK erstellt hat. Die Ergebnisse sind am gestrigen Mittwoch (26. April 2006) der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Danach wollen nur zwei Prozent der Frauen einen Wunsch-Kaiserschnitt. Fast 90 Prozent der Frauen, die eine Kaiserschnitt-Geburt hinter sich haben, sind der Ansicht, dass dieser nur im Notfall durchgeführt werden sollte.
In zehn Jahren erhöhte sich der Anteil der Entbindungen durch Kaiserschnitt in deutschen Krankenhäusern von 17 auf 27 Prozent. Als Gründe werden ein verändertes Risikoprofil der Schwangeren, beispielsweise ein höheres Durchschnittsalter, aber auch organisatorische oder ökonomische Gründe genannt. Wissenschaftlerinnen vom Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen (IPP) werteten für die GEK Kaiserschnittstudie die persönlichen Erfahrungen von 1.339 Frauen aus, die im Jahr 2004 per Kaiserschnitt entbunden hatten. Beim primären Kaiserschnitt, der vor der Geburt geplant wird, ist zu 60 Prozent die Empfehlung der Ärztinnen und Ärzte ausschlaggebend. Die Studie ergab, das nur bei zwei Prozent der Frauen von einem "Wunschkaiserschnitt" ausgegangen werden kann. "Die Ergebnisse der GEK Studie zeigen, dass das Argument, es seien die Frauen selbst, die den Anstieg der Kaiserschnittraten verursachen, weil sie auch ohne medizinische Indikation auf eine Schnitt-Entbindung drängen, ein Mythos ist," betont Professor Petra Kolip vom IPP.
Für den so genannten sekundären Kaiserschnitt, bei dem die Entscheidung zur Operation während der Geburt fällt, waren zu 39 Prozent die schlechten Herztöne des Kindes Auslöser für den Schnitt; bei 37 Prozent führte Geburtsstillstand zu dem Eingriff. Allerdings fühlte sich nur die Hälfte der Frauen tatsächlich in die Entscheidung für einen Kaiserschnitt eingebunden. "Hier gibt es sicherlich noch Handlungsbedarf. Internationale Studien zeigen jedenfalls, dass die Zufriedenheit mit dem Geburtserlebnis umso größer ist, je stärker die Bedürfnisse der Frauen bei der Geburt berücksichtigt werden", lautet eine Schlussfolgerung der Bremer Gesundheitswissenschaftlerin Petra Kolip
Der Bericht (176 Seiten) kann als PDF-Datei hier heruntergeladen werden: U.Lutz, P.Kolip: Die GEK-Kaiserschnittstudie
Gerd Marstedt, 25.10.2006
Der unerschütterliche Glaube an Kostendämpfung durch Zuzahlungen
 Kaum ein Monat vergeht, ohne dass aus mehr oder weniger berufenem Munde der Ruf nach höheren Zuzahlungen im Krankheitsfall erklingt. Im Zuge der Fußballweltmeisterschaft und der darin geschickt verborgenen Idee vom Gesundheitsfonds war es kurzzeitig ruhig geworden um die Frage von mehr Geldbeutel bestimmter Eigenverantwortlichkeit. Doch nach der Sommerpause trat zuerst der Baden-Württembergische Ministerpräsident Oettinger mit seiner Forderung nach anteiligen Selbstbeteiligungen auch für kostspielige Behandlungen in die Bütt . Andere übliche Verdächtige um Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt ließen nicht auf sich warten und stießen in dasselbe Horn.
Kaum ein Monat vergeht, ohne dass aus mehr oder weniger berufenem Munde der Ruf nach höheren Zuzahlungen im Krankheitsfall erklingt. Im Zuge der Fußballweltmeisterschaft und der darin geschickt verborgenen Idee vom Gesundheitsfonds war es kurzzeitig ruhig geworden um die Frage von mehr Geldbeutel bestimmter Eigenverantwortlichkeit. Doch nach der Sommerpause trat zuerst der Baden-Württembergische Ministerpräsident Oettinger mit seiner Forderung nach anteiligen Selbstbeteiligungen auch für kostspielige Behandlungen in die Bütt . Andere übliche Verdächtige um Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt ließen nicht auf sich warten und stießen in dasselbe Horn.
Damit zeigen sie vor allem eins: Von der Sache verstehen sie nichts. Entgegen der auch von unzähligen "WirtschaftsexpertInnen" ununterbrochen wiederholten Wunschvorstellung sind Zuzahlungen im Krankheitsfall nicht nur unsozial, sondern können die Kassen teuer zu stehen kommen. Ein Kommentar in der tageszeitung vom 28.8.2006 zeigt einige Risse des unverwüstlich erscheinenden Mythos Kostendämpfung durch Zuzahlungen auf.
Hier finden Sie den taz-Kommentar Der wahre Preis der Zuzahlungen
Jens Holst, 28.8.2006
Exportschlager Praxisgebühr?
 Eine gemeinsame Untersuchung des Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung und der TU Berlin stellt für 2004 einen signifikanten Rückgang der Arztbesuche im Vergleich zum Vorjahr 2003 fest. Aufgrund der Berechnung von zwei Modellen schließen die Autoren, gesundheitlich notwendige Arztbesuche seien unverändert erfolgt und es sei nicht zu sozialer Benachteiligung von GeringverdienerInnen gekommen. Insgesamt habe die Einführung der Praxisgebühr dazu beigetragen, die Zahl nicht notwendiger Arztbesuche oder Mehrfachuntersuchungen zu verringern. Die Zuzahlungsregelungen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) avancierten damit nicht nur zum Ei des Kolumbus, sondern bieten sich als Exportschlager aus deutschen Landen an - schließlich ist es noch in keinem anderen Gesundheitssystem der Erde gelungen, mit Hilfe von Zuzahlungen treffsicher zwischen "berechtigten" und "überflüssigen" medizinischen Leistungen zu unterscheiden und die ärmere Bevölkerung nicht auszugrenzen.
Eine gemeinsame Untersuchung des Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung und der TU Berlin stellt für 2004 einen signifikanten Rückgang der Arztbesuche im Vergleich zum Vorjahr 2003 fest. Aufgrund der Berechnung von zwei Modellen schließen die Autoren, gesundheitlich notwendige Arztbesuche seien unverändert erfolgt und es sei nicht zu sozialer Benachteiligung von GeringverdienerInnen gekommen. Insgesamt habe die Einführung der Praxisgebühr dazu beigetragen, die Zahl nicht notwendiger Arztbesuche oder Mehrfachuntersuchungen zu verringern. Die Zuzahlungsregelungen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) avancierten damit nicht nur zum Ei des Kolumbus, sondern bieten sich als Exportschlager aus deutschen Landen an - schließlich ist es noch in keinem anderen Gesundheitssystem der Erde gelungen, mit Hilfe von Zuzahlungen treffsicher zwischen "berechtigten" und "überflüssigen" medizinischen Leistungen zu unterscheiden und die ärmere Bevölkerung nicht auszugrenzen.
Eine eingehendere Betrachtung der Untersuchung wirft denn auch mehr Fragen auf, als die vollmundigen Schlussfolgerungen erwarten ließen. Warum die positive Einschätzung in Frage zu stellen ist, erklärt eine Kurzanalyse mit etlichen Literaturverweisen, die im Rahmen einer umfangreicheren Forschungsarbeit für das Wissenschaftszentrum Berlin den Effekten von Zuzahlungen im Gesundheitswesen auf den Grund geht.
Hier finden Sie das DIW-TU-Discussion Paper 506
Hier finden Sie die PDF-Datei: Stellungnahme zur DIW-TU-Studie Praxisgebühr
Jens Holst, 15.5.2006
Zuzahlungen im Gesundheitswesen - ein unerschütterbarer Mythos
 Spätestens mit Inkrafttreten des Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) Anfang 2004 traten Zuzahlungen im Krankheitsfall massiv in das öffentliche Bewusstsein der Bevölkerung. Neben erhöhter Selbstbeteiligung für Medikamente und Heilmittel erregte vor allem die Praxisgebühr die Gemüter. Angesichts steigender Gesundheitsausgaben soll die finanzielle Beteiligung der PatientInnen an den Kosten die Eigenverantwortlichkeit stärken und zu einer spürbaren Entlastung der Sozialversicherungskassen beitragen. Dieser Ansatz ist weder neu noch besonders originell, Selbstbeteiligungen im Krankheitsfall sind in den allermeisten Ländern dieser Welt anzutreffen. Direktzahlungen für Gesundheitsleistungen sollen die Gesundheitssysteme finanziell entlasten und gleichzeitig die vermeintliche übertriebene Inanspruchnahme verringern.
Spätestens mit Inkrafttreten des Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) Anfang 2004 traten Zuzahlungen im Krankheitsfall massiv in das öffentliche Bewusstsein der Bevölkerung. Neben erhöhter Selbstbeteiligung für Medikamente und Heilmittel erregte vor allem die Praxisgebühr die Gemüter. Angesichts steigender Gesundheitsausgaben soll die finanzielle Beteiligung der PatientInnen an den Kosten die Eigenverantwortlichkeit stärken und zu einer spürbaren Entlastung der Sozialversicherungskassen beitragen. Dieser Ansatz ist weder neu noch besonders originell, Selbstbeteiligungen im Krankheitsfall sind in den allermeisten Ländern dieser Welt anzutreffen. Direktzahlungen für Gesundheitsleistungen sollen die Gesundheitssysteme finanziell entlasten und gleichzeitig die vermeintliche übertriebene Inanspruchnahme verringern.
Doch zeigt die internationale Erfahrung, dass erhebliche Zweifel an diesen Wirkungen angebracht sind. Einerseits wirkt sich die Selbstbeteiligung zwar negativ auf die Zahl der Arztkontakte aus, aber nicht unbedingt auf die wirklich teuren Leistungen. Und vor allem tendieren ökonomische Ansätze dazu, das "Anspruchsverhalten" im Gesundheitswesen massiv zu überschätzen. Ob die postulierten Auswirkungen von Zuzahlungen wirklich zutreffen, ist mehr als fraglich.
Fakten und Mythen von Selbstbeteiligungen geht die detailreiche und ausführliche Analyse des Internisten und Gesundheitswissenschaftler Jens Holst auf den Grund. Wem die einseitige Debatte über "Eigenverantwortlichkeit" und die oftmals platten ökonomisch motivierten Argumente für eine zunehmende Privatisierung sozialer Lasten unbehaglich ist, der findet in dem Text eine Fülle von Argumenten und Erfahrungen, welche die vorherrschende Argumentation erheblich entkräften und viele der vermeintlich alternativlosen Ansätze entmystifizieren.
Für "schnelle LeserInnen": Hier finden Sie eine Kurzfassung des Textes als PDF-Datei, erschienen im Deutschen Ärzteblatt.
Hier finden Sie den ausführlichen Text als PDF-Datei: Zuzahlungen im Gesundheitswesen
Jens Holst, 23.11.2005
Scheitern eines scheinbaren Patentrezeptes: die Patientenquittung
 Als sie noch nicht gesetzlich vorgeschrieben und administrativ in Kraft gesetzt war (vor 2004 gab es zwar entsprechende Paragraphen im Sozialgesetzbuch aber keine für die Umsetzung notwendigen Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Ärzteschaft), schien sie einer der wichtigsten Beiträge für mehr Transparenz, Kostenersparnis und Steuerung der Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen: Die Patientenquittung. Über anderthalb Jahre nachdem der Paragraph 305, Absatz 2 des Sozialgesetzbuchs 5 seit Anfang 2004 einen Rechtsanspruch auf diese Art der Auskunft an Versicherte festschrieb und die Beteiligten zum Handeln verpflichtete, resumierte die "Ärzte Zeitung" am 5.10. 2005: "Zwar wollen nur wenige Patienten eine Patientenquittung. Aber richtig informiert über das wahre Honorar werden selbst sie - systembedingt - oft nicht." Nach einer "vorsichtigen Schätzung" der Kassenärztlichen Bundesvereinigung werden im Moment rund 25.000 Quittungen pro Jahr ausgestellt, ob mit korrektem Inhalt "weiß niemand" (Ärzte Zeitung).
Als sie noch nicht gesetzlich vorgeschrieben und administrativ in Kraft gesetzt war (vor 2004 gab es zwar entsprechende Paragraphen im Sozialgesetzbuch aber keine für die Umsetzung notwendigen Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Ärzteschaft), schien sie einer der wichtigsten Beiträge für mehr Transparenz, Kostenersparnis und Steuerung der Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen: Die Patientenquittung. Über anderthalb Jahre nachdem der Paragraph 305, Absatz 2 des Sozialgesetzbuchs 5 seit Anfang 2004 einen Rechtsanspruch auf diese Art der Auskunft an Versicherte festschrieb und die Beteiligten zum Handeln verpflichtete, resumierte die "Ärzte Zeitung" am 5.10. 2005: "Zwar wollen nur wenige Patienten eine Patientenquittung. Aber richtig informiert über das wahre Honorar werden selbst sie - systembedingt - oft nicht." Nach einer "vorsichtigen Schätzung" der Kassenärztlichen Bundesvereinigung werden im Moment rund 25.000 Quittungen pro Jahr ausgestellt, ob mit korrektem Inhalt "weiß niemand" (Ärzte Zeitung).
Die wahrscheinlich dauerhaft geringe Nutzung dieses Angebots und den daraus folgenden Hinweis, die Patientenquittung nicht als Patentrezept zu euphorisieren, hätte man allerdings bereits dem im Mai 2003 vom "Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland" veröffentlichten Bericht "Modellversuch: Ausgabe einer vertragsärztlichen Leistungs- und Kosteninformation (Lki) in der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen. Ergebnisbericht der wissenschaftlichen Beleitung (Evaluation)" entnehmen können.
In diesem Bericht finden sich eingangs auch die Ergebnisse früherer Modellversuche:
• Beim von 1962 bis 1967 gelaufenen Modellversuch bei der BKK Carl Zeiss "ergab sich keine statistisch signifikante Veränderung in der Inanspruchnahme der Ärzte durch die Versicherten ... . Die Ärzte konnten auch keine Änderung im Arzt-Patientenverhältnis feststellen. Die Mehrzahl hielt die Aktion für wirkungslos, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf erwünschte pädagogische Effekte, z.B. Aktivierung des Gesundheitswillens und der Mitverantwortung." (S. 6)
• Die Beteiligung am von 1986 bis Anfang der 1990er Jahre laufenden Modellversuch bei der Bundesknappschaft war "verschwindend gering" (S. 6).
• Die Nutzung des Angebots der KV Hessen lag 1988 im "Pro-Mille-Bereich" (S. 7).
Das trotz dieser auch bereits 2002 bekannten Erfahrungen durchgeführte Modellprojekt im Bereich der KV Rheinhessen erbrachte trotz erheblicher Werbung und Ausstattung qualitativ nichts Neues:
• In den 67 Arztpraxen, die sich am Modellversuch beteiligten, sank der Anteil von an einer Patientenquittung interessierten Patienten von 21,9 Prozent (im 2. Quartal 2002 = 16.954 Personen) über 15,2 Prozent im 3. Quartal auf 14 Prozent (= 10.956 Personen) im 4. Quartal 2002.
- "Auch in der Längsschnittbetrachtung wurde deutlich, dass das Interesse der Patienten an einer Quittung auf Dauer zurückgeht: Gerade ein Viertel der Patienten, die im ersten Modell-Quartal eine Quittung mitgenommen haben, taten dies auch im zweiten. Wiederum die Hälfte davon war im dritten Quartal noch interessiert."(S. 17)
• Ersatzkassenversicherte und 30-50-jährige Patienten waren überrepräsentiert, AOK-Versicherte und Ältere unterrepräsentiert.
• Insgesamt 19 Patienten mit Quittung ließen diese von der KV überprüfen, 8 Teilnehmer nutzten die kostenlose Beratungs-Hotline der KV.
• Von 6.500 zur Verteilung eingeplanten Fragebögen an Quittungsnutzer wurden im 3. Quartal 2002 tatsächlich 3.784 ausgegeben. Davon kamen 522 oder 13,8 % ausgefüllt zurück. Gemessen an der beabsichtigten Anzahl von Fragebögen betrug der Rücklauf aber nur rund 8 Prozent. Von dieser extremen Minderheit hielten dann 80 Prozent die Quittung "für wichtig und hilfreich" was für die Ministerin U. Schmidt ein Argument für die gesetzliche Vorschrift war. Realistischer waren hier die Feststellungen im Evaluationsbericht, dass "man davon ausgehen (muss), dass die ... Aussagen überwiegend für solche Patienten stehen, welche die Quittung als Angebot nützlich finden und dass der überwiegende Teil der Nichtbeantworter unter den Quittungsempfängern das Quittungsangebot als unnötig ansieht." (S. 94)
Deutlicher kann eine Evaluation kaum ausfallen und es ist kein Wunder, dass die Umsetzung im Alltag der gesundheitlichen Versorgung so dürftig ausfällt. Die hochgesteckten Erwartungen in die Steuerung von Patienten- und Arztverhalten durch Patientenquittungen sind nachhaltig meist "heiße Luft" und - wenn überhaupt gewollt - nur durch andere Instrumente zu erreichen.
Hier finden Sie die umfangreiche PDF-Datei (7,6 MB): Evaluation des Modellversuchs zur Patientenquittung (2003)
Bernard Braun, 10.10.2005
Immer weniger Sonntagskinder, immer mehr Wunsch-Kaiserschnitte
 Die Anzahl der Geburten an Wochenenden und insbesondere an Sonntagen geht in Deutschland immer weiter zurück. Professor Alexander Lerchl von der International University Bremen (IUB) analysierte über 700.000 Geburten zwischen 1988 und 2003 und verglich die Erhebungen mit älteren Daten. Verglichen mit dem Freitag, dem Wochentag mit den meisten Geburten, sind im Jahre 2003 über 26% weniger Kinder an Sonntagen zur Welt gekommen. Für Samstage sank die Anzahl um immerhin ca. 23%. "Dieser Trend begründet sich durch die zunehmende Anzahl an Geburten, die medikamentös eingeleitet werden sowie durch Kaiserschnitte. Diese ersetzen gegenüber früheren Jahren mehr und mehr die spontane Geburt", erklärte Lerchl. "Ursachen der Entwicklung sind vermutlich praktische und finanzielle Gesichtspunkte, denn Geburten an Wochenenden sind durch Zuschläge an Ärzte und Hebammen teurer." Oft werde den Müttern aus medizinischen Gründen zur künstlichen Einleitung der Geburt oder Kaiserschnitt geraten, dabei seien Risiken einer eingeleiteten Geburt nicht zu unterschätzen. Bluthochdruck der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Säugling könnten Nebenwirkungen sein. Aktuell sieht Lerchl zwar noch natürliche Geburten in der Überzahl, die Tendenz zur eingeleiteten Geburt sei jedoch deutlich.
Die Anzahl der Geburten an Wochenenden und insbesondere an Sonntagen geht in Deutschland immer weiter zurück. Professor Alexander Lerchl von der International University Bremen (IUB) analysierte über 700.000 Geburten zwischen 1988 und 2003 und verglich die Erhebungen mit älteren Daten. Verglichen mit dem Freitag, dem Wochentag mit den meisten Geburten, sind im Jahre 2003 über 26% weniger Kinder an Sonntagen zur Welt gekommen. Für Samstage sank die Anzahl um immerhin ca. 23%. "Dieser Trend begründet sich durch die zunehmende Anzahl an Geburten, die medikamentös eingeleitet werden sowie durch Kaiserschnitte. Diese ersetzen gegenüber früheren Jahren mehr und mehr die spontane Geburt", erklärte Lerchl. "Ursachen der Entwicklung sind vermutlich praktische und finanzielle Gesichtspunkte, denn Geburten an Wochenenden sind durch Zuschläge an Ärzte und Hebammen teurer." Oft werde den Müttern aus medizinischen Gründen zur künstlichen Einleitung der Geburt oder Kaiserschnitt geraten, dabei seien Risiken einer eingeleiteten Geburt nicht zu unterschätzen. Bluthochdruck der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Säugling könnten Nebenwirkungen sein. Aktuell sieht Lerchl zwar noch natürliche Geburten in der Überzahl, die Tendenz zur eingeleiteten Geburt sei jedoch deutlich.
Parallel zu diesen Beobachtungen gibt es seit geraumer Zeit auch Erkenntnisse über die immer weiter steigende Zahl von Kaiserschnitten auf Wunsch der Mütter. Nach Informationen des Sozialministeriums in Stuttgart hat die Zahl der Kaiserschnitte in den vergangenen 15 Jahren um mehr als die Hälfte zugenommen. In den Krankenhäusern Baden-Württembergs wurden im Jahre 2003 insgesamt 95 216 Frauen entbunden, darunter 25 574 mit Kaiserschnitt, 4 842 mithilfe der Saugglocke (Vakuumextraktion) und 715 mithilfe der Geburtszange. Möglicher Hintergrund: Fallpauschalen der Kliniken fördern den Trend. werde. Marianne Dirks, Vorsitzende des Hebammenverbandes Baden-Württemberg: "Für einen Kaiserschnitt bekommt ein Krankenhaus 3000 Euro vergütet - etwa doppelt so viel wie für ein normale Geburt." Zu Anfang der Schwangerschaft wünschen sich nur vier Prozent der Frauen einen Kaiserschnitt, erklärte Dirks. Viele Schwangere würden jedoch zunehmend im Laufe der Schwangerschaft verunsichert. In einem Bericht im Statistischen Monatsheft Baden-Württemberg "Immer mehr Kaiserschnitte bei immer weniger Geburten" finden sich viele weitere Details zu diesen Beobachtungen.
Im Forschungsprojekt "Technisierung der 'normalen' Geburt - Interventionen im Kreißsaal" wurden an der Universität Osnabrück Daten von mehr als einer Million Geburten analysiert. Das Fazit der Wissenschaftlerinnen Clarissa M. Schwarz und Beate A. Schücking heißt: "Eine Risikoschwangerschaft ist zur Regel geworden und eine normale Schwangerschaft zur Ausnahme. Unsere Studie bestätigt, dass drei von vier Schwangeren als "risikoschwanger" definiert werden und in unserem Gesundheitssystem nach wie vor die Tendenz besteht, die überzuversorgen, die es am wenigsten brauchen." Nach den Ergebnissen der Studie hat sich der Zustand der Neugeborenen jedoch nicht weiter verbessert. Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse findet sich hier: Adieu, normale Geburt? Ergebnisse eines Forschungsprojekts sowie in diesem Aufsatz: Selbstbestimmt und risikolos? Wunschkaiserschnitt
Gerd Marstedt, 7.10.2005
Hormontherapie: Neuere Forschungserkenntnisse gelangen kaum in Arztpraxen
 Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WidO) hat in einer Befragung von rund 400 niedergelassenen Frauenärzten in Deutschland zur umstrittenen Hormontherapie nach der Menopause einige Besorgnis erregende Erkenntnisse gewonnen. Danach "zeigen die Gynäkologen generell eine unkritische Grundhaltung gegenüber der Hormonbehandlung in und nach den Wechseljahren". Einstellung und Verhalten vieler Gynäkologen stehen im Widerspruch zu Studien mit hover Evidenz, wonach die Gesundheitsrisiken einer Hormontherapie bei gesunden Frauen deutlicher höher sind als der Nutzen.
Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WidO) hat in einer Befragung von rund 400 niedergelassenen Frauenärzten in Deutschland zur umstrittenen Hormontherapie nach der Menopause einige Besorgnis erregende Erkenntnisse gewonnen. Danach "zeigen die Gynäkologen generell eine unkritische Grundhaltung gegenüber der Hormonbehandlung in und nach den Wechseljahren". Einstellung und Verhalten vieler Gynäkologen stehen im Widerspruch zu Studien mit hover Evidenz, wonach die Gesundheitsrisiken einer Hormontherapie bei gesunden Frauen deutlicher höher sind als der Nutzen.
Über die Hälfte (53%) der Ärzte meinten, die Therapie sei wichtig, um dem Alterungsprozess von Frauen entgegenzuwirken, 43% erklärten, dass in Deutschland zu wenig Frauen Hormone erhielten, 79% gaben an, die Risiken dieser Therapie würden überschätzt. Ein Hintergrund dieser Fehleinschätzungen liegt wohl darin, so vermutet das WIdO, dass der Informationsstand der Ärzte sehr stark durch Veröffentlichungen der Pharma-Industrie geprägt ist, während Fachveröffentlichungen (etwa von AkdÄ, BfArM, KV) kaum zur Kenntnis genommen werden.
Mehr Details und Ergebnisse der Befragung: WidO: Frauenärzte unterschätzen Gesundheitsrisiken
Gerd Marstedt, 24.7.2005
Gesundheitsreform: Die Bürger sparen auch an ihrer Gesundheit
 Die Deutschen haben ihr Gesundheitsverhalten in den vergangenen zwölf Monaten infolge der Gesundheitsreform deutlich verändert und mit großer Mehrheit (77%) eine oder mehrere "Sparmaßnahmen" ergriffen. Nach eigenen Angaben verzichteten 40 Prozent der Bevölkerung im Krankheitsfall auf Medikamente und griffen stattdessen auf altbewährte "Hausmittel" zurück. 15 Prozent nahmen weniger rezeptpflichtige Medikamente ein, um Zuzahlungen einzusparen; 21 Prozent kauften weniger rezeptfreie Medikamente. 23 Prozent haben ihr Medikamenten-Einnahmevolumen zwar nicht grundsätzlich reduziert, aber auf preisgünstigere Arzneimittel zurückgegriffen.
Die Deutschen haben ihr Gesundheitsverhalten in den vergangenen zwölf Monaten infolge der Gesundheitsreform deutlich verändert und mit großer Mehrheit (77%) eine oder mehrere "Sparmaßnahmen" ergriffen. Nach eigenen Angaben verzichteten 40 Prozent der Bevölkerung im Krankheitsfall auf Medikamente und griffen stattdessen auf altbewährte "Hausmittel" zurück. 15 Prozent nahmen weniger rezeptpflichtige Medikamente ein, um Zuzahlungen einzusparen; 21 Prozent kauften weniger rezeptfreie Medikamente. 23 Prozent haben ihr Medikamenten-Einnahmevolumen zwar nicht grundsätzlich reduziert, aber auf preisgünstigere Arzneimittel zurückgegriffen.
Gleichzeitig setzt sich die in Deutschland seit Jahren rückläufige Tendenz zum Arztbesuch unvermindert fort: Gaben 1998 noch 56 Prozent der Deutschen an, gleich zum Arzt zu gehen, wenn sie sich unwohl fühlen oder spüren, dass sie krank werden, so sind dies aktuell nur noch 29 Prozent (Vorjahr: 35%). Rund 20 Prozent der Bundesbürger verschoben auf Grund der Praxisgebühr eigentlich sinnvolle Arztbesuche oder unterließen diese ganz. Insgesamt sind die Bundesbürger bezüglich der Entwicklungen im Gesundheitswesen nach wie vor stark verunsichert und erleben ein turbulentes Durcheinander der verschiedenen Reformansätze und Beteiligten.
Dies ergab jetzt die groß angelegte Studie "Health Care Monitoring 2005" des Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstituts psychonomics AG zum deutschen Gesundheitsmarkt. 1.504 Bundesbürger ab 16 Jahren wurden dazu repräsentativ befragt. Die Selbstmedikationsbereitschaft der Deutschen liegt auf hohem Niveau: 56 Prozent versuchen sich, wann immer es geht, zunächst mit rezeptfreien Medikamenten selbst zu helfen. Die monatlichen Ausgaben für rezeptfreie Medikamente (OTC-Präparate) haben sich im vergangenen Jahr durchschnittlich um 10% erhöht. Der Apotheker schlüpft zunehmend in eine beratende Rolle und der Gang in die Apotheke wird zum "kleinen Arztbesuch zwischendurch".
Quelle und weitere Informationen zur Studie: psychonomics.de
ch, 6.7.2005