



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Patienteninteressen |
Alle Artikel aus:
Patienten
Patienteninteressen
"Lack of transparency in clinical trials harms patients. The timely posting of summary results is an ... obligation" (TI/Cochrane)
 Nicht zuletzt durch die gegenwärtige CoVid-19-Pandemie befeuert spielen Studien in immer mehr Darstellungen gesundheitlicher Probleme und den Debatten über die Pros und Cons ihrer Prävention und Therapie eine zentrale Rolle. Studien, die in einer peer-reviewten Fachzeitschrift veröffentlicht worden sind werden dabei als besonders valide und aussagekräftig bewertet.
Nicht zuletzt durch die gegenwärtige CoVid-19-Pandemie befeuert spielen Studien in immer mehr Darstellungen gesundheitlicher Probleme und den Debatten über die Pros und Cons ihrer Prävention und Therapie eine zentrale Rolle. Studien, die in einer peer-reviewten Fachzeitschrift veröffentlicht worden sind werden dabei als besonders valide und aussagekräftig bewertet.
Dass viele Aufsätze über CoVid-19-Pandemie-Studien zwar erst vorläufig nur auf so genannten Preprint-Servern zugänglich sind, also noch nicht von unabhängigen Wissenschaftler*innen überprüft worden sind, sich aber trotzdem auf gesundheitspolitische Entscheidungen auswirken, stellt daher ein Problem der Transparenz über wissenschaftliche Studien dar. Bei solchen Texten handelt es sich oft um vorläufige Erkenntnisse, die in einem Peer Review-Verfahren geändert werden.
Ein anderes, wesentlich unbekannteres Problem ist, dass die Ergebnisse vieler Studien nicht nur nicht in einer Fachzeitschrift oder auf einem Preprint-Server veröffentlicht worden sind, sondern noch nicht einmal ihre Existenz öffentlich bekannt wird.
Dabei verpflichtet die Leitlinie 2012/302 03/EG der Europäischen Kommission seit 2014 alle Sponsoren von in der EU durchgeführten klinischen Studien zumindest eine Zusammenfassung der Ergebnisse klinischer Prüfungen in der EU-Datenbank für klinische Prüfungen (EudraCT) spätestens ein Jahr (6 Monate bei pädiatrischen Studien) nach Beendigung über das EU-Register für klinische Prüfungen öffentlich zugänglich zu machen. Näheres findet sich in dem Gemeinsamen Schreiben der Europäischen Kommission, der EMA und der HMA vom 20.6. 2019.
Wer sich für die Praxis dieser Verpflichtung zur Transparenz interessiert findet themenspezifische Reports auf der Website TranspariMED - Working to end evidence distortion in medicine. TranspariMED ist eine non-profit-Vereinigung, deren Arbeit von rund 30 europäischen Organisationen (z.B. Cochrane, HealthWatch, BUKO Pharmakampagne) u.a. mit Forschungsaufträgen unterstützt wird.
Die Überschriften der neuesten Reports zeigen bereits, dass klare Verstöße gegen die Transparenzpflichten und damit mögliche nachteilige Folgen für Patient*innen keine Einzelfälle sind, sondern eine systematische Praxis in vielen Ländern, privaten oder universitären Forschungseinrichtungen sind:
• Hundreds of clinical trials involving children are missing results across Europe
• Over half of COVID trials in Europe may never make their results public
• FDA leaves $10 billion in fines uncollected as thousands of clinical trials go unreported
• Scandinavian universities perform dismally (duster) at reporting clinical trial results
• Austria: 273 clinical trials of medicines are missing results
In weiteren Beiträgen setzen sich die Autor*innen der Website mit Argumenten auseinander, die einige der Protagonisten dieser Art von Intransparenz für ihr Verhalten vorbringen. So werden oftmals die Ergebnisse von Studien mit dem Argument, es wären zu wenig Teilnehmer*innen gewesen, es gäbe keine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift oder das erwartete Ergebnis wäre nicht erreicht worden, nicht an die EU-Datenbank gemeldet. Viele kleine Studien hätten aber u.U. kumulativ durchaus praktische Relevanz - so die Autor*innen von TranspariMED. Und das Wissen, dass ein bestimmtes Therapeutikum nicht wirkt, habe sehr wohl praktische Bedeutung.
Bernard Braun, 7.8.20
Beeinflusst in den USA die Behandlung durch nicht-weiße Ärzte die Gesundheit nicht-weißer Männer? Ja, und was ist in Deutschland!?
 Afroamerikanische männliche (auch weibliche) US-Bürger leben fast 5 Jahre kürzer als nichthispanische weiße Männer. Rund 60% dieser kürzeren Lebenserwartung beruht auf der höheren Prävalenz chronischer Erkrankungen unter den Afroamerikanern. Ein wiederum großer Anteil dieser Erkrankungen könnte durch präventive Interventionen z.B. durch Veränderungen des Lebensstiles, durch Impfungen oder durch die Nutzung von Früherkennungsuntersuchungen vermieden oder der Zeitpunkt der Erkrankung zeitlich hinausgeschoben werden. Die meisten dieser Maßnahmen setzen aber einen Arztbesuch bzw. eine ärztliche Behandlung voraus. Und damit kommt eine weitere Ungleichheit im us-amerikanischen Gesundheitssystem zur Geltung. Während der Anteil der Afroamerikaner an der Gesamtbevölkerung rund 13% beträgt, gehören nur 4% der Ärzt*innen und 7% der Medizinstudierenden dieser ethnischen (im englischen Originaltext werden hier immer Begriffe wie "race" oder "same-race" benutzt, die im Deutschen negativ belastet sind und deshalb nicht direkt übersetzt werden) Gruppe an.
Afroamerikanische männliche (auch weibliche) US-Bürger leben fast 5 Jahre kürzer als nichthispanische weiße Männer. Rund 60% dieser kürzeren Lebenserwartung beruht auf der höheren Prävalenz chronischer Erkrankungen unter den Afroamerikanern. Ein wiederum großer Anteil dieser Erkrankungen könnte durch präventive Interventionen z.B. durch Veränderungen des Lebensstiles, durch Impfungen oder durch die Nutzung von Früherkennungsuntersuchungen vermieden oder der Zeitpunkt der Erkrankung zeitlich hinausgeschoben werden. Die meisten dieser Maßnahmen setzen aber einen Arztbesuch bzw. eine ärztliche Behandlung voraus. Und damit kommt eine weitere Ungleichheit im us-amerikanischen Gesundheitssystem zur Geltung. Während der Anteil der Afroamerikaner an der Gesamtbevölkerung rund 13% beträgt, gehören nur 4% der Ärzt*innen und 7% der Medizinstudierenden dieser ethnischen (im englischen Originaltext werden hier immer Begriffe wie "race" oder "same-race" benutzt, die im Deutschen negativ belastet sind und deshalb nicht direkt übersetzt werden) Gruppe an.
Zu dieser quantitativen Lücke kommt noch ein qualitatives Misstrauen der Afroamerikaner gegen das mehrheitlich weiße Ärzte-Establishment, das an einer Reihe rassistischer oder die Afroamerikaner systematisch benachteiligenden Aktivitäten beteiligt war. Auch wenn sie bereits vor einiger Zeit beendet wurde, gehört dazu die zwischen 1932 und 1972 durch staatliche Public Health-Institutionen durchgeführte so genannte Tuskegee-Syphilis-Studie. Und ganz aktuell zeigte eine Studie, dass durch Fehlannahmen bzw. Geringschätzung über die Gesundheitsrisiken von Afroamerikanern ein in der Behandlungssteuerung im Krankenhaus verwandter Algorithmus schwarze Patient*innen gegenüber weißen erheblich benachteiligte. Zu den weiteren Einzelheiten siehe den Artikel Algorithmus im US-Gesundheitswesen benachteiligt Afroamerikaner im Deutschen Ärzteblatt vom 25. Oktober 2019 und den Aufsatz Hospital 'risk scores' prioritize white patients in der Zeitschrift "Science" vom 24. Oktober 2019.
Auf diesem Hintergrund entstand die Vermutung, die eingangs beschriebene Ungleichheit beim Sterberisiko könne dadurch verringert werden, wenn afroamerikanische Patienten bei Ärzt*innen ihrer Ethnie in Behandlung wären und wegen des wesentlich höheren Vertrauen auch gesundheitsfördernden Verhaltensempfehlungen dieser Ärzt*innen eher und mit größerem gesundheitlichen Effekt folgen.
Ob dies nur gut gemeint ist oder wirklich zutrifft untersuchte jetzt eine Gruppe von US-Wissenschaftler*innen mit einer randomisierten kontrollierten Studie von über 1.3000 afroamerikanischen Männern aus Kalifornien.
Für die Untersuchung wählten die Wissenschaftler*innen ein anspruchsvolles mehrdimensionales methodisches Konzept aus: Die Teilnehmer füllten zuerst einen umfangreichen Fragebogen zu ihrem gesundheitlichen Zustand aus. Sie erhielten zugleich einen Gutschein für eine Gesundheitsuntersuchung in einer kooperierenden Klinik. Die Studienteilnehmer, die sich für eine Screeninguntersuchung entschieden wurden per Zufall einem schwarzen oder nichtschwarzen (weiß oder asiatisch) Arzt zugewiesen. Sie erhielten dann ein Bild ihres Arztes und konnten angeben welche invasiven oder nicht-invasiven Untersuchungen sie aus einer umfangreichen Liste in Anspruch nehmen wollten. In dem sich anschließenden Gespräch mit dem ihnen zugewiesenen Arzt konnten sie ihre Auswahl an Untersuchungen revidieren. Bis zu Beginn dieses Gesprächs gab es keine signifikanten Unterschiede des Auswahlverhaltens nach der Ethnie der Ärzt*innen.
Dies änderte sich nach dem persönlichen Kontakt mit dem Arzt aber grundlegend. Der Anteil der Patienten, die sich mit einem afroamerikanischen Arzt unterhalten hatten und bei denen anschließend z.B. präventive Untersuchungen des Blutdrucks, Blutzuckers und des Cholesterins durchgeführt wurden oder der Body Mass-Index bestimmt wurde, war 20 bis 25 Prozentpunkte höher als bei den Patienten, die mit einem weißen oder asiaamerikanischen Arzt zu tun hatten.
Entscheidend für dieses Ergebnis war die wesentlich bessere Kommunikation zwischen afroamerikanischen Patienten und Ärzten, die u.a. invasive Untersuchungen, die ein bestimmtes Vertrauen zum Arzt voraussetzen.
Abschließend versuchten die Forscher*innen unter Berücksichtigung anderer Studien noch den potenziellen Gesundheitsgewinn zu bestimmen, der durch ein afroamerikanisches Patient-Arzt-Team entsteht. Sie schätzen, dass die Lücke bei der kardiovaskulären Sterblichkeit zwischen weißen und schwarzen Patienten durch mehr solcher Teams oder Paarungen zu Gunsten der afroamerikanischen Patienten um 19% geschlossen werden könnte und die bei der generellen Lebenserwartung um 8%.
Auch wenn jetzt deutsche Leser*innen denken, die Ergebnisse dieser Studie aus der wesentlich diverseren us-amerikanischen Gesellschaft, gingen an der deutschen Wirklichkeit vorbei, weisen sie auf Dynamiken und Effekte von Patient-Arzt-Interaktionen hin, die nur mit anderen Hautfarben oder Phänotypen auch hierzulande Behandlungsergebnisse verbessern oder verschlechtern könnten.
Von dem Aufsatz Does Diversity Matter for Health? Experimental Evidence from Oakland von Marcella Alsan, Owen Garrick und Grant Graziani (erschienen als "NBER Working Paper No. 24787), gibt es kostenlos eine kurze Zusammenfassung. Prüfen sollte jeder, der duiese aber auch noch weitere NBER-Studien komplett lesen will, ob er eine der Zugangsvoraussetzungen (z.B. Universitätsangehöriger, Journalist) erfüllt. Das NBER (National Bureau of Economic Research) ist keine regierungszahme Einrichtung und auch nicht dem neoliberalen Ökonomie-Mainstream verfallen.
Eine umfangreiche Sammlung von Daten und Literatur zum Aufsatz 'Does Diversity Matter for Health? Experimental Evidence from Oakland'. Appendix — For Online Publication gibt es kostenlos zum Herunterladen.
Bernard Braun, 14.12.19
Wie kann der Vorrang der Patientensicherheit gegenüber Wirtschaftlichkeit arbeitsrechtlich erstritten werden?
 Zu den von vielen in Krankenhäusern aber auch Medizinischen Versorgungszentren angestellten ÄrztInnen Arbeitsbelastungen und kritischen Situationen gehört der Mangel an für die gute Qualität der Behandlung notwendigem zusätzlichem insbesondere pflegerischen Personal. Dass trotzdem ein Teil des Operationsbetriebs mit reduziertem Personal unverändert stattfindet, stellt nicht nur eine zusätzliche Belastung des Behandlungspersonals dar, sondern auch ein gesundheitliches Risiko für die PatientInnen. Dass es "zur Not" mit weniger Personal geht, birgt außerdem die Gefahr in sich, dass die Geschäftsführungen der Kliniken mangels Information glauben, dies ginge auf Dauer so und daran müsse nichts geändert werden und bei den beteiligten Beschäftigten der Ausnahme- zum nicht mehr strittigen oder thematisierten Dauer- oder Normalzustand wird.
Zu den von vielen in Krankenhäusern aber auch Medizinischen Versorgungszentren angestellten ÄrztInnen Arbeitsbelastungen und kritischen Situationen gehört der Mangel an für die gute Qualität der Behandlung notwendigem zusätzlichem insbesondere pflegerischen Personal. Dass trotzdem ein Teil des Operationsbetriebs mit reduziertem Personal unverändert stattfindet, stellt nicht nur eine zusätzliche Belastung des Behandlungspersonals dar, sondern auch ein gesundheitliches Risiko für die PatientInnen. Dass es "zur Not" mit weniger Personal geht, birgt außerdem die Gefahr in sich, dass die Geschäftsführungen der Kliniken mangels Information glauben, dies ginge auf Dauer so und daran müsse nichts geändert werden und bei den beteiligten Beschäftigten der Ausnahme- zum nicht mehr strittigen oder thematisierten Dauer- oder Normalzustand wird.
Anhand eines "Fall des Monats Dezember 2018" von eskalierendem Anästhesie-Pflegemangel des Bundesverbands Deutscher Anästhesisten, der das "Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Sicherheit am Beispiel einer chronischen Unterbesetzung des Anästhesiepflegepersonals thematisiert", weisen die Autoren auf zwei schon etwas ältere, gleichwohl rechtskräftige Urteile hin, die an handfesten arbeitsvertraglichen und -rechtlichen Streitfällen, verdeutlichen was der immer wieder beschworene Vorrang von Patientensicherheit gegenüber Wirtschaftlichkeitserwägungen im Ernstfall konkret bedeutet.
Das Arbeitsgericht Wilhelmshaven hatte bereits 2004 darüber zu urteilen, ob ein Chefarzt bzw. ein leitender Arzt einer Anästhesieabteilung einen Anspruch auf eine Mindestzahl von Assistenzärzten hat und sein Arbeitgeber, ein Krankenhaus, diesem materiell gerecht werden muss und dies notfalls per Klage durchsetzen muss
In einer Zusammenfassung des Urteils heißt es: "Der Chefarzt war der Auffassung, dass das Krankenhaus verpflichtet sei, so viele Assistenzärzte zu beschäftigen, dass die tariflichen und gesetzlichen Arbeitszeitvorgaben eingehalten werden können. Ohne eine Mindestanzahl von Assistenzärzten sei die Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllbar, weshalb ein einklagbarer Anspruch auf die erforderlichen personellen Mittel bestehe. Er beantragte daher vor dem Arbeitsgericht Wilhelmshaven das Krankenhaus zu verurteilen, die mindestens erforderlichen Assistenzärzte zur Verfügung zu stellen. Hilfsweise für den Fall des Unterliegens beantragte er ihn aus der Verantwortung des Arbeitsvertrages zu entlassen sowie die Bestellung zum Arbeitszeitbeauftragten aufzuheben."
Im Urteil wird diese Auffassung des klagenden Chefarztes folgendermaßen unterstützt: ""Kann ein Arbeitnehmer seine vertragsgemäße Arbeit nur zusammen mit anderen Arbeitnehmern oder mit deren Mithilfe ausüben, muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass diese anderen Personen zur Verfügung stehen. So ist es selbstverständlich, dass dort, wo aus Sicherheitsgründen mindestens zwei Arbeitnehmer zusammenarbeiten müssen, die Verpflichtung des Arbeitgebers besteht, das Vorhandensein des erforderlichen zweiten Arbeitnehmers zu garantieren."
Das Argument des beklagten Krankenhauses, der klagende Chefarzt greife mit seiner Klage in die Entscheidungen des Krankenhauses als Arbeitgeber und Unternehmen ein, ließ das Gericht nicht gelten und gab dem Kläger uneingeschränkt recht.
Das Urteil des Arbeitsgericht Wilhelmshaven vom 23.09.2004 - Az.: 2 Ca 212/04) ist in einer sehr schlechten PDF-Qualität komplett zu erhalten.
2013 spielte die Unterausstattung mit Personal auch in einem vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg gelandeten Fall eine wichtige Rolle. Hier hatte ein leitender Krankenhausarzt praktisch die "Handbremse" gezogen und sein Arbeitsverhältnis wegen der Personalunterbesetzung außerordentlich gekündigt. Da der frühere Arbeitgeber dies für nicht gerechtfertigt hielt und auch auf die nachteiligenb Folgen für sich hinwies, kam es zum Rechtsstreit.
Das Gericht stellte als erstes fest: "a) Nach § 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer es dem Kündigenden bei Berücksichtigung aller Umstände und der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist aufrechtzuerhalten".
Konkret bedeutet dies nach Meinung des LAG: "Die außerordentliche Eigenkündigung eines leitenden Krankenhausarztes kann begründet sein, wenn ihm der Krankenhausträger entgegen seinen vertraglichen Verpflichtungen trotz Abmahnung kein ausreichendes nichtärztliches Personal zur Verfügung stellt. b) Das wiederholte vertragswidrige Vorenthalten von Personal kann in einem Arbeitsverhältnis wie dem Vorliegenden grundsätzlich dessen außerordentliche Kündigung begründen, weil die Vertragsbeziehungen massiv gestört werden. Mit der unzureichenden Personalausstattung wird zunächst die vertragsgemäße Beschäftigung des Arztes in Frage gestellt. Das berührt ihn nicht nur in seiner Vertragsposition als Gläubiger des Beschäftigungsanspruchs. Es berührt ihn auch in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, hier in Erscheinung des Rechts auf berufliche Entfaltung seiner Persönlichkeit (vgl. BAG GS, Beschluss vom 27.02.1985, GS 1/84, AP Nr. 14 zu § 611 BGB Beschäftigungspflicht Bl. 7 f.). Zudem wirkt sich eine unzureichende Personalausstattung - hier - unmittelbar auf die Vergütung des Arztes aus. Der Operationsbetrieb muss eingeschränkt werden, sowohl die erlösabhängigen Zusatzentgelte als auch die Einkünfte aus der Nebentätigkeit mindern sich. Schließlich leidet der Ruf als zuverlässiger Arzt, wenn dieser gezwungen ist, bereits vereinbarte Operationstermine kurzfristig zu verlegen. Diese erheblichen Vertragsstörungen können an sich die außerordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses begründen."
"Angesichts dieser Pflichtverletzungen bestand für den Beklagten gem. § 626 Abs. 1 BGB ein wichtiger Grund, das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin außerordentlich zu kündigen. Es gelten dieselben Grundsätze wie bei einer außerordentlichen Kündigung des Arbeitgebers (vgl. BAG, Urteil vom 12.03.2009, 2 AZR 894/07, NZA 2009, 840, Rn. 14)."
Das Urteil vom 11.10.2013 - 12 Sa 15/13 ist komplett und gut lesbar zu erhalten.
Bernard Braun, 7.4.19
Nutzen der kieferorthopädischen Behandlung von Kindern/Jugendlichen weder belegt noch auszuschließen - weitere Forschung notwendig
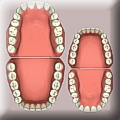 Nachdem trotz mehrerer kritischer Bewertungen des Nutzens und der Umstände der kieferorthopädischen Versorgung (Kfo) von gesetzlich versicherten Kindern und Jugendlichen in den letzten anderthalb Jahrzehnten lange Zeit weder durch die gesetzlichen Krankenkassen noch durch KieferorthopädInnen und ZahnärztInnen Anstöße für versorgungswissenschaftliche Untersuchungen erfolgten, beginnt sich dies in den letzten Jahren u.a. durch Befragungen von kieferorthopädisch behandelten Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern im Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung und der Barmer GEK, durch eine kritische Mitteilung des Bundesrechnungshofs und durch die Analyse von Routinedaten aus der kieferorthopädischen Versorgung in einem Gesundheitsreport der Handelskrankenkasse (hkk) etwas zu ändern (siehe dazu Erste Schritte für mehr Transparenz über die Art, den Umfang und die Bedarfsgerechtigkeit der kieferorthopädischen Behandlung).
Nachdem trotz mehrerer kritischer Bewertungen des Nutzens und der Umstände der kieferorthopädischen Versorgung (Kfo) von gesetzlich versicherten Kindern und Jugendlichen in den letzten anderthalb Jahrzehnten lange Zeit weder durch die gesetzlichen Krankenkassen noch durch KieferorthopädInnen und ZahnärztInnen Anstöße für versorgungswissenschaftliche Untersuchungen erfolgten, beginnt sich dies in den letzten Jahren u.a. durch Befragungen von kieferorthopädisch behandelten Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern im Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung und der Barmer GEK, durch eine kritische Mitteilung des Bundesrechnungshofs und durch die Analyse von Routinedaten aus der kieferorthopädischen Versorgung in einem Gesundheitsreport der Handelskrankenkasse (hkk) etwas zu ändern (siehe dazu Erste Schritte für mehr Transparenz über die Art, den Umfang und die Bedarfsgerechtigkeit der kieferorthopädischen Behandlung).
Noch mehr Licht in das besonders dunkle Dunkel der Kfo-Versorgung bringt nun ein im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstelltes und gerade veröffentlichtes Gutachten bzw. eine Meta-Studie des Berliner Gesundheitsforschungsinstituts IGES zum Nutzen von Zahnspangen.
Die vorsichtig differenzierenden Kernaussagen des Gutachtens lauten:
• "Da insgesamt nur wenige Untersuchungen zur Mundgesundheit identifiziert werden konnten, die zudem vornehmlich auf Surrogatendpunkten beruhen, lässt sich keine abschließende Einschätzung vornehmen, ob und welche langfristigen Auswirkungen die angewendeten kieferorthopädischen Therapieregime auf die Mundgesundheit haben."
• "Zwar konnte eine hohe Anzahl an Studien und Dokumenten in den Recherchen gefunden werden, das identifizierte Material ist zur Beantwortung der zugrunde liegenden Fragen jedoch nur bedingt geeignet."
• "Insgesamt lassen die identifizierten Studien in Bezug auf die diagnostischen und therapeutischen kieferorthopädischen Maßnahmen keinen Rückschluss auf einen patientenrelevanten Nutzen zu. Dies ist insbesondere durch die Heterogenität der Studien in Bezug auf die betrachteten Populationen, die angewendeten Interventionen und die Studiendesigns bedingt und darauf zurückzuführen, dass morbiditätsrelevante Endpunkte wie Zahnverlust, Karies oder Parodontitis und Parodontose i. d. R. erst mehrere Jahre nach der Behandlung auftreten und somit sehr lange Beobachtungszeiten erfordern."
• "Hier zeigte sich, dass Patientinnen und Patienten mit einer abgeschlossenen kieferorthopädischen Behandlung eine höhere Lebensqualität berichteten als nicht behandelte Studienteilnehmerinnen oder Patienten, die sich aktuell kieferorthopädischen Maßnahmen unterzogen."
• "Unabhängig von den genutzten Indizes zeigten sich ... durch die Anwendung von kieferorthopädischen Apparaturen Verbesserungen."
Die Zusammenfassung des BMG bestätigt zum einen die nicht abschließend geklärte Frage nach Nutzen und Wirtschaftlichkeit der Kfo-Versorgung und die Notwendigkeit weiterer Forschung und zeigt zum anderen wer sich wie auf der Erkenntnisbasis aktueller wie künftiger Studien um die Standards der künftigen Kfo-Versorgung kümmern muss:
• "Das Gesundheitsministerium zweifelt nicht an der Notwendigkeit kieferorthopädischer Leistungen. In seinem Auftrag wurde gleichwohl eine Meta-Studie vom IGES-Institut zu dem Thema erstellt. Darin kommen die Studien-Autoren zu dem Ergebnis, dass die Datengrundlage derzeit nicht ausreicht, um diese Frage abschließend zu bewerten. Dass Zahnspangen die Morbidität (Karies, Parondontitis, Zahnverlust, etc.) verringern, kann zwar nicht belegt werden, ist aber laut IGES auch nicht ausgeschlossen. Dafür konstatieren die Studien-Autoren, dass sich Zahnfehlstellungen sowie die Lebensqualität der Patienten durch diese Behandlung verbessern. Prinzipiell bewertet den Nutzen einer Therapie nicht der Gesetzgeber, sondern der Gemeinsame Bundesausschuss. Das BMG wird mit den beteiligten Organisationen den weiteren Forschungsbedarf und Handlungsempfehlungen erörtern."
Die zu erwartende Kritik der KieferorthopädInnen an der kritischen Bewertung des Nutzens eines Teils der von ihnen erbrachten Leistungen und deren oftmals problematischen Umstände (z.B. schlechte Aufklärung der in einer besonders vulnerablen Situation befindlichen Eltern und ihrer Kinder in der Pubertät über die Evidenz der Notwendigkeit von Behandlung oder die extreme Abhängigkeit der Eltern beim Erhalt eines vorfinanzierten Kostenanteils vom behandelnden Arzt) sollte sich schon vorab der Frage stellen, warum sie selber nicht schon vor Jahren ergebnisoffene Quer- und Längsschnittsuntersuchungen oder die Erstellung von evidenzbasierten Leitlinien und Entscheidungshilfen gefordert und begleitet haben.
Das 144-seitige Gutachten Kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen von Anja Hoffmann et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.1.19
Von den Möglichkeiten die Lebensqualität von PatientInnen zu messen. Nationale Normwerte machen es besser möglich!
 Immer noch spielt die Lebensqualität von PatientInnen selbst in methodisch hochwertigen Studien keine oder lediglich eine gegenüber so genannten "objektiven" Endpunkten (z.B. Mortalität oder Wiedereinweisungshäufigkeit) nachgeordnete Rolle. Dies kann aus Patientensicht zu falschen Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von Therapien führen oder dazu, dass die Suche nach anderen Therapien, die sich mehr auf die Lebensqualität auswirken, unterbleibt.
Immer noch spielt die Lebensqualität von PatientInnen selbst in methodisch hochwertigen Studien keine oder lediglich eine gegenüber so genannten "objektiven" Endpunkten (z.B. Mortalität oder Wiedereinweisungshäufigkeit) nachgeordnete Rolle. Dies kann aus Patientensicht zu falschen Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von Therapien führen oder dazu, dass die Suche nach anderen Therapien, die sich mehr auf die Lebensqualität auswirken, unterbleibt.
Selbst wenn aber in nationalen und international vergleichenden Studien Veränderungen der Lebensqualität zentrale Endpunkte sind, wird sie oft mit völlig unterschiedlichen Indikatoren gemessen, was Vergleiche unmöglich macht oder zu fragwürdigen Ergebnissen führt.
Insofern ist eine jetzt veröffentlichte Studie von nationalen Referenzwerten für die Lebensqualität oder das Wohlbefinden von Krebskranken in 11 Mitgliedsländern der EU und vier weiteren Ländern (Russland, Kanada, USA, Türkei) ein riesiger Fortschritt.
Als Grundlage dient der bereits vor über 25 Jahren entwickelte, weltweit anerkannte und eingesetzte, 30 Fragen umfassende Fragebogen "QLQ-C30" der European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), der nach einer kurzen und sicheren Anmeldung kostenlos zugänglich ist.
Aber selbst wenn man diesen Fragebogen in Studien einsetzte, existierte bisher das Problem, dass es weder für nationale noch für internationale Studien nationale Normwerte gab. Um wie viel schlechter oder sogar besser ist also die Lebensqualität von bestimmten PatientInnen im Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung im eigenen Land oder im Vergleich mit anderen Ländern?
Diesen Zustand beendeten nun an der Charité tätige ForscherInnen mit einer standardisierten Onlinebefragung zur Lebensqualität von 15.386 EinwohnerInnen der 15 Länder.
Dabei zeigten sich teilweise unerwartet deutliche Unterschiede des Wohlbefindens der Allgemeinbevölkerungen:
• "Während die unter den Deutschen (67) ermittelte Lebensqualität im Mittelfeld lag, gaben die Befragten in Österreich (75,6) und den Niederlanden (77,4) die höchsten Werte an. Menschen aus Polen (60), Russland (59,7), der Türkei (60,7), Großbritannien (62,3) und den USA (63,9) hingegen nannten in der Regel deutlich niedrigere Werte in sämtlichen Bereichen ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität. So schätzten sie beispielsweise ihre körperliche und emotionale Verfassung schlechter ein oder berichteten vermehrt über Erschöpfung oder finanzielle Nöte im Vergleich zu Befragten aus Österreich oder den Niederlanden."
• Eine der ForscherInnen wies auf die praktischen Konsequenzen für die Behandlung hin: "Denn es macht einen Unterschied, ob eine Krebspatientin aus Russland oder aus Spanien kommt, wenn sie angibt, erschöpft zu sein: In Russland gibt die Allgemeinbevölkerung eine deutlich stärkere Erschöpfung an als in Spanien. Für 15 Länder haben wir nun diese Normdaten, die sowohl länderspezifische als auch länderübergreifende Vergleiche ermöglichen."
Weitere nach den 30 Lebensqualitätsmerkmalen differenzierte Informationen finden sich in zwei komplett kostenlos erhältlichen Aufsätzen:General population normative data for the EORTC QLQ-C30 health-related quality of life questionnaire based on 15,386 persons across 13 European countries, Canada and the United States von Nolte S et al., online am 19. Dezember 2018 veröffentlicht in der Zeitschrift "European Journal of Cancer" (107 (2019) 153-163) und Establishing the European Norm for the health-related quality of life domains of the computer-adaptive test EORTC CAT Core von Liegl G et al., online am 19. Dezember 2018 veröffentlicht in der Fachzeitschrift "European Journal of Cancer" (107 (2019) 133-141).
Bernard Braun, 22.12.18
Weniger ist mehr: Das Beispiel täglich-mehrfache Blutzuckermessung durch nicht insulinpflichtige DiabetespatientInnen.
 Schon bevor es einigen IT-Unternehmen gelang, Millionen von Menschen zu vollkontinuierlich selbstvermessenden Anhängseln diverser Selbstoptimierungsgeräte zu machen, gab es bereits eine etwas kleinere und blutigere Variante, nämlich die engmaschige Bestimmung des Blutzuckers mit einer immer phantasievolleren Anzahl von Testgeräten und Teststreifen für an Diabetes erkrankte Menschen. In diesem Fall wurde das möglichst tägliche und mehrfache Messen des Blutzuckers in einer geringen Menge Blut als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das bedarfsgerechte (Selbst-)Management mit Antidiabetika oder Insulin und für die Lebensqualität propagiert. Dass es sich dabei möglicherweise und zu einem nicht geringen Teil um einen Klassiker der Überversorgung mit Diagnostika handelte, wurde bereits des Öfteren vermutet oder eingewandt.
Schon bevor es einigen IT-Unternehmen gelang, Millionen von Menschen zu vollkontinuierlich selbstvermessenden Anhängseln diverser Selbstoptimierungsgeräte zu machen, gab es bereits eine etwas kleinere und blutigere Variante, nämlich die engmaschige Bestimmung des Blutzuckers mit einer immer phantasievolleren Anzahl von Testgeräten und Teststreifen für an Diabetes erkrankte Menschen. In diesem Fall wurde das möglichst tägliche und mehrfache Messen des Blutzuckers in einer geringen Menge Blut als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das bedarfsgerechte (Selbst-)Management mit Antidiabetika oder Insulin und für die Lebensqualität propagiert. Dass es sich dabei möglicherweise und zu einem nicht geringen Teil um einen Klassiker der Überversorgung mit Diagnostika handelte, wurde bereits des Öfteren vermutet oder eingewandt.
Eine gerade im Medizin-Fachjournal "JAMA Internal Medicine" online first veröffentlichte Studie mit 370.740 Personen, die laut ihrer Krankenversicherungsdaten an Diabetes Typ 2 erkrankt sind aber (noch) nicht mit Insulin behandelt wurden, hat dies nun nachdrücklich bestätigt.
Zu beachten ist, dass in der us-amerikanischen Ärzteschaft auf der Basis methodisch hochwertiger Studien (u.a. ein Cochran Review mit 12 randomisierten kontrollierten Studien) ein so genannter "choosing wisely"-Standard empfiehlt: "avoid routine multiple daily self-glucose monitoring in adults with stable type 2 diabetes on agents that do not cause hypoglycemia."
Die wesentlichen Ergebnisse lauten:
• In jedem Fall gilt: Personen, die sich mit Insulin behandeln müssen oder die Medikamente einnehmen, die zu einem zu niedrigen Blutzuckergehalt führen können und damit zu einem lebensbedrohlichen Zustand, müssen ihren Blutzuckerwert regelmäßig messen.
• 86.747 der StudienteilnehmerInnen erhielten über das gesamte Jahr 3 und mehr Verordnungen für Blutzucker-Teststreifen, was als Indikator für dauerhafte Messungen genommen wurde.
• Bei mehr als der Hälfte dieser Personen, nämlich 51.820 Personen (14% der gesamten Personengruppe), ist anzunehmen, dass sie gesundheitlich unangemessene Messungen durchführen: 32.773 nahmen nur Medikamente ein, die kein Risiko der Unterzuckerung in sich bergen (z.B. Metformin) und 19.047 wurde kein einziges Antidiabetikum verordnet. Für die Angehörigen dieser beiden Gruppen bedeutet dies, dass sie durchschnittlich zweimal pro Tag mit einem Teststreifen ihren Blutzuckerwert untersuchten, ihre Krankenversicherung dies durchschnittlich 325 US-Dollar pro Jahr kostete und sie selber im Schnitt jährlich rund 18 Dollar zuzahlen mussten. Die Kosten für die Instrumente mit denen der Bluttropfen gewonnen wird, sind hier nicht erfasst.
Zum Schluss ihres kurzen "Researchletter" weisen die AutorInnen daraufhin, dass die Entwicklung und der Einsatz von Tools möglich und zum Teil erprobt ist, die verordnende ÄrztInnen vor der unsinnigen Verordnung von Teststreifen aber auch anderer diagnostischer Verfahren (z.B. zur Bestimmung des Vitamin D-Levels) warnen und als fachliche Basis für die gemeinsame Entscheidungsfindung von PatientInnen und ÄrztInnen dienen können. Zusätzlich wird empfohlen, PatientInnen, die ihren "Wert" wissen wollen, als Alternative zu der täglich mehrfachen Messung einen einmaligen Test für die Blutzuckerentwicklung innerhalb von 2-3 Monaten (so genannter HBA1c-Wert/Test) anzubieten.
Von dem Reaearchletter Assessment of Self-monitoring of Blood Glucose in Individuals With Type 2 Diabetes Not Using Insulin von Kevin D. Platt, Amy N. Thompson, Paul Lin, Tanima Basu, Ariel Linden, A. Mark Fendrick, online erschienen am 10. Dezember 2018 in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine", gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 15.12.18
Trotz eklatanter Forschungslücken: individuelles Entlassungsmanagement wirkt sich für PatientInnen mehrfach positiv aus.
 Obwohl niemand im deutschen Gesundheitssystem mit seiner charakteristischen Abschottung oder seinem Hürdenreichtum zwischen stationärer, ambulanter medizinischer und pflegerischer Versorgung die Notwendigkeit von Entlass- oder Überleitungsmanagement offen bestreitet und dies auch in einer Fülle gesetzlicher und vertraglicher Vorschriften der letzten anderthalb Jahrzehnte seinen Niederschlag gefunden hat, ist die Empirie des Entlassmanagements trotz der zuletzt 2017 konkretisierten Bestimmungen unzulänglich (vgl. dazu den hkk-Gesundheitsreport 2018: Entlassmanagement). Das Recht auf Entlassmanagement ist einem erheblichen Teil der derzeit jährlich rund 19 Millionen KrankenhauspatientInnen unbekannt und Millionen von PatientInnen erhalten selbst dann wenn sie über ihr Recht informiert werden keine oder eine lediglich lückenhafte individuelle Entlassplanung.
Obwohl niemand im deutschen Gesundheitssystem mit seiner charakteristischen Abschottung oder seinem Hürdenreichtum zwischen stationärer, ambulanter medizinischer und pflegerischer Versorgung die Notwendigkeit von Entlass- oder Überleitungsmanagement offen bestreitet und dies auch in einer Fülle gesetzlicher und vertraglicher Vorschriften der letzten anderthalb Jahrzehnte seinen Niederschlag gefunden hat, ist die Empirie des Entlassmanagements trotz der zuletzt 2017 konkretisierten Bestimmungen unzulänglich (vgl. dazu den hkk-Gesundheitsreport 2018: Entlassmanagement). Das Recht auf Entlassmanagement ist einem erheblichen Teil der derzeit jährlich rund 19 Millionen KrankenhauspatientInnen unbekannt und Millionen von PatientInnen erhalten selbst dann wenn sie über ihr Recht informiert werden keine oder eine lediglich lückenhafte individuelle Entlassplanung.
Zur Rechtfertigung dieses Zustands gibt es eine Reihe von allgemeinen (z.B. zu viel bürokratischer Aufwand, zu wenig Personal) und spezifischen (z.B. fehlende Formulare, ungeeignete Drucker, Unklarheiten über Zuständigkeiten) technisch-organisatorischen Hinweisen, die bei entsprechendem Interesse in den allermeisten Fällen relativ kurzfristig klärbar wären. Dass dies möglich ist, zeigen die nicht wenigen und strukturell unterschiedlichen Kliniken in denen zum Teil seit mehreren Jahren ein funktionierendes Entlassmanagement existiert. Ein stillschweigendes Argument könnten Zweifel am Nutzen sein.
Ein bereits 2016 veröffentlichter so genannter Cochrane Review untersuchte was 30 randomisierte kontrollierte Studien mit 11.964 TeilnehmerInnen, die zur allgemein medizinischen, chirurgischen oder psychiatrischen Behandlung im Krankenhaus waren, dazu an Ergebnissen zu Tage gefördert hatten. Verglichen wurden PatientInnen mit individuellem Entlassmanagement und mit normaler Entlassung.
Die wichtigsten Ergebnisse sehen wie folgt aus:
• PatientInnen mit allgemein medizinischem Behandlungsanlass mit Entlassmanagement lagen etwas kürzer im Krankenhaus und hatten auch ein geringeres Risiko innerhalb der drei Monate nach Entlassung wieder einen Krankenhausaufenthalt nötig zu haben. Die gesicherte Evidenz war aber moderat. Dieser Nutzen ist für Patienten mit Sturzfolgen fraglich.
• Bei älteren PatientInnen mit allgemein medizinischem oder chirurgischem Behandlungsanlass gab es lediglich kleine oder keine Unterschiede bei der Sterblichkeit.
• Die Zufriedenheit von PatientInnen mit Entlassmanagement und Krankenhauspersonal war höher als bei PatientInnen mit Standardentlassung - mit sehr geringer Sicherheit und Evidenz.
• Und auch bei möglichen Kostenunterschieden sind sich die RCTs bei PatientInnen mit allgemein-medizinischem Behandlungsanlass unsicher, ob es irgendeinen Kostenunterschied gibt. Immerhin sind die Kosten der Entlassung mit Entlassungsmanagement nicht gesichert und/oder deutlich höher.
• Zu ihrer eigenen Überraschung mussten die Cochrane Reviewer aber feststellen, dass wichtige Aspekte der Wirksamkeit und des Nutzens von Entlassmanagement in keiner einzigen der von ihnen untersuchten Studien untersucht wurden. So gab es keine detaillierten Analysen wie und wodurch die Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Behandlung überbrückt wurde und ob sich dies auf die weitere Gesundheit und die generell vernachlässigte Lebensqualität der PatientInnen ausgewirkt hat. Dies traf auch für die Kommunikation zwischen KrankenhausbehandlerInnen und ambulanten Leistungserbringern zu.
Trotz vieler Forschungsdesiderata und teilweise geringer Evidenz gibt es also genug Hinweise auf einen vorhandenen Nutzen von individueller Entlassungsplanung im Krankenhaus.
Der 74-seitige Cochrane Review Discharge planning from hospital von Gonçalves-Bradley DC, Lannin NA, Clemson LM, Cameron ID, Shepperd S. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.18
Ein Jahr "Rahmenvertrag Entlassmanagement": "Natürlich wichtig", aber immer noch jede Menge Schwachstellen
 Auch nach jahrzehntelanger Debatte über die unerwünschten Wirkungen der in Deutschland existierenden Abschottung der stationären von der ambulanten Gesundheitsversorgung und trotz einiger gesetzlicher Vorschriften (z.B. Nahtlosigkeit und Zügigkeit bei der Rehabilitation nach dem SGB IX und mehrere Varianten multilateraler Verträge im SGB V), gibt es zwar graduelle Fortschritte aber keine strukturelle Lösung der Schnittstellenprobleme. Als Lösung unterhalb einer richtigen Strukturreform gilt seit Mitte der Nuller Jahre das so genannte Überleitungs- oder Entlassmanagement während der stationären Behandlung. Die Pflicht, dies anzubieten und das Recht der im Krankenhaus behandelten PatientInnen diese Leistung bei Bedarf zu erhalten, wurde mehrere Male im SGB V betont und ein ExpertInnenkreis an der Universität Osnabrück arbeitet seit Jahren an einem Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege dessen neueste Version noch in der Konsultationsphase steckt und im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein soll.
Auch nach jahrzehntelanger Debatte über die unerwünschten Wirkungen der in Deutschland existierenden Abschottung der stationären von der ambulanten Gesundheitsversorgung und trotz einiger gesetzlicher Vorschriften (z.B. Nahtlosigkeit und Zügigkeit bei der Rehabilitation nach dem SGB IX und mehrere Varianten multilateraler Verträge im SGB V), gibt es zwar graduelle Fortschritte aber keine strukturelle Lösung der Schnittstellenprobleme. Als Lösung unterhalb einer richtigen Strukturreform gilt seit Mitte der Nuller Jahre das so genannte Überleitungs- oder Entlassmanagement während der stationären Behandlung. Die Pflicht, dies anzubieten und das Recht der im Krankenhaus behandelten PatientInnen diese Leistung bei Bedarf zu erhalten, wurde mehrere Male im SGB V betont und ein ExpertInnenkreis an der Universität Osnabrück arbeitet seit Jahren an einem Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege dessen neueste Version noch in der Konsultationsphase steckt und im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein soll.
Da sich aber die Wirklichkeit an vielen deutschen Krankenhäusern nicht verbessert hatte, verpflichtete der Gesetzgeber im GKV-Versorgungsstrukturgesetz von 2012 in § 39 Abs. 1a SGB V Leistungserbringer und Krankenkassen dazu, einen detaillierten Vertrag zur Ausgestaltung der geltenden Form des Entlassmanagements (EM) für die Zeit nach einer Krankenhausbehandlung abzuschließen.
Wie allerdings bereits die Entstehungsgeschichte des Rahmenvertrags über das "Ent-lassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versi¬cherten beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung" zeigt, ist auch mit einem solchen Vertrag keineswegs der Reformdurchbruch vollzogen; inhaltlich und organisatorisch handelt es sich also trotz stetiger verbaler Bestätigung der Wichtigkeit keineswegs um ein Selbstläuferprojekt. Selbst die genannte gesetzliche Vorgabe an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bun¬desvereinigung (KBV) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), das Entlassmanagement in einem Rahmenvertrag zu regeln, ließ sich nach langen strittigen und ergeb¬nislosen Verhandlungen zwischen den Vertragspartnern erst durch ein Schiedsverfahren des erweiterten Bundesschiedsamts für die vertragsärztliche Versorgung erfüllen. Der danach ab dem 17.10.2016 verbindliche Vertrag wurde durch die "Änderungsvereinba¬rung zum Rahmenvertrag" der drei Selbstverwaltungspartner vom 06.06.2017 anerkannt und trat am 01.10.2017 in Kraft.
Angesichts der ausgesprochen zähen und tatenarmen Vorgeschichte lag der Gedanke nahe, nicht erst wieder mehrere Jahre abzuwarten, sondern zu einem frühen sich inhaltlich anbietenden Zeitpunkt zu überprüfen was und wie viel von diesem Rahmenvertrag umgesetzt worden ist.
Geradezu themenspezifisch nahmen sich dies nicht die Vertragspartner vor (entgegen dem Standard bei Modellversuchen etc. gibt es aber auch keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Evaluation), sondern zum Jahrestag des Rahmenvertrags am 1.10.2018 allein die Handelskrankenkasse (hkk) Bremen.
Dazu ließ sie durch das "Bremer Institut für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung (BIAG)" eine Zufallsstichprobe von 1.200 Versicherten, die im April 2018 einen Krankenhausaufenthalt beendet hatten (Rücklauf 29,1%) zu ihren Erfahrungen mit wichtigen Elementen des Entlassmanagements und dem gesundheitlichen Anlass ihrer Behandlung befragen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Ein Jahr nach Einführung des Rahmenvertrags werden lediglich 35,8 % der Krankenhauspatienten über das Pflichtangebot des EM ihrer behandelnden Klinik informiert. Noch weniger, nämlich 26,6 % aller Patienten wurden schriftlich über Inhalt und Ziele des EM in Kenntnis gesetzt. Solange aber nicht mindestens die 42,1% der schwer und chronisch Erkrankten unter den Befragten mit einem eindeutigen nachstationären Behandlungs- und Versorgungsbedarf vollumfänglich informiert werden, ist der Rahmenvertrag zum Entlassmanagement nicht erfüllt.
• Der mangelhafte Informationsgrad hat zur Folge, dass weniger als ein Fünftel (19,2 Prozent) der Patienten einen Entlassplan zu ihrem Behandlungsbedarf an die Hand bekommen, also weniger als die Hälfte der PatientInnen mit nachstationärem Behandlungsbedarf als der Hauptzielgruppe von EM.
• Von den Studienteilnehmern, die nach ihrer Entlassung genehmigungspflichtige Leistungen der Krankenkasse benötigten, erhielten weniger als ein Drittel (29,3 %) Unterstützung bei der Bearbeitung der dafür notwendigen Antragsunterlagen.
• Mit existentiellen Risiken verbunden ist, dass 37,1 % der Befragten, die eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung benötigen, keine bekamen, was eigentlich selbst ohne EM-Rahmenvertrag nicht passieren darf.
• Besser sieht es bei der Aufklärung der Patienten über Art und Behandlung ihrer Krankheit aus. 83,7 % der Befragungsteilnehmer gaben an, ausreichend über ihre Krankheit und Behandlung informiert worden zu sein. Aber: 40 % der Patienten erhielten keine Erklärung zur Selbsthilfe zur Genesung, obwohl der Bedarf nach ihren eigenen Angaben bestand. Weiterhin wurde mit 45,7 % entgegen der Notwendigkeit nicht darüber gesprochen, wie sie nach ihrer Entlassung ihre gewohnten Alltagsaktivitäten wieder aufnehmen könnten.
• 85,4 % erhielten einen (vorläufigen) Entlassbrief, der zwar einzelne Aspekte des Entlassplans enthalten kann, aber keineswegs alle und auch nicht durch eine entsprechende Beratung im Krankenhaus sichert, dass der Patient weiß an wen mit welchen Zielen etc. er sich nach der Entlassung wenden muss.
• Positiv ist auch, dass 81,8 % der Patienten, die mindestens drei verordnete Arzneimittel einnehmen mussten, einen Medikationsplan mit nach Hause bekamen.
Und wer jetzt meint, ein Jahr sei völlig utopisch, wenn es um Veränderungen in 1942 Krankenhäusern geht, sollte daran denken, wie lange bereits die Wichtigkeit einer strukturierten Entlassung aus dem Krankenhaus diskutiert wird und geltendes Recht ist und sollte sich die Wiederholung einer derartigen Studie auf Wiedervorlage im Jahr 2019 oder 2020 legen.
Der 22 Seiten umfassende hkk-Gesundheitsreport 2018: Entlassmanagement von Bernard Braun ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.11.18
Weder Vor- noch Nachteil von Telemonitoring bei Herzerkrankungen gegenüber Standardbehandlung - Lebensqualität Fehlanzeige!
 Gefördert durch gesetzliche Initiativen wie dem eHealth-Gesetz oder den diversen Digitalisierungsinitiativen und der Vielzahl der mit ihnen verknüpften Erwartungen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur und der kurativen wie präventiven Behandlung, wird allzu oft übersehen, dass auch alle digitalen, elektronischen und modernen Verfahren etc. vor einer regelhaften Einführung ihre Wirksamkeit bzw. ihren zusätzlichen Nutzen in methodisch hochwertigen Studien nachweisen müssen.
Gefördert durch gesetzliche Initiativen wie dem eHealth-Gesetz oder den diversen Digitalisierungsinitiativen und der Vielzahl der mit ihnen verknüpften Erwartungen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur und der kurativen wie präventiven Behandlung, wird allzu oft übersehen, dass auch alle digitalen, elektronischen und modernen Verfahren etc. vor einer regelhaften Einführung ihre Wirksamkeit bzw. ihren zusätzlichen Nutzen in methodisch hochwertigen Studien nachweisen müssen.
Dass diese Forderung richtig ist und was dies für die Übernahme in die Regelversorgung bedeutet, zeigt ein am 3 Juli 2018 veröffentlichter Bericht des "Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" zum "Telemonitoring mithilfe von aktiven kardialen implantierbaren Aggregaten bei ventrikulärer Tachyarrhythmie sowie Herzinsuffizienz".
Worum es in diesem Bericht geht, beschreiben die VerfasserInnen so: "Eine ventrikuläre Tachyarrhythmie ist eine Herzrhythmusstörung mit hoher Herzfrequenz (bei Erwachsenen ≥ 100/Minute), die von den Herzkammern ausgeht. Man unterscheidet Kammertachykardien und Kammerflattern / -flimmern. Ventrikuläre Tachyarrhythmien können zum plötzlichen Herztod führen" und "Eine Herzinsuffizienz ist ein komplexes klinisches Syndrom, das sich aus jeder strukturellen oder funktionellen Störung des Herzens ergeben kann und die Fähigkeit des Ventrikels, sich mit Blut zu füllen oder es auszuwerfen, beeinträchtigt. Eine chronische Herzinsuffizienz ist die Unfähigkeit des Herzens, den Organismus mit genügend Sauerstoff zu versorgen, um den Stoffwechsel unter Ruhe- wie unter Belastungsbedingungen zu gewährleisten. Sie ist eine häufige Erkrankung der älteren Bevölkerung und gehört zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland."
Ziel des Berichts des IQWiG ist "die Nutzenbewertung des Telemonitorings mithilfe von aktiven kardialen implantierbaren Aggregaten und der aus der Methode folgenden Interventionen im Vergleich zu einer Standardbehandlung ohne Telemonitoring."
In die Nutzenbewertung durch das IQWiG gingen nach einer umfassenden Recherche der dazu bereits durchgeführten qualitativ hochwertigen Studien 17 randomisierte kontrollierte Studien mit 64 Dokumenten mit 10.130 Patienten ein. "Es wurden darüber hinaus 8 abgeschlossene Studien ohne berichtete Ergebnisse identifiziert, davon 5 herstellergesponsert. 4 dieser 8 abgeschlossenen Studien waren bereits seit mehr als 2 Jahren abgeschlossen. Des Weiteren wurden 3 laufende Studien identifiziert."
Das Fazit lautet:
• "Hinsichtlich der Endpunkte Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Mortalität, Schlaganfall, kardiale Dekompensation, Herzinfarkt, therapiebedürftige Herzrhythmusstörungen, thromboembolische Ereignisse, Gesundheitszustand, herzinsuffizienzbedingte Morbidität, psychische Morbidität, Herztransplantation, Hospitalisierung gesamt, Hospitalisierung aus kardiovaskulären Gründen und abgegebene Schocks zeigte sich kein Vor- oder Nachteil des Telemonitorings."
• "Der Nutzen des Telemonitorings bleibt insgesamt weiter unklar. Für die endgültige Beurteilung möglicher Vor- oder Nachteile des Telemonitorings ist es notwendig, dass die fehlenden Daten verfügbar werden und so ein vollständiges Bild ermöglichen….Die Informationsübermittlung durch Hersteller war teilweise lückenhaft."
Ein weiteres Ergebnis dieses Berichts zum Telemonitoring dieser kardiologischen Erkrankungen und Störungen weist auf die trotz aller Diskussion über die Relevanz von Lebensqualität als Endpunkt bei der Behandlung von Patienten offensichtlich immer noch weit verbreitete Ignoranz solcher Faktoren der Ergebnisqualität hin:
• "Für zentrale Endpunkte (SUE schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis und gesundheitsbezogene Lebensqualität) fehlen durch unvollständige oder nicht verwertbare Angaben relevante Mengen von Daten: Zu SUE fehlen Ergebnisse von 42 % (2964/7120 Patienten), zu gesundheitsbezogener Lebensqualität von 82 % der Patienten (4220/5138 Patienten). Eine Verzerrung aufgrund dieser Datenlücken ist möglich. Aus diesem Grund wurde für diese Endpunkte keine Nutzenaussage getroffen."
Der 203 Seiten umfassende IQWiG-Bericht - Nr. 577 "Telemonitoring mithilfe von aktiven kardialen implantierbaren Aggregaten bei ventrikulärer Tachyarrhythmie sowie Herzinsuffizienz" ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.7.18
Erste Schritte für mehr Transparenz über die Art, den Umfang und die Bedarfsgerechtigkeit der kieferorthopädischen Behandlung
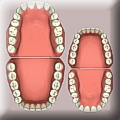 Wer den Eindruck hat, dass auffällig viele der 12- bis 15-Jährigen eine Zahnspange tragen und dann genau wissen will, wie viele Angehörige eines Altersjahrgangs denn kieferorthopädisch behandelt werden, in welchem Alter Behandlungen beginnen , warum sie behandelt werden, mit welchen Mitteln die Ziele erreicht werden, wie lange die Wirkung anhält und wie viel solche Behandlungen im Einzelnen die gesetzlichen Krankenkassen und die Eltern der SpangenträgerInnen kostet, bekommt bisher nahezu keine oder vage Antworten.
Wer den Eindruck hat, dass auffällig viele der 12- bis 15-Jährigen eine Zahnspange tragen und dann genau wissen will, wie viele Angehörige eines Altersjahrgangs denn kieferorthopädisch behandelt werden, in welchem Alter Behandlungen beginnen , warum sie behandelt werden, mit welchen Mitteln die Ziele erreicht werden, wie lange die Wirkung anhält und wie viel solche Behandlungen im Einzelnen die gesetzlichen Krankenkassen und die Eltern der SpangenträgerInnen kostet, bekommt bisher nahezu keine oder vage Antworten.
Er oder sie finden sich dabei in bester Gesellschaft, denn seit Beginn dieses Jahrhunderts haben u.a. sowohl der Gesundheitssachverständigenrat, AutorInnen eines HTA-Berichts für das "Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" als auch jüngst der Bundesrechnungshof und zum jeweiligen Zeitpunkt auch einige WissenschaftlerInnen oder Teile der interessierten Öffentlichkeit die fehlende Intransparenz beklagt und auf die eigentümlich unterentwickelte oder evidenzarme/-lose kieferorthopädische Behandlungspraxis hingewiesen. Eine Reaktion der vertraglich verantwortlichen Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), des Berufsverbandes der Kieferorthopäden oder mit wenigen Ausnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) blieb häufig aus oder beschränkte sich auf ein apodiktisches und veränderungsresistentes "Die Behandlung ist gut, die Patienten sind zufrieden, also weiter so".
Eine der GKV-Ausnahmekassen war und ist die regional auf den Nordwesten Deutschlands konzentrierte Handelskrankenkasse Bremen (hkk), die bereits 2012 eine Befragung von kieferorthopädisch behandelten Kindern und Jugendlichen samt ihren Eltern durchführt. Eine andere war die damalige Barmer GEK, die im Rahmen des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung 2016 eine bundesweite Befragung von bei ihr krankenversicherten Kindern und Jugendlichen(ausgewählte Ergebnisse) durchführte, die gerade mit einer kieferorthopädischen Behandlung begonnen hatten oder eine Behandlung bereits abgeschlossen hatten.
2018 ermöglichte schließlich die hkk einer Forschergruppe aus dem Facharzt für Kieferorthopädie (Dr. med. dent. A. Spassov, Greifswald) und dem Gesundheitswissenschaftler (Dr. rer. pol. B. Braun, Bremen) eine erstmalige pionierhafte Analyse von zum Teil mehrjährig verfügbaren (2012 bis 2017) Abrechnungs- und Behandlungsdaten bzw. Routinedaten ihrer kieferorthopädisch behandelten jungen Versicherten. Zu den Hauptzielen gehörte die Machbarkeit solcher Analyse mit vorhandenen Daten zu demonstrieren und erste quantitative und qualitative Beispiele für die dabei zu erwartende Transparenz zu liefern und bewertbar zu machen. Zum Dritten war aber dabei klar, dass für eine völlige Transparenz und eine deutliche Verbesserung der Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit der an den Präferenzen der jungen PatientInnen und evidenzbasierten Erkenntnissen orientierte Behandlung noch wesentlich mehr und mit vielen Methoden geforscht werden muss. Trotzdem ergeben sich schon aus dem bereits Bekannten zahlreiche strukturelle, organisatorische und behandlungspraktische Schlussfolgerungen für die kieferorthopädische Versorgung.
Die wesentlichen Ergebnissen der Routinedatenanalyse lauten:
• Zahlreiche diagnostische Untersuchungen und therapeutische Maßnahmen werden ohne Notwendigkeit routinemäßig erbracht. Demnach werden fast alle Versicherten, unabhängig vom Alter und ohne Prüfung der kieferorthopädischen Erfordernis, mit Röntgenstrahlen untersucht.
• Zwei Drittel der Versicherten erhalten vor einer festen Spange eine herausnehmbare Apparatur. In den meisten Fällen wäre jedoch die ausschließliche Behandlung mit einer festsitzenden Apparatur zweckmäßig und wirtschaftlich. Eine feste Spange kommt zudem dem Wunsch der meisten Kinder und Jugendlichen nach einer möglichst kurzen Behandlung entgegen. Außerdem wirkt sie sich positiv auf Lebensqualität und Behandlungstreue aus, so ein wichtiges Ergebnis der Kinder-/Jugendlichenbefragungen.
• Schließlich ist die Behandlungsdauer mit bis zu drei Jahren zu lang und in den meisten Fällen nicht mit einem gesundheitlichen Bedarf begründbar.
• Ein spürbarer Anteil der kieferorthopädischen Behandlungen startet als so genannte Frühbehandlung im Alter von 7 oder 8 Jahren bereits im nicht bleibenden Milchgebiss. Sinnvoller wäre in den meisten Fällen, wenn überhaupt, mit einer Behandlung erst im bleibenden Gebiss zu beginnen.
Diese und zahlreiche weitere Ergebnisse sowie ein Überblick über die jahrzehntelange (Nicht)-Debatte über die Kfo-Behandlung und eine Reihe von Vorschlägen oder Denkanstößen für eine längst überfällige Reform der Behandlung und der für sie geltenden Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses aus dem Jahr 2004 finden sich im 72 Seiten umfassenden hkk-Gesundheitsreport 2018 Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen, der komplett kostenlos heruntergeladen werden kann.
Bernard Braun, 18.7.18
Das Elend von Transparenz im Wettbewerb: Qualität hinter der Vielzahl von Siegeln zur Langzeitpflege trotz Checkliste unzureichend
 Wenn etwas im Gesundheitswesen, und zwar von den gesetzlichen Krankenkassen über Krankenhäuser, Arztpraxen bis zu Pflegeheimen laufend boomt ist es eine Flut von Siegeln, Zertifikaten und Kunden-/Versicherten-/Patienten-Voten über die "beste" Qualität oder die "vollste" Zufriedenheit der Befragten mit nahezu allen Regungen dieser Institutionen.
Wenn etwas im Gesundheitswesen, und zwar von den gesetzlichen Krankenkassen über Krankenhäuser, Arztpraxen bis zu Pflegeheimen laufend boomt ist es eine Flut von Siegeln, Zertifikaten und Kunden-/Versicherten-/Patienten-Voten über die "beste" Qualität oder die "vollste" Zufriedenheit der Befragten mit nahezu allen Regungen dieser Institutionen.
Vor lauter "Besten", "Nummer 1" oder "Freundlichsten" ist es für diejenigen, die eine Krankenkasse, ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung suchen, auch mit viel Zeit- und Recherchieraufwand - im Ernstfall hat man aber meist nicht viel Zeit sich für oder gegen eine Einrichtung zu entscheiden - aber eher erschwert, mit gutem Gewissen eine Entscheidung zu treffen mit der man auch noch "übermorgen" zufrieden ist. Vor lauter Siegel-Bäumen ist oft der Wald nicht mehr sichtbar.
Und natürlich gibt es auch schon "Fluthelfer", so aktuell das "Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP)" mit einer "Checkliste zu Siegeln und Zertifikaten" in der Langzeitpflege. An diesem Beispiel lässt sich dann aber auch das Wohl und Wehe der Transparenz von Siegeln etc. erkennen.
Positiv ist an dieser "Checkliste" zunächst, dass ein Sohn oder eine Tochter, der/die für pflegebedürftige Eltern eine Einrichtung zur Langzeitpflege sucht, einen Überblick über die derzeit existierenden und von den Einrichtungen mehr oder weniger aktiv bis aufdringlich-suggestiv präsentierten Qualitäts-Etiketten bekommt. In der ZQP-Liste sind dies Stand Januar 2018 auf 6 Seiten 20 Siegel von "AWO-Qualitätsmanagement Zertifikat" bis "Schmerzmanagement-Zertifikat". Jedes Siegel wird steckbriefmäßig vorgestellt und außerdem gibt es den Link auf Webseiten, die zu dem was für das Siegel geprüft wird und wie die Überprüfung stattfindet sicherlich noch weitere Informationen liefern - natürlich von den Anbietern dieser Siegel.
Und damit ist man auch schon bei den Schwachstellen und Unzuverlässigkeiten dieser Art, den Eindruck von gesicherter Qualität zu erzeugen.
Richtig stellen nämlich die ZQP-AutorInnen folgendes fest: "Wichtig, zu wissen ist: Die Siegel und Zertifikate sind meist nicht vergleichbar, da Prüfverfahren und konkrete Prüfinhalte unterschiedlich und nicht immer transparent sind. Wissenschaftlich gesicherte und verlässliche Aussagen über die Qualität der Pflegeleistungen und -angebote können nicht getroffen werden. Auch ist nicht bekannt, wie sich die regelmäßige Prüfung auf die Qualität der Leistungsangebote auswirkt."
Und: "Als Basis für die Entscheidung, welches Heim oder welcher Dienst gut pflegt, taugen die Prüfbescheinigungen jedoch kaum. Denn über die tatsächliche Pflegequalität sagen diese eher nichts aus. Allerdings können sie Hinweise zu bestimmten Strukturen und Prozessen der Pflegeangebote geben."
Die Lösung des ZQP in einer Pressemitteilung hat dann nichts mehr mit Siegeln, sondern mit dem guten, alten Augenschein durch die Suchenden zu tun: "Da also Siegel und Zertifikate - sowie auch die offiziellen Pflegenoten - für Pflegebedürftige und Angehörige keine hinreichenden Aufschlüsse über die Pflegequalität bieten und schon gar nicht Auskunft darüber geben können, ob ein Angebot zu den persönlichen Bedürfnissen passt, ist es wichtig, sich selbst ein Bild zu machen."
Dies ist sicherlich nicht falsch, wirft aber die Frage auf, warum dann mit viel Aufwand und Kosten, die natürlich in den Preis der Einrichtungen eingepreist sind, Siegel bestellt und verbreitet werden. Das einzige Siegel, das problemlos vergeben werden kann, ist dann wohl das "Siegel für Geschäftstüchtigkeit" der Siegel-Anbieter und -Produzenten.
Und ob die vom ZQP vorgeschlagenen teilnehmenden Beobachtungen und Gespräche in jeder Einrichtung geführt werden können und auch von den dort Beschäftigten und Betreuten offen geführt werden, ist nicht sicher.
Die ZQP-Pressemitteilung zur Veröffentlichung der Checkliste vom 27. März 2018ist kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für die 6-seitige Checkliste zu Siegeln und Zertifikate in der Langzeitpflege.
Bernard Braun, 27.3.18
18,7 Millionen Hartz IV-Empfänger zwischen 2007 und 2017 bedeuten auch zig Milliarden Euro Mindereinnahmen für die GKV
 Seit Beginn der erklärten Politik zur Kostendämpfung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Jahr 1977 gehört paradoxerweise der Verschiebebahnhof von eigentlich aus Steuermitteln zu finanzierenden Ausgaben (z.B. die familienpolitisch für sinnvoll erachtete beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehepartnern, der Aufbau der GKV in den neuen Bundesländern, Absenkung der von der Renten- und Arbeitslosenversicherung zu zahlenden GKV-Beiträge) zum Stammrepertoire der Gesundheitspolitik.
Seit Beginn der erklärten Politik zur Kostendämpfung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Jahr 1977 gehört paradoxerweise der Verschiebebahnhof von eigentlich aus Steuermitteln zu finanzierenden Ausgaben (z.B. die familienpolitisch für sinnvoll erachtete beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehepartnern, der Aufbau der GKV in den neuen Bundesländern, Absenkung der von der Renten- und Arbeitslosenversicherung zu zahlenden GKV-Beiträge) zum Stammrepertoire der Gesundheitspolitik.
Dies setzt sich mit der Einführung des Arbeitslosengelds II durch die Hartz-Gesetzgebung bruchlos und massiv fort.
In einem Gutachten des IGES-Instituts für das Bundesgesundheitsministerium vom 7. Dezember 2017 wurde auch gezeigt wie viel die Bundesregierung zu Lasten der GKV einspart:
• Um die bei vielen langjährigen Hartz IV-Empfängern sowieso überdurchschnittlichen Gesundheitsausgaben decken zu können, hätte die GKV 2016 15,486 Milliarden Euro einnehmen müssen. Tatsächlich waren es aber nur 5,896 Mrd. Euro, d.h. nur rund 38%.
• Statt der knapp 100 Euro, die der Bund monatlich für jeden Hartz IV-Bezieher Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge bezahl, wäre ein monatlicher Beitrag zwischen 275,31 Euro und 289,20 Euro kostendeckend.
• Dass diese Beträge nicht außerhalb des Finanzhorizonts der Bundesregierung liegen zeigt die Tatsache, dass in der PKV versicherte Hartz IV-Bezieher bis zu 341 Euro Beiträge erhalten.
Wer hier vielleicht noch denkt, dass es sich hier um ein Einjahresereignis handelt, wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eines Schlechteren belehrt. Auf eine kleine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann zur Anzahl der Hartz IV-Empfänger seit 2005 antwortete die parlamentarische Staatssekretärin des BMAS am 13. März 2018, zwischen 2007 und 2017 hätte es 18,23 Millionen so genannte Regelleistungsberechtigte gegeben, darunter 5,47 Millionen unter 15-Jährige. Auch wenn diese nicht die gesamte Zeit mit Hartz IV leben mussten, lässt sich bei durchschnittlich rund 5 Millionen Hartz IV-Bezieher pro Monat (im Februar 2018 waren es laut der Bundesagentur für Arbeit 5,95 Millionen, von denen 4,26 erwerbsfähig waren) leicht schätzen, dass für diese 10 Jahre der GKV mindestens 70 bis 80 Mrd. Euro zu wenig Beiträge bezahlt worden sind und diese für die Versorgung notwendigen Beträge solidarisch von den restlichen Beitragszahlern bezahlt worden sind.
Darüber hinaus zeigen aber diese Zahlen, dass Hartz IV-Armuts- oder Mangelerfahrungen durchaus zur Normalität breiter Bevölkerungsteile gehören. Wäre nicht die deutlich höhere Beitragszahlung für die in der PKV versicherten Personen, könnte die Bundesregierung eventuell noch darauf hinweisen, dass in der GKV als Solidargemeinschaft (§ 1 SGB V) der Beitrag nicht kostendeckend sein muss, sondern die höheren Ausgaben für viele Versicherte durch Beiträge von anderen Versicherten, die deutlich weniger Ausgaben haben als sie Beiträge zahlen, ausgeglichen wird.
Das IGES-Gutachten GKV-Beiträge der Bezieher von ALG II. Forschungsgutachten zur Berechnung kostendeckender Beiträge für gesetzlich krankenversicherte Bezieher von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld im SGB II von M. Albrecht et al. Ist kostenlos erhältlich.
Die Auskünfte zur Anzahl der Hartz IV-Empfänger 2007-2017 findet man in der Bundestagsdrucksache 19/1241 auf den Seiten 52ff.
Bernard Braun, 26.3.18
Mehr Stillstand und Rück- statt Fortschritt - Aktuelle Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel
 "Seit 2011 werden neu in den Markt eingeführte Medikamente oder bereits etablierte Arzneien mit erweitertem Indikationseinsatz einer sogenannten "frühen Nutzenbewertung" durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) unterzogen. Gesetzliche Basis ist das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG). Es hinterfragt, ob ein neues Medikament gegenüber bereits verfügbaren Präparaten einen Zusatznutzen aufweist. Es geht dabei nicht um die Qualität, Wirksamkeit oder Sicherheit einer neuen Therapie. Dies wurde bereits vor der Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft. Die Ergebnisse dieser Bewertung dienen vielmehr den Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem GKV-Spitzenverband." Soweit die Zusammenfassung dessen was Gegenstand einer umfassenden Analyse der Ergebnisse aller AMNOG-Verfahren von 2011 bis 2016 durch eine Ad-hoc-Kommission (20 Mitglieder aus verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften) der "Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e.V." war, die im Mai 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
"Seit 2011 werden neu in den Markt eingeführte Medikamente oder bereits etablierte Arzneien mit erweitertem Indikationseinsatz einer sogenannten "frühen Nutzenbewertung" durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) unterzogen. Gesetzliche Basis ist das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG). Es hinterfragt, ob ein neues Medikament gegenüber bereits verfügbaren Präparaten einen Zusatznutzen aufweist. Es geht dabei nicht um die Qualität, Wirksamkeit oder Sicherheit einer neuen Therapie. Dies wurde bereits vor der Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft. Die Ergebnisse dieser Bewertung dienen vielmehr den Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem GKV-Spitzenverband." Soweit die Zusammenfassung dessen was Gegenstand einer umfassenden Analyse der Ergebnisse aller AMNOG-Verfahren von 2011 bis 2016 durch eine Ad-hoc-Kommission (20 Mitglieder aus verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften) der "Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e.V." war, die im Mai 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Die Ergebnisse:
• Ende 2016 waren 224 Verfahren mit 469 ausgewerteten Subgruppen abgeschlossen.
• Bei 61,1% war der Zusatznutzen durch die u.a., von den Herstellern vorgelegten Unterlagen nicht belegt, bei 15,8% war der Zusatznutzen gering und bei 12,1% beträchtlich.
• Der Anteil von Verfahren deren Zusatznutzen nicht belegt war, schwankte zwischen 88% im Fachgebiet Diabetologie und 45% im Bereich Infektiologie.
• In Verfahren auf der Basis von nicht randomisierten klinischen Studien betrug der Anteil mit quantifizierbarem Zusatznutzen nur 12%.
• Der G-BA entscheidet nicht nur über den Zusatznutzen, sonderen berichtet auch die jeweilige Aussagesicherheit. Für 343 aller Subgruppen (73,1%) macht er keine Aussage, was überwiegend Arzneimittel ohne Zusatznutzen betrifft. Für 68 (14,5% gibt es für die Sicherheit der Aussage Anhaltspunkte, für 53 (11,3%) Hinweise und für lediglich 5 (1,1%) Belege. Auf die mit dieser Nichtfestlegung zur Aussagesicherheit verbundenen Probleme weist die AWMF-Kommission ausdrücklich hin: "Das ist kritisch, weil diese Festlegung auf einer sehr unterschiedlichen Studienlage basieren kann, vom Fehlen ausreichender Daten bis zum negativen Ergebnis in einer Metaanalyse. Die hohe Datenunsicherheit der frühen Nutzenbewertung zeigt sich auch darin, dass in der Hälfte der Subgruppen bei Neubewertungen eine andere Festlegung als im ersten Verfahren getroffen wurde."
• Schließlich kritisiert die AWMF, dass auch im AMNOG und folgerichtig bei den G-BA-Bewertungen Indikatoren des patientenbezogenen Outcomes (z.B. Schmerzen statt ausschließlich Morbidität im allgemeinen) weitgehend fehlen - ein weitverbreiteter Mangel bei den Endpunkten vieler Studien und Bewertungen von Behandlungsmethoden und -mittel.
Ob die offen geäußerte Befürchtung der AWMF, die dargestellten Entwicklungen würden "aktuell den langfristigen Wert des Verfahrens in Frage (stellen)", eintreten, hängt sicherlich auch von der öffentlichen Diskussion der Ergebnisse des AWMF-Berichts ab.
Die Ergebnisbroschüre Frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel in Deutschland 2011 - 2016. Analysen und Impulse. ist kostenlos erhältlich.
Ebenso das Positionspapier der Ad-hoc-Kommission Frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel 2017.
Bernard Braun, 25.5.17
Personalausstattung in der stationären Psychiatrie zwischen gerade noch ausreichend bis desaströs.
 Zu einer der seit Jahren in der stationären Versorgung immer intensiver diskutierten Fragen gehört, wie viel und welches ärztliches und pflegerisches Personal dort tätig ist und ob damit eine gute Behandlung möglich ist. Sobald es darauf genügend Antworten gibt, sollen es per Gesetz verbindliche Vorgaben für die Anzahl von Patienten pro Pflegekraft oder Arzt geben. Speziell für den Bereich der Behandlung psychisch Kranker plant die Bundesregierung ab 2017 mit dem "Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)", Verbesserungen zu erreichen. Mit dem PsychVVG "wird z. B. auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, verbindliche Mindestvorgaben für die Personalausstattung in Kliniken für psychisch kranke Menschen festzulegen. Diese sollen - soweit möglich - evidenzbasiert sein und eine leitliniengerechte Behandlung ermöglichen."
Zu einer der seit Jahren in der stationären Versorgung immer intensiver diskutierten Fragen gehört, wie viel und welches ärztliches und pflegerisches Personal dort tätig ist und ob damit eine gute Behandlung möglich ist. Sobald es darauf genügend Antworten gibt, sollen es per Gesetz verbindliche Vorgaben für die Anzahl von Patienten pro Pflegekraft oder Arzt geben. Speziell für den Bereich der Behandlung psychisch Kranker plant die Bundesregierung ab 2017 mit dem "Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)", Verbesserungen zu erreichen. Mit dem PsychVVG "wird z. B. auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, verbindliche Mindestvorgaben für die Personalausstattung in Kliniken für psychisch kranke Menschen festzulegen. Diese sollen - soweit möglich - evidenzbasiert sein und eine leitliniengerechte Behandlung ermöglichen."
Dass dies alles nicht schon längst erfolgt ist, liegt auch daran, dass es keine verlässlichen und konsentierten Zahlen zum quantitativen und qualitativen Status quo gibt.
Eine im Juni 2016 vorgelegte Studie der Bundespsychotherapeutenkammer über die personellen Verhältnisse und die Versorgungsqualität in der stationären Psychiatrie und Psychosomatik zeigt zum einen die Fülle von Schwierigkeiten bei der Schaffung von Transparenz und zum andern anhand der wenigen Angaben in den verpflichtenden Qualitätsberichten von Krankenhäusern aus drei Bundesländern (Bayern, Hamburg und Sachsen) und weiteren Recherchen, welche personellen Versorgungsmängel hier existieren.
Die Maßstäbe mit denen beurteilt wird, ob die Personalausstattung ausreichend ist oder nicht, entstammen der "Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie (Psychiatrie-Personalverordnung - Psych-PV)" vom 18. Dezember 1990. Diese Verordnung regelte die "Maßstäbe und Grundsätze zur Ermittlung des Personalbedarfs für Ärzte, Krankenpflegepersonal und sonstiges therapeutisches Fachpersonal in psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche stationäre oder teilstationäre Behandlung der Patienten zu gewährleisten." Angesichts der Tatsache, dass das was eine ausreichende Behandlung ausmacht sich seitdem im Sinne neuer Leistungen mit einem entsprechenden Personalaufwand verändert hat, sind die Personalwerte der Psych-PV aber heute eine Art Mindestwerte. Umso bedenklicher, wenn noch nicht einmal diese Werte in der heutigen Behandlungswirklichkeit erreicht werden.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Es beginnt relativ positiv: "In fast neun von zehn (86 Prozent) der allgemeinpsychiatrischen und psychosomatischen und in acht von zehn (82 Prozent) der kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken und Abteilungen gibt es ausreichend ärztliches und fachärztliches Personal, um die medizinisch-psychiatrische Grundversorgung der Patienten sicherzustellen. Die Leistungen der medizinisch-psychiatrischen Grundversorgung nach Psych-PV (Psychiatrie-Personalverordnung), die nicht durch andere Berufsgruppen erbracht werden können, können dort durch Ärzte abgedeckt werden."
• Doch dieses Bild verdunkelt sich dann rasch: "Deutlich wird aber ein Defizit, wenn man die medizinisch-psychiatrische Grundversorgung und die psychotherapeutische Versorgung, d. h. die Aufgabe n von Ärzten und Psychologen, zusammen betrachtet. Nur drei von vier der Kliniken und Abteilungen für Allgemeinpsychiatrie (75 Prozent) und (etwas knapper) für Kinder- und Jugendpsychiatrie (73 Prozent) verfügen über ausreichend Ärzte/Fachärzte und Diplom-Psychologen/Psychotherapeuten, um die Leistungen, wie sie nach Psych-PV im Regelbehandlungsbereich für die medizinisch-psychiatrische und die psychotherapeutische Versorgung zusammen vorgesehen sind, zu erbringen."
• Und bevor es richtig "desaströs" wird, ist die Personalausstattung in den Klinken und Abteilungen für Psychosomatik wiederum etwas besser: "Dort verfügen 95 Prozent der Kliniken über ausreichend Ärzte/Fachärzte und Diplom-Psychologen/Psychotherapeuten, um die Vorgaben der Psych-PV zu erfüllen."
• Die schlechteste Personalausstattung gibt es dagegen in dem gerade auch für die gute Behandlung von psychisch Kranken wichtigen Bereich der Pflege: "Nur die Hälfte der Kliniken und Abteilungen in der Allgemeinpsychiatrie (49 Prozent) und nur eine von fünf psychosomatischen Einrichtungen (17 Prozent) verfügen über ausreichend Pflegepersonal, um die Vorgaben der Psych-PV zu erfüllen."
• Da in Deutschland die Privatisierung von Krankenhäusern weiterhin ungebremst stattfindet, ist ein weiterer Fund des Reports der Bundespsychotherapeutenkammer versorgungspolitisch beachtenswert: "In der ärztlichen und der ärztlich-psychotherapeutischen Versorgung gibt es wenig Unterschiede zwischen öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern bei der Erfüllung der Vorgaben nach Psych-PV. In der Pflege ist die Personalausstattung, insbesondere in den Kliniken und Abteilungen in privater Trägerschaft, besonders schlecht. Auch bei den rein ärztlichen Leistungen werden die Vorgaben der Psych-PV seltener erfüllt (79 Prozent)."
Die Studie der Bundespsychotherapeutenkammer 2016: Die Qualität der Versorgung in Psychiatrie und Psychosomatik. Eine Auswertung der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.7.16
Mehrheit der Studienergebnisse über Strahlentherapie in den USA trotz Verpflichtung nicht offen zugänglich
 Wichtige Entscheidungen über die Einführung und Nutzung neuer diagnostischen und therapeutischen Mittel werden immer mehr auf der Basis wissenschaftlicher klinischer Studien und der dort identifizierten Evidenz zum erreichbaren Nutzen getroffen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass dieses Entscheidungssystem funktioniert, ist die vollständige und zeitnahe Transparenz über alle Ergebnisse dieser Studien.
Wichtige Entscheidungen über die Einführung und Nutzung neuer diagnostischen und therapeutischen Mittel werden immer mehr auf der Basis wissenschaftlicher klinischer Studien und der dort identifizierten Evidenz zum erreichbaren Nutzen getroffen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass dieses Entscheidungssystem funktioniert, ist die vollständige und zeitnahe Transparenz über alle Ergebnisse dieser Studien.
Einer der möglichen und bereits mehrere Male aufgedeckte Mangel ist, dass Ergebnisse negativer Art, also z.B. fehlender Nutzen oder unerwünschte Wirkungen nicht, d.h. nur positive Ergebnisse veröffentlicht werden.
Um einen weiteren Mangel, nämlich die Nichtveröffentlichung oder zeitlich erheblich verzögerte Veröffentlichung von Ergebnissen, zu verhindern, gibt es in den USA seit 2007 die Verpflichtung, Studienergebnisse innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung der Studienarbeiten öffentlich zugänglich zu machen.
Wie die Realität im Bereich von in den USA durchgeführten Phase III-Studien zur Strahlentherapie, also einer für viele Patienten relevanten Therapieform - aussieht, haben nun Wissenschaftler für die "European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)" und auf deren Konferenz am 30. April 2016 präsentiert.
Als erstes untersuchten sie wie hoch der Anteil dieser Art von Therapiestudien war, die ihre Ergebnisse vor Inkrafttreten der Veröffentlichungspflichten im Jahr 2007 nicht veröffentlichten. Von den 552 berücksichtigten Studien waren dies 422 oder 76,4%.
Entgegen der Erwartung, die Publikationsverpflichtung sorge für mehr Transparenz, stieg der Anteil der Studien, die ihre Ergebnisse nicht wie ab 2007 vorgeschrieben transparent machten, und sei es nur in einer Zusammenfassung der Resultate, im Zeitraum bis 2013 sogar noch auf 81,7% an (655 von insgesamt 802 Strahlentherapiestudien).
Zu den weiteren Funden der beiden Wissenschaftler gehörte, dass sich die Intransparenz je nach Krankheitsart erheblich unterschied. So wurden Studienergebnisse über die strahlentherapeutische Behandlung von Augenkarzinomen "nur" zu 47% nicht veröffentlicht, die über die Behandlung von Brust- und Lungenkrebs zu 78% und 73,7% nicht und die über die Strahlentherapie von Hoden- und Dickdarmkrebs überhaupt nicht - jeweils nicht in dem vorgeschriebenen Einjahreszeitraum.
Ebenfalls unerwartet war, dass sich die für explizit unternehmensfinanzierte Studien Verantwortlichen deutlich häufiger regelkonform verhielten als die von akademischen Studien.
Um im ethischen und gesundheitlichen Interesse der StudienteilnehmerInnen und anderer PatientInnen mehr Transparenz erwirken zu können, schlagen die AutorInnen vor, dass Studienverantwortliche, die eine neue Studie öffentlich finanziert bekommen bzw. registrieren (diese Registration in einer speziellen Datenbank ist eine Voraussetzung für den Studienbeginn) wollen, vorher die Ergebnisse aller ihrer bisherigen Studien veröffentlichen müssen.
Eine Zusammenfassung der Präsentation Failure to publish trial results exposes patients to risks without providing benefits von Jaime Pérez-Aljia und Pedro Gallego ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.5.16
Immer noch eingeschränktes Interesse an der Quantität und Qualität von Transparenz über Interessenkonflikte in Chirurgiestudien
 Beginnend mit einem Aufruf eines der renommiertesten Medizin-Journals, dem "New England Journal of Medicine (NEJM)", im Jahr 1984 nahm das Bewusstsein zu, dass verborgene finanzielle oder soziale Beziehungen zwischen ForscherInnen und z.B. Herstellern von Arzneimitteln oder Medizinprodukten Forschungsergebnisse verzerren können und das Vertrauen in medizinische Forschung gefährden können. Das geeignete Gegenmittel erschien die Offenlegung möglichst aller potenziellen Interessenkonflikte (z.B. direkte Finanzierung der durchgeführten Studie durch den Hersteller des untersuchten Produkts, Vergütungen für andere Studien und Vorträge durch den Hersteller, alle sonst gewährten Vorteile für den Besuch von Tagungen etc.) im Rahmen wissenschaftlicher Studien und deren Veröffentlichung zu sein. Wie diverse Untersuchungen gezeigt haben, wurden und werden selbst erhebliche Interessenkonflikte entweder gar nicht oder nur partiell transparent gemacht.
Beginnend mit einem Aufruf eines der renommiertesten Medizin-Journals, dem "New England Journal of Medicine (NEJM)", im Jahr 1984 nahm das Bewusstsein zu, dass verborgene finanzielle oder soziale Beziehungen zwischen ForscherInnen und z.B. Herstellern von Arzneimitteln oder Medizinprodukten Forschungsergebnisse verzerren können und das Vertrauen in medizinische Forschung gefährden können. Das geeignete Gegenmittel erschien die Offenlegung möglichst aller potenziellen Interessenkonflikte (z.B. direkte Finanzierung der durchgeführten Studie durch den Hersteller des untersuchten Produkts, Vergütungen für andere Studien und Vorträge durch den Hersteller, alle sonst gewährten Vorteile für den Besuch von Tagungen etc.) im Rahmen wissenschaftlicher Studien und deren Veröffentlichung zu sein. Wie diverse Untersuchungen gezeigt haben, wurden und werden selbst erhebliche Interessenkonflikte entweder gar nicht oder nur partiell transparent gemacht.
Zur Entwicklung und zum Status quo der Transparenz in 444 randomisierten kontrollierten Studien (RCT) zur chirurgischen Behandlung in den Jahren 1985 bis 2015 gibt nun eine von an der Universität Heidelberg tätigen MedizinerInnen erstellte Studie differenziert Auskunft.
Diese sieht dann u.a. so aus:
• 66,2% der Studien untersuchten die Wirkung bzw. den Nutzen von medizinischen Geräten und 33,8% die Medikation und Ernährung im Umfeld chirurgischer Eingriffe - also durchaus für Interessenkonflikte anfällige Dinge
• 25,9% aller RCTs waren durch Hersteller finanziert.
• In sämtlichen bis 2000 durchgeführten RCTs gab es keinerlei Hinweise auf Interessenkonflikte.
• Trotz eines Anstiegs der Studien mit Angaben zu Interessenkonflikten fanden sich diese nur in 33% der zwischen 2005 und 2014 durchgeführten RCTs.
• Von den allein im Jahr 2014 durchgeführten RCTs enthielten schließlich immerhin schon 74% Informationen über Interessenkonflikte.
• Trotz der deutlichen Verbesserung der Transparenz fanden sich nur in 93 oder 20,9% aller 444 RCTs Angaben zur Existenz oder Nichtexistenz von Interessenkonflikten. Dies ist deshalb noch von aktueller Bedeutung, weil die Ergebnisse vieler dieser Studien noch heute das Operationsgeschehen beeinflussen dürften.
• Selbst wenn man die quantitative Entwicklung positiv bewertet, zeigt die qualitative Analyse erhebliche Mängel der abgegebenen Erklärungen zu Interessenkonflikten: Nur in 49 der 93 überhaupt Interessenkonflikte ansprechenden RCTs (52,7% und 11% bezogen auf alle RCTs) waren die Formulierungen so detailliert oder prägnant, dass es dem Leser möglich war zu bewerten, ob die veröffentlichten Ergebnisse durch Interessen beeinflusst sein könnten oder nicht.
• Dies liegt nach Ansicht der AutorInnen auch daran, dass viele Zeitschriften bisher keine detaillierten Vorgaben für die bei einer Erklärung zu nennenden Interessenkonflikte vorgeben und Reviewer nicht entschieden genug diese Erklärung einfordern.
Um die Transparenz über Interessenkonflikte quantitativ wie qualitativ weiter und zum Teil erheblich zu verbessern, kommt es nach Ansicht der AutorInnen vor allem auf die Herausgeber und Reviewer von wissenschaftlichen Veröffentlichungen an.
Der Aufsatz Conflicts of interest in randomised controlled surgical trials: systematic review and qualitative and quantitative analysis von Pascal Probst, Kathrin Grummich, Ulla Klaiber, Phillip Knebel, Alexis Ulrich, Markus W. Büchler und Markus K. ist am 22. April 2016 vor Drucklegung in der Zeitschrift "Innovative Surgical Science" online erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 29.4.16
Keine "schwarze Schafe" sondern Schattenseite der gewinnorientierten Gesundheitswirtschaft?! Die "Fälle" Olympus und Valeant
 Über das Verhalten der Pharmaindustrie oder anderer Produzenten von Gesundheitsgütern gibt es zahlreiche negative Urteile, Behauptungen oder Erwartungen, die von den damit gemeinten Unternehmen und ihren Verbänden fast reflexartig als Vorurteile oder als Herauspicken weniger oder kleiner "schwarzer Schafe" abgetan werden. Konkret werden beispielsweise exorbitant hohe Preise der Produkte mit den milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungskosten begründet und stets das Image des vor allem dem Wohl des Patienten verpflichteten Unternehmens gepflegt.
Über das Verhalten der Pharmaindustrie oder anderer Produzenten von Gesundheitsgütern gibt es zahlreiche negative Urteile, Behauptungen oder Erwartungen, die von den damit gemeinten Unternehmen und ihren Verbänden fast reflexartig als Vorurteile oder als Herauspicken weniger oder kleiner "schwarzer Schafe" abgetan werden. Konkret werden beispielsweise exorbitant hohe Preise der Produkte mit den milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungskosten begründet und stets das Image des vor allem dem Wohl des Patienten verpflichteten Unternehmens gepflegt.
Dafür, ob dies wirklich so oder völlig anders ist, gibt es fast nie oder nur selten griffige Belege bzw. die sprichwörtlichen "rauchenden Colts".
Umso interessanter sind zwei gut mit Originaldokumenten belegte Fälle eines der weltweit größten Anbieter von diagnostischen Geräten (Olympus) und eines großen kanadischen Arzneimittelherstellers (Valeant Pharmaceuticals), die beide erhebliche Zweifel an der positiven Selbstdarstellung zu lassen.
Im Falle der Firma Olympus geht es um endoskopische Geräte der Firma, die durch ihre Konstruktion so schwer oder gar nicht keimfrei gemacht werden können, dass Patienten durch den Einsatz dieser Geräte infiziert werden können. Dies bemerkte u.a. eines der größten Krankenhäuser im US-Bundesstaat Kalifornien und Anwender dieser Geräte, das "Ronald Reagan Medical Center" der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) u.a. durch den Tod von drei Patienten und die schwere Erkrankung von fünf weiteren Patienten an resistenten Bakterien, die im Gerät existieren konnten und durch dessen Gebrauch übertragen wurden. Nachdem das Krankenhaus diesen Konstruktionsfehler und die unerwünschten Folgen dem Hersteller mitteilte und den Ersatz von 35 Geräten verlangte, weigerte sich Olympus mit einer einmaligen Ausnahme. Stattdessen bot die Firma dem Krankenhaus mit dem es im Übrigen jahrelang eng zusammenarbeitete, die Lieferung neuer Geräte zu einem Preis an, der 28% höher lag als der, den sie selber wenige Monate vorher für die dann fehlerhaften Geräte verlangt und erhalten hatte. Auf den Hinweis, die Firma versuche damit von einer Versorgungskrise zu profitieren (die Firma sprach für das betreffende Geschäftsjahr selber von einer "record breaking" Gewinnerhöhung von 13%), die sie durch ihre Gerätemängel selber geschaffen habe, bot Olympus lediglich an, über Rabatte nachzudenken, wenn das Krankenhaus mehr Geräte bestellen würde.
Nach der bundesweiten Warnung vor den Risiken der Geräte durch die "Food and Drug Administration (FDA)" behauptete Olympus sowohl gegenüber den Angehörigen eines verstorbenen Patienten als auch im Rahmen eines ersten Gerichtsverfahrens, die Schuld an den Vorfällen läge bei Beschäftigten der Klinik, die sich nicht an die Instruktionen des Herstellers gehalten hätten. Daran hielt Olympus trotz der Feststellung der FDA fest, die Infektionen würden selbst dann stattfinden, wenn sich die Kliniken an die Herstellerhinweise hielten. Und auch eine Untersuchung des US-Senats, in der für den Zeitraum 2012 bis 2015 19 schwere Infektionsausbrüche ("superbug outbreaks") in den USA und Europa durch Olympusgeräte dokumentiert sind und auch die mangelhafte oder zögerliche Aufklärung von Kliniken durch die Firma kritisiert wurde, änderte am aktuellen Verhalten der Firma bisher nichts. Das UCLA-Krankenhaus kauft die Geräte mittlerweile bei einem anderen Hersteller.
Dass es sich nicht um einen einmaligen "Ausrutscher" der Firma oder einzelner Mitarbeiter handelte, zeigt schließlich die Tatsache, dass Olympus bereits in 2016 einer Strafzahlung von 646 Millionen US-Dollar zustimmte, damit weitere Ermittlungen wegen massiver Verstöße gegen geltendes US-Recht (u.a. Verbot diverser finanzieller Vergünstigungen für Ärzte) eingestellt werden.
Die ganze Geschichte, verfasst von Chad Terhune und Melody Petersen, ist versehen mit Auszügen von Mails der Firma an die Klinik am 25. März 2016 unter der Überschrift Device Maker Olympus Hiked Prices For Scopes As Superbug Infections Spread in der Los Angeles Times und den Kaiser Health News veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Ebenfalls in dem von jedermann abonnierbaren aber fast ausschließlich über US-Ereignisse berichtende Newsletter "Kaiser Health News" erschien am 28. März 2016 der Bericht Pharmaceutical Company Has Hiked Price On Aid-In-Dying Drug von April Dembosky.
Für das weitere Verständnis sei daran erinnert, das im Bundesstaat Kalifornien ähnlich wie z.B. schon länger im Bundesstaat Oregon nach langen öffentlichen Debatten mit einer parlamentarischen Mehrheit ein Gesetz verabschiedet wurde - das so genannte "aid-in-dying law" -, das bestimmten todkranken PatientInnen die Selbsttötung mit legal zugänglichen bzw. verschreibungspflichtigen Medikamenten ermöglicht. Selbstverständlich kann und darf man dazu weiterhin verschiedener Meinung sein und diese Möglichkeit ethisch ablehnen.
Das Verhalten des Herstellers eines dafür gut geeigneten und die PatientInnen relativ gering belastenden Arzneimittels hat aber nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun.
Das Mittel Seconal auch mit der Bezeichnung Secobarbital erhältlich, wurde im Jahr 1930 als Schlafmittel entwickelt und erwies sich bei einer Überdosierung oder in Kombination mit Alkohol als potenziell tödlich. Daher gilt es auch als "Mittel der Wahl" für die Selbsttötung nach dem geltenden Gesetz.
Im Jahr 2009 kostete eine tödliche Dosis von maximal 100 Kapseln (dies wird oft genannt, wird aber ebenso häufig bestritten und für zu hoch erklärt) weniger als 200 US-Dollar. Während der folgenden sechs Jahre stieg der Preis für diese Dosis auf 1.500 US-Dollar, um nach dem Kauf des Herstellers durch die Firma Valeant im Februar 2015 auf 3.000 US-Dollar zu steigen.
Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Dieselbe Firma erhöhte nach weiteren Aufkäufen anderer Pharmaunternehmen deren Preise um bis zu 500%. Sie kann dies vor allem bei dem vor 80 Jahren entwickelten Seconal nicht durch Forschungskosten rechtfertigen, sondern nutzt nur ohne jegliche Zurückhaltung das Fehlen von ähnlich wirksamen Generika oder den bei der 400-Dollar-Alternative eines Cocktails von drei Medikamenten erforderlichen Aufwand.
Auch wenn das Verhalten der kanadischen Firma Valeant in Deutschland nicht 1:1 möglich wäre, unterstreicht es, dass das Vertrauen auf ein "vernünftiges Marktverhalten" oder das Sichverlassen auf freiwillige Selbstverpflichtungen bzw. Verhaltens-Kodes solcher Firmen nicht zwangsläufig gegen "schwarze Schafe" hilft und stattdessen gezielte staatliche Regulation notwendig ist.
Bernard Braun, 30.3.16
Todkranke und zu Hause palliativ versorgte Menschen haben keine Nachteile, eher Vorteile. Rücksicht auf Präferenzen möglich!
 Fragt man gesunde wie schwer kranke Menschen an welchem Ort oder unter welchen Umständen sie sterben möchten, bevorzugen fast alle Befragten ihr häusliches Umfeld und eine dort erhältliche Pflege und Betreuung. Ein oft in diesem Zusammenhang vorgebrachter Einwand ist, dass in diesem Umfeld keine optimale Versorgung möglich wäre und die so versorgten Menschen früher und möglicherweise unter im Krankenhaus oder anderen nichthäuslichen Versorgungsorten vermeidbaren Schmerzen etc. sterben würden.
Fragt man gesunde wie schwer kranke Menschen an welchem Ort oder unter welchen Umständen sie sterben möchten, bevorzugen fast alle Befragten ihr häusliches Umfeld und eine dort erhältliche Pflege und Betreuung. Ein oft in diesem Zusammenhang vorgebrachter Einwand ist, dass in diesem Umfeld keine optimale Versorgung möglich wäre und die so versorgten Menschen früher und möglicherweise unter im Krankenhaus oder anderen nichthäuslichen Versorgungsorten vermeidbaren Schmerzen etc. sterben würden.
Dass nicht so sein muss und die geäußerten Präferenzen ernster genommen werden sollten, zeigen die Ergebnisse einer gerade veröffentlichten prospektiven multizentrischen Kohortenstudie über die Überlebenszeit von an unterschiedlichen Orten vor ihrem Tod versorgten Menschen.
Zwischen September 2012 und April 2014 wurde für 2.069 von 58 spezialisierten Anbietern von palliativer Leistungen versorgten Patienten die Überlebenszeit untersucht. 1.582 Personen erhielten die palliativen Leistungen in Kliniken oder anderen stationären Einrichtungen, 487 erhielten sie im häuslichen Umfeld. Im Untersuchungszeitraum starben insgesamt 1.607 der stationär und 462 der ambulant versorgten PatientInnen tatsächlich.
Das Ergebnis war eindeutig: Die Überlebenszeit der zu Hause palliativ versorgten todkranken PatientInnen war signifikant länger - wenige Tage, aber die sind eventuell extrem wichtig - als die der PatientInnen, die im Krankenhaus versorgt wurden und dort starben. Dabei blieb es auch nach der Adjustierung der Ergebnisse beider Gruppen nach einer Reihe von möglichen Einflussfaktoren oder Confounder, darunter soziodemografische Merkmale und klinische Charakteristika der PatientInnen.
Trotz aller selbst eingeräumten Begrenzungen ihrer Studie, kommt einer der Autoren zu dem für die eingangs zitierten Befürchtungen zu folgendem praktisch bedeutsamen Schluss: "Patients, families, and clinicians should be reassured that good home hospice care does not shorten patient life, and even may achieve longer survival."
Warum dies bei einer guten palliativen Versorgung in Deutschland völlig anders aussehen soll, ist nicht nachvollziehbar. Auf die genannten Befürchtungen sollte daher auch hierzulande zumindest bis zum Ergebnis einer vergleichbaren Studie in Deutschland verzichtet werden, und damit mehr die Präferenzen der PatientInnen beachtet werden.
Die Studie A multicenter cohort study on the survival time of cancer patients dying at home or in hospital: Does place matter? von Jun Hamano et al. ist in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Cancer" im März 2016 erschienen, von der das Abstract kostenlos verfügbar ist.
Bernard Braun, 30.3.16
EU-GH und Dextro Energy: Auch wenn positive Wirkungen nachgewiesen sind, kann gesundheitsbezogene Werbung unzulässig sein
 Bereits im Titel "Verbraucherschutz - Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 - Andere gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern - Nichtzulassung bestimmter Angaben trotz positiver Stellungnahme der EFSA - Verhältnismäßigkeit - Gleichbehandlung - Begründungspflicht" seines Urteils vom 16. März 2016 kündigt der Europäische Gerichtshof (EU-GH) eine interessante Erweiterung der Kriterien für die EU-weite Regulation von Gütern und Dienstleistungen mit expliziten gesundheitsbezogenen Prädikaten (so genannte "health claim"-Verordnung) an.
Bereits im Titel "Verbraucherschutz - Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 - Andere gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern - Nichtzulassung bestimmter Angaben trotz positiver Stellungnahme der EFSA - Verhältnismäßigkeit - Gleichbehandlung - Begründungspflicht" seines Urteils vom 16. März 2016 kündigt der Europäische Gerichtshof (EU-GH) eine interessante Erweiterung der Kriterien für die EU-weite Regulation von Gütern und Dienstleistungen mit expliziten gesundheitsbezogenen Prädikaten (so genannte "health claim"-Verordnung) an.
In dieser Verordnung ist zum einen das Prinzip festgelegt, dass Hersteller, die für ihr Produkt oder ihre Leistungen mit einem positiven gesundheitlichen Nutzen werben, ihn auch wissenschaftlich nachweisen müssen. In einer langen, aber bei weitem nicht vollständigen Liste ist dann geregelt, welche Gesundheitsbezeichnungen unzulässig, weil irreführend sind. Die "health claim"-Verordnung ist in jedem EU-Mitgliedsland unmittelbar geltendes Recht.
Bei dem jetzt vom EU-GH gefällten Urteil ging es darum, dass im Jahr 2011 die Firma "Dextro Energy die Zulassung u.a. folgender gesundheitsbezogener Angaben beantragt: "Glucose wird im Rahmen des normalen Energiestoffwechsels verstoffwechselt", "Glucose trägt zu einem normalen Energiegewinnungsstoffwechsel bei", "Glucose unterstützt die körperliche Betätigung", "Glucose trägt zu einem normalen Energiegewinnungsstoffwechsel bei körperlicher Betätigung bei" und "Glucose trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei körperlicher Betätigung bei". Trotz der positiven Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die zu dem Ergebnis gekommen war, dass ein Kausalzusammenhang zwischen der Aufnahme von Glucose und dem Beitrag zu einem normalen Energiegewinnungsstoffwechsel nachweisbar sei, lehnte die Kommission die Zulassung dieser Angaben im Januar 2015 ab."
Warum die EU-Kommission und danach auch der EU-GH trotz dieses ja eigentlich für die Zulassung ausreichenden Nachweises die Werbeangaben nicht zuließ, beruhte auf einer Erweiterung der dabei zu beachtenden Kriterien: "Sie (die EU-Kommission) befand nämlich , dass die in Rede stehenden gesundheitsbezogenen Angaben ein widersprüchliches und verwirrendes Signal an die Verbraucher senden würden, da diese zum Verzehr von Zucker aufgerufen würden, für den nationale und internationale Behörden aber eine Verringerung des Verzehrs empföhlen. Selbst wenn diese Angaben nur mit speziellen Bedingungen für ihre Verwendung und/oder mit zusätzlichen Erklärungen oder Warnungen zugelassen würden, würde die Irreführung der Verbraucher nicht genügend eingedämmt, so dass von einer Zulassung dieser Angabe abgesehen werden sollte."
"Das Gericht weist u.a. darauf hin, dass die Kommission, auch wenn sie die Stellungnahmen der EFSA (deren Aufgabe lediglich darin besteht, zu prüfen, ob die gesundheitsbezogenen Angaben durch wissenschaftliche Nachweise abgesichert sind und ob ihre Formulierung bestimmten Kriterien entspricht) nicht in Frage gestellt hat, im Rahmen des Risikomanagements die Vorschriften des Unionsrechts und sonstige relevante legitime Faktoren zu berücksichtigen hat. Da der Durchschnittsverbraucher nach den allgemein anerkannten Ernährungs-und Gesundheitsgrundsätzen seinen Zuckerverzehr verringern soll, ist die Feststellung der Kommission nicht fehlerhaft, dass die in Rede stehenden gesundheitsbezogenen Angaben, die nur die positiven Effekte für den Energiegewinnungsstoffwechsel herausstellen, ohne die mit dem Verzehr von mehr Zucker verbundenen Gefahren zu erwähnen, mehrdeutig und irreführend seien und daher nicht zugelassen werden könnten."
Es wird spannend sein, ob die Betonung der Relevanz weiterer "legitimer Faktoren" und dem Schutz von Verbrauchern vor verwirrenden Informationen und Argumenten künftig systematisch erfolgt und damit ganze Regalwände von Drogerien etc. ihre Gesundheitsprädikate verlieren könnten.
Eine Presseerklärung zum Urteil in der Rechtssache T-100/15
Dextro Energy GmbH & Co. KG/ Kommission sowie sein Volltext sind kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 20.3.16
Ungleichheit in der palliativen Behandlung am Beispiel von Schlaganfall- und Krebspatienten in Schweden
 Bei einer Reihe von schweren Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Teil der Erkrankten innerhalb kurzer Zeit sterben wird. Sowohl professionelle Helfer aber auch Laien sind daher auf palliative Unterstützung vorbereitet und wissen womit diesen Patienten in der Zeit vor ihrem Tod geholfen werden kann. Zu erwarten wäre, dass dies für sämtliche schwer Erkrankten der Fall ist.
Bei einer Reihe von schweren Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Teil der Erkrankten innerhalb kurzer Zeit sterben wird. Sowohl professionelle Helfer aber auch Laien sind daher auf palliative Unterstützung vorbereitet und wissen womit diesen Patienten in der Zeit vor ihrem Tod geholfen werden kann. Zu erwarten wäre, dass dies für sämtliche schwer Erkrankten der Fall ist.
Eine in Schweden durchgeführte Studie mit Daten des "Palliative Care Registers" (hier werden eine Fülle von Details der palliativen Behandlung aller Patienten dokumentiert) zeigt aber, dass dies nicht immer der Fall ist bzw. sein muss. Beim Vergleich der "End of Life"-Behandlung von je 1.626 Krebs- und Schlaganfallpatienten zeigten sich erhebliche Wissens- und Behandlungsunterschiede zu Ungunsten der letzteren.
Dass der Bedarf für Personen, die einen Schlaganfall erleiden vorhanden ist, zeigt die Tatsache, dass rund 20 Prozent von ihnen innerhalb einer Woche sterben und 40 Prozent innerhalb eines Jahres.
Bei Schlaganfallpatienten hatten die Helfer laut der Studie u.a. Schwierigkeiten zu berücksichtigen, ob die Patienten jemand hatten, den sie in den letzten Tagen bei sich haben wollten, sie wussten wesentlich seltener als bei Krebspatienten ob die Patienten Wünsche zum Ort ihres Sterbens hatten oder ob sie Schmerzen hatten. Letzteres ist auf dem Hintergrund problematisch, weil andere Studien zeigten, dass 43 oder sogar mehr Prozent der Patienten mit Schlaganfall Schmerzen haben, in dem analysierten Register war dies aber nur für 5 Prozent eingetragen und damit wahrscheinlich auch behandlungsrelevant. Schließlich wurde mit diesen Patienten und ihren Angehörigen auch wesentlich seltener als mit Krebskranken so genannte "turning point"-Gespräche zu dem Zeitpunkt geführt, wo an Stelle einer kurativen die palliative Behandlung tritt. Diese Gespräche wurden bei 69 Prozent der Schlaganfallpatienten und bei 24 Prozent der Krebspatienten nicht geführt.
Die bei ausländischen Studien obligatorische Frage, ob deren Ergebnisse auch für Deutschland gelten, ist mangels vergleichbarer Registerdaten seriös nicht zu beantworten. Trotzdem sollten sie Anlass sein, derartige Ungleichheiten auch in der palliativen Versorgung in Deutschland nicht auszuschließen oder mit geeigneten Methoden sie zu identifizieren oder auszuschließen.
Die Studie End of Life Care for Patients Dying of Stroke: A Comparative Registry Study of Stroke and von Heléne Eriksson, Anna Milberg, Katarina Hjelm, Maria Friedrichsen ist im März 2016 in der Fachzeitschrift "PLOS ONE" (11 (2)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.3.16
Enger Zusammenhang: Wohlbefinden in der letzten Lebensphase, soziale Ziele, Teilhabe und Aktivitäten
 Eine Grunderkenntnis von und ein Ansatzpunkt für Public Health ist, dass viele Krankheiten und gesundheitsbezogene Ereignisse in erheblichem, wenn nicht sogar überwiegenden Maße mit sozialen Strukturen und Beziehungen assoziiert sind oder durch diese verursacht werden. Dort befinden sich folglich auch wichtige Ansatzpunkte für Prävention und Bewältigung.
Eine Grunderkenntnis von und ein Ansatzpunkt für Public Health ist, dass viele Krankheiten und gesundheitsbezogene Ereignisse in erheblichem, wenn nicht sogar überwiegenden Maße mit sozialen Strukturen und Beziehungen assoziiert sind oder durch diese verursacht werden. Dort befinden sich folglich auch wichtige Ansatzpunkte für Prävention und Bewältigung.
Einen gewichtigen Beleg für diese Zusammenhänge liefert jetzt eine gerade veröffentlichte Analyse über die spezifischen und eigenständigen Zusammenhänge von sozialer Aktivität und Engagement sowie einer Vielzahl gelebter sozialer Werte auf das Wohlbefinden insbesondere älterer Personen in den letzten Jahren vor ihrem Tod.
Der Studie lagen Daten aus dem Sozioökonomischen Panel (SOEP) von 2.910 verstorbenen Personen zugrunde, die vor ihrem Tod bis zu 27-mal an der jährlich durchgeführten Erhebung teilgenommen hatten. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt ihres Todes betrug 74 Jahre und das Verhältnis von Männern und Frauen war ausgeglichen. Diese Personen wurden u.a. regelmäßig zu ihrem Wohlbefinden und ihren sozialen Aktivitäten befragt.
Die wesentlichen Ergebnisse waren:
• "Sowohl ein sozial aktives Leben als auch das Verfolgen von sozialen Zielen stehen unabhängig voneinander mit einem höheren Wohlbefinden in der letzten Lebensphase in Verbindung.
• Der Zusammenhang ist unabhängig von anderen bereits bekannten Faktoren, wie dem Gesundheitszustand, Behinderungen oder Krankenhausaufenthalten sowie beispielsweise dem Geschlecht, dem sozio-ökonomischen Status und dem Bildungsstand zu beobachten.
• Die Stärke des Effektes liegt bei annähernd zehn Prozent im Hinblick auf die Höhe des Wohlbefindens und bei beinahe zwanzig Prozent in Bezug auf dessen Abnahme kurz vor dem Tod.
• Wenn die untersuchten Personen sowohl weniger sozial aktiv waren als auch soziale Ziele weniger wichtig fanden, verstärkten sich die an sich schon einzeln vorhandenen Effekte erheblich. Diese Menschen schätzten ihre Lebenszufriedenheit ein Jahr vor ihrem Tod besonders niedrig ein. Außerdem konnte gezeigt werden, dass soziale Teilhabe nicht nur an sich wichtig ist, sondern dass es auch darauf ankommt, sozial aktiv zu bleiben. So war die Abnahme des Wohlbefindens vor dem Tod weniger ausgeprägt bei Menschen, deren hohes Niveau an sozialen Aktivitäten - trotz Krankheit und Behinderung - kaum abnahm."
Die von einem internationalen ForscherInnenteam u.a. aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erstellte 56-seitiges Studie Terminal decline in well-being: The role of social orientation von Gerbstoff, D., Hoppmann, C. A., Löckenhoff, C. E., Infurna, F. J., Schupp, J., Wagner, G. G. und Ram, N. ist im März 2016 in der Fachzeitschrift "Psychology and Aging" (31(2):149-65) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.3.16
Beteiligung von Krebspatienten bei Behandlungsentscheidungen verbessert die Versorgungsqualität

Eine amerikanische Studie befasste sich mit dem Zusammenhang von Shared Decision Making und der Versorgungsqualität aus Patientensicht.
Patienten mit Darmkrebs oder Lungenkrebs, die angeben, dass der Arzt die Behandlungsentscheidungen kontrolliert, bewerten die Qualität der Versorgung und die ärztliche Kommunikation als weniger gut im Vergleich zu den Patienten, die an den Entscheidungen beteiligt sind.
Dies ist das Ergebnis Befragung von über 5000 Patienten, die zwischen 2003 und 2005 eine Darmkrebs- oder Lungenkrebsdiagnose erhalten haben.
3 bis 6 Monate nach der Diagnosestellung waren die Patienten befragt worden nach
• ihrer Bewertung der Behandlungsqualität
• der bevorzugten und der tatsächlichen Rolle bei Entscheidungen
• ihrer Bewertung der ärztlichen Kommunikation.
Die Rolle bei Entscheidungen wurde in die Kategorien "patientenkontrolliert", "Shared Decision Making" und "arztkontrolliert" unterteilt.
Die Mehrheit (58%) der 5315 Patienten gab den Wunsch nach Shared Decision Making an, 36% bevorzugten die patientenkontrollierte Rolle und 6% die arztkontrollierte Rolle. 42% der 10.817 Behandlungsentscheidungen betrafen Operationen, 36% Chemotherapie und 22% Strahlentherapie.
Auch Patienten, die sich nicht beteiligen möchten, bewerten die Qualität der Versorgung der Kommunikation tendenziell höher, wenn der Arzt sie beteiligte.
Kehl KL, Landrum M, Arora NK, et al. Association of actual and preferred decision roles with patient-reported quality of care: Shared decision making in cancer care. JAMA Oncology 2015. Abstract
David Klemperer, 6.8.15
Zügigkeit des Verwaltungsverfahrens von Krankenkassen als Patientenrecht - aber manchmal nur mit Hilfe eines Gerichts
 Zu einem wichtigen Recht von Patienten gehört, dass Entscheidungen über oder in ihrer Behandlung schnell und verbindlich getroffen werden, Ungewissheiten möglichst vermieden werden oder so schnell wie möglich Klarheit geschaffen wird. Dies gilt seit Verabschiedung des Patientenrechtegesetzes im Jahr 2013 auch für Entscheidungen der gesetzlichen Krankenkassen. Im § 13 Abs. 3a des Fünften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V) heißt es seitdem eigentlich unmissverständlich: (1) Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf Leistungen zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (Medizinischer Dienst), eingeholt wird, innerhalb von fünf Wochen nach Antragseingang zu entscheiden. … (5) Kann die Krankenkasse Fristen nach Satz 1[...] nicht einhalten, teilt sie dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. (6) Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt. (7) Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet."
Zu einem wichtigen Recht von Patienten gehört, dass Entscheidungen über oder in ihrer Behandlung schnell und verbindlich getroffen werden, Ungewissheiten möglichst vermieden werden oder so schnell wie möglich Klarheit geschaffen wird. Dies gilt seit Verabschiedung des Patientenrechtegesetzes im Jahr 2013 auch für Entscheidungen der gesetzlichen Krankenkassen. Im § 13 Abs. 3a des Fünften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V) heißt es seitdem eigentlich unmissverständlich: (1) Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf Leistungen zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (Medizinischer Dienst), eingeholt wird, innerhalb von fünf Wochen nach Antragseingang zu entscheiden. … (5) Kann die Krankenkasse Fristen nach Satz 1[...] nicht einhalten, teilt sie dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. (6) Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt. (7) Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet."
Trotzdem verzögern GKV-Kassen immer wieder bestimmte Entscheidungen weit über die gesetzliche Frist hinaus und informieren die davon betroffenen Patienten nicht über die maßgeblichen Gründe.
In einem aktuellen vor Gericht gelandeten Fall hatte eine zur Gewichtsabnahme am Magen operierte Versicherte nach dem eingetretenen Erfolg wohlbegründet beantragt, die dadurch an verschiedenen Körperstellen aufgetretenen Hautlappen operativ entfernen lassen zu können - als eine Sachleistung ihrer Kasse. Die Kasse konnte sich innerhalb der maximal fünfwöchigen Bewilligungsfrist nicht zu einer Entscheidung durchringen und informierte die Patientin darüber nicht. Erst nach einem halben Jahr bewilligte sie schließlich die Entfernung einiger Hautlappen, nicht aber aller beantragten. Gegen diese Entscheidung klagte die Versicherte und zwar, weil nach dem gesamten Verlauf und dem zitierten Gesetzeswortlaut diese Leistungen als genehmigt gelten müssten. Die Kasse räumte zwar die Fristüberziehung ein, blieb aber bei ihrer Position und verwies darauf, hier liege weder eine Krankheit vor noch sei die Operation wirtschaftlich.
Das Sozialgericht Heilbronn wies diese Argumentation in einer Entscheidung vom 11. März 2015 zurück und unterstrich den vom Gesetzgeber im Interesse von Patienten gewollten Druck auf ein zügiges Verwaltungsverfahren von dem sich eine Krankenkasse auch nicht mit nachgeschobenen Argumenten befreien könne.
Eine Pressemitteilung des Gerichtes zu dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des SG Heilbronn mit dem Az.: S 11 KR 2425/14 ist kostenlos erhältlich. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, ist aber sicherlich nach ihrer Veröffentlichung ebenfalls zugänglich.
Bernard Braun, 26.5.15
Gesundheitsdatenschutz zwischen "Die Daten sind sicher" und "NSA is watching you" - Wie sicher sind Gesundheitsdaten in den USA?
 Egal, ob es um die elektronische Versichertenkarte der Gesetzlichen Krankenkassen, elektronische Patientenakten, das "sichere Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen (SNK)" bzw. seinen Vorgänger KV-SafeNet oder andere Datendokumentationen und -flüsse im deutschen Gesundheitswesen geht: Die Daten sind sicher sagen die Einen, während Andere Datenschutzverletzungen zu Lasten von Versicherten oder Patienten drohen sehen.
Egal, ob es um die elektronische Versichertenkarte der Gesetzlichen Krankenkassen, elektronische Patientenakten, das "sichere Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen (SNK)" bzw. seinen Vorgänger KV-SafeNet oder andere Datendokumentationen und -flüsse im deutschen Gesundheitswesen geht: Die Daten sind sicher sagen die Einen, während Andere Datenschutzverletzungen zu Lasten von Versicherten oder Patienten drohen sehen.
Zu den Letzteren zählen weite Teile der Bevölkerung: Die im Rahmen des bevölkerungsrepräsentativen "Gesundheitsmonitors" der Bertelsmann Stiftung Befragten antworteten auf die zwischen 2001 und der Gegenwart regelmäßig gestellte Frage, ob sie befürchteten, dass "ihre persönlichen Gesundheits- und Behandlungsdaten von nicht dazu berechtigten Personen eingesehen werden können" eine von rund 43% auf knapp 50% umfassende Gruppe von Befragten mit "ja". Ob diese Befürchtung praktische Auswirkungen hat, d.h. Patienten u.U. ihrem Arzt nicht alles sagen, was dieser für eine bedarfsgerechte Behandlung benötigt, ist nicht bekannt, aber untersuchungswürdig.
Für das gemeinsame Ziel des uneingeschränkten Datenschutzes sollte jedenfalls an die Stelle der gebetsmühlenhaft geführten "könnte versus könnte-nicht-sein"-Debatte mehr Transparenz über Datenflüsse, den Datenschutz aber auch Datenschutzverletzungen treten.
Wie dies aussehen kann, zeigt ein gerade in dem Medizinjournal "JAMA" veröffentlichter Forschungsbrief über die Anzahl und Art von Datenschutzverletzungen und die davon Betroffenen im Gesundheitssystem der USA.
Die Autoren stützen sich dabei auf Daten über Datenschutzverletzungen, die nach dem "Health Isurance Portability and Accountability Act" und dem "Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act" aus dem Jahr 209 meldepflichtig sind, d.h. mehr als 500 Individuen betrafen.
Im Zeitraum 2010 bis 2013 fanden im US-Gesundheitswesen folgende gemeldete (über Dunkelziffern gibt es nur Spekulationen) Ereignisse statt:
• Insgesamt ereigneten sich 949 Datenschutzverletzungen, die zusammen 29,1 Millionen Datensammlungen/-sätze oder Akten betrafen.
• In sechs dieser Ereignisse wurde der Schutz von mehr als 1 Million Datensammlungen/Akten gebrochen.
• Die Zahl der Verletzungen nahm kontinuierlich zu.
• Bei 67% dieser Ereignisse ging es um elektronisch gespeicherte Daten.
• Die meisten Ereignisse waren krimineller Natur.
• Die Verletzungen des Datenschutzes erfolgte durch Hacking, Diebstahl von Datenträgern, die Erlangung von Datenzugängen durch Täuschung von mit der Datenverwaltung betrauten Personen (z.B. Passworterschlechung) oder die eigentlich verbotene Speicherung und Mitnahme ins "home office" von Daten auf persönlichen, gering gesicherten Tablets etc.
Angesichts der absehbaren Tendenzen von noch mehr digitalisierten und elektronisch erhobenen, transportierten und gespeicherten Gesundheitsdaten (z.B. DNA-Daten, Telemonitoring) erwarten die AutorInnen, dass "health care data breaches are likely to increase" und fordern, dass statt an einer "Alles-ist-sicher"-Legende kontinuierlich an Gegenstrategien und an der Weiterentwicklung von guter Datenschutzpraxis gearbeitet wird.
Geht man davon aus, dass auch die us-amerikanischen Krankenversicherungsunternehmen, Krankenhäuser oder Arztpraxen alles tun, um solche Ereignisse mit allen Mitteln zu verhindern, gibt es keinen Grund, dass ausgerechnet Deutschland eine Art "Insel der Datensicherheit" sein sollte.
Der am Tag der Erstveröffentlichung dieses Beitrags (20. April 2015) fast den gesamten Tag anhaltende Zusammenbruch des IT-Systems der Bundesagentur für Arbeit, zeigt außerdem, dass auch Computersysteme von Sozialversicherungsträger nicht vor gravierenden Fehlern gefeit sind - ohne dass richtig klar ist, was oder wer daran "schuld" ist.
Der am 14. April 2015 erschienene "Research Letter" Data Breaches of Protected Health Information in the United States von Vincent Liu, Mark A. Musen,und Timothy Chou ist im "Journal of American Medical Association (JMA)" (313(14):1471-1473) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.4.15
Gesundheitswirtschaft: "Health sells" aber wovor öffentliche Verbraucherschützer schützen sollten.
 Es vergeht kein Monat in dem nicht irgendein wissenschaftliches Institut, ein Wirtschaftsverband, ein Bundes- oder Landesministerium, eine Unternehmensberatung, eine Industrie- und Handelskammer oder eine Autorengemeinschaft aus diesen Einrichtungen, das hohe Lied von der goldenen Zukunft und der konjunkturtragenden Bedeutung der Gesundheitswirtschaft anstimmt. Auf einen dieser Reports soll hier wegen einer relativ seltenen aber zunächst inhaltlich vielversprechenden Besonderheit hingewiesen werden.
Es vergeht kein Monat in dem nicht irgendein wissenschaftliches Institut, ein Wirtschaftsverband, ein Bundes- oder Landesministerium, eine Unternehmensberatung, eine Industrie- und Handelskammer oder eine Autorengemeinschaft aus diesen Einrichtungen, das hohe Lied von der goldenen Zukunft und der konjunkturtragenden Bedeutung der Gesundheitswirtschaft anstimmt. Auf einen dieser Reports soll hier wegen einer relativ seltenen aber zunächst inhaltlich vielversprechenden Besonderheit hingewiesen werden.
Zunächst stimmt das Ende Februar 2015 erschienene Gutachten zur ökonomischen Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg inhaltlich das gewohnte Lied an. Etwas anders sehen die "Sänger", d.h. der Auftraggeber "Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH" aus. Dieser ist nämlich eine public-private-Partnership-Tochtergesellschaft der Handelskammer und der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburgs. Interessant ist nun, ob sich dies irgendwie bei der Darstellung und Bewertung der gesundheitswirtschaftlichen Grunddaten bemerkbar macht!?
Der Report listet dazu die folgenden uneingeschränkt positiv bewerteten ökonomischen Eckdaten auf:
• Der Anteil der Gesundheitswirtschaft an der regionalen Gesamtwirtschaft ist von 8,4 Prozent im Jahr 2005 auf 9,4 Prozent im Jahr 2013 gestiegen.
• Die Bruttowertschöpfung (BWS) lag 2013 bei enormen 8,2 Milliarden Euro.
• Die jährliche Steigerung der BWS im Untersuchungszeitraum in der Gesamtwirtschaft betrug 1,6 Prozent, in der Gesundheitswirtschaft dagegen 3,1 Prozent - und dieser Vorsprung war im Krisenjahr 2009 sogar deutlich größer.
• All dies schlug sich last but not least in einer überdurchschnittlichen Wachstumsrate der Beschäftigung von rund 2 Prozent nieder.
• Und auch die Zukunft sieht mit Hilfe geeigneter "Kellen" gut aus: "Der Zweite Gesundheitsmarkt weist somit insbesondere hinsichtlich der Bruttowertschöpfung Wachstumspotentiale auf, die es zukünftig auszuschöpfen gilt."
Auch wenn die Studie sich auf die "ökonomische Bedeutung" der Gesundheitswirtschaft konzentriert, und dies dem vorrangig dem Umsatz- und Gewinninteressen von Wirtschaftsunternehmen verpflichteten Mitherausgeber "Handelskammer Hamburg" vollkommen genügen mag, stellt sich aber doch die Frage, ob dies dem Zweiten im Bunde, nämlich der dem Gemeinwohl verpflichteten "Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz" genügen darf.
Auch einer noch so von Umsatz- und damit auch Gewinnzahlen der Gesundheitswirtschaft eingenommenen Behörde für Gesundheit hätte es eigentlich zu Ohren gekommen sein müssen, dass ein mehr oder weniger großer, aber jedenfalls spürbarer Teil der im ersten (10% bis 20%) aber vor allem zweiten Gesundheitsmarkt angebotenen Güter und Dienstleistungen bestenfalls keinen nachweisbaren gesundheitlichen Nutzen hat und der Verbraucher eigentlich zumindest vor deren Angebot als Gesundheits-Gut bewahrt werden sollte. Anstatt alles zu tun, um die für das Verhalten großer Teile der Bevölkerung hohe Bedeutung der Prädikate Gesundheit oder gesund abzusichern, legitimiert die Hamburger Behörde euroselig das gegenüber Inhalten gleichgültige Primat von Umsätzen, Gewinnen und Arbeitsplätzen.
Das Elend dieser Taubheit ist, dass alle z.B. durch die Einnahme verordnungspflichtiger aber qualitativ problematischer Arzneimittel oder den Konsum von fragwürdigen Vitamin- oder Nahrungsergänzungsmittel-Cocktails ausgelösten behandlungsbedürftigen Nebenwirkungen oder das Verschleppen und damit möglicherweise Teurerwerden der Behandlung von krankhaften Erscheinungen der Gesundheitswirtschaft nicht als eine Art externalisierte Kosten in Rechnung gestellt wird und deren Bilanz dann deutlich weniger strahlt. Das Gegenteil trifft zu, d.h. auch die Bewältigung der ungeplanten oder auch billigend in Kauf genommen Effekte eines Teils der Gesundheitswirtschaftsangebote erhöht ja noch ihren Umsatz. Auf die Idee, dass ein etwas niedrigerer Umsatz der Gesundheitswirtschaft bzw. die rigorose Entfernung von Produkten vom Gesundheitsmarkt, die zwar gesund zu sein behaupten, es aber nicht sind, mehr Gesundheit bedeuten können, kommen leider die Hamburger Behörde und viele andere öffentliche Akteure in diesem Feld nicht.
Nähert sich dann doch einmal einer dieser Gesundheitswirtschafts-Berichte einem Produktbereich wie dem der Arzneimittel, in dem es jahrzehntelange Bemühungen um die Entfernung unwirksamer oder nur schädlicher Mittel oder die Verhinderung neuer, qualitativ ebenfalls problematischer Güter gibt, werden diese Bemühungen um Gesundheit ignoriert und stattdessen das Bürokratielamento angestimmt.
In dem ebenfalls gerade erschienenen und allein von der IHK Lübeck herausgegebenen "Branchenportrait Gesundheitswirtschaft" werden nach dem gewohnten Freudensturm eine Reihe von lästigen Jubelhindernissen aufgezählt:
• "Mit einer überbordenden Bürokratie und steigenden Produktionskosten werden Bundes- und EU -politische Themen als gravierende Hemmnisse benannt."
• Und: "Allerdings werden die anhaltenden Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen nicht spurlos am Handel mit Arzneimitteln vorübergehen. Im Zuge restriktiverer Vorgaben wird es zunehmend bedeutender, die Produktpalette weiter zu diversifizieren und stärker an die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung auszurichten."
• Und schließlich werden "die zunehmenden Restriktionen und der teilweise damit einhergehende Preisverfall bei Arzneimitteln als größte Risiken eingestuft."
Ein 9-seitiges Management Summary der im Auftrag der Gesundheitswirtschaft GmbH Hamburg erstellten Untersuchung der ökonomischen Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg verfasst von Dennis A. Ostwald, Benno Legler und Marion Cornelia Schwärzler, ist komplett kostenlos erhältlich - die Langfassung nicht.
Das Branchenportrait Gesundheitswirtschaft - Struktur und Perspektiven einer Zukunfts-Branche der IHK Lübeck gibt es auch kostenlos.
Bernard Braun, 16.4.15
Ist die Ergebnisqualität teurer high-end-Leistungen besser oder "hilft viel, viel"? Das Beispiel der Hörgeräteversorgungsreform
 Obwohl in Deutschland seit längerem kein Jahr ohne mehr oder weniger tiefgreifende gesetzliche und vertragliche Reformen der Strukturen und Leistungen im Gesundheitswesen vergeht, mangelt es häufig an methodisch höherwertigen Untersuchungen ihrer Wirkungen oder Nutzen. Methodisch anspruchsvoller und ertragreicher sind z.B. Untersuchungen, die nicht nur Wahrnehmungen und Erfahrungen nach einer Reform messen, sondern sich darum bereits im Vorfeld einer Reform kümmern, um dann durch den Vergleich zweier Querschnittsanalysen und nicht allein durch häufig verzerrte Erinnerungen solide Erkenntnisse über Veränderungen gewinnen zu können. Zu einer praktisch relevanten Politikfolgenforschung gehört aber außerdem, dass die Wahrnehmungen, Erfahrungen und Bewertungen von Betroffenen oder Nutznießer von Reformen oder der patienten- und versichertenbezogene Nutzen die entscheidende empirische Grundlage sind.
Obwohl in Deutschland seit längerem kein Jahr ohne mehr oder weniger tiefgreifende gesetzliche und vertragliche Reformen der Strukturen und Leistungen im Gesundheitswesen vergeht, mangelt es häufig an methodisch höherwertigen Untersuchungen ihrer Wirkungen oder Nutzen. Methodisch anspruchsvoller und ertragreicher sind z.B. Untersuchungen, die nicht nur Wahrnehmungen und Erfahrungen nach einer Reform messen, sondern sich darum bereits im Vorfeld einer Reform kümmern, um dann durch den Vergleich zweier Querschnittsanalysen und nicht allein durch häufig verzerrte Erinnerungen solide Erkenntnisse über Veränderungen gewinnen zu können. Zu einer praktisch relevanten Politikfolgenforschung gehört aber außerdem, dass die Wahrnehmungen, Erfahrungen und Bewertungen von Betroffenen oder Nutznießer von Reformen oder der patienten- und versichertenbezogene Nutzen die entscheidende empirische Grundlage sind.
Dass diese Art Politikfolgenforschung inhaltlich, organisatorisch und relativ unaufwändig möglich ist, zeigen diverse in den letzten Jahren mit Routinedaten der GKV-Krankenkassen oder mit Daten aus Befragungen von Krankenkassenversicherten erstellte Surveys zu krankheitsspezifischen Behandlungen oder gruppenspezifischen Interventionen.
Ein aktuelles Beispiel ist eine auf zwei inhaltlich identische Befragungen gestützte Analyse verschiedener Folgen einer Reform der technischen Leistungen für Hörgeminderte auf die finanzielle Situation und die Hörqualität der HörgerätenutzerInnen. Zum 1. November 2013 haben die gesetzlichen Krankenkassen ihren Festbetrag für Hörhilfen deutlich erhöht. Dadurch sollten Versicherte von den zum Teil mehrere Tausend Euro betragenden Eigenanteilen finanziell entlastet und gleichzeitig die Leistungsanforderungen an die Hörgeräte deutlich erhöht werden, was sich u.a. aus der Streichung von rund 2.500 Hörgeräten aus dem GKV-Hilfsmittelverzeichnis führte, welche die höheren technischen Anforderungen nicht mehr erfüllten. Von der Hörgeräteversorgung betroffen sind jährlich rund 500.000 gesetzlich Krankenversicherte, wobei die Anzahl der Personen, die eigentlich ein Hörgerät tragen sollten deutlich größer ist, die Nachfrage aber u.a. wegen der Stigmatisierung des Tragens von Hörgeräten oftmals erst mit großen Verzögerungen erfolgt. So dauert es auch aktuell fast bei der Hälfte der Befragten 18 Monate oder länger bis sie sich nach der Wahrnehmung der Hörminderung für ein Hörgerät entscheiden.
Die Wirkungen der Leistungsreform wurden in zwei Erhebungswellen mit insgesamt 1.481 Versicherte der Bremer Handelskrankenkasse (hkk) über 18 Jahre erhoben, denen vor oder nach der Erhöhung der Festbeträge für Hörhilfen am 1. November 2013 eine Hörhilfe verordnet wurde. Die Befragung erfolgte mit einem schriftlichen Fragebogen. Der Rücklauf betrug 77,8 Prozent (Welle 1) und 51,4 Prozent (Welle 2).
Die wesentlichen Ergebnisse der von dem Gesundheitswissenschaftler Dr. Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen durchgeführten Studie lauten:
• Versicherte zahlen weiterhin hohe Eigenanteile für Hörgeräte: Auch wenn der Anteil der Befragten, die einen Eigenanteil leisten, von 80,6 auf 74,1 Prozent nach der Festbetragserhöhung gesunken ist, zahlen weiterhin knapp 40 Prozent der überwiegend Rente beziehenden HörgerätenutzerInnen einen Eigenanteil von 500 bis 2.000 Euro. Lediglich im hochpreisigen Segment mit Eigenanteilen über 2.000 Euro ist der Anteil deutlich von 25,5 Prozent auf 13,7 Prozent gesunken. Obwohl sich die Ausgaben der GKV für Hörgeräte seit Erhöhung der Festbeträge erwartungsgemäß und zwar um 60% erhöht haben, tragen Hörgeräteempfänger immer noch beträchtliche Eigenanteilslasten.
• Teuer ist nicht besser oder "viel muss nicht viel bringen": Die oft bei gesundheitsbezogenen Leistungen mit hohen Preisen und damit auch mit dieser Reform verknüpfte Erwartung an eine bessere Erlebnisqualität bestätigt sich in der Befragung für Höregeräte bis auf winzige Ausnahmen nicht. Die durch zahlreiche erprobte Indikatoren für verschiedenste Hörsituationen gemessene subjektiv wahrgenommene Hörqualität unterscheidet sich weder zwischen den beiden Wellen noch zwischen Eigenanteilszahlern und -nichtzahlern signifikant.
• Diskrepanz zwischen Leistungsversprechen und Nutzen: Rund 80 Prozent der Befragten bewerten zwar den durch ein Hörgerät realisierten Nutzen für Gespräche mit einzelnen Personen oder vor dem heimischen Fernsehgerät uneingeschränkt positiv. Aber der Anteil, der diesen Nutzen zum Beispiel bei Unterhaltungen im größeren Kreis oder in weitläufigen, offenen Räumen wahrnimmt, sinkt auf ein Drittel und weniger. Mindestens zwei Drittel der Befragten nehmen also in Situationen, die für ihre aktive soziale Teilhabe wichtig sind, keinen wesentlichen Nutzen durch ein Hörgerät wahr. Dabei leisten teure Geräte "in den Ohren" ihrer Träger - trotz aller Werbeversprechen von Hörgeräteherstellern und -akustikern - nicht wesentlich mehr als preisgünstige beziehungsweise eigenanteilsfreie Hörgeräte.
• Defizite bei der Compliance: Da das regelmäßige Tragen des Hörgeräts die entscheidende Voraussetzung für den Versorgungserfolg und die Wiederherstellung bestimmter Hörfähigkeit ist, sind die 40 Prozent der Hörgerätebesitzer, die angaben das Gerät auch außerhalb der Schlafenszeit zu entfernen ein bedenklich hoher Anteil. Sie gefährden damit sich und andere. Als Hauptgrund geben die Befragten an, dass die Geräte nicht funktionieren oder stören, was bedeutet, dass ein Teil dieser riskanten Noncompliance vermeidbar ist.
Der ausführliche, im März 2015 erschienene hkk-Gesundheitsreport Hörhilfen: Ergebnisse einer Versichertenbefragung kann kostenlos heruntergeladen werden.
Jens Holst, 30.3.15
Soll die Flut der diagnostischen Tests staatlich reguliert werden? Eine Einführung in die Pro und Contra-Debatte in den USA
 Zum medizinisch-technischen Fortschritt wird u.a. die in den letzten Jahren rasch zunehmende Anzahl von diagnostischen Labortests gezählt, die von einfachen Bestimmungen von Körperwerten bis zu prädiktiven Tests für hochkomplexe Risikokonstellationen im menschlichen Körper reichen. Diese Tests werden zum Teil - so zumindest in den USA - sogar zum Selbsttest angeboten, dessen Ergebnisse der Nutzer bzw. Patient per Post an ein Labor schickt, das ihm dann auf demselben Weg auch die Ergebnisse über das Vorhandensein von Risiken oder Erkrankungen zusendet. Viele dieser Tests basieren auf Erkenntnissen der Genom-Medizin.
Zum medizinisch-technischen Fortschritt wird u.a. die in den letzten Jahren rasch zunehmende Anzahl von diagnostischen Labortests gezählt, die von einfachen Bestimmungen von Körperwerten bis zu prädiktiven Tests für hochkomplexe Risikokonstellationen im menschlichen Körper reichen. Diese Tests werden zum Teil - so zumindest in den USA - sogar zum Selbsttest angeboten, dessen Ergebnisse der Nutzer bzw. Patient per Post an ein Labor schickt, das ihm dann auf demselben Weg auch die Ergebnisse über das Vorhandensein von Risiken oder Erkrankungen zusendet. Viele dieser Tests basieren auf Erkenntnissen der Genom-Medizin.
Ob die Entwicklung, die Vermarktung und der Einsatz solcher Tests durch die für die Zulassung von Medizinprodukten wie Arzneimittel oder Medizingeräten zuständigen staatlichen Einrichtungen reguliert werden sollte, wird nun in den USA seit einigen Monaten intensiv diskutiert. Dafür spricht, dass eine Reihe dieser diagnostischen Tests falsch-positive aber auch falsch-negative Ergebnisse liefern und Ärzte wie Patienten kritische Entscheidungen im Dunkeln treffen müssen, die u.U. zu Fehlbehandlungen führen - so die Befürworter einer systematischen Kontrolle der Wirksamkeit und des Schadenspotenzials der Tests. Eine zu starke Regulierung verhindert nach Ansicht der Warner vor einem solchen Schritt den gerade möglich erscheinenden Nutzen der Genforschung, die Entwicklung besserer genetischer Tests und das Versprechen der "genomic medicine".
Wer sich einen Überblick über den derzeitigen Stand der Debatte in den USA verschaffen will, kann dies jetzt kostenlos in zwei kurzen pro und contra-"Viewpoint"-Beiträgen beginnen, die am 5. Januar 2015 online in der Fachzeitschrift "JAMA" erschienen sind.
Es handelt sich um den Aufsatz FDA Regulation of Laboratory-Developed Diagnostic Tests Protect the Public, Advance the Science. Should the FDA regulate laboratory-developed diagnostic tests? —Yes. von Joshua Sharfstein, und den Aufsatz Genetic Testing and FDA RegulationOverregulation Threatens the Emergence of Genomic Medicine. Should the FDA regulate laboratory-developed diagnostic tests? —No. von James P. Evans und Michael S. Watson.
Mehr zum Thema Laboratory Developed Tests, darunter zahlreiche Gutachten, findet sich auf einer Website der für die Regulierung potenziell zuständigen "U.S. Food and Drug Administration (FDA".
Bernard Braun, 5.1.15
Beratung über sexuelle Aktivitäten nach Herzinfarkt Mangelware und trotz Leitlinienevidenz restriktiv und frauen-/altenfeindlich
 Für viele PatientInnen, die einen Herzinfarkt hatten, gehören sexuelle Aktivitäten zu den wichtigen Merkmalen einer Rückkehr ins normale und gute Leben und tragen dazu positiv bei. Deshalb empfehlen die aktuellen US-Leitlinien zur Akutbehandlung und Rehabilitation von Herzinfarktpatienten auch ausdrücklich, dass Patienten mit einem komplikationsfreien Herzinfarkt (HI) und sofern sie keine unerwünschten Herz-/Kreislaufsymptome bei leichter oder mittelmäßiger körperlichen Aktivität haben, eine Woche nach ihrem Infarkt oder kurz später wieder sexuell aktiv sein können.
Für viele PatientInnen, die einen Herzinfarkt hatten, gehören sexuelle Aktivitäten zu den wichtigen Merkmalen einer Rückkehr ins normale und gute Leben und tragen dazu positiv bei. Deshalb empfehlen die aktuellen US-Leitlinien zur Akutbehandlung und Rehabilitation von Herzinfarktpatienten auch ausdrücklich, dass Patienten mit einem komplikationsfreien Herzinfarkt (HI) und sofern sie keine unerwünschten Herz-/Kreislaufsymptome bei leichter oder mittelmäßiger körperlichen Aktivität haben, eine Woche nach ihrem Infarkt oder kurz später wieder sexuell aktiv sein können.
Die Wirklichkeit sieht nach den Ergebnissen einer Studie (Baseliner und Follow up nach einem Monat) mit 2.349 weiblichen und 1.152 männlichen, achtzehn- bis fünfundfünfzigjährigen erwachsenen (Durchschnittsalter 48 Jahre) HI-Patienten in den USA und Spanien in jeder Hinsicht anders aus:
• Während des ersten Monats nach ihrem Infarkt sprachen gerade mal 12% der weiblichen und 19% der männlichen HI-Patienten mit ihren Ärzten über ihre Sexualpraxis.
• Von diesen Patienten wurde gerade mal einem Drittel gesagt, sie könnten ohne Einschränkungen Geschlechtsverkehr haben. Zwei Drittel erhielten den ärztlichen Rat so passiv wie möglich zu bleiben und auf einen niedrigen Puls zu achten - wahrhaft schlechte Bedingungen für guten Sex.
• Frauen, Ältere und Personen mit sexueller Inaktivität zu Beginn oder kurz vor der Behandlung warenm besonders vom Nichterhalt von Beratung betroffen.
• Unter den Patienten, die überhaupt beraten wurden, wurden den Spanierinnen signifikant häufiger restriktive Ratschläge gegeben als den Amerikanerinnen.
Die AutorInnen der Studie empfehlen dringend, die Beratung über die bedenkenlose Möglichkeit sexueller Aktivitäten zum festen Bestandteil der Beratung über die Rückkehr zu sonstigen Aktivitäten und zur Arbeit zu machen.
Der Aufsatz Sexual Activity and Counseling in the First Month After Acute Myocardial Infarction (AMI) Among Younger Adults in the United States and Spain: A Prospective, Observational Study von Stacy Tessler Lindau et al. ist am 15. Dezember 2014 online vor dem Druck in der Zeitschrift "Circulation" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.12.14
Gehirnjogging-Produkte "nein danke" oder geistig fit durch "gutes Leben"
 Egal ob papiergebunden oder computerbasiert: Trainingsprogramme für den Erhalt und die Stärkung der geistigen Leistungsfähigkeit sowie gegen Alzheimer und Demenz "bis ins hohe Alter" gehören zu den "cash cows" der Gesundheitswirtschaft. Wie bei vielen Produkten und Dienstleistungen auf dem besonders im Zeichen der alternden Babyboomer anwachsenden zweiten Gesundheitsmarkts wird der Eindruck erweckt bei den für die Gesundheit und die Lebensqualität positiven Wirkungen handle es sich um wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse.
Egal ob papiergebunden oder computerbasiert: Trainingsprogramme für den Erhalt und die Stärkung der geistigen Leistungsfähigkeit sowie gegen Alzheimer und Demenz "bis ins hohe Alter" gehören zu den "cash cows" der Gesundheitswirtschaft. Wie bei vielen Produkten und Dienstleistungen auf dem besonders im Zeichen der alternden Babyboomer anwachsenden zweiten Gesundheitsmarkts wird der Eindruck erweckt bei den für die Gesundheit und die Lebensqualität positiven Wirkungen handle es sich um wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse.
Doch daran, dass diese Programme das leisten was drauf steht, gibt es mittlerweile erhebliche Zweifel.
Aktuell am deutlichsten äußert dies eine am 21. Oktober 2014 veröffentlichte gemeinsame Erklärung von internationalen Kognitions- und Neurowissenschaftlern, die sich mit den Gehirnjogging-Produkten auf Einladung des Stanford Center on Longevity an der Stanford University und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin ausführlich beschäftigten.
Die Kernaussagen dieser Erklärung lauten folgendermaßen:
• Es ist nicht belegt, dass Gehirnjogging die allgemeine geistige Leistungsfähigkeit steigert.
• Werbung für Gehirnjogging-Spiele, die behauptet, Alzheimer- oder andere Demenzformen verhindern oder heilen zu können, ist wissenschaftlich unbegründet.
• Körperliches Training (aerobes Fitnesstraining) steigert die körperliche Gesundheit und wirkt nachweisbar positiv auf die Durchblutung des Gehirns und auf kognitive Leistungen.
• Weder in Einzelstudien noch summiert über viele Studien (d.h. in sogenannten Metaanalysen) gibt es klare Hinweise auf länger andauernde Leistungsverbesserungen in allgemeinen kognitiven Fähigkeiten mit Alltagsrelevanz.
Zum Schluss Ihrer Stellungnahme empfehlen die Wissenschaftler anstatt Gesundheit vorrangig zum Nutzen der Hersteller durch Gehirnjogging- und andere Produkte einkaufen und konsumieren zu wollen, "ein körperlich aktives, geistig herausforderndes und sozial anregendes Leben zu führen, und zwar in der Art, die zu einem passt." Und wie dies konkret aussehen könnte, fasst der anschließende Ratschlag so zusammen: "Bevor man Zeit und Geld in ein Gehirnjoggingprodukt steckt, sollte man an das denken, was in der Ökonomie als Opportunitätskosten bezeichnet wird: Wenn man eine Stunde damit verbringt, alleine am Computer Aufgaben zu trainieren, anstatt in der Zeit spazieren zu gehen, Italienisch zu lernen, ein neues Rezept auszuprobieren oder mit seinen Enkeln zu spielen, so könnte dies eine ungünstige Wahl sein. Aber wenn diese Stunde am Computer eine Stunde auf der Couch vor dem Fernseher ersetzt, so könnte es sich um eine gute Wahl handeln."
Die neunseitige Langfassung der Erklärung Gehirnjogging am Computer hält nicht, was es verspricht.Gemeinsame Erklärung von internationalen Kognitions- und Neurowissenschaftlern ist kostenlos erhältlich und enthält auch noch einige Verweise auf weiterführende wissenschaftliche Studien.
Bernard Braun, 9.11.14
Warum ein "guter" niedriger Blutdruck nicht immer anstrebenswert ist. Am Beispiel der geistigen Fitness von hochaltrigen Personen.
 Dies soll kein Plädoyer dafür sein, sich nicht um einen "zu hohen" Blutdruck zu kümmern. Ähnlich wie bereits beim Übergewicht oder Blutzucker, soll lediglich dem Eindruck entgegengewirkt werden, das Überschreiten bestimmter absoluter Werte bedeuteten zwangsläufig den eindeutigen Übergang von gesund zu krank und müsse immer und bei jedem Menschen mit allen geeigneten Mitteln verhindert bzw. rückgängig gemacht werden.
Dies soll kein Plädoyer dafür sein, sich nicht um einen "zu hohen" Blutdruck zu kümmern. Ähnlich wie bereits beim Übergewicht oder Blutzucker, soll lediglich dem Eindruck entgegengewirkt werden, das Überschreiten bestimmter absoluter Werte bedeuteten zwangsläufig den eindeutigen Übergang von gesund zu krank und müsse immer und bei jedem Menschen mit allen geeigneten Mitteln verhindert bzw. rückgängig gemacht werden.
Entgegen dieser Ansicht zeigen immer mehr Studien, dass dies nicht immer und zwangsläufig der Fall ist, und bestimmte als "krank" definierte Körperwerte sogar "gesunde" Effekte haben können. Beim eingangs erwähnten Übergewicht, war dies die mehrfach bestätigte Erkenntnis, dass ein so genannter Body-mass-Index-(BMI)-Wert zwischen 25 und 30 durchaus auch protektive bzw. "gesunderhaltende" Wirkungen bei der kardiologischen Morbidität haben kann.
"Zu hoher" Blutdruck (ein Wert, dessen absolutes Niveau sich dazu auch noch in regelmäßigen Abständen verändert), galt und gilt wegen der mit ihm assoziierten Arterienverkalkung als Risikofaktor für Herzinfarkt, Nierenversagen und Schlaganfall.
Eine Studie in den Niederlanden, die so genannte "Leiden 85-plus Study", kommt nun zu dem Ergebnis, dass ein hoher Blutdruck nicht immer und offensichtlich auch nicht für alle Seiten der gesundheitlichen Lebensqualität eines Menschen schlecht ist. Und dies gilt besonders für hochaltrige Menschen und deren geistige Fitness.
TeilnehmerInnen dieser Studie waren 560 Personen im Alter von 85 Jahren, bei denen fünf Jahre lang der Blutdruck, die geistige Fitness (mittels des Mini-Mental-Status-Tests) und die Leistungsfähigkeit ihres Herzens (über einen Eiweißmarker) gemessen wurden. Die Personen wurden in drei Gruppen mit einem niedrigen (unter 147 mmHg), normalen (147 bis 162 mmHG) und hohen (über 162 mmHg) systolischen Blutdruck aufgeteilt.
Die Ergebnisse lauteten im Detail so:
• Die TeilnehmerInnen mit dem niedrigsten Blutdruck schnitten bereits zu Beginn der Studie am schlechtesten bei der geistigen Fitness ab.
• Daran änderte sich im Studienzeitraum nichts, d.h. "Probanden mit einem niedrigeren Blutdruck bauten geistig schneller ab, als die mit einem höheren Blutdruck".
• Direkt unabhängig davon, wirkte sich auch eine Herzinsuffizienz negativ auf die kognitiven Leistungen aus.
• Personen mit einer schwachen Herzleistung und niedrigem Blutdruck hatten die schlechteste kognitive Leistung. Dies deutet darauf hin ("possibly"), dass das zentrale Problem die Herzinsuffizienz mit der Folge eines niedrigen Blutdrucks und einer schlechten Sauerstoffversorgung u.a. des Gehirns ist.
Auch wenn die AutorInnen sich nicht ausführlich mit den praktischen Konsequenzen befassen, folgt aus ihren Ergebnissen, dass niedrige Blutdruckwerte je nach Personenkreis und dessen Gesamt-Gesundheitszustand unterschiedlich beurteilt werden müssen und u.U. auch für die spezifische Lebensqualität bestimmter Personen gesund sein können.
Das Abstract der Studie NT-proBNP, blood pressure, and cognitive decline in the oldest old. The Leiden 85-plus Study. von P. van Vliet et al., am 20. August 2014 online in der Zeitschrift "Neurology" erschienen, ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.14
16% oder 0,3% - Relativ oder absolut und was folgt daraus für das Screening von Lungenkrebs?
 Auch in Deutschland hat sich vor allem durch die Arbeiten des Harding Center for risk literacy am Max-Planckinstitut für Bildungsforschung in Berlin und seines Direktors Gerd Gigerenzer bei immer mehr Menschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass bei den Effekten von Interventionen und den daraus gezogenen Schlüssen für diagnostische und therapeutische Angebote sorgsam auf die Werte für relative und absolute Risikoveränderungen geachtet bzw. zwischen ihnen unterschieden werden muss.
Auch in Deutschland hat sich vor allem durch die Arbeiten des Harding Center for risk literacy am Max-Planckinstitut für Bildungsforschung in Berlin und seines Direktors Gerd Gigerenzer bei immer mehr Menschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass bei den Effekten von Interventionen und den daraus gezogenen Schlüssen für diagnostische und therapeutische Angebote sorgsam auf die Werte für relative und absolute Risikoveränderungen geachtet bzw. zwischen ihnen unterschieden werden muss.
Dass es sich dabei aber keineswegs bereits um versorgungswissenschaftliches Allgemeingut handelt, zeigt z.B. die gerade in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" geführte Debatte daüber, ob Medicare- und Medicaid-Versicherten eine Screeninguntersuchung auf Lungenkrebs mit einer niedrig dosierten Computertomographie bezahlt werden sollte oder nicht. Für diese Entscheidung sind in den USA die "Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)" zuständig.
Ein erster Autor kam nach einer Analyse der Daten des "National Lung Screening Trial" für 53.454 Personen zwischen 55 und 74 Jahren zu dem Schluss, der Nutzen des Screenings sehr größer als die Risiken z.B. durch die immer noch vorhandene Strahlenbelastung. Es gäbe "a substantial improvement in lung cancer mortality among screened patients" und mögliche unerwünschte Folgen könnten durch einen kritischen Umgang mit der Untersuchung verhindert werden. Der Durchschnittswert der Sterblichkeitsreduktion von 16% verbirgt im Übrigen erhebliche Unterschiede zwischen Männen und Frauen. Die relative Reduktion betrug bei Frauen 27% und 8% bei Männern.
In einem zweiten Beitrag kommen seine AutorInnen bereits bei der Datenanalyse zu anderen, weil differenzierteren Ergebnissen. Die dem Screening zugeschriebene relative Reduktion der Sterblichkeit an Lungenkrebs von 16% könne man nur beurteilen, wenn man auch zur Kenntnis nähme, dass die absolute Reduktion des Risikos 0,3% betrage, die Anzahl der Gestorbenen also von 21 auf 18 Tote pro 1.000 Personen gesunken ist. Auf der anderen Seite dieser gar nicht mehr so blendenden Bilanz stehen außerdem 16 an den Folgen der Vielzahl diagnostischer Verfahren (z.B. in der Folge der 10.246 Tomogramm-Analysen, 671 Bronchoskopien, 322 perkutane Biopsien, 713 Operationen) gestorbenen Personen und 228 Komplikationen, von denen 86 groß waren.
Da es die AutorInnen sowohl für unklar halten "if routine screening would result in net good or net harm" als auch ein großes Potenzial an "false-positive results, patient anxiety, radiation exposure, numerous diagnostic workups, and the complications of these workups" sehen, raten sie trotz der auch sie beschäftigenden großen Anzahl von Lungenkrebskranken zur Zurückhaltung bei der Aufnahme des CT-Screenings in den Leistungskatalog der staatlichen Krankenversicherungen.
In ihrer Schlussbemerkung weisen sie schließlich noch auf eine andere möglicherweise unerwünschte Folge der Konzentration der Leistungspolitik auf ein CT-Screening hin: "In any event, enthusiasm for low-dose CT screening should not draw attention or resources away from the priority of tobacco control."
Dass dies nicht an den Haaren herbeigezogen ist, deutet schließlich auch noch eine Herausgebernotiz an: "The decision about low-dose CT is one of the most consequential and closely watched coverage determinations that CMS has had to make in many years. … As CMS deliberates, an intensive lobbying effort is under way to influence the decision, with support from industry and various professional and advocacy organizations. In June 2014, 45 US Senators and 134 House Representatives, from both political parties, separately wrote to CMS to advocate for low-dose CT scans."
Der erste Beitrag unter dem Titel The Importance of Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography for Medicare Beneficiaries von Douglas E. Wood ist online first am 13. Oktober 2014 in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der zweite Beitrag Low-Dose Computed Tomography Screening for Lung CancerHow Strong Is the Evidence? von Steven H. Woolf et al. ist ebenfalls online first in derselben Ausgabe erschienen, und auch von ihm gibt es frei zugänglich das Abstract.
Die Editor's Note Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography for Medicare Beneficiaries von Robert Steinbrook komplettiert das Bild in derselben Zeitschrift.
Bei dieser Gelegenheit sei auch erneut auf die Rubrik der "Unstatistik des Monats" auf der Website des Harding-Centers hingewiesen, wo es sehr oft um vorsätzlich oder aus Unwissen aufgebauschte und dramatisierende Gesundheitsstatistiken geht.
Bernard Braun, 19.10.14
Wenn Risiken und Belastungen den Nutzen überwiegen: Ernährungssonden für demente PatientInnen oft nicht in derem Interesse
 Es ist immer schwer, gesundheitsbezogene oder als gesundheitlich wirksam geltende Leistungen in Frage zu stellen oder sie nicht aktiv anzubieten. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um schwer kranke PatientInnen und den für sie mit einer Leistung erreichbaren Nutzen geht.
Es ist immer schwer, gesundheitsbezogene oder als gesundheitlich wirksam geltende Leistungen in Frage zu stellen oder sie nicht aktiv anzubieten. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um schwer kranke PatientInnen und den für sie mit einer Leistung erreichbaren Nutzen geht.
Eine dieser immer wieder erbrachten aber auch schon immer wieder bezweifelten Leistungen ist der Einsatz so genannter PEG-Sonden (perkutane endoskopische Gastrostomie) oder G-Tubes ("gastrostomy tube"), mit deren Hilfe PatientInnen z.B. durch die Bauchdecke mit Nahrungsmitteln und Flüssigkeit versorgt werden können.
In einer jetzt veröffentlichten Analyse der dazu vorhandenen wissenschaftlichen Literatur kommen die AutorInnen zu dem Schluss, dass PEG-Sonden PatientInnen mit fortgeschrittener Demenz oder anderen "near-end-of-life"-Erkrankungen nur sehr zurückhaltend angeboten und keinesfalls "aufgezwungen" werden sollten. Für diese Empfehlung ist eine offene Abwägung der durch die Sondenernährung erreichbaren Vorteile oder des Nutzens und möglicher Nachteile oder Schäden entscheidend.
Als Quintessenz ihrer Literatursichtung stellen sie also fest: "Current scientific evidence suggests that the potential benefits of tube feeding do not outweigh the associated burdens of treatment in persons with advanced dementia. Studies consistently demonstrate a very high mortality rate in older adults with advanced dementia who have feeding tubes."
Die Entscheidung gegen den Einsatz einer PEG-Sonde sollte aber, so die AutorInnen, nicht von einem behandelnden Arzt alleine getroffen werden, sondern nach einer gründlichen Information und Beratung des Patienten und der ihm nahestehenden Personen über den Nutzen, die Risiken und Belastungen von diesem Personenkreis und allen Mitgliedern des Behandlungsteams.
Die AutorInnen empfehlen darüber hinaus, dass Krankenhäuser und andere Versorgungsanbieter für "end-of-life"-Situationen nicht ausschließlich auf spontanes Vorgehen setzen, sondern Routinen entwickeln, wie patientenbezogene Entscheidungen für Schwerstkranke oder Sterbende unter größtmöglicher Berücksichtigung der Patientenwünsche nach Autonomie, Selbstbestimmung und Würde getroffen werden.
Der Aufsatz Gastrostomy Tube Placement in Patients With Advanced Dementia or Near End of Life. von Denise Baird Schwartz et al. ist in der Zeitschrift "Nutrition in Clinical Practice", dem offiziellen Journal der "American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)" online am 7. Oktober 2014 erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.10.14
Zur Vergabe von "health top-level domains": Wie sich vor .health bald in Wirklichkeit British-Tobacco oder MacDonald befinden kann
 Nachdem die e-, m-, aHealth-Wellen nahezu ungebremst und unreflektiert in die Smartphones und die Gesundheitswirklichkeit geschwappt sind, und demnächst manche Cloud die weltweit größte Sammlung gesundheitsrelevanter Daten sein könnte, gibt es gegen die geplante nächste Welle der Zukunft des "Health Internet" ernstzunehmende Warnungen und Einwände.
Nachdem die e-, m-, aHealth-Wellen nahezu ungebremst und unreflektiert in die Smartphones und die Gesundheitswirklichkeit geschwappt sind, und demnächst manche Cloud die weltweit größte Sammlung gesundheitsrelevanter Daten sein könnte, gibt es gegen die geplante nächste Welle der Zukunft des "Health Internet" ernstzunehmende Warnungen und Einwände.
Die Welle verbirgt sich hinter der Absicht der für die Vergabe und Verwaltung von Internet-Domain-Namen zuständigen "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN), so genannte "health top-level domain" oder "generic top-level domain names" ("gTLDs") mit den kompetenzsuggerierenden Endungen "health" oder "doctor" an jeden interessierten Kunden per Auktion zu vergeben.
Damit, so eine Gruppe internationaler ExpertInnen, würden die Türen für den Erwerb folgender Websites mit entsprechenden Angeboten aufgemacht: "http://www.[smoking].[health] (potentially purchased by a tobacco company), http://www.[vaccinatekids].[health] (potentially purchased by anti-vaccine activists), http://www.[obesity].[health] (potentially purchased by a junk food company), http://www.[cancer].[doctor] (potentially purchased by unscrupulous vendors catering to the desperate dying)". Wer sich z.B. an die jahrzehntelangen vorsätzlichen Versuche der Tabakindustrie erinnert, mit allen legalen und illegalen Methoden die gesundheitlichen Gefahren ihrer Produkte zu verheimlichen und die Öffentlichkeit zugunsten ihrer Profitinteressen zu desinformieren, muss wissen, dass die Warnung vor anbietereigenen "health"-Websites nichts mit Unkenrufen oder Fortschrittsfeindlichkeit zu tun hat.
Die Autoren sind sich mit verschiedenen internationalen Gesundheits- und Public Health-Institutionen (z.B. der WHO) sowie den unabhängigen Teilen der Internet-Community in der Notwendigkeit einig, vor allen Geschäftsinteressen die "future integrity and proper governance of this important namespace fort he Health Internet" zu sichern. Wie dringend solche Forderungen sind, zeigen die Autoren daran, dass die ICANN ausgerechnet die industriefreundliche oder -eigene "International Chamber of Commerce" (ICC) beauftragt hat, die Einsprüche zu prüfen. Erwartungsgemäß lehnte die ICC dann die Einsprüche ab.
Angesichts der offensichtlich noch für September geplanten Versteigerung der "health"- und anderer gesundheitsbezogenen Domains und den Schachzügen der ICANN, fordern die Autoren zumindest ein unverzügliches Moratorium, in dessen Laufzeit eine öffentliche Debatte über ein unabhängiges, nutzerorientiertes und vertrauenswürdiges Internetangebot in diesem häufig existentiellen Angebotssektor stattfinden kann.
Das Ganze wirft aber auch die in diesem Forum bereits mehrfach gestellte Frage auf, ob es nicht im gesellschaftlichen Interesse ist, die öffentlichkeitswirksame Nutzung der Etiketten "Gesundheit", "gesund", "health", "Gesundheitswirtschaft" etc. nur nach einer unabhängigen Überprüfung zu ermöglichen in der die Nutzer nachweisen müssen, dass der sich darunter steckende Inhalt, d.h. das Produkt, die Dienstleistung oder die Informationen tatsächlich "gesund" ist. Dass dies rechtlich-normativ gar nicht so neu oder radikal ist, zeigt die für alle Mitgliedsländer unmittelbar geltende so genannte "Health Claims"-Verordnung der EU und die entsprechende nationale Rechtsprechung u.a. in Deutschland. Welcher Geist hier bereits gerichtsfest weht, zeigt z.B. die Begründung des gleich zitierten gerichtlichen Verbots der Werbung mit den gesundheitlichen Wirkungen eines Produkts, die der Hersteller nicht nachgewiesen hat bzw. nachweisen konnte: "Wird in einer Werbung auf die Gesundheit Bezug genommen, sind besonders strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Aussage zu stellen (BGH, Urteil vom 03.05.2001 - I ZR 318/98). Wegen der nach allgemeiner Auffassung der menschlichen Gesundheit zukommenden besonderen Bedeutung können Erzeugnisse, die zu ihrer Erhaltung oder Förderung beitragen, erfahrungsgemäß mit einer gesteigerten Wertschätzung rechnen, so dass sich eine an die Gesundheit anknüpfende Werbemaßnahme als besonders wirksam erweist. Dabei ist die Gesundheit als ein über das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen hinausgehender Zustand vollständigen körperlich, geistigen Wohlergehens zu verstehen. 2. Stellt eine Werbung einen gesundheitsbezogenen Zusammenhang zwischen dem beworbenen Produkt (hier: Fitness-Sandalen) und der Gesundheit der Anwender her, müssen die insoweit in der Werbung behaupteten gesundheitsfördernden Wirkungen des beworbenen Produkts von dem Werbenden hinreichend wissenschaftlich belegt werden, damit die Werbung nicht zur Täuschung des Verbrauchers geeignet und deshalb irreführend ist. 3. Eine Werbeaussage über die gesundheitsfördernde Wirkung eines Produkts verbietet sich, wenn der Werbende die wissenschaftliche Absicherung der gesundheitsfördernde Wirkung nicht dartun kann oder die Aussage wissenschaftlich umstritten ist und damit jeder Grundlage entbehrt (BGH, Urteil vom 07.12.2000 - I ZR 260/98 - Eusovit; BGH, Urteil vom 07.03.1991 - I ZR 127/89 - Rheumalind)." (OLG Koblenz, Urteil vom 10.01.2013 - 9 U 922/12)
Dass die Hersteller und Anbieter der von allen Seiten als "Jobmotor" gepriesenen Gesundheitswirtschaft ihre Angebote keineswegs von sich aus an diesen Normen orientieren, zeigen die zahllosen Gerichtsurteile, die es mittlerweile allein in Deutschland zur Unzulässigkeit von "Gesundheits"-Aussagen gibt. Allein mit der Kopie der Kurzdarstellungen zahlreicher solcher Urteile auf der Website der Rechtsanwälte Burchert & Partner kann man mehrere hundert Seiten füllen - ohne dass es sich dabei um alle Urteile zu Verstößen gegen die EU-Verordnung handeln dürfte.
Der Aufsatz A call for a moratorium on the .health generic top-level domain: preventing the commercialization and exclusive control of online health information. von Tim K Mackey, Gunther Eysenbach, Bryan A Liang, Jillian C Kohler, Antoine Geissbuhler und Amir Attaran ist am 25. September 2014 in der Zeitschrift "Globalization and Health" (10 (1): 62) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.9.14
Wie "fest" ist ein Festbetrag und wo liegen die Grenzen des Service-Outsourcens gesetzlicher Krankenkassen und Rentenversicherer?
 Wer denkt, und "wer" sind durchaus auch Leistungsabteilungen gesetzlicher Krankenkassen, ein Festbetrag schließe absolut höhere Beträge aus bzw. erlaube es, sie komplett auf den versicherten Patienten abzuwälzen, kann sich täuschen und trägt dazu durch eigene Vernachlässigung gesetzlicher Pflichten auch noch selber bei.
Wer denkt, und "wer" sind durchaus auch Leistungsabteilungen gesetzlicher Krankenkassen, ein Festbetrag schließe absolut höhere Beträge aus bzw. erlaube es, sie komplett auf den versicherten Patienten abzuwälzen, kann sich täuschen und trägt dazu durch eigene Vernachlässigung gesetzlicher Pflichten auch noch selber bei.
Diese Position vertritt das Hessische Landessozialgericht (LSG) in einem Ende Juli 2014 gefällten letztinstanzlichen Urteil zur speziellen Hörgeräteversorgung eines schwerst hörbehinderten Menschen mit bemerkenswerten Argumenten zur Priorität des gesundheitlichen Bedarfs von Patienten und gegen systematische Servicemängel im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen.
Streitgegenstand war, dass eine bei einer GKV-Kasse versicherte Person nach Kontakt mit einem HNO-Arzt und einem Hörgeräteakustiker ein Hörgerät erhielt, das rund 4.900 Euro kostete. Die Kasse weigerte sich unter Verweis auf den damaligen Festbetrag von 1.200 Euro, ihrem Versicherten den Differenzbetrag von rund 3.700 Euro zu erstatten.
Die entsprechende Klage des Versicherten wies das Sozialgericht in erster Instanz ab. Das LSG gab ihm dagegen Recht und begründete dies u.a. folgendermaßen:
• Zunächst räumt das LSG ein, dass die GKV-Kassen das Recht oder sogar die Pflicht haben, die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu prüfen: "Ausgeschlossen sind danach Ansprüche auf teure Hilfsmittel, wenn eine kostengünstigere Versorgung für den angestrebten Nachteilsausgleich funktionell ebenfalls geeignet ist; Mehrkosten sind andernfalls selbst zu tragen (§ 33 Abs. 1 Satz 5 SGB V)." Dabei muss sich aber die Krankenkasse, so das LSG weiter, am gesundheitlichen Bedarf des bei ihr versicherten Patienten orientieren: "Eingeschlossen in den Versorgungsauftrag der GKV ist eine kostenaufwändige Versorgung dagegen dann, wenn durch sie eine Verbesserung bedingt ist, die einen wesentlichen Gebrauchsvorteil gegenüber einer kostengünstigeren Alternative bietet. Das gilt bei Hilfsmitteln zum unmittelbaren Behinderungsausgleich für grundsätzlich jede Innovation, die dem Versicherten nach ärztlicher Einschätzung in seinem Alltagsleben deutliche Gebrauchsvorteile bietet." Dies sah das Gericht bei dem Kläger als gesichert an.
• "Soweit die Krankenkasse aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Sachleistung "Versorgung mit Hörhilfen" (§ 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V) auf der Grundlage einer Festbetragsregelung (§ 36 SGB V) zu erbringen hat, also unter Zuzahlungspflicht des Versicherten hinsichtlich des den Festbetrag übersteigenden Teils des Kaufpreises, erfüllt sie zwar im Regelfall ihre Leistungspflicht mit dem Festbetrag (§ 12 Abs. 2 SGB V). Dies ist grundsätzlich verfassungsgemäß, gilt jedoch in dieser Form nur, wenn eine sachgerechte Versorgung des Versicherten zu den festgesetzten Festbeträgen möglich ist. Der für ein Hilfsmittel festgesetzte Festbetrag begrenzt die Leistungspflicht der Krankenkasse nämlich dann nicht, wenn er für den Ausgleich der konkret vorliegenden Behinderung objektiv nicht ausreicht".
• Und schließlich weist das LSG zugunsten des Versicherten auf eine offensichtlich vorsätzliche Praxis fehlender Beratung in diesem Bereich der Hilfsmittelversorgung hin: "Den Grad der Schwerhörigkeit und die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Funktionen der zum Behinderungsausgleich benötigten Hörgeräte hat die Beklagte indessen im Verwaltungsverfahren keiner eigenständigen Prüfung und Feststellung zugeführt. Sie hat weder durch die Heranziehung eigener fachkundiger Stellen und oder von Sachverständigen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) abklären lassen, welche Hörhilfen der Kläger benötigt. Dies ist bislang keine bloße fehlerhafte Vorgehensweise in einem Einzelfall, sondern durchgängige Praxis. Obwohl eine erhebliche Zahl von Versicherten vergleichbar nachhaltig im Hörvermögen beeinträchtigt ist wie der Kläger, halten die Krankenkassen und auch die weiter als Rehabilitationsträger in Betracht kommenden Rentenversicherungsträger bislang nicht die erforderlichen Beratungs- und Begutachtungsstrukturen vor, um eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Ermittlung des Versorgungs- und Rehabilitationsbedarfes zu ermöglichen. Die Sozialleistungsträger bieten den hörgeschädigten Versicherten keinen Zugang zu unabhängigen Beratungs- und Begutachtungsstellen, die losgelöst von eigenen Gewinnerwartungen eine neutrale Untersuchung und Beratung - was eine ausgiebige Erprobung und Anpassung der in Betracht kommenden Hörgeräte beinhalten müsste - über die (unter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit im vorstehend erläuterten Sinne) bestmögliche Hörgeräteversorgung gewährleisten … . Das Bundessozialgericht hat sich im Zusammenhang mit der Hilfsmittelversorgung bei hörgeschädigten Versicherten zu der Feststellung veranlasst gesehen, dass sich die zuständigen Rehabilitationsträger ihrer leistungsrechtlichen Verantwortung durch sog. "Verträge zur Komplettversorgung" jedenfalls vielfach nahezu vollständig entziehen und dem Leistungserbringer quasi die Entscheidung darüber überlassen, ob dem Versicherten eine Teilhabeleistung (wenn auch unmittelbar zunächst nur zum Festbetrag) zu Teil wird. Es hat hervorgehoben, dass die betroffenen Träger damit weder ihrer Pflicht zur ordnungsgemäßen Einzelfallprüfung nach § 33 SGB V genügen noch die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachten (§ 12 Abs. 1 und § 70 Abs. 1 S. 2 SGB V; vgl. BSG, Urteil vom 24. Januar 2013, a.a.O., vgl. auch den dortigen Hinweis: Es mute zudem "abenteuerlich" an, dass die Rehabilitationsträger die Versorgung mit bestimmten Hilfsmitteln - hier: Hörgeräte - praktisch nicht mehr selbst vornehmen, sondern in die Hände der Leistungserbringer "outgesourced" haben). Ein entsprechendes "Outsourcing" hat für Fallgestaltungen der vorliegenden Art überdies zur Folge, dass sich die Versicherten mangels eigener Beratungs- und Untersuchungsstellen der Sozialleistungsträger zur bestmöglichen Hörgeräteversorgung auch bezüglich der Frage, inwieweit sich mit höherwertigen als den sog. Festbetragsgeräten greifbare bessere Hörerfolge erzielen lassen, in weiten Teilen auf das fachkundige (wenn auch nicht immer von vornherein uneigennützige) Urteil des beratenden Hörgeräteakustikers verlassen müssen."
• "Der Umstand, dass die Krankenkassen und andere Sozialleistungsträger entgegen § 4 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) systematisch und somit letztlich im Rahmen eines sog. Systemversagens keine eigenständige Untersuchung und Beratung der Versicherten bei der Hörgeräteauswahl mit dem Ziel eines weitest möglichen Behinderungsausgleichs anbieten, kann die Gerichte nicht von ihrer Verpflichtung entbinden, eine effektive Durchsetzung der Hilfsmittelansprüche der Versicherten zu bewirken. Mit der Beauftragung der gewerblichen Hörgeräteakustiker haben insbesondere die Krankenkassen im Ergebnis zum Ausdruck gebracht, dass sie diesen die erforderliche Fachkunde und Beurteilungskompetenz in den Fragen der Hörgeräteversorgung zuerkennen und die Erwartung für berechtigt erachten, dass die Qualität der Beratung durch die Hörgeräteakustiker nicht durch eigenwirtschaftliche Interessen der herangezogenen Akustikerbetriebe ernsthaft beeinträchtigt wird. Die Krankenkassen haben sich somit von der Erwartung leiten lassen, die Heranziehung der gewerblichen Hörgeräteakustiker werde jedenfalls im Regelfall zu einer im Rahmen der sog. Festbetragsgeräte optimierten Versorgung führen. An dieser eigenen Einschätzung müssen sich die Krankenkassen und auch an ihrer Stelle nach § 14 SGB IX zuständige andere Leistungsträger festhalten lassen, soweit sie nicht im jeweiligen Einzelfall anderweitig verlässliche Feststellungen hinsichtlich des Rehabilitationsbedarfs gewährleisten."
• "Gründe für die Zulassung der Revision (§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor."
Angesichts dieses fast nicht mehr steigerbaren richterlichen Levitenlesens wird es spannend sein, ob, wie und wann sich die Kranken- und Rentenversicherungsträger damit auseinandersetzen und evtl. praktische Änderungen vornehmen.
Wer sich noch genauer für die zum Teil im obenstehenden Text gekürzten gesetzlichen Bestimmungen und Urteile interessiert, die für die Entscheidung des LSG maßgeblich waren, kann sich das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 04.09.14 - Az L 8 KR 352/11 komplett kostenlos durchlesen.
Bernard Braun, 20.9.14
Henne oder Ei? Ist Sprachenlernen Hirn-Jogging gegen Demenz oder lernen Leute mit "fittem" Hirn mehr und besser Sprachen?
 Auf der Suche nach nichtmedizinischen Möglichkeiten sich bis in das höhere Lebensalter geistig fit zu halten, wird immer wieder das Lernen von Fremdsprachen genannt. Trotz zahlreicher bestätigender Hinweise aus Beobachtungsstudien konnte bisher nicht geklärt werden, welche Wirkrichtung hinter dieser Beobachtung steckt.
Auf der Suche nach nichtmedizinischen Möglichkeiten sich bis in das höhere Lebensalter geistig fit zu halten, wird immer wieder das Lernen von Fremdsprachen genannt. Trotz zahlreicher bestätigender Hinweise aus Beobachtungsstudien konnte bisher nicht geklärt werden, welche Wirkrichtung hinter dieser Beobachtung steckt.
Britische Forscher liefern mit den am 2. Juni 2014 in der Fachzeitschrift "Annals of Neurology" veröffentlichten Ergebnissen einer Längsschnittstudie schlüssige Belege für die positiven Wirkungen von Bilingualismus auf das kognitive Altern.
Dazu absolvierte eine Gruppe von 853 im Jahr 1936 geborenen TeilnehmerInnen im Alter von 11 Jahren, also 1947, einen Intelligenztest. Alle TeilnehmerInnen hatten Englisch als Muttersprache. Dieser Test wurde zwischen 2008 und 2010 mit den dann rund 70 Jahre alten Personen wiederholt. 262 von ihnen sprachen mindestens eine Fremdsprache, die sie entweder in der Schule oder im späteren Alter gelernt hatten.
Das Ergebnis war eindeutig: Unabhängig von der Anfangsintelligenz und auch vom Zeitpunkt des Sprachelernens (Quintessenz: Es ist nie zu spät!!) hatten die Personen mit mindestens einer Fremdsprache im hohen Alter bessere kognitive Fähigkeiten. Die stärksten protektiven Wirkungen traten bei der allgemeinen Intelligenz und beim Lesen auf. Kontrolliert wurde auch der mögliche Einfluss anderer Faktoren. Die Wirkungen können nicht durch das Geschlecht, den sozioökonomischen Status oder durch Immigrationsaspekte erklärt werden. Das positive Bild wird dadurch abgerundet, dass die Forscher keine negativen Wirkungen von Bilingualismus fanden.
Angesichts der Erkenntnis über die positive Wirkung des Erwerbs, der Kenntnis und Nutzung von Fremdsprachen auf die geistige Fitness, geben wir die zentralen Erkenntnisse der Studie nochmals in präventiver Absicht in der Originalsprache wieder: "Our results suggest a protective effect of bilingualism against age-related cognitive decline independently of CI (child intelligence). The effects are not explained by other variables, such as gender, socioeconomic status, or immigration. Importantly, we detected no negative effects of bilingualism. The cognitive effects of bilingualism showed a consistent pattern, affecting reading, verbal fluency, and general intelligence to a higher degree than memory, reasoning, and speed of processing."
Die Studie Does Bilingualism Influence Cognitive Aging? von Bak T. H. et al. ist in der Zeitschrift "Annals of Neurology" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.6.14
Beschneidung von männlichen Kindern mit oder ohne ihre Beteiligung - wenn überhaupt, wann und mit welchem gesundheitlichen Risiko?
 Einer der häufigsten operativen Eingriffe bei männlichen Kindern und Jugendlichen (in medizinischen Einrichtungen der USA jährlich rund 1,4 Millionen Fälle) ist die Entfernung der Vorhaut bzw. die Beschneidung. Sie geschieht überwiegend aus religiösen oder kulturellen Gründen und seltener wegen einer krankhaften, d.h. medizinisch behandlungsbedürftigen Verengung der Vorhaut oder Phimose. In regelmäßigen Abständen, in Deutschland vor zwei Jahren, gibt es Diskussionen darüber, ob es sich bei der religiös oder kulturell motivierten Beschneidung nicht um die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit der oft sehr jungen Kinder handelt, die sich dazu noch komplett über deren Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte hinwegsetzt bzw. mangels Fähigkeit kleiner Kinder hinwegsetzen muss. Da so etwas wie eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit Babys oder sehr jungen Kindern nur sehr schlecht stattfinden kann, gab es immer wieder Forderungen, den Zeitpunkt der Entscheidung pro oder contra Beschneidung ins höhere Kindes- oder Jugendlichenalter zu verschieben.
Einer der häufigsten operativen Eingriffe bei männlichen Kindern und Jugendlichen (in medizinischen Einrichtungen der USA jährlich rund 1,4 Millionen Fälle) ist die Entfernung der Vorhaut bzw. die Beschneidung. Sie geschieht überwiegend aus religiösen oder kulturellen Gründen und seltener wegen einer krankhaften, d.h. medizinisch behandlungsbedürftigen Verengung der Vorhaut oder Phimose. In regelmäßigen Abständen, in Deutschland vor zwei Jahren, gibt es Diskussionen darüber, ob es sich bei der religiös oder kulturell motivierten Beschneidung nicht um die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit der oft sehr jungen Kinder handelt, die sich dazu noch komplett über deren Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte hinwegsetzt bzw. mangels Fähigkeit kleiner Kinder hinwegsetzen muss. Da so etwas wie eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit Babys oder sehr jungen Kindern nur sehr schlecht stattfinden kann, gab es immer wieder Forderungen, den Zeitpunkt der Entscheidung pro oder contra Beschneidung ins höhere Kindes- oder Jugendlichenalter zu verschieben.
Unabhängig von den dagegen wiederum erhobenen religiösen Einwänden, stellt sich die gesundheitliche Frage, ob es einen Zusammenhang von unerwünschten Nebenwirkungen und Lebensalter zum Zeitpunkt der Beschneidung gibt.
Die am 12. Mai 2014 in der Fachzeitschrift "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Ergebnisse einer Analyse der Routinedaten über unerwünschte Ereignisse und Folgen bei der Beschneidung von 1.400.920 us-amerikanischen männlichen Kindern, lauten so:
• Die Inzidenz aller 41 möglichen unerwünschten Effekte betrug 0,5%.
• Sie stieg im Vergleich mit den unter einem Jahr alten männlichen Kindern bei den 1 bis 9-Jährigen auf das Zwanzigfache und bei den 10 Jahre alten und älteren Jungs und jungen Männer auf das Zehnfache dieses Werts.
• Die Rate potenziell ernsthafter Nebenwirkungen reichte von 0,76 Ereignissen pro einer Million Beschneidungen bis zu 703,23 Ereignissen pro eine Million Beschneidungen, wenn eine nicht vollständige Beschneidung nachbehandelt werden musste.
Auch wenn damit eine größere Transparenz existiert, ähnelt die besser informierte Entscheidung einer zwischen Scylla und Charybdis bzw. zwischen dem Gebot, die Operierten an Entscheidungen zu beteiligen und dem mit steigendem Lebensalter ebenfalls steigenden Risiko von unerwünschten Behandlungsfolgen.
Von dem am 12. Mai 2014 "online first" in der Zeitschrift "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Aufsatz Rates of Adverse Events Associated With Male Circumcision in US Medical Settings, 2001 to 2010 von Charbel El Bcheraoui et al. gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 17.5.14
Arzt/Pflegekräfte-Teams sind für die meisten geriatrischen Patienten besser als Ärzte allein: Wann werden wir es jemals lernen?
 Die seit einiger Zeit durch den Gesetzgeber und den Gemeinsamen Bundesausschuss auch in Deutschland geschaffenen normativen Grundlagen für eine teamorientierte, Delegation und Substitution umfassende Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe zwischen Ärzten und Pflegekräften kommt nur langsam gegen die traditionellen standespolitischen Widerstände und Vorurteile voran. In anderen Ländern gibt es dafür immer mehr Belege für den gesundheitlichen Nutzen einer solchen systematischen multiprofessionellen Teamorientierung und damit auch den Nutzen für das Selbstbewusstsein oder die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Ärzte und Pflegekräfte.
Die seit einiger Zeit durch den Gesetzgeber und den Gemeinsamen Bundesausschuss auch in Deutschland geschaffenen normativen Grundlagen für eine teamorientierte, Delegation und Substitution umfassende Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe zwischen Ärzten und Pflegekräften kommt nur langsam gegen die traditionellen standespolitischen Widerstände und Vorurteile voran. In anderen Ländern gibt es dafür immer mehr Belege für den gesundheitlichen Nutzen einer solchen systematischen multiprofessionellen Teamorientierung und damit auch den Nutzen für das Selbstbewusstsein oder die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Ärzte und Pflegekräfte.
Jüngstes Beispiel ist eine vergleichende Untersuchung aus den USA, ob und wie 658 bzw. 485 (von insgesamt 1.084 TeilnehmerInnen) an mehreren chronischen Krankheiten leidende Personen im Alter von 75 Jahren und älter durch ambulante Allgemeinärzte allein oder durch ein Team aus solchen Ärzten und aus so genannten "primary care physician-nurse practitioner", also speziell ausgebildeten Pflegekräften, die für sie in Leitlinien empfohlene Behandlung erhielten. Nach der zufälligen Verteilung der geriatrischen Patienten auf die beiden Gruppen waren 49% in der Komanagement-Gruppe. Die Qualität wurde mittels sieben standardisierter Qualitätsindikatoren gemessen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Insgesamt erhielten 57% die empfohlene Behandlung,
• Von den Patienten, die an Sturzfolgen litten, erhielten in der Komanagement-Gruppe (KG) 80% die empfohlene Behandlung, in der Arzt-Gruppe (AG) 34%,
• Von den Patienten mit einer Urin-Inkontinenz erhielten in der KM 66% und in der AG 19% die für sie beste Behandlung,
• Bei Patienten mit Demenz erhielten 59% in der KG und 38% in der AG die empfohlene Behandlung und
• Patienten mit einer Depression erhielten in der KG zu 63% und in der AG zu 60% die empfohlene Behandlung.
Diese Behandlungsvorteile für die geriatrischen Patienten in der KG blieben auch nach einer Adjustierung nach Alter, Geschlecht, Anzahl der Krankheiten etc. signifikant erhalten.
Der Aufsatz Effect of nurse practitioner comanagement on the care of geriatric conditions von Reuben DB et al. ist im Juni 2013 in der Fachzeitschrift "Journal of the American Geriatrics Society" (61(6): 857-67) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Dass aber auch in den USA trotz solcher Ergebnisse keineswegs die große Umorientierung in Richtung gemischtprofessionelle Teams und Komanagement stattfindet, zeigt ein Kommentar zu dem Aufsatz mit dem an einen Song von Pete Seeger anknüpfenden Titel When Will We Ever Learn the Benefits of Teams? von Barbara Resnick in derselben Ausgabe der Fachzeitschrift (1019-1021). Zu ihm gibt es leider weder ein kostenloses Abstract noch einen freien Zugang.
Bernard Braun, 15.12.13
Werbung zu Arzneimitteln und Medizinprodukten ohne Wirkungsnachweis ist als irreführend verboten. Das Beispiel Kinesio-Tape.
 Gerichte werden immer häufiger zu Wächtern bzw. Sachwaltern der Interessen der Bevölkerung an gesundheitlich nützlichen und wirksamen Gütern und Dienstleistungen. Dies ist einerseits zu begrüßen, andererseits aber wegen des dafür notwendigen aber aufwändigen und von vielen gescheuten Klageverfahrens gegen Hersteller oder z.B. ärztliche Anbieter nicht unproblematisch. Zu wünschen wäre, dass vorhandene staatliche Behörden nach geltendem Recht beim Marktzugang oder -auftritt solcher Produkte aktiv werden und den bisher mit relativ geringen und nicht immer unabhängig erbrachten Nachweispflichten von erwünschten und unerwünschten Wirkungen versehenen Marktzugang erschweren oder wenigstens die werbewirksame Etikettierung als "gesund" untersagen.
Gerichte werden immer häufiger zu Wächtern bzw. Sachwaltern der Interessen der Bevölkerung an gesundheitlich nützlichen und wirksamen Gütern und Dienstleistungen. Dies ist einerseits zu begrüßen, andererseits aber wegen des dafür notwendigen aber aufwändigen und von vielen gescheuten Klageverfahrens gegen Hersteller oder z.B. ärztliche Anbieter nicht unproblematisch. Zu wünschen wäre, dass vorhandene staatliche Behörden nach geltendem Recht beim Marktzugang oder -auftritt solcher Produkte aktiv werden und den bisher mit relativ geringen und nicht immer unabhängig erbrachten Nachweispflichten von erwünschten und unerwünschten Wirkungen versehenen Marktzugang erschweren oder wenigstens die werbewirksame Etikettierung als "gesund" untersagen.
Das jüngste, auf der Basis des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und des Heilmittelwerbegesetzes gefällte Urteil des Landgerichts Ulm zeigt aber, dass es eine Reihe bereits existierender Gesetze gibt, welche es verhindern helfen können, dass gesundheitlich unsinnige oder problematische, aber in jedem Fall umsatzgarantierende Angebote der Gesundheitswirtschaft mit der Wertschätzung für "gesunde" Güter und Leistungen werben bzw. versprechen, die Hoffnungen von kranken Menschen auf Heilung oder Linderung zu erfüllen.
Es geht hier um das so genannte Kinesio-Taping. Die von einem japanischen Chiropraktiker erfundenen bunten Bänder sollen nach Meinung ihrer Hersteller, der sie oft plakativ tragenden Sportler und auch von Ärzten Sportlern wie Nichtsportlern akut gegen Verspannungen und Verletzungen helfen und ferner durch eine bessere Durchblutung und Muskellockerung vorbeugend wirken sollen. Mit diesen Effekten warb eine Ärztin, die ihre PatientInnen auch mit dieser Art von Bandage behandelte, umfänglich auf ihrer Praxis-Website. Dagegen klagte ein "Verband sozialer Wettbewerb" mit dem Argument, es handle sich hierbei um unlauteren Wettbewerb und einen Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz.
In dessen Paragraph 3 ist "irreführende Werbung" für Arzneimittel, Medizinprodukte und einer Reihe weiterer gesundheitsbezogener Produkte und Leistungen verboten. Irreführend ist dabei "insbesondere", wenn Arzneimitteln, Medizinprodukten, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln eine therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die sie nicht haben, wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, daß ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann, bei bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen Wirkungen eintreten" oder "die Werbung nicht zu Zwecken des Wettbewerbs veranstaltet wird."
Das für die Klage zuständige Landgericht Ulm machte es sich nicht einfach und zog für seine Bewertung der von der Beklagten veröffentlichten werbenden Aussagen und sein Urteil die wissenschaftlichen Erkenntnisse heran, die sich eigentlich bereits der Hersteller oder spätestens die hierfür ja ausgebildete Ärztin statt Werbeprospekte und Fußballer-Statements hätten anschauen können und müssen.
Die einzige methodisch hochwertige Studie, eine so genannte Metaanalyse aus dem Jahr 2012 kommt zu dem für solche Analysen selten eindeutigen Schluss, dass "von 97 Beiträgen...gerade einmal 10 die Einschlusskriterien (der Artikel musste Daten über die Wirkung des Kinesio-Tapings zur Verfügung stellen, und zwar im Hinblick auf Resultate, die die Muskeln und das Skelett betreffen; ferner musste die Arbeit eine Kontrollgruppe haben). Von diesen 10 Publikationen prüften nur 2 Studien sportbezogene Verletzungen. Davon involvierte lediglich eine Studie verletzte Athleten. Die eingeschlossenen Studien enthielten aber z.T. Ergebisse zur möglichen Prävention von Sportverletzungen. Die Wirksamkeit des Kinesio-Tapings in Bezug auf Schmerzerleichterung war belanglos: Es gab keine klinisch relevanten Ergebnisse. Fazit der Metaanalyse war, dass lediglich eine qualitative Evidenz von geringer Bedeutung vorlag, die den Nutzen des Kinesio-Tapings gegenüber anderen Arten des Tapings bei Handhabung und Prävention von Sportverletzungen untermauern konnte" - so ein das Urteil kommentierender Fachanwalt.
Das Gericht sah dies genauso, unterstrich die gerade für gesundheitsbezogene Aussagen und Angebote zentrale Bedeutung eines wissenschaftlich erbrachten positiven Nutzen-/Wirkungsnachweises, bewertete die Werbung der Ärztin als "Vorsprung durch Rechtsbruch" und verbot ihr unter Androhung eines Bussgelds bei Zuwiderhandlung im Detail 36 inhaltlich werbende Aussagen als irreführend und damit im Prinzip ihren gesamten Kinesio-Werbeauftritt.
Das gesamte Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Ulm mit dem Aktenzeichen 10 O 35/13 KfH ist leider nicht kostenlos zugänglich. Ob dies bei einem Urteil eines öffentlichen Gerichts zu einem Gegenstand öffentlichen Interesses in Zeiten des Internets gerechtfertigt ist, ist fragwürdig - vor allem wenn an einem "steuerfinanzierten" Urteil dann private Anbieter wie Jurion oder Beck-Online verdienen.
Zumindest an den Tenor und die Liste der als Irreführung untersagten 36 werbenden Aussagen kommt man dann aber trotzdem kostenlos heran. Weiteres Interesse am Urteil kostet dann aber z.B. 39,99 Euro monatlich für ein entsprechendes Urteils-Abo.
Die 2012 veröffentlichte Metaanalyse Kinesio taping in treatment and prevention of sport injuries: a meta-analysis of the evidence for its effectiveness von Sean Williams et al. ist in der Fachzeitschrift "Sports Medicine" (42: 153-164) erschienen. Von diesem Aufsatz ist das Abstract kostenlos zugänglich.
Von dem ausführlichen juristischen Kommentar Gesetzliche Anforderungen an ärztliche Werbung des Wettbewerbsrechtler T. Oehler, erschienen in der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift" (2013. 138(45): 2322-2324), ist ebenfalls das Abstract kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.13
Hauptsache Test, auch wenn für denTest auf Gebärmutterhalskrebs die Gebärmutter fehlt oder die Frau gesund und älter als 65 ist.
 Ein häufig verwendeter Test zur Früherkennung einer Krebserkrankung des Gebärmutterhalses ist der so genannte Papanicolaou-Abstrichtest. Bereits seit 2003 veröffentlichten us-amerikanische medizinische Fachgesellschaften evidenzbasierte Empfehlungen gegen eine drohende Überversorgung. So wird empfohlen, den Test nicht bei Frauen durchzuführen, die wegen einer Totalentfernung der Gebärmutter auch keinen Gebärmutterhals mehr haben und die keine Krebs-Vorerkrankungsgeschichte haben. Und auch für Frauen über 65 Jahre ohne spezifische Vorerkrankung, deren bisherigen Papanicolaou-Tests normal waren und die auch sonst kein erkennbar hohes Erkrankungsrisiko haben, wird der Verzicht auf diesen Test empfohlen.
Ein häufig verwendeter Test zur Früherkennung einer Krebserkrankung des Gebärmutterhalses ist der so genannte Papanicolaou-Abstrichtest. Bereits seit 2003 veröffentlichten us-amerikanische medizinische Fachgesellschaften evidenzbasierte Empfehlungen gegen eine drohende Überversorgung. So wird empfohlen, den Test nicht bei Frauen durchzuführen, die wegen einer Totalentfernung der Gebärmutter auch keinen Gebärmutterhals mehr haben und die keine Krebs-Vorerkrankungsgeschichte haben. Und auch für Frauen über 65 Jahre ohne spezifische Vorerkrankung, deren bisherigen Papanicolaou-Tests normal waren und die auch sonst kein erkennbar hohes Erkrankungsrisiko haben, wird der Verzicht auf diesen Test empfohlen.
In dem für die US-Bevölkerung repräsentativen und mehrfach validierten "National Health Interview Survey (NHIS)" wurde im Jahr 2010 bei den über 18-Jährigen Befragten eine Zusatzbefragung mit dem Schwerpunkt Krebserkrankungen ("cancer control supplement") durchgeführt. Dazu gehörten u.a. auch Fragen nach einer Gebärmutterentfernung, der Durchführung des Papanicolaou-Tests als Screeningmethode und diverse soziodemografische Daten.
Die wichtigsten Ergebnisse zeigen ein erschreckendes Bild mangelnder Orientierung an den evodenzbasierten Empfehlungen -möglicherweise auch der schlichten Unkenntnis:
• Bei 34% der Frauen, deren Gebärmutter völlig entfernt ("total hysterectomy") wurde, erhielten im Jahr vor der Befragung einen Papanicolaou-Test. 64,8% dieser Frauen erhielten in der gesamten nachoperativen Zeit einen derartigen Test.
• Von den über 65-jährigen Frauen ohne Gebärmutterentfernung erhielten in den letzten drei Jahren 58,4% einen Test - 44,4% auch jedes Jahr.
• Damit erhielten insgesamt fast 14 Millionen Frauen einen Test, der mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Nutzen für sie erbrachte.
• Interessant ist schließlich noch, dass u.a. der Anteil der Testempfängerinnen bei den privat Versicherten durchweg am höchsten war (80,3% unter den Frauen mit Gebärmutterentfernung und 88,6% unter den Frauen ohne diese Operation).
Auch wenn die AutorInnen auf mögliche Grenzen ihrer Studie als Studie mit Angaben über das Testgeschehen von den Befragten Frauen hinweisen und auch keine Details zur genauen Art der Gebärmutterentfernung erfragt werden konnten, sehen sie einen beträchtlichen "misuse" des Tests trotz eindeutiger und seit rund einem Jahrzehnt bekannten Empfehlungen. Eine ihrer kritischen Bewertungen: "health care resources could be spent better elsewhere". Kritisch ist der beobachtete missbräuchliche Einsatz des Tests aber nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen der allein mit dem u.U. ängstlichen Warten auf das Testergebnis verbundenen Einschränkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Die Hoffnung, dass die US-Gesundheitsreform daran etwas ändere, klingt angesichts der Zahlen und den auch sonst identifizierten ärztlichen Über- und Fehlversorgungsexzessen (z.B. Krebsfrüherkennung für terminal an Krebs erkrankten älteren Patienten) etwas naiv und unrealistisch.
Und auch hier kann man für Deutschland mangels vergleichbarer Daten mal wieder weder Kritisches noch Entwarnendes sagen.
Der Research Letter Overuse of Papanicolaou Testing Among Older Women and Among Women Without a Cervix von Deanna Kepka et al. ist in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" vom 25. November 2013 komplett kostenlos veröffentlicht worden.
Bernard Braun, 27.11.13
Wissenstransfer für die Selbsthilfe - Datenbank online
 Obwohl es Selbsthilfegruppen bereits seit mehreren Jahrzehnten gibt und sich dort wahrscheinlich bereits Hunderttausende wenn nicht mehr Kranke mit dem professionellen und vor allem auch selbstverantwortlichen Umgang mit ihren Krankheitsbildern beschäftigt haben und beschäftigen, ist es schwer sich über deren Arbeit und deren wissenschaftlichen Untersuchungen einen Überblick zu verschaffen.
Obwohl es Selbsthilfegruppen bereits seit mehreren Jahrzehnten gibt und sich dort wahrscheinlich bereits Hunderttausende wenn nicht mehr Kranke mit dem professionellen und vor allem auch selbstverantwortlichen Umgang mit ihren Krankheitsbildern beschäftigt haben und beschäftigen, ist es schwer sich über deren Arbeit und deren wissenschaftlichen Untersuchungen einen Überblick zu verschaffen.
Hier abzuhelfen ist das Ziel des seit 2012 vom Bundesministerium für Gesundheit u.a. an der Universität Freiburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen geförderten und durch verschiedene Selbsthilfeorganisationen (z.B. NAKOS) unterstützten Projekts "Wissenstransfer für die Selbsthilfe (WISE)".
"Ziel des Projektes ist die Unterstützung und die Förderung der gesundheitsbezogenen gemeinschaftlichen Selbsthilfe durch den Transfer wissenschaftlichen Wissens in die Praxis. Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Aufbereitung wissenschaftlicher Literatur. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der allgemeinverständlichen und systematischen Darstellung sowie methodenkritischen Bewertung von Studien über die gesundheitsbezogene gemeinschaftliche Selbsthilfe. Eine derartige Literaturübersicht ermöglicht eine bessere Einschätzung der heutigen quantitativen und qualitativen Verbreitung der gesundheitsbezogenen gemeinschaftlichen Selbsthilfe, ihrer Arbeitsweisen, Ziele, Erfolge und Wirkungen sowie ihres Unterstützungs- und Förderbedarfs."
Die dafür entwickelte Wissens-Datenbank ist seit kurzem online und frei zugänglich.
In den bisherigen Schwerpunkten deskriptive Forschung und Wirkungsforschung finden sich u.a. gut aufbereitete und bewertete quantitative und qualitative wissenschaftliche Beiträge zu den Themen Beratungskonzepte und Dienstleistungen gesundheitsbezogener Selbsthilfe-Initiativen, Alkoholiker nach Therapien: Teilnahme an Selbsthilfegruppen, "Schön, dass sich auch einmal jemand für mich interessiert". Eine Erhebung der Lebensqualität von Angehörigen langzeitig an Schizophrenie Erkrankter, Beratungskonzepte und Dienstleistungen gesundheitsbezogener Selbsthilfe-Initiativen und Die Wirksamkeit von Angst-Selbsthilfegruppen aus Patienten- und Expertensicht.
Geplant ist die Aufnahme von weiteren Studien und Forschungsbereichen der Selbsthilfeforschung, sodass sich der regelmäßige Besuch sicher lohnt.
So erreicht man die Datenbank "Wise - Wissenstransfer für die Selbsthilfe".
Bernard Braun, 16.10.13
Wie gut oder schlecht werden Public Health-Großrisiken gemanagt? Die Beispiele Schweinegrippe-Pandemie und EHEC-Ausbruch
 Vollständige, verlässliche und sachliche Transparenz über das Risiko und seine Entwicklung, umfassende Ursachenerforschung sowie der gesicherte Nutzen von Gegenmaßnahmen gehören zu den Essentials des politischen Managements von Großrisiken für die Bevölkerungsgesundheit.
Vollständige, verlässliche und sachliche Transparenz über das Risiko und seine Entwicklung, umfassende Ursachenerforschung sowie der gesicherte Nutzen von Gegenmaßnahmen gehören zu den Essentials des politischen Managements von Großrisiken für die Bevölkerungsgesundheit.
Das was bei zwei der jüngsten Großrisiken, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) proklamierten aber nie faktischen Schweinegrippe-Pandemie und dem EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli)-Ausbruch im Frühjahr 2011, passiert ist und teilweise erst nach hartnäckigen Analysen und Recherchen an die Öffentlichkeit gelangt ist, zeigt massive Defizite der eingangs genannten Essentials bei verschiedenen internationalen und nationalen Public Health-Akteuren.
Beim Umgang mit den Schweinegrippe-Infektionen vom Typ H1N1 in den Jahren 2009/10 bleibt bis heute nicht nur die Frage offen, warum die WHO hier eine Pandemie ausgerufen hat, sondern stellt sich vor allem die Frage, wie es zu der Empfehlung kam, zur Prävention und zur Behandlung von Schweinegrippe vor allem das Medikament Tamiflu des Schweizer Pharmaunternehmens Roche zu propagieren, einsetzen zu wollen oder einzusetzen (einen nachwievor konkurrenzlos guten Überblick über die WHO-Politik und die eigentlich bis heute nicht beendete Debatte über das Medikament Tamiflu gibt die exzellente Website Tamiflu campaign der Fachzeitschrift "British Medical Journal (BMJ)"). Letzteres führte dazu, dass öffentliche Gesundheitseinrichtungen zahlreicher Länder Millionen von Packungen für Hunderte von Millionen Euro einkauften, einlagerten und letztlich fast alle mangels Nachfrage vernichten mussten. Nachdem öffentlich wurde, dass zumindest ein Autor dieser WHO-Empfehlungen finanzielle Kontakte zu Roche hatte und dies auch ehrlicherweise der WHO mitgeteilt hatte, ist das Zustandekommen der Empfehlung weniger rätselhaft. Offen interessenorientiert ist dann auch das Verhalten von Roche, nach der Veröffentlichung von Zweifeln an dem Nutzen ihres Arzneimittels, die Herausgabe einer Vielzahl nicht veröffentlichter Studiendaten an unabhängige Wissenschaftler jahrelang zu verschleppen. Zu dieser Strategie passt nahtlos, dass Roche auch nach Beendigung dieser Blockade nichts Anrüchiges daran findet, dass in einem jetzt existierenden "unabhängigen" vierköpfigen Untersuchungsgremium zwei Mitglieder vielfache offene Verbindungen mit der Firma Roche hatten. Das Schlimme an diesen und weiteren Merkwürdigkeiten ist, dass z.B. die WHO eine Menge Glaubwürdigkeit und Vertrauen in ihre Unabhängigkeit verspielt hat. In dem Fall, dass ein neues und wirklich weltweit bedrohliches Großrisiko kommen sollte, könnte es deswegen dazu kommen, dass dann möglicherweise völlig richtige Daten und Empfehlungen nicht geglaubt und befolgt werden - mit erheblichen Folgen für die öffentliche Gesundheit.
Nicht arg viel besser agierten das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und das Robert-Koch-Institut (RKI), die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention, bei der Aufklärung und Nachbereitung des weltweit größten EHEC-Ausbruchs im Jahr 2011. Dies geht jedenfalls aus einem Ende September 2013 von der Nichtregierungsorganisation "foodwatch" veröffentlichten Brief des RKI über die Ursachenforschung und das Management der Erkrankungswelle hervor.
Offiziell erweckten das zuständige Bundesministerium für Ernährung, das RKI und das BVL den Eindruck, sie hätten einen Sprossenerzeugungsbetrieb in Niedersachsen und die dortige Saat aus Ägypten eindeutig als praktisch exklusiven Auslöser der für 53 Personen tödlich endenden Epidemie identifiziert.
Dies war aber offenbar eine Täuschung oder extrem verzerrte Information der Öffentlichkeit, da nach den jetzigen Angaben des RKI nur bei 500 der mehr als 3.800 bekannt gewordenen Fälle die Ursache aufgedeckt worden ist. 87% der Fälle blieben also ungeklärt.
Außerdem konnte erst nach einem Antrag auf Akteneinsicht für "foodwatch" die Behauptung der amtlichen Public Health-Einrichtungen, sie hätte eine nicht veröffentlichte Gesamtliste aller EHEC-Ausbruchsorte und damit auch genügend Klarheit über das Geschehen gehabt, als falsch nachgewiesen werden. Eine solche Liste mit der damit verbundenen eindeutigen Identifikation der Auslöser hat es laut des RKI-Schreibens maximal für 500 Fälle gegeben. Wodurch, durch wen oder woher die Majorität der Fälle stammte, blieb damit ungeklärt. Zurück bleibt daher auch hier ein erschüttertes Vertrauen in die Sorgfalt und Verlässlichkeit der Handlungen anerkannter Public Health-Institutionen für den Ernstfall.
Das Antwortschreiben des Robert-Koch-Instituts an foodwatch vom 17.6.2013 ist mittels eines extrem lange dauernden Ladevorgang kostenlos erhältlich.
Den ausführlichen foodwatch-Report zur EHEC-Krise "Im Bockshorn" vom Mai 2012 gibt es ebenfalls kostenlos.
Die umfängliche Pressemitteilung von Verbraucherministerin Ilse Aigner und Gesundheitsminister Daniel Bahr zur EHEC-Krise vom 3. Mai 2012 ist auch noch kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.10.13
Welche zentralen Faktoren spielen bei Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit Hauptrollen und was haben beide miteinander zu tun?
 Was sind die häufigsten Probleme von Pflegekräften, Ärzten und Patienten im Zusammenhang mit der stationären Behandlung? Gibt es Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit von Patienten und Krankenhausmitarbeitern? Diesen Fragen ging das Picker-Institut, einer der international tätigen Pioniere der seriösen Patienten- und Mitarbeiterbefragung, umfassend nach. Erstens mit einer Analyse der Antworten von 111.835 Patienten-Befragungsbögen aus den Jahren 2009 bis 2012, zweitens mit einer Auswertung der Antworten auf einen Mitarbeiter-Fragebogen von 10.441 Pflegekräften und 4.211 Ärzten im selben Zeitraum und drittens mit den Antworten von 27.300 Patienten, ca. 4.000 Ärzten und 11.000 Pflegekräfte aus Krankenhäusern, in denen im Abstand von höchstens einem Jahr alle drei Gruppen befragt wurden.
Was sind die häufigsten Probleme von Pflegekräften, Ärzten und Patienten im Zusammenhang mit der stationären Behandlung? Gibt es Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit von Patienten und Krankenhausmitarbeitern? Diesen Fragen ging das Picker-Institut, einer der international tätigen Pioniere der seriösen Patienten- und Mitarbeiterbefragung, umfassend nach. Erstens mit einer Analyse der Antworten von 111.835 Patienten-Befragungsbögen aus den Jahren 2009 bis 2012, zweitens mit einer Auswertung der Antworten auf einen Mitarbeiter-Fragebogen von 10.441 Pflegekräften und 4.211 Ärzten im selben Zeitraum und drittens mit den Antworten von 27.300 Patienten, ca. 4.000 Ärzten und 11.000 Pflegekräfte aus Krankenhäusern, in denen im Abstand von höchstens einem Jahr alle drei Gruppen befragt wurden.
Zu den wichtigsten bekannten und neuen Erkenntnissen gehören:
• 47% der befragten Patienten berichten über eine suboptimale Versorgungssituation bei der Vorbereitung auf ihre Entlassung, 30% sahen ihre Familie nicht gut einbezogen, 22% hatten Probleme mit der Arzt-Patient-Interaktion, 18% hatten Probleme mit dem Essen und der geringste Anteil von 10% Probleme mit der Sauberkeit.
• Die zentralen Faktoren für die Gesamtzufriedenheit der Patienten waren mit 60,8% Anteil die Pflegepersonal- und Arzt-Patient-Interaktion. Und nicht die häufig kolportierte Qualität der Küche oder der TV-Empfangsmöglichkeiten.
• 57%, 54% und 50% der Ärzte haben große Probleme mit der Arbeitsbelastung, ihrer Qualifizierung und der Führungs- und Unternehmenskultur. Diese Wahrnehmung und Erfahrungen teilten sie sich mit 49%, 47% und 48% der Pflegekräfte. Die wenigsten Ärzte und Pflegekräfte, nämlich zwischen 13% und 20% hatten dagegen Probleme mit dem zwischenmenschlichen Umgang oder der Dienstplanung.
• 49% der Arbeitszufriedenheit von Ärzten wird durch die Faktoren Führungs- und Unternehmenskultur, das Verhältnis zu den direkten Vorgesetzten sowie zu ihren direkten Kollegen bestimmt. Etwas anders sieht es bei Pflegekräften aus: 58% ihrer Arbeitszufriedenheit werden auch durch den Faktor Führungs- und Unternehmenskultur, die Arbeitsbelastung und die Bedingungen der Patientenversorgung bestimmt.
• 50% bis 65% der Ärzte und Pflegekräfte haben aus ihrer subjektiven Sicht zu wenig Zeit für die Interaktion mit Patienten und deren Angehörigen.
• Je besser die Pflegekräfte die Interaktion von Patienten, Pflegekräften und Ärzten und die Bedingungen der Patientenversorgung bewerten, umso besser beurteilen die Patienten die Interaktion mit den Pflegekräften. Ähnliche ebenfalls hochsignifikante Zusammenhänge gibt es auch zwischen Patienten und Ärzten.
Für die Autoren des Picker-Reports bedeutet dies, dass Patienten- und Mitarbeiterorientierung "nicht zu Lippenbekenntnissen in Leitbildern und Marketingaktionen" "verkommen" dürfen. Ähnliches gilt wohl auch für einen Teil der Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsrituale. Die offensichtlich essentiell miteinander verbundenen Erfahrungen von Patienten und Ärzten sollten daher wesentlich mehr als bisher bei der Definition von Qualitätszielen oder als Steuerungselemente in Krankenhäusern genutzt werden.
Eine Kurzversion von vier Seiten des Reports Picker-Report 2013. Zentrale Faktoren der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit von K. Stahl und M. Nadj-Kittler ist kostenlos erhältlich. Wer an der 23-seitigen Langversion interessiert ist, sollte es beim Picker-Institut in Hamburg versuchen.
Bernard Braun, 2.10.13
Weniger ist mehr: Das Beispiel der operativen Behandlung von Hautkrebspatienten mit begrenzter Lebenserwartung
 Eine besondere Form der Über- und Fehlversorgung ist die Behandlung von Patienten mit limitierter Lebenserwartung, die den möglichen Nutzen der Therapie nicht mehr erleben können, sondern nur noch deren unerwünschte Wirkungen auf die gesundheitliche Lebensqualität.
Eine besondere Form der Über- und Fehlversorgung ist die Behandlung von Patienten mit limitierter Lebenserwartung, die den möglichen Nutzen der Therapie nicht mehr erleben können, sondern nur noch deren unerwünschte Wirkungen auf die gesundheitliche Lebensqualität.
Ein aktuelles Beispiel liefern die Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie mit 1.536 an einem Nicht-Melanom-Hautkrebs erkranktenPatienten, von denen am Ende noch 1.360 Patienten mit 1.739 dieser Art von Tumoren über durchschnittlich 9 Jahre hinweg genauer untersucht wurden. Von ihnen hatten 332 Patienten nach mehreren anerkannten Kriterien (z.B. älter als 85 Jahre, hoher Komorbiditätsindex) nur noch eine begrenzte Lebenserwartung (limited life expectancy - LLE). Untersucht werden sollte, ob und wie derartige Patienten mit oder ohne begrenzte Lebenserwartung behandelt worden sind. Dies erfolgt vor dem Hintergrund einiger in den USA durchgeführter Studien, die nachwiesen, dass z.B. zahlreiche Patienten mit metastasierendem Krebs und geringer Lebenserwartung noch völlig wertlose Früherkennungsuntersuchungen angeboten bekamen (vgl. dazu den entsprechenden Beitrag in forum-gesundheitspolitik) oder 20% sterbenskranke Medicare-Versicherte im letzten Monat ihres Lebens noch operiert wurden.
Das Ergebnis bei den an Nichtmelanom-Hautkrebs erkrankten Patienten war eindeutig: Ob einer dieser Patienten voraussichtlich bald sterben wird oder nicht, spielte für die Art der Therapie nahezu keine Rolle.
Insgesamt wurden 68,7% der Tumore operativ entfernt. Dies geschah bei 34,2% der Patienten mit der aufwändigen und belastenden so genannten Mohs-Chirurgie, bei 34,5% mit einer einfacheren Methode. Bei weiteren 26,7% wurden die Tumore mit Kälte, Laser, Bestrahlung etc. zerstört. Nur 3,1% erhielten keine Behandlung.
Die Behandlung der Patienten mit begrenzter Lebenserwartung sah so aus: 70,1% von ihnen wurden operiert, 33,9% mit der Mohs-Chirurgie und 36,2% mittels einer einfachen Entfernung. Bei 25,2% wurden die Tumore mit Kälte, Laser etc. entfernt und nur 3,3% blieben unbehandelt. Die Über- und Fehlversorgung solcher Patienten ergibt sich auch dadurch, dass 73% dieser Patientengruppe völlig asymptomatisch waren, also z.B. nicht an Schmerzen litten. Nach 5 Jahren waren aber rund 43% und nach 10 Jahren bereits 77% dieser Patienten gestorben (in der Kontrollgruppe betrug die Sterblichkeit 11% und 33%) - keineinziger wegen seiner Hautkrebserkrankung. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie den möglichen Nutzen der Behandlung erleben konnten, war also tatsächlich gering. Erlebt hatten allerdings 20% dieser Patienten eine Reihe unerwünschter Folgen der Behandlung, nämlich Wundheilungsstörungen, Schmerzen oder Taubheitsgefühle.
Auch wenn die Teilnehmer der Studie aus einer Stadt stammten, viele ehemalige Soldaten waren und es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, sollte künftig bei Interventionsentscheidungen auch die möglicherweise begrenzte Lebenserwartung berücksichtigt werden.
Der in der Reihe "Less is more" der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" am 10. Juni 2013 erschienene Aufsatz Treatment of nonfatal conditions at the end of life von Eleni Linos et al ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.6.13
Hohe Evidenz für die Bedeutung von Patientenerfahrungen als Säule der Versorgungsqualität.
 Eignen sich die Erfahrungen von Patienten als eine der Säulen zur Bewertung der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit von Gesundheitsversorgung oder sollte man dies lieber weiter den Experten überlassen? Wer hier mit "ja" antwortet, muss klären, welche Aspekte und Facetten der Patientenerfahrungen Indikatoren für die klinische Wirksamkeit und die patientenbezogenen Sicherheit bzw. die Ergebnisqualität gesundheitsbezogener Leistungen sind. Und auch hier gilt wie bei medizinischen Indikatoren und Interventionen, dass die Antwort nicht vom "guten Gefühl" bei der Berücksichtigung von Patientenerfahrungen oder -bewertungen abhängig sein darf, sondern von der gesicherten Evidenz ihrer Links oder Assoziationen mit Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit.
Eignen sich die Erfahrungen von Patienten als eine der Säulen zur Bewertung der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit von Gesundheitsversorgung oder sollte man dies lieber weiter den Experten überlassen? Wer hier mit "ja" antwortet, muss klären, welche Aspekte und Facetten der Patientenerfahrungen Indikatoren für die klinische Wirksamkeit und die patientenbezogenen Sicherheit bzw. die Ergebnisqualität gesundheitsbezogener Leistungen sind. Und auch hier gilt wie bei medizinischen Indikatoren und Interventionen, dass die Antwort nicht vom "guten Gefühl" bei der Berücksichtigung von Patientenerfahrungen oder -bewertungen abhängig sein darf, sondern von der gesicherten Evidenz ihrer Links oder Assoziationen mit Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit.
Ein am 3. Januar 2013 im "British Medical Journal (BMJ) Open" veröffentlichter systematischer Review der Ergebnisse von 55 Studien (z-.B. randomisierte kontrollierte Studien, Kohortenanalysen) zu diesen Zusammenhängen liefert zahlreiche Belege für derartige Assoziationen.
Dazu zählen u.a.
• der Nachweis, dass Patientenerfahrungen bei einer Fülle von Erkrankungen, in verschiedenen Studiendesigns (z.B. Surveys, Interviews, strukturierte Patient-Arzt-Gespräche), Settings (z.B. Krankenhäuser, Hausarztpraxen), Bevölkerungsgruppen und Ergebnisparametern (z.B. Anzahl der Arztbesuche, Erkrankungshäufigkeit, Komplikationen) positiv mit Patientensicherheit klinischer Wirksamkeit assoziiert sind, d.h. valide und reliable Hinweise auf die Ausprägungen der beiden Qualitätsparameter liefern,
• die positive und dann auch statistisch signifikante Assoziation von Patientenerfahrungen mit sieben Arten von Behandlungsergebnissen. Dazu zählt das subjektiv wahrgenommene aber auch objektive, d.h. durch Ärzte und andere Experten erhobene oder gemessene Behandlungsergebnis, die Adhärenz bei empfohlenen Medikationen und Behandlungen, die Inanspruchnahme präventiver Versorgungsangebote wie Impfungen und Screening-Untersuchungen, die Anzahl der Besuche oder Inanspruchnahme von Versorgungsressourcen im Krankenhaus oder in ambulanten Arztpraxen, die technische Behandlungsqualität und unerwünschte Ereignisse unter der Behandlung.
• In den 55 berücksichtigten Studien werden für diese sieben Facetten von Behandlungsqualität 312 positive Assoziationen dafür gefunden, dass die Patientenerfahrung verlässliche Hinweise auf die Qualität, d.h. Stärken und Schwächen von Gesundheitsversorgung liefert. Die Anzahl der fehlenden positiven Assoziationen beläuft sich dagegen auf lediglich 66. Überdurchschnittlich häufig finden sich Nachweise für positive Assoziationen bei objektiven Gesundheits-Outcomes (29 positive Assoziationen und 11 Fälle fehlender Assoziation), bei der Adhärenz von Behandlungen (152 und 7) und den unerwünschten Ereignissen (7 und 0). Selbst im Bereich der technischen Behandlungsqualität, wo der Anteil der nachgewiesenen Anzahl positiver Assoziationen unterdurchschnittlich ist, gibt es mit 8 mehr Untersuchungen, die eine positive Assoziation nachweisen als 4 in denen dieser Nachweis nicht zu finden ist.
Die Schlussfolgerungen der britischen Reviewergruppe lauten: Differenzierte und spezifische Patientenerfahrung sollten als einer der "central pillars" in die Bewertung der gesundheitsbezogenen Versorgungsqualität einbezogen werden. Klinische Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenerfahrungen sollten nicht isoliert und einzeln, sondern als Gruppe von Faktoren behandelt werden. Den Erfahrungen von Patienten kommt dabei der evidenzgesicherte Part zu, nutzlose und unsichere Versorgungspraxis verlässlich zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit von Verbesserungen bei der Ergebnisqualität und Sicherheit zu verbessern. Direkt an die Ärzte und andere Experten gewandt weisen die selbst in Krankenhäusern arbeitenden Wissenschaftler abschließend auf eine Schlüsselvoraussetzung für den praktischen Nutzen der von ihnen gefundenen Assoziationen hin: "Clinicians should resist sidelining patient experience measures as too subjective or mood-orientated, divorced from the 'real' clinical work of measuring and delivering patient safety and clinical effectiveness."
Die im deutschen Gesundheitswesen immer noch weit verbreitete Praxis entweder Patienten gar nicht (z.B. in Arztpraxen) und überwiegend nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit (z.B. in Krankenhäusern) zu fragen oder die gewonnenen Ergebnisse als Schrankware zu entsorgen und folgenlos zu machen, sollte nach diesen Ergebnissen ein rasches Ende nehmen.
Auch wenn die Autoren selbst auf Grenzen ihres aktuellen Reviews hinweisen, also z.B. ein Publikationsbias durch die in Veröffentlichungen Bevorzugung von Studien mit positiver Assoziation existieren könnte oder im Moment noch Studien aus den USA relativ stark vertreten sind, verbietet die Ergebnisfülle auf differenzierte Patientenerfahrungen als Qualitätssicherungs-Faktor weiterhin zu verzichten. Trotzdem vorhandene Forschungslücken sollten in weiteren systematischen Reviews möglichst bald geschlossen werden.
Der durch eine vorbildlich informative Dokumentation der berücksichtigten Studien äußerst materialreiche Aufsatz A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness von Cathal Doyle, Laura Lennox und Derek Bell ist in "BMJ Open" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Hilfreich und erneut vorbildlich ist schließlich der Hinweis auf die Möglichkeit, 13 der im Aufsatz zitierten Aufsätze mittels eines entsprechenden Sammellinks ebenfalls komplett kostenlos einsehen zu können.
Bernard Braun, 3.4.13
Wie viele Jahre müssen Darm- und Brustkrebs-Gescreente noch leben, um den Überlebensnutzen der Untersuchungen genießen zu können?
 10 Jahre müssen TeilnehmerInnen an Screeninguntersuchungen zur Früherkennung von Darm-(Teststreifen für okkultes Blut) und Brustkrebs (Mammografie) im Durchschnitt noch leben, um einen der von ihnen erwarteten oder versprochenen Nutzen, nämlich das Überleben für eine bestimmte Zeit erleben zu können.
10 Jahre müssen TeilnehmerInnen an Screeninguntersuchungen zur Früherkennung von Darm-(Teststreifen für okkultes Blut) und Brustkrebs (Mammografie) im Durchschnitt noch leben, um einen der von ihnen erwarteten oder versprochenen Nutzen, nämlich das Überleben für eine bestimmte Zeit erleben zu können.
Die Grundlage für diese Schätzung stellt erstens eine Metaanalyse der Überlebensraten in vier Darmkrebsstudien in Dänemark, Großbritannien, Schweden und den USA mit rund 31.000 bis 150.000 Teilnehmern im Alter zwischen 45 und 80 Jahren dar, in denen jährlich oder zweijährlich Tests auf okkultes Blut im Stuhl durchgeführt wurden. Zweitens lagen der Studie die Ergebnisse von fünf ebenfalls internationalen Brustkrebsscreening-Studien zugrunde, in denen rund 14.000 bis 61.000 Teilnehmerinnen im Alter von 40 bis 74 Jahren alle 12 bis 33 Monate mit einer Mammografie untersucht worden waren.
Die AutorInnen nahmen in ihrer Metaanalyse an, dass die absolute Risikoreduktion von einem krebsassoziierten Toten pro 1.000 ScreeningteilnehmerInnen ein vernünftiger Schwellenwert ist, bei dem der potenzielle Nutzen des Screenings für das Überleben die potenziellen Schädigungen oder Belastungen für die meisten Gescreenten aufwiegt. Zu den unerwünschten gesundheitlichen Folgen der beiden Screeningmethoden rechneten die WissenschaftlerInnen die Anzahl von 3 Personen pro 10.000 NutzerInnen von Teststreifen für okkultes Blut, bei denen der Befund durch eine Koloskopie validiert werden musste, die zu Darmverletzungen führte. Zu den unerwünschten Folgen der Mammografie gehört die bei einer von 1.000 mammografierten Frauen unnötigerweise durchgeführte Biopsie von Brustgewebe.
Diese Nachteile werden laut den Berechnungen dieser Metaanalyse erst nach 10 Jahren bzw. durch die erst dann erreichte Risikoreduktion oder den Gewinn beim Überleben aufgewogen.
Die wichtigste Schlussfolgerung der AutorInnen lautet: "Screening for breast and colorectal cancer should be targeted toward those patients with a life expectancy greater than 10 years".
Der Aufsatz Time lag to benefit after screening for breast and colorectal cancer: Meta-analysis of survival data from the United States, Sweden, United Kingdom, and Denmark. von Lee SJ et al. ist am 8. Januar 2013 im "British Medical Journal" (346:e8441) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.3.13
"Hoch zufrieden" und als hilfreich geschätzt, nur womit und wofür? Mammografie-PR statt Argumente für informierte Teilnahme
 Folgt man den Ausführungen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz, zeigt eine von ihr am 18. Februar 2013 mit vorgestellte und vom Ministerium geförderte Studie eine "hohe Zufriedenheit der Frauen mit dem Mammographie-Screening. Die Ergebnisse zeigen, dass organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme von den Menschen in Deutschland angenommen werden." Und weil alles so gut und wegweisend zu sein scheint, fährt sie fort: "Daher werden mit dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vergleichbare Programme für die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses und des Darmkrebses eingeführt." Was sie dabei immerhin auch für wichtig hält, ist, dass "die Menschen fundiert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsuntersuchung informiert werden (müssen)."
Folgt man den Ausführungen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz, zeigt eine von ihr am 18. Februar 2013 mit vorgestellte und vom Ministerium geförderte Studie eine "hohe Zufriedenheit der Frauen mit dem Mammographie-Screening. Die Ergebnisse zeigen, dass organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme von den Menschen in Deutschland angenommen werden." Und weil alles so gut und wegweisend zu sein scheint, fährt sie fort: "Daher werden mit dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vergleichbare Programme für die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses und des Darmkrebses eingeführt." Was sie dabei immerhin auch für wichtig hält, ist, dass "die Menschen fundiert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsuntersuchung informiert werden (müssen)."
Und auf den ersten Blick sind die Ergebnisse der 2012 durchgeführten Follow-up-Befragung von 4.663 aus 13.517 ursprünglich angeschriebenen Frauen im Alter von 50 bis 69 (Rücklaufquote von 34,9%), denen das Mammografiescreening in Deutschland zumindest dem Namen nach bekannt war, und darunter 3.811, die mindestens schon einmal an dem Mammografiescreening teilgenommen haben, auch beeindruckend:
• Von den 3.811 Befragten, die bereits ein oder mehrere Male an einem Mammografie-Screening teilgenommen haben, "wird das qualitätsgesicherte Mammographie-Screening Programm überwiegend positiv beurteilt. Die Aspekte Termintreue (95,7%), Hygiene (95,1%), Kompetenz (92,7%) und Freundlichkeit (91,6%) des Personals sowie die Modernität der Geräte (90,2%) werden von fast allen teilnehmenden Frauen als positiv wahrgenommen." Bemerkenswert ist, dass sich unter den von einer großen Mehrheit positiv bewerteten Faktoren keiner aus dem harten Kern von gesundheitlichem Nutzen oder Qualität befindet.
• Rund 94 Prozent der eingeladenen Teilnehmerinnen würden erneut am Screening teilnehmen.
• Fast 95 Prozent würden Freundinnen und Bekannten das Mammographie-Screening weiterempfehlen.
Zu den Schattenseiten des Programms liefert diese Studie aber auch wichtige Ergebnisse, die jedoch leicht und (un)beabsichtigt hinter der Schlagzeilen-Zufriedenheit verschwinden.
Bereits allgemein macht die Beobachtung nachdenklich, dass sich an vielen der seit der ersten vergleichbaren Befragung im Jahr 2008 bekannten Schwachstellen trotz zahlreicher öffentlicher und kontroverser Debatten und Aufklärungskampagnen "nur geringe Veränderungen" ergeben haben.
Dabei handelt es sich um z. B. um "Wissensdefizite …, die (sich) insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Lebensalter und Brustkrebsrisiko sowie auf eine überhöhte Erwartungshaltung an den Nutzen des Mammographie-Screening Programms im Sinne eines größtmöglichen Schutzes vor und einer Verhinderung von Brustkrebs (beziehen). Weiterer Informationsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Themen Sicherheit des Befundes, gesundheitliche Risiken, Unterschied zur bisherigen Mammographie und Verwendung der persönlichen Daten." Insgesamt existiert eine "Überschätzung des Nutzens" der Untersuchung.
Konkret listet die Studie dazu Folgendes auf: "Vor allem die Teilnehmerinnen neigen zu einer Überschätzung des Nutzens und gehen (fälschlicherweise - Anmerkung bb) davon aus, dass das Mammographie-Screening Brustkrebs verhindern kann (57,1%) und größtmöglichen Schutz vor Brustkrebs bietet (73,5%). Dahingegen weisen die Nicht-Teilnehmerinnen eine rationalere Einschätzung auf: nur 33,0% glauben, dass Brustkrebs durch das Screening Programm verhindert werden kann und 42,5% erwarten sich größtmöglichen Schutz durch die Teilnahme am Screening-Programm. Beide Substichproben sind skeptisch im Hinblick auf die Weiterverwendung ihrer Daten (Teilnehmerinnen: 25,5%, Nicht-Teilnehmerinnen: 31,1%) und die Möglichkeit, mit Hilfe des Screenings alle Brustkrebsarten erkennen zu können (Teilnehmerinnen: 22,5%, Nicht-Teilnehmerinnen: 31,9%)."
Trotz des offiziellen, allerdings nach Meinung von KritikerInnen zu uneingeschränkt positiven und affirmativen Einladungsschreibens fanden die StudienautorInnen zahlreiche Informationslücken und -bedürfnisse bei den potenziellen TeilnehmerInnen: "Die Teilnehmerinnen sind vor allem auf der Suche nach Informationen, die ihnen eine Rückbestätigung für ihr eigenes Verhalten liefern. Sie geben an, mehr Informationen über die Sicherheit des Befundes (67,7%), gesundheitliche Risiken (60,9%) und die Verwendung der persönlichen Daten (41,7%) haben zu wollen. Die Nicht-Teilnehmerinnen hingegen interessieren sich für Argumente, die für eine Teilnahme am Mammographie-Screening sprechen, wie die Sicherheit des Befundes (63,4%), den Unterschied zur bisherigen Mammographie (62,0%), den persönlichen Nutzen einer Teilnahme (21,3%) sowie für Informationen zum Ablauf des Screenings (16,6%)."
Angesichts der immer noch zu niedrigen Beteiligungsrate von 56% am Mammografiescreening (um wissenschaftlich belastbare Aussagen zum Nutzen des Screenings machen zu können, müssen sich nach den eigenen Kriterien der Organisatoren mindestens 70% der anspruchsberechtigten Frauen am Screening beteiligen) stellt sich u.a. die Frage, welche Einstellung die Nicht-Beteiligten zum Mammografiescreening haben.
Wie die Studie zeigt, unterscheiden sich die beiden Gruppen beträchtlich. Die Frauen, die sich an der Befragung nicht beteiligen, betrachten "die "Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen eher als Belastung. Die Nicht-Teilnehmerinnen haben eine negativere Einstellung zum qualitätsgesicherten Mammographie-Screening Programm und nehmen die Inhibitoren für eine Teilnahme wie Risiken und das Gefühl der Bevormundung deutlich eher wahr als die Teilnehmerinnen. Darüber hinaus sind Verdrängung und Angst bei den Nicht-Teilnehmerinnen weitere Faktoren, die eine Teilnahme am Mammographie-Screening verhindern. Innerhalb der Gruppe der Nicht-Teilnehmerinnen hat ein deutlich geringerer Anteil der Frauen mit einem Arzt über das Mammographie-Screening Programm gesprochen. Diejenigen, bei denen das Thema im Arztgespräch diskutiert wurde, haben signifikant häufiger eine neutrale Reaktion des Arztes erfahren als die Teilnehmerinnen. Im Vergleich der beiden Erhebungswellen zeigt sich, dass die kritische Haltung der eingeladenen Nicht-Teilnehmerinnen deutlich zugenommen hat, so dass eine Manifestierung der negativen Einstellung anzunehmen ist. Dies spiegelt sich auch in der Abnahme der Bereitschaft zur Teilnahme bei erneuter Einladung und der sinkenden Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung einer Teilnahme wider."
Ein weiterer interessanter Teil der Studie beschäftigt sich schließlich auch noch damit, ob und wie stark die Befragten den fünf anerkannten Einstellungstypen Befürworterinnen (Anteil: 33,7%), Risikobewusste (26,0%), Ambivalente (26,3%), Verdrängerinnen (7,5%) und Ablehnerinnen (6,6%) zuzuordnen sind und wie sich diese Gruppen voneinander unterscheiden.
Mustergültig ist schließlich die Dokumentation des Fragebogens im Anhang des Berichts.
Der bereits auf den 22. Oktober 2012 datierte aber erst am 18. Februar veröffentlichte 70-seitige wissenschaftliche Bericht "Inanspruchnahme des qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings - Follow-Up Studie 2012" von den Koordinatorinnen Hilde Schulte,Irmgard Nass-Griegoleit sowie den WissenschaftlerInnen Ute-Susann Albert und Sabine Fischbeck, kann kostenlos über die Website des BMG heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 19.2.13
Verlust von Lebensqualität und Therapietreue durch Spritz-Ess-Abstand bei insulinpflichtigen Typ 2-DiabetikerInnen "not necessary"
 Es gibt Forschungsergebnisse nach deren Lektüre man sich fassungslos fragt, warum sie nicht bereits seit Jahren oder Jahrzehnten vorliegen und die Versorgung von Millionen PatientInnen positiv bestimmen. Es geht um den so genannten Spritz-Ess-Abstand bei den mit Humaninsulin behandelten PatientInnen mit einem Diabetes mellitus 2 bzw. Altersdiabetes.
Es gibt Forschungsergebnisse nach deren Lektüre man sich fassungslos fragt, warum sie nicht bereits seit Jahren oder Jahrzehnten vorliegen und die Versorgung von Millionen PatientInnen positiv bestimmen. Es geht um den so genannten Spritz-Ess-Abstand bei den mit Humaninsulin behandelten PatientInnen mit einem Diabetes mellitus 2 bzw. Altersdiabetes.
Die Fähigkeit ihrer Bauchspeicheldrüse, Insulin zu produzieren, und damit den Blutzuckerspiegel zu senken, ist bei diesen Personen so weit verringert, dass z.B. vor Mahlzeiten Humaninsulin gespritzt werden muss, um den gesundheitlich bedenklichen Anstieg des Blutzuckerspiegels zu verhindern. Um die volle Wirkung erzielen zu können gehörte bisher eine Wartezeit vor den beabsichtigten Mahlzeiten von 20 bis 30 Minuten zu den Standardempfehlungen bzw. -vorschriften. Damit schien der gesundheitliche Effekt der Insulinspritze unabänderlich mit einer Beeinträchtigung der Lebensqualität verbunden zu sein, auch wenn dies nicht selten zu einer geringeren Therapietreue beitrug. Ein Teil der Neuentwicklungen von Insulin versuchte daher, auch insulinpflichtigen DiabetikerInnen spontaneres Essen zu ermöglichen und den Spritz-Ess-Abstand gegen Null zu verkürzen.
Eine jetzt von WissenschaftlerInnen des Uni-Klinikums Jena durchgeführte Studie belegt wahrscheinlich zum ersten Mal so deutlich, dass Millionen von DiabetikerInnen umsonst gewartet und gelitten haben und auch ein Teil der pharmazeutischen Fortschritte eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.
Eine Studie mit 100 Probanden, die an Diabetes Typ 2 erkrankt und insulinpflichtig waren, untersuchte mit einem randomisierten Kontrollgruppendesign, wie sich der Blutzuckerspiegel nach der Einnahme von Mahlzeiten mit oder ohne Wartezeit entwickelte.
Das Ergebnis: DiabetikerInnen können direkt nach dem Spritzen von Normalinsulin essen, ohne dass der als valider Indikator für den Blutzuckerwert gemessene Langzeitwert HbA1c-Wert zu stark ansteigt. Dieser Wert schwankte in beiden Gruppen lediglich um nach Meinung der Diabetologen gesundheitlich unbedenkliche 0,08%. Auch bei den zusätzlich erhobenen Blutzuckerprofilen, dem Beginn einer Unterzuckerung, der Lebensqualität und der Zufriedenheit mit der Behandlung gab es keine nennenswerten oder nur Unterschiede zugunsten des Wegfalls des Spritz-Abstand.
Auch für viele andere PatientInnen mit anderen Krankheiten gibt es jede Menge "goldene Regeln" oder Verhaltensvorschriften mit vergleichbaren Auswirkungen auf deren Lebensqualität und Versorgungsverhalten. Vor allem dann, wenn diese letztlich nur eminenzbasiert sind oder vom einen zum anderen "Ratgeber" ab- und fortgeschrieben werden, sollten auch dort schleunigst und systematisch Untersuchungen stattfinden, die der hier vorgestellten ähneln.
Der Aufsatz Randomized Crossover Study to Examine the Necessity of an Injection-to-Meal Interval in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Human Insulin. von Nicolle Müller, Thomas Frank, Christof Kloos, Thomas Lehmann, Gunter Wolf und Ulrich Alfons Müller ist in der Fachzeitschrift "Diabetes Care" am 22. Januar 2013 online veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.2.13
Metaanalyse zeigt: Vitamine und antioxidative Nahrungsergänzungsmittel nützen nichts gegen Herz-Kreislaufkrankheiten.
 In der Fülle der zum Teil auch bereits im "forum-Gesundheitspolitik" vorgestellten Studien über den präventiven und therapeutischen Nutzen einer Reihe von industriell gefertigten Vitaminen und antioxidativen Nahrungsergänzungsmittel, überwiegen hochwertige Studien, die keine Evidenz dafür fanden, dass diese Produkte das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung signifikant verringern oder sich auf die Sterblichkeit auswirken. Es gab aber auch einige andere hochwertige Studien, die bei dem einen oder anderen Vitamin oder Nahrungsergänzungsmittel einen signifikanten Nutzen für die Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen behaupteten. Was für die weitere Bewertung dieser Produkte und entsprechende praktische Schlussfolgerungen für die Prävention und die Versorgung von Kranken bisher fehlte, war eine umfassende Metaanalyse, die gleichzeitig die Ergebnisse möglichst aller hochwertigen aber inhaltlich uneinigen Studien zu diesem Bereich insgesamt berechnet.
In der Fülle der zum Teil auch bereits im "forum-Gesundheitspolitik" vorgestellten Studien über den präventiven und therapeutischen Nutzen einer Reihe von industriell gefertigten Vitaminen und antioxidativen Nahrungsergänzungsmittel, überwiegen hochwertige Studien, die keine Evidenz dafür fanden, dass diese Produkte das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung signifikant verringern oder sich auf die Sterblichkeit auswirken. Es gab aber auch einige andere hochwertige Studien, die bei dem einen oder anderen Vitamin oder Nahrungsergänzungsmittel einen signifikanten Nutzen für die Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen behaupteten. Was für die weitere Bewertung dieser Produkte und entsprechende praktische Schlussfolgerungen für die Prävention und die Versorgung von Kranken bisher fehlte, war eine umfassende Metaanalyse, die gleichzeitig die Ergebnisse möglichst aller hochwertigen aber inhaltlich uneinigen Studien zu diesem Bereich insgesamt berechnet.
Hieran versuchte sich jetzt eine ForscherInnengruppe aus Südkorea und schuf sich dazu aus insgesamt 2.240 bis zum November 2012 veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträgen zur primär- oder sekundärpräventiven Wirksamkeit von Vitaminen und antioxidativen Ergänzungsmitteln (z.B. Vitamin A, B-6, B-12, C, D, E, Betacarotin, Selen, Folsäure) eine Basis von 50 randomisierten kontrollierten Studie mit insgesamt 294.478 TeilnehmerInnen (156.663 TeilnehmerInnen in den Interventionsgruppen und 137.815 TeilnehmerInnen in Kontrollgruppen).
Die damit durchgeführte umfassende Metaanalyse einschließlich einiger Subgruppen-Metaanalysen, kommt zu folgenden Erkenntnissen:
• Die zusätzlich zur Aufnahme über die Nahrung konsumierten industriell gefertigten Vitamine und Antioxidantien waren nicht mit einem niedrigeren Risiko großer kardiovaskulärer Ereignisse (z.B. Herzinfarkt) assoziiert (relatives Risiko 1,00).
• Auch Subgruppen-Metaanalysen in denen z.B. der Typ der Prävention, einzelne Vitamine oder Ergänzungsmittel, der Typ des kardiovaskulären Ereignisses, das Design der Studie, die methodische Qualität, die Behandlungsdauer, der Finanzier der Studie jeweils gesondert berücksichtigt wurde, konnten keinen statistisch signifikanten Nutzeneffekt der untersuchten Produkte belegen.
• Bei Metaanalysen mit einigen kleineren Studien zeigten sich sowohl unerwünschte wie erwünschte Effekte: So stieg mit der Einnahme einiger Vitamine das Risiko einer Angina pectoris marginal an. Die Aufnahme niedriger Dosen von Vitamin B-6 war mit einem leicht niedrigeren Risiko schwererer Herz-Kreislauferkrankungen assoziiert. Sowohl nützliche wie schädliche Effekte verschwanden aber fast immer dann, wenn die Analysen mit den Daten von qualitativ hochwertigen RCTs wiederholt wurden.
• Wenn dann doch die Metaanalyse hochwertiger Studien z.B. eine Assoziation der Einnahme von Vitamin B-6 mit einem niedrigeren Risiko der kardiovaskulären Sterblichkeit oder eine Assoziation der Einnahme von Vitamin E mit einem niedrigeren Herzinfarktrisiko zeigte, handelte es sich immer und ausschließlich um Studien, in denen die Ergänzungsmittel von Pharmaherstellern bereitgestellt worden waren. Diese Effekte tauchten aber markant in RCTs nicht auf, die nicht von Herstellern oder mit deren Unterstützung durchgeführt worden waren. In den Worten der ForscherInnen zeigten sich die genannten nützlichen Effekte "only in trials with supplements provided by the pharmaceutical industry." Und der vorsichtige Versuch, dieses Phänomen zu erklären, lautet so: "So we cannot completely exclude the possibility that this might have influenced the respective trial design, results, or interpretations."
• Die WissenschaftlerInnen lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie ihre Ergebnisse und die einer Reihe anderer im Text zitierten AutorInnen für so gesichert und ernst halten, dass sie eigentlich zu gesetzgeberischen Schlussfolgerungen für den Konsumentenschutz führen müssten: "Most countries permit the pharmaceutical or food industry to sell these supplements under the name of functional food or medical food, and many people take vitamin or antioxidant supplements in the belief that they improve their health. Based on recent meta-analyses of randomised controlled trials, including the current study, however, governments and regulating agencies for food and drugs should consider vitamin and antioxidant supplements as medicinal products and strictly evaluate their efficacy and safety before marketing."
• Abschließend halten die WissenschaftlerInnen aber dennoch weitere Studien für notwendig, um zum Beispiel zu klären, ob die ergänzende Zufuhr von Vitaminen zumindest den Personen hilft, die zu Beginn einer solchen Studie eine mangelhafte Versorgung mit dem einen oder anderen Vitamin hatten.
• Und hier der obligatorische Hinweis: Auch diese Ergebnisse sind kein Plädoyer gegen den Nutzen von Obst. Nur besteht er nicht in der Prävention von Herzinfarkten!
Warum aber nimmt man die Hersteller zahlreicher "Gesundheits"Produkte der boomenden Gesundheitswirtschaft nicht beim Wort und verlangt von ihnen alles das an Nutzennachweis und Nachweis der Schädigungsfreiheit, was die Hersteller eines Teils der Gesundheits- und Medizinprodukte des ersten Gesundheitsmarktes immer mehr erbringen müssen, wenn sie mit dem Begriff "Gesundheit" Konsumenten zu gewinnen versuchen?!
Die Ergebnisse der umfassenden Metaanalysen von Myung SK, Ju W, Cho B, et al. sind am 18. Januar 2013 unter dem Titel Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. im renommierten "British Medical Journal" (2013; 346: f10) veröffentlicht worden und im Rahmen der "open access"-Politik dieser Zeitschrift komplett kostenlos zugänglich. Als wahre Fundgruppe für zahlreiche weitere interessante Ergebnisse erweisen sich die umfänglichen Tabellen im Anhang zu diesem Aufsatz.
Bernard Braun, 1.2.13
"Englische Verhältnisse" Modell? Transparenz über die Behandlungsqualität von psychisch Kranken in geschlossenen Einrichtungen
 Auch in Großbritannien ist ein relevanter Teil aller Erkrankungen psychisch bedingt: gegenwärtig rund 23%. Wie gewichtig dieser Anteil ist, wird klar, wenn man sieht, dass in Großbritannien "nur" jeweils 16% der gesamten Krankheitslast durch Krebs und Herzerkrankungen verursacht werden. Ob psychisch kranke und in hohem Maße noch in geschlossenen Anstalten behandelte Personen eine problemgerechte und vor allem ihre Menschen- und Freiheitsrechte so weit wie möglich berücksichtigende Versorgung erhalten, wird seit dem 1983 verabschiedeten "Mental Health Act" u.a. von speziellen "Mental Health Act commissioners" der "Care Quality Commission (CQC)" untersucht und die Ergebnisse umfassend in bisher drei umfangreichen Berichten veröffentlicht.
Auch in Großbritannien ist ein relevanter Teil aller Erkrankungen psychisch bedingt: gegenwärtig rund 23%. Wie gewichtig dieser Anteil ist, wird klar, wenn man sieht, dass in Großbritannien "nur" jeweils 16% der gesamten Krankheitslast durch Krebs und Herzerkrankungen verursacht werden. Ob psychisch kranke und in hohem Maße noch in geschlossenen Anstalten behandelte Personen eine problemgerechte und vor allem ihre Menschen- und Freiheitsrechte so weit wie möglich berücksichtigende Versorgung erhalten, wird seit dem 1983 verabschiedeten "Mental Health Act" u.a. von speziellen "Mental Health Act commissioners" der "Care Quality Commission (CQC)" untersucht und die Ergebnisse umfassend in bisher drei umfangreichen Berichten veröffentlicht.
Der dritte Bericht ist im Januar 2013 veröffentlicht worden und beruht hauptsächlich auf dem Besuch von 1.546 stationären Abteilungen für die Behandlung psychisch Kranker in den Jahren 2011 und 2012. 811 der Einrichtungen wurden unangekündigt besucht und kontrolliert und 95 der Kontrollen fanden am Wochenende statt. Die "Kommissare" sprachen im Rahmen ihrer Untersuchung mit 4.569 PatientInnen, MitarbeiterInnen der Einrichtung, untersuchten über 4.500 Behandlungspläne und andere Dokumente und nahmen auch den baulichen und sonstigen Zustand der Einrichtung in Augenschein. Außerdem sind die "Kommissare" auch für die Kontrolle der Arbeit von so genannten "Second Opinion Appointed Doctors (SOADs)" zuständig, deren wesentliche Aufgabe darin besteht, zu bewerten ob die freiheitsentziehenden Maßnahmen bei der Behandlung psychisch Kranker angemessen oder zulässig sind. Die SOADS führten in dem Untersuchungszeitraum fast 9.000 Besuche von PatientInnen in geschlossenen Anstalten und weitere rund 3.200 bei anderen psychisch Kranken durch. Inhaltlich spielten die Erfahrungen der PatientInnen eine zentrale Rolle, und dabei vor allem der Grad ihrer Beteiligung an Behandlungsentscheidungen und die Art und Weise ihrer informierten Zustimmung zu Behandlungsschritten.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten folgende:
• Zahlreiche Kliniken und Abteilungen machten eine ausgezeichnete Arbeit in deren Mittelpunkt der respekt- und würdevolle Umgang mit PatientInnen stand. Der Bericht nennt zum ersten Mal auch diese Leistungserbringer, und zwar mit dem expliziten Ziel, damit andere Anbieter "anstecken" zu wollen.
• Auch wenn sich einige der positiven Aspekte aus vergangenen Berichten stabilisierten, fanden sich in 37% der kontrollierten Behandlungspläne Anzeichen dafür, dass die Sicht der PatientInnen nicht berücksichtigt wurde. In 21% der Behandlungsdokumentationen fehlten Hinweise, ob die PatientInnen über ihre gesetzlichen Rechte von einem "Mental Health Advocate" informiert worden sind. Und 45% der Behandlungsakten enthielten keinen Hinweis auf die vorgeschriebene konsensuale Diskussion über die Behandlungsschritte vor dem ersten Einsatz von Medikamenten bei den stationär untergebrachten Kranken.
• Insgesamt konstatiert der Bericht eine signifikante Lücke zwischen der Versorgungswirklichkeit und der ambitionierten "mental health"-Politik.
• Die CQC-Kommissare sind schließlich besorgt, dass sich hartnäckig eine Kontrollkultur hält, die auch prioritär gegenüber einer Kultur der Behandlung und Unterstützung von Individuen ist. Bei rund 20% ihrer Besuche hatten die Berichterstatter den Eindruck, dass die PatientInnen eher wie zwangsweise Behandelte behandelt wurden und auch nicht versucht wurde den Aufenthalt zusammen mit den Patienten als freiwilligen und konsentierten zu gestalten.
Der Bericht schließt mit ausführlichen Überlegungen und Empfehlungen zur Beseitigung der Behandlungsdefizite. Auch hier spielt die Stärkung der Patienten und ein patientenorientiertes Verständnis der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte eine zentrale Rolle. Aus Patientensicht sollte die Normalität durch das Motto "no decision about me, without me" bestimmt sein.
Wer diesen Bericht liest, und sich dann an die jüngsten empirieschwachen Debatten über den Einsatz von Zwangsmaßnahmen gegen psychisch Kranke in deutschen psychiatrischen Kliniken vor Gerichten und parlamentarischen Einrichtungen oder die endlose Debatte über die Modalitäten des "Pflegeheim-TÜVs" erinnert, hat weitere kritische Belege für den enormen Rückstand der Transparenz über die Art und Qualität der Behandlungsverhältnisse selbst großer Krankengruppen in Deutschland.
Über eine Website erhält man den Zugang zu verschiedenen Formaten des Berichts.
Den 108 Seiten umfassenden kompletten Bericht "Monitoring the Mental Health Act in 2011/12" der "Care Quality Commission" erhält man kostenlos.
Und wenn man schon einmal auf der CQC-Website ist, lohnt sich auch der Blick auf andere, zum Teil ebenfalls beispielhaften Reports der Kommission. Diese Art von "englischen Verhältnissen" täten dem deutschen Gesundheitswesen sehr gut.
Bernard Braun, 31.1.13
Helfen Flüssigkeitsinfusionen sterbenden (Krebs-)patienten? Sehr wenig, aber garantiert regelmäßige Besucher!
 Bei manchen wissenschaftlichen Studien ist die Frage berechtigt, ob sie wirklich notwendig oder ethisch vertretbar sind. Die "Entdeckung" der Wirkung einer weder primär noch sekundär vermuteten sozialen Bedingung rechtfertigt diese Studie aber möglicherweise doch. Es geht konkret um die randomisierte, kontrollierte und doppelblinde Untersuchung der Wirkung von parenteraler, d.h. per Infusion zugeführter Flüssigkeit auf im Sterben liegende Krebspatienten (durchschnittliche Überlebenszeit 17 Tage). Dies geschieht routinemäßig in Krankenhäusern, in Hospizen nach Darstellung der Studienautoren aber nicht. Die Evidenz für beide Behandlungsweisen ist begrenzt.
Bei manchen wissenschaftlichen Studien ist die Frage berechtigt, ob sie wirklich notwendig oder ethisch vertretbar sind. Die "Entdeckung" der Wirkung einer weder primär noch sekundär vermuteten sozialen Bedingung rechtfertigt diese Studie aber möglicherweise doch. Es geht konkret um die randomisierte, kontrollierte und doppelblinde Untersuchung der Wirkung von parenteraler, d.h. per Infusion zugeführter Flüssigkeit auf im Sterben liegende Krebspatienten (durchschnittliche Überlebenszeit 17 Tage). Dies geschieht routinemäßig in Krankenhäusern, in Hospizen nach Darstellung der Studienautoren aber nicht. Die Evidenz für beide Behandlungsweisen ist begrenzt.
In der bei 129 Krebspatienten an 6 Krankenhäusern durchgeführten Studie erhielt ein Teil der Patienten (n=63) täglich über vier Stunden verteilt einen Liter salzhaltiger Flüssigkeit per Infusion zugeführt. Die von ihrem Krankheitszustand zu Beginn der Studie vergleichbaren Patienten der Kontrollgruppe (n=66) erhielten als Placebo und für sie nicht erkennbar nur 100 Milliliter dieser Flüssigkeit infundiert.
Für alle Patienten wurde dann eine Reihe Indikatoren für Flüssigkeitsmangel (z.B. Müdigkeit, Halluzinationen), die Lebensqualität nach rund vier und sieben Tagen sowie die Überlebensdauer gemessen.
Das Ergebnis: Zu beiden Zeitpunkten gab es bei keinem der Indikatoren einen signifikanten Unterschied zwischen den Patientengruppen. Was aber nach Ansicht der Wissenschaftler den PatientInnen wirklich geholfen hat, waren die regelmäßigen Besuche der Forschungs-Pflegekräfte.
Auch wenn diese Forschergruppe jetzt bei weiteren Patientengruppen die Wirkung von Flüssigkeitszufuhr untersuchen will, spricht einiges dafür, dass regelmäßige Besuche von Pflegekräften und anderen Personen, also soziale Unterstützung, nicht nur bei sterbenden PatientInnen überhaupt einen oder zumindest einen gleichrangigen Nutzen wie medizinische Interventionen haben.
Der bereits am 19. November 2012 online und am 1. Januar 2013 auch gedruckt veröffentlichte Aufsatz Parenteral hydration in patients with advanced cancer: a multicenter, double-blind, placebo-controlled randomized trial. von Bruera E, Hui D, Dalal S, Torres-Vigil I, Trumble J, Roosth J, Krauter S, Strickland C, Unger K, Palmer JL, Allo J, Frisbee-Hume S und Tarleton K. ist im "Journal of Clinical Oncology" (2013, vol. 31 no.: 111-118) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.1.13
GKV-Mitglieder müssen nicht lückenlos Leistungsrecht kennen und Kassen haften für "Versicherungsvertretertricks" ihrer Mitarbeiter
 Ein letztinstanzliches Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe vom 18. Dezember 2012 vermittelt einen interessanten Einblick in das Klima des in der GKV herrschenden Wettbewerbs um neue Mitglieder und den u.a. durch Zielvereinbarungen aufgebauten Druck auf die mit der Mitgliedergewinnung beauftragten Mitarbeiter in den GKV-Kassen. Auch wenn es dabei zu offensichtlich falschen oder ungesetzlichen Zusagen an künftige Mitglieder und zum Einsatz teilweise absurder Mittel kommt, bedeutet dies noch lange nicht, dass der "schwarze Peter" beim Mitglied hängen bleiben muss.
Ein letztinstanzliches Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe vom 18. Dezember 2012 vermittelt einen interessanten Einblick in das Klima des in der GKV herrschenden Wettbewerbs um neue Mitglieder und den u.a. durch Zielvereinbarungen aufgebauten Druck auf die mit der Mitgliedergewinnung beauftragten Mitarbeiter in den GKV-Kassen. Auch wenn es dabei zu offensichtlich falschen oder ungesetzlichen Zusagen an künftige Mitglieder und zum Einsatz teilweise absurder Mittel kommt, bedeutet dies noch lange nicht, dass der "schwarze Peter" beim Mitglied hängen bleiben muss.
In dem jetzt rechtlich geklärten Fall wechselte eine Frau mit einer Krebserkrankung nach einem Beratungsgespräch mit einem Kassenmitarbeiter ihre Kasse. Das künftige Mitglied ließ sich wegen ihrer Krebserkrankung naturheilkundlich behandeln und kaufte unter anderem Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Dinkelkaffee, Kräuterblut, Natron, Mineraltabletten und Bierhefe. Die Frau konnte u.a. auch durch Zeugen belegen, dass ihr der Mitarbeiter mündlich die Erstattung der Kosten für diese Mittel durch ihre neue Kasse zugesagt hatte. Die Belege für die von ihr zum Teil verauslagten Kosten für diese naturheilkundliche ärztliche Behandlung, die Nahrungsergänzungsmittel, auch für Zahnreinigung, Praxisgebühren sowie Zuzahlungen für Massagen und für Medikamente reichte sie bei dem Kassenmitarbeiter ein und bat darum sie an die Kasse weiterzuleiten. Da dem Kassenmitarbeiter aber spätestens zu diesem Zeitpunkt klar war, dass die Kostenerstattung in diesem Fall unmöglich war, griff er zu einem absurden Mittel: Er beglich die Beträge aus seiner eigenen Tasche - ohne dass die spätere Klägerin dies erkennen konnte! Nachdem dies offensichtlich nach einer Weile nicht mehr finanzierbar war, stoppte er die Erstattung. Als sich daraufhin das Neumitglied direkt an ihre Krankenkasse wandte, flog der Schwindel auf. Die Krankenkasse weigerte sich dann aber unter Berufung auf die angeblich für jedes Mitglied bekannte Rechtslage zu den engen Grenzen der Kostenerstattung, einen Betrag von mehreren Tausend Euro zu begleichen. Dabei spielten Argumente ein Rolle, die das OLG in seinem Urteil so zusammenfasste: "Unabhängig von einem Wechsel der Krankenkasse seien die geltend gemachten Kostenpositionen nicht erstattungsfähig und medizinisch nicht erforderlich. Die Klägerin treffe ein weit überwiegendes, eine Schadensersatzpflicht ausschließendes Mitverschulden. Die behauptete Zusage des Zeugen K (der Kassenmitarbeiter) sei derart lebensfremd gewesen, der Umfang der gesetzlichen Leistungen auch allgemeinhin bekannt, so dass die Klägerin nicht auf die Zusage habe vertrauen dürfen, zumindest aber darauf hätte bestehen müssen, dass ihr diese schriftlich gegeben werde."
So kam es zur Klage, die über ein vor dem Landgericht gewonnenes Verfahren zuletzt zum OLG Karlsruhe führte. Beide Gerichte hielten die Schadenersatzansprüche der Frau für rechtens.
Das OLG stellte bei dieser Gelegenheit grundsätzlich drei Dinge zum Verhältnis zwischen gesetzlichen Krankenkassen und ihren Mitgliedern fest:
• Krankenkassen sind keine Wirtschaftsunternehmen, sondern Körperschaften öffentlichen Rechts, deren Handeln besonderen Ansprüchen genügen muss. Den von Kassen mit der Gewinnung neuer Mitglieder beauftragten Mitarbeiter muss dies unmissverständlich klar gemacht werden und vor unseriösen Versprechungen als Mittel gewarnt werden. Im OLG-Urteil steht dazu u.a.: "Bei Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung obliegt der Beklagten bzw. ihren zuständigen Amtsträgern - …- die Verpflichtung zu gesetzeskonformen Verwaltungshandeln. Nach § 14 SGB I sind die Sozialleistungsträger zu einer zutreffenden Beratung der Versicherten über die Rechte und Pflichte in der gesetzlichen Krankenversicherung verpflichtet. Auskünfte und Belehrungen sind grundsätzlich richtig, klar, unmissverständlich, eindeutig und vollständig zu erteilen … . Die damit im Vorfeld des Wechsels der Klägerin zur Beklagten sowie die danach entfaltete Beratungstätigkeit des Zeugen K im Rahmen von § 14 SGB I ist als hoheitliches Handeln anzusehen."
• Die in der Tat immer unübersichtlicher werdende Welt des SGB V darf sich nicht zu Lasten des Krankenversicherten auswirken. Dazu das OLG: "Aufgrund der Komplexität des Sozialversicherungsrechts und der Verzahnung der gesetzlichen Krankenversicherung mit anderen Sozialversicherungsbereichen (Pflege, Rentenrecht, Sozialhilfe) kann nicht davon ausgegangen werden, dass in der Öffentlichkeit der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung auch in den Details in der Weise bekannt ist, dass sich die Unrichtigkeit der Auskünfte des Zeugen K der Klägerin aufdrängen musste."
• Daraus folgt dann auch, dass dem Versicherten aus seiner Unkenntnis der Rechtslage grundsätzlich kein (finanzieller) Nachteil entstehen darf. Daher schließt das OLG seine Begründung folgendermaßen: "Nach dem Schutzzweck der verletzten Amtspflicht kann die Klägerin Erstattung der Kosten verlangen, die ihr entstanden sind, weil sie nicht zutreffend über den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung informiert worden ist und daher nicht erstattungsfähige Leistungen in Anspruch genommen hat. Gerade die Beratungspflicht nach § 14 SGB I soll Nachteilen des Versicherten vorbeugen, die ihm dadurch entstehen können, dass er sich in Unkenntnis der Leistungen des Sozialleistungsträgers befindet."
Da nicht jeder künftige Fall von Falschauskünften zum Zwecke der Mitgliedergewinnung so ablaufen muss wie der vorliegende, empfehlen Kommentatoren jeder Person in ähnlicher Konstellation, sich Leistungszusagen vor einem Kassenwechsel schriftlich geben zu lassen oder Zeugen beizuziehen.
Das Urteil des OLG Karlsruhe Urteil vom 18.12.2012, 12 U 105/12: Amtshaftung einer gesetzlichen Krankenkasse wegen unrichtiger Auskunft der Mitarbeiter über den Leistungsumfang; Gegenstand des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs ist komplett kostenlos auf dem Urteils-Server der baden-württembergischen Justiz herunterladbar.
Bernard Braun, 13.1.13
Choosing Wisely - Klug entscheiden: Fachgesellschaften und Verbraucher Hand in Hand für eine gute Versorgung
 Choosing Wisely ist eine Initiative des American Board for Internal Medicine.
Choosing Wisely ist eine Initiative des American Board for Internal Medicine.
Ausgangspunkt ist eine im Jahr 2002 veröffentlichte Charta für ärztliche Berufsethik "Medical Professionalism in the New Millennium".
In der Charta sind 3 Grundprinzipien ärztlicher Tätigkeit festgehalten:
• Das Primat des Patientenwohls
• Das Primat des Selbstbestimmungsrechts des Patienten
• Das Primat der sozialen Gerechtigkeit
Zu den ethischen Pflichten der Ärzte zählt die Charta
• fachliche Kompetenz
• Wahrhaftigkeit im Umgang mit Patienten
• ständigen Qualitätsverbesserung
• gerechte Verteilung begrenzter Mittel im Gesundheitswesen
• Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse
• angemessenes Verhalten bei Interessenskonflikten
"Less is more"- eine der Aktivitäten, die auf dieser Physician Charter beruhen (wir berichteten) - ist mittlerweile zu einer umfassenden Initiative von 9 Fachgesellschaften und 14 Verbraucherschutzorganisation geworden.
Geführt wird die Inititaitve von der ABIM Foundation und Consumer Reports, der weltgrößten Warentestorganisation.
Neun Fachgesellschaften haben jeweils ihre Top 5 der überflüssigen Maßnahmen ihres Fachgebietes aufgelistet und wissenschaftlich begründet: Link.
Weitere 21 Fachgesellschaften werden ihr Top 5 Anfang bis Mitte 2013 veröffentlichen.
Consumer Reports hat in Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachgesellschaften Informationen für die Bürger bzw. Patienten erstellt und auf der Website Consumer Health Choices veröffentlicht.
Website Choosing Wisely Link
Website ConsumerHealthChoices Link
Medical Professionalism in the New Millennium Link
Charta zur ärztlichen Berufsethik (dt. Version) Link
David Klemperer, 30.11.12
90% der US- Muster-Krankenhäuser haben ein Programm zur Reduktion vermeidbarer Wiedereinweisungen von Herzpatienten, sagen sie!
 Zweite und weitere Krankenhausaufenthalte nach der Erstbehandlung von Herzversagen und akutem Herzinfarkt stellen für die PatientInnen mindestens eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität dar und können unter den Bedingungen einer Vergütung mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) auch erhebliche Nachteile für das Krankenhaus haben - vor allem, wenn es sich um vermeidbare Wiedereinweisungen handelt. Deshalb gibt es Bemühungen, diese mit entsprechend differenzierten Programmen zu senken.
Zweite und weitere Krankenhausaufenthalte nach der Erstbehandlung von Herzversagen und akutem Herzinfarkt stellen für die PatientInnen mindestens eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität dar und können unter den Bedingungen einer Vergütung mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) auch erhebliche Nachteile für das Krankenhaus haben - vor allem, wenn es sich um vermeidbare Wiedereinweisungen handelt. Deshalb gibt es Bemühungen, diese mit entsprechend differenzierten Programmen zu senken.
Fragt man, wie es jetzt eine ForscherInnengruppe in den USA gemacht hat, Krankenhausleitungen danach, was sie tun um die Anzahl der Wiedereinweisungen dieser Patientengruppen innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung zu senken, geben 90% an, bei ihnen existierten dazu klare schriftliche Strategien und Maßnahmenpakete. Dies war eigentlich auch gar nicht anders zu erwarten, wenn man sich die Art der Krankenhäuser ansieht, die dazu in einem nationalen Survey befragt wurden. Es waren 594 Kliniken (Antwortrate 90,4%), die im Jahr 2010 Mitglied der Qualitätsverbesserungsinitiative "Hospital to Home (H2H)" waren.
Umso kritikwürdiger sieht aber die Qualitätssicherungsrealität im Lichte der Antworten auf konkrete Nachfragen zu den Einzelmaßnahmen aus mit denen die Kliniken das Ziel zu erreichen versuchten:
• 87% von ihnen hatten Qualitätsverbesserungsteams für PatientInnen mit Herzversagen und 54% für Herzinfarkt-PatientInnen.
• 49,3% gaben an, partnerschaftliche Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten zu haben und zu pflegen.
• 23,5% hatten für PatientInnen mit hohem Krankheitsrisiko zweckbezogene Partnerschaften mit anderen örtlichen Krankenhäusern.
• In 28,9% der befragten Krankenhäuser wurden routinemäßig die Angaben über die Art und die Menge ambulanten und stationären Verordnungen von Arzneimitteln zusammengeführt, bewertet und bei der weiteren Medikation berücksichtigt.
• 25,5% der Kliniken gaben an, sie würden eine Zusammenfassung aller Entlassungsdaten immer direkt an den ambulanten (weiter)behandelnden Arzt des Patienten schicken.
• Von 10 nützlichen Praktiken und Maßnahmen (einige sind gerade genannt worden) zur Verringerung des Rehospitalisierungsrisikos nutzten die befragten Krankenhäuser im Durchschnitt 4,8 und nur weniger als 3% der befragten Kliniken nutzten alle 10. Einer kleinen Zahl von 12% aller Krankenhäuser mit weit unterdurchschnittlicher Nutzung (zwei und weniger der Maßnahmen) der angeblich schriftlich vereinbarten Maßnahmen steht eine ebenso kleine Gruppe mit überdurchschnittlicher Nutzung (8 und mehr dieser Maßnahmen) gegenüber.
Bedenkt man, dass es sich bei den befragten Krankenhäusern um eine positiv verzerrte Gruppe handelt, ist die enorme Diskrepanz zwischen der Schrift-Performance und den tatsächlich umgesetzten konkreten Maßnahmen bedenklich. Vor allem dann, wenn man weiter bedenkt, dass sich z.B. Patienten und ihre Ärzte bei der Auswahl eines Krankenhauses oft nur an den schriftlichen Angaben zur Existenz eines derartigen Programms oder entsprechenden Qualitätssiegeln orientieren können - wenn sie überhaupt die Wahl haben.
Die im deutschen Gesundheitswesen verbreitete Hoffnung, dass ein Entlassungs-, Überleitungs- oder versorgungskettenbezogenes Versorgungsmanagement in Krankenhäusern allein schon durch die gesetzliche Verpflichtung (neuerdings die gesetzliche Verpflichtung zu einem Versorgungsmanagement zwischen stationärer und ambulanter Behandlung nach § 11 Abs. 4 SGB V und zum Entlassungsmanagement der Krankenhäuser nach den §§ 39 und 112 SGB V) oder die Existenz von Leitbildern, Qualitätssiegeln etc. existiert und funktioniert, sollte im Lichte dieser Untersuchung gründlich hinterfragt werden. Außer der schon fast traditionelle Pawlowsche Reflex, das sei nur in den USA so und an deutschen Krankenhäuser kein Thema, funktioniert auch bei diesem Thema. Eine Überprüfung nach dem hier erprobten Modell wäre aber allemal vertrauenswürdiger.
Vom Aufsatz "Contemporary evidence about hospital strategies for reducing 30-day readmissions: a national study." von Bradley EH et al. in der Zeitschrift "Journal of American College of Cardiology" (14. August 2012; 60(7): 607-14) gibt es nur das Abstract kostenlos.
Für diejenigen LeserInnen, die einen Zugang zu dieser Zeitschrift haben lohnt sich auch die Lektüre des ausführlichen Kommentars "Hospital strategies to reduce heart failure readmissions: where is the evidence?" von Butler J und Kalogeropoulos A. in derselben Ausgabe der Zeitschrift (60[7]: 615-7), von dem es wie bei Kommentaren üblich noch nicht einmal ein Abstract gibt.
Wie der Titel ihres Kommentars bereits andeutet, weisen die Verfasser auf ein besonders in den USA existierendes Dilemma hin: Einerseits reagiert Medicare, die staatliche Krankenversicherung für Ältere, auf Qualitätsmängel bei der stationären Versorgung, und dazu zählen vermeidbare Wiedereinweisungen in den ersten 30 Tagen nach Entlassung mit derselben Indikation, mit spürbaren Abschlägen bei der Honorierung. Darauf reagieren die Krankenhäuser u.a. verstärkt mit Maßnahmen, die z.B. Wiedereinweisungen reduzieren helfen sollen.
Andererseits bedeutet dies, dass häufig Maßnahmen entwickelt und eingesetzt werden, die "are neither proven nor primarily based on the motivation to improve patient outcomes, but rather on the fear of punitive financial disincentives. Would these enormous resources spent by hospitals to randomly implement unproven interventions be better spent on actually studying what the real determinants of HF (heart failure) hospitalizations are and which interventions will prove to be beneficial? Such questions are difficult to answer when policy trumps science. We agree with the investigators in their concluding remarks that more evidence establishing the effectiveness of the various hospital practices is needed."
Bernard Braun, 9.11.12
Patient, Konsument, Teilnehmer...!? Personen, die psychiatrische Leistungen nutzen, bevorzugen die Bezeichnung Patient oder Klient
 Wie die immer noch lesenswerte diskursanalytische Arbeit zum Bild vom "mündigen Patienten" von Anja Dieterich aus dem Jahr 2006 gezeigt hat, ist die Bezeichnung kranker Menschen nicht nur eine Etikettenfrage, sondern kann auch massive Nachteile für den Kranken mit sich bringen.
Wie die immer noch lesenswerte diskursanalytische Arbeit zum Bild vom "mündigen Patienten" von Anja Dieterich aus dem Jahr 2006 gezeigt hat, ist die Bezeichnung kranker Menschen nicht nur eine Etikettenfrage, sondern kann auch massive Nachteile für den Kranken mit sich bringen.
Der britische Sozialpolitikwissenschaftler McLaughlin hat in einem 2009 publizierten Aufsatz bereits in der Überschrift auf die anhaltende Bedeutung des "wording", "branding" oder "labeling" von Personen im Bereich der Sozialarbeit hingewiesen: "What's in a Name: 'Client', 'Patient', 'customer', 'Consumer', 'Expert by Experience', 'Service User' - What's Next?" Er zeigt ferner in kompakter Form, dass mit jedem dieser und künftiger Etiketten Annahmen und Erwartungen zum Verhalten von Personen verbunden sind, die letztlich dann auch das Verhalten anderer Personen gegenüber den Etikettierten beeinflussen. Auf was der Autor aber auch hinweist ist, dass man vor der Erfindung der nächsten Bezeichnung vielleicht einmal die Bezeichneten selbst fragen sollte, mit welchem Begriff sie sich am besten charakterisiert finden.
Diese Anregung wurde in einem 2012 publizierten systematischen Review von Einzelstudien aufgegriffen, die sich sämtlich damit beschäftigten, wie Menschen, die sich in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung befanden, sich selber bezeichnen und von anderen Personen bezeichnet wurden. Der Aufsatz enthält hierzu den Stand des Wissens in der internationalen Literatur.
In den zunächst recherchierten 13.765 Abstracts in englischer Sprache , den 69 Volltext-Aufsätzen und den schließlich kriteriengesteuert für den Review ausgewählten 11 Studien, wimmelte es von den bereits bekannten Begriffen. Und selbst Studien, die lediglich beabsichtigten die bevorzugten Bezeichnungen zu identifizieren, fügten ironischerweise eigene Bezeichnungen hinzu. So gelangten z.B. die Bezeichnungen "recipients" und "attendees (Teilnehmer)" in die Welt.
Das britische Autorenteam kam u.a. zu folgenden Ergebnissen:
• Für die Hypothese, die Fülle der Bezeichnungen von Menschen, die sich in einer psychiatrischen Behandlung befinden, hätte das Potenzial diese Personen zu stigmatisieren oder zu empowern, fanden sie wenig empirische Evidenz.
• Die "Nutzer" psychiatrischer Behandlung beschreiben sich selber gegenwärtig, je nach Herkunftsland, vorrangig als Patient oder Klient.
• Die untersuchten Studien weisen fast durchweg einen Mangel an Beteiligung von Angehörigen der untersuchten Krankengruppe am Studiendesign und der Planung angemessener Fragen z.B. nach der Selbstbezeichnung sowie bei sonstigen Inputs auf. Wer schon einmal selber versucht hat, Patienten nach ihrem Selbstbild zu fragen oder danach welche Bezeichnungen durch Dritte sie bevorzugen, weiß wie schwer solche Fragen zu formulieren sind und dass man immer mit Einflüssen der sozialen Erwünschtheit bestimmter Typisierungen zu kämpfen hat.
Von dem Aufsatz "A systematic review of the terms used to refer to people who use mental health services: User perspectives" von Geoff Dickens und Marco Picchioni - veröffentlicht im "International Journal of Social Psychiatry" (März 2012, vol. 58 no. 2: 115-122) ist der gesamte Text kostenlos erhältlich.
Von dem Aufsatz "What's in a Name: 'Client', 'Patient', 'Customer', 'Consumer', 'Expert by Experience', 'Service User'—What's Next?", verfasst von Hugh McLaughlin und 2009 veröffentlicht im "British Journal of Social Work" (Volume 39, Issue 6: 1101-1117) ist ebenfalls der gesamte Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.8.12
Versorgung von PatientInnen mit Vorhofflimmern durch qualifizierte Pflegekräfte wirksamer als die durch Kardiologen
 In Deutschland wird auch oder gerade nach dem richtungsweisenden Beschluss des "Gemeinsamen-Bundesausschusses (G-BA)" weiter heftig über den Nutzen der Delegation und Substitution einiger weniger ärztlicher Tätigkeiten an oder durch nichtärztliche Fachkräfte gestritten. Bestritten wird dabei ex- wie implizit, dass die Übertragung dieser Tätigkeiten ohne Qualitätsverlust, d.h. ohne Schaden für die PatientInnen möglich sei.
In Deutschland wird auch oder gerade nach dem richtungsweisenden Beschluss des "Gemeinsamen-Bundesausschusses (G-BA)" weiter heftig über den Nutzen der Delegation und Substitution einiger weniger ärztlicher Tätigkeiten an oder durch nichtärztliche Fachkräfte gestritten. Bestritten wird dabei ex- wie implizit, dass die Übertragung dieser Tätigkeiten ohne Qualitätsverlust, d.h. ohne Schaden für die PatientInnen möglich sei.
In einer in den Niederlanden seit 2007 über längstens 22 Monate durchgeführten randomisierten kontrollierten Studie erwiesen sich die Ergebnisse einer von speziell qualifizierten Pflegekräften durchgeführten Langzeitbetreuung von 712 PatientInnen mit Vorhofflimmern im Vergleich mit der ambulanten Standardbetreuung durch Kardiologen in vielerlei Hinsicht als signifikant besser.
Die auf dem Chronic Care-Modell beruhende Betreuung der PatientInnen bestand aus einer umfassenden Labor- und Kardio-Diagnostik ihres Krankheitszustandes und einer umfassenden Anamnese der PatientInnen durch eine spezialisierte Pflegekraft, die den Patienten auch über die Pathophysiologie der Erkrankung, die Krankheitssymptome, die geeigneten Therapien und mögliche Komplikationen informiert. Das weitere angemessene Management der weiteren Behandlung der Kranken durch die Pflegekräfte erfolgte unter Zuhilfenahme einer leitlinienbasierten Software zur Entscheidungsfindung und stand unter der fachlichen Supervision eines Kardiologen. Nach der ersten Beratung werden den PatientInnen weitere 30-minütige Folgebesuche nach 3, 6 und 12 Monaten sowie weitere Beratungen nach jeweils weiteren 6 Monaten angeboten. Wenn sie den Bedarf haben, können die PatientInnen die Pflegekraft auch zwischen den geplanten Besuchen persönlich oder per Telefon kontaktieren. Im Rahmen der Folgebesuche werden die zur psychosozialen Unterstützung wichtigen Informationen oder Übungen und die gezielten gesundheitserzieherischen Interventionen auch mehrfach angeboten.
Die TeilnehmerInnen der Kontrollgruppe erhielten die normale Behandlung durch Besuche oder Konsultationen eines in einer klinischen Ambulanz praktizierenden Kardiologen. Die Behandlung umfasste einen 20-minütigen Anfangsbesuch und 10-minütige Folgebesuche.
Alle Patienten wurden in den Folgebesuchen nach relevanten unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen und Krankenhausaufenthalten gefragt. Ergänzt wurde dies durch Reviews sämtlicher Dokumentationen zur Art, Häufigkeit und Verlauf sämtlicher medizinischen Behandlungen im mehrjährigen Verlauf der Studie.
Das primäre Behandlungsergebnis an dem der Nutzen beider Therapiekonzepte gemessen wurde, war eine Mischung aus der Sterblichkeit an kardiovaskulären Ereignissen wie Herzinfarkt, Schlaganfall etc. und der Anzahl von Krankenhausaufenthalten wegen dieser und weiterer kardiovaskulärer Erkrankungen (z.B. ernsthafte Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt) sowie lebensbedrohlicher Wirkungen von Arzneimitteln.
Nach Ablauf der maximal 22 Monate umfassenden Untersuchungszeit traten in der von Pflegekräften geleiteten Gruppe von 356 PatientInnen bei 14,3% ein oder mehrere der Ereignisse bzw. Ergebnisse auf. Bei den 356 PatientInnen in der standardmäßig von Kardiologen betreuten Gruppe war dies bei 20,8% der Fall. Dies entspricht einer signifikanten Risikorate von 0,65. Die von Pflegekräften betreuten PatientInnen hatten ein um 35% geringeres Risiko des Auftretens der unerwünschten kardiovaskulären Ereignisse. Nach einer Adjustierung stieg dieser Wert sogar auf 37%. Das Sterberisiko allein lag signifikant um 72% und das der Krankenhauseinweisung wegen eines kardiovaskulären Ereignisses um 34% unter dem Niveau bei den von Kardiologen betreuten PatientInnen. Diese positiven Wirkungen beruhten wahrscheinlich darauf, dass die TeilnehmerInnen der Pflegekräfte-Gruppe besser über ihre Erkrankung und den Umgang mit ihr informiert waren und sich auch eher an die Leitlinienempfehlungen hielten als die TeilnehmerInnen der Kardiologen-Gruppe.
Da dies nicht ausdrücklich untersucht wurde, mutmaßen die Studienverantwortlichen lediglich, dass drei infrastrukturelle und personale Bedingungen zu dem Erfolg ihrer Studie beitrugen: Erstens die für alle therapeutisch tätigen Akteure zugängliche elektronische Patientenakte, zweitens die von der Kooperations- und Abstimmungspflicht zwischen Kardiologen und Pflegekräften ausgehende starke Motivation, sich an Leitlinien zu halten oder Abweichungen begründen zu müssen und drittens die Nutzung von Checklisten. Ob das Ergebnis dann eintritt, wenn auf der Ärzteseite nicht Kardiologen, sondern andere Fachärzte tätig sind, lassen die Verantwortlichen dieser Studie offen.
Von der Studie "Nurse-led care vs. usual care for patients with atrial fibrillation: results of a randomized trial of integrated chronic care vs. routine clinical care in ambulatory patients with atrial fibrillation" von Hendriks JM, de Wit R, Crijns HJ, et al. - erschienen in der gewiss nicht arztkritischen oder pflegeorientierten Fachzeitschrift "European Heart Journal"(elektronische Vorabpublikation vom 27. März 2012 - ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.8.12
Zu viel Medizin, zu wenig Palliativ-Versorgung am Ende des Lebens
 Die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung in den letzten 6 Monaten ihres Lebens untersuchten Wissenschaftler unter Leitung von Nancy Morden vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice. Für die Studie wurden die Daten von 215.311 Medicare-Versicherten ausgewertet, die in den Jahren 2004 bis 2007 an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung verstorben sind. Die häufigsten Diagnosen lauteten Lungenkrebs (31% der Patienten), Blutkrebs (9,2%), Darmkrebs (8,5%) und Bauchspeicheldrüsenkrebs (6,2%).
Die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung in den letzten 6 Monaten ihres Lebens untersuchten Wissenschaftler unter Leitung von Nancy Morden vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice. Für die Studie wurden die Daten von 215.311 Medicare-Versicherten ausgewertet, die in den Jahren 2004 bis 2007 an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung verstorben sind. Die häufigsten Diagnosen lauteten Lungenkrebs (31% der Patienten), Blutkrebs (9,2%), Darmkrebs (8,5%) und Bauchspeicheldrüsenkrebs (6,2%).
Als Indikatoren für die Versorgungsqualität gelten laut National Quality Forum (Link) u.a. der jeweilige Anteil der Patienten:
• der in den letzten 30 Tagen des Lebens auf die Intensivstation aufgenommen wurde
• der Chemotherapie in den letzten 2 Wochen des Lebens
• der im Krankenhaus verstirbt
• mit Palliativversorgung für weniger als 3 Tage
• ohne Palliativversorgung
Untersucht wurde, ob sich Krankenhäuser unterschiedlicher Ausrichtung in insgesamt 11 Indikatoren der Versorgungsqualität unterscheiden. Dafür wurde die Krankenhäuser folgendermaßen gruppiert: kommunale Krankenhäuser, Universitätskliniken, for-profit- und nonprofit-Kliniken sowie Kliniken mit zertifizierten Abteilungen für Krebserkrankte.
Im Ergebnis zeigt sich, dass in keiner der Krankenhausarten die Patienten mit einer sehr guten Versorgung rechnen können.
Die Unterschiede zwischen den Krankenhausarten waren eher gering:
• Die Anzahl der in den letzten 4 Wochen im Krankenhaus verbrachten Tage lag zwischen 5,3 und 5,9.
• Chemotherapie in den letzten 2 Wochen ihres Lebens erhielten zwischen 5,3 und 6,3% der Patienten.
• Potentiell lebensverlängernde Maßnahmen wurden im letzten Lebensmonat an 8,9 bis 12,6% der Patienten durchgeführt.
• Palliativversorgung im letzten Lebensmonat erhielten zwischen 50,3 und 54,2% der Patienten.
• Der Beginn der Palliativversorgung erfolgte (zu) spät, also innerhalb der letzten 3 Lebenstage, bei 7,1 bis 8,6% der Patienten
Deutlicher waren hingegen die Unterschiede innerhalb der Krankenhausarten - die Raten für die genannten Indikatoren unterschieden sich durchgehend um einen Faktor von mehr als 2.
Die Autoren schließen aus den Ergebnissen, dass Patienten mit Krebs im Endstadium häufig aggressive Therapien erhalten. Für Chemotherapie in den letzten 2 Wochen des Lebens gilt beispielsweise, dass sie die Lebenserwartung verkürzt und nicht etwas - wie erhofft - verlängert.
Die großen Versorgungsunterschiede innerhalb der Krankenhausarten wirft die Frage nach der Ursache für diese Unterschiede auf. Die Wünsche und Präferenzen der Patienten sind es jedenfalls nicht, wie frühere Studien ergeben haben. Die Mehrheit der Patienten lege höheren Wert auf Lebensqualität und möchte lieber zu Hause als im Krankenhaus sterben. So sind die Ursachen eher auf Seiten der Anbieter zu finden. Notwendig sei insbesondere, dass in allen Krankenhäusern die Wünsche und Präferenzen der Patienten und ihrer Angehörigen besser erfasst und umgesetzt werden.
Morden NE, Chang C-H, Jacobson JO, Berke EM, Bynum JPW, Murray KM, et al. End-Of-Life Care For Medicare Beneficiaries With Cancer Is Highly Intensive Overall And Varies Widely. Health Affairs 2012;31(4):786-96 Abstract
Pressemitteilung des Dartmouth Institute Download
David Klemperer, 19.4.12
USA: Öffentliche Berichte über Mortalitätsrisiken in Krankenhäusern wirken sich nicht oder nur mäßig auf Risikoentwicklung aus.
 Öffentliche Berichte über wichtige Maße der Qualität der Krankheitsbehandlung in Krankenhäusern oder Arztpraxen üben durch das Abwandern von Patienten oder auch indirekt so viel Druck auf die Anbieter aus, bei denen das Sterbe- oder Komplikationsrisiko vergleichsweise hoch ist, dass die Risiken deutlich sinken - so weit die Theorie vom Patienten als "König Kunde" und der "Macht von Daten".
Öffentliche Berichte über wichtige Maße der Qualität der Krankheitsbehandlung in Krankenhäusern oder Arztpraxen üben durch das Abwandern von Patienten oder auch indirekt so viel Druck auf die Anbieter aus, bei denen das Sterbe- oder Komplikationsrisiko vergleichsweise hoch ist, dass die Risiken deutlich sinken - so weit die Theorie vom Patienten als "König Kunde" und der "Macht von Daten".
In den USA begann die staatliche Krankenversicherung Medicare im Jahre 2005 mit der Veröffentlichung einer Vielzahl von Qualitätsindikatoren für die meisten Akutkrankenhäuser in den USA. Ob dieses Programm, "Hospital Compare", wirklich den erwarteten Nutzen hatte, war lange unbekannt. Eine Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern und Medizinern beendete diesen Zustand und untersuchte mit Routinedaten von Medicare für die Jahre 2000 bis 2008 die Veränderungen der 30-Tagesmortalität für die drei Indikationen Herzinfarkt, Herzinsuffizienz/-versagen und Lungenentzündung.
Der mögliche Vergleich der Sterblichkeitstrends vor und nach der Veröffentlichung der krankenhausspezifischen Sterblichkeitsrisiken erbrachte für diese Indikationen folgende Ergebnisse:
• Die Berichterstattung beeinflusste das Risiko an einem Herzinfarkt oder einer Lungenentzündung innerhalb der 30 Tage nach der Krankenhausentlassung zu sterben nicht zusätzlich zu den unabhängig von der Publikationsintervention oder bereits vor ihr ablaufenden Trends.
• Die Sterblichkeit wegen Herzversagens wurde dagegen durch die Berichterstattung mäßig reduziert.
• Ein Nebenergebnis der Studie zeigt für die untersuchte Zeit und die USA, dass die Veröffentlichung der Qualitätsindikatoren zu keiner erkennbaren Veränderung der Patientenströme führte, also keine nennenswerte Anzahl von PatientInnen durch die "Hospital Compare"-Qualitätsindikatoren ein qualitativ höherwertiges Krankenhaus ausgewählt hat.
Warum dies so war und ist, kann mit den Daten nicht erklärt werden, sollte aber ein Kernanliegen aller Ersteller und Vertreiber solcher Vergleiche sein - egal ob sie Medicare, "Weiße Liste" oder Krankenhaus-Navigator heißen. Den Autoren ist zuzustimmen, dass diese Ergebnisse nicht als Begründung für die Beendigung der Berichterstattung mit Mortalitätsindikatoren dienen sollten. Und sie bedeuten auch nicht, dass es in dem einen oder anderen Fall nicht doch zu den erwarteten Wirkungen kommen wird.
In Deutschland wäre es sogar wünschenswert, dass Mortalitäts-Qualitätsindikatoren endlich für jedes Krankenhaus existierten und veröffentlicht werden. Nur die allein auf solche Indikatoren begründeten gewaltigen Hoffnungen auf spürbare Effekte in den Krankenhäusern und bei den PatientInnen müssen wohl reduziert und über andere Steuerungsmöglichkeiten für beide nachgedacht werden.
Der Aufsatz " Medicare's Public Reporting Initiative On Hospital Quality Had Modest Or No Impact On Mortality From Three Key Conditions" von Andrew M. Ryan, Brahmajee K. Nallamothu und Justin B. Dimick ist in der Märzausgabe 2012 der Public Health-Fachzeitschrift "Health Affairs" (31, no.3 (2012): 585-592) erschienen. Leider ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.12
Wie und warum Ärzte in Experimenten Tausenden von Menschen bewusst "vor allem schaden": Der Fall Guatemala
 Fast parallel zu der Beteiligung von deutschen Ärzten, Psychiatern und Pflegekräften an der Vernichtung unwerten Lebens in so genannten Heilanstalten für geistig behinderte Menschen, der Beteiligung von Ärzten an der Selektion in Konzentrationslagern und der tausendfachen "medizinischen" Menschenversuche in diesen Lagern, infizierten us-amerikanische Ärzte im Namen der Wissenschaft und des "Krieges gegen die Syphilis" sowie unter den liberalen Bedingungen einer parlamentarischen Demokratie 1.308 guatemaltekische Gefangene, Soldaten und Psychiatriepatienten bewusst, mit Vorsatz und zum großen Teil ohne deren Zustimmung mit Erregern von Geschlechtskrankheiten.
Fast parallel zu der Beteiligung von deutschen Ärzten, Psychiatern und Pflegekräften an der Vernichtung unwerten Lebens in so genannten Heilanstalten für geistig behinderte Menschen, der Beteiligung von Ärzten an der Selektion in Konzentrationslagern und der tausendfachen "medizinischen" Menschenversuche in diesen Lagern, infizierten us-amerikanische Ärzte im Namen der Wissenschaft und des "Krieges gegen die Syphilis" sowie unter den liberalen Bedingungen einer parlamentarischen Demokratie 1.308 guatemaltekische Gefangene, Soldaten und Psychiatriepatienten bewusst, mit Vorsatz und zum großen Teil ohne deren Zustimmung mit Erregern von Geschlechtskrankheiten.
Diese zeitliche Nähe ist insofern beklemmend, weil Ende 1946, als die Experimente in Guatemala begannen, 23 Ärzte und Beamte des Nazi-Regimes wegen ihrer unmenschlichen Versuche in den KZs in Nürnberg vor Gericht standen. In der Folge entstand der medizinethische Nürnberger Codex als einer ethischen Richtlinie zur Durchführung von Experimenten am Menschen. Dieser Codex fordert die freiwillige Zustimmung der Teilnehmer solcher Versuche, ihre Fähigkeit eine Zustimmung geben zu können und die Vermeidung unnötiger physischer und psychischer Schädigung. Ob diese Grundsätze wirksam genug sind und etwa der Performance der modernen Krebs-Therapieversuche gerecht wird, sei dahingestellt, sollte aber bedacht werden.
Der am 8. Februar 2012 in der Zeitschrift "Nature" erschienene Aufsatz "Human Experiments: First, do harm. In the 1940s, US doctors deliberately infected thousands of Guatemalans with venereal diseases. The wound is still raw" von Matthew Walter informiert ausführlich über die damaligen Ereignisse, die Motive und Umstände sowie über die bis heute laufenden juristischen Auseinandersetzungen über eine angemessene Entschädigung für die zum Teil noch heute lebenden und leidenden Opfer. Im Anhang des originalen "Nature"-Aufsatzes finden sich auch Links zu den mittlerweile veröffentlichten "Behandlungs"-Unterlagen der amerikanischen Ärzte, ein Bericht der Regierung Guatemalas in spanischer Sprache und weitere Dokumente und Hintergrundinformationen.
Der Aufsatz ist aber auch am 5. März 2012 in deutscher Übersetzung auf der Website von "Spektrum der Wissenschaft" erschienen.
Warum die Lektüre und das öffentliche Nachdenken keine reine Vergangenheitsbewältigung sind und es sich auch nicht um das Wirken weniger "schwarzer Schafe" in längst vergangenen "bösen" Zeiten handelt, zeigen einige aktuelle Hinweise am Ende des Aufsatzes. So stützten sich 80% der Anträge auf Zulassung neuer Arzneimittel in den USA im Jahr 2008 auf klinische Studien in anderen Ländern mit oft wesentlich niedrigeren medizinischen Standards als in USA oder Mitteleuropa. Dass die Vermutungen, in Entwicklungsländern würden insbesondere arme Personen ohne richtige Einsicht in das Risiko oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Beteiligte und Opfer von Arzneimitteltests, kein Einfall einiger englischer oder schwedischer Großromanciers sind, zeigt eine Entscheidung des Pharma-Konzerns Pfizer aus dem Jahr 2008. Er zahlte bis zu 75 Millionen US-Dollar, um Klagen zu den Todesfällen nigerianischer Kinder abzuwehren, die an Tests mit einem neuen Antibiotikum teilgenommen hatten.
Der Originalaufsatz in der Zeitschrift "Nature" mit den zahlreichen dokumentarischen Anhängen ist kostenlos erhältlich.
Die Übersetzung mit dem Titel "Vor allem schaden. In den 1940ern infizierten US-Ärzte in Guatemala ganz bewusst tausende Menschen mit Geschlechtskrankheiten. Die Wunden sind noch nicht verheilt gibt es ebenfalls kostenlos über "Spektrum.de".
Bernard Braun, 7.3.12
Offenlegung von Interessenkonflikten - unerwünschte Wirkungen möglich
 Interessenkonflikte finanzieller und nicht-finanzieller Art sind in der Medizin weit verbreitet. Als problematisch gelten sie, weil die Wahrnehmung und Bewertung von Sachverhalten beeinflussen und verzerren können. Beispiele zeigen, dass Wissenschaftler je nach Vorhandensein von Interessenkonflikte identische Daten gegensätzlich beurteilen (wir berichteten über das Beispiel Avandia Link).
Interessenkonflikte finanzieller und nicht-finanzieller Art sind in der Medizin weit verbreitet. Als problematisch gelten sie, weil die Wahrnehmung und Bewertung von Sachverhalten beeinflussen und verzerren können. Beispiele zeigen, dass Wissenschaftler je nach Vorhandensein von Interessenkonflikte identische Daten gegensätzlich beurteilen (wir berichteten über das Beispiel Avandia Link).
Als probates Gegenmittel wird die Offenlegung von Interessenkonflikten angesehen. In den USA wird gerade an der Umsetzung von weitreichenden Meldepflichten gearbeitet (wir berichteten: "Es werde Licht - Transparenzregelungen in den USA werden konkretisiert" Link).
Die amerikanischen Sozialwissenschaftler Loewenstein, Sah und Cain haben eine Reihe von Experimenten durchgeführt, die gezeigt haben, dass die Offenlegung von Interessenkonflikten unbeabsichtigte und unerwünschte Folgen haben kann (Quellen 1-4). Eine Zusammenfassung erschien kürzlich im Journal of the American Medical Association.
Die Offenlegung kann Ärzte dazu veranlassen, Informationen stärker zu verzerren, als es ohne Offenlegung der Fall wäre.
Zwei Mechanismen sind dafür ursächlich:
• Die strategische Übertreibung (strategic exaggeration): der Arzt stellt Sachverhalte z.B. stärker positiv verzerrt da, um der Korrektur entgegenzuwirken, die der Rezipient aufgrund seines Wissens um den Interessenkonflikt des Arztes durchführt.
• Die moralische Genehmigung (moral licensing): der Arzt hat das Gefühl, verzerrte Informationen geben zu dürfen, weil der zu Beratende ja gewarnt war.
Diese Ergebnisse wurden in Versuchsanordnungen erzielt, in der die Arzt-Patient-Beziehung nachgeahmt wurde. In den Versuchen musste eine Person (estimator) Mengen schätzen (z.B. Münzen in einem Glas), allerdings auf Grundlage unvollständiger Informationen. Die andere Person (advisor) hatte die Aufgabe, dem Schätzenden als Experte ergänzende Informationen zu geben. Der Berater hatte stets einen Informationsvorteil, indem er z.B. das Glas mit Münzen länger und aus kürzerer Distanz anschauen durfte. Der Schätzende erhielt eine Bezahlung bei möglichst genauer Schätzung. Für den Berater wurden unterschiedliche Anreize gesetzt.
Geprüft wurde nun das Verhalten des Beraters in Abhängigkeit eines Interessenkonflikts sowie das Verhalten des Schätzenden in Abhängigkeit seines Wissens bzw. Nicht-Wissens um den Interessenkonflikt des Beraters.
Kein Interessenkonflikt lag vor, wenn die Bezahlung des Beraters sich nach der Genauigkeit der Schätzung richtete.
Ein Interessenkonflikt wurde dadurch gesetzt, dass der Berater eine höhere Bezahlung erhielt, wenn die Schätzung möglichst hoch lag.
Das wenig überraschende Ergebnis lautet, dass der Berater dem Schätzenden höhere Werte angab, wenn er durch Überschätzung mehr Geld verdiente.
Bei Offenlegung des Interessenkonflikts gaben die Berater noch höhere Werte an als bei Nicht-Offenlegung - im Sinne der strategischen Übertreibung und der moralischen Lizensierung.
Die Schätzer konnten jedoch die verstärkte Verzerrung bei Offenlegung des Interessenkonflikts nicht entsprechend verrechnen. Sie nahmen zwar stärkere Verzerrung an, unterschätzten diese jedoch.
In beiden Studien verdienten die Schätzer bei Offenlegung als bei Nicht-Offenlegung weniger - die Berater genau umgekehrt. Die Verzerrung wurde auf Seiten des Schätzers (Patient) erhöht. Mit der Offenlegung wurde also genau das Gegenteil von dem erreicht, was Offenlegung bewirken soll.
In der Medizin dürfte das Problem nach Einschätzung der Autoren noch größer sein als in den künstlichen Experimenten (stylized eperiments). Patienten gehen zwar davon aus, dass die Informationen von Ärzten durch Interessenkonflikte verzerrt werden, sie vertrauen aber zumeist ihrem Arzt und meinen, dass er davon ausgenommen ist. Dies kann mit der Fehlannahme zusammenhängen, dass Bias das Ergebnis einer einer absichtlichen Täuschung ist.
Ein weiteres unerwünschtes Ergebnis von Offenlegung kann sein, dass Patienten dem Arzt weniger vertrauen und trotzdem unter erhöhtem Druck stehen, das zu machen, was dieser empfiehlt - ein Phänomen, das die Autoren als "insinuation anxiety" bezeichnen: weiß der Patient, dass eine bestimmte Entscheidung dem Arzt einen finanziellen Vorteil bringt, könnte die Ablehnung durch den Patienten eine neue Dimension in die Beziehung bringen, sie könnte dem Arzt signalisieren, dass der Patient ihn für korrupt hält. In diesem Fall mindert die Offenlegung das Vertrauen des Patienten und erhöht den Druck, dem Ratschlag des Arztes zu folgen.
Angesichts der hier dargelegten Erkenntnisse betonen die Autoren, dass sie auf unerwünschte Folgen der Offenlegung von Interessenkonflikten hinweisen und nicht etwa die Offenlegung in Frage stellen wollen. Es gehe darum sicherzustellen, die erwünschten Effekte der Offenlegung zu erzielen. Auch dafür haben die Autoren Experimente durchgeführt (3).
Zielführend könne z.B. eine unverzerrte, also nicht durch Interessenkonflikt beeinflusste Zweitmeinung sein. Hilfreich sei es auch, wenn der Interessenkonflikt durch eine dritte Person offengelegt wird, der Patient genügend Zeit für eine Entscheidung erhält und die Entscheidung in Abwesenheit des Arztes erfolgt.
Die stärkste Wirkung erziele die Pflicht zur Offenlegung von Interessenkonflikten vermutlich auf die Ärzte selbst. Analoge Beispiele aus anderen Bereichen zeigen, dass Personen das Eingehen von Interessenkonflikten vermeiden, wenn diese schwer vor Anderen zu rechtfertigen sind. Dies dürfte für die Annahme von Geschenken und die Finanzierung von ärztlicher Fortbildung durch die pharmazeutische Industrie durchaus zutreffen.
Loewenstein G, Sah S, Cain DM. The Unintended Consequences of Conflict of Interest Disclosure. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2012;307:669-70 Link (Volltext kostenpflichtig)
Weitere Studien der Arbeitsgruppe
(1) Loewenstein G, Sah S, Cain DM. The Burden of Disclosure: Increased Compliance with Distrusted Advice, 2012 Download Volltext (noch nicht in einer Fachzeitschrift mit peer review erschienen)
(2) Sah S, Loewenstein G, Cain DM. How Doctors' Disclosures Increase Patient Anxiety. Download Volltext (noch nicht in einer Fachzeitschrift mit peer review erschienen)
(3) Cain DM, Loewenstein G, Moore DA. The Dirt on Coming Clean: Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest. J Legal Studies 2005;34:1-25. Download Volltext
(4) Cain DM, Loewenstein G, Don AM. When Sunlight Fails to Disinfect: Understanding the Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest. Journal of Consumer Research 2011;37:836-57 Download Volltext
David Klemperer, 24.2.12
Was kostet Patientenzufriedenheit? Warum haben zufriedendste Patienten ein höheres Mortalitätsrisiko als völlig unzufriedene?
 Für viele Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanitärhäuser oder Versorgungsforscher gehören eine "alles-in-allem"-Frage oder auch mehrere detailliertere Fragen zur Zufriedenheit ihrer Patienten zum Standardrepertoire der Messung, Sicherung und Demonstration von Versorgungsqualität. Auch Versicherte oder PatientInnen orientieren sich bei Wahlentscheidungen für ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis häufig am Grad der Zufriedenheit früherer Nutzer der in Frage kommenden Behandlungseinrichtungen. Schließlich halten sich zufriedene PatientInnen auch mehr an ärztliche Empfehlungen und sind auch loyaler gegenüber Ärzten als unzufriedene PatientInnen. Eigentlich könnten also alle Beteiligte am Behandlungsgeschehen zufrieden mit der Zufriedenheit sein.
Für viele Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanitärhäuser oder Versorgungsforscher gehören eine "alles-in-allem"-Frage oder auch mehrere detailliertere Fragen zur Zufriedenheit ihrer Patienten zum Standardrepertoire der Messung, Sicherung und Demonstration von Versorgungsqualität. Auch Versicherte oder PatientInnen orientieren sich bei Wahlentscheidungen für ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis häufig am Grad der Zufriedenheit früherer Nutzer der in Frage kommenden Behandlungseinrichtungen. Schließlich halten sich zufriedene PatientInnen auch mehr an ärztliche Empfehlungen und sind auch loyaler gegenüber Ärzten als unzufriedene PatientInnen. Eigentlich könnten also alle Beteiligte am Behandlungsgeschehen zufrieden mit der Zufriedenheit sein.
Viele Untersuchungen weisen aber darauf hin, dass summarische Fragen nach der Zufriedenheit mit einem Krankenhausaufenthalt ein zu positives oder verzerrtes Bild liefert. Ein wichtiger Grund ist der, dass gerade PatientInnen glauben, ihre hohe Zufriedenheit sei ein sozial erwünschtes Antwortverhalten und dies dann aus Loyalität oder Angst vor möglichen Folgen einer anderen Antwort auch "abliefern".
Andere Studien haben gezeigt, dass es oft nur einen spärlichen Link zwischen Patientenzufriedenheit und objektiver Behandlungsqualität sowie den Behandlungsergebnissen gibt. Gerade bei besonders bedürftigen, verletzlichen und meist älteren PatientInnengruppen gibt es zum Beispiel keine Assoziation zwischen ihrer Zufriedenheit und der technischen Qualität geriatrischer Behandlung. Und "subjektive" Patientenzufriedenheit korreliert überhaupt nicht oder nur sehr wenig mit den von den Leistungserbringern gemessenen "objektiven" Qualitätsindikatoren. Und da PatientInnen auch an Leistungen interessiert sind, die keinen oder nur sehr wenig Nutzen haben, deren Inanspruchnahme sie aber tatsächlich oder vermutlich zufriedener macht, bieten Ärzte oder Krankenhäuser, deren Bezahlung wenigstens zum Teil von der Zufriedenheit ihrer PatientInnen abhängt, auch häufiger Leistungen an, die wenig oder keinen bewiesenen Nutzen haben. Patientenzufriedenheit kann also durchaus zu einem Verhalten von Ärzten und Patienten führen, das für beide Akteure mehr Nach- als Vorteile hat.
Mit den Daten mehrerer Wellen der des für die US-Bevölkerung repräsentativen "Medical Expenditure Panel Survey (MEPS)" untersuchten nun US-ForscherInnen für den Zeitraum 2000 bis 2005/07 die Entwicklung einer Fülle von soziodemografischen Merkmalen, den Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten, mögliche Confounder, die Sterblichkeit. die Nutzung von Notfallabteilungen in Krankenhäusern, die Intensität der Arzneimittelverordnungen und die Nutzung sonstiger stationärer Versorgungsangebote von 51.946 (ohne Sterblichkeitsdaten aber mit allen anderen Daten bis 2007) bzw. 36.428 (mit Sterblichkeitsdaten bis zum Jahr 2006) Erwachsenen. Für diese Personen wurde auch jeweils jahresmittig mit vier Standardfragen die Patientenzufriedenheit erhoben. Mit diesen Daten konnte dann untersucht werden wie sich der Gesundheitszustand und das Inanspruchnahmeverhalten der im ersten Untersuchungsjahr mit ihrem Gesundheitszustand und der Behandlung im Gesundheitssystem zufriedenen Personen im zweiten Jahr entwickelte und wie in einem Beobachtungszeitraum von bis zu 3,9 Jahre die Sterblichkeit der anfänglich zufriedenen Personen aussah.
Nach einer umfassenden Standardisierung nach soziodemografischen und gesundheitlichen Merkmalen, d.h. dem Ausschluss des Einflusses derartiger Faktoren auf die Ergebnisse, ergab sich ein unerwartetes Bild:
• Die Wahrscheinlichkeit in einer Notfallstation aufgenommen und behandelt zu werden, war unter dem Viertel der am meisten zufriedenen Untersuchten fast durchweg signifikant niedriger als bei Angehörigen des Viertels der Untersuchten mit der geringsten Zufriedenheit.
• Das Viertel der Personen mit der im ersten Jahr höchsten Zufriedenheit hatte im zweiten Jahr im Vergleich mit dem Viertel der StudienteilnehmerInnen mit der geringsten Zufriedenheit Gesundheitsausgaben, die signifikant um 8,8% höher und Arzneimittelausgaben, die ebenfalls signifikant um 9,1% höher waren. An diesen Assoziationen änderte sich selbst dann nichts als die AutorInnen alle Untersuchungspersonen mit sehr schlechtem selbst wahrgenommenem Gesundheitszustand und mit 3 oder mehr chronischen Erkrankungen aus ihrer Untersuchung ausschlossen.
• Noch verblüffender war, dass das Mortalitätsrisiko des Viertels der Personen, die am zufriedendsten war um signifikante 26% höher war als das des am wenigsten zufriedenen Viertels (p=0,02).
Ihre eigenen Versuche, diese unerwarteten oder verwirrenden Assoziationen von hoher Patientenzufriedenheit und erhöhten Behandlungs- und sogar Sterberisiken zu erklären, wägen zwar eine Reihe vertrackter Wechselwirkungen zwischen Ärzteverhalten und Patientenerwartungen ab, liefern aber auch keine plausible Erklärung.
Die AutorInnen plädieren zwar zu Recht dagegen, regelmäßige differenzierte Zufriedenheitsmessungen bei PatientInnen ab sofort zu ignorieren oder als Indikatoren zur Qualitätssicherung auszumustern. Ihre Daten zeigen aber, dass nicht vollständig klar ist, welche messbaren Faktoren die Patientenzufriedenheit letztlich bestimmen oder wie sie sich auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und deren Ergebnisse auswirken.
Insofern gehört der Schlusssatz des Aufsatzes nicht nur zum Ritual wissenschaftlicher Studien, sondern enthält eine ernst zu nehmende Botschaft für die Praxis der Patientenzufriedenheitserhebungen und -nutzungen: "Without additional measures to ensure that care is evidence based and patient centered, an overemphasis on patient satisfaction could have unintentended adverse effects on health care utilization, expenditures, and outcomes."
Der Aufsatz "The Cost of Satisfaction. A National Study of Patient Satisfaction, Health Care Utilization, Expenditures, and Mortality" von Joshua J. Fenton, Anthony F. Jerant, Klea D. Bertakis und Peter Franks ist am 13. Februar 2012 "online first" in der US-Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" erschienen und bisher noch komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.2.12
"Liar, Liar, Pants on Fire!" (Journal Watch vom 10.2. 2012) oder: Wie gehen ÄrztInnen gegenüber PatientInnen mit der Wahrheit um?
 Wenn man manche Debatten zwischen ÄrztInnen über ihre Stellung in der Gesellschaft verfolgt, würde der an ihrer Unfehlbarkeit und ihrer in jeder Hinsicht "weißen Weste" zweifelnde Hinweis, sie würden nicht selten ihre PatientInnen belügen oder ihnen wichtige Informationen vorenthalten, mit einem rhetorischen und evtl. auch handfesteren Gegenfeuer beantwortet. Zum "deutschen Stil der Debatte" gehörte dann noch das Konzedieren, es gäbe mal das eine oder andere "schwarze Schaf" oder extrem seltene Zwangssituationen wo eine Lüge das Mittel der letzten Wahl darstelle. Das sei aber alles so selten, dass eine empirisch repräsentative Untersuchung der Häufigkeit von Lügen bei deutschen ÄrztInnen reine Zeit- und Geldverschwendung wäre.
Wenn man manche Debatten zwischen ÄrztInnen über ihre Stellung in der Gesellschaft verfolgt, würde der an ihrer Unfehlbarkeit und ihrer in jeder Hinsicht "weißen Weste" zweifelnde Hinweis, sie würden nicht selten ihre PatientInnen belügen oder ihnen wichtige Informationen vorenthalten, mit einem rhetorischen und evtl. auch handfesteren Gegenfeuer beantwortet. Zum "deutschen Stil der Debatte" gehörte dann noch das Konzedieren, es gäbe mal das eine oder andere "schwarze Schaf" oder extrem seltene Zwangssituationen wo eine Lüge das Mittel der letzten Wahl darstelle. Das sei aber alles so selten, dass eine empirisch repräsentative Untersuchung der Häufigkeit von Lügen bei deutschen ÄrztInnen reine Zeit- und Geldverschwendung wäre.
Dass diese "Schluss-der-Debatte"-Kultur problematisch ist, zeigen jetzt die Ergebnisse einer unter us-amerikanischen ÄrztInnen durchgeführten Untersuchung.
Im Jahr 2008 wurde aus der Mitgliedschaft der "American Medical Association" aus jeder von 7 Arztgruppen (z.B. Hausärzte, Chirurgen, Psychiater) zufällig 500 ÄrztInnen ausgewählt, die einen achtseitigen Fragebogen zugeschickt erhielten, der sich u.a. an den professionellen, ethischen oder moralischen Zielvorgaben und Handlungsempfehlungen der praktisch von allen Ärzteorganisationen anerkannten "Charter on Medical Professionalism" orientierte. Von den 3.500 EmpfängerInnen des Fragebogens konnten schließlich nur 2.938 antworten und 1.891, d.h. für Ärztebefragungen sehr gute 64,4%, taten dies dann auch wirklich.
Die wesentlichen Ergebnisse:
• Die große Mehrheit der ÄrztInnen in den USA stimmt generell dem Prinzip zu, ihre PatientInnen vollständig über Behandlungsrisiken und -nutzen zu informieren. Dies gilt auch für das Prinzip, vertrauliche Informationen über PatientInnen unter keinen Umständen oder nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Patienten an Außenstehende weiterzugeben.
• 34,1% der ÄrztInnen stimmten dem Prinzip nur eingeschränkt oder gar nicht zu, davon betroffenen PatientInnen alle wichtigen ärztlichen oder Behandlungsfehler mitzuteilen - auch dann, wenn es zu keinen dramatischen Folgen kam.
• 17,2% der ÄrztInnen stimmten auch dem Prinzip nur eingeschränkt oder gar nicht zu, einem Patienten niemals etwas zu sagen, was nicht wahr ist.
• 35,4% der ÄrztInnen stimmten ferner dem ebenfalls eindeutig kodifizierten Prinzip nicht oder nur mit Einschränkungen zu, ihren PatientInnen eigene finanzielle Beziehungen mit Arzneimittel- oder Geräteherstellern bekannt zu geben.
• 8,6% stimmten schließlich dem Prinzip, Patientendaten unter allen Umständen vertraulich zu behandeln, nur mit Einschränkungen oder gar nicht zu.
• 11% sagten, sie hätten innerhalb des letzten Jahres einem Patienten oder dem Erziehungsberechtigten eines Kindes wenigstens selten oder auch manchmal oder oft etwas Unwahres gesagt.
• Bei der sicherlich heikelsten Situation in einer Arzt-Patient-Beziehung, der Kommunikation einer Erkrankungsprognose, sagten 55,2% der ÄrztInnen, sie hätten dabei selten, manchmal oder oft eine Darstellung gewählt, welche die Prognose positiver darstellt als es sachlich gerechtfertigt gewesen war.
• Aus Angst verklagt zu werden, teilten 19,9% der Befragten den entsprechend betroffenen Patienten nur selten, manchmal oder oft nicht mit, dass ein Fehler gemacht wurde.
• Im Zeitalter der besonderen Bedeutung von Datenschutz besonders diskutierenswert: 28,4% der ÄrztInnen räumten ein, selten, manchmal oder auch oft einer dazu nicht berechtigten Person absichtlich oder unabsichtlich Gesundheitsinformationen über einen ihrer Patienten preisgegeben zu haben.
Trotz einiger Begrenzungen der Studie (z.B. durch die immer noch nicht sehr hohe Beteiligungsrate oder die Wahrscheinlichkeit von positiv verzerrten Antworten), zeigen ihre Ergebnisse, dass es bei unwahrhaftigem Verhalten von Ärzten nicht nur um eine Handvoll "schwarzer Schafe" unter ihnen und auch nicht nur um ein paar "misstrauische" oder unter Verfolgungswahn leidende PatientInnen geht, die nicht nach den allgemein anerkannten professionellen Regeln handeln oder behandelt werden.
Es geht den AutorInnen nicht darum, bei dieser Transparenz oder beim An- und Wehklagen stehen zu bleiben. Eine solche Transparenz, und auch nur sie schiebt vielmehr den notwendigen Prozess an, die Arzt-Patientbeziehung so vertrauensvoll zu gestalten, dass beide nicht weiter glauben, sich entweder unwahrhaft oder misstrauisch und angstvoll verhalten zu müssen.
Nur wer glaubt, deutsche ÄrztInnen wären radikal anders als ihre us-amerikanischen KollegInnen, kann sich angesichts dieser Zahlen ruhig und selbstzufrieden zurücklehnen und eine vergleichbare Transparenz wie die in den USA in Deutschland für unnötig halten.
Die Studie "Survey Shows That At Least Some Physicians Are Not Always Open Or Honest With Patients" von Lisa I. Iezzoni, Sowmya R. Rao, Catherine M. DesRoches, Christine Vogeli und Eric Campbell ist in der renommierten gesundheitswissenschaftlichen Zeitschrift "Health Affairs" (31, Nr. 2 2012: 383-391) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
In der Literaturliste finden sich eine Menge Hinweise auf eine Reihe klassischer angelsächsischer Texte und Studien (mit Links) zur Patientenzentrierung im Gesundheitswesen und speziell des ärztlichen Handelns. Wer glaubt, die oben genannten Prinzipien seien radikal kann sich durch die Lektüre eines wahrhaften "extremistischen" Textes eines Besseren belehren lassen. Gemeint ist der 2009 in derselben Zeitschrift erschienene Aufsatz (28, no.4 (2009): w555-w565) von DM Berwick "What 'Patient-Centered' Should Mean: Confessions Of An Extremist", der komplett kostenlos erhältlich und sehr lesenswert ist.
Seine drei Kernmaximen für Patientenzentrierung lauten: (1) "The needs of the patient come first."(2) "Nothing about me without me."(3) "Every patient is the only patient."
Bernard Braun, 11.2.12
Ambulant oder teilstationär vor vollstationär - gilt dies auch für die Behandlung von Menschen mit akut-psychiatrischen Störungen?
 Wegen der häufig längeren Behandlungsdauer akuter psychiatrischer Störungen und wegen des Risikos einer zusätzlichen psychischen Belastung der PatientInnen durch Hospitalisierung gibt es verbreitete Kritik an den Kosten und des lebensqualitätsbezogenen Nachteile ihrer stationären Behandlung. Als einer der kräftigsten Nachteile gilt die zu lange Abschottung gegenüber den alltäglichen sozialen Bedingungen, die zwar zum Teil Ursache der psychischen Störung sind, aber Heilung ohne den produktiven Umgang mit ihnen aber schwierig ist. Als Alternative wird immer wieder eine Behandlung in Tageskliniken als einer Form der nur partiellen Hospitalisierung diskutiert und erprobt. Ob dies wirklich die erwarteten Vorteile hat oder gar schadet untersucht ein im Dezember 2011 veröffentlichter systematischer Cochrane-Review von zehn randomisierten kontrollierten Studien mit an akuten psychiatrischen Störungen leidenden 2.685 TeilnehmerInnen im Alter von 18 bis 65 Jahren. Ausgeschlossen waren nicht nur Studien mit TeilnehmerInnen in dem genannten Alter, sondern auch solche Studien, deren TeilnehmerInnen wegen eines Substanzmissbrauchs oder einer hirnorganischen Störung in Behandlung waren.
Wegen der häufig längeren Behandlungsdauer akuter psychiatrischer Störungen und wegen des Risikos einer zusätzlichen psychischen Belastung der PatientInnen durch Hospitalisierung gibt es verbreitete Kritik an den Kosten und des lebensqualitätsbezogenen Nachteile ihrer stationären Behandlung. Als einer der kräftigsten Nachteile gilt die zu lange Abschottung gegenüber den alltäglichen sozialen Bedingungen, die zwar zum Teil Ursache der psychischen Störung sind, aber Heilung ohne den produktiven Umgang mit ihnen aber schwierig ist. Als Alternative wird immer wieder eine Behandlung in Tageskliniken als einer Form der nur partiellen Hospitalisierung diskutiert und erprobt. Ob dies wirklich die erwarteten Vorteile hat oder gar schadet untersucht ein im Dezember 2011 veröffentlichter systematischer Cochrane-Review von zehn randomisierten kontrollierten Studien mit an akuten psychiatrischen Störungen leidenden 2.685 TeilnehmerInnen im Alter von 18 bis 65 Jahren. Ausgeschlossen waren nicht nur Studien mit TeilnehmerInnen in dem genannten Alter, sondern auch solche Studien, deren TeilnehmerInnen wegen eines Substanzmissbrauchs oder einer hirnorganischen Störung in Behandlung waren.
Die wesentlichen Ergebnisse des Reviews waren auf der Basis von jeweils unterschiedlich vielen und uzmfangreichen RCTs:
• Zwischen der stationären und Tagesklinik-Population gab es ein Jahr nach Beginn der Intervention keinen Unterschied beim Verlust von TeilnehmerInnen.
• TagesklinikpatientInnen brauchen signifikant mehr Behandlungstage als vollstationär behandelte PatientInnen.
• Es gibt keinen signifikanten Unterschied beim Risiko der Wiedereinweisung in eine erneute stationäre oder Tagesklinikbehandlung. Beim Vergleich dieses wichtigen Indikators für Egebnisqualität bei Tagesklinikpatienten gegenüber Patienten mit einem radikalen stationären Kriseninterventionsansatz zeigt sich allerdings ein deutlicher Nachteil der Tagesklinikbehandlung.
• Weder bei dem Risiko nach Beendigung der Behandlung arbeitslos zu sein/werden, der Lebensqualität noch bei der Zufriedenheit mit der Behandlung gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen den TeilnehmerInnen der beiden Behandlungsformen.
• Dies bedeutet nicht, dass alle PatientInnen eigentlich in Tageskliniken behandelt werden könnten. Wenigstens 20% (dieser Wert schwankt je nach Studie zwischen 18,4% und 39,1%) der bisher stationär eingewiesenen PatientInnen könnten aber, so die Cochrane-Reviewer, nach der Studienlage in einer akut ausgerichteten Tagesklinik behandelt werden. Und wörtlich: "Day hospitals are a less restrictive alternative to inpatient admission for people who are acutely and severely mentally ill."
Angesichts der längeren Behandlungsdauer in Tageskliniken relativieren die Reviewer ihre Bewertung aber selber und machen sie letztendlich von weiteren Daten über die Kosteneffektivität der Tagesklinikbehandlung abhängig.
Eine elementare Frage, die von Praktikern der psychiatrischen Behandlung aufgeworfen wird, ist, ob RCTs die allein angemessene und aussagekräftige Methodik sind, um den Nutzen der unterschiedlichen Möglichkeiten der Behandlung psychisch Kranker ermitteln und bewerten zu können. Sie machen darauf aufmerksam, dass psychisch Kranke wesentlich heterogenere Problemlagen aufweisen und unterschiedlicher Lösungswege und Behandlungsmethoden bedürfen als somatisch Kranke, bei denen z.B. der Nutzen unterschiedlicher medikamentöser Behandlungen in RCTs untersucht wird. Wie aber die unterschiedlichen Bedürfnisse psychisch Kranker aussehen und wie Behandlungsformen aussehen müssen, die sich nicht bewusst oder unbewusst einer primär an Patienteninteressen orientierten Überprüfung ihres Nutzens oder ihrer Wirksamkeit entziehen, zeigen weder der Cochrane-Review noch die kritischen Stimmen über ihn. Darüber mehr zu wissen ist aber wahrscheinlich wichtiger als die Kostenfrage.
Der wie gewohnt umfangreiche Abstract zu dem Cochrane-Review (Cochrane Database Syst Rev. 2011, 7. Dezember) Day hospital versus admission for acute psychiatric disorders" von Marshall M, Crowther R, Sledge WH, et al. ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.1.12
Avastin bei Eierstockkrebs: Länger leben ohne Krankheitsverschlimmerung aber mit Nebenwirkungen und insgesamt nicht länger!?
 Während der Pharmakonzern Roche pünktlich vor Weihnachten 2011 von der "European Medicines Agency (EMA)" die Zulassung ihres Medikaments Avastin für die Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt, zögert das us-amerikanische Tochterunternehmen Genentech nach einem Gespräch mit der US-Zulassungsbehörde "Food and Drug Administration (FDA)" und dem Vorliegen zweier von ihr mitfinanzierten Studien, die Zulassung in den USA aktiv zu betreiben. Unter der Überschrift "Avastin Disappoints Against Ovarian Cancer" zitiert die Nachrichtenagentur "Associated Press" jedenfalls am 28. Dezember 2011 unwidersprochen einen Sprecher der Firma so: "We do not believe the data will support approval".
Während der Pharmakonzern Roche pünktlich vor Weihnachten 2011 von der "European Medicines Agency (EMA)" die Zulassung ihres Medikaments Avastin für die Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt, zögert das us-amerikanische Tochterunternehmen Genentech nach einem Gespräch mit der US-Zulassungsbehörde "Food and Drug Administration (FDA)" und dem Vorliegen zweier von ihr mitfinanzierten Studien, die Zulassung in den USA aktiv zu betreiben. Unter der Überschrift "Avastin Disappoints Against Ovarian Cancer" zitiert die Nachrichtenagentur "Associated Press" jedenfalls am 28. Dezember 2011 unwidersprochen einen Sprecher der Firma so: "We do not believe the data will support approval".
Die Zulassung und Verordnung des Krebsmedikaments Avastin zur Behandlung unterschiedlicher Krebsarten entwickelt sich somit in kürzester Zeit zu einem Lehrstück über verschiedene interregionale Besonderheiten und Probleme der Arzneimittelzulassung und die unterschiedliche Bewertung des Nutzens solcher mit großen Heilungserwartungen entwickelten und vermarkteten Medikamente.
Über den ersten dramatischen Akt dieses Lehrstücks im Bereich der Behandlung von metastasierten Brustkrebs berichteten wir im "forum-gesundheitspolitik" bereits ausführlich. Nach langer fachlicher Debatte zog die FDA für die USA die Anerkennung von Avastin als dafür geeignetes Arzneimittel mit der offiziellen Begründung zurück: "There is no benefit to breast cancer patients that would justify its risks." Trotzdem ist Avastin in Europa auch weiter für die Behandlung von Brustkrebspatientinnen zugelassen.
Im zweiten, wiederum überwiegend in den USA spielenden Akt, verschließen selbst die Hersteller des Medikaments nicht ihre Augen vor den Ergebnissen zweier am 29. Dezember 2011 im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichten und von ihnen mitfinanzierten Studien über die empirischen gesundheitlichen Effekte einer Behandlung von Eierstockkrebs mit Avastin.
Man unterscheidet dabei zwei Wirkungen: Um wieviel die progressionsfreie, d.h. ohne Verschlimmerung der Erkrankung erlebbare Zeit verlängert und um wieviel Wochen, Monate oder auch Jahre das Gesamtüberleben nach dem Erstauftritt der Erkrankung verlängert wird. In beiden Fällen muss abgewogen werden, welche zusätzlichen gesundheitlichen Risiken oder gravierenden Nebenwirkungen mit der Einnahme des Medikaments verbunden sind und möglicherweise die sonstige Lebensqualität gewaltig verschlechtern.
Die doppelblinde, placebokontrollierte Studie von Burger et al. mit 1.873 teilnehmenden Frauen mit Eierstockkrebs untersuchte als primären Endpunkt ihrer Intervention das progressionsfreie Überleben durch das während der Chemotherapie und den 10 Monaten nach ihrer Beendigung eingenommene Avastin.
Das Ergebnis weist für die mit einer Standardchemotherapie und einem Placebo behandelte Kontrollgruppe von Partientinnen 10,3 Monate progressionsfreies Überleben nach. In der Gruppe, die zu allen Zeitpunkten ihrer Behandlung Avastin erhielt, betrug diese Zeit 14,1 Monate. Avastin verlängerte also wahrscheinlich diese Art des Überlebens um 4 Monate. Auf der Schattenseite war die Rate derjenigen Angehörigen der Avastin-Gruppe, die sich wegen höheren Blutdrucks und schweren Magen-/Darmstörungen behandeln lassen mussten, signifikant höher als in der Kontrollgruppe.
Auch in der zweiten Studie (Perren et al.) mit 1.528 Frauen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung ihrer Eierstöcke von wurde primär die Verlängerung des progressionsfreien Lebens untersucht. 36 Monate nach Beginn der Therapie fanden die ForscherInnen in der Kontrollgruppe mit Chemotherapie und ohne Avastin ein progressionsfreies Überleben von 20,3 Monaten und von 21,8 Monaten in der Avastin-Gruppe. Der Unterschied war statistisch signifikant. In einer zusätzlichen Analyse nach 42 Monaten betrug das progressionsfreie Überleben in der Kontrollgruppe 22,4 Monate und lag in der Avastingruppe bei 24,1 Monate. Auch wenn sich die Abstände der progressionsfreien Zeiten zwischen den beiden Gruppen gegenüber der ersten Studie verringert hatten, war der Unterschied immer noch statistisch signifikant. Zu den letztlich nicht eindeutig kausal zu klärenden Beobachtungen dieser Studie gehört, dass die Wirkung von Avastin, das progressionsfreie Überleben zu verlängern, nicht zu jedem Zeitpunkt der Studie existierte. Während die Wirkung nach 12 Monaten der Intervention eindeutig auftrat, war sie nach 24 Monaten so schwach, dass die Chance des progressionsfreien Überlebens für die Nutzerinnen der Standardtherapiegruppe sogar leicht höher war.
Auch bei den Teilnehmerinnen dieser Studie traten eine Reihe der bereits genannten Art in schwerem Maße wie z.B. schwerer Bluthochdruck auf.
Auch wenn beide ForscherInnen-Gruppen nicht das Gesamtüberleben als primären Endpunkt der Avastin-Intervention untersuchten bzw. Burger et al. sogar während der laufenden Studie auf diesen Endpunkt zugunsten des progressionsfreien Überlebens verzichteten, muss man auf gesicherte Daten darüber, ob Avastin das Gesamtüberleben verlängert bei Perren et al. noch bis 2013 warten. Burger et al. liefern eher nebenbei einige Daten, die belegen, dass Avastin die Chance, die Erkrankung insgesamt zu überleben, nicht erhöht bzw. Unterschiede nicht signifikant sind. Angehörige der Placebo-Kontrollgruppe überlebten danach 39,3 Monate, die nur zeitweise mit Avastin behandelten Frauen 38,7 Monate und die in der gesamten Behandlungszeit auch mit Avastin behandelten Frauen 39,7 Monate. Wenn also eine Behandlung mit Avastin überhaupt das Gesamtüberleben verlängert, ist der maximale Lebensgewinn 12 Tage.
Das Lehrstückhafte der aktuellen Debatten über und Entscheidungen zu Avastin besteht u.E. darin; dass sich in diesem Zusammenhang nicht zum ersten Mal einige bedeutende und schwierige Fragen aufdrängen: Was ist der Grund für die beträchtlichen Bewertungsunterschiede des Nutzens von bestimmten Therapien zwischen europäischen und us-amerikanischen Arzneimittel-Zulassungsinstitutionen? Warum bewerten die europäischen Experten die Studienlage, die z.B. in den USA zu einem einstimmigen Urteil über den mangelnden Nutzen von Avastin zur Brustkrebsbehandlung beigetragen hat, völlig anders? Warum freuen sich Vertreter des Herstellers Roche auf der Grundlage ein- und desselben Wissens über die Zulassung von Avastin zur Eierstockkrebstherapie in Europa und scheuen andere Vertreter des Unternehmens in den USA davor zurück, das Mittel dort für diese Indikation zuzulassen? In beiden Ländern generiert ein Jahr Behandlung mit Avastin im Übrigen einen Umsatz von rund 100.000 US-Dollar.
Noch drängender sind Fragen, wie im Rahmen der "evidence-based-medicine"-Orientierung neben der wissenschaftlichen Evidenz für den Nutzen einer Behandlung gleichrangig die "patient values" aussehen bzw. erfasst werden können: Welche "Überlebens"-Variante ist aus Sicht der Kranken wichtiger: die möglichst lange Zeit der Nichtverschlimmerung oder des Nichtwiederauftretens einer Erkrankung nach ihrem ersten Auftreten oder das möglichst lange Überleben der Erkrankung? Bei welchen Größenordnungen (z.B. wenige Monate und wenige Tage) von positiven Wirkungen im Bereich des progressionsfreien oder Gesamtüberlebens nehmen PatientInnen das Risiko von schweren Nebenwirkungen in Kauf und ist die Therapie mit Mitteln wie Avastin aus Patientensicht gerechtfertigt? Ist die Annahme, Kranke griffen zu jedem "Strohhalm", der ihnen Hilfe verspricht, "koste es, was es wolle", wirklich realistisch
Antworten erhält man darauf mit Sicherheit nicht mit noch so aufwändigen "hazard of death"-, "Was-wäre-wenn"- oder Survival-Analysen, sondern wahrscheinlich nur durch qualitative Studien, in denen die letztlich entscheidenden Wahrnehmungen, Entscheidungskalküle und Erfahrungen der betreffenden Patientinnen ernst genommen und systematisch erhoben werden.
Von den am 29. Dezember 2011 veröffentlichten Studien "Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer" von Robert A. Burger et al. (New England Journal of Medicine 2011; 365: 2473-2483) und "A Phase 3 Trial of Bevacizumab in Ovarian Cancer" von Timothy J. Perren et al. (New England Journal of Medicine 2011; 365: 2484-2496) sind Abstracts erhältlich.
Bernard Braun, 6.1.12
"Der Patient steht im Mittelpunkt" … der dritten Reihe. Prioritäten im Reporting und Benchmarking von Krankenhäusern
 Egal, ob Krankenhäuser im Zusammenhang mit einer möglichen Privatisierung, wegen unerwünschter Todesfälle unter PatientInnen oder durch "rollende Köpfe" öffentlich ins Gerede kommen, stellt sich auch die Frage, welche Aspekte des sozialen Systems Krankenhaus eigentlich für die Führungskräfte des Krankenhauses wichtig sind und aufbereitet werden und welche Informationen und Benchmarking-Indikatoren in der Steuerung die wichtigste Rolle spielen, und auf dem "Chef-Schreibtisch" landen.
Egal, ob Krankenhäuser im Zusammenhang mit einer möglichen Privatisierung, wegen unerwünschter Todesfälle unter PatientInnen oder durch "rollende Köpfe" öffentlich ins Gerede kommen, stellt sich auch die Frage, welche Aspekte des sozialen Systems Krankenhaus eigentlich für die Führungskräfte des Krankenhauses wichtig sind und aufbereitet werden und welche Informationen und Benchmarking-Indikatoren in der Steuerung die wichtigste Rolle spielen, und auf dem "Chef-Schreibtisch" landen.
Etwas Licht verschaffen die Ergebnisse zweier kleiner, wahrscheinlich nichtrepräsentativen Befragungen: 184 leitende Mitglieder von Krankenhausverwaltungen (Rücklauf 31%) wurden zur Ausgestaltung des Reportings in ihren Einrichtungen gefragt und 97 Chefärzten in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie (Rücklaufquote 53%) wurden u.a. Fragen zur Identifikation mit dem Krankenhaus und Beruf sowie der wahrgenommenen Nützlichkeit von Berichten und Kennzahlen gestellt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Krankenhäuser steuern vor allem durch die Aufbereitung und Kommunikation von "Zielen zu abrechnungsrelevanten medizinischen Leistungskennzahlen, wie etwa Case-Mix-Index oder Fallzahlen."
• Danach kommen die Aufbereitung und praktische Nutzung von Daten zur Verweildauer von Patienten und durchschnittlichen Auslastung des Krankenhauses - alsao Effizienzkennzahlen. Ergänzt werden diese Daten durch Finanzkennzahlen zu den Einnahmen und Ausgaben.
• Qualitätskennzahlen wie die "Patientenzufriedenheit oder (die) Beachtung von Qualitätsmaßstäben … spielen eine eher untergeordnete Rolle."
• Die abrechnungsrelevanten medizinischen Leistungskennzahlen und die Effizienzkennzahlen werden in über 90% der Krankenhäuser wenigstens monatlich berichtet und wenigstens einmal jährlich gibt es hierzu Benchmarking-Daten. Finanzkennzahlen und mit Sicherheit auch Qualitätskennzahlen werden von weniger Krankenhäuser und dann vermutlich auch wesentlich seltener berichtet.
• Die befragten Chefärzte messen sämtlichen Indikatoren einen geringen Stellenwert zu. Auf die Frage, welche der Kennzahlen für sie als Arzt wichtig sind, sagen ein Drittel (ob immerhin oder nur, ist mangels Referenzdaten schwer zu sagen), dies träfe für die Qualitätskennzahlen zu, also z.B. für die Patientenzufriedenheit. Finanzkennzahlen sehen nur noch 10% der Chefärzte positiv.
• Regelmäßige aber "wohldosierte" bzw. nicht zu häufige Benchmarking-Informationen tragen nach Meinung der Autoren des Reporting-Aufsatzes "zu einer positiven sozialen Austauschbeziehung" bei, weil sich "die Mitarbeiter … unterstützt (fühlen)."
• Ein weiteres nicht genauer belegtes Fazit: "Erfolgreiche Krankenhäuser setzten Benchmarking-Informationen deutlich häufiger und umfänglicher ein als ihre weniger erfolgreichen Konkurrenten." Welche Indikatoren dies waren oder sind und welcher Art die Erfolge sind, wird ebenfalls nicht genauer berichtet.
Zu dem Aufsatz "Reporting in deutschen Krankenhäusern - die Bedeutung von Benchmarking-Informationen" von Matthias Mahlendorf und Fabian Kleinschmidt (ZfCM/Controlling & Management 55. Jg. 2011, Heft 4: 216-223), der diese Einblicke in eine ansonsten relativ intransparente Ecke des Gesundheitswesens vermittelt, gibt es kostenlos leider nur ein mageres thesenartiges Abstract.
Warum dies ausgerechnet bei einem Aufsatz über mehr und bessere Transparenz aus dem "Institut für Management und Controlling" der privaten Otto Beisheim School of Management so ist, wirft ein seltsames Licht auf das dort herrschende Verständnis von Berichterstattung.
Bernard Braun, 20.11.11
96,4% des in NRW untersuchten Mastgeflügels mit Antibiotika behandelt. Nie erfolgte dies in Kleinbetrieben mit längerer Mastdauer.
 Auch wenn jetzt der öffentliche Aufschrei auf einen am 14. November 2011 veröffentlichten Bericht des NRW-Verbraucherschutzministeriums groß ist und eigentlich alle Beteiligten, Verantwortlichen und Betroffenen "rasche und entschiedene Maßnahmen" fordern: Das Problem des Antibiotika-Einsatzes in der Tierzucht und das der wachsenden Anzahl der u.a. dadurch resistent gewordenen Krankheitserreger ist mindestens schon zwei, drei Jahrzehnte bekannt und taucht etwa zusammen oder in bunter Reihe mit dem Tranquilizereinsatz bei Schweinen und weiteren vergleichbaren Tierpharma-Usancen regelmäßig im Skandal-Zirkus auf. Genauso regelmäßig verschwindet aber der Skandal wieder, nicht ohne Appelle und Versprechungen der Mastbetriebe, ihren Verbänden und den approbierten Pharmadealern, so etwas nie wieder zu tun.
Auch wenn jetzt der öffentliche Aufschrei auf einen am 14. November 2011 veröffentlichten Bericht des NRW-Verbraucherschutzministeriums groß ist und eigentlich alle Beteiligten, Verantwortlichen und Betroffenen "rasche und entschiedene Maßnahmen" fordern: Das Problem des Antibiotika-Einsatzes in der Tierzucht und das der wachsenden Anzahl der u.a. dadurch resistent gewordenen Krankheitserreger ist mindestens schon zwei, drei Jahrzehnte bekannt und taucht etwa zusammen oder in bunter Reihe mit dem Tranquilizereinsatz bei Schweinen und weiteren vergleichbaren Tierpharma-Usancen regelmäßig im Skandal-Zirkus auf. Genauso regelmäßig verschwindet aber der Skandal wieder, nicht ohne Appelle und Versprechungen der Mastbetriebe, ihren Verbänden und den approbierten Pharmadealern, so etwas nie wieder zu tun.
Ein Indiz für das Dauerproblem sind die mit einer Ausnahme auch in den letzten Jahren stetig gegenüber dem Vorjahr steigenden Mengen von für die "Tiergesundheit" eingesetzten Antibiotika: Für das Jahr 2005 schätzte der Bundesverband für Tiergesundheit und berichtete am 1. September 2011 die Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen, dass 784,4 Tonnen Antibiotika verabreicht worden sind. Das war gegenüber 2004 eine Zunahme um 8,8%. 2006 stieg der Verbrauch um 7%, 2007 um 9,2%, 2008 um 1%, um 2009 sogar einmal um 2,5% abzunehmen, die aber 2010 durch eine erneute Zunahme um 2% zum größten Teil wieder aufgeholt wurde. Bisher wurde aber von Seiten der Politik wenig getan, um das datengestützte Problembewusstsein zu fördern. In der seit Januar 2011 geführten bundeseinheitlichen DIMDI-Datenbank zu den nach Postleitzahlen aufgeschlüsselten Arzneimittelverwendungen war und ist die Geflügelwirtschaft ausgenommen.
Der Untersuchung des "Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen" liegen die "Daten von 962 Mastdurchgängen und von 182 verschiedenen Betrieben in NRW innerhalb des Zeitraums von Februar bis Juni 2011" zugrunde. Die amtlichen Experten halten dies, ohne dass ihnen bisher jemand direkt widersprach, für eine "belastbare Datengrundlage". Nebenbei erfährt man, dass allein in den nordrhein-westfälischen Hühnermastbetrieben jährlich fast 57 Millionen Tiere gehalten und geschlachtet werden. Die Betriebsgröße schwankt zwischen 3.400 und 170.000 Tieren.
Das Fazit der 10-seitigen Expertise ist an Deutlichkeit nicht zu übertreffen und lautet im Wortlaut:
• "Die Haltung von Masthühnern erfolgte bei 163 (17 %) aller Mastdurchgänge bzw. in 18 (10 %) der ausgewerteten Betriebe durchgehend ohne den Einsatz von antimikrobiellen Substanzen. Auffallend ist, dass auf diesen 10 % der Betriebe lediglich 3,6 % der Tiere gehalten wurden, also 96,4% der Masthühner einer antibiotischen Behandlung unterzogen wurden."
• "Bei den erfassten Mastdurchgängen mit Antibiotikaeinsatz kam eine Vielzahl von Wirkstoffen zum Teil zeitgleich zum Einsatz (1-8 Wirkstoffe pro Mastdurchgang) und die jeweilige Behandlungsdauer eines Wirkstoffes lag bei 53 % (924 von 1748) der Behandlungen mit 1-2 Tagen deutlich unter den Zulassungsbedingungen der verabreichten Wirkstoffe." Dies ist vor allem deshalb gefährlich, weil durch diese zu kurze Behandlung Bakterien Resistenzen entwickeln können.
• "Bei kleinen Betrieben (<20.000 Tiere) und bei einer Mastdauer >45 Tage wurde eine signifikant geringere Behandlungsintensität (Dauer, Anzahl der Wirkstoffe) festgestellt. Ein genereller Zusammenhang zwischen Behandlungsintensität und Betriebsgröße war auf Basis der Einzelbetriebsdaten dagegen nicht erkennbar."
• "Die dargestellte Situation, wonach über 96 % der Masthühner behandelt werden, ist nicht akzeptabel und legt den Schluss nahe, dass das Haltungssystem nicht den Vorgaben des Tierschutzgesetzes entspricht, da die angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung in Frage gestellt werden muss."
Unklar bleibt, ob der Antibiotika-Einsatz als Wachstumsförderung stattfindet, und damit seit 2006 ausdrücklich verboten ist, oder als Gesundheitsförderung bzw. Krankheitsprophylaxe. Angesichts der oberen Betriebsgrößen und dem damit verbundenen Risiko einer Masseninfektion aufgrund der Massenhaltung, dürfte letzteres das Hauptmotiv für den Antibiotika-Einsatz sein.
Die Reaktion des "Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft" und des "Deutschen Bauernverbandes" ist als Musterbeispiel für Problemvernebelung lesenswert: Natürlich "nehmen (wir) diese Ergebnisse sehr ernst" und starten jetzt "in enger Abstimmung mit der Tierärzteschaft ein Monitoring-Programm innerhalb des QS-Systems". Dabei geht es aber lediglich darum, dass der "im EU-Vergleich ohnehin niedrige Antibiotika-Einsatz weiter minimiert" wird. Und im Übrigen könne trotz "der ermittelten Antibiotikagaben Geflügelfleisch bedenkenlos verzehrt werden". Deswegen und aus ein paar Gründen mehr "sollte die Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen über den Antibiotika-Einsatz beim Hähnchen auch nicht im Zusammenhang mit dem Thema Antibiotikaresistenzen missbraucht werden."
Und wer ein großes Merkzettelbrett hat, sollte die folgende Schlusspassage der Verbändeerklärung mindestens 5 Jahre lang dort hängen lassen: "'Die Ergebnisse der Studie (aus NRW) machen einmal mehr deutlich, dass eine verlässliche Auswertung vorhandener Daten bisher nicht möglich ist - das muss nun unverzüglich angegangen werden', fordert DBV-Generalsekretär Dr. Born. Die Wirtschaft ergreift daher die Initiative und hat die Etablierung eines eigenen Monitoringsystems für Antibiotikagaben in der Geflügelaufzucht in die Wege geleitet. Eine Meldepflicht besteht ohnehin schon: DBV und ZDG machen deutlich, dass bereits seit zehn Jahren alle tierhaltenden Betriebe in Deutschland verpflichtet sind, jeden Einsatz von Tierarzneimitteln zu dokumentieren. Zudem müssen die Betriebsleiter den Amtsveterinären jederzeit Einsicht in diese Unterlagen geben. Darüber hinausgehend soll das von der Geflügelwirtschaft initiierte QS-Monitoring eine verlässliche bundesweite Auswertung als Grundlage für eine Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes liefern: So hat sich die deutsche Geflügelwirtschaft auf die Zielvereinbarung verständigt, durch Verbesserungen im Tierhaltungsmanagement den Antibiotika-Einsatz in den kommenden fünf Jahren um 30 Prozent zu verringern.
Den "Abschlussbericht. Evaluierung des Antibiotikaeinsatzes in der Hähnchenhaltung gibt es kostenlos herunterzuladen.
Und wem bisher nicht der Appetit vergangen ist: Weitere Informationen, Debatten und Erklärungen aus den letzten Jahren und diverse Links findet man auf der Antibiotika-Themenseite des Verbraucherschutzministeriums. Zwei Beispiele: "Mehr Gewicht in kürzerer Zeit: Um 1,6 Kilogramm zuzunehmen brauchte ein Masthähnchen 1970 noch 48 Tage. 2007 waren es nur noch 27 Tage" und "Zwischen 1985 und 2007 stieg das durchschnittliche Gewicht bei Masthähnchen um 61 Prozent."
Bernard Braun, 16.11.11
Online-Cochrane-Summaries evidenter Erkenntnisse für BürgerInnen in Kanada: Hilfreich aber für viele immer noch nicht ausreichend.
 Die insbesondere unter jüngeren BürgerInnen und PatientInnen immer häufiger genutzte Quelle für gesundheits- und behandlungsbezogene Informationen hat häufig den Nachteil falsche, qualitativ minderwertige und ungesicherte oder unverständliche Informationen zu liefern, die aber als solche für Durchschnitts-NutzerInnen nicht erkennbar sind. Falsch, schlecht oder Viertels-Informierte riskieren spätestens dann, wenn sie ihr ersurftes Wissen in die Kommunikation z.B. mit Ärzten einbringen, ihr blaues Wunder und werden sich dies - unabhängig davon, ob die Informationen von Ärzten wirklich arg viel besser sind - nicht noch einmal antun wollen. Eine Reihe von Patientenorganisationen, Krankenkassen oder mit Leitlinien befassten Fachgesellschaften versuchen seit einiger Zeit, die gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse bzw. Evidenzwissen speziell für PatientInnen und Versicherte aufzubereiten und diese für die veränderten und effektiveren Arzt-Patient-Kommunikation à la informed consent und shared decision making kognitiv auszustatten.
Die insbesondere unter jüngeren BürgerInnen und PatientInnen immer häufiger genutzte Quelle für gesundheits- und behandlungsbezogene Informationen hat häufig den Nachteil falsche, qualitativ minderwertige und ungesicherte oder unverständliche Informationen zu liefern, die aber als solche für Durchschnitts-NutzerInnen nicht erkennbar sind. Falsch, schlecht oder Viertels-Informierte riskieren spätestens dann, wenn sie ihr ersurftes Wissen in die Kommunikation z.B. mit Ärzten einbringen, ihr blaues Wunder und werden sich dies - unabhängig davon, ob die Informationen von Ärzten wirklich arg viel besser sind - nicht noch einmal antun wollen. Eine Reihe von Patientenorganisationen, Krankenkassen oder mit Leitlinien befassten Fachgesellschaften versuchen seit einiger Zeit, die gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse bzw. Evidenzwissen speziell für PatientInnen und Versicherte aufzubereiten und diese für die veränderten und effektiveren Arzt-Patient-Kommunikation à la informed consent und shared decision making kognitiv auszustatten.
Welche Qualität solche "Listen", "Navigatoren", Patientenleitlinien oder "consumer summaries" von Studien der evidence based medicine (EBM) haben und wie sie vor allen Dingen bei den anvisierten NutzerInnen ankommen, weiß man nicht wirklich.
Deshalb sind die Ergebnisse einer Studie von enormer Wichtigkeit, die zum einen den Prozess der Erstellung der in Kanada bereits über 15 Jahre existierenden patientenzentrierten Online-Summaries der vorhandenen wissenschaftlich soliden systematischen Reviews durch die "Cochrane Musculoskeletal Group's" darstellt und untersucht. Die speziellen "summaries" beschäftigen sich beispielsweise mit folgenden Fragen: "Does exercise help osteoarthritis of the Hip or knee", oder "Does ultrasound therapy work to treat osteoarthritis of the knee?" Die Cochrane-Reviews sind die qualitativ hochwertigsten Informationsquellen über EBM, als solche aber für die Mehrheit der PatientInnen nicht verständlich genug. Zum anderen untersucht die hier zitierte Studie ob und wie die Nutzer dieser u.a. von Patienten oder Konsumenten mitgestalteten Summaries sie bewerten oder welche Eindrücke PatientInnen davon haben.
Dazu wurden zwischen dem August 2005 und dem Februar 2006 NutzerInnen der Summaries auf verschiedenen Websites (z.B. die der kanadischen "Arthritis Society" und der "Canadian Arthritis Patient Alliance") in einem Online-Survey nach dem Hintergrund ihres Interesses, dem Zusammenhang von Information und Behandlungsentscheidungen, ihrer Zufriedenheit mit der Vorbereitung auf eine gemeinsame Entscheidungsfindung und ihren Vorschlägen zur Verbesserung der "summaries" gefragt.
Von den insgesamt 261 AntworterInnen waren 87% mit einer arthritischen Erkrankung in Behandlung.
Ihre Wahrnehmung und Bewertung der auf den besagten "summaries" basierenden Informationen sahen so aus:
• 68% der AntworterInnen bewerteten die Information als sachlich angemessen.
- 61% meinen, diese Informationen seien auch für andere nützlich.
• 61% fanden die Machart der "summaries" gut und 60% sagten, es wäre leicht gewesen, das Nötige zu lernen und für 59% der Leser waren die Informationen nützlich.
• Nur 45% der Befragten stimmten aber der Position zu, sie hätten alle Informationen, die sie brauchten auch einfach finden können.
• 31% waren nicht in der Lage zu beurteilen, ob die Informationsanbieter verlässlich sind und 26% waren unfähig zu entscheiden, ob die in den "summaries" präsentierten Informationen wirklich die besten verfügbaren sind.
• 40% benötigen auch nach der Lektüre mehr Information über ihre Behandlung. Jeweils 15% wollten noch mehr über die Behandlungsrisiken und über Forschungsdetails wissen. 20% benötigen ein noch interaktiveres und modular aufgebautes Websiteangebot.
Die AutorInnen räumen zwar Grenzen der Repräsentativität ein, erstellen aber trotzdem u.a. Ratschläge wie die "summaries" argumentativ und hinsichtlich ihres Layouts künftig besser zu gestalten sind.
Der 13 Seiten umfassende Aufsatz "Presenting Evidence to Patients Online: What Do Web Users Think of Consumer Summaries of Cochrane Musculoskeletal Reviews? von Jamie C Brehaut, Nancy Santesso, Annette M O'Connor, Alison Lott, Gitte Lindgaard, Ania Syrowatka, Ian D Graham und Peter S Tugwell ist im Januar 2011 in der Zeitschrift "Journal of Medical Internet Research" erschienen und in der HTML-Version komplett kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 16.11.11
Welchen Nutzen hat die Behandlung von kranken Menschen statt von Krankheiten?
 Als patientenzentriert gilt eine Behandlung, in der die Ärzte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Behandlungsplan entwickeln und sich dabei bemühen, sämtliche Ressourcen der Krankheitsgeschichte des Patienten zu nutzen aber auch mögliche persönliche Hindernisse für die Behandlung zu berücksichtigen. Ob es sich dabei vor allem um einen Beitrag zum Wohlfühlen beider Seiten handelt oder um mehr, sollte eine von 2008 bis 2010 in Schweden durchgeführte kontrollierte Vorher-Nachher-Studie über die Ergebnisse der stationären Behandlung von 248 PatientInnen mit chronischer Herzschwäche herausbekommen.
Als patientenzentriert gilt eine Behandlung, in der die Ärzte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Behandlungsplan entwickeln und sich dabei bemühen, sämtliche Ressourcen der Krankheitsgeschichte des Patienten zu nutzen aber auch mögliche persönliche Hindernisse für die Behandlung zu berücksichtigen. Ob es sich dabei vor allem um einen Beitrag zum Wohlfühlen beider Seiten handelt oder um mehr, sollte eine von 2008 bis 2010 in Schweden durchgeführte kontrollierte Vorher-Nachher-Studie über die Ergebnisse der stationären Behandlung von 248 PatientInnen mit chronischer Herzschwäche herausbekommen.
Die Ergebnisse bei den für die Studie ausgewählten Merkmalen der Behandlung sahen so aus:
• Die Herzpatienten mit der vollständig implementierten personenzentrierten Behandlung lagen 2,5 Tage kürzer im Krankenhaus als die "normal" behandelten Patienten in der Kontrollgruppe. Diese Differenz ist statistisch signifikant.
• Bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) sah es bei den personenzentriert Behandelten ebenfalls signifikant besser aus.
• Bei der gesundheitsbedingten Lebensqualität und der Zeit bis zu einem erneuten Krankenhausaufenthalt unterschieden sich die beiden Patientengruppen nach 3 bzw. 6 Monaten nicht bzw. nicht signifikant. Die raschere Entlassung aus dem Krankenhaus wirkt sich also mit Sicherheit nicht negativ auf die gesundheitsbedingte Lebensqualität und die Notwendigkeit eines erneuten Krankenhausaufenthalts aus.
• Die AutorInnen weisen darauf hin, dass die Effekte der personenzentrierten Behandlung je nach Krankheit unterschiedlich sein können. Diese Art der Behandlung reduzierte beispielsweise die Krankenhausliegedauer von älteren Patienten mit einer Hüftfraktur sogar um 50%.
Trotz einiger Probleme bei der Durchführung der Studie wie zum Beispiel der relativ hohen Abbrecherquote während ihrer Laufzeit, hat eine personenzentrierte Behandlung offensichtlich einen mehrfachen Nutzen für die PatientInnen, der allerdings auch einen gewissen Aufwand auf Arzt- und Patientenseite erfordert. Dies führt immerhin dazu, dass nur 60% der Angehörigen der Interventionsgruppe während ihres gesamten Aufenthalts in der Klinik eine konsistent personenbezogene Behandlung erhielten. Dies zeige, so der Studienleiter Ekman, dass "the difficulty of rearranging the healthcare culture since it is based on a person with an illness and not on the person's illness alone. The biggest challenge will be to break the traditional and rigid structure of healthcare."
Von dem am 15. September 2011 im "European Heart Journal" veröffentlichten Aufsatz "Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure - the PCC-HF study" von Inger Ekman at al. ist neben dem Abstract auch die achtseitige komplette Fassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.11
Qualitätsreport in GB: Werden PatientInnen im Krankenhaus respektvoll behandelt und entspricht ihre Ernährung ihren Bedürfnissen?
 Zu den Prüfaufgaben der "Care Quality Commission (CQC)" des "National Health Service" in Großbritannien gehört auch die stichprobenweise Überprüfung, ob und wie insbesondere mit den älteren PatientInnen in Akutkrankenhäusern würdevoll und mit Respekt umgegangen wird und ob ihre Ernährung und die Umstände ihrer Aufnahme ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Zu den Prüfaufgaben der "Care Quality Commission (CQC)" des "National Health Service" in Großbritannien gehört auch die stichprobenweise Überprüfung, ob und wie insbesondere mit den älteren PatientInnen in Akutkrankenhäusern würdevoll und mit Respekt umgegangen wird und ob ihre Ernährung und die Umstände ihrer Aufnahme ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Was mit der dazu gewählten Methode des unangemeldeten Besuchs einer Prüfgruppe aus CQC-Inspektoren, einer praktizierenden erfahrenen Krankenpflegekraft und eines "expert by experience" mit der Behandlung in Krankenhäusern, alles herauzszubekommen ist, zeigt der jüngste Bericht über eine Überprüfung von 100 zufällig ausgewählten Akutkrankenhäusern in England zwischen März und Juni 2011.
Zwei Outcomes standen hier im Mittelpunkt: Der Respekt vor und die Einbeziehung von PatientInnen in die Behandlung (Standard: "People should be treated with respect, involved in discussions about their care and treatment and able to influence how the service is run") und die Übereinstimmung der Nahrungs-/Ernährungsbedürfnissen von PatientInnen mit dem tatsächlichen Ernährungsangebot (Standard: "Food and drink should meet people's individual dietary needs").
Bezogen auf die Standards für das Versorgungsergebnis, stellt sich die Wirklichkeit so dar:
• In 45 der 100 inspizierten Krankenhäuser wurden die PatientInnen mit vollem Respekt und würdevoll behandelt und war auch die Ernährung patientengerecht.
• In weiteren 35 wurden immer noch beide Standards erfüllt, aber je nach Klinik mit Verbesserungsbedarf in einem der beiden Qualitätsbereiche.
• 29 Kliniken oder 20% aller untersuchten Kliniken erfüllten mindestens einen der Standards oder gar beide nicht. Verbesserungen waren entsprechend dringend nötig.
• Betrachtet man nur den Qualitätsstandard des würde- und respektvollen Umgangs mit Patienten, erbrachten 12 der 100 Kliniken nicht akzeptable Leistungen. Dies bedeutete z.B., dass Trennvorhänge zwischen Betten bei Behandlungen im Bett nicht dicht genug schlossen, dass Klingeln außerhalb der Reichweite von Patienten positioniert waren und auf Klingeln sehr langsam reagiert wurde und schließlich das Personal herabsetzend und unpersönlich über oder mit PatientInnen redete.
• Im Bereich der Ernährung erfüllten 15% der Kliniken überhaupt nicht das Qualitätsziel. Die Hauptprobleme waren die fehlende Unterstützung der PatientInnen bei der Essensaufnahme oder die vorschnelle Annahme, ein Teil von ihnen seit körperlich nicht in der Lage, alleine oder auch unterstützt Nahrung aufzunehmen. Außerdem wurden PatientInnen während des Essens unterbrochen oder mussten vom Mittagstisch aufstehen bevor sie mit dem Essen fertig waren. Mangelnde Dokumentation der Aufnahme von Nahrungsmitteln und Getränken verhinderte Fortschrittsmessungen. Mangelnde Umsetzung des Qualitätsstandards führte auch dazu, dass PatientInnen oft nicht in der Lage waren, ihre Hände vor dem Essen zu waschen.
Zum gesamten patientenorientierten Qualitätssicherungsprogramm "Dignity and nutrition inspection programme 2011" gibt es kostenlos einen 30-seitigen nationalen Überblick.
Zusätzlich sind ebenfalls die kompletten Prüfberichte für die 100 Krankenhäuser im Internet für jeden Interessierten herunterladbar.
Bernard Braun, 31.10.11
Merkantilisierung ärztlichen Handelns in USA und Deutschland: Bevorzugung gut zahlender Patienten - Aussperrung zum Quartalsende
 Weltweit haben viele Ärzte kein Problem (mehr) damit, offen zu sagen, dass sie aus finanziellen Gründen bestimmte Patienten oder alle Patienten zu bestimmten Zeiten nicht behandeln. Damit erodiert eines der für Ärzte bisher identitätsstiftenden Selbstverständnisse und eine zentrale Erwartung von Patienten an Ärzte: die selbst durch eigene finanzielle Interessen nicht eingeschränkte Einsatzbereitschaft für kranke Menschen.
Weltweit haben viele Ärzte kein Problem (mehr) damit, offen zu sagen, dass sie aus finanziellen Gründen bestimmte Patienten oder alle Patienten zu bestimmten Zeiten nicht behandeln. Damit erodiert eines der für Ärzte bisher identitätsstiftenden Selbstverständnisse und eine zentrale Erwartung von Patienten an Ärzte: die selbst durch eigene finanzielle Interessen nicht eingeschränkte Einsatzbereitschaft für kranke Menschen.
Jüngstes Beispiel ist der Anteil der niedergelassenen Ärzte in den USA, die auf eine entsprechende Frage im "National Ambulatory Medical Care Survey" angeben, ob sie und wenn ja welche Kranken sie als neue Patienten akzeptieren. Sowohl 1999/2000 als auch 2008/2009 akzeptierten durchschnittlich 95% der ambulanten Ärzte neue Patienten. In beiden Jahren nahm diese Bereitschaft aber vom höchsten Niveau bei den Selbstzahlern über die privat Versicherten, die Mitglieder der "Alten"-Krankenversicherung Medicare bis zu den Mitgliedern der "Armen"-Versicherung Medicaid kräftig kräftig und kontinuierlich ab. Praktisch durch alle Patientengruppen hindurch verringerte sich außerdem die Behandlungsbereitschaft zwischen den beiden Jahren: Der Anteil der Ärzte, die privat Krankenversicherte als Patient akzeptiert sank von 91,5% auf 88,4%, gegenüber Medicare-Versicherten von 85% auf 81,5% und bei Medicaid-Versicherten von 73,5% auf 64,5%.
Der Kurzbeitrag bzw. die Grafik "QuickStats: Percentage of Office-Based Physicians Accepting New Patients, by Types of Payment Accepted — United States, 1999-2000 and 2008-2009 aus dem "Morbidity and Mortality Weekly Report" (MMWR. 2011;60(27): 928) ist in der neuesten Ausgabe von JAMA (2011;306(16): 1758) kostenlos zu finden.
Eine Ärztebefragung (150 Allgemeinärzte/Internisten und 172 Fachärzte), die im Frühjahr des Jahres 2011 in Deutschland stattfand, lieferte eine Reihe von Belegen, dass Ärzte ihre Praxen aus Budgetgründen an den Quartalsenden vorzeitig schließen oder auch Termine mit Kassenpatienten gleich in das nächste Quartal verschieben.
Das Ergebnis fassen die WissenschaftlerInnen so zusammen: "Die vorzeitige Schließung der Praxis am Quartalsende aus Budgetgründen scheint innerhalb der Ärzteschaft kein Tabuthema zu sein. Knapp der Hälfte der APIs (Allgemeinärzte, Pädiater und Internisten) (49%) und der Fachärzte (47%) geht davon aus, dass ihre Kollegen dies tun. Die eigene Praxis vor Quartalsende geschlossen haben in den letzten 12 Monaten 30% der Allgemeinmediziner und 28% der Fachärzte. In beiden Ärztegruppen lehnten je ein Drittel die vorzeitige Schließung kategorisch ab." Und wenn Ärzte schon ihre Praxis vorzeitig schließen, dann im Durchschnitt eine Woche oder länger.
Und weiter: "Die bewusste Verschiebung von Terminen von Kassenpatienten, sofern medizinisch unbedenklich (keine Not- oder Akutfälle), vom Ende des einen Quartals auf den Anfang des nächsten Quartals, ist insbesondere unter Fachärzten (56%; APIs: 33%) eine gängige Praxis. Hingegen ist diese für 41% der APIs keine Option (Fachärzte: 20%)."
Eine rund 30 Seiten lange Zusammenfassung der Ergebnisse der von Psychonomics durchgeführten Studie "Budgetvorgaben, Arbeitsbelastung und Praxisöffnungszeiten am Quartalsende. Online-Befragung von APIs und Fachärzten im Auftrag des AOK-Bundesverbandes ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.10.11
Wie lang und oft sollen der gesundheitliche Nutzen und die aufwandsenkende Wirkung von Patientenzentrierung noch bewiesen werden?
 Die immer wieder in Studien erkannten Mängel in der Dauer und der Art der Kommunikation und der patientenzentrierten Behandlung insgesamt, stellen auch aus Sicht von vielen Ärzten ein Hemmnis für ihre Wirksamkeit, die Therapietreue und die Zufriedenheit von PatientInnen dar. Dass sich insbesondere in Deutschland nichts an der 6-8-Minutenmedizin und der einseitigen Beendigung des Erzählflusses von PatientInnen durch den Arzt nach kurzer Zeit verändert, begründen ÄrztInnen häufig mit Zweifeln an der tatsächlichen gesundheitlichen Wirksamkeit eines anderen Kommunikations- und Behandlungsstils und auch damit, dass das ja noch mehr zeitlichen Aufwand bei sowieso schon durch die immer wieder berichteten 18 Patient-Arzt-Kontakte pro Jahr überstrapazierten zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Dass eine qualitativ patientenzentriertere und zunächst zeitintensivere Behandlung unter dem Strich zu weniger Aufwand und einer besseren Behandlung könnte, erschien und erscheint vielen ÄrztInnen, Krankenkassenmanagern und Gesundheitspolitikern immer noch zu unsicher, um so zu arbeiten und Anreize zu setzen.
Die immer wieder in Studien erkannten Mängel in der Dauer und der Art der Kommunikation und der patientenzentrierten Behandlung insgesamt, stellen auch aus Sicht von vielen Ärzten ein Hemmnis für ihre Wirksamkeit, die Therapietreue und die Zufriedenheit von PatientInnen dar. Dass sich insbesondere in Deutschland nichts an der 6-8-Minutenmedizin und der einseitigen Beendigung des Erzählflusses von PatientInnen durch den Arzt nach kurzer Zeit verändert, begründen ÄrztInnen häufig mit Zweifeln an der tatsächlichen gesundheitlichen Wirksamkeit eines anderen Kommunikations- und Behandlungsstils und auch damit, dass das ja noch mehr zeitlichen Aufwand bei sowieso schon durch die immer wieder berichteten 18 Patient-Arzt-Kontakte pro Jahr überstrapazierten zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Dass eine qualitativ patientenzentriertere und zunächst zeitintensivere Behandlung unter dem Strich zu weniger Aufwand und einer besseren Behandlung könnte, erschien und erscheint vielen ÄrztInnen, Krankenkassenmanagern und Gesundheitspolitikern immer noch zu unsicher, um so zu arbeiten und Anreize zu setzen.
Dabei gibt es seit mittlerweile über einem Jahrzehnt und bis in die Gegenwart hinein immer wieder genügend Evidenz für den allseitigen Nutzen patientenzentrierterer Behandlung:
• In einem 1995 im "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichten Review von 21 randomisierten kontrollierten Studien über die Wirkungen einer qualitativ anspruchsvollen patientenzentrierten Arzt-Patientkommunikation von der gründlichen und auch narrativen (!) Anamnese bis zur Besprechung (!) eines Behandlungsplans auf die Gesundheit der Patienten, berichteten 16 signifikant positive Resultate, vier negative, die aber nicht signifikant waren und eine Studie ließ den Leser im Unklaren. Die in dem Aufsatz genannten Elemente einer anspruchsvollen Kommunikation empfahlen die AutorInnen als Inputs für die Arztausbildung und Gesundheitsbildungsangebote für PatientInnen. Neben dem Abstract des Aufsatzes "Effective physician-patient communication and health outcomes: a review" von M. A. Stewart im CMAJ (vol. 152 no. 9: 1423-1433) gibt es auch noch eine kostenlose Komplettversion.
• 2000 untersuchte eine andere Gruppe kanadischer VersorgungsforscherInnen in einer Beobachtungsstudie die Kommunikation in 39 Familienärzte-Praxen aus denen insgesamt 315 PatientInnen an der Studie teilnahmen. Das Untersuchungsziel war, heraus zu bekommen, ob sich patientenzentriertes Verhalten von ÄrztInnen auf eine Reihe von Ergebnisindikatoren der Behandlung auswirkte. Sie nahmen zum einen sämtliche Unterhaltungen zwischen diesen PatientInnen und ihren ÄrztInnen auf Tonband auf und klassifizierten die Gespräche anschließend nach dem Grad ihrer Patientenzentrierung. Zusätzlich fragten sie die PatientInnen nach ihren Wahrnehmungen über die Patientenzentrierung des Arztbesuchs. Bei den Ergebnisindikatoren handelte es sich um die Unannehmlichkeit von Symptomen, den selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand nach dem SF-36-Instrument und die Häufigkeit der Nutzung verschiedener diagnostischer Tests, von Überweisungen und von Arztbesuchen. In der Analyse wurden mögliche Confoundervariablen kontrolliert und eine Standardisierung der unterschiedlichen Praxis-PatientInnen vorgenommen.
Zu den Ergebnissen: Die auf der Basis der Tonbandmitschnitte vorgenommene Klassifizierung der Patientenzentrierung korrelierte gut mit der Wahrnehmung von Patientenzentrierung der Kommunikation mit ihrem Arzt. Die Patienten nahmen eine gemeinsame Basis der Arzt-Patientbeziehung wahr. Positive Wahrnehmungen der Patientenzentrierung und eines gemeinsamen Grundes waren deutlich mit einer besseren Erholung von den Unannehmlichkeiten verschiedener Symptome, einer 2 Monate nach der patrienzentrierten Behandlung besseren emotionalen Gesundheit und weniger diagnostischer Tests und Überweisungen assoziiert: Von den Patienten, die in der patientenzentrierten Gruppe behandelt wurden, erhielten 14,6% einen oder mehrere diagnostische Tests, von den PatientInnen, die ihre Behandlung nicht patientenzentriert wahrnahmen, erhielten solche Tests 24,3%. Ähnliche Unterschiede, teils statistisch signifikant, teils nicht, gab es auch noch bei weiteren Aspekten des Behandlungsgeschehens. Die Erfahrung des Patienten, ein anerkannter und gewünschter Teilnehmer an der Problemdiskussion und am Behandlungsprozess zu sein, ist nach Meinung der AutorInnen vielleicht von höchster Bedeutung für sein geringeres Bedürfnis, eine weitere Untersuchung durch Tests und Überweisungen durchzuführen. Dieser Prozess scheint auch beim Arzt abzulaufen. Interessant und nur teilweise erklärt ist, dass es keine statistische Beziehung zwischen der per Tonband klassifizierten Patientenzentrierung ihres Arztkontakts und den positiven Outcomes gab.
Der Aufsatz endet mit einer ausführlichen Reflexion der schwierigen und zum Teil ambivalenten methodischen und inhaltlichen Aspekte der Studie.
Der Aufsatz "The Impact of Patient-Centered Care on Outcomes" von Moira Stewart et al. ist im September 2000 in der Zeitschrift "The Journal of Familiy Practice" (Vol. 49, No. 9) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
• Und schließlich stellte eine us-amerikanische Forschergruppe in der Mai/Juni-Nummer des 2011er-Jahrgangs der Zeitschrift "Journal of the American Board of Family Medicine" die Ergebnisse einer einjährigen randomisierten Studie mit 509 erwachsenen Patienten vor, die von Familienärzten und allgemeinmedizinisch tätigen Internisten behandelt wurden. Die Untersuchung wurde mit Hilfe eines interaktiven Analyseinstruments durchgeführt, das sowohl anzeigt, ob und wie die primärärztliche Behandlung patientenzentriert stattfand und in welchem Verhältnis Patientenzentrierung zu der Nutzung von Gesundheitsversorgung stand.
Nach der Kontrolle des Einflusses einer Vielzahl von sioziodemografischen, Gesundheitsverhaltens- und Gesundheitsindikatoren und dem rechnerischen Ausschluss ihrer möglichen Einwirkung, gab es ein klares Ergebnis zum Zusammenhang von patientenzentreierten Behandlung und zahlreichen der Behandlungsindikatoren. So sank bei den PatientInnen mit wahrgenommener Patientenzentrierung die Anzahl der Inanspruchnahme spezieller Behandlung pro Jahr schwach signifikant, es gab signifikant weniger Krankenhauseinweisungen und weniger Labor- und Diagnosetests. Die Gesamtausgaben für medizinische Dienstleistungen wurden schließlich innerhalb des Untersuchungsjahres ebenfalls signifikant reduziert. Auch hier lohnen sich gründliche Blicke auf die kritische Diskussion der beobachteten Effekte, die zahlreiche Impulse geben, solche Studien für die dennoch ungläubig bleibenden Gesundheitsakteure zu replizieren.
Der Aufsatz "Patient-Centered Care is Associated with Decreased Health Care Utilization" von Klea D. Bertakis und Rahman Azari, erschienen im "The Journal of the American Board of Family Medicine" (24 [3]: 229-239), ist komplett kostenlos erhältlich.
Nach dem hier geschlagenen 16-jährigen Bogen von unterschiedlichsten Studien zum möglichen Zusammenhang von Patientenzentrierung, der Nutzungshäufigkeit gesundheitlicher Leistungen und ihres gesundheitlichen Nutzens, sollten zumindest die Ärzte und andere Erbringer gesundheitlicher Leistungen, die "eigentlich" gern mehr mit ihren PatientInnen kommuniziert und sie in die Behandlung einbezogen hätten, aber nicht so richtig an den Erfolg glauben und vor allem eine aus ihrer Sicht drohende Zunahme von finanzierter und unfinanzierter Arbeit befürchten, auch im deutschen Gesundheitssystem mehr Patientenzentrierung wagen bzw. unterstützen.
Bernard Braun, 24.10.11
Geringes Gesundheitswissen ist nicht "nur" ein Bildungsproblem, sondern auch mit höherer Gesamtsterblichkeit assoziiert
 Über den Umfang und die Verteilung geringer individueller Fähigkeiten Basiskenntnisse über die eigene Gesundheit und Versorgungsmöglichkeiten zu erhalten, mit ihnen umzugehen und sie zu verstehen, gibt es mittlerweile weltweit zahlreiche gesicherte Erkenntnisse. Weniger genau untersucht ist aber, ob eine niedrige so genannte "health literacy" relevante negative Wirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen hat oder eine Verbesserung der Gesundheitssystemkenntnisse außer einer persönlichen Zufriedenheit über Wissensgewinne auch positive gesundheitliche Wirkungen hat.
Über den Umfang und die Verteilung geringer individueller Fähigkeiten Basiskenntnisse über die eigene Gesundheit und Versorgungsmöglichkeiten zu erhalten, mit ihnen umzugehen und sie zu verstehen, gibt es mittlerweile weltweit zahlreiche gesicherte Erkenntnisse. Weniger genau untersucht ist aber, ob eine niedrige so genannte "health literacy" relevante negative Wirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen hat oder eine Verbesserung der Gesundheitssystemkenntnisse außer einer persönlichen Zufriedenheit über Wissensgewinne auch positive gesundheitliche Wirkungen hat.
Mit den Ergebnissen einer retrospektiven Kohortenstudie, welche Kaiser Permanente, ein Gesundheitsunternehmen, das Krankenversicherung und Gesundheitsversorgung integriert, im US-Bundesstaat Colorado mit 2.156 herzkranken Patienten durchführte, existiert aber nun recht handfestes Wissen.
Die ambulant behandelten Patienten nahmen zwischen 2001 und 2008 an der Studie teil und mussten neben einer mehrfach durchgeführten (durchschnittlich ein follow up nach 1,2 Jahren) schriftlichen Befragung zu ihrem Gesundheitszustand auch drei aus einem größeren Standardfragebogen stammende, evaluierte Fragen zu ihrer "health literacy" beantworten. Nach deren Beantwortung wurden sie als Patienten mit hoher oder geringer "Gesundheitsbildung" klassifiziert. Die Messgrößen für die mögliche Wirkung der "health literacy" waren die Gesamtsterblichkeit und die Gesamtrate der Krankenhauseinweisungen.
Von den 1.547 Herz-Patienten, die letztlich an der Untersuchung teilnahmen, gehörten 262 oder 17,5% der Gruppe mit geringer "health literacy" an. Diese Personen waren älter, gehörten niedrigeren sozialen Schichten an, ihr Bildungsabschluss war niedrig und die Rate zusätzlicher Erkrankungen war höher. In der Untersuchungszeit verstarben insgesamt 124 Personen, darunter 46 in der Gruppe mit geringem und 78 in der mit angemessenem Gesundheitswissen.
In einer multivariaten Regressionsanalyse zeigte sich, dass eine geringe "health literacy" signifikant mit einer höheren Gesamtsterblichkeit assoziiert war. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben war nach dem rechnerischen Ausschluss des Einflusses verschiedener anderer Merkmale (z.B. Alter, Bildungsabschluss, sonstige Erkrankungen und einiger Erkrankungsmerkmale) bei den Personen mit geringem Gesundheitswissen um 97% höher als bei den Personen mit hohem Gesundheitswissen.
Die ähnlich angelegte Untersuchung eines Zusammenhangs von "health literacy" mit der Gesamtrate der Krankenhausaufenthalte zeigte kein signifikantes Ergebnis.
Da diese Untersuchung bei krankenversicherten und bei englischsprachigen US-AmerikanerInnen durchgeführt wurde, vermuten die AutorInnen, dass ihr Ergebnis im Vergleich zu einer Studie in einer für die Gesamtbevölkerung repräsentativen Patientengruppe zu positiv ausgefallen ist.
Wie die offensichtlich auch gesundheitlich nachteiligen Lücken im Gesundheitswissen geschlossen werden können, sagen die AutorInnen zwar nicht, weisen aber zumindest auf die wichtige Rolle der Kommunikation von ÄrztInnen und Angehörigen anderer Gesundheitsberufegruppen hin. Dies hebt sich positiv von vielen, auch durchaus gut gemeinten Versuchen ab, die PatientInnen mit geringer "health literacy" vorrangig für deren Beseitigung durch die Lektüre entsprechender Literatur oder den Besuch von Gesundheitsbildungsangeboten bis hin zu Patientenuniversitäten verantwortlich zu machen.
Von der Studie "Health literacy and outcomes among patients with heart failure" von Peterson PN et al., veröffentlicht am 27. April 2011 in der Fachzeitschrift "JAMA (305: 1695-1701), ist kostenlos nur ein Abstract zugänglich.
Bernard Braun, 22.10.11
Brustkrebspatientinnen werden schlecht auf die sozialen, emotionalen und kognitiven Bedingungen nach dem Überleben vorbereitet
 Trotz zahlreicher Verbesserungen der diagnostischen und therapeutischen Techniken und Möglichkeiten in der Behandlung von Brustkrebserkrankten, ist die soziale, emotionale und auch kognitive Vorbereitung auf die zum Teil langwierige, die Gesundheit und Lebensqualität der Patientinnen über Jahre belastende Behandlung und die Zeit nach der unmittelbaren Therapie immer noch lückenhaft oder qualitativ schlecht.
Trotz zahlreicher Verbesserungen der diagnostischen und therapeutischen Techniken und Möglichkeiten in der Behandlung von Brustkrebserkrankten, ist die soziale, emotionale und auch kognitive Vorbereitung auf die zum Teil langwierige, die Gesundheit und Lebensqualität der Patientinnen über Jahre belastende Behandlung und die Zeit nach der unmittelbaren Therapie immer noch lückenhaft oder qualitativ schlecht.
Das zeigt die am 11. Oktober 2011 veröffentlichte Auswertung der Antworten von 1.043 Frauen, welche ihre Krebserkrankung und -therapie überlebt haben, im Rahmen des in dieser Form in den USA und weltweit einmaligen "The Breast Cancer M.A.P. (Mind Affects the Physical) Projects". In diesem Projekt werden die persönlichen, emotionalen, physischen und sozialen Wahrnehmungen und Erfahrungen dieser Frauen erfasst und auswertbar sowie kommunikabel gemacht.
Zu den wichtigen Funden des Projektes gehört:
• 90% der Teilnehmerinnen bekamen innerhalb ihrer gesamten Behandlung keine Übersicht oder keinen Plan ("survivorship care planning") ausgehändigt, der sich mit der oft noch jahrelang notwendigen Behandlung und ihren oft belastenden Umständen nach dem akuten Überleben der Erkrankung beschäftigte.
• Von den überlebenden Krebskranken, die keinen solchen Plan erhielten, hätten aber gerne 96% einen erhalten.
• Von den Empfängern eines derartigen Plans fanden ihn 71% nützlich oder sehr nützlich.
• Die Mehrheit der Patientinnen fühlte sich für die weiteren Kontakten und die wichtigste Unterhaltung mit verschiedenen Ärzten nach der Erstdiagnose Brustkrebs nicht gut vorbereitet.
• 75% der überlebenden Krebskranken berichteten, sie hätten gerne vor diesem Erstkontakt so viel wie möglich Informationsmaterial erhalten. Erhalten haben diese Information aber lediglich 15%.
• Entsprechend waren 48% der Frauen nicht völlig mit ihren Fragen zufrieden, die sie innerhalb des ersten Gesprächs mit einem Facharzt gestellt hatten.
• 87% der Befragungsteilnehmerinnen nahmen mindestens ein soziales, physisches oder emotionalen Problem als mittelmäßig bis sehr stark wahr.
• zu den häufigsten Fällen von Behandlungs-Stress gehören starke Müdigkeit, sexuelle Fehlfunktionen und Schlafprobleme. Zu den häufigsten Begleiterkrankungen gehören im Moment die Depression und eine Reihe von Komorbiditäten.
Eine der Beraterin des Projekts, Lidia Schapira von der Harvard Medical School in Boston, fasst die Projektergebnisse so zusammen: "We have made extraordinary advances in the treatment of breast cancer but it's clear from these findings that the full spectrum of care isn't currently being delivered to survivors." Dies ist verbunden mit der praktischen Aufforderung an die "cancer community" nach einem "renewed focus on providing social and emotional support to people with breast cancer, and improve the standard of care for the growing survivor population."
Da es keinen Grund gibt, dass die soziale und emotionale Unterstützung von an Brustkrebs erkrankten Frauen in Deutschland völlig anders oder gar besser aussieht, sollte auch hierzulande nicht erst auf eine solche Studie gewartet werden, sondern prinzipiell mehr für diese Seite der Versorgung getan werden. Dazu die betroffenen Frauen zu fragen und nicht allein den Expertenmeinungen zu folgen, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Den 73 Seiten umfassenden 2011-Bericht des Projekts erhält man komplett kostenlos.
Eine knappe Pressemitteilung über die wichtigsten Projektergebnisse ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.10.11
US-Empfehlung: Schluss mit PSA-basiertem Prostatakrebs-Screening bei gesunden Männern! Deutsche Urologen: "zu drastisch"!
 33 der 44 Millionen US-Amerikaner über 50 Jahre haben schon einen so genannten PSA-Test (Suche nach einem prostata-spezifischen Antigen) hinter sich. Vielen von ihnen wurde dabei, gestützt auf die "gute Erfahrungen" ihrer Urologen und auf entsprechende Leitlinien der Fachgesellschaften, ein großer persönlicher Nutzen bis hin zur Verbesserung der Überlebenschancen bei Prostatakrebs versprochen. Selbst die sich häufenden Hinweise, dass dieser Test bei symptomlos gesunden Männern wahrscheinlich weder diesen noch andere Nutzen erbringe, und daher die nachweisbaren Nachteile und Schäden durch weitere invasive Tests (z.B. Biopsien) und Behandlungen umso stärker zu bewerten sind, brachten das Vertrauen in den PSA-Test nicht ins Wanken.
33 der 44 Millionen US-Amerikaner über 50 Jahre haben schon einen so genannten PSA-Test (Suche nach einem prostata-spezifischen Antigen) hinter sich. Vielen von ihnen wurde dabei, gestützt auf die "gute Erfahrungen" ihrer Urologen und auf entsprechende Leitlinien der Fachgesellschaften, ein großer persönlicher Nutzen bis hin zur Verbesserung der Überlebenschancen bei Prostatakrebs versprochen. Selbst die sich häufenden Hinweise, dass dieser Test bei symptomlos gesunden Männern wahrscheinlich weder diesen noch andere Nutzen erbringe, und daher die nachweisbaren Nachteile und Schäden durch weitere invasive Tests (z.B. Biopsien) und Behandlungen umso stärker zu bewerten sind, brachten das Vertrauen in den PSA-Test nicht ins Wanken.
Gestützt auf die bewerteten Ergebnisse von 5 in den USA und Europa durchgeführten großen Studien, macht sich jetzt mit der "United States Preventive Services Task Force (USPSTF)" eine recht gewichtige und für die us-amerikanische Behandlungswirklichkeit autoritative Fachinstitution daran, aus dem Wanken einen Umsturz zu machen.
Nachdem die USPSTF bereits 2008 empfohlen hatte von einem PSA-Screening bei 75-Jährigen und Älteren abzusehen, lautet ihre jetzige Empfehlung: "The USPSTF now recommends against PSA-based screening for prostate cancer in all age groups." Die Studien hätten auf der Basis von Lebens- und Behandlungsverläufen von hunderttausenden Männern selbst nach bis zu 10 Jahren entweder keine lebensrettenden oder -verlängernden oder höchstens einen sehr kleinen Effekt des Tests nachweisen können.
Was die Experten zu dieser, im Moment auch noch gegen eine explizit andere Empfehlung der urologischen Fachgesellschaften der USA gerichtete Empfehlung bewogen hat, begründen u.a. die folgenden versorgungsepidemiologischen Daten: Von 1986 bis 2005 sind allein in den USA eine Million Männer operiert, bestrahlt oder beides geworden, die ohne den PSA-Test niemals behandelt worden wären. Von ihnen starben wenigstens 5.000 kurz nach der Operation und 10.000 bis 70.000 litten unter ernsthaften Komplikationen. Die Hälfte dieser Männer hatte anhaltend Blut in ihrem Samen und 200.000 bis 300.000 litten unter Impotenz oder Inkontinenz oder beiden gravierenden Einschränkungen ihrer Lebensqualität. Selbst der Entwickler des Tests, Richard Ablin, sprach daher bereits vor einiger Zeit von einem "public health disaster". Um einen Todesfall durch ein Prostatakarzinom zu verhindern, müssen 1.400 Männer gescreent werden und 48 Männer als Patienten behandelt werden.
Dabei verschweigen die Experten keineswegs, dass Prostatakrebs bei Männern zu den häufigsten, auch tödlichen Krebserkrankungen gehört: 2010 wurden in den USA bei schätzungsweise 217.730 Männer ein Prostakarzinom diagnostiziert und 32.050 Männer starben an dieser Krankheit.
Ab Dienstag dem 11. Oktober 2011 können interessierte Akteure die Empfehlung der Task Force kommentieren. Bereits bekannte Äußerungen lassen auch komplette Ablehnung oder moderatere Kompromissvorschläge erwarten. Hier lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Kommentar-Website der USPSTF.
Den deutschen Urologen sind die Empfehlungen laut dem entsprechenden Spiegel online-Beitrag von Cinthia Briseno "zu drastisch", es gäbe viele Männer, die ihn für nützlich hielten und außerdem würde der PSA-Test hierzulande bei weitem nicht so häufig angeboten und durchgeführt wie in den USA. Trotzdem wäre es nach Meinung einiger dieser Experten wahrscheinlich sinnvoll, einen anderen Test zu entwickeln - was aber noch viele Jahre dauern könne. Und deshalb windet sich diese Argumentation wieder der Position zu, dass doch lieber der PSA-Test weiter durchgeführt aber durch rektale Untersuchungen ergänzt werden solle.
Wer mit dieser Art von "Sachargumentation" nichts anfangen kann, dem seien die auf 7 Seiten zusammengetragenen vielfältigen Sach- und Fachinformationen im "Draft Recommendation Statement - Summary of Recommendation and Evidence" der USPSTF empfohlen, die es mit viel Literaturverweisen angereichert, komplett und kostenlos zum Herunterladen gibt. Egal wie die weitere Diskussion ausgeht, sollten die hier vorliegenden Fakten in keiner PSA- und Prostatakrebsdebatte der Zukunft mehr fehlen.
Eine lesenswerte Zusammenfassung der Empfehlungen und einige Ergänzungen liefert auch der von Gardiner Harris verfasste Artikel U.S. Panel Says No to Prostate Screening for Healthy Men in der New York Times vom 6. Oktober 2011.
Bernard Braun, 9.10.11
Krankenhausgeistliche: Anrührendes Relikt oder doch nützlich? Ein Beispiel aus der Kinder-Palliativbehandlung.
 Welchen Nutzen stiften die rund 10.000 Geistlichen in den Krankenhäusern der USA für Patienten, ihre Angehörigen, die traditionellen Berufsgruppen der Ärzte und Pflegekräfte und die immer größer werdende Schar von Case-, Care- oder Palliativ-Care-Manager? Oder stellen sie einfach nur ein Relikt aus der Zeit vor dem medizinisch-technischen Fortschritt dar?
Welchen Nutzen stiften die rund 10.000 Geistlichen in den Krankenhäusern der USA für Patienten, ihre Angehörigen, die traditionellen Berufsgruppen der Ärzte und Pflegekräfte und die immer größer werdende Schar von Case-, Care- oder Palliativ-Care-Manager? Oder stellen sie einfach nur ein Relikt aus der Zeit vor dem medizinisch-technischen Fortschritt dar?
Diese Frage stand im Mittelpunkt einer weitgehend qualitativen Pilotstudie im Auftrag des "The Hastings Center" und des "Rush University Medical Center" deren Ergebnisse im August 2011 veröffentlicht wurden. Genauer ging es darum, mehr über die Rolle und den Alltag von Geistlichen in Palliativ-Behandlungsteams für Kinder in Erfahrung zu bringen - aus Sicht von Ärzten und Geistlicher selbst. Dabei ist weitgehend akzeptiert und belegt, dass geistige oder spirituelle Hilfe oder Behandlung ein wichtiges Element bei der Schmerzbehandlung von Kindern ist und einen Teil der Probleme ernsthafter oder gar tödlicher Erkrankungen von Kindern für sie selber und ihre Familien bewältigen oder lindern hilft.
In der Pilotstudie sollte zusätzlich untersucht werden wie spirituelle Behandlung in etablierten Programmen zur kindbezogenen Schmerzbehandlung (so genannte "pediatric palliative care" [PPC]) geliefert wird und die Rolle von in den Programmen fest integrierten Geistlichen zu beschreiben.
Dazu untersuchten die Wissenschaftler 2009 zunächst 28 USA-weit verbreitete PPC-Programme und wählten daraus acht Programme zur weiteren Analyse aus, die länger als ein Jahr existierten, interdisziplinär besetzt waren, ausgebaute Verweisungsprozeduren besaßen und in der Lage waren, Daten über ihren Arbeitsaufwand zu liefern. Sieben Programme liefen in speziellen Kinderkliniken und eines in der Kinderabteilung einer Hochschulklinik.
In den acht Programmen wurden schließlich halbstrukturierte Interviews mit dem Geistlichen und dem medizinischen Direktor oder Chefarzt durchgeführt. Zu den Ergebnissen:
• Die Chefärzte beschrieben die Programm-Beiträge der überwiegend fest am Krankenhaus angestellten Geistlichen so: Als erstes erleichterten sie das geistig verursachte Leiden der jungen Patienten und ihrer Familien. Zweitens verbesserten Gespräche mit den Geistlichen die Kommunikation zwischen den Familien und dem Behandlungsteam über die Ziele der Behandlung. Zum Beispiel erfahren vor allem Geistliche mehr über die kulturellen oder religiösen Überezeugungen und Einstellungen der Familien, deren Kenntnis allen Teammitgliedern oft erst ermöglichte elterliche Entscheidungen, Ziele, Prioritäten und Werte zu verstehen. Drittens vermitteln Geistliche auch den anderen Teammitgliedern eine etwas andere oder aufmerksamere Sichtweise der Behandlung und Behandelten. Umso wichtiger ist daher die Erkenntnis der Untersuchung, dass Geistliche in der Regel zu den gut integrierten Mitgliedern der PPC gehörten.
• Die interviewten Geistlichen berichteten im Großen und Ganzen Ähnliches über ihre Rolle und Beiträge zur Behandlung der schwer erkrankten Kinder. Sie konzentrierten sich dabei aber mehr auf den Prozess ihrer Arbeit als darauf, wie sie zu besseren Ergebnissen führt.
• Beide Gruppen waren sich einig, dass es darauf ankommt, gemeinsam im Team zu lernen, wie man die Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen nach geistiger Unterstützung besser befriedigt und ihre Erwartungen an Geistliche genauer erkennen lernt. Zudem müssen die bei Angehörigen verbreiteten Vorurteile beseitigt werden, Geistliche wären dann präsent, wenn der Tod des Kindes kurz bevor stünde oder wollten als Missionare ihrer eigenen religiösen Überzeugung auftreten.
Die Pilotprojektergebnisse werden von den ForscherInnen als Rechtfertigung angesehen, zukünftig noch intensiver darüber zu forschen, ob und wenn ja wie die Interventionen der Geistlichen die spirituellen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen treffen und welche organisatorischen Bedingungen hilfreich sind, geistige Unterstützung und Behandlung zu liefern.
Die Ergebnisse der Pilotstudie "The Role of Professional Chaplains on Pediatric Palliative Care Teams: Perspectives from Physicians and Chaplains" von George Fitchett et al., erschienen in der Fachzeitschrift "JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE" (Volume 14, Number 6, 2011: 704-707) sind komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.8.11
Medizinisch-technischer Fortschritt: teuer, aber gut und nützlich!? Das Beispiel der softwaregestützten Analyse von Mammogrammen.
 Zu den Verheißungen des Pro-E-Health-Diskurses gehört, dass ein Teil der bisher für diagnostische und therapeutische Tätigkeit aufgewandten Arbeitszeit und Aufmerksamkeit von Ärzten oder anderen hochqualifizierten, teuren und angeblich auch knapp werdenden Berufstätigen im Gesundheitswesen durch entsprechende Computersoftware eingespart werden kann - ohne, so jedenfalls nimmermüde die Hersteller, einen relevanten Qualitätsverlust oder gar mit einem höheren Nutzen dank des nie müde und unpräzise werdenden technischen Verfahrens.
Zu den Verheißungen des Pro-E-Health-Diskurses gehört, dass ein Teil der bisher für diagnostische und therapeutische Tätigkeit aufgewandten Arbeitszeit und Aufmerksamkeit von Ärzten oder anderen hochqualifizierten, teuren und angeblich auch knapp werdenden Berufstätigen im Gesundheitswesen durch entsprechende Computersoftware eingespart werden kann - ohne, so jedenfalls nimmermüde die Hersteller, einen relevanten Qualitätsverlust oder gar mit einem höheren Nutzen dank des nie müde und unpräzise werdenden technischen Verfahrens.
Es wundert deshalb nicht, dass gerade auch bei sehr häufigen diagnostischen Verfahren wie der Mammographie in den USA bereits rund 75% der gewonnenen Bilder mit Unterstützung entsprechender Software ("computer assisted detection" [CAD]) ausgewertet werden und sich Therapieentscheidungen u.a. auf die Richtigkeit der damit erzielten Ergebnisse beziehen. Die staatliche Krankenversicherung für Ältere, Medicare, gibt jährlich 20 Millionen US-Dollar für diese Art der Mammografie-Analyse aus.
Überprüft man den mit technischer Assistenz erzielten Ergebnisqualität-Nutzen mit dem, der allein auf den Augen und Erfahrungen von Radiologen etc. beruht, ist ersterer relativ gering und die Anzahl von falsch-positiven Befunden deutlich höher.
Nachdem dieser Verdacht bereits vor einigen Jahren geäußert und auch empirisch erhärtet wurde, untersuchten nach dem definitiven Ende einer Lernzeit eine Gruppe von Wissenschaftlern mit den Daten der 90 im "Breast Cancer Surveillance Consortium" zusammengefassten Diagnosezentren diese Frage erneut. Die Datenbasis umfasste 684.956 Frauen mit mehr als 1,6 Millionen Mammografien. Im Untersuchungsjahr 2006 setzten rund 28% der Diagnosezentren die Analyse-Software bereits 27,5 Monate lang ein.
Der Vergleich mit Zentren, die dieses Instrument des medizinisch-technischen Fortschritts nicht einsetzten, sieht dann wie folgt aus:
• Die Spezifität (die Fähigkeit risikofreie Personen zu entdecken und damit von weiteren diagnostischen und therapeutischen Prozeduren frei zu halten) der softwaregestützten Diagnose war statistisch signifikant um 13% geringer. Und auch der positive prädiktive Wert, also ein zentraler Ergebnisindikator der Mammografie, war signifikant um 11% niedriger.
• Die Sensitivität oder die Fähigkeit risikobehaftete Personen zuverlässig zu entdecken ist beim Einsatz con CAD zunächst leicht um 6% erhöht. Vor allzu viel Jubel ist aber zweierlei zu bedenken: Die Sensitivität in den Mammografiezentren, die sich auf die Blicke und Erfahrungen von ärztlichen Experten verlassen, ist erstens nicht signifikant niedriger und zweitens werden überwiegend "nur" so genannte duktale Karzinome in situ entdeckt. Dies sind krankhafte Wucherungen neoplastischer Zellen in den Milchgängen der weiblichen Brust, also aktuell kein bösartiger Krebs, die nur zum Teil (schätzungsweise in 10-20 Jahren rund 50%) invasive Karzinome werden können. Nur für diese Fälle hätte also eine Entdeckung möglicherweise einen Nutzen als Krebsvorsorge.
• Die computerassistierte Entdeckungsmethode war aber auch nicht mit einer generell höheren Entdeckungsrate von Brustkrebs oder mit der Entdeckung in einem besseren Stadium, in kleinerer Größe und einem unproblematischen Zustand der Lymphknoten im Falle eines invasiven Karzinoms assoziiert.
Zurückhaltend formulierend fassen die Forscher ihre Ergebnisse so zusammen: "The health benefits of CAD use during screening mammograms remain unclear, and the data indicate that the associated costs may outweigh the potential health benefits." Damit nicht genug, weisen sie darauf hin, dass die jetzige CAD-Praxis in den USA das Risiko erhöht, ohne gesundheitlichen Grund und mit zweifelhaftem gesundheitlichen Nutzen weitere Untersuchungen angeboten zu bekommen.
Wenn man jetzt noch bedenkt, dass es seit Jahren (vgl. dazu den Forumsbeitrag Brustkrebs-Früherkennung durch Mammographie: Ein Drittel aller Karzinome ist harmlos und überdiagnostiziert aber auch ganz aktuell (vgl. dazu die Ergebnisse eines gerade im "British Medical Journal" veröffentlichten und kostenlos erhältlichen 6-Ländervergleichs des Mammographienutzens für die Sterblichkeit, welche die Autoren so zusammenfassen: ""The contrast between the time differences in implementation of mammography screening and the similarity in reductions in mortality between the country pairs suggest[s] that screening did not play a direct part in the reductions in breast cancer mortality." - mehr dazu demnächst im Forum) kontroverse Untersuchungen und heftige Debatten über den grundsätzlichen Nutzen der Mammographie gibt, wird ein möglicherweise im Zeichen von Ärztemangel standardmäßige Einsatz von CAD noch fragwürdiger.
Für den Aufsatz "Effectiveness of Computer-Aided Detection in Community Mammography Practice" von Joshua Fenton et al., erschienen im "Journal of the National Cancer Institute (JNCI)" der USA (Vol. 103, Issue 15 vom 3.August 2011), ist kostenlos nur ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 14.8.11
"Darf's ein wenig mehr sein"? Blutarmut durch Blutabnahme als jüngstes Beispiel der Fehlversorgung durch Überversorgung
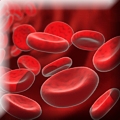 Der Blutverlust bei der Blutabnahme für diagnostische Zwecke ist bei Patienten, die wegen eines akuten Herzinfarkts stationär behandelt werden, mit einem im Krankenhaus erworbenen Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) assoziiert. Die Folge, eine unzureichende Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers, ist gerade bei Menschen mit bereits vorgeschwächtem Organismus ungesund und daher eigentlich systematisch zu vermeiden.
Der Blutverlust bei der Blutabnahme für diagnostische Zwecke ist bei Patienten, die wegen eines akuten Herzinfarkts stationär behandelt werden, mit einem im Krankenhaus erworbenen Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) assoziiert. Die Folge, eine unzureichende Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers, ist gerade bei Menschen mit bereits vorgeschwächtem Organismus ungesund und daher eigentlich systematisch zu vermeiden.
Trotzdem zeigte eine Untersuchung bei 17.676 Herzinfarkt-Patienten, die im Zeitraum von 2000 bis 2008 bei ihrer Einweisung in eines von 57 us-bundesweiten Krankenhäusern nicht an Blutarmut litten, dass rund 20% von ihnen während ihres Krankenhausaufenthaltes eine moderate bis ernste Form einer Anämie entwickelten. Der Hauptgrund war die während des Aufenthalts und insbesondere während der ersten beiden Tage für diagnostische Zwecke entnommene Menge Blut: Bei den anämischen Personen betrug diese Menge 175 mL, bei den nchtanämischen Patienten lediglich 85 mL. Und auch bei den Patienten mit nachstationärer Anämie variierte die entnommene Blutmenge zwischen 119 mL bei moderater Blutarmut bis zu 246 mL Blut bei schwerer Blutarmut. Menschen mit keiner oder einer leichten Form der Blutarmut hatten zwischen 53 und 110 mL abgenommen bekommen. Dies alles zeigt auch, dass es bei vergleichbar erkrankten Personen große Mengen Blut keineswegs gesundheitlich notwendig sind, sondern man auch "mit ein bisschen weniger" diagnostizieren und behandeln kann.
Wer der Meinung ist, es käme bei der Menge Blut im Körper nicht auf ein paar Tropfen an, kann sich durch die Ergebnisse dieser Studie eines Besseren belehren lassen. Mit jeden 50 mL entnommenen Blutes steigt das Risiko für leichte bis schwere Blutarmut und damit auch der Folgen um 18%, multivariat adjustiert immer noch signifikant um 15%.
Die Autoren schlagen auch noch zwei eigentlich triviale Mittel vor, um die Entnahmemenge generell zu reduzieren: Blutröhrchen aus der Pädiatrie zu verwenden oder einfach die Erwachsenenbehälter mit weniger als der höchstmöglichen Menge zu füllen. Nachzudenken wäre aber auch noch über den Sinn und Zweck mancher Blutentnahme. Ob auch bei anderen Behandlungsanlässen für eine stationäre Behandlung so viel zu viel Blut abgenommen wird, dass Blutarmut die Folge ist und ob dies ohne Nachteile für die Diagnostik und Therapie reduziert werden kann, sollte weiter untersucht werden.
Der unter der Rubriküberschrift "Online First. Less is more" stehende Aufsatz "Diagnostic Blood Loss From Phlebotomy and Hospital-Acquired Anemia During Acute Myocardial Infarction von Salisbury et al. ist in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" am 8. August 2011 erschienen (Seiten E1 bis E8) und komplett kostenlos erhältlich.
Ein weiterer "online first" veröffentlichter Kommentar ist unter der Überschrift "Comment on 'Diagnostic Blood Loss From Phlebotomy and Hospital-Acquired Anemia During Acute Myocardial Infarction' von Stephanie Rennke und Margaret C. Fang ist in derselben Ausgabe der Zeitschrift erschienen und ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.8.11
Es müssen nicht immer teure High-Tech-Interventionen sein! Ein Beispiel aus der Schlaganfall-Rehabilitation.
 Zu den wichtigsten Bestandteilen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, die noch eine gewisse Restbeweglichkeit behalten oder schon wieder erreicht haben, gehören systematische Bewegungsübungen. Die Nutzung eines kostspieligen mechanischen Heimtrainers oder Laufgeräts ("tread mill") samt einer aufwändigen und wartungsintensiven Einrichtung, welche von seinem Körpergewicht abhängig und mittels eines Sicherheitsgürtels für die Standsicherheit des Rehabilitanden beim Training sorgt (so genanntes Locomotor-System), ist normalen abwechslungsreichen Bewegungsübungen unter Anleitung eines Physiotherapeuten nicht überlegen. Und zwar auch in allen möglichen Untergruppen.
Zu den wichtigsten Bestandteilen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, die noch eine gewisse Restbeweglichkeit behalten oder schon wieder erreicht haben, gehören systematische Bewegungsübungen. Die Nutzung eines kostspieligen mechanischen Heimtrainers oder Laufgeräts ("tread mill") samt einer aufwändigen und wartungsintensiven Einrichtung, welche von seinem Körpergewicht abhängig und mittels eines Sicherheitsgürtels für die Standsicherheit des Rehabilitanden beim Training sorgt (so genanntes Locomotor-System), ist normalen abwechslungsreichen Bewegungsübungen unter Anleitung eines Physiotherapeuten nicht überlegen. Und zwar auch in allen möglichen Untergruppen.
Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA, in der 408 Personen, die zwei Monate vor dem Start der Rehabilitation einen Schlaganfall erlitten hatten, einer von drei Rehabilitationsgruppen zugewiesen wurden. Einer so genannten Locomotor-Gruppe, die bereits 2 Monate nach dem Schlaganfall mit dem Training begann, einer Gruppe, die erst 6 Monate nach dem Ereignis mit dieser Art der Rehabilitation begann und einer dritten Gruppe, die 2 Monate nach dem Schlaganfall mit einem traditionellen Heimübungsprogramm unter Begleitung eines Physiotherapeuten startete. Jede Intervention schloss 36 Sitzungen à 90 Minuten im Verlaufe von 12 bis 16 Wochen ein. Der primäre Endpunkt der Studie war eine Verbesserung der Fähigkeit funktional zu gehen spätestens ein Jahr nach dem Schlaganfall.
Diesen Zustand erreichten 52% aller TeilnehmerInnen. Weder zwischen der früh gestarteten noch der spät gestarteten Locomotor-Gruppe und der Heimübungsgruppe gab es statistisch signifikante Unterschiede z.B. bei der Gehgeschwindigkeit, dem Balanciervermögen und der Lebensqualität. Weder Verzögerungen beim späteren Beginn des Heimtrainer- bzw. "Tretmühlen"trainings noch die Ernsthaftigkeit der initialen Behinderung oder Schädigungen wirkten sich signifikant auf das Beweglichkeitsergebnis nach einem Jahr aus.
Insgesamt kam es während der Rehabilitationsmaßnahmen lediglich zu zehn ernsthaften unerwünschten Wirkungen. Im Vergleich mit der Heimübungsgruppe hatten beide Heimtrainer-Gruppen eine signifikant größere (p=0.008) Häufigkeit von Schwindelgefühlen und Ohnmachten. Mehrfachstürze waren unter den Patienten mit ernsten Gehbehinderungen in der Heimtrainer-Gruppe, die schon 2 Monate nach dem Schlaganfall mit der Rehabilitation begannen, mehr verbreitet als in beiden Vergleichsgruppen.
Von der im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (364 (21): 2026-36) am 26. Mai 2011 erschienenen randomisierten und kontrollierten Studie "Body-weight-supported treadmill rehabilitation after stroke" von Duncan PW et al. ist lediglich das Abstract kostenlos erhältlich.
Mit dieser Studie wird aktuell die Gesamtbewertung des Cochrane Reviews "Treadmill training and body weight support for walking after stroke" von Moseley et al. aus den Jahren 2003 und 2005 bestätigt und untermauert. Dessen Conclusio lautete: "Overall no statistically significant effect of treadmill training with or without body weight support was detected. Although individual studies suggested that treadmill training with body weight support may be more effective than treadmill training alone and that treadmill training plus task-oriented exercise may be more effective than sham exercises, further trials are required to confirm these findings."
Bernard Braun, 11.7.11
Praxis-Pflegekräfte behandeln Diabetiker vergleichbar gut wie Allgemeinärzte - Ergebnis eines RCT in den Niederlanden
 Selbst in Deutschland wird unter dem Druck, die ungünstigen Effekte der Ungleichverteilung der Ärzte auf die Bewohner ländlicher Gebiete zu bewältigen, immer intensiver über die "Substitution" oder "Delegation" ärztlicher Tätigkeit durch qualifizierte Pflegekräfte oder Angehörige andere Fachberufe nachgedacht und auch an Modellen (z.B. AGnES) gearbeitet. Dass sich dabei z.B. zuletzt der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Liste der so zu erledigenden Aufgaben darum herum drückte einen der unterschiedlichen Begriffe zu verwenden, zeigt aber, dass das deutsche Gesundheitssystem auch hier noch einen etwas längeren Weg vor sich hat als andere.
Selbst in Deutschland wird unter dem Druck, die ungünstigen Effekte der Ungleichverteilung der Ärzte auf die Bewohner ländlicher Gebiete zu bewältigen, immer intensiver über die "Substitution" oder "Delegation" ärztlicher Tätigkeit durch qualifizierte Pflegekräfte oder Angehörige andere Fachberufe nachgedacht und auch an Modellen (z.B. AGnES) gearbeitet. Dass sich dabei z.B. zuletzt der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Liste der so zu erledigenden Aufgaben darum herum drückte einen der unterschiedlichen Begriffe zu verwenden, zeigt aber, dass das deutsche Gesundheitssystem auch hier noch einen etwas längeren Weg vor sich hat als andere.
Für manche deutsche Diskutanten gehört auch die Ergebnisqualität der "ärztlichen" Tätigkeit von Nichtärzten zu den noch offenen Fragen - egal ob die Aufgaben noch unter der Oberaufsicht von Ärzten oder von den Nichtärzten schon autonom erledigt werden. In den meisten der bisherigen Interventionsstudien sollte im Wesentlichen gezeigt werden, dass die Behandlung durch Pflegekräfte die Behandlung von Patienten verbessert.
Für eine der häufigen, demnächst vielleicht sogar häufigsten chronischen und aufwendungsintensiven Erkrankungen, den Diabetes Typ II, belegt jetzt eine in den Niederlanden mit 230 PatientInnen über 14 Monate durchgeführte randomisierte und kontrollierte Studie, dass so genannte "practice nurses", also qualifizierte ambulant tätige Pflegekräfte oder "ArzthelferInnen", DiabetikerInnen nicht nur gut, sondern vergleichbar gut, wenn nicht sogar besser behandeln können als Allgemeinärzte. Die Behandlung in der Interventionsgruppe mit nichtärztlichem Pflegepersonal bestand in der Kontrolle des Blutzuckerwertes, des Blutdrucks und der Fettstoffwerte. Die Diabetespatienten in der Kontrollgruppe wurden konventionell durch Allgemeinärzte behandelt. Der in beiden Behandlergruppen gemessene primäre Outcome war eine Absenkung des HbA1c-Wertes, des so genannten Blutzuckergedächtnis-Wert am Ende der 14 Monate.
Die Ergebnisse waren unerwartet klar:
• Zwischen den beiden Patientengruppen gab es bei der Reduktion der drei Messwerte keine signifikanten Unterschiede.
• In beiden Gruppen sank der Blutdruck, eine der wichtigen Zielgrößen evidenter Diabetesbehandlung, signifikant: Um 7,4 mm Hg und 3,2 mm Hg beim systolischen bzw. diastolischen Wert in der Interventionsgruppe mit nichtärztlicher Behandlung und um 5,5 bzw. 1,0 mm Hg. In der Kontrollgruppe.
• In beiden Gruppen erreichten mehr Patienten als zu Beginn der Studie Zielgrößen für ihr Fettstoffwerteprofil.
• In der Interventionsgruppetraten häufiger als in der Kontrollgruppe Verschlechterungen in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und diabetesspezifische Symptome nahmen stärker zu.
• Trotzdem waren Patienten, die von Praxis-Pflegekräften behandelt wurden, mit der Behandlung zufriedener als die von Allgemeinärzten behandelten Patienten.
Eine Empfehlung der ForscherInnen lautete, die entsprechend qualifizierten und offensichtlich auch praktisch erfolgreichen Praxis-Pflegekräfte sollten auch Medikamente verordnen dürfen.
Was steht daher dem Transfer der weitgehend standardisierbaren Behandlung derart verbreiteter Erkrankungen zu Praxis-Pflegekräften noch im Wege?
Zu dem erstmals im Mai 2011 in der Fachzeitschrift "Journal of Clinical Nursing" (2011 May; 20 (9-10): 1264-72) veröffentlichten Aufsatz "Can diabetes management be safely transferred to practice nurses in a primary care setting? A randomised controlled trial" von Houweling ST, Kleefstra N, van Hateren KJ, et al. gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 30.6.11
Intelligente Umsetzung von Wissen als "return of investment" öffentlich finanzierter Gesundheitsforschung!? - Entwicklungsland BRD
 Eigentlich sollte man erwarten können, dass zumindest in öffentlichen, d.h. aus Steuergeldern oder Sozialversicherungsbeiträgen finanzierten Gesundheitsforschungsprojekten die Frage, ob, wie und was Patienten oder auch noch Gesunde von den Ergebnissen haben zu den wesentlichen Fragen und Zielen gehört. Und da neues Wissen sich meist nicht nur durch seine bloße Existenz verbreitet, sollten Gedanken zu seiner Dissemination zum integralen Bestandteil von Gesundheitsforschung gehören bzw. in engem Kontakt angestellt werden.
Eigentlich sollte man erwarten können, dass zumindest in öffentlichen, d.h. aus Steuergeldern oder Sozialversicherungsbeiträgen finanzierten Gesundheitsforschungsprojekten die Frage, ob, wie und was Patienten oder auch noch Gesunde von den Ergebnissen haben zu den wesentlichen Fragen und Zielen gehört. Und da neues Wissen sich meist nicht nur durch seine bloße Existenz verbreitet, sollten Gedanken zu seiner Dissemination zum integralen Bestandteil von Gesundheitsforschung gehören bzw. in engem Kontakt angestellt werden.
Dass dem tatsächlich nicht so ist, hat Gerd Antes, Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums am Institut für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik des Universitätsklinikums Freiburg, am 20. Juni 2011 in einem bemerkenswerten Beitrag in der "FAZNET" pointiert dargestellt.
Anlässlich der öffentlichen Präsentation eines auf sechs Zentren der Gesundheitsforschung für Volkskrankheiten konzentrierten staatlichen Rahmenprogramms stellt er u.a. fest: "Wie diese Priorisierung zustande gekommen ist, wird nicht verraten. Dazu kommen Aktionsfelder, deren Beschreibung in Diktion und Inhalt allerdings eher einem Wirtschaftsprogramm denn einem Gesundheitsforschungsprogramm ähnelt. Während Begriffe wie Methodik, Ethik oder Lebensqualität ein bis sechsmal im gesamten Programm auftauchen, zählt man Wirtschaft oder Gesundheitswirtschaft über fünfzigmal. Folgerichtig taucht die Gesundheitswirtschaft als eigenes Aktionsfeld des Rahmenprogramms auf, was vermutlich ein Novum in einem deutschen Forschungsstrategieplan ist. So wie in dem gesamten Programm Marktreife, Gesundheit als Wachstumsmarkt und die Beseitigung von Barrieren betont werden, liegt die Gefahr auf der Hand, dass Wissenschafts- und Forschungsprinzipien beschädigt werden. … Aus Patientensicht könnte hier angemerkt werden, dass Innovation kein Wert per se ist, sondern dass neue Verfahren, Medikamente und Geräte daran zu messen sind, dass sie bei patientenrelevanten Ergebnissen eine überzeugende Nutzen-Schadens-Bilanz haben. Diese Forderung scheint im Rahmenplan untergeordnete Bedeutung zu haben. Die Botschaft ist eher, dass eine gute Grundlagenwissenschaft zentrale Bedeutung hat und alles weitere, insbesondere die Implementierung in der Praxis, sich dann von allein ergibt."
Dies liegt daran, so Antes weiter, dass im Konzept der Volkskrankheiten eine der wichtigsten und sehr weit verbreiteten Krankheiten (fehlt), nämlich die Unwissenheit. Sie trifft den normalen Bürger hart, ist aber auch in höheren Kreisen inklusive Parlament weit verbreitet. In Kanada ist deswegen 2001 der Begriff Knowledge Translation geprägt worden. Diese Übersetzung von Wissen umfasst die Generierung und die systematische und intelligente Umsetzung von Wissen. Während in Amerika, Kanada, Australien, Großbritannien und anderen Ländern diese Begrifflichkeit die Grundlage für die Forschungsstrukturen bildet, taucht diese Denkweise im deutschen Rahmenplan gar nicht auf."
Wem dazu selber nichts einfällt, konnte sich seit Mai 2011 in der englischsprachigen und kann sich seit wenigen Tagen auch in einer deutschsprachigen Fassung der von der "European Science Foundation" - einer von 78 europäischen Instituten getragenen öffentlichen Stiftung - erstellten Studie "Implementation of Medical Research in Clinical Practice" eine Menge Hinweise auf die Schlaglöcher des deutschen Weg zu Wissen und dessen intelligenter Nutzung besorgen. Die dort dokumentierte Wirklichkeit in vielen anderen europäischen Ländern hilft zu erkennen, dass und was durchaus inhaltlich und finanziell möglich ist. Die empfohlenen Instrumente, Methoden und inhaltlichen Herangehensweisen reichen von der Intensivierung von evidence based medicine, der Schaffung und Nutzung von Leitlinien, bis zur intensiven Nutzung von evidenten Audit- und Feedbackinstrumenten.
Der laut Antes "zunehmende Abstand bei der patientenorientierten Forschung zwischen Deutschland und den führenden Ländern" wird in dem bereits erwähnten 76-Seiten-Report "FORWARD LOOK Implementation of Medical Research in Clinical Practice durch den Vergleich der in einer Reihe von vergleichbaren Ländern vorhandenen Praktiken mit der Realität in Deutschland plastisch. Der Bericht ist in einer Langfassung von 76 Seiten in englischer und zusammengefasst auf sechs Seiten in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.
Der Artikel Medizinforschung: Für Patienten forschen, nicht für die Bilanzen von Gerd Antes ist online kostenlos zu erhalten.
Bernard Braun, 28.6.11
USA: Wie der rein kommerzielle Verkauf von Rezeptdaten an die Pharmaindustrie zum Verfassungsrecht auf "freie Rede" wird.
 Am 26. Mai 2011 warnten drei Herausgeber des renommierten "New England Journal of Medicine" davor, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel der Redefreiheit die patient- und arztbezogene Aufbereitung von Rezeptinformationen durch so genannte "data mining"-Firmen für die Vertriebsinteressen der Pharmaindustrie (dem so genannten "detailing") für zulässig erklärt. Dem Rechtsstreit lag ein Gesetz des Bundesstaates Vermont zugrunde, das die Weitergabe derartiger Daten für diese kommerziellen Zwecke (ausdrücklich aber nicht für Forschungszwecke) verboten hatte und sich positive Effekte zur Senkung der Arzneimittelausgaben und Sicherung der Arzneimittelsicherheit erhofft hatte.
Am 26. Mai 2011 warnten drei Herausgeber des renommierten "New England Journal of Medicine" davor, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel der Redefreiheit die patient- und arztbezogene Aufbereitung von Rezeptinformationen durch so genannte "data mining"-Firmen für die Vertriebsinteressen der Pharmaindustrie (dem so genannten "detailing") für zulässig erklärt. Dem Rechtsstreit lag ein Gesetz des Bundesstaates Vermont zugrunde, das die Weitergabe derartiger Daten für diese kommerziellen Zwecke (ausdrücklich aber nicht für Forschungszwecke) verboten hatte und sich positive Effekte zur Senkung der Arzneimittelausgaben und Sicherung der Arzneimittelsicherheit erhofft hatte.
Der Datenhandel läuft so, dass sämtliche Rezeptdaten, die bei Apotheken zusammenlaufen, also Informationen über die Art und Menge von Verordnungen, der Arztname und soziodemografische Angaben zum Patienten, von diesen an Firmen weiterverkauft werden, die diese Daten so aufbereiten, dass sie von den Außendienstmitarbeitern der Pharmaunternehmen für die Direktwerbung oder die wie auch immer geartete Einflussnahme auf das Verordnungsverhalten einzelner Ärzte genutzt werden können. Zur Aufbereitung gehören patient- wie arztbezogene Verschreibungsgeschichten. Durch die Kenntnis des konkreten Arztes können die "data mining"-Firmen dem Verkaufsdatensatz durch einen Link zum Masterfile der "American Medical Association" (AMA) u.a. auch noch Informationen über die Ausbildung des Arztes und Praxisdetails hinzufügen. Das Ganze gleicht also einer Art Marketing-"Schlaraffenland" für die Pharmaindustrie, das die Empfänger der Rezepte, ohne dass sie einen Nutzen davon haben, letztlich über die Medikamentenpreise bezahlen.
Gegen das Gesetz, das dies zumindest Vermont verboten hatte, klagte u.a. die auch in Deutschland aktive Firma IMS Health. Sie sah in ihm eine Einschränkung der mit dem First Amendement zur US-Verfassung zum unverzichtbaren Kern der Verfassung gezählten Redefreiheit.
Die NEJM-Herausgeber wiesen dagegen sehr darauf hin, dass es hier nicht um den Schutz eines Verfassungsrecht geht, sondern um schlichte Geschäftemacherei ohne jeglichen Verfassungsrang: "As medical journal editors committed to the open communication of medical knowledge, we are strong proponents of First Amendment protection for speakers who attempt to communicate important evidence-based health information or advocate for patients and physicians' rights. But, the doctor-patient relationship is a sacred trust, and the sale of physicians' confidential prescribing information puts pa-tients' highly private medical information at risk. Why should this information be sold to data-mining and drug companies as a commodity, when it offers no benefit to patients and their physicians? This undesirable practice is nothing more than commercial conduct — not speech — and it is not in the best interest of the health of the American people." Sie wiesen ferner darauf hin, dass überhaupt nur 3% der Ärzte eine der wenigen Möglichkeiten kennt, einen Teil ihrer sie identifizierenden Daten zu verbergen oder nicht weitergeben zu lassen.
Trotz dieser und ähnlicher Einwände erklärte der "Supreme Court" am 23. Juni 2011 mit eine rMehrheit von sechs zu drei Stimmen das Gesetz zu einem Verstoß gegen die in der US-Verfassung durch den ersten Zusatz verankerte und auch sehr hoch geachtete Redefreiheit. Damit haben die Apotheken, die "data mining"-Unternehmen und die Pharmaunternehmen auch in Vermont wieder alle Freiheiten über die Daten von Ärzten und PatientInnen miteinander "zu reden" und brauchen auch nicht zu fürchten, dass andere Bundesstaaten das Gesetz übernehmen. Zugleich wurde damit zum ersten Mal in einem demokratischen Land die Vorbereitung und die Abwicklung rein kommerzieller und zum Teil auch qualitativ fragwürdiger Geschäfte zu einem schützenswerten Verfassungsgut höchstrichterlich aufgehübscht und gegen praktische Kritik immunisiert. Fragwürdig meint z.B. die nicht selten an Drückermethoden erinnernden "Beratungstätigkeiten" von Pharmavertretern bei den mittels dieser Daten identifizierten ärztlichen Wenigverordnern von Medikamenten.
Sieht man sich, sensibilisiert durch den Rechtsstreit in den USA an, was die deutsche Dependanz der Firma IMS Health an Dienstleistungen vor allem für die hiesigen "detailer" der Pharmaindustrie anbietet, fällt die geringe Transparenz über die Gewinnung der dazu genutzten Daten auf.
IMS bietet beispielsweise folgende Leistungen an:
• "Sales Optimization: Die IMS Sales Optimization Lösungen schaffen regionale Transparenz über die Vertriebs- und Verschreibungsaktivitäten in allen wichtigen Distributionskanälen. Damit können sowohl Führungskräfte in Vertrieb und Marketing als auch die einzelnen Außendienstmitarbeiter Potenziale und Ziele besser erkennen und ihre Aktivitäten auf einer verlässlichen Basis planen und kontrollieren."
• Das Leistungspaket "IMS Disease Analyzer liefert retrospektive Analysen tatsächlicher Therapie- und Krankheitsverläufe auf Patientenebene in deutschen Arzt-Praxen. Die erhobenen Daten erlauben eine Verknüpfung zwischen Arzt, Patient, Diagnose und Therapie. IMS Disease Analyzer bietet Entscheidungshilfen zu Fragen in allen Phasen des Produktlebenszyklus und unterstützt eine optimierte Produktpositionierung und Potenzialbestimmung. Als Datenquelle dienen Patientenkonsultations-Daten aus Praxiscomputern von mehr als 1.000 deutschen Arztpraxen (internationale Daten aus 3 weiteren europäischen Ländern stehen zusätzlich zur Verfügung). Insgesamt liegen Informationen zu mehr als 8 Mio. Patienten mit über 100 Mio. Verordnungen über einen Zeitraum von 12 Jahre vor."
Hier stellt sich die Frage, ob es sich nicht um Daten handelt, die primär für andere Zwecke und vor allem auf Kosten der Krankenversicherten generiert und gesammelt wurden. Mit Sicherheit werden diese Daten also nicht deshalb produziert, damit sie Firmen wie IMS wie auch immer aufbereitet weiterverkaufen können und dabei keinen erkennbaren substantiellen Nutzen für Patienten und Ärzte verfolgen.
Das 53 Seiten-Urteil des Supreme Court of the United States ist kostenlos erhältlich. Lohnenswert zu lesen sind sowohl das Mehrheits- als auch das Minderheitsvotum der mehrheitlich von den beiden Bush-Administrationen berufenen obersten Bundesrichter.
Bernard Braun, 24.6.11
"Bewertet wird das, was beim Bewohner tatsächlich ankommt": Qualitäts-Indikatoren für Altenpflege liegen vor - und was nun?
 Mitten in die unsägliche Situation, dass eine nette Weihnachtsfeier im Altenpflegeheim die fehlerhafte Ausgabe von Arzneimitteln an HeimbewohnerInnen aufwiegen oder ausgleichen kann und Prüfberichte über Altenheime nicht veröffentlicht werden dürfen, legt jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlich gesicherter, machbarer und sogar innerhalb des Projekts praktisch erprobter Indikatoren zur Erhebung und Bewertung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe vor. Sie wurde zwischen 2008 und 2011 im Auftrag von Gesundheits- und Familienministerium von MitarbeiterInnen des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) sowie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) erarbeitet.
Mitten in die unsägliche Situation, dass eine nette Weihnachtsfeier im Altenpflegeheim die fehlerhafte Ausgabe von Arzneimitteln an HeimbewohnerInnen aufwiegen oder ausgleichen kann und Prüfberichte über Altenheime nicht veröffentlicht werden dürfen, legt jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlich gesicherter, machbarer und sogar innerhalb des Projekts praktisch erprobter Indikatoren zur Erhebung und Bewertung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe vor. Sie wurde zwischen 2008 und 2011 im Auftrag von Gesundheits- und Familienministerium von MitarbeiterInnen des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) sowie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) erarbeitet.
Wegen der bescheidenen Wirklichkeit der (Ergebnis)-Qualitätsaktivitäten in Deutschland heben die AutorInnen vor ihren detaillierteren Vorschlägen ein "gemeinsames Grundverständnis von Versorgungsergebnissen" hervor: "Ergebnisse der vollstationären pflegerischen Versorgung umfassen danach messbare Veränderungen des Gesundheitszustands, der Wahrnehmung und des Erlebens der Bewohner, die durch die Unterstützung der Einrichtung bzw. durch das Handeln ihrer Mitarbeiter bewirkt werden. Ergebnisqualität ist dementsprechend eine Eigenschaft von Versorgungsergebnissen, die mit einer bewertenden Aussage beschrieben wird." Für besonders wichtig halten sie, "dass sich die Indikatoren auf Ergebnisse beziehen, die von einer Einrichtung und ihren Mitarbeitern maßgeblich beeinflusst werden können. Darüber hinaus sollten sie sich für einen seriösen Vergleich der Qualität zwischen Einrichtungen eignen."
Im Detail schlagen sie 15 Indikatoren als geeignet vor: Erhalt oder Verbesserung der Mobilität (zwei Indikatoren, die abhängig vom Grad der kognitiven Einbußen sind), Selbständigkeitserhalt oder -verbesserung bei Alltagsverrichtungen (zwei Indikatoren), Selbständigkeitserhalt oder -verbesserung bei der Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte, Dekubitusentstehung (zwei Indikatoren je nach Dekubitusrisiko), Stürze mit gravierenden Folgen (zwei Indikatoren), Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (zwei Indikatoren), Integrationsgespräch für Bewohner nach dem Heimeinzug, Einsatz von Gurtfixierungen, Einschätzung von Verhaltensauffälligkeiten bei Bewohnern mit kognitiven Einbußen, Schmerzmanagement (Schmerzeinschätzung/Information über Schmerz).
Zusätzlich geben sie auch an, welche Indikatoren für die Beurteilung der Ergebnisqualität begrenzt einsetzbar und nicht empfohlen sind bzw. werden können - durchaus aber im Rahmen des internen Qualitätsmanagements nutzbar sind: Häufigkeit von Sondenernährung, Sturzhäufigkeit, Entstehung von Kontrakturen bei Bewohnern mit erheblichen Mobilitätseinbußen, Intensiver Medikamenteneinsatz ohne Überprüfung von Wechsel-/Nebenwirkungen, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Management von Harninkontinenz und Häufigkeit von Medikationsfehlern.
Bei einer dritten Gruppe von Indikatoren "wirft auch der begrenzte Einsatz im internen Qualitätsmanagement Probleme auf. Vielfach steht in Frage, ob hier tatsächlich von einem relevanten Einfluss der Einrichtungen ausgegangen werden kann." Dazu gehören u.a. die Entwöhnung von der Sondenernährung, Ungeplante Krankenhaus-Einweisungen, Häufigkeit von Harnwegsinfekten, Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten, Depression, Angst, Inadäquater Psychopharmakaeinsatz, Im Krankenhaus verstorbene Bewohner, Vorliegen einer Stuhlinkontinenz, Nosokomiale Infektionen, Grippeimpfungen, Chronische Wunden und Frakturen/Verletzungen.
Zu den so genannten "objektiven Indikatoren" zählen die Pflegeexperten schließlich noch sechs Indikatoren für den Regelbetrieb: Grad der Möglichkeit zur Möblierung, Qualität der Wäscheversorgung, Teilnahme an Aktivitäten und Kommunikation, Aktionsradius von Bewohnern mit deutlichen Mobilitätseinschränkungen, Risiko sozialer Isolation (mit Bedarf an Weiterentwicklung) und Mitarbeiterzeit pro Bewohner (mit Bedarf an Weiterentwicklung).
Auf der Basis einer zehnmonatigen Versuchsphase an Bewohnern von 46 Heimen halten die AutorInnen ihre Vorschläge auch mit einem geringen zusatzaufwand für praktikabel , an die "heutigen Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen anschlussfähig und in bestehende Abläufe integrierbar." Den zusätzlichen Aufwand halten sie für gering bzw. müsste er im Rahmen einer fachgerechten Pflege sowieso erbracht werden.
Ihr Fazit lautet: "Mit dem vorgestellten Set gesundheitsbezogener Indikatoren stehen die Voraussetzungen für ein innovatives Qualitätsberichtssystem zur Verfügung. Mit einem solchen System würde der Anspruch, Ergebnisqualität in den Mittelpunkt von Qualitätssicherung und Qualitätsbeurteilung zu stellen, nach vielen Jahren Diskussion umgesetzt. In Deutschland würde damit auch frühzeitig Anschluss gefunden an den aktuellen internationalen Entwicklungstrend. … Die Eigenverantwortung der Einrichtungen würde gestärkt und ein erheblicher Anreiz für "gute Pflege" im Interesse des Bewohners geschaffen."
Was die tatsächliche Chancen für den Einsatz der Indikatoren zur Qualitätssicherung in stationären Altenpflegeeinrichtungen angeht, ist aber nach Meinung des Staatssekretärs im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Ilka, auch trotz der ausdrücklich in Auftrag gegebenen und positiv verlaufenen praktischen ERprobung offen: "Die Ergebnisse lassen sich jedoch auf das heutige System nur schrittweise übertragen und benötigen weitere sorgfältige Vorbereitungen."
Der im März 2011 veröffentlichte Abschlussbericht "Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe von Klaus Wingenfeld, Dietrich Engels et al. umfasst 394 Seiten und ist kostenlos erhältlich. Er sollte in keiner künftigen Debatte über Pflegequalität unerwähnt bleiben.
Bernard Braun, 20.6.11
Unerwünschte Folgen der Fallpauschalen in Krankenhäusern für die Rehabilitation: Aktuelle Ergebnisse der REDIA-Studie
 Die Zahl der Patienten, die bei Aufnahme in eine Rehabilitationsmaßnahme vermehrt unter Komplikationen litten sowie einen deutlich verschlechterten Gesundheits- und Mobilitätszustand aufwiesen, stieg seit der Einführung des Fallpauschalen- oder DRG-Systems in deutschen Akutkrankenhäusern stabil an.
Die Zahl der Patienten, die bei Aufnahme in eine Rehabilitationsmaßnahme vermehrt unter Komplikationen litten sowie einen deutlich verschlechterten Gesundheits- und Mobilitätszustand aufwiesen, stieg seit der Einführung des Fallpauschalen- oder DRG-Systems in deutschen Akutkrankenhäusern stabil an.
So stieg etwa der der Anteil von Hüftpatienten, die wegen Schmerzen und geklammerten Wundnähten in der ersten Woche nicht an der Physiotherapie, also der eigentlichen Leistung in der Rehabilitation, teilnehmen konnten, von 5,6 % auf 39,4 %. Deutlich nahm auch der Medikationsaufwand in der Reha zu: die Verabreichung von Herz entlastenden Nitraten wuchs von 1,2 % (2003) auf 33,3 % (2010) und die Gabe von Schmerzpräparaten nahm von 4% auf 32 % zu. Die Einnahme von Blutverdünnern entwickelte sich gar von 3,1 % (2003) auf 57,4 % (2010) bei kardiologischen Patienten. Dies sind akutmedizinische Maßnahmen, die eigentlich nichts mehr in der Rehabilitationsphase zu suchen haben, d.h. deren Ziel beeinträchtigen kann.
Zusätzlich zu der offensichtlich zunehmenden Entlassung von noch akutmedizinisch behandlungsbedürftigen Patienten aus dem Krankenhaus in die Rehabilitation gab es aber auch noch vermehrt Probleme mit dem Verlegungs- oder Entlassungsmanagement der Krankenhäuser oder der sonstigen für eine nahtlose und zügige Versorgung verantwortlichen Akteure und Institutionen (z.B. auch die Gesetzliche Krankenversicherung.
Diese auch bereits im Berliner/Bremer Forschungsvorhaben "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System (WAMP)" mehrfach festgestellte unerwünschte Auswirkung oder nicht zu der DRG-Einführung passende Entwicklung führt u.a. zu einer Verlängerung der Übergangszeit zwischen Entlassung aus dem Krankenhaus und der Aufnahme in der Reha-Klinik führt. Diese häusliche Übergangszeit ist - so die REDIA-Studie - mit therapeutisch und ökonomisch relevanten Risiken verbunden: Häufig wird die Thromboseprophylaxe unterbrochen und die Wundversorgung erfolgt nicht fachgerecht; in 2003 waren 1,8% der kardiologischen Patienten von Komplikationen wie Pleuraerguß und Wundheilungsstörungen während der Übergangszeit betroffen, in 2010 dagegen 18%.
Das sind einige der gesicherten Erkenntnisse der aktuell veröffentlichten Ergebnisse der so genannten REDIA-Studie (REhabilitation und DIAgnosis Related Groups-Studie) aus dem Centrum für Krankenhaus-Management an der Universität Münster.
Die Mitarbeiter dieses Instituts gehören zu den wenigen WissenschaftlerInnengruppen, die trotz der jahrelangen Blockade des Beginns der gesetzlich vorgeschriebenen inhaltlich hochwertigen Begleitforschung begannen, die Auswirkungen der Einführung des Fallpauschalen-Vergütungssystems der Diagnosis related groups (DRG) zu erforschen. REDIA ist die einzige prospektive, multizentrische, zufallsgesteuerte Langzeitstudie über die Auswirkungen der DRG-Einführung im Akutbereich auf medizinische Leistungsanforderungen und Kosten in der Rehabilitation.
Mit Unterstützung der "Deutschen Rentenversicherung" untersuchten die Münsteraner Forscher seit 2003, ob die durch das DRG-System ausgelösten Aktivitäten, die Liegezeit und die Versorgungskosten in den Akutkrankenhäuser zu senken zu unerwünschten Effekten für andere Behandlungsbereiche und vor allem die PatientInnen führt.
Dies geschah in drei Erhebungsphasen 2003/04 vor DRG-Einführung;2005 und 2007 während der Konvergenzphase sowie 2009/10 und 2011 nach Ende der Konvergenzphase. Dabei wurden patientenindividuelle (Depression und Angst umfassende), medizinische (den Patientenzustand beschreibende), ökonomische (Arbeitsaufwand und Kosten berücksichtigende), entgeltbezogene (die Entwicklung der Vergütung von Reha-Leistungen zeigende) und systemische (die Anreizwirkungen von politischen Eingriffen in das Gesundheitssystem reflektierende) Daten von 956 Anschlussheilbehandlung (AHB)-Patienten der Kardiologie (Bypass-OP; Myokardinfarkt) und 1.334 Patienten der Orthopädie (Hüft-TEP; Knie-TEP; Bandscheiben-OP) in 27 ausgewählten stationären und ambulanten Reha—Einrichtungen erfasst. Die medizinischen Patientendaten (Laborwerte, Medikation, Morbidität) wurden über Fragebögen durch die behandelnden Ärzte erhoben. Die Patienten individuellen Daten zur persönlichen Befindlichkeit (Mobilität, Angst, Depression) wurden abgefragt bei Aufnahme des Patienten in die Reha sowie sechs Monate nach Entlassung.
Die Auswahl der Patienten erfolgte zufällig, so dass sowohl Patienten der Rentenversicherung als auch der gesetzlichen Krankenversicherung repräsentiert sind und die Scheregrade der Patienten sind zufallsverteilt abgebildet. Die darüber hinaus durchgeführte Strukturerhebung in Verbindung mit einer Mitarbeiterbefragung machte die Veränderungen im Arbeitsaufwand, in der Organisation sowie der baulichen und technischen Ausstattung transparent.
Die kompletten Ergebnisse der Studie finden sich in dem von Wilfried von Eiff, Stefan Schüring und Christopher Niehues verfassten Buch "REDIA: Auswirkungen der DRG-Einführung auf die medizinische Rehabilitation. Ergebnisse einer prospektiven medizin-ökonomischen Langzeitstudie 2003 bis 2011", das 2011 im LIT-Verlag Münster erschienen und im Buchhandel erhältlich ist.
Einen kostenlosen Überblick zu den genannten und weiteren Ergebnissen liefert unter dem Titel "Rehabilitation unter Kosten- und Qualitätsdruck Konsequenzen der DRG-Einführung für Patienten und Versorgungsstruktur" ein kurzer Text des Projektleiters Wilfried von Eiff.
Bernard Braun, 24.5.11
Warum Weniger auch Mehr sein kann oder es muss nicht immer CT sein.
 In der notwendigen Debatte wie der im deutschen Gesundheitswesen immer noch hohe Anteil von Über- und Fehlversorgung abgebaut werden kann, braucht man häufig keinerlei neuen Techniken, sondern es reicht auch manchmal die Rückbesinnung und Anwendung traditioneller Methoden. Ein mittlerweile recht bekanntes, aber leider noch nicht überall verbreitete Vorgehen dieser Art, ist der "watch-and-wait"-Ansatz" bei Mittelohrentzündungen von Kindern als Alternative zum vorschnellen und systematisch riskanten (Resistenzbildung) Einsatz von Antibiotika.
In der notwendigen Debatte wie der im deutschen Gesundheitswesen immer noch hohe Anteil von Über- und Fehlversorgung abgebaut werden kann, braucht man häufig keinerlei neuen Techniken, sondern es reicht auch manchmal die Rückbesinnung und Anwendung traditioneller Methoden. Ein mittlerweile recht bekanntes, aber leider noch nicht überall verbreitete Vorgehen dieser Art, ist der "watch-and-wait"-Ansatz" bei Mittelohrentzündungen von Kindern als Alternative zum vorschnellen und systematisch riskanten (Resistenzbildung) Einsatz von Antibiotika.
Eine gerade im amerikanischen Fachjournal "Pediatrics" veröffentliche Studie über die Diagnostik von kleineren stumpfen Schädeltraumata bei Kindern, unterstreicht die Bedeutung und den Nutzen der klinischen Beobachtung, um eine schnelle Computertomographie (CT) zu vermeiden, die oft unnötig und dann nur gesundheitlich nachteilig ist.
Oft äußerten Ärzte Skrupel, sie wüssten nicht, ob der Verzicht nicht doch zu mehr gesundheitlichen Nachteilen für die jungen Patienten führten, sie also z.B. durch den dumpfen Schlag auf den Schädel schwere Hirnverletzungen hätten, die man sofort behandeln müsste.
Einen Teil dieser Ängste dämpft diese Studie jetzt: WissenschaftlerInnen untersuchten dazu die Daten von rund 40.000 Kindern, die Notfallstationen von Krankenhäusern in den USA mit kleinen Schädeltraumata aufsuchten. 14% von ihnen wurden im Rahmen der Studie zuerst für eine bestimmte Zeit klinisch beobachtet - vor einer Entscheidung, ein CT durchzuführen oder nicht. Die anderen 86% wurden nicht beobachtet, d.h. inklusive CT wie gewohnt behandelt.
Das Ergebnis war ein signifikant geringerer Anteil der zuerst klinisch beobachteten Gruppe, der per CT untersucht wurde (31% versus 35%). Wichtig ist aber auch, dass die Häufigkeit einer endgültig diagnostizierten Hirnverletzung sich in den beiden Gruppen nicht unterschied, d.h. das Risiko durch die Option der klinischen Beobachtung, den verletzten Kindern einen zusätzlichen Schaden zuzufügen sehr gering ist.
Die AutorInnen berechnen zusammenfassend, dass durch die primäre Wahl der klinischen Beobachtung 39 unnötige CT-Untersuchungen pro 1.000 Kinder mit kleinen Schädeltraumata vermieden werden könnten.
Eine am 9. Mai 2011 zunächst online veröffentlichte Version des Aufsatzes "The Effect of Observation on Cranial Computed Tomography Utilization for Children After Blunt Head Trauma" von Lise E. Nigrovic, Jeff E. Schunk, Adele Foerster, Arthur Cooper, Michelle Miskin, Shireen M. Atabaki, John Hoyle, Peter S. Dayan, James F. Holmes, Nathan Kuppermann und der Traumatic Brain Injury Group for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network der Zeitschrift "Pediatrics" (10.1542/peds.2010-3373) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.5.11
Wirtschaftlichkeitsgebot einer gesetzlichen Krankenkasse muss gegen ihre Pflicht zur "humanen Krankenbehandlung" abgewogen werden!
 "Hiernach erschiene es nicht nur inhuman, sondern geradezu verwerflich, eine Patientin mit Herzbeschwerden und Luftnot unter Hinweis auf den ohnehin bevorstehenden Tod nicht in die Krankenhausbehandlung aufzunehmen." So lautet der Tenor eines Urteils des Sozialgerichts Hannover vom 28.04.2010 (S 19 KR 961/08) gegen eine Krankenkasse, die sich gestützt auf mehrere Gutachten ihres Medizinischen Dienstes geweigert hatte, die Rechnung für die akutmedizinische Krankenhausbehandlung einer bei ihr versicherten Frau zu bezahlen, die nach dieser Behandlung verstorben war.
"Hiernach erschiene es nicht nur inhuman, sondern geradezu verwerflich, eine Patientin mit Herzbeschwerden und Luftnot unter Hinweis auf den ohnehin bevorstehenden Tod nicht in die Krankenhausbehandlung aufzunehmen." So lautet der Tenor eines Urteils des Sozialgerichts Hannover vom 28.04.2010 (S 19 KR 961/08) gegen eine Krankenkasse, die sich gestützt auf mehrere Gutachten ihres Medizinischen Dienstes geweigert hatte, die Rechnung für die akutmedizinische Krankenhausbehandlung einer bei ihr versicherten Frau zu bezahlen, die nach dieser Behandlung verstorben war.
Die zentrale Begründung für diese Krankenkasse lautete, dass das Krankenhaus die verschiedenen therapeutischen Leistungen bei einer Reihe von schwerwiegenden Herz-/Kreislaufzuständen (Zusammenfassung des gesundheitlichen Zustands im Urteil: "globale Herzinsuffizienz, eine Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe, eine akute respiratorische Insuffizienz, eine Aortenklappenstenose mit Insuffizienz, ein Diabetes mellitus, eine arterielle Hypertonie, ein Delia und eine Hypokaliämie") unnötigerweise erbracht hätte, da das Versterben absehbar gewesen wäre. Auch wenn der Hausarzt dieser Patientin diese als Notfall durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen ließ, wären für die Schmerzbehandlung und die angeblich einzig notwendige Sterbebegleitung einzig nur ambulante oder Leistungen eines Hospizes notwendig gewesen - so die Krankenkasse.
Für das Gericht waren nach der Einholung eines weiteren Gutachtens zwei Argumente von zentraler Bedeutung für sein Urteil, die Krankenkasse müsse die Krankenhaus-Rechnung bezahlen:
• "Im Rahmen der Behandlung sind die besonderen Mittel des Krankenhauses durch ärztliche Behandlung und aufwändige pflegerische Versorgung zum Einsatz gekommen. Die Krankenhausbehandlung ist medizinisch begründet gewesen und stand nicht im Widerspruch zur allgemeinen oder besonderen ärztlichen Erfahrung. Aufgrund der durchgeführten therapeutischen Maßnahmen ist die Behandlung auch nicht als Sterbebegleitung, sondern vielmehr als stationäre Krankenhausbehandlung zu qualifizieren. Eine Versorgung im ambulanten Bereich ist aufgrund der besonderen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen nicht möglich gewesen. Eine Hospizbehandlung ist ebenfalls nicht angezeigt gewesen, da die instabile Gesundheitssituation der Patientin eine durchgehende Arztpräsenz notwendig gemacht hat."
• Sein zweites Argument würdigt eine in Zeichen knapper Kassen und des Wettbewerbs allzu leicht vergessene Bestimmung des Paragraphen 70 SGB V: "Unabhängig von der festgestellten medizinischen Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung stützt sich der Vergütungsanspruch der Klägerin ergänzend auf § 70 Abs.2 SGBV. Die Leistungsverweigerung der Beklagten verstößt in eklatanter Weise gegen das Humanitätsgebot. Nach der Vorschrift des § 70 Abs. 2 SGB V haben die Krankenkassen und die Leistungserbringer durch geeignete Maßnahmen auf eine humane Krankenbehandlung ihrer Versicherten hinzuwirken. Die Vorschrift richtet sich an Krankenkassen und Leistungserbringer und ist bei der Auslegung, ob und in welcher Weise Versicherte Anspruch auf eine bestimmte Art der Krankenbehandlung haben, als Auslegungsrichtlinie zu berücksichtigen … . Dabei kommt der Verpflichtung zur Herbeiführung einer humanen Krankenbehandlung gerade Bedeutung bei der Abwägung mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot zu. Sie wird demgemäß in gerichtlichen Auseinandersetzungen über einen Anspruch auf eine bestimmte Leistung in der Weise herangezogen, dass sie diesen stützen soll."
Krankenkassen achten einerseits und auch im Interesse vieler schwer kranker alter Versicherter zu Recht darauf, dass nicht die Humanität der Behandlung dadurch gefährdet wird, dass Sterbende mit unnötigen und oftmals nur quälenden Leistungen überschüttet werden und völlig unsinnige Ausgaben entstehen. Andererseits sollten sie dabei aber nicht die Regeln des gesunden Menschenverstands vergessen und aktiv das qualvolle Ableben eines Versicherten provozieren oder billigend eine Verkürzung des Lebens in Kauf nehmen.
Das Urteil des SG Hannover ist komplett kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 27.2.11
Vitamin D: "Vitamin of the year" oder meist unnötiger Konsum mit Tendenz zur riskanten Über- und Fehlversorgung?
 Richtig ist, dass die menschliche Haut in den Wintermonaten wegen des geringeren Sonnenlichts weniger Vitamin D produziert. Und richtig ist auch, dass ein Mangel dieses Vitamins nach weiteren dadurch beeinflussten biochemischen Prozessen bei Kindern zu Rachitis bzw. Knochenverbiegungen führen und bei Erwachsenen u.a. zur Osteoporose beitragen kann.
Richtig ist, dass die menschliche Haut in den Wintermonaten wegen des geringeren Sonnenlichts weniger Vitamin D produziert. Und richtig ist auch, dass ein Mangel dieses Vitamins nach weiteren dadurch beeinflussten biochemischen Prozessen bei Kindern zu Rachitis bzw. Knochenverbiegungen führen und bei Erwachsenen u.a. zur Osteoporose beitragen kann.
Ob die von vielen traditionellen und alternativen GesundheitsexpertInnen und Dienstleistern als Gegenmittel empfohlene kräftige Zufuhr des Vitamins D und zusätzlich von Calcium auch noch richtig bzw. notwendig und nützlich ist, lässt sich nach den Erkenntnissen eines gerade veröffentlichten Consensus-Reports des "US-"Institute of Medicine (IOM)" in Zweifel ziehen. Und auch an der ebenfalls weit verbreiteten Annahme, die Einnahme natürlicher Stoffe sei prinzipiell harmlos und in keinem Fall schädlich, gibt es handfeste Zweifel.
Im Auftrag us-amerikanischer und kanadischer Public Health-Einrichtungen reviewte eine beim unabhängigen IOM eingerichtete Gruppe von 14 Wissenschaftlern mehr als 1.000 Studien über das Vitamin D und führte zusätztlich mit zahlreichen Experten Interviews zu verschiedenen Aspekten der Wirkung des Vitamins.
Die wesentlichen Ergebnisse lauteten folgendermaßen:
• Das Vitamin D spielt unbestritten eine positive und nützliche Rolle beim gesamten Stoffwechsel der Knochen und damit auch bei deren Stabilität. Die zusätzliche Zufuhr von Vitamin D kann daher bei spezifischen Mängeln der Knochendichte und einem dadurch erhöhten Osteoporoserisiko durchaus notwendig und sinnvoll sein.
• Nur unzureichende Evidenz gibt es aber für den gesundheitlichen Nutzen von Vitamin D bei Prozessen und Preoblemen außerhalb des Knochenbereichs wie etwa bei der Förderung des Immunverhaltens, dem Schutz gegen Krebs, vor Herz-/Kreislauferkrankungen oder Diabetes.
• Die IOM-Experten halten einen Vitamin-Spiegel von 20 Nanogramm pro Milliliter und damit, wenn nötig, auch wesentlich kleineren Dosen als immer wieder vorgeschlagen (600 bis 800 Internationale Einheiten [IU] pro Tag statt mehr als 4.000) für den Erhalt der Knochengesundheit als hinreichend.
• Obwohl die durchschnittliche Einnahme von Vitamin D in den USA unter den gerade genannten Werten liegt, fanden die Wissenschaftlern bei Sichtung der Studien, dass der durchschnittliche Vitamin D-Pegel über den 20 Ng/mL liegt und damit offensichtlich die normale Exposition gegenüber der Sonne allein bereits für eine angemessene Produktion des Vitamins sorgt. Durch die Sonneneinstrahlung werden rund 80 % der benötigten Vitaminmenge produziert.
• Selbst kurze Aufenthalte in der Natur und dann noch bei Sonnenschein reichen daher bereits für eine ausreichende Menge des Vitamins aus. In jedem Fall überwögen außerdem die Risiken eines Sonnenbank-Besuches den möglichen Nutzen, weshalb auch von dieser Versorgungsvariante abzuraten wäre.
• Das Komitee warnt schließlich auch vor dem Konsum hoher Vitamindosen, die wissenschaftlich gesichert zu einer Reihe von unerwünschten gesundheitlichen Effekten führen. Der zu hohe Vitaminspiegel treibt die Calciumwerten im Blut nach oben, was wiederum zu keineswegs harmlosen Erscheinungen wie Harnflut, Übelkeit und Erbrechen sowie Nierenverkalkungen führen kann.
• In der Ausgabe des von einem Wissenschaftlerkreis um das "New England Journal of Medicine" getragenen "Journal Watch Psychiatric" vom 3. Januar 2011" finden sich zusätzlich Ergebnisse mehrerer methodisch hochwertiger Studien, die zeigen, dass es zumindest noch einen positiven Zusammenhang eines normalen Vitamin D-Pegels mit einer Reihe neuropsychiatrischen Erkrankungen (z.B. Depressionen und multiple Sklerose) gibt. Auch in diesen Studien wird aber davor gewarnt, dass bei Werten von über 30 ng/mL kein zusätzlicher Nutzen mehr belegt worden wäre.
Den kompletten Bericht "Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D" gibt es zwar nicht kostenlos herunterzuladen und auszudrucken, aber wer Genaueres wissen will, hat zahlreiche andere Möglichkeiten. Über die Report-Website des IOM erhält man eine kostenlose vierseitige Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Außerdem erhält man hier den Zugang zu der 999 Seiten umfassenden online lesbaren Gesamtversion der Studie.
Zu einem Übersichtstext von Ross AC et al. mit dem Titel "The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: What clinicians need to know" in der Fachzeitschrift "Journal of Clin Endocrinol Metab" gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 10.2.11
Unbequem, unethisch, tabuisiert: Haben KZ-Selektionsrampen, Euthanasie und die Priorisierung im Gesundheitswesen etwas gemein?
 So drastisch bringt das Sondervotum in der gerade veröffentlichten Stellungnahme des durch das "Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrats" aus dem Jahr 2007 eingerichteten Gremiums zum Thema "Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen - Zur normativen Funktion ihrer Bewertung" die damit thematisierten und für eine weitere offene öffentliche Debatte empfohlenen Fragen zum Ausdruck. Den Verfassern von Sondervotum und "Stellungnahme" geht es gemeinsam darum, dass Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche Gruppen, Krankenkassenvertreter oder die Massenmedien, nicht weiter um den "heißen Brei" von Ressourcenallokation, Rationalisierung, Rationierung und Priorisierung herumschweigen, während nicht wenige Patienten oder Pflegebedürftige ihn hautnah nachteilig zu spüren bekommen.
So drastisch bringt das Sondervotum in der gerade veröffentlichten Stellungnahme des durch das "Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrats" aus dem Jahr 2007 eingerichteten Gremiums zum Thema "Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen - Zur normativen Funktion ihrer Bewertung" die damit thematisierten und für eine weitere offene öffentliche Debatte empfohlenen Fragen zum Ausdruck. Den Verfassern von Sondervotum und "Stellungnahme" geht es gemeinsam darum, dass Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche Gruppen, Krankenkassenvertreter oder die Massenmedien, nicht weiter um den "heißen Brei" von Ressourcenallokation, Rationalisierung, Rationierung und Priorisierung herumschweigen, während nicht wenige Patienten oder Pflegebedürftige ihn hautnah nachteilig zu spüren bekommen.
Auf 81 Seiten breiten die pluralistisch zusammengesetzten Mitglieder des Ethikrates die Fülle der dabei zu berücksichtigenden Fakten, Faktoren und Normen aus und fassen diese Debatte in 12, hier auszugsweise zitierten Feststellungen so zusammen:
• "Eine Erhöhung der auf solidarischer Basis zur Verfügung stehenden Finanzmittel darf … nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Jedoch gibt es auch im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung Grenzen kollektiver Finanzierungsbereitschaft.
• Priorisierung, Rationalisierung und Rationierung (sollten) offen thematisiert werden. Jede Form einer "verdeckten Rationierung" medizinischer Leistungen ist abzulehnen. Notwendige Rationierungsentscheidungen dürfen nicht an den einzelnen Arzt oder die einzelne Pflegekraft delegiert werden.
• Das Sicheinlassen auf das Problem der Verteilung knapper Ressourcen im Gesundheitswesen bedeutet keine Festlegung auf eine "Ökonomisierung" von Entscheidungen. … Verteilungsentscheidungen sind nicht allein Gegenstand wissenschaftlicher Expertise, … Letztlich sind Entscheidungen über den Umfang solidarisch finanzierter Leistungen ethische Entscheidungen, die im gesellschaftlichen Diskurs und auf politischem Wege getroffen werden müssen.
• Zwischen den gesamtgesellschaftlichen Interessen und denjenigen des Einzelnen besteht ein Spannungsverhältnis. Das Prinzip der Menschenwürde und die Grundrechte erfordern einen durch Rechte gesicherten Zugang jedes Bürgers zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Diese Rechte dürfen nicht hinter etwaige Erwägungen zur Steigerung des kollektiven Nutzens zurückgestellt werden. Auch darf der errechnete oder vermutete sozio-ökonomische "Wert" von Individuen oder Gruppen nicht Grundlage von Verteilungsentscheidungen sein.
• Der Gesetzgeber hat zu beachten, dass Fragen der gesundheitspolitischen Mittelverteilung unter Bedingungen der Knappheit Gerechtigkeitsfragen sind, die nicht an wissenschaftliche Institute, Verbände oder Interessengruppen delegierbar sind. Eine Mindestanforderung ist die demokratische Legitimation der Entscheidungsträger; der demokratisch legitimierte Gesetzgeber darf sich seiner Verantwortung nicht entziehen.
• Der verantwortliche Einsatz knapper Ressourcen erfordert es, sie für Maßnahmen einzusetzen, die unter den alltäglichen Versorgungsbedingungen tatsächlich einen Nutzen erbringen.
• Die Transfer- und die Versorgungsforschung sind auszubauen, ebenso die vom Hersteller unabhängige Förderung versorgungsnaher klinischer Studien nach Zulassung eines Medikaments oder Medizinprodukts.
• Es ist eine Publikationspflicht für alle Studien anzustreben, unabhängig von ihrem Ergebnis.
• Im Kontext der Kosten-Nutzen-Bewertung medizinischer Leistungen gibt es aus ethischer und gerechtigkeitstheoretischer Sicht gewichtige Gründe dafür, nicht das Prinzip einer patientengruppenübergreifenden Nutzenmaximierung zu verfolgen.
• Aber auch die Kosteneffektivitätsberechnungen nach einem Effizienzgrenzenkonzept können nicht ethisch "neutral" als Maßstab der Angemessenheit von Erstattungsentscheidungen für Innovationen dienen.
• Die Auswirkungen der aktuellen Vorgaben zur Kosten-Nutzen-Bewertung in Deutschland sind zurzeit wegen des formell unveränderten Anspruchs der Versicherten auf Versorgung mit allem medizinisch Notwendigen im Wesentlichen unschädlich. Sie dienen derzeit nicht als Instrument zur Verteilung knapper Ressourcen, sondern zur Preisfestsetzung.
• Die in Zukunft zu erwartende Notwendigkeit von Rationierungsentscheidungen wird den Gesetzgeber aber zwingen zu klären, in welchem Umfang Leistungsansprüche nach § 27 und § 12 SGB V von einer Kosten-Nutzen-Bewertung beeinflusst werden dürfen und in welchem Verhältnis sich diese zum Kriterium der medizinischen Notwendigkeit verhält."
Dem Plädoyer, die hier angesprochenen Fragen so öffentlich wie möglich zu diskutieren und konsensuale Antworten zu finden, folgen hoffentlich große Teile der interessierten, aktiv und passiv betroffenen BürgerInnen und sollten sich auch nicht wieder in die "(Ver)-Schweigepositionen" zurückfallen oder -drängen lassen.
Beim Einstieg hilft die Lektüre der gesamten, insgesamt verständlich formulierten Stellungnahme ausgezeichnet.
Die Stellungnahme "Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen - Zur normativen Funktion ihrer Bewertung" des Deutschen Ethikrats vom 27. Januar 2011 ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.1.11
Patientenrecht auf fachgerechte Behandlung à la Bundesgerichtshof: Wundheilbehandlung zwischen Antibiotika und Zitronensaft
 Nach § 2 Abs. 1 SGB V (Fünftes Buch des Sozialgesetzbuchs) haben die "Qualität und Wirksamkeit der Leistungen … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen." Und nach dem § 70 SGB V "(haben) … Krankenkassen und Leistungserbringer … eine … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten". Außerdem "muss" die Versorgung "in der fachlich gebotenen Qualität … erbracht werden" und zu einer "humanen Krankenbehandlung" beitragen.
Nach § 2 Abs. 1 SGB V (Fünftes Buch des Sozialgesetzbuchs) haben die "Qualität und Wirksamkeit der Leistungen … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen." Und nach dem § 70 SGB V "(haben) … Krankenkassen und Leistungserbringer … eine … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten". Außerdem "muss" die Versorgung "in der fachlich gebotenen Qualität … erbracht werden" und zu einer "humanen Krankenbehandlung" beitragen.
Auch wenn dieser trotz aller Offenheit unbestimmter Rechtsbegriffe eigentlich unmissverständliche gesetzliche Rahmen bei weitem nicht die Versorgungswirklichkeit für GKV-Versicherte bestimmt, hat der Bundesgerichtshof (BGH) kurz vor Weihnachten 2010 ein bemerkenswertes und aus Patientensicht bedenkliches Urteil gefällt.
Seinem Urteil als Revisionsinstanz lag in den Worten der BGH-Pressemitteilung zum Urteil vom 22. Dezember 2010 folgender vom Landgericht (LG) Mönchengladbach (Urteil vom 15. Januar 2010 - 27 Ks 2/10) ermittelte Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte, Chefarzt und Eigentümer einer privaten Klinik in Nordrhein-Westfalen, hatte "eine (80-jährige) Patientin, bei der er eine Darmoperation kunstgerecht durchführte, vor diesem Eingriff nicht darüber aufgeklärt, dass er zur Behandlung einer nach dieser Operation eventuell auftretenden Wundinfektion auch Zitronensaft verwenden würde. Er war von dessen desinfizierenden Wirkung überzeugt und ließ ihn daher unter nicht sterilen Bedingungen mit üblichen Haushaltsgeräten in der Stationsküche gewinnen. Jedoch konnte es durch den unsterilen Zitronensaft zu einer weiteren bakteriellen Belastung damit behandelter Wunden kommen. Nachdem bei der Patientin tatsächlich eine massive Wundheilungsstörung aufgetreten war, nahm der Angeklagte eine zweite Operation (sog. Reoperation) vor und brachte hierbei sowie in der Folgezeit - neben dem Einsatz herkömmlicher Medikamente (insbesondere von Antibiotika) - mehrfach Zitronensaft in die Wunde ein. Auch jetzt informierte er die Patientin hierüber nicht. Diese verstarb rund zwei Wochen nach dem ersten Eingriff an den Folgen der Wundinfektion."
Auch wenn das LG "keinen hinreichenden Anhalt" gefunden hat, dass die Verwendung des Zitronensaftes für den Eintritt des septischen Herz-Kreislaufversagens mitursächlich war, "hätte der Angeklagte die Patientin aber über den möglichen späteren Einsatz von Zitronensaft schon vor der ersten Operation aufklären müssen. Daher hat es bereits die Einwilligung der Patientin in die Vornahme dieses Eingriffes als unwirksam angesehen und diesen daher als rechtswidrige Körperverletzung gewertet. Weil die durch die Erstoperation bedingte Wundinfektion zum Tode der Patientin geführt hat, hat es den Angeklagten der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig erachtet."
Dazu, so der der 3. Strafsenat des BGH, sei der behandelnde Chefarzt nicht verpflichtet gewesen: "Birgt ein ärztlicher Heileingriff das Risiko, dass sich in seiner Folge eine weitere behandlungsbedürftige Erkrankung oder körperliche Schädigung einstellt, so muss der Arzt den Patienten vor dem ersten Eingriff nur dann über die Art und die Gefahren einer bei Verwirklichung des Risikos notwendigen Nachbehandlung aufklären, wenn dieser ein schwerwiegendes, die Lebensführung eines Patienten besonders belastendes Risiko anhaftet, etwa der Verlust eines Organs. Eine derartige Konstellation lag hier nicht vor."
Selbst wenn die Annahme richtig sein mag, das wiederholte Einbringen von nicht sterilen Zitronenstreifen und Zitronensaft in die Wunde, sei nicht die Ursache für den Tod der Patientin, kümmert zumindest die BGH-Richter noch nicht einmal die Tatsache, dass es sich hier weder um ein für diese Zwecke medizinisch "allgemein" anerkanntes Therapeutikum handelt noch das Einbringen insteriler Mittel in eine offene Wunde etwas mit fachlich gebotener Qualität zu tun hat. In seiner Lesart stellt dies alles vielmehr eine "unerprobte Außenseitermethode" dar. Und der tödliche Ausgang der stationären Behandlung könnte dann als ein "schicksalhafter Krankheitsverlauf" bezeichnet werden.
Gerade weil ein Patient von einem behandelnden Arzt eine wissenschaftlich gesichert wirksame Behandlung und nicht eine selbst nach Ansicht des angeklagten Chefarztes nur selten hilfreiche "unerprobte Außenseitermethode" erwartet, gingen die Richter des LG von einer Aufklärungspflicht vor der ersten Operation aus. Diese Information hätte nämlich "bei der Patientin Zweifel an seiner Fachkompetenz … wecken können mit der Folge, dass sie den Eingriff nicht vom Angeklagten hätte vornehmen lassen." Dieser Überlegung schließen sich aber die BGH-Richter ausdrücklich nicht an.
Damit ist es nur konsequent, dass nahezu alle weiteren Besonderheiten ihrer Behandlung strikt und angesichts ihres Todes fast schon zynisch gegen die Patientin ver- und gewendet werden:
• Die Patientin habe immerhin zuerst und als Alternative zur Zitronensaft-Therapie Antibiotika erhalten,
• es wäre "grundsätzlich noch genügend Zeit vorhanden (gewesen), um die Patientin auf den beabsichtigten Einsatz von Zitronensaft hinzuweisen" (ob dies geschah, bleibt im Moment unklar und auch nicht ermittelbar) und
• sie sei "trotz ihrer erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen sogar noch in der Lage (gewesen), eigenverantwortlich ihre Einwilligung in die Reoperation zu erteilen".
Dies gipfelt in der Feststellung, dass das "maßgebliche Risiko" der Zitronensaftbehandlung "ausschließlich eine gewisse zusätzliche bakterielle Belastung" gewesen sei, "was nicht mit der Gefahr für die künftige Lebensführung eines Patienten vergleichbar ist, dem durch die Nachbehandlung etwa ein Organverlust droht."
Der Chefarzt hätte also vom LG nach Ansicht des BGH wegen der fehlenden Aufklärung des Einsatzes von Zitronensaft nach der ersten Operation nicht wegen Körperverletzung noch insgesamt wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt werden dürfen. Da er seine Patientin aber zumindest vor der zweiten Operation über die beabsichtigte Behandlung mit Zitronensaft hätte aufklären müssen (warum, ist der Pressemitteilung nicht zu entnehmen), ordnet der BGH eine erneute Verhandlung des Falles vor dem LG an. Auf "anderer Tatsachengrundlage" wäre nämlich nicht auszuschließen, dass z.B. wegen anderer Fehler bei der Operation doch eine Körperverletzung mit Todesfolge vorläge.
Angesichts dessen, was der BGH hier mit höchstinstanzlicher Autorität und Bedeutung zu Gunsten der "Therapiefreiheit" des Arztes und zu Ungunsten des Anspruchs von Patienten auf eine fachlich wirksame und anerkannte Behandlung geurteilt hat, kann man sich allerdings kaum etwas vorstellen, was die LG-Richter zu einem solchen Urteil bewegen könnte.
Da sich derselbe Chefarzt aber noch wegen zahlreicher weiterer möglicher Fälle von Körperverletzung vor dem LG zu verantworten hat, besteht immer noch die Chance, dass sich die Waage der Rechtsprechung in diesem Fall noch etwas anders einpendelt.
Wer das für Patientenrechte schlechte Signal zum Ende des Jahres 2010 noch etwas genauer erkunden will, ist im Moment ausschließlich auf die offizielle "Pressemitteilung 246/2010 des BGH" angewiesen, die frei zugänglich ist.
Auch wenn sich durch das ausführliche schriftliche Urteil am Ergebnis und der Argumentationsführung des Urteils nichts mehr ändern wird, sollte es in jedem Fall - und das gilt auch ausdrücklich für Nichtjuristen - für die abschließende Bewertung seiner Argumente und Tragweite genau gelesen werden. Der Text lag aber nach Angaben des BGH vom 30.12. 2010 noch nicht in gedruckter Form vor.
Bernard Braun, 1.1.11
Patientenzufriedenheitsbefragungen im Krankenhaus: "Nice to have" oder "Duschen ohne nass zu werden"
 Egal ob es Gesetze und der Gemeinsame Bundesausschuss vorschreiben oder es "der Markt" fordert, erstellen alle oder die Mehrheit der Krankenhäuser Qualitätsberichte oder f�hren standardm��ig Patientenzufriedenheitsbefragungen durch. Welche Qualit�t die Qualitätsberichte haben, d.h. wie verst�ndlich, relevant und bedarfsorientiert sie für die Zielgruppen potenzielle Patienten und ambulante Leistungserbringer sind, wird seit einiger Zeit untersucht. Diese Untersuchungen zeigen trotz mehrfacher Appelle besser zu werden bis in die Gegenwart hinein erhebliche Umsetzungsdefizite auf, die den Nutzen des Entscheidungs-Hilfsmittels Qualitätsberichte zum Teil auf Null f�hrt.
Egal ob es Gesetze und der Gemeinsame Bundesausschuss vorschreiben oder es "der Markt" fordert, erstellen alle oder die Mehrheit der Krankenhäuser Qualitätsberichte oder f�hren standardm��ig Patientenzufriedenheitsbefragungen durch. Welche Qualit�t die Qualitätsberichte haben, d.h. wie verst�ndlich, relevant und bedarfsorientiert sie für die Zielgruppen potenzielle Patienten und ambulante Leistungserbringer sind, wird seit einiger Zeit untersucht. Diese Untersuchungen zeigen trotz mehrfacher Appelle besser zu werden bis in die Gegenwart hinein erhebliche Umsetzungsdefizite auf, die den Nutzen des Entscheidungs-Hilfsmittels Qualitätsberichte zum Teil auf Null f�hrt.
Au�er der wissenschaftlichen Kritik an der Aussagefähigkeit des Zufriedenheitskonzepts und von verschiedenen Varianten der Zufriedenheitsbefragungen der WZB-Wissenschaftlerin Birgit Aust oder der ZUMA-Autoren Birgit Neugebauer und Rolf Porst, die aber bei der Entwicklung einiger Instrumente konstruktiv aufgegriffen wurde, gibt es zum Design der fast an jedem Krankenhaus aber auch in anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens geradezu inflation�r pr�senten Zufriedenheitsbefragungen nur sehr wenig substantielle empirische Untersuchungen.
Noch weniger wei� man dar�ber, ob und wie die Ergebnisse der Befragungen genutzt werden. Einzelne Studien wie beispielsweise Befragungen von Pflegekr�ften �ber die Auswirkungen der DRG in den Jahren 2003 und 2006 zeigten, dass an mindestens 70 bis 85 % der Krankenh�user Patientenbefragungen durchgef�hrt wurden, zwischen 45% und 60 % der Befragten aber nichts �ber die Ergebnisse sagen konnten. Hinweise auf Tendenzen, dass solche Befragungen ausschlie�lich als Marketinginstrument oder Symbol f�r "Kundenorientierung" genutzt wurden, gab es also schon l�ngere Zeit.
Das "Institut f�r betriebswirtschaftliche Analysen, Beratung und Strategieentwicklung (ifabs)" hat nun aber im Rahmen einer "Forschungsinitiative Benchmarking" in einer kleinen, nicht repr�sentativen Untersuchung �ber die Befragungspraxis in 174 Klinikabteilungen verschiedener Krankenh�user und Fachrichtungen sowohl aktuellere als auch facettenreichere Ergebnisse nachgelegt.
Die wesentlichen Ergebnisse einer Art Best-Practice-Analyse lauten:
• In der Mehrheit der untersuchten Einrichtungen waren die Besch�ftigten lediglich oberfl�chlich �ber die Durchf�hrung solcher Patientenbefragungen informiert. In 62 % der Einrichtungen erfolgte die Verteilung der B�gen eher zuf�llig und wurden Patienten nicht systematisch daran erinnert, einen Bogen auszuf�llen. Knapp die H�lfte der Besch�ftigten sahen die Zufriedenheitsbefragungen nahezu folgerichtig nicht als notwendiges Instrument f�r die Entwicklung der Dienstleistungsqualit�t an.
• In lediglich 35% der untersuchten Abteilungen wurden die Resultate durchg�ngig kommuniziert, in den �brigen H�usern erfolgte die Information entweder selektiv nur f�r einzelne Mitarbeitergruppen (26%) oder gar nicht (39%).
• Lediglich 12% der Abteilungen setzten bei ihren Befragungen eine zweidimensionale Befragungsmethodik ein, mit der f�r die untersuchten Leistungsmerkmale sowohl deren Wichtigkeit f�r die Patienten als auch die Zufriedenheit mit der Umsetzung ermittelt werden. In 75 % der Befragungewn wurden au�erdem keine offene Fragen verwendet. Hauptgrund war das Vermeiden des gr��eren Auswertungsaufwandes.
• Die Frageb�gen enthielten zahlreiche Ausf�llbarrieren: In 51 % war die Schrift so klein, dass gerade �ltere Menschen sie nicht lesen konnten. 38 % der Frageb�gen waren un�bersichtlich gelayoutet und in 42 % der B�gen fehlten Erkl�rungen zum Ausf�llen der B�gen.
• In keiner der Kliniken, die Patienten-Befragungen durchf�hrten wurden parallel die Vorstellungen von Mitarbeitern �ber die von den Patienten abgefragten Leistungsmerkmale erhoben. Die Diskrepanz zwischen Patienten- und Besch�ftigtensicht und -bewertung sind aber die h�ufigsten Ursachen f�r Unzufriedenheit der Patienten oder auch frustrierenden Erfahrungen von Krankenhaus-Personal.
• 19 % der untersuchten Abteilgten unterschieden in ihren Analysen nach Patientengruppen wie beispielsweise �ltere von J�ngeren.
• In 64 % der Kliniken lagen lediglich zeitpunktbezogene Auswertungen vor. Darstellungen der Entwicklung der Merkmale im Zeitverlauf fehlten dort.
• In s�mtlichen Kliniken und Abteilungen fehlten Vergleiche der Ergebnisse mit anderen Abteilungen des Hauses oder mit anderen fachlich �hnlichen Kliniken.
• Als Fazit ihrer Untersuchung halten die Benchmarking-ForscherInnen zur�ckhaltend fest, dass der "hohe Verbreitungsgrad" derartiger Befragungen mit einer "geringen Umsetzungsqualit�t" einhergeht.
Etwas zu viel Zur�ckhaltung, das verst�ndliche Interesse des privatwirtschaftlichen Instituts an m�glichen Beratungsauftr�gen oder eine enorme Untersch�tzung der Gr�nde f�r diese durchgehenden Umsetzungs- und Nutzungsm�ngel verbergen sich allerdings hinter der Formulierung, die mangelnde Qualit�t sei mit "geringem Aufwand � steigerbar".
Die Pr�sentation der M�ngel und die Darstellung von Best practice und der dabei hilfreichen technischen �nderungen sind sicherlich notwendige und �berf�llige Voraussetzungen f�r die Verbesserung des Instruments Patientenzufriedenheitsbefragungen, hinreichend ist dies aber mit Sicherheit nicht. Um welche Dimensionen es sich handelt, sollte dann mit gekl�rt werden, wenn noch etwas mehr und auch repr�sentative Transparenz �ber den Status quo dieser Befragungen geschaffen wird.
Eine vierseitige Zusammenfassung der Ergebnisse "Patientenzufriedenheits-Befragungen im Krankenaus: Ein Qualit�tsmanagement-Instrument mit Anwendungs-schw�chen - Best-Practice-Studienergebnisse" steht kostenlos zur Verf�gung.
Bernard Braun, 9.12.10
Verschwenderisch, nutzlos, inhuman: Warum erhalten todkranke Krebspatienten noch Untersuchungen zur Früherkennung?
 Ein Drittel aller Gesundheitsausgaben fallen unabhängig vom Lebensalter in den letzten 12 Monaten vor dem Tod an. Privat krankenversicherte Personen erhalten kurz vor ihrem Tod besonders häufig eine Vielzahl von möglicherweise lebensverlängernden Behandlungen. Über die Art der Leistungen weiß man wenig und vor allem ist es schwer den Nutzen dieser Leistungen in Frage zu stellen.
Ein Drittel aller Gesundheitsausgaben fallen unabhängig vom Lebensalter in den letzten 12 Monaten vor dem Tod an. Privat krankenversicherte Personen erhalten kurz vor ihrem Tod besonders häufig eine Vielzahl von möglicherweise lebensverlängernden Behandlungen. Über die Art der Leistungen weiß man wenig und vor allem ist es schwer den Nutzen dieser Leistungen in Frage zu stellen.
Eine jetzt veröffentlichte Untersuchung aus den USA ermöglicht aber tiefe Einblicke in einen Teil des Leistungsgeschehens für sterbenskranke Patienten und dessen medizinische und vor allem ethische Unsinnigkeit.
In die Untersuchung gingen 87.736 Versicherte von Medicare (eines der beiden staatlichen Krankenversicherungssysteme der USA mit Einzelleistungsvergütung) im Alter von 65 und mehr Jahren ein, die zwischen 1998 und 2005 im fortgeschrittenen Zustand an nicht mehr behandelbaren ("incurable") Lungen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- oder Brustkrebs erkrankt waren und in einem der Tumorregister erfasst waren. Die Behandlungsgeschichte aller Teilnehmer wurde bis zu ihrem Tode oder bis zum 31. Dezember 2007 erfasst und ausgewertet. Eine zweite Gruppe von 87.307 Medicare-Versicherte, die nicht an Krebs erkrankt waren, wurde der ersten Gruppe nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Rasse individuell zugeordnet. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung lag auf dem Angebot und der Nutzung von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen.
Die wesentlichen Ergebnisse sahen so aus:
• Dass es sich bei den an Krebs erkrankten Personen zu einem erheblichen Teil um tot-kranke Personen handelte, zeigen die Überlebensraten: Sie lagen zwischen 4,3 Monaten in der Gruppe der Pankreaskrebspatienten und 16,2 Monaten bei den Brustkrebspatienten. Die 5-Jahres-Überlebensrate betrug bei den Brustkrebspatienten 15,5 %, bei allen anderen Krebskranken aber 5% und weniger. Von der zu Beginn der Studie nicht an Krebs erkrankten Versichertengruppe lebten 5 Jahre nach dem Beginn der vergleichenden Untersuchung noch 80% bis 85 %.
• Unabhängig von ihrer geringen künftigen Lebenserwartung erhielt aber ein bedeutungsvoller Teil der eindeutig diagnostizierten Krebskranken noch weitere Krebsfrüherkennungsuntersuchungen im Rahmen des entsprechenden Screeningprogramms angeboten und nutzten sie auch: 8,9% der Frauen mit Krebs in fortgeschrittenem Stadium erhielten noch Mammographien (in der gesunden Kontrollgruppe waren es 22%), 5,8% erhielten einen PAP-Test zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs (in der Kontrollgruppe erhielten den Test 12,5%) und 15% der krenskranken Männer erhielten einen PSA-Test zur möglichen Früherkennung eines Prostatakarzinoms (Kontrollgruppe 27,2%). Eine endoskopische Untersuchung des Darmes erhielten dagegen nur 1,7% sämtlicher Patienten (Kontrollgruppe 4,7%). Dabei ist besonders bemerkenswert, dass die Raten bei den Schwerkranken zwischen 25% und 55% der Raten betragen, die in der gesunden Kontrollgruppe bei deren Angehörigen also Früherkennungsuntersuchungen auf Krebs möglicherweise einen gesundheitlichen Nutzen haben im selben Zeitraum zu finden sind.
• Die WissenschaftlerInnen vermuten, dass in der Gruppe der unter 65-Jährigen die Frühherkennungsuntersuchungsrate bei unheilbar erkrankten Krebspatienten sogar noch höher sein dürfte.
• Der Faktor mit dem höchsten Vorhersagewert für eine Früherkennungsuntersuchung bei Krebskranken war die langjährige Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen vor der Diagnose der Krebserkrankung.
• Aus dem gerade genannten Prädiktor leiten die Autoren eine Reihe von Erklärungen für die Angebote dieser unter den Erkrankungsumständen der Patienten nutzlosen Leistungen her: Um die Adhärenz für die Teilnahme an Screenings zu verbessern seien systematische Erinnerungs- und Einbestellsysteme eingerichtet und auch wirksam, die nicht den aktuellen Gesundheitszustand erfassten. Es gäbe außerdem eine Art Screeningkultur,, die wie ein "Autopilot" funktioniere und u.a. auch dazu beitrage, dass PAP-Tests selbst bei Frauen durchgeführt werden, deren Gebärmutter entfernt worden war. Nicht zuletzt seien dafür auch Kommunikationsdefizite über die reale oder ernsthafte Bedeutung von Erkrankungsprognosen innerhalb der Aerzteschaft und gegenüber Patienten verantwortlich.
Auch wenn man der Einschränkung der Autoren folgt, dass die eine oder andere Früherkennungsuntersuchung auch bei todkranken Personen angemessen und nützlich sein kann, steht mit ihrer Untersuchung fest, dass viele Ärzte oder das "Früherkennungssystem" speziell bei schwerkranken Patienten eine Menge verschwenderische und gesundheitlich nicht notwendige oder nutzlose Leistungen erbringen. Ob dies - wie vermutet - bei jüngeren Krebskranken sogar noch häufiger passiert und auch bei anderen Patienten mit geringer Lebenserwartung in anderer Weise erfolgt, müssen weitere Untersuchungen schnellstens klären. Dabei wäre allerdings auch zu prüfen, ob die ärztliche Vergütung nach Einzelleistungen nicht als zusätzlicher Anreiz für Leistungsangebote ohne gesundheitliche Rechtfertigung wirkt.
Und natürlich sollte man sich weder als Arzt noch als Versicherter oder Patient im deutschen Gesundheitssystem unbetroffen, entspannt oder nur entsetzt über die "amerikanischen Zustände" zurücklehnen, sondern sich auch hierzulande um mehr Transparenz bemühen.
Der Aufsatz "Cancer screening among patients with advanced cancer" von Sima CS et al. ist in JAMA (2010 Oct 13; 304:1584) erschienen und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.11.10
Atheistisch gesinnte Ärzte sind bei todkranken Patienten häufiger zu lebensverkürzenden Maßnahmen bereit
 Im Vergleich zu tief religiösen Ärzten sind atheistisch gesinnte Ärzte eher bereit, todkranken Patienten medizinische Maßnahmen zukommen zu lassen, die ihr Leben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verkürzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine im United Kingdom durchgeführte Befragung von rund 4.000 Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, die jetzt im "Journal of Medical Ethics" veröffentlicht wurde.
Im Vergleich zu tief religiösen Ärzten sind atheistisch gesinnte Ärzte eher bereit, todkranken Patienten medizinische Maßnahmen zukommen zu lassen, die ihr Leben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verkürzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine im United Kingdom durchgeführte Befragung von rund 4.000 Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, die jetzt im "Journal of Medical Ethics" veröffentlicht wurde.
Die Ergebnisse der Studie basieren auf einer postalischen Befragung von 3.733 Ärzten aus dem United Kingdom, Ärzten sehr unterschiedlicher Fachrichtungen (von Neurologie über Geriatrie und Allgemeinmedizin bis hin zur Palliativmedizin) und auch aus unterschiedlichen beruflichen Feldern (Einzel- und Gemeinschaftspraxen, Pflegeheime, Kliniken). An der Umfrage beteiligt haben sich 42 Prozent von insgesamt etwa 8.500 angeschriebenen Medizinern - die Beteiligungsrate ist damit für diese Berufsgruppe im Vergleich zu anderen Studien recht hoch. (Forschungsprojekte, die eine postalische oder telefonische Befragung von Ärzten umfassen, müssen sich oft mit Response-Quoten von 10-20% begnügen.) Die überwiegende Mehrheit der teilnehmenden Ärzte (N= 2923, 78%) konnte dabei auch über einen zumindest einen Patienten berichten, der bei ihnen in Behandlung war und dann verstarb.
Im Fragebogen wurde eine Reihe von Informationen erfragt: Die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, die Intensität der religiösen Überzeugungen, Meinungen zu Euthanasie und Sterbehilfe, Details der Behandlung des oder der verstorbenen Patienten wie z.B. Verordnung von Schmerz- und Beruhigungsmitteln, Gespräche mit Patienten über lebensverkürzende Maßnahmen bei einer unheilbaren Krankheit usw.
In der Analyse dieser Daten zeigte sich dann:
• Religionszugehörigkeit und medizinische Fachrichtung sind nicht unabhängig voneinander: Geriatrisch spezialisierte Mediziner, die also häufiger mit älteren Patienten in Kontakt kamen, waren eher Hindus oder Muslime. Palliativmediziner waren häufiger Christen.
• Die ethnische Zugehörigkeit der Ärzte zeigte keinen Zusammenhang zu persönlichen Einstellungen, was ethisch kontroverse Fragen anbetraf.
• Etwa 13% der Ärzte bezeichneten sich selbst als "sehr gläubig" (in der Bevölkerung im UK sind dies mit 6,5% nur halb so viele) und 20% als "stark ungläubig" (Bevölkerung: 15%).
Palliativmediziner zeigten die geringste Bereitschaft, lebensverkürzende Maßnahmen (aus Mitleid oder anderen Gründen) einzusetzen. Ganz unabhängig von der medizinischen Fachrichtung zeigte sich ein enger Zusammenhang zum persönlichen religiösen Glauben der Ärzte mit verschiedenen Verhaltensweisen im Rahmen der Behandlung. Bei Ärzten, die sich selbst als ungläubig oder atheistisch definierten, zeigte sich eine etwa zweimal so große Wahrscheinlichkeit:
• dass diese über einen längeren Zeitraum bis zum Tod des Patienten massiv Schmerz- und Beruhigungsmittel verordnet hatten,
• therapeutische Maßnahmen durchgeführt hatten, von denen sie annahmen, dass sie auch das Leben verkürzen könnten,
• mit Patienten, die sie als geistig wach einschätzten, über solche Maßnahmen und damit verbundene Risiken geredet und sie in die Entscheidung einbezogen hatten.
Kurzkommentar des Wissenschaftlers Prof. Seale: "Wenn Sie schwer erkrankt oder sogar todkrank sind, fragen Sie Ihren Arzt, ob er an Gott glaubt."
Hier ist ein Abstract: Clive Seale: The role of doctors' religious faith and ethnicity in taking ethically controversial decisions during end-of-life care (J Med Ethics, doi:10.1136/jme.2010.036194)
Gerd Marstedt, 10.9.10
Möglichkeiten und Grenzen von BürgerInnenbeteiligung in der Gesundheitspolitik und Gesundheitsforschung - Ein Cochrane-Review
 Viele empirische Versuche, die Gesundheitspolitik oder verschiedenste inhaltlich relevante Methoden und Instrumente der gesundheitlichen Versorgung u.a. durch Beteiligung von BürgerInnen bürgerorientierter und vor allem wirksamer zu gestalten, mussten ihren Erfolg niemals im Rahmen systematischer Evaluation nachweisen noch waren veröffentlichte Ergebnisse vor Verzerrungen jedweder Art gefeit.
Viele empirische Versuche, die Gesundheitspolitik oder verschiedenste inhaltlich relevante Methoden und Instrumente der gesundheitlichen Versorgung u.a. durch Beteiligung von BürgerInnen bürgerorientierter und vor allem wirksamer zu gestalten, mussten ihren Erfolg niemals im Rahmen systematischer Evaluation nachweisen noch waren veröffentlichte Ergebnisse vor Verzerrungen jedweder Art gefeit.
Das rechtfertigende Argument, das in den Leistungsbereichen der medizinischen Versorgung angewandte Untersuchungsdesign randomisierter kontrollierter Studien, sei bei sozialen Interventionen oder Beteiligungen nicht einsetzbar, wirkte schon immer vorgeschoben. Selbst wenn also in den Beobachtungsstudien Bemühungen unternommen wurden, den Nutzen der jeweiligen Intervention nachzuweisen, konnte nie ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse durch die Selektivität der untersuchten Akteure oder andere Faktoren verzerrt waren.
Mit dem erstmals 2006 und aktuell im Jahr 2010 geupdateten Cochrane-Intervention Review "Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material" (Nilsen et al. 2010) liegt ein methodisch wie inhaltlich wichtiger Beitrag vor, an dem sich die weitere Erforschung der Praxis von Maßnahmen zur Bürgerorientierung im Gesundheitsbereich messen lassen muss.
Die diesem Review zugrundeliegenden Studien waren randomisierte kontrollierte Untersuchungen, welche die Wirkungen der Einbeziehung von Konsumenten oder Nutzer und verschiedene Methoden der Beteiligung bei der Entwicklung von Gesundheitspolitik und bei deren Erforschung, von Leitlinien für die Behandlungspraxis und von Informationsmaterial für Patienten untersuchten.
Die Ergebnisindikatoren der jeweiligen Intervention war die Beteiligungs- oder Antwortrate der Konsumenten, die entdeckten Nutzersichtweisen, der Nutzereinfluss auf Entscheidungen, das gesundheitliche Ergebnis oder der Verbrauch von Ressourcen, die Zufriedenheit der Konsumenten oder professionellen Akteure mit dem Beteiligungsprozess oder den Produkten dieses Prozesses, die Wirkung auf die beteiligten Nutzer und schließlich auch die Kosten.
Die wesentlichen Ergebnisse der sechs reviewten RCTs mit 2.123 TeilnehmerInnen lauten:
• Es gibt mäßige qualitative Evidenz, dass die Beteiligung von NutzerInnen an der Entwicklung von Informationsmaterialien für Patienten zu Produkten führt, die für sie relevanter, lesbarer und verständlicher sind als die sonstigen Materialien, ohne ihnen Angst zu machen.
• Das auf Nutzer-Input beruhende Informationsmaterial kann außerdem das Wissen der Patienten verbessern.
• Außerdem gibt es eine geringe qualitative Evidenz, dass der Einsatz von Interviewern aus den Reihen der Nutzer statt hauptamtlicher Interviewer in Zufriedenheitssurveys einen geringen Einfluss auf die Resultate des Surveys hat. Die Zufriedenheit ist allerdings beim Einsatz von Nutzer-Interviewern etwas geringer. Da es sich dabei um Befragungen von psychisch Kranken handelte, muss die Verallgemeinerbarkeit der Vorteile noch genauer untersucht werden.
• Ebenfalls nur eine geringe qualitative Evidenz gibt es dafür, dass eine von Nutzern mitentwickeltes Dokument für das erklärte Einverständnis mit gesundheitlichen Maßnahmen innerhalb einer wissenschaftlichen Studie im Vergleich mit einem von professionellen ForscherInnen entwickeltem Dokument einen kleinen Vorteil bei der Verständlichkeit der Studienbeschreibung bietet, wenn es überhaupt eine nachweisbare Wirkung eines solchen Dokuments gibt.
• Dafür, dass mündliche Verfahren wie Telefondiskussionen oder face-to-face-Gruppendiskussionen Konsumenten besser in die Prioritätensetzung für kommunale Gesundheitsziele einbeziehen als schriftlich zugesandte Befragungen, lieferten RCTs nur eine sehr geringe qualitative Evidenz. Die unterschiedlichen Beteiligungsmethoden lieferten allerdings unterschiedliche Prioritätenkataloge und hatten insofern eine potenziell manipulative Bedeutung.
Zusammenfassend lässt sich also dreierlei sagen:
• Bisher sind aus den verschiedensten ernst gemeinten oder auch nur vorgeschobenen Gründen wenige Untersuchungen durchgeführt worden, die qualitativ hochwertig untersuchten, welches die besten Wege und Methoden sind, Nutzer und Konsumenten von gesundheitlichen Leistungen auf Bevölkerungsniveau in Entscheidungen über Versorgungsangebote einzubeziehen bzw. sie daran mitwirken zu lassen.
• RCTs sind machbar, um gesichertes Wissen über den Nutzen von Konsumenten- oder Nutzerbeteiligung im Bereich verschiedener Entscheidungen über Elemente der gesundheitlichen Versorgung zu gewinnen.
• Auf dem Niveau der gesamten Bevölkerung liefern die hier reviewten RCTs nur eine sehr kleine Evidenz für die Wirkung von Nutzermitwirkung an Entscheidungen über die Gesundheitsversorgung.
Der Review "Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material" von Nilsen ES, Myrhaug HT, Johansen M, Oliver S, Oxman AD ist in der "Cochrane Database of Systematic Reviews" zuerst 2006 und erneut 2010 erschienen. Kostenlos ist nur ein ausführliches Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 28.7.10
Blutdruckmessen und Hochdruckbehandeln: Können Patienten Teile dieser wichtigsten Allgemeinarzttätigkeiten erfolgreich übernehmen?
 Die in der Regel mit der ein- oder mehrmaligen Messung des Blutdrucks verbundene und begründete ICD-Diagnose I10 "essentielle (primäre) Hypertonie" bzw. der "Bluthochdruck" steht seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten auf Platz 1 der Hitliste der 50 häufigsten Diagnosen bei Allgemeinärzten und Internisten. Und selbst bei Augenärzten taucht diese Diagnose auf Platz 12 ihrer Diagnose-Hitliste auf.
Die in der Regel mit der ein- oder mehrmaligen Messung des Blutdrucks verbundene und begründete ICD-Diagnose I10 "essentielle (primäre) Hypertonie" bzw. der "Bluthochdruck" steht seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten auf Platz 1 der Hitliste der 50 häufigsten Diagnosen bei Allgemeinärzten und Internisten. Und selbst bei Augenärzten taucht diese Diagnose auf Platz 12 ihrer Diagnose-Hitliste auf.
In einer der immer noch seltenen differenzierten Analysen des inhaltlichen Geschehens in der ambulanten ärztlichen Versorgung wurden im ersten Quartal 2001 24,3 % aller Patienten von Allgemeinmedizinern und praktischen Ärzten wegen dieser Diagnose behandelt, 29,3 % aller Arztkontakte fanden deswegen statt, 29,9 % des angeforderten Leistungsbedarfs beruhte auf dieser Diagnose und je Patient gab es deswegen 4 Kontakte mit Primärärzten. Bis auf die Kontaktanzahl spielten alle anderen Diagnosen und zum Teil schwere symptomreiche Erkrankungen wie etwa Rückenschmerzen oder akute Infektionen der oberen Atemwege eine wesentlich geringere Bedeutung. 2008 verließen 23,5 % aller Patienten allgemeinärztlicher Praxen ihren Arzt nach einer Blutdruckmessung mit der Diagnose Bluthochdruck und 31,1 % aller Behandlungsfälle derselben Arztgruppe lag eine Bluthochdruckdiagnose zugrunde. Diese aus den Daten des ADT-Panels des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung der KBV (ZI) für Brandenburg und Nordrhein entnehmbaren Verhältnisse werfen u.v.a. die Frage auf, ob es sich dabei nicht zum Teil um eine Überversorgung, ja sogar zum Teil eine Fehlversorgung handelt und ein Teil dieses Geschehens vom Arzt und dem Praxisbetrieb wegverlagert werden kann. Ob vor allem einmalige Blutdruckmessungen durch den Arzt in großem Umfang zu iatrogenen Effekten führen, ist eine häufig aufgeworfene Frage zur Validität und Reliabilität (Wiederholbarkeit) der Diagnose eines der bedeutendsten Risikofaktoren.
Insofern sind die Ergebnisse einer großen randomisierten kontrollierten Studie zur Wirksamkeit des Selbstmanagements der Blutdruckmessung und -medikation im Rahmen eines ärztlichen Telemonitorings der gemessenen Blutdruckwerte von äußerst großer Bedeutung. Mit der zusätzlich obligatorischen elektronischen Fern-Überprüfung durch den Primärarzt sollen mögliche Messfehler, Interpretationsfehler der gemessenen Werte und eine falsche Medikation erkannt und verhindert werden.
Um dies zu untersuchen wurden 527 PatientInnen im Alter von 35-85 Jahren aus 24 Allgemeinarztpraxen in Großbritannien ausgesucht, die trotz einer Behandlung erhöhte Blutdruckwerte von 140/90 mm Hg und mehr hatten und gewillt waren, ihren Bluthochdruck selbst zu managen. Von den 480 endgültigen TeilnehmnerInnen wurden 234 der Selbstmanagementgruppe und 246 der Kontrollgruppe mit traditioneller Arzt- und Praxisversorgung zugeordnet. Die Effekte bzw. die Wirksamkeit wurde in allen Gruppen beim Start, nach 6 und nach 12 Monaten anhand des systolischen Druckwertes überprüft. Nach 6 (Differenz: 3,7 mm Hg) und nach 12 Monaten (Differenz: 5,4 mm Hg) lag der systolische Blutdruck in der Selbstmanagementgruppe statistisch signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe. Die Häufigkeit der meisten Nebenwirkungen unterschied sich zwischen den beiden Gruppen nicht, abgesehen von Beinschwellungen, die in der Selbstmanagementgruppe häufiger (32%) auftraten als in der Kontrollgruppe (22 %).
Zumindest ein Teil der Blutdruckmessungen und der Versorgung mit angemessenen Arzneimitteldosen könnten also ohne unerwünschte gesundheitliche Wirkungen bei Bluthochdruckpatienten mit unkomplizierten Erkrankungsverläufen außerhalb der Arztpraxis und von den PatientInnen selber durchgeführt werden. Dadurch könnte sowohl die international sehr hohe Anzahl von Arztkontakten reduziert werden als auch die für jeden Arzt-Patientkontakt zur Verfügung stehende Zeit deutlich über die gegenwärtige 8-Minuten-Marke hinaus verlängert werden.
Diese Erkenntnisse finden sich in dem am 8. Juli 2010 als "Early Online Publication" veröffentlichten Aufsatz "Telemonitoring and self-management in the control of hypertension (TASMINH2): a randomised controlled trial" von Richard McManus et al. im Medizinjournal "The Lancet", von dem leider nur das Abstract kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 8.7.10
"Vorsicht Röhre": Bildgebende Diagnostik zwischen Überversorgung und unerwünschten Folgewirkungen
 Als empirische Belege für ein zum Teil anbieterinduziertes oder -gesteuertes Geschehen in der Behandlung von PatientInnen wurde schon immer die wachsende Anzahl und die zunehmende Häufigkeit des Einsatzes bestimmter diagnostischer Prozeduren oder Verfahren genannt. Dabei ging es nicht nur um die absolute Anzahl einzelner Untrersuchungen, sondern insbesondere um so genannte Diagnose-Kaskaden im Bereich der bildgebenden Verfahren. Die Aneinanderreihung mehrerer bildgebenden Verfahren bzw. Techniken entspringt nicht nur einer Strategie des "Auf-Nummer-Sicher-Gehens", sondern dient unter geeigneten Vergütungsordnungen auch der Optimierung ärztlicher Einkünfte und natürlich dem Umsatz der Medizintechnik-Industrie. Gegen diese kritische Beurteilung wird eingewandt, es handle sich zum Teil darum den Einsatz potenziell gesundheitsschädigender Verfahren zu vermeiden oder der gesundheitliche Nutzen würde durch Diagnosekaskaden erhöht.
Als empirische Belege für ein zum Teil anbieterinduziertes oder -gesteuertes Geschehen in der Behandlung von PatientInnen wurde schon immer die wachsende Anzahl und die zunehmende Häufigkeit des Einsatzes bestimmter diagnostischer Prozeduren oder Verfahren genannt. Dabei ging es nicht nur um die absolute Anzahl einzelner Untrersuchungen, sondern insbesondere um so genannte Diagnose-Kaskaden im Bereich der bildgebenden Verfahren. Die Aneinanderreihung mehrerer bildgebenden Verfahren bzw. Techniken entspringt nicht nur einer Strategie des "Auf-Nummer-Sicher-Gehens", sondern dient unter geeigneten Vergütungsordnungen auch der Optimierung ärztlicher Einkünfte und natürlich dem Umsatz der Medizintechnik-Industrie. Gegen diese kritische Beurteilung wird eingewandt, es handle sich zum Teil darum den Einsatz potenziell gesundheitsschädigender Verfahren zu vermeiden oder der gesundheitliche Nutzen würde durch Diagnosekaskaden erhöht.
Schon welche Verfahren und Untersuchungen aber wirklich neben- oder nacheinander zum Einsatz kommen und welchen Nutzen oder gar Schaden dies für PatientInnen hat, ist immer noch nicht sehr gut empirisch belegt.
2008 hatte eine Gruppe von Gesundheitswissenschaftler aus den USA untersucht, wie viele bildgebende Untersuchungen bei 377.048 Patienten einer großen Krankenversicherung von 1997 bis 2006 insgesamt durchgeführt wurden. Absolut waren es 4,9 Millionen einzelne Untersuchungen oder Tests. Die Anzahl aller bildgebenden Untersuchungen verdoppelte sich im Querschnitt während dieses Zeitraums von 260 auf 478 Untersuchungen pro 1.000 Versicherte und pro Jahr. Während sich speziell die Computertomographie-Untersuchungen (CTs) ebenfalls "nur" verdoppelten, verdreifachte sich etwa die Häufigkeit von Magnetresonanzuntersuchungen (MRI). Hinter der Zunahme verbirgt sich sowohl eine Zunahme der Anzahl der Personen, die überhaupt mit einem bildgebenden Verfahren untersucht wurde, als auch die Zunahme der Anzahl von UNtersuchungen pro einzelnem Patienten. Fast 5 % der Patienten wurden mehr als fünfmal pro Jahr diagnostiziert.
Die Autoren überprüften mit ihren Daten die immer wieder vorgetragene Hypothese, hinter der Zunahme der Bilddiagnostik stecke die Zunahme der Prävalenz bestimmter Erkrankungen, fanden dafür aber keinen empirischen Beleg. Sie untersuchten ferner die Hypothese, finanzielle Vorteile für die untersuchenden Ärzte führten zu Zuwächsen beim Einsatz bestimmter, teurer Verfahren. Obwohl sie direkte Zusammenhänge eher ausschließen, halten sie es für möglich, weitgespannte finanzielle Anreize auf die Mitglieder der "radiology community" "could affect clinical practice standards". Und schließlich untersuchen die Autoren eine Verbindung von mehr Diagnostik mit besseren Behandlungsergebnissen. Weder für diese Verbindung noch für ihr Fehlen liefert aber die vorlegende Studie ausreichend empirische Evidenz. Für gesichert halten sie aber die These, die enorm wachsenden Kosten dieser Diagnostik "are rising out of proportion to any possible benefit".
Warnend weisen die Forscher abschließend auf die enorme Zunahme der Strahlenbelastung insbesondere durch CT-Untersuchungen hin.
Zusätzlich und ganz aktuell liegen nach der Analyse des Umfangs und der Art des diagnostischen Geschehens bei 101.000 durchschnittlich 76 Jahre alten Krebspatienten zwischen 1999 und 2006, die bei der staatlichen Krankenversicherung der USA für ältere BürgerInnen, Medicare, versichert waren, noch differenziertere und vor allem indikationsbezogene Daten zum Diagnostikgeschehen vor. Dies gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren nach der Erstdiagnose von Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphsystemkrebs, Brustkrebs, Darm-, Lungen- oder Prostatakrebs.
Die Studie bestätigte zunächst, dass die Ausgaben für bildgebende Untersuchungen in den USA die am schnellsten wachsende Ausgabenart ist. Die Häufigkeit von bildgebenden Untersuchungen variierte je nach Krebsart erheblich. Am häufigsten wurden diese Untersuchungen bei Personen durchgeführt, die an Lungenkrebs unhd Lymphsystemkrebs erkrankt waren.
Die Ergebnisse sahen im Einzelnen so aus:
• Der durchschnittliche Lungenkrebspatient des Jahres 2006 durchlief in den zwei Jahren davor 11 konventionelle Röntgenuntersuchungen, 6 Computertomogramme, 1 Positronen-Emissions-Tomogramm (PET), einen nuklearmedizinischen Test, 1 Magnetresonanzuntersuchung (MRI), 2 Echokardiogramme und eine zusätzliuche Ultraschalluntersuchung.
• Das größte Wachstum erreichte die Anzahl der PET-Untersuchungen, die im Durchschnitt und je nach Krebsart um 36 bis 54 % pro Jahr wuchs. Zum Vergleich: MRI-Untersuchungen wuchsen jährlich um 4 bis 12 %, der Einsatz von Echokardiographie wuchs zwischen 5 und 8 % und die einfachen kardiographischen Untersuchungen nahmen in einigen Jahren sogar ab oder blieben im Rest des Untersuchungszeitraums stabil.
• Je nach Krebsart stiegen die Kosten für diese Diagnoseverfahren, wiederum in Abhängigkeit von der Krebsart, zwischen 5 und 10 %. Damit lagen die Kostenzuwächse für bildgebende Verfahren über denen für die gesamten Krebsbehandlungskosten: Diese stiegen in den 7 Studienjahren jährlich um 2 bis 5 %.
Als Erklärungsmöglichkeiten verweisen auch diese ForscherInnen u.a. auf die Möglichkeit erweiterter Indikationen hin, was ihres Erachtens besonders die Zunahme der PET-Untersuchungen erklären könnte.
Für sämtliche untersuchten Indikationen ist schließlich trotz der unbestreitbaren Relevanz solchen Wissens weiterhin unklar, ob das dramatische Ansteigen der Untersuchungshäufigkeit durch bessere gesundheitliche Ergebnisse gerechtfertigt ist - was ja immerhin eine wichtige Basis für inhaltliche Entscheidungen darstellen würde.
Selbst auf der eher technik- und industriefreundlichen Website "diagnosticimaging.com" wird daher die Frage gestellt: "Is imaging being overused on Medicare cancer patients?" Auch wenn es darauf keine eindeutig bejahende Antwort gibt, referiert der Autor den Hinweis der ForscherInnen der Duke-Universität, dass wahrscheinlich beim Großteil der jüngeren Krebspatienten noch deutlich häufiger diagnostische Verfahren zum Einsatz kämen als bei den über 70 Jahre alten Medicare-PatientInnen.
Zum Aufsatz mit den Ergebnissen der 2008 durchgeführten Studie "Rising Use of diagnostic medical imaging in a large integrated health system" von Rebecca Smith-Bindman, Diana Miglioretti und Eric Larson (Health Affairs; 27, Nr. 6: 1491-1502) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Auch zu dem Aufsatz "Changes in the use and costs of diagnostic imaging among Medicare beneficiaries with cancer 1999-2006" von Dinan MA et al. (JAMA. 2010;303(16):1625-1631) gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 5.6.10
Müssen Gehörlose auf Kassenkosten Klingeltöne sehen können? Warum eine AOK 5 Jahre durch alle Instanzen prozessiert und verliert!
 "Versicherte, die wegen einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit die Klingel ihrer Wohnung auch mit den vorhandenen Hörgeräten nicht wahrnehmen können, haben grundsätzlich Anspruch auf Versorgung mit einer Lichtsignalanlage, durch die akustische Signale einer Türklingel in optische Signale umgewandelt werden." Wer dem zustimmt, hat seit dem 29. April 2010 das Bundessozialgericht (BSG) auf seiner Seite, das in einem Revisionsverfahren zu diesem Schluss kommt und eine Klage abwies, die diesen Anspruch verneinte.
"Versicherte, die wegen einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit die Klingel ihrer Wohnung auch mit den vorhandenen Hörgeräten nicht wahrnehmen können, haben grundsätzlich Anspruch auf Versorgung mit einer Lichtsignalanlage, durch die akustische Signale einer Türklingel in optische Signale umgewandelt werden." Wer dem zustimmt, hat seit dem 29. April 2010 das Bundessozialgericht (BSG) auf seiner Seite, das in einem Revisionsverfahren zu diesem Schluss kommt und eine Klage abwies, die diesen Anspruch verneinte.
Es bedurfte aber schon des BSGs um die AOK Niedersachsen zu stoppen, die seit dem Dezember 2005 einer ihrer 1963 geborenen Versicherten mit der beschriebenen und auch nie bestrittenen Behinderung die Versorgung mit einer Lichtsignalanlage verweigerte und an dieser Entscheidung sowohl im Sozialgerichts- (Aurich), im Landessozialgerichtsverfahren (Niedersachsen-Bremen) und schließlich im Verfahren vor dem BSG festhielt. Mit dieser Anlage können ohne aufwändige Installationen akustische Signale von Telefonanlage und Türklingel in Lichtsignale und Vibrationen umgesetzt und damit erst von der behinderten Person wahrgenommen werden. Während die Position der AOK noch durch das Sozialgericht bestätigt wurde, legte bereits das Landessozialgericht ausführlich dar, warum die Position der AOK nicht dem geltenden Leistungsrecht der sozialen Krankenversicherung entspricht, ließ aber die Revision vor dem BSG zu.
Nach dem Kostenvoranschlag einer Fachfirma vom 22.12. 2005 sollte übrigens die Anlage 780 Euro kosten.
Die Argumentation der AOK bestand im Wesentlichen aus drei Annahmen oder Behauptungen:
• Erstens stelle die Lichtsignalanlage kein Hilfsmittel nach dem für die gesetzlichen Krankenkassen geltenden SGB V dar und dürfe daher gar nicht von einer Krankenkasse bezahlt werden. Bei der Anlage handle es sich nämlich um eine technische Hilfe zur Anpassung des individuellen Wohnumfeldes an einen Bewohner und nicht um etwas, was den Behinderten den Erfordernissen der Umwelt anpassen würde. Die Anlage wäre fest mit der Wohnung verbunden und könne vom behinderten Versicherten nicht auch noch nach einem Umzug in einer anderen Wohnung benutzt werden. Dabei stützt sich die AOK auf ein Grundsatzurteil des BSG, in dem es zur Definition des GKV-Hilfsmittels nach der Zusammenfassung des LSG heißt: "Nach dem … Urteil des BSG vom 6. August 1998 - B 3 KR 14/97 R = SozR 3-2500 § 33 Nr. 30 S. 179 ff ergibt sich aus der Gegenüberstellung der in § 33 Abs. 1 SGB V ausdrücklich genannten Hilfsmittel, Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücken und orthopädische Hilfsmitteln einerseits und der nicht näher konkretisierten anderen Hilfsmittel andererseits, dass nur solche technischen Hilfen als Hilfsmittel im Sinne dieser Vorschrift anzuerkennen sind, die vom Behinderten getragen oder mitgeführt, bei einem Wohnungswechsel auch mitgenommen und benutzt werden können, um sich im jeweiligen Umfeld zu bewegen, zurecht zu finden und die elementaren Grundbedürfnisse des täglichen Lebens zu befriedigen. Das Hilfsmittel soll die Körperfunktionen des Behinderten ersetzen, ergänzen oder verbessern, die für die möglichst selbstständige Durchführung der Alltagsverrichtungen notwendig sind. Der Behinderte wird dadurch den Erfordernissen der Umwelt angepasst, nicht aber das Umfeld an die Bedürfnisse des Behinderten angeglichen."
• Zweitens vertrat die AOK die Position, bei einer Lichtsignalanlage handle es sich um einen allgemeinen Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. Ohne offensichtlich auch nur einen Gedanken über die Lebenssituation eines derartig hörbehinderten Menschens zu verschwenden, erwiesen sich die AOK-Vertreter als wesentlich kundiger, wenn es um den Einsatz solcher Anlagen in Tonstudios und Call-Centers geht oder wenn sie insinuierten, solche Anlagen könnten und würden auch von Menschen mit intaktem Hörsinn im Alltag verwendet.
• Hilfsweise wurde drittens behauptet, die beantragte Ausstattung mit drei Blitzlampen (Gesamtpreis 348 Euro) in der Mehrzimmerwohnung der AOK-Versicherten sei unverhältnismäßig. Die Begründung lautet in der Zusammenfassung des LSG so: "Eine Lichtsignalanlage mit drei Blitzlampen benötige die Klägerin nur wegen der individuellen Größe ihrer Wohnung. Für einen Versicherten mit gleicher Behinderung, der in einer kleineren Wohnung wohne, ergäbe sich die Notwendigkeit einer solchen Lichtsignalanlage nicht."
Dies ist leider nicht der erste Fall, dass eine gesetzliche Krankenkasse jeden Sinn für die realen Bedürfnisse schwer kranker und behinderter Versicherten verloren hat (vgl. dazu das auch schon im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte höchstinstanzliche "Elektro-Rollstuhlurteil" gegen die Barmer Ersatzkasse) und gegen Buchstaben und Geist der gesetzlichen Vorschriften des SGB IX (vor allem § 4 Abs. 1 Nr. 4 und § 9 Abs. 3 SGB IX) verstößt. Dort wird seit 2001 das Recht von Kranken zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und auf eine selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung festgeschrieben. Daher verdienen auch einige Passagen des vom BSG bestätigten LSG-Urteil in aller Ausführlichkeit und präventiv verbreitet zu werden.
Zur Frage der Hilfsmittel aus Krankenversicherungsmitteln stellt das LSG fest (in unseren Zitaten wird aus Gründen der Übersichtlichkeit für Nichtjuristen auf die ausführlichen Rechtsverweise verzichtet. Diese können aber im Original jederzeit nachgelesen werden):
• "Ein Hilfsmittel ist von der GKV immer dann zu gewähren, wenn es die Auswirkungen der Behinderung im täglichen Leben beseitigt oder mildert und damit ein Grundbedürfnis betrifft. Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG … gehören zu den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens das Gehen, Stehen, Greifen, Sehen, Hören, die Nahrungsaufnahme, das Ausscheiden, die (elementare) Körperpflege, das selbstständige Wohnen sowie das Erschließen eines körperlichen Freiraums im Nahbereich der Wohnung und das Bedürfnis bei Krankheit oder Behinderung Ärzte und Therapeuten aufzusuchen. Zum Grundbedürfnis der Erschließung eines geistigen Freiraums gehört u.a. das Aufnehmen von Informationen, die Kommunikation mit anderen Menschen sowie das Erlernen eines lebensnotwendigen Grundwissens bzw. Schulwissens … . Nach der Rechtsprechung des BSG gehört zu diesen Grundbedürfnissen auch die passive Erreichbarkeit des Versicherten in seinem Wohnbereich. Hierzu zählt etwa die Wahrnehmung unangekündigter, spontaner Besuche oder von Besuch, der die genaue Uhrzeit seines Erscheinens nicht vorhersagen kann (etwa Arztbesuche) … . Für Gehörlose ist der lebenswichtige Kontakt mit anderen Menschen jedoch stark eingeschränkt. Deshalb ist für einen Gehörlosen jeder ihm noch mögliche Kontakt mit anderen Menschen besonders wichtig … . Im vorliegenden Fall sind die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Kommunikation und selbstständiges Wohnen betroffen."
Was dies heißt wird dann in den folgenden Sätzen konkretisiert, wo aber auch deutlich wird, dass sich Krankenkassen offensichtlich auch über andere, in ihrer Funktion aber ähnliche Hilfsmittel bis zum BSG durchprozessieren:
• "Das Hilfsmittel ist zum Ausgleich der Behinderung der Klägerin erforderlich. Während die ältere Rechtsprechung des BSG darauf abgestellt hat, ob das Hilfsmittel für die in Abs 1 Satz 1 des § 33 SGB V genannten Zwecke unentbehrlich oder unverzichtbar war …, wird es jetzt für ausreichend gehalten, dass das Hilfsmittel die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wesentlich fördert … . Zwar haben Versicherte keinen Anspruch auf optimale Hilfsmittelversorgung, es ist jedoch ein wesentliches Ziel der Hilfsmittelversorgung, dass behinderte Menschen nach Möglichkeit von der Hilfe anderer Menschen unabhängig, zumindest aber deutlich weniger abhängig werden … . Nach der Rechtsprechung des BSG ist es die spezielle Pflicht der Krankenkassen, behinderten Menschen durch eine angemessenen Hilfsmittelversorgung eine möglichst selbstständige Lebensführung zu erhalten und ihnen zu ermöglichen, ein selbst bestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht (BSG, Urteil vom 15. November 2007 - 3 P 9/06 R "Einmalservietten"). Zur selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung gehört es, bestimmten Personen (Bekannte, Ärzte) jederzeit und selbstständig Einlass gewähren zu können (so BSG SozR 3 - 3300 § 40 Nr. 6 S. 32 "Gegensprechanlage")."
Auch bei der Entscheidung, ob diese Lichtsignalanlage so fest eingebaut wird, dass sie nicht mitgenommen werden könnte, reicht der AOK nicht der Augenschein, der gesunde Menschenverstand oder ein Gespräch mit einem Tonanlagenmeister um das Unsinnige dieser Annahme festzustellen. Mehrere höhere und höchste Sozialrichter müssen stattdessen jahrelang ermitteln und schließlich verkünden, die Anlage könne durch einfaches Entfernen aus einer Steckdose an jeden anderen Ort mit Stromanschluss verbracht werden.
Warum die Frage der Portabilität aus Sicht der AOK so wichtig ist, erschließt sich erst, wenn man etwas in das Innenleben des Sozialversicherungssystems eindringt: Wenn die Anlage eingebaut worden wäre und damit eine feste Maßnahme zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes darstellte, fiele diese Art einer Maßnahme nach § 40 SGB XI in die Zuständigkeit der sozialen Pflegeversicherung. Diese könnte aber auch erst dann aktiv werden, wenn die Pflegebedürftigkeit der behinderten Person festgestellt worden ist. Deutlicher kann man eigentlich nicht die zynische Bemerkung illustrieren, der Patient stünde zwar immer im Mittelpunkt, aber damit auch stets allen Akteuren im Wege.
Zu dem "Argument", eine solche Anlage könnte durchaus auch im Alltag von Menschen mit intaktem Hörsinn als eine Art "Lichtorgel" benutzt werden, verweisen die LSG- und BSG-Richter die AOK und ihre potenziellen Nachahmer auf den lebenspraktischen Unsinn und die aus ihrer Sicht einzig zulässigen Ermittlungsverfahren: "Bei der von der Klägerin begehrten Lichtklingelanlage handelt es sich auch nicht um einen Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. Zur Ermittlung des Vorliegens der Eigenschaft eines Hilfsmittels in der gesetzlichen Krankenversicherung ist maßgeblich auf die Zweckbestimmung des Gegenstandes abzustellen, die einerseits aus der Sicht der Hersteller, andererseits aus der Sicht der tatsächlichen Benutzer zu bestimmen ist."
Offensichtlich durch allerdings nicht öffentlich bekannten Bemerkungen der AOK-Vertreter in den Verfahren und Schriftsätzen (das ist also reine Spekulation, aber grundlos formulieren Richter den folgenden Satz wahrscheinlich nicht) oder durch andere konkrete Erfahrungen sensibiliert, hatten die LSG-Richter diesen und anderen GKV-Vertretern einen denkbaren Ausweg aus der Leistungspflicht ausdrücklich verwehrt: "Die Klägerin (die behinderte AOK-Versicherte) kann auch nicht darauf verwiesen werden, ihre Tür dauerhaft offen stehen zu lassen oder andere Personen mit einem Wohnungsschlüssel auszustatten."
Auch wenn wir nicht wissen, wie die Klägerin, die jetzt vor dem BSG endgültig gegen die AOK Niedersachsen gewonnen hat, seit dem Dezember 2005 gemerkt hat, wann Besuch vor ihrer Wohnungsklingel stand oder ihr behandelnder Arzt anrief, ihre verminderte oder verhinderte Teilhabe am Lebens und ihre Möglichkeiten zur selbstbestimmten Lebensführung werden noch ein Weilchen anhalten: Um prüfen zu lassen, ob der Kostenvoranschlag in allen Teilen dem Grundsatz der Notwendigkeit (3 Lichtblitze!?) und Wirtschaftlichkeit entspricht, musste das BSG den Fall an das LSG zurückverweisen.
Theoretisch, aber durchaus nicht wirklichkeitsfern, könnte dort noch ein Streit darüber ausbrechen, ob die beantragten "Vibrationskissen (inkl. 3 Mignon Batterien)" zum Preis von 34,00 € wirklich diesen Grundsätzen entsprechen. Möglicher Tenor: Zumindest die 3 Mignonbatterien sind eigentlich Gegenstände des täglichen Lebens und könnten auch in MP 3-Playern verwendet werden.
Der Text des BSG-Urteil ist zwar noch nicht veröffentlicht, aber der inhaltliche Tenor findet sich im veröffentlichten "Terminbericht Nr. 21/10 des 3. Senat des Bundessozialgerichts über seine Sitzung vom 29. April 2010".
Nachtrag aktuell: Mittlerweile ist der komplette Urteilstext veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Das komplett 13 Seiten umfassende Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen vom 25.2.2009 (Aktenzeichen: L 1 KR 201/07), dessen Kernaussagen das BSG nun bestätigt hat, ist dagegen vollständig veröffentlicht und kostenlos erhältlich. Seine Lektüre ist auch für Nichtjuristen und Mitarbeiter von Leistungsabteilungen gesetzlicher Krankenkassen uneingeschränkt empfehlenswert.
Bernard Braun, 14.5.10
Falsch-positive Ergebnisse des Lungenkrebs-Screenings per CT und Bruströntgen samt sinnlosen Eingriffen höher als erwartet
 Zu den möglichen unerwünschten und negativ folgenreichen Ergebnissen praktisch aller Früherkennungsuntersuchungen gehören falsch positive und negative Ergebnisse. Je höher der diagnostizierte Anteil von in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Erkrankungen oder von befundlosen Untersuchungen ist, die eine schwere Erkrankung "übersehen", desto gesundheitsabkömmlicher sind die physischen und psychischen Folgen.
Zu den möglichen unerwünschten und negativ folgenreichen Ergebnissen praktisch aller Früherkennungsuntersuchungen gehören falsch positive und negative Ergebnisse. Je höher der diagnostizierte Anteil von in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Erkrankungen oder von befundlosen Untersuchungen ist, die eine schwere Erkrankung "übersehen", desto gesundheitsabkömmlicher sind die physischen und psychischen Folgen.
Dies gilt zusätzlich noch für Untersuchungen, die als Screening empfohlen und durchgeführt werden. Sofern mit der Diagnostik auch noch mehr oder weniger hohe Strahlenbelastungen verbunden sind, droht eine Kumulation gesundheitlicher Risiken, die es dann sehr genau gegen die möglichen gesundheitlichen Vorteilen des Screenings abzuwägen gilt. Dabei spielen natürlich generell auch die ökonomischen Folgen eine wichtige Rolle.
Für viele Screeningangebote zur möglichst frühen Identifizierung von häufigen wie gefährlichen Erkrankungen gibt es bisher lediglich Vermutungen zu den diversen unerwünschten Effekten und damit auch für die sich daraus ergebenden Belastungen von Individuen und Versicherungsgemeinschaften.
Um diesen Zustand zu beenden, untersuchten nun WissenschaftlerInnen im Rahmen der noch laufenden randomisierten kontrollierten "National Lung Screening Trial" wie häufig bei den Untersuchungen von 3.190 früheren und aktuellen Rauchern (teilweise mit einer über 30 Jahre langen "Rauchgeschichte") im Alter von 55 bis 74 Jahren falsch positive oder negative Ergebnisse auftraten. Der Betrachtungszeitraum ob ein Lungenkrebs auftrat oder nicht, erstreckte sich noch auf den Zeitraum von einem Jahr nach der zweiten Screening-Untersuchung.
Die jetzt vorliegende Untersuchung, welche die Effekte zweier im Jahresabstand folgenden CT-Untersuchungen mit geringer Strahlenbelastung und der traditionellen Röntgenuntersuchung des Brustraums zur Existenz von Lungenkrebs bei zuvor nie wegen Lungenkrebs auffällig gewordenen Personen vergleicht, kommt zu einigen quantitativ wie qualitativ unerwarteten Ergebnissen:
• Eine Person, die einmal an einem CT-Screening teilnimmt, hat eine kumulierte Wahrscheinlichkeit von 21%, ein falsch-positives Ergebnis zu erhalten. Nach der Teilnahme an zwei Screeninguntersuchungen steigt die Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise einen Lungenkrebs diagnostiziert zu bekommen auf 33%.
• Neben der psychischen Belastung durch den mehr oder weniger lang anhaltenden Schrecken der irrtümlich gestellten Diagnose erfolgte bei 7% der CT-untersuchten Personen mit falsch-positivem Befund eine mehr oder weniger gravierende invasive Prozedur.
• Falsch positive Ergebnisse erhielten beim ersten Screening mittels Bruströntgen 7 % und nach der Teilnahme an der zweiten Untersuchung 15 % der Untersuchten.
• Und bei immerhin noch 4 % von ihnen folgte dieser Fehldiagnose eine invasive Zusatzdiagnostik (z.B. Bronchoskopie, Biopsie) oder gar eine große Operation.
• Die Studie konzentrierte sich auf die falsch positiven Ergebnisse und vernachlässigte bereits methodisch die Erkennung der tatsächlichen Anzahl der Nichtentdeckung eines tatsächlich vorhandenen Lungenkarzinoms. So wurden die auftretenden falsch negativen Fälle nur zwischen dem ersten und zweiten Sreening genau gezählt und untersucht. Deshalb beurteilen die Forscher den relativ geringen Anteil falsch-negativer Untersuchungsergebnisse in ihrer Untersuchung als eine Unterschätzung dieses Risikos.
Was aus den falschen Ergebnissen im Einzelnen gesundheitlich, psychosozial, ökonomisch und körperlich folgt, empfehlen die AutorInnen nach ihren Funden noch genauer zu untersuchen.
Wichtige Hinweise für Ärzte und PatientInnen, die eine Bewertung des Verhältnisses von Nutzen, Kosten und Wirkungen/Nebenwirkungen von CT- und Röntgenuntersuchungen im Brustbereich vornehmen und auf dieser Basis Entscheidungen treffen wollen, enthält der 13-Seiten-Aufsatz "Cumulative incidence of false-positive test results in lung cancer screening: a randomized trial" von Croswell JM, Baker SG, Marcus PM, et al. in der anerkannten Fachzeitschrift "Annales of Internal Medicine" vom 20. April 2010 (2010 Apr 20;152(8):505-12, W176-80). Sowohl das Abstract als auch den kompletten Aufsatz gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 9.5.10
Zu Hause betreute Demenzkranke leben über 2 Jahre länger als wenn sie in Heimen gepflegt würden. Was folgt daraus?
 Bei manchen Forschungsergebnissen stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, sie existierten nicht oder man müsste sich nicht mit den praktischen Konsequenzen auseinandersetzen.
Bei manchen Forschungsergebnissen stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, sie existierten nicht oder man müsste sich nicht mit den praktischen Konsequenzen auseinandersetzen.
Dies gilt beispielsweise für die Antwort auf die Frage "Leben Demenzkranke zu Hause länger als im Heim?", die am 5.April 2010 in einem Online-First-Beitrag in der Fachzeitschrift "Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie" erschienen ist. Sie beruht auf einer bemerkenswerten und in ihrer Art sehr seltenen Follow up-Studie, die mit 173 in einer Ambulanz der Uniklinik Bochum diagnostizierten Demenzkranken zwischen 1995 und 2001 bzw. 2006 durchgeführt wurde. Beim Erstkontakt lebten 48 der Patienten mit vollständiger Datenlage in einem Seniorenheim, die restlichen 97 Demenzkranken mit kompletten Daten wurden zuhause gepflegt.
Wie die ForscherInnen aus verschiedenen Kliniken betonen, sind Frage wie Antwort deshalb von großer Bedeutung, weil bei wahrscheinlich zunehmender Inzidenz von Demenz bei älteren Menschen die "Deckung der Kosten, die durch Demenzkranke verursacht werden, und die Sicherstellung ihrer adäquaten Betreuung" wichtige gesellschaftliche Fragen sind. Dabei gibt es bereits ohne diese Studie einige ethisch schwierigen Konstellationen. Dazu zählt u.a. das Neben- und Gegeneinander des auch bei dementen Personen bekannten Wunsches, solange wie möglich zuhause gepflegt zu werden und der enormen psychischen, psychosozialen und -mentalen Belastungen, denen pflegende Angehörige bis hin zur eigenen Psychiatrisierung ausgesetzt sind.
Die Studie der fünf Ärzte und Gerontologen kommt nun zu folgenden Ergebnissen:
• Die Sterblichkeit von Alzheimer-Patientenhängt hauptsächlich vom Alter und vom Schweregrad der Demenz ab. Demenzkranke Frauen leben länger als demenzkranke Männer.
• Im Seniorenheim gepflegte Patienten haben nach Ausschluss des Einflusses von Alters-, Geschlechts- und vor allem Schweregradunterschieden ein signifikant um 53,1% höheres relatives Sterberisiko (p=0,047) als zu Hause gepflegte Betreute. Dies entspricht absolut und maximal einem um 2,2 Jahre längeren Leben, was je nach Bewertung methodischer Besonderheiten leicht kürzer ist, aber bei einem anderen prospektiven Design auch "deutlich höher" liegen könnte.
Unter dem Ziel der Verlängerung von Lebenszeit bedeutet also eine Heimunterbringung eine bisher so nicht bekannte gravierende Verkürzung der "medianen Überlebenszeit".
Was es noch bedeutet, deuten die Autoren dann an, wenn sie nach der praktischen Bedeutung der Abschätzung von Überlebenszeiten fragen: "Angehörige bezüglich der Prognose fundierter beraten zu können, damit diese besser ihre eigenen Grenzen erkennen und sich entsprechend für eine häusliche oder in-stitutionelle pflegerische Versorgung entscheiden können. Dies hätte im Sinne einer psychiatrischen Primärpräventi¬on eine Verbesserung des Gesundheitzustandes der pflegenden Angehörigen zur Folge, da diese eine Hochrisikopopulation für psychiatrische Morbidität darstellen."
Die anschließende konkrete Schilderung der enormen Belastungsfolgen bei pflegenden Angehörigen von Demenzkranken und die Darstellung einiger struktureller Vorteile der Heimunterbringung (z.B. besserer Umgang mit Mangelernährung, Dehydrierung und dem oft gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus von Demenzkranken, befreit nicht von dem Druck des jetzt sogar quantifizierten Lebensverkürzungseffekt einer "vernünftig" erscheinenden Entscheidung zu Gunsten einer Heimunterbringung.
Offen bleibt in der Studie aber leider u.a. auch, warum unter den für die genannten Aspekte der Lebensqualität von Alzheimerpatienten und die Lebensqualität pflegender Angehöriger vorteilhaften Heimbedingungen die Pflegebedürftigen um Jahre früher sterben. Immerhin weisen die ForscherInnen auf die Unterbeachtung der Lebensqualität von Demenzkranken hin und die vermutlich in Heimen weniger berücksichtigten und befriedigten sozialen Bedürfnisse nach zwischenmenschlichen Kontakten und sinnvoller Beschäftigung.
Wer als Wissenschaftler Angehörige nicht unter einen extremen Rechtfertigungs- und möglicherweise Missbilligungsdruck setzen oder geraten lassen will, wenn sie eine Heimunterbringung für notwendig halten, und wem über zwei Lebensjahre für Demenzkranke nicht gleichgültig sind, muss also so schnell und klar wie möglich sagen, wie entweder die mortalitätsfördernden Bedingungen in Seniorenheimen geändert werden können oder wie Demenzkranke zu Hause betreut werden können ohne dass die Betreuenden selber schwer körperlich und psychisch erkranken.
Der 5 Seiten umfassende Aufsatz ""Leben Demenzkranke zu Hause länger als im Heim?" von D. Lankers, S. Kissler, S.D. Hötte, H.J. Freyberger und S.G. Schröder ist Online-First am 5.4.2010 in der Fachzeitschrift "Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie" (DOI: 10.1007/s00391-010-0096-7) erschienen und kostenlos lediglich als Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 22.4.10
Erstmalige Evaluation der Qualität ärztlicher Weiterbildung in Deutschland: Licht und Schatten
 Egal um welche ärztlichen Behandlungsdefizite oder fehlenden Kenntnisse von Ärzten es geht: In Gestalt anderer Studieninhalte aber auch durch mehr und andere Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärzten scheinen Königswege für nachhaltige Problemlösungen oder -vermeidung vorhanden zu sein.
Egal um welche ärztlichen Behandlungsdefizite oder fehlenden Kenntnisse von Ärzten es geht: In Gestalt anderer Studieninhalte aber auch durch mehr und andere Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärzten scheinen Königswege für nachhaltige Problemlösungen oder -vermeidung vorhanden zu sein.
Dass weder die angebotenen Inhalte noch die Lehrmethoden geeignet sind, die komplexen Probleme zu lösen und dass dies auch nicht ausreichende Lösungsmittel sind, wurde zwar immer schon vermutet, aber eher "gefühlt" als empirisch erhärtet.
Mit der Vorlage der für Deutschland allen Ernstes ersten Evaluation der inhaltlichen Schwerpunkte und Rahmenbedingungen der durch eine separate Weiterbildungsordnung geregelten Weiterbildung junger Ärzte nach seit 14 Jahren praktiziertem Schweizer Muster und mit Unterstützung der Schweizer Evaluatoren, kommt etwas mehr Licht in die Weiterbildungswirklichkeit. Dazu tragen auch Fragen nach der Zufriedenheit der Weiterzubildenden mit dem Angebot bei.
Zwischen Juni und September 2009 wurden mit bis zu 100 Fragen starke Fragebögen an 38.706 bei den Ärztekammern registrierte Weiterbildungsstätten verteilt/zugänglich gemacht, die mangels einer anderen Dokumentation der Anzahl der Weiterzubildenden gebeten wurden, die Anzahl der beschäftigten Weiterbildungsassistenten anzugeben und deren Zugang zur Befragung zu organisieren. 22.363 dieser Weiterbildungsstätten haben zurückgemeldet, dass zurzeit der Befragung keine Ärzte weitergebildet werden. Von den verbleibenden 16.343 Weiterbildungsbefugten haben sich 60,4 %, das heißt 9.876 Weiterbildungsbefugte aktiv an der Befragung beteiligt. Diese 9.876 Weiterbildungsbefugten haben angegeben, dass sich 57.564 Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung befinden. Von diesen haben 18.858, das heißt 32,8 % den Fragebogen ausgefüllt und abgesandt. Insgesamt gingen also in den ersten "Weiterbildungsrapport" der Bundesärztekammer die Antworten von 28.734 Ärzte ein.
Gefragt wurde mit jeweils mehreren Einzelfragen nach der Vermittlung von Fachkompetenzen, der Weiterbildung zur Fehlerkultur, der Anwendung von evidenzbasierter Medizin,nach der Lernkultur, Entscheidungskultur, Betriebskultur und Führungskultur in den Weiterbildungsstätten, also überwiegend in Krankenhäusern. Abschließend war auch die Globalbeurteilung des Angebots gefragt. Hinzu kamen Fragen zur Person und zu weiteren strukturellen Faktoren der beruflichen Situation.
Am interessantesten und für die Diskussion über Gründe für bestimmte ärztliche Handlungsdefizite am wichtigsten sind folgende Ergebnisse:
• Das Durchschnittsalter beim Ablegen der Facharztprüfung ist mit 34 Jahren relativ hoch. Woran dies liegt, lässt die Befragung ungeklärt.
• Bei der Bewertung mit Schulnoten von 1 bis 6 werden acht ausgewählte Aspekte durchschnittlich mit Noten zwischen 2,13 und 3,82 bewertet. Dabei fällt der Mittelwert für die Betriebskultur in den Weiterbildungseinrichtungen mit 2,13 am besten aus, während die schwerpunktmäßig für die Versorgungsqualität relevanten Angebote zur Kultur der Fehlervermeidung (2,81) und zur Anwendung evidenzbasierter Medizin (3,82) deutlich schlechter bewertet werden. Etwa gleich gute Bewertungen erhielten die Vermittlung von Fachkompetenz mit einer mittleren Notenbewertung von 2,52, Lernkultur (2,39), Führungskultur (2,45) und Entscheidungskultur (2,21). Der Mittelwert von 2,54 zur Globalbeurteilung (z. B. "ich würde die Weiterbildungsstätte weiterempfehlen", "ich bin zufrieden mit der Arbeitssituation" …) spiegelt aber nicht unerwartet die grundsätzliche Zufriedenheit mit der Weiterbildungssituation in Deutschland wider.
• Für eine Mehrheit der Weiterzubildenden scheint die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeitregelung keinen negativen Einfluss auf die Arbeit am Patienten (aber 32 % halten dies in irgendeiner Intensität für möglich) und auf die Weiterbildung zu haben (aber immerhin 33 % der Befragten halten dies in irgendeiner Intensität für möglich).
• Dennoch haben 35,2 % der Weiterzubildenden das Gefühl, dass in der vertraglich geregelten Arbeitszeit die Arbeit nicht zur Zufriedenheit erfüllt werden kann (Bewertung durch Notte 4 und schlechter).
• Weniger positiv wurden die administrativen Auflagen beurteilt, da diese die Arbeit am Patienten (67 % der Befragten bewerteten die Situation mit der Note 1 bis 3, stimmten dem also mehr oder minder zu) sowie die Weiterbildung (64,3 % der Befragten sahen dies mehr oder minder so) einschränken.
• 80 % der Ärztinnen und Ärzte, die sich in Weiterbildung befinden, üben Bereitschaftsdienste aus, wobei fast 30 % nie oder sehr selten die Ruhezeiten gemäß Arbeitszeitgesetz einhalten können. Dies ist lediglich bei 7,7 % der Ärztinnen und Ärzte immer gewährleistet. Auch müssen 83,7 % nach Beendigung ihres Bereitschaftsdienstes weiterarbeiten und einer regulären Tätigkeit nachgehen.
• Bei fasst allen Weiterbildungsassistenten (91,5 %) fallen Mehrarbeiten/Überstunden an, welche in 13,9 % gar nicht dokumentiert und in 16,3 % weder durch Freizeit noch durch Bezahlung ausgeglichen werden.
• Genau ein Drittel der Weiterzubildenden haben das Ziel, wissenschaftliche Arbeiten zu publizieren, wobei deutlich mehr als die Hälfte (61,4 %) keine Gelegenheit sieht, während der Weiterbildung an einer wissenschaftlichen Publikation zu arbeiten.
• Der Großteil aller Weiterbildungsassistenten (83,5 %) gibt an, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen regelmäßig zu besuchen.
• Fast zwei Drittel (62,7 %) aller Ärztinnen und Ärzte, die sich in Weiterbildung befinden, geben an, für andere Assistenzärzte Weiterbildungsveranstaltungen durchzuführen.
• Nur in 15,1 % betreut in erster Linie der Chefarzt die praktische Weiterbildung. In 61,4 % übernimmt dies der Oberarzt.
• Bei Antritt der Weiterbildung erhielten lediglich 48% aller Weiterzubildenden einen strukturierten Weiterbildungsplan vom Weiterbildungsbefugten zur Kenntnis gegeben. Dies, so die Autoren der Bundesärztekammer, "verstößt gegen die Weiterbildungsordnung."
• Auch gaben fast 40 % der Weiterzubildenden an, dass gar keine - auch keine mündlichen - Lern- bzw. Weiterbildungsziele vereinbart werden.
Sieht man sich an, was die Inhalte dieser erstmaligen Evaluation der ärztlichen Weiterbildung und damit ihres formalisiert "letzten Schliffs" sind, stellt sich aus Patientensicht schon die Frage, warum es mehr Fragen nach den organisatorischen und "klimatischen" Umständen der Weiterbildung gibt als nach ihren Inhalten und warum die wenigen inhaltlichen Fragen so pauschal und abstrakt gestellt werden.
Warum wird also nicht das in der Präambel der (Muster-)Weiterbildungsordnung von 2003 genannte allgemeine Ziel von Weiterbildung in konkrete Fragen umgewandelt und geprüft, ob die Weiterbildungsinhalte die Ärzte befähigen, diese Ziele zu erreichen? Dort heißt es "Die Weiterbildungsbezeichnung ist der Nachweis für erworbene Kompetenz. Sie dient der Qualitätssicherung der Patientenversorgung und der Bürgerorientierung."
Und mehr darüber zu wissen, ob die im § 4 Abs. 3 derselben Ordnung genannten Ziele qualitativ erreicht worden sind, wäre ebenfalls wichtig: "Die Weiterbildung muss gründlich und umfassend sein. Sie beinhaltet insbesondere die Vertiefung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Verhütung, Erkennung, Behandlung, Rehabilitation und Begutachtung von Krankheiten, Körperschäden und Leiden einschließlich der Wechselbeziehun-gen zwischen Mensch und Umwelt."
Und auch in den langen Lernzieltabellen der "(Muster-)Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung (MWBO 2003)" aus dem Jahr 2008 gibt es genug Ansatzpunkte für Fragen nach der Wirksamkeit von Weiterbildung.
Hier ist es auch nicht wirklich tröstlich, dass in der Schweiz nach einiger Zeit dieser Art der Evaluation Besserungen zu verzeichnen waren.
Und schließlich sollten so schnell wie möglich die Inhalte, die Qualität und die Wirksamkeit der zahllosen anderen anerkannten und punkteträchtigen Fortbildungsangebote untersucht werden, unter denen die Vertragsärzte im Rahmen ihrer seit einiger Zeit existierenden ständigen Fortbildungspflichten wählen können. Einige jüngere Beobachtungen haben gezeigt, dass manche dieser Angebote trotz erkennbarer Mängel von Seiten der Ärztekammern zugelassen worden waren und möglicherweise noch werden.
Den Gesamtbericht gibt es ebenso wie eine textliche Zusammenfassung mit dem Titel "Gute Weiterbildung in Deutschland: Fakt oder Fiktion?" kostenlos auf einer speziellen Website der Bundesärztekammer.
Bernard Braun, 11.3.10
Wem die zigste Debatte über Gesundheitsfinanzierung zu unsozial ist: Open Access zu Zeitschrift über Gerechtigkeit und Gleichheit!
 Wenn die gesundheitspolitische Debatte ab und zu mal wieder aus dem schier endlosen, wenig nachhaltigen und wirkungslosen experto-esoterischen Meer alter, neuer, restaurierter oder revitalisierter Finanzierungsmodelle auftaucht, geraten immer mal wieder auch "weichere" soziale Bedingungen und Resultate für das Funktionieren, die Stabilität und die Wirkkraft des Gesundheitssystems vor ihr Periskop. Dazu zählen u.a. Gerechtigkeit (equity), Gleichheit (equality), Gesundheit als soziales Kapital oder Vertrauen und ihre jeweiligen Gegenteile.
Wenn die gesundheitspolitische Debatte ab und zu mal wieder aus dem schier endlosen, wenig nachhaltigen und wirkungslosen experto-esoterischen Meer alter, neuer, restaurierter oder revitalisierter Finanzierungsmodelle auftaucht, geraten immer mal wieder auch "weichere" soziale Bedingungen und Resultate für das Funktionieren, die Stabilität und die Wirkkraft des Gesundheitssystems vor ihr Periskop. Dazu zählen u.a. Gerechtigkeit (equity), Gleichheit (equality), Gesundheit als soziales Kapital oder Vertrauen und ihre jeweiligen Gegenteile.
Für einen ersten Ein- und Überblick zum nationalen aber vor allem internationalen Kenntnis- und Forschungsstands über die "weicheren" Bedingungen von Gesundheitssystemen bietet jetzt die gerade komplett seit 2002 offen und kostenlos zugängliche Fachzeitschrift "International Journal for Equity in Health" eine gute Grundlage.
Sie ist offizielles Organ der International Society for Equity in Health. Die Gesellschaft gibt nicht nur diese Zeitschrift heraus, sondern veröffentlicht auch regelmäßig Reports zu gesundheitspolitischen Entwicklungen in Regionen, in denen der freie, gleiche oder gerechte Zugang zu und die Nutzung von Gesundheitseinrichtungen noch keine Selbstverständlichkeiten sind oder gar wegreformiert werden sollen. Aktuell findet man dort den 2006 erschienenen Report "EQUITY AND HEALTH SECTOR REFORM IN LATIN AMERICA AND THE CARRIBBEAN FROM 1995 TO 2005: Approaches and Limitations". Darin geht es um Erfahrungen und Lektionen aus den Gesundheitsreforminitiativen in dieser Region und besonders um Effekte auf die Gerechtigkeit beim Zugang und der Erbringung von Leistungen. Unerfreuliches Ergebnis: "The evidence gathered reveals that for most countries, the implementation of HSR has not delivered the effects expected."
Die Zeitschrift erreicht man u.a. über die "Open Access"-Plattform des "Open Access Publisher Biomed Central home". Es gibt dort auch die Möglichkeit der kostenlosen Registrierung für den Zugang zu den anderen, immer zahlreicher werdenden Open Access-Zeitschriften - als Leser und Autor!
Wer beim "International Journal for Equity in Health" zu stöbern anfängt, startet mit einer nicht nur historisch interessanten "Annotated Bibliography on Equity in Health, 1980-2001" von James A Macinko und Barbara Starfield von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore im Aprilheft 2002 der Zeitschrift (2002, 1:1doi:10.1186/1475-9276-1-1). Weiter geht es zwischendrin beispielsweise mit einem Literatur-Review "Social capital and health: Does egalitarianism matter? A literature review" von M Kamrul Islam, Juan Merlo, Ichiro Kawachi, Martin Lindström und Ulf-G Gerdtham in der Aprilnimmer 2006 weiter (2006, 5:3 [5. April 2006]) und reicht bis zum aktuellsten Aufsatz "Willingness to pay for rapid diagnostic tests for the diagnosis and treatment of malaria in southeast Nigeria: ex post and ex ante" von Benjamin S.C. Uzochukwu, Obinna E Onwujekwe, Nkoli P Uguru, Maduka D. Ughasoro und Ogochukwu P. Ezeoke in der Januarnummer 2010 der Zeitschrift (2010, 9:1 [15. Januar 2010]).
Bernard Braun, 3.2.10
Wie entscheiden sich Patienten für oder gegen Therapien und welche Rolle spielen dabei Entscheidungshilfen? Das Beispiel Tamoxifen
 Wie viele Frauen mit einem relativ hohem Risiko, innerhalb der nächsten 5 Jahre an primärem Brustkrebs zu erkranken, versuchen dieses Risiko durch die Einnahme des nachweislich wirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Wirkstoffs Tamoxifen (vgl. genauere pharmakologische und sonstige Angaben mit hervorragenden und hilfreichen Links in der umfassend aufgebauten Datenbank "ChemIDplus lite" der US-National Library of Medicine) zu verringern bzw. eine Erkrankung zu vermeiden?
Wie viele Frauen mit einem relativ hohem Risiko, innerhalb der nächsten 5 Jahre an primärem Brustkrebs zu erkranken, versuchen dieses Risiko durch die Einnahme des nachweislich wirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Wirkstoffs Tamoxifen (vgl. genauere pharmakologische und sonstige Angaben mit hervorragenden und hilfreichen Links in der umfassend aufgebauten Datenbank "ChemIDplus lite" der US-National Library of Medicine) zu verringern bzw. eine Erkrankung zu vermeiden?
Wie entscheiden sie sich, wenn ihnen umfassende, wissenschaftliche ausgewogene und verständliche Informationen über ihr individuelles Erkrankungsrisiko, das Pro und Contra zu den Wirkungen des Wirkstoffs und die positiven wie negativen Wirkungen des Verzichts, ihn einzunehmen, mittels einer maßgeschneiderten Entscheidungshilfe ("tailored decision aid") im Rahmen einer "informed decision making"-Behandlung zur Verfügung gestellt werden?
Der Hintergrund dieser Fragen ist, dass einerseits nach Angaben des "National Cancer Institute" der USA in mehreren seit 1998 durchgeführten Brustkrebs-Präventionsstudien bei Frauen, die ohne Vorerkrankung also präventiv ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tamoxifen eingenommen hatten, eine geringere Inzidenz von Brustkrebs nachgewiesen wurde. Andererseits nehmen aber schätzungsweise von den allein in den USA lebenden 10 Millionen Frauen, die etwas von der Wirkung dieser Präventionsmaßnahme haben könnten, nur wenige Tamoxifen ein.
Ob dies an Informationsmängeln oder dem Fehlen verständlicher und ausgewogener Information liegt, wollte nun erstmals ein Wissenschaftlerteam in den USA genauer wissen.
Dazu wählten sie auf Basis von medizinischen Daten in zwei Krankenversicherungen in Michigan und im Bundesstaat Washington die Frauen im Alter von 40 bis 74 Jahren aus, die zur Zielgruppe der Prophylaxe gehören und für die ein erhöhtes 5-Jahresrisiko für Brustkrebs berechnet werden konnte. Vorgeklärt wurde ferner, ob Tamoxifen nicht evtl. durch sonstige Erkrankungen kontraindiziert wäre.
Von den zunächst als mögliche Teilnehmerinnen mit einem Einladungs- und Informationsschreiben angesprochenen 8.896 Frauen blieben nach weiteren Überprüfungen ihrer Eignung für die Studie noch 632 Teilnehmerinnen übrig. Sie waren durchschnittlich 59 Jahre alt, weiß und gut ausgebildet.
Jede Teilnehmerin erhielt im Rahmen der Studie eine Online-Information zur Quantität ihres Erkrankungsrisikos, der Risiken der Einnahme aber auch der Nichteinnahme von Tamoxifen, die bis in Details auf ihre Person zugeschnitten war. Die VerfasserInnen wollten die Leserinnen ausdrücklich nicht überzeugen, Tamoxifen einzunehmen, sondern ihnen lediglich ausgewogene evidente Informationen zur Entscheidungsfindung liefern. Nachdem die Teilnehmerinnen die Entscheidungshilfe gelesen hatten wurden sie nach ihren Verhaltensabsichten gefragt. Nach 3 Monaten folgten Fragen zum tatsächlichen Verhalten bis zu diesem Zeitpunkt, nach dem Wissensstand und nach Gründen für die Nichteinnahme des Wirkstoffs.
Dabei gab es eine Reihe interessanter Ergebnisse, die in dieser Qualität erstmalig erhoben worden sind:
• Nach der ersten Lektüre der Entscheidungshilfe wollten 28,8% der Teilnehmerinnen sich nach weiteren Informationen umsehen, die sie zum Teil durch Links in dem Hilfetext leicht erreichen konnten. 29,5 % wollten darüber mit ihrem Arzt reden. Nur 5,8% gaben aber an, sie würden innerhalb des folgenden Jahres mit der Einnahme von Tamoxifen beginnen. Dies waren sogar weniger als bei Frauen, die keine derartige Informationsbasis besaßen.
• Es gab einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten Risikoniveau (abgebildet mit dem so genannten Gail score) und dem Wunsch mit einem Arzt über mögliche Behandlungsschritte zu reden. Keine Assoziation gab es aber zwischen dem Risikoniveau und der Absicht, weitere Informationen zum Wirkstoff zu suchen.
• Nach 3 Monaten hatten 0,9% (n=3) der Teilnehmerinnen mit der Einnahme von Tamoxifen begonnen, 5,8 % hatten mit ihrem Arzt geredet und 5,4% hatten nach weiteren Informationen gesucht. Selbst Frauen mit dem höchsten Risikowert suchten zwar etwas häufiger nach Informationen oder redeten mit ihrem Arzt, aber mehr als 10,6% und nochmals 10,6% waren dies nicht. Die große Mehrheit reagierte nicht auf die Informationen der Entscheidungshilfe.
• Als einen Grund für die geringe Anzahl von Teilnehmerinnen mit Reaktionen und Folgeaktivitäten nennen die WissenschaftlerInnen das trotz umfassender Information relativ geringe Wissensniveau vieler Angehörigen der Interventionsgruppe: Alles in Allem beantworteten die Teilnehmerinnen 4,31 der 6 Wissensfragen korrekt. 63% von ihnen beantworteten mindestens 5 Fragen korrekt und 41,4% gaben ausschließlich richtige Antworten. Nur 3% beantworteten aber sämtliche Fragen falsch und stellten interessanterweise einen überproportionalen Anteil an der Gruppe von Frauen, die Tamoxifen einnehmen wollten.
• 81% der Frauen wussten dabei genau, dass der Wirkstoff ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, präventiv beeinflussen kann.
• Gut ein Drittel waren schließlich noch daran interessiert mehr über das Risiko und den Nutzen von Brustkrebs und Tamoxifen zu lernen.
• Da es unmöglich ist, mit den 3 TeilnehmerInnen, die nach der Intervention Tamoxifen einnahmen, differenzierte Analysen über mögliche Ursachen durchzuführen, gaben die ForscherInnen lediglich plausible Hinweise auf die Rolle subjektiver Erwartungen über die Risiken und den Nutzen von Tamoxifen. Hinzu kamen bei 80% der TeilnehmerInnen, die den Wirkstoff nicht einzunehmen beabsichtigten, Sorgen über seine Nebenwirkungen, 58,8% bewerteten den Nutzen nicht so hoch, dass er die Risiken aufwiegen könnte und zwischen 20 und 40% dieser Gruppe hielten viele Umstände einer Arzneimitteltherapie persönlich nicht für ertragbar.
Selbst bei einer so großen Anzahl von Studienteilnehmerinnen und nach dem erstmaligen Einsatz einer maßgeschneiderten Risiko- und Nutzeninformation waren also "many women at elevated risk … unwilling to accept the risks of tamixofen to reduce their breast cancer risk."
Die Studie liefert eine Reihe Einblicke in die wirkliche relative Bedeutung von evidenten und gut aufbereiteten Informationen für Entscheidungen von Gesunden und PatientInnen über medizinische Interventionen. Bemerkenswert ist die insgesamt geringe handlungsauslösende oder -steuernde Rolle der Ressource Wissen bzw. die bereits in anderem Zusammenhang beobachtete deutliche Differenz zwischen dem Interesse an "mehr Informationen", Handlungsabsichten und tatsächlichem Handeln. Weitere empirische Belege hierfür finden sich z.B. in dem Forums-Beitrag "Wissen=Handeln?". Diese Differenz ist für all jene Studien und Interventionsprojekte wichtig, die sich ausschließlich an Informations- oder Handlungsinteressen und -absichten orientieren und dabei riskieren, dass ihre Intervention quantitativ wenig genutzt wird oder wirkungslos verpufft. Lehrreich sind die Ergebnisse dieser Studie auch für jene, die beabsichtigen, optimale Versorgungsziele per informationsorientierten Entscheidungshilfen bzw. "decision aids" zu erreichen.
Da die Studie weder für andere ethnischen Gruppen und auch nicht für Frauen mit anderen Bildungsabschlüssen Gültigkeit besitzen kann, wird erst eine repräsentative Studie, dann aber auch gleich mit Kontrollgruppe, zeigen können, wie sich Entscheidungshilfen in einer Normalbevölkerung auswirken.
Die konkrete 48-seitige Entscheidungshilfe Tamoxifen und Brustkrebs ist für diejenigen, die sich für diese Form der patientenorientierten Entscheidungshilfe interessieren, kostenlos erhältlich.
Zum Aufsatz "Women's decisions regarding tamoxifen for breast cancer prevention: responses to a tailored decision aid" von Angela Fagerlin et al. in der Fachzeitschrift "Breast Cancer Research Treatment" (12. November 2009 - elektronische Vorabveröffentlichung) gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 6.1.10
Hand- oder Elektrobetrieb: Wo endet für eine Krankenkasse die gesetzliche Pflicht, die Selbständigkeit von Behinderten zu fördern?
 Egal, ob es um Rehabilitationsleistungen oder Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung geht, verpflichtet der Gesetzgeber die Sozialverwaltungen, durch ihre Leistungen die Selbständigkeit und Selbstbestimmung ihrer betroffenen Versicherten zu fördern:
Egal, ob es um Rehabilitationsleistungen oder Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung geht, verpflichtet der Gesetzgeber die Sozialverwaltungen, durch ihre Leistungen die Selbständigkeit und Selbstbestimmung ihrer betroffenen Versicherten zu fördern:
• "Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen … um … die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. (§ 4 Abs. 1 SGB IX)
• "Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht" (§ 2 SGB XI)
• "Den besonderen Belangen behinderter und chronisch kranker Menschen ist Rechnung zu tragen." (§ 2a SGB V)
Dennoch verweigerte die Barmer Ersatzkasse einem ihrer an beiden Beinen amputierten und damit schon länger auf einen Rollstuhl angewiesenen Versicherten, der nun wegen Kreislauf- und Herzproblemen und einer durch das ständige Fahren des Rollstuhls verursachten ärztlich attestierten chronischen Entzündung beider Arme auch noch Probleme bekam, sich mit eigener Kraft zu bewegen, die Finanzierung eines Elektrorollstuhl nach § 33 SGB V.
Zentrale Begründung: Der Behinderte könne sich doch durch seine Frau oder seinen Schwiegersohn schieben lassen. Diese Position hielten das zuständige baden-württembergische Sozial- und Landessozialgericht (LSG) auf eine entsprechende Klage des behinderten Versicherten gegen die Barmer für rechtens.
Erst das Bundessozialgericht (BSG) besann sich jetzt auf die eingangs zitierten klaren und auch die Wuppertaler Großkasse verpflichtenden Ziele des Gesetzgebers, den Behinderten wenn irgend möglich unabhängig zu machen und erklärte in einer bereits im August 2009 veröffentlichten Entscheidung: "Zu Unrecht hat das LSG auf die Möglichkeiten der familiären Schiebehilfe verwiesen; wesentliches Ziel der Hilfsmittelversorgung ist es nämlich, den behinderten Menschen von der Hilfe anderer Menschen unabhängig zu machen und ihm eine selbständigere Lebensführung zu ermöglichen. Deshalb besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Versorgung mit einem Elektrorollstuhl, wenn ein Versicherter nicht (mehr) in der Lage ist, den Nahbereich der Wohnung mit einem vorhandenen Aktivrollstuhl aus eigener Kraft zu erschließen."
Das LSG müsse nun abschließend ermitteln, dass der Versicherte nicht selbst in der Lage sei, seinen Rollstuhl zu bewegen. Trotz der Hinweise und vorgelegter Atteste des klagenden Behinderten geschah dies im ersten Verfahren wohl nicht. Bestätigt sich dann das Unvermögen des Versicherten, sich mit eigener Kraft zu bewegen, muss ihm nach dem BSG-Urteil die Barmer Ersatzkasse einen Elektrorollstuhl finanzieren.
Dies ist leider kein Einzelfall, sondern es kommt immer wieder ausgerechnet zwischen schwer bedürftigen und damit natürlich so genannten "schlechten Risiken" und ihren Kassen zu derartigen vorgerichtlichen oder auch gerichtlichen Auseinandersetzungen. Daher sei die Frage erlaubt, ob in solchen Fällen bereits die rechts- und sozialblinden Betriebswirte das Sagen haben oder man den Kassenmitarbeitern empfehlen sollte, sich mal eine Stunde von ihrem Schwiegersohn durch die bergige Wuppertaler Innenstadt schieben zu lassen - Sammeln von Versorgungswirklichkeit eben!
Die wesentlichen Argumente zu dem beim BSG unter dem Aktenzeichen B 3 KR 8/08 R geführten Rechtsstreit stehen der Öffentlichkeit innerhalb des BSG-"Terminbericht 44/09" vom 13.8.2009 kostenlos zur Verfügung.
Aktueller Nachtrag: Außerdem ist auch der komplette Text des Urteils samt Begründung veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.09
Arzneimittelhersteller behindert die bestmögliche Behandlung von Patienten mit Depression
 Mehr als andere findet das Pharmaunternehmen Pfizer immer mal wieder den Weg in die Öffentlichkeit, und meistens sprechen die Schlagzeilen nicht für das US-Unternehmen. Im jüngsten Fall geht es um das Antidepressivum Reboxetin mit dem Handelsnamen Edronax®. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) mit Sitz in Köln wirft dem Pharmahersteller vor, Informationen und Daten über die Wirkung dieses Medikaments zu verschweigen. Nach Angaben des IQWIG, das im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusse (g-BA) vom 22. Februar 2005 die Wirksamkeit dreier neuer Antidepressiva bewerten sollte, weigerte sich Pfizer trotz wiederholter Bitte, eine vollständige Aufstellung sämtlicher veröffentlichter und unveröffentlichter Studien zu Reboxetin zur Verfügung zu stellen. Nach Recherchen des IQWIG erfolgte die Testung dieses in Deutschland zugelassenen Arzneimittels in mindestens 16 Studien an etwa 4600 PatientInnen, die an Depressionen leiden. Allerdings fehlen von 9 dieser 16 Studien Schlüsselinformationen zur Beurteilung von Reboxetin, und dem IQWIG stehen bisher nur Daten von ca. 1.600 ProbandInnen zur Verfügung.
Mehr als andere findet das Pharmaunternehmen Pfizer immer mal wieder den Weg in die Öffentlichkeit, und meistens sprechen die Schlagzeilen nicht für das US-Unternehmen. Im jüngsten Fall geht es um das Antidepressivum Reboxetin mit dem Handelsnamen Edronax®. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) mit Sitz in Köln wirft dem Pharmahersteller vor, Informationen und Daten über die Wirkung dieses Medikaments zu verschweigen. Nach Angaben des IQWIG, das im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusse (g-BA) vom 22. Februar 2005 die Wirksamkeit dreier neuer Antidepressiva bewerten sollte, weigerte sich Pfizer trotz wiederholter Bitte, eine vollständige Aufstellung sämtlicher veröffentlichter und unveröffentlichter Studien zu Reboxetin zur Verfügung zu stellen. Nach Recherchen des IQWIG erfolgte die Testung dieses in Deutschland zugelassenen Arzneimittels in mindestens 16 Studien an etwa 4600 PatientInnen, die an Depressionen leiden. Allerdings fehlen von 9 dieser 16 Studien Schlüsselinformationen zur Beurteilung von Reboxetin, und dem IQWIG stehen bisher nur Daten von ca. 1.600 ProbandInnen zur Verfügung.
Ohne Einbeziehung der unveröffentlichten Daten ist keine zuverlässige Einschätzung der Studienlage möglich und es besteht die große Gefahr, den Nutzen und Schaden des Medikaments falsch einzuschätzen. Pfizer hat dem IQWiG keinerlei Begründung für die Weigerung genannt, die Studien offen zu legen. "Durch das Verschweigen von Studiendaten nimmt der Hersteller Patienten und Ärzten die Möglichkeit, sich informiert zwischen verschiedenen Therapieoptionen zu entscheiden", sagt Peter Sawicki, Leiter des IQWiG, und kritisiert die Behinderung Arbeit seines und anderer unabhängiger Institutionen. Das IQWIG, dessen Ziel es ist, verlässliche Aussagen über Vor- und Nachteile von Arzneimitteln zu treffen, sieht aufgrund dieser Situation vorläufig keinen Hinweis auf einen Nutzen einer Behandlung mit Reboxetin.
Zu diesem Fall wandte sich das IQWIG mit dem Vorwurf Pfizer hält Studien unter Verschluss mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Von dem Instituts-Vorbericht über die Nutzenbewertung einer Behandlung mit Bupropion, Mirtazapin oder Reboxetin bei der Behandlung der akuten Phase der Depression, bei der Erhaltungstherapie (Rückfallprävention) und bei der Rezidivprophylaxe ist auch eine vorab veröffentlichte Kurzfassung im Netz verfügbar. Die Auseinandersetzung zwischen dem IQWIG und Pfizer stieß in der deutschen Fach- und Laienpresse auf großes Interesse. So berichten das Deutsche Ärzteblatt und die Berliner Zeitung ausführlich und an prominenter Stelle über den Vorfall.
Dieses jüngste Beispiel ist allem Anschein nach ein weiterer Beleg für den lange bekannten Publikations-Bias in der medizinischen und pharmakologischen Fachliteratur. Insbesondere so genannte negative Studien, die nicht die erwünschte Wirksamkeit oder Überlegenheit eines Arzneimittels belegen können, haben erheblich größere Hürden zu überwinden, um in renommierten Journals zu erscheinen. Da eine Veröffentlichung vielfach erst mit großer Verzögerung oder gar nicht erfolgt, erhalten ÄrztInnen und PatientInnen ein geschöntes Bild. Immer wieder zeigt sich, dass publizierte Literatur die Wirkungen von Medikamenten zu überschätzen pflegt, und für einige Wirkstoffe ist sogar jedweder Nutzen fraglich.
Auch der 112. Ärztetag vom 19.-22. Mai 2009 in Mainz machte sich die Forderung nach industrie-unabhängiger Forschung zu eigen, wie das Deutsche Ärzteblatt in seiner Ausgabe vom 29.5.2009 berichtet. Dankenswerterweise stellt der in dieser Sache engagierte Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) auf seiner Homepage auch einen einschlägigen Untersuchungsbericht der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft zum Der Einfluss der pharmazeutischen Industrie auf die wissenschaftlichen Ergebnisse und die Publikation von Arzneimittelstudien kostenlos zum Download zur Verfügung. Darin kommt der federführende Autor, der Mainzer Ordinarius Professor Klaus Lieb, zu einem ernüchternden Fazit: "Zurzeit besteht also die inakzeptable Situation, dass Publikationen von Studienergebnissen, bei denen die pharmazeutische Industrie beteiligt war, den Leser den therapeutischen Nutzen eines Arzneimittels überschätzen lassen. Diese Fehleinschätzung beschränkt sich nicht auf den einzelnen Arzt, da auch Leitlinien, z. B. von medizinischen Fachgesellschaften, auf der Basis von veröffentlichten Studienergebnissen erarbeitet werden und die verzerrte Wahrnehmung der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit eines Arzneimittels zu fehlerhaften Empfehlungen führen kann. Dies wirkt sich auf die Versorgung des einzelnen Patienten und über eine verzerrte Einschätzung von Kosten und Nutzen auf das gesamte Gesundheitswesen aus."
Die Ursache dieser verbreiteten Problematik liegt zu einem nicht unerheblichen Teil daran, dass heutzutage die meisten medizinisch-pharmazeutische Studien nicht in unabhängigen Institutionen, sondern auf Veranlassung und vor allem mit Finanzierung der Hersteller möglich sind. Eine im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte, Untersuchung über die selektive Publikation von Studienergebnissen über Antidepressiva bestätigt insbesondere für Industrie-gesponserte Untersuchungen einen unübersehbaren Hang zur Veröffentlichung positiver, also erwarteter Studienergebnisse. Bei der Beurteilung der Ursachen führen die Autoren mehrere Gründe an, bei den Konsequenzen ist ihr Fazit aber eindeutig: "We cannot determine whether the bias observed resulted from a failure to submit manuscripts on the part of authors and sponsors, from decisions by journal editors and reviewers not to publish, or both. Selective reporting of clinical trial results may have adverse consequences for researchers, study participants, health care professionals, and patients." Löblicherweise steht die sehr lesenswerte Studie Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on Apparent Efficacy kostenlos als Volltext auf der Website des NEJM zum Download zur Verfügung.
Erschwerend kommen wirtschaftliche Verflechtungen wichtiger Verlagshäuser mit interessierten Kreisen der Gesundheitswirtschaft hinzu. Eine erkleckliche Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen stammt aus der Feder von Marketingfirmen. Das Forum Gesundheitspolitik hatte bereits Anfang Oktober 2007 auf das Thema des Ghost Management" der Pharmaindustrie hingewiesen. In ihrer Ausgabe vom 5. Mai macht die Fachzeitschrift Annals of Internal Medicine auf die vielfach unzureichende Qualität von Presseinformationen wissenschaftlicher Institutionen aufmerksam. Erwähnenswert und aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch eine Untersuchung über die Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlicher Institutionen, die oftmals von ebenso unübersehbarem wie unkritischen Eigeninteresse geleitet ist und an Objektivität zu wünschen übrig lässt. Der Artikel Press Releases by Academic Medical Centers: Not So Academic, der als Volltext kostenfrei im Internet zur Verfügung steht, verweist auf die unzureichende Qualität und Verständlichkeit der Verlautbarungen von Wissenschaftlern. Ihre Fazit ist ernüchternd: "Press releases issued by 20 academic medical centers frequently promoted preliminary research or inherently limited human studies without providing basic details or cautions needed to judge the meaning, relevance, or validity of the science."
Nicht nur die pharmazeutische Industrie versucht sich üblicherweise durch Selbstverpflichtungen von allzu starkem gesellschaftlichem Druck zu befreien. So hatte auch das IQWiG bereits 2005 mit dem Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA) eine grundsätzliche Einigung zur Übergabe aller zur Bewertung erforderlichen Daten vereinbart und die internationalen Verbände der pharmazeutischen Industrie hatten sich im Januar 2005 zur Offenlegung von Informationen zu klinischen Studien verpflichtet. Nicht nur das jüngste Beispiel von Pfizer und seinem Antidepressivum Reboxetin zeigt, dass freiwillige Lösungen nicht ausreichen. Auch andere Firmen lehnten es in den letzten Jahren wiederholt ab, dem IQWIG Studienunterlagen zur Verfügung zu stellen, die es für die Nutzenbewertung von Arzneimitteln benötigte. Diese Daten sind zudem vielfach gar nicht in den Studienregistern enthalten, deren Aufbau in den letzten Jahren den Überblick über laufende Untersuchungen erleichtern und das Verschweigen erschweren sollte.
Der Fall Pfizer ist ebenso wie viele andere im Übrigen auch eine Angelegenheit für VerbraucherschützerInnen und PatientenvertreterInnen. Mit dem Verschweigen und Vorenthalten von Studiendaten und -ergebnissen verstoßen die Hersteller nämlich auch gegen Absprachen mit den StudienteilnehmerInnen. Schließlich stellen sich die ProbandInnen freiwillig und uneigennützig mit dem Ziel zur Verfügung, durch ihre Teilnahme und die Veröffentlichung der Ergebnisse anderen Erkrankten zu helfen.
Hier finden die LeserInnen des Forum Gesundheitspolitik den ausführlichen Vorbericht des IQWIG.
Jens Holst, 12.6.09
Hausgeburten sind bei Müttern mit geringem Geburtsrisiko und guter Notfall-Infrastruktur so sicher wie Krankenhaus-Entbindungen
 Auch wenn es in Deutschland und einigen vergleichbaren europäischen Ländern (z. B. England und Wales 2,7 % aller Geburten in 2006) immer noch relativ wenige Geburten außerhalb von Krankenhäusern, also in Geburtshäusern oder zu Hause, gibt, liegen doch seit Jahren Daten über die Qualität dieses Teils des Geburtsgeschehens vor. Über die insgesamt positiven Ergebnisse eines der letzten "Qualitätsberichte", die regelmäßig von der von den Hebammenverbänden getragenen "Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V. (QUAG)" erstellt werden, wurde im Forum-Gesundheitspolitik bereits berichtet.
Auch wenn es in Deutschland und einigen vergleichbaren europäischen Ländern (z. B. England und Wales 2,7 % aller Geburten in 2006) immer noch relativ wenige Geburten außerhalb von Krankenhäusern, also in Geburtshäusern oder zu Hause, gibt, liegen doch seit Jahren Daten über die Qualität dieses Teils des Geburtsgeschehens vor. Über die insgesamt positiven Ergebnisse eines der letzten "Qualitätsberichte", die regelmäßig von der von den Hebammenverbänden getragenen "Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V. (QUAG)" erstellt werden, wurde im Forum-Gesundheitspolitik bereits berichtet.
Ob die Sicherheit dieser Art von Geburt auch noch gewährleistet ist, wenn ein höherer Anteil der werdenden Mütter beschließt, ihr Kind nicht in einer Klinik und dominant von Ärzten entbinden zu lassen, sondern außerstationär unter maßgeblicher Beteiligung von Hebammen, war bisher noch umstritten oder offen. Dies lag u.a. auch daran, dass es nur sehr wenige und dann auch nur kleine Studien gab, bei denen der Geburtsort bei der Randomisierung eine wichtige Rolle spielte.
Dieser unbefriedigende Zustand und damit auch die Ängste vor Sicherheitsrisiken von Hausgeburten, haben mit dem Abschluss einer landesweiten Studie in den Niederlanden ein Ende gefunden. An der Studie waren 529.688 Frauen mit einem als gering eingeschätzten Geburtsrisiko beteiligt, die während ihrer Schwangerschaft überwiegend oder primär von Hebammen betreut wurden und ihr Kind zwischen dem 1.Januar 2000 und 31. Dezember 2006 zur Welt brachten. Damit handelt es sich um die bisher größte Untersuchung über die Verteilung der Geburtsort-Präferenzen und die Sicherheit der verschiedenen Geburtsvarianten.
Für die Diskussion in Deutschland ist bereits interessant, dass 60,7 % der Frauen eine Hausgeburt geplant hatten, 30,8 % in ein Krankenhaus gehen wollten und es für 8,5% der Frauen keine Daten zum Entbindungsort gab.
Die ForscherInnen fanden, dass mehr Frauen, die eine Hausgeburt planten 25 Jahre alt und älter und Holländerinnen waren und der mittleren bis höheren Sozialschicht angehörten. Unter ihnen war der Anteil der Frauen größer, die schon zwei oder mehr Kinder hatten.
Die Sicherheit der Geburtsvarianten wurde an Hand der so genannten perinatalen Sterblichkeitsrate der Kinder während der ersten 24 Stunden des Geburtsgeschehens und während der ersten Woche nach der Entbindung gemessen.
Die Ergebnisse waren eindeutig:
• Bei den Gesamt-Sterblichkeitsraten gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Frauen, die zu Hause oder im Krankenhaus mit jeweiliger Hilfe einer Hebamme entbunden hatten.
• Kinder einer geplanten Hausgeburt mussten mit einer vergleichbaren Wahrscheinlichkeit, nämlich sieben Neugeborene pro 1.000 Neugeborene, wegen Geburtskomplikationen in einer Intensivstation für Neugeborene ("Neonatal intensive care unit (NICU)" behandelt werden wie Kinder, deren Mütter sich von vornherein für eine Entbindung im Krankenhaus entschieden hatten.
• Das Risiko für einen schlechten Verlauf bzw. Komplikationen bei der Geburt war nach den Studienergebnissen höher bei den Erstgebärenden, bei Frauen in der 37ten oder 41ten Schwangerschaftswoche (im Vergleich mit jenen Frauen, die zwischen der 38ten und 40ten Woche entbanden), bei Frauen, die 35 Jahre oder älter und unter 25 Jahren alt waren und nichtholländischer Herkunft waren. Diese Faktoren wurden beim Vergleich zwischen den geplanten Haus- und Krankenhausgeburten in Rechnung gestellt, sodass sie keine Rolle bei Unterschieden oder Nichtunterschieden spielten.
• Nahezu ein Drittel der Frauen, die eine Hausgeburt planten und auch mit ihr praktisch starteten, musste sie wegen medizinischer Komplikationen beim Fötus oder wegen der Notwendigkeit einer wirksameren Schmerzbehandlung (z. B. Epiduralanästhesie) bei der Gebärenden in einem Krankenhaus und dort in ärztlicher Behandlung beenden.
• Dass das Sterblichkeitsrisiko dieser Mütter und ihrer Kinder nicht höher war als bei Müttern, die von Beginn an ins Krankenhaus gingen, liegt nach Ansicht der WissenschaftlerInnen aber dann auch an der Schnelligkeit der Transporte und den kurzen Wegen in ein Krankenhaus innerhalb der Niederlande.
Unter der Voraussetzung, dass es sich bei den werdenden Müttern zum Zeitpunkt der Geburtssituation um "low-risk women" handelt, eine entsprechende Notfall-Infrastruktur existiert und nicht zuletzt die Schwangeren über die unerwarteten Notfallsituationen beraten wurden, die während der Geburt auftreten können und eine schnelle Reaktion erfordern, sind Hausgeburten nach der niederländischen Studie "as safe as hospital".
Künftige Forschungsarbeiten sollten u.a. die Sicherheit der Hausgeburten mit Geburten von "low-risk-women" vergleichen, die entweder für eine maßgeblich von Ärzten oder maßgeblich von Hebammen mitgetragene Geburtsvariante optierten.
Der komplette Aufsatz "Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births" von A. de Jonge, BY van der Goes, ACJ Ravelli, MP Amelink-Verburg, BW Mol, JG Nijhuis, J Bennebroek Gravenhorst und SE Buitendijk ist in der Zeitschrift "BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology" (2009;116: 1-8) veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.4.09
Selbstkontrolle des Blutzuckers und Selbstmanagement der Ergebnisse oder HbA1c-Messung - Schwarzer Tag für Teststreifenhersteller?
 Um eigenverantwortliches Handeln zu stärken und Patienten in diagnostische und therapeutische Prozesse einzubeziehen, galten die regelmäßige, d.h. nicht selten täglich mehrmalige Messung des Blutzuckerwertes und die zusätzliche Notwendigkeit Patienten zu qualifizieren, die gewonnenen Erkenntnisse bis zu einem bestimmten Punkt in ihr Behandlungs- und Verhaltenskonzept miteinzubeziehen als wirksam, um den Blutzuckerspiegel bei nicht mit Insulin behandelten DiabetikerInnen absenken und dauerhaft auf einem niedrigen Niveau halten zu können. Trotz des damit verbundenen auf Dauer kostspieligen Verbrauchs von Teststreifen - ob aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen oder direkt aus der eigenen Geldbörse der Kranken - oder der Anschaffung immer besserer, schmerzfreierer und genauerer Testgeräte, ging und geht es in der Debatte über die eigenaktive Messung und Steuerung des Blutzuckers überwiegend um die Kosten dieser Dauermessungen und nicht um deren Sinn und Nutzen.
Um eigenverantwortliches Handeln zu stärken und Patienten in diagnostische und therapeutische Prozesse einzubeziehen, galten die regelmäßige, d.h. nicht selten täglich mehrmalige Messung des Blutzuckerwertes und die zusätzliche Notwendigkeit Patienten zu qualifizieren, die gewonnenen Erkenntnisse bis zu einem bestimmten Punkt in ihr Behandlungs- und Verhaltenskonzept miteinzubeziehen als wirksam, um den Blutzuckerspiegel bei nicht mit Insulin behandelten DiabetikerInnen absenken und dauerhaft auf einem niedrigen Niveau halten zu können. Trotz des damit verbundenen auf Dauer kostspieligen Verbrauchs von Teststreifen - ob aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen oder direkt aus der eigenen Geldbörse der Kranken - oder der Anschaffung immer besserer, schmerzfreierer und genauerer Testgeräte, ging und geht es in der Debatte über die eigenaktive Messung und Steuerung des Blutzuckers überwiegend um die Kosten dieser Dauermessungen und nicht um deren Sinn und Nutzen.
An diesen gab es bereits seit längerem Zweifel, die von Warnungen über die technischen und vor allem Effektivitätsdefizite der Selbstmessung begleitet wurden. Unter den Schlagzeilen "Self management" bei Diabetes und Asthma kein Selbstläufer - Sachkundige Unterstützung und Überprüfung der Umsetzung erforderlich und Self-Monitoring des Blutzuckers ohne gesundheitlichen Zusatznutzen - Von den Grenzen der Patienten-Eigenaktivitäten gab es im Forum-Gesundheitspolitik auch bereits entsprechende Hin- und Nachweise.
Die im Februar 2009 in Großbritannien im Rahmen der "Diabetes Glycaemic Education and Monitoring (DiGEM)"-Studie abgeschlossene und als Health Technology Assessment-Bericht veröffentlichte Studie "Blood glucose self-monitoring in type 2 diabetes: a randomised controlled trial" wollte die immer noch wenig verbreiteten Annahmen über die inhaltlichen Grenzen dieser Methode randomisiert und kontrolliert untersuchen. Dazu wurden 435 Patienten im Alter über 25 Jahren aus 24 Allgemeinarztpraxen in Oxfordshire und 24 in South Yorkshire zufallsgesteuert und in etwa gleich stark auf eine von drei Interventions- oder Placebogruppen aufgeteilt. Die Patienten waren älter als 24 Jahre und hatten einen HbA1c-Wert (ein Messwert, der zuverlässig den Blutzuckerspiegel über einen längeren Zeitraum anzeigt oder das "Blutzuckergedächtnis") von 6,2 % und höher, der bislang nicht mit Insulin behandelt wurde.
Die erste Gruppe (n=152) der Patienten erhielt die Standardbehandlung, d.h. alle 3 Monate eine HbA1c-Bestimmung durch einen Arzt, die zweite Gruppe (n=150) bestimmten ihren Butzuckerwert selber und erhielten ein Patiententraining, das allerdings bei der Frage der Ergebnisinterpretation auf den Arzt fokussierte und die dritte Gruppe (n=151) maß ihren Blutzuckerwert ebenfalls selber und lernte außerdem, die Werte selber zu interpretieren und einzusetzen, um ihre Motivation und Stabilisierung eines gesunden Lebensstils zu erhöhen.
Nach 12 Monaten Dauer der unterschiedlichen Behandlungs- bzw. Überwachungskonzepte wurde der Zustand der Patienten umfassend überprüft. Dies umfasste u.a. eine Messung des Blutdrucks, der Fettstoffe, der möglicherweise durchlebten Unterzuckerungen, der Lebensqualität im Allgemeinen mittels des EuroQol 5, des gesundheitlichen Wohlbefindens, der gesundheitsbezogenen Lebensweisen (z.B. Ernährung und Bewegung), der Inanspruchnahme von gesundheitlicher Versorgung ebenso wie die Erhebung der Überzeugungen zur Selbstmessung des Blutzuckers. Das Ganze wurde schließlich mit einer Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Methoden abgerundet.
Die Ergebnisse sahen u.a. so aus:
• Die HbA1c-Werte in den drei Patientengruppen (die Werte waren bezüglich der unterschiedlichen Ausgangswerte adjustiert) unterschieden sich nicht statistisch signifikant.
• Die nichtadjustierte durchschnittliche Veränderung des HbA1c-Wertes zwischen den TeilnehmerInnen in der standardmäßig behandelten (Kontroll-)Gruppe und jenen in der gemäßigten Selbstmessgruppe betrug -0,14% und gegenüber der intensiven Selbstmessgruppe -0,17%. Beide Werte waren statistisch nicht signifikant.
• Auch wenn man die Gruppen in Subgruppen aufteilte, die sich nach der Dauer der Diabeteserkrankung, der bisherigen Therapie oder der bisherigen diabetesassoziierten Komplikationen unterschieden, gab es keine Evidenz für einen signifikanten Unterschied der Wirkung des Selbsttestens.
• Die ökonomische Analyse bestätigte lediglich, dass zusätzliche Ausgaben entstünden und ein Routineeinsatz von Selbstmonitoring unwahrscheinlich kosteneffektiv wäre.
• Bei einer Reihe von Patienten wirkte sich das Selbstmessen negativ auf die Lebensqualität aus.
• Eine Reihe anderer Patienten gaben in Intensivinterviews aber an, die Selbstmessung sei für sie hilfreich gewesen, ernsthafte Folgen ihrer Diabeteserkrankung zu verhindern und ihr Verhalten anzupassen.
• Sollte der HbA1c-Wert ständig über 8% liegen, könnte die regelmäßige Selbstmessung geeignet sein, einen ständigen Druck auf diese PatientInnen auszuüben, sich an Behandlungsempfehlungen zu halten und möglicherweise auch eine Insulinbehandlung zu bevorzugen.
• Umgekehrt war aber trotz Qualifizierung anderen TeilnehmerInnen der Zusammenhang zwischen den Tests und ihrem Verhalten am Ende des Versuchs nicht klar.
Auch wenn die Studie nicht ausschloss, dass die Selbstmessung des Blutzuckerwerts mit oder ohne Qualifizierung für bestimmte PatientInnen Vorteile bietet, lautet die Schlussfolgerung und Empfehlung der ForscherInnen, dass "there was no convincing evidence to support a recommendation for routine self-monitoring of all patients and no evidence of improved glycaemic control in predefined subgroups of patients."
Den 88-seitigen HTA-Bericht "Blood glucose self-monitoring in type 2 diabetes: a randomised controlled trial" von Farmer A, Wade A, French D et al. (Health Technol Assess. 2009 Feb;13(15): 1-72 kann man umsonst als PDF-Datei herunterladen.
Bernard Braun, 13.4.09
Offenlegung ärztlicher Interessenkonflikte fördert Vertrauen der Patienten
 Die Offenlegung ärztlicher Interessenkonflikte würde das Vertrauen der Patienten in ihre Ärzte und in die Behandlungsentscheidungen stärken. Viele Patienten befürchten, dass Interessenkonflikte sich ungünstig auf ärztliche Entscheidungen auswirken.
Die Offenlegung ärztlicher Interessenkonflikte würde das Vertrauen der Patienten in ihre Ärzte und in die Behandlungsentscheidungen stärken. Viele Patienten befürchten, dass Interessenkonflikte sich ungünstig auf ärztliche Entscheidungen auswirken.
Dies sind Ergebnisse einer Studie, die im Medical Journal of Australia erschienen ist. 906 Patienten aus drei Allgemeinmedizin-Praxen in Sydney sind im Jahr 2007 über ihr Wissen und ihre Einstellung zu Interessenkonflikte ihrer Ärzte befragt worden.
Die meisten der Befragten (76%) gaben an, keine Informationen über mögliche Interessenkonflikte ihrer Ärzte zu haben.
Die Mehrheit würde aber gerne wissen ob ihr Arzt von der Industrie Geld oder andere Zuwendungen und Unterstützung erhält (76%), insbesondere für die Teilnahme an Forschung (69%) und für den Besuch von wissenschaftlichen Tagungen (61%).
Auch würden die Patienten gerne wissen, ob dem Arzt materielle Vorteile entstehen aus
•der Durchführung einer Behandlung (80%)
•der Durchführung einer Untersuchung (77%)
•einer Überweisung 77%
•der Verschreibung eines Medikamentes.
Fast allen Befragten (98%) erscheint es wichtig, dass der Arzt sich in seinen Entscheidung ausschließlich von den Interessen des Patienten leiten lässt.
Viele Patienten befürchten jedoch, dass die Zuwendungen der Industrie diesbezüglich ein Problem darstellen. Die Frage, ob ihrer Meinung nach ihre Ärzte durch die Zuwendungen der Industrie unangemessen beeinflusst würden, beantworteten 49% mit ja, 27% mit nein, 24% waren sich nicht schlüssig.
Die meisten Befragten (78%) meinen, dass sie eine bessere informierte Entscheidung treffen können, wenn sie über die Interessenkonflikte ihres Arztes informiert sind.
Bevorzugt wird die Informationen direkt durch den Arzt im Arzt-Patient-Gespräch (78%), schriftliche Informationen wünschen sich 62%.
Die Offenlegung der Interessenkonflikte stärkt das Vertrauen der meisten Patienten - 80% geben an, dass sie bei Offenlegung den Entscheidungen des Arztes mehr vertrauen würden, 7% verneinten dies, 13% waren unentschieden.
Die Studie zeigt, dass viele Patienten mögliche Interessenkonflikte ihrer Ärzte als Problem erkannt haben. Auch wenn etwa die Hälfte der Patienten meint, die Ärzte würden nicht unangemessen beeinflusst, ist jeder 4. Befragte anderer Meinung. Interessant ist, dass nicht nur die Mehrzahl aller Befragten eine vollständige Offenlegung wünscht sondern auch 77% derjenigen, die keine unangemessene Beeinflussung ihrer Ärzte befürchten. Die Offenlegung würde zu besseren Behandlungsentscheidungen und zu höherem Vertrauen führen.
In Deutschland wird die Mitteilung von ärztlicher Interessenkonflikte außerhalb des Wissenschaftsbereiches bislang kaum diskutiert. In Australien und in den USA wird die Transparenz in Zukunft vom Staat gefordert werden. In beiden Ländern werden Gesetzte vorbereitet, mit denen die Industrie zur Veröffentlichung aller Zahlungen an Ärzte verpflichtet wird.
Die Firma Pfizer hat für ihren US-amerikanischen Bereich die Zeichen der Zeit erkannt und angekündigt, ab 2010 alle ab 1. Juli 2009 erfolgenden Zahlungen an amerikanische Ärzte öffentlich zu machen. Einbezogen sind alle praktizierende Ärzte sowie alle Forscher und Einrichtungen, die Studien durchführen.
Australische Studie (Abstract): Tattersall MHN, Dimoska A, Gan K. Patients expect transparency in doctors' relationships with the pharmaceutical industry. Medical Journal of Australia 2009;190:65-68 (19. Januar).
Pressemitteilung Pfizer 9. Februar 2009. Pfizer to Publicly Disclose Payments to U.S. Physicians, Healthcare Professionals and Clinical Investigators.
David Klemperer, 12.2.09
Gute Vorbereitung auf die Krankenhausentlassung (Entlassplan, Arztinfo) bringt spürbaren gesundheitlichen und finanziellen Nutzen.
 Viele der aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten sind noch nicht wieder voll genesen und brauchen sowohl akutmedizinische Behandlung als auch oft eine Reihe nichtmedizinischer oder -ärztlicher sozialer Unterstützungsangebote, um ihre vorherige Lebensqualität wieder erreichen zu können.
Viele der aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten sind noch nicht wieder voll genesen und brauchen sowohl akutmedizinische Behandlung als auch oft eine Reihe nichtmedizinischer oder -ärztlicher sozialer Unterstützungsangebote, um ihre vorherige Lebensqualität wieder erreichen zu können.
Angesichts der zusätzlich in den letzten Jahren auch in Deutschland spürbar verkürzten Liegezeiten im Krankenhaus entscheidet eine gute Vorbereitung des Patienten auf die Zeit danach und die Vorbereitung eines möglichst nahtlosen und zügigen poststationären Behandlungs- und Unterstützungsprozesses wesentlich über die Heilung der Patienten, d.h. die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der stationären Behandlung mit.
Der entlasspunktnahe Fluss von Informationen über die Diagnosen, den Behandlungsverlauf, die wichtigsten Behandlungsinhalte (z. B. Arzneimittelverordnungen) und die Prognose der entlassenen Patienten zu ihren ambulanten Versorgungsexperten wird daher seit langem zu den wichtigsten Entlassleistungen des Krankenhauses gerechnet. Als Instrumente dienen der "gute alte" Arztbrief und mündliche Informationen für die ambulante Versorge.
So plausibel und nahezu selbstverständlich all dies erscheint (ein Kommentar der hier gleich vorgestellten Studie bringt dies auf den Punkt: "Nevertheless, the results of this study confirm what those working in hospital medicine already know: It's high time we reconfigure the discharge process.") so verwunderlicher ist das in einer aktuellen Studie ("Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System [WAMP]")des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen und des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) erkannte weit verbreitete Fehlen oder das schlechte Funktionieren des Entlassungs- oder Überleitungsmanagements in Krankenhäusern und die in Befragungen von Krankenhausärzten sogar in den letzten Jahren schlechter werdende Kooperation der Krankenhaus- mit Haus- und Fachärzten.
Sollte dieser Zustand damit begründet werden, man wisse überhaupt nicht, ob der vermutete Nutzen einer guten Kommunikation von stationär und ambulant tätigen Ärzten wirklich etwas für die Gesundheit oder gar den Geldbeutel der Versicherten bringe, zeigten die gerade veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten Studie des weiteren Behandlungsverlaufes von Krankenhauspatienten eines Allgemeinkrankenhauses eines städtischen Ballungsgebiets (Boston Medical Center) nach dem Klinikaufenthalt das Gegenteil.
Dazu verteilten die ForscherInnen eine Gruppe von 749 PatientInnen zufällig in eine Gruppe, welche das gewöhnliche, also schmalspurige und nicht unbedingt auf nahtloses Geschehen orientierte Entlassprogramm erhielten und eine Gruppe mit einem aufwändigen und neu konzipierten Entlassungsprogramm. Die neuartige Entlassleistung bestand aus einem Bündel neuer Akteure und Aktivitäten.
Dazu gehörten spezielle Entlass-Krankenschwestern bzw. -beauftragte ("nurse discharge advocates"), die früh damit beginnen, einen individuellen Entlassungsbericht zusammenzustellen, umfangreiche Kontaktinformationen der ambulanten Behandlungshelfer, Terminvereinbarungen mit diesen, die Ergebnisse der bisherigen klinischen Tests, Einnahmepläne für verordnete Medikamente und weitere Informationen. Am Entlassungstag erhält der vorher bekannte oder organisierte Hausarzt des Patienten diesen Entlassbericht und eine Kurzzusammenfassung zur weiteren Behandlung per Fax zugeschickt. Die entlassenen Patienten werden außerdem innerhalb der nächsten vier Tage von einem klinischen Pharmakologen angerufen oder sogar besucht, der sich gezielt um die Alltagstauglichkeit und die mögliche Anpassung der Medikation kümmert.
Die von den ForscherInnen verblindet gemessenen Ergebnisse (sie wussten also nicht, in welcher Entlassenengruppe der analysierte Patient war) sahen so aus:
• Innerhalb der 30 Tage nach Entlassung hatten die PatientInnen in der Interventionsgruppe eine um ein Drittel geringere Häufigkeit von erneuten Krankenhausaufenthalten oder gar Notaufnahmeereignisse (0,314 Besuche gegenüber 0,451 Besuche pro Person und Monat). 90 Patienten in der Kontroll-/Standardgruppe gegenüber 61 in der Interventionsgruppe mussten eine Notfallstation aufsuchen. Wiedereinweisungen gab es bei 76 gegenüber 55 PatientInnen.
• Die Patienten der Interventionsgruppe wussten signifikant besser über ihre Entlassdiagnose Bescheid (70 % in der Kontroll- und 79 % in der Interventionsgruppe), kannten ebenfalls signifikant mehr und besser den Allgemeinmediziner, bei dem sie sich weiterbehandeln mussten (89 % zu 95 %) und berichteten auch häufiger, dass sie sich optimal auf ihre Entlassung vorbereitet gefühlt hatten (55 % gegenüber 65 %).
• Die Behandlungskosten waren in der Interventionsgruppe ebenfalls rund ein Drittel niedriger als in der Kontrollgruppe. Pro Kopf der Angehörigen der Interventionsgruppe waren dies 412 US-$.
Die von der Forschergruppe selbst benannte Schwäche dieser Studie, nämlich an einem einzigen großstädtischen Krankenhaus durchgeführt worden zu sein, schmälert nichts an dem Nachweis der Machbarkeit eines solchen Managements. Wer an der Übertragbarkeit in andere Regionen der USA, auf an speziellen Krankheit erkrankten Personen und natürlich nach Deutschland zweifelt, sollte es daher auf einen gar nicht so aufwändigen neuen Versuch ankommen lassen und u. U. dabei auch weitere Instrumente entwickeln und einführen.
Von dem Aufsatz "A Reengineered Hospital Discharge Program to Decrease Rehospitalization A Randomized Trial" von Brian W. Jack et al., der am 3. Februar 2009 in der US-Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (Volume 150, Issue 3: 178-187) erschienen ist, gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 3.2.09
GVG- und Kasseler Konzept: Zwei weitere Gutachten zur Situation und Perspektive der sozialen Selbstverwaltung aus dem Jahr 2008
 2008 war von Anzahl und Inhalt her eines der seltenen Jahre, in denen die soziale Selbstverwaltung in den deutschen Sozialversicherungsträgern und besonders in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) besondere wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit erfuhr. Dazu trugen auch die beiden Gutachten bei, auf die hier hingewiesen werden soll.
2008 war von Anzahl und Inhalt her eines der seltenen Jahre, in denen die soziale Selbstverwaltung in den deutschen Sozialversicherungsträgern und besonders in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) besondere wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit erfuhr. Dazu trugen auch die beiden Gutachten bei, auf die hier hingewiesen werden soll.
Vorgestellt wurde hier bereits ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) an Bremer, Hallenser und Neubrandenburger WissenschaftlerInnen in Auftrag gegebenes Gutachten zur "Geschichte und Modernisierung der Sozialwahlen", das mittlerweile in einer gestrafften Version als Buch im Nomos-Verlag, Baden-Baden erschienen ist.
Auf dieses Gutachten beziehen sich das durch die Hans Böckler Stiftung geförderte Gutachten des Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder und das im Kontext der "Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG)" - einer seit 1947 bestehenden Organisation, die vorrangig von den gesetzlichen Sozialversicherungen, den Sozialpartnern und einer Reihe von Individualmitgliedern getragen wird - erstellte Memorandum ex- und implizit sowie kontrovers.
Das in einer Arbeitsgruppe unter Leitung des Bremer Ökonomen Winfried Schmähl erarbeitete GVG-Memorandum verzichtete auf eigene Analysen und stellt überwiegend ein politisches Plädoyer für die Selbstverwaltung dar.
Das Schroeder-Gutachten stützt sich auf die empirischen Ergebnisse von vorausgegangenen Projekten und verzichtet ebenfalls weitgehend auf eigene empirische Erhebungen.
Kritisch liegt auch diesen beiden Gutachten die Feststellung zugrunde: "Den Status quo der sozialen Selbstverwaltung zu verteidigen erscheint angesichts der vielfältigen Veränderungen und Kritiken keine tragfähige Strategie" (Schroeder).
Trotz der Kritik an der aktuellen Funktionsfähigkeit, heben beide Gutachter die prinzipielle Bedeutung und Notwendigkeit der Selbstverwaltung und deren potenzielle Leistungsfähigkeit auch im 21. Jahrhundert hervor:
"In der Selbstverwaltung leisten die gesellschaftlichen Akteure durch ihr persönliches sozialpolitisches Engagement selbst einen Beitrag zur sozialen Sicherheit und sozialen Teilhabe. Das Engagement der Selbstverwaltung ist damit im Grundsatz Teil der selbstverantwortlichen, demokratischen Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der Verwaltung des sozialen Rechtsstaats und Kernbestandteil des bundesdeutschen Sozialstaatsmodells" (GVG:15). Und weiter: "Dieser Delegation von Aufgaben liegt die berechtigte Einschätzung zugrunde, dass die Selbstverwaltung sachgerechtere Entscheidungen treffen kann, weil sie näher an den konkreten Sachfragen und Bedürfnissen der Menschen ist. Zugleich hat dieses Selbstverwaltungsmodell somit in erheblichem Maße eine staatsentlastende Funktion" (GVG 2007: 16). Und schließlich: Die Selbstverwaltung ist "Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements", das es "zielorientiert auszuschöpfen und zu stärken (gilt)" (GVG: 41).
Auch das Kasseler Gutachten betont die Wichtigkeit der verschiedenen Funktionen der sozialen Selbstverwaltung: Einerseits ist "die in der Selbstverwaltung praktizierte Partizipation der Beitragszahler ... eine Form gelebter Demokratie". Andererseits ermöglicht die ausgesprochene Nähe der sozialen Selbstverwaltung zu den Versicherten einen bedarfsbezogenen Anschluss an die Lebenswelt der Betroffenen, wodurch eine effektive und sachgerechte Gesundheitsversorgung gesichert werden soll (Schroeder).
Die Einigkeit aller ExpertInnen hört aber schnell bei den konkreten Reformvorschlägen auf, die insbesondere von den BMAS-Gutachtern pointiert radikal vorgetragen wurden. Dies gilt insbesondere für die Vorstellungen die soziale Basis der Selbstverwaltung in Richtung einer Orientierung auf Betroffene statt Beitragszahler sowie auf die Arbeits- und Lebenswelt zu erweitern und die Forderung nach einer verpflichtenden kompetitiven Wahl der Mitglieder von Selbstverwaltungsorganen.
Der Vorschlag, den Kreis der potenziellen SV-Akteure vor allem in der GKV in Richtung Betroffenenvertreter zu erweitern, wird sowohl im Kasseler Konzept als auch in der Studie der GVG abgelehnt. Schroeder sieht dadurch "den Charakter der sozialen Selbstverwaltung grundlegend" (58) verändert und fügt gegen eine Repräsentation von Patienteninteressen argumentierend an: "Zudem ist zu bedenken, dass jede einzelne Interessengruppe der Patienten an einer optimalen Nutzenorientierung für ihre Gruppe orientiert ist. Sollten diese Gruppen einen stärkeren Einfluss innerhalb der Kassen gewinnen, würde es zukünftig noch weitaus schwieriger werden, die Interessen der verschiedenen Gruppen auszubalancieren" (58).
Obwohl auch die GVG-Studie und das Kasseler Konzept die Praxis der "Friedens"wahlen in Teilen als problematisch bewerten, versuchen sie letztlich, diese zu rechtfertigen und vor Veränderung zu bewahren.
Trotz des Ziels "Selbstverwaltung als Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements … auszuschöpfen und zu stärken" (GVG: 41) ringt sich die GVG nur dazu durch, dass "Urwahlen da umgesetzt werden (sollen), wo immer sie möglich und sinnvoll sind" (GVG: 47). Es gibt leider keinen expliziten Hinweis, was eine "sinnvolle" Nichtwahl ist und wer dies feststellt.
Das Kasseler Konzept stellt seinen Reform-Vorschlag für die Sozialwahlen in einen Spannungsbogen zwischen einem "emphatischen Demokratieverständnis" (Schroeder: 80) und einer "realistischen Demokratietheorie" (ebd. 45). So müsse man beispielsweise "diskutieren, ob nicht manche der Ansprüche hinsichtlich Beteiligung und Transparenz die Leistungsfähigkeit moderner, demokratischer Staaten überfordern" (45). "Urwahlen könnten die Sozialpartner jedoch personell und materiell überfordern. … und … Mehrheitsverhältnisse (könnten) unübersichtlicher, die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse schwieriger werden" (81).
In drei im Mittelpunkt seines Gutachtens stehenden Szenarien zur Zukunft der sozialen Selbstverwaltung baut Schroeder diese Position systematisch aus:
• Sein erstes Szenario befasst sich mit dem Bruch mit der bekannten Form der Selbstverwaltung in Richtung Verstaatlichung oder Privatisierung dessen was Selbstverwaltung ausmacht, das Schroeder wie alle aktuellen Gutachter eindeutig verwirft.
• Sein zweites Szenario beschäftigt sich mit der "einseitigen Stärkung der demokratischen Beteiligung und Legitimation", also der Forderung nach einer verpflichtenden Sozialwahl, die eine, aber keineswegs die einzige oder einseitige Forderung der BMAS-Gutachter ist.
• Seine eigene Position enthält das Szenario III, das er mit Revitalisierung der bestehenden Selbstverwaltungspolitik überschreibt. In einem 4-Punkte-Programm finden sich dann die folgenden "Vorschläge zur Revitalisierung der sozialen Selbstverwaltung aus Gewerkschaftsperspektive": Kompetenz- und Professionalisierungsoffensive, Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit und Versichertennähe, verstärkte informelle Integration von Betroffeneninteressen und Revitalisierung der Sozialwahl.
Die hier in selbstverpflichtendem Gestus als Alternative zu den BMAS-Gutachtensvorschlägen vorgestellten Vorschläge sind lesenswert und ihnen ist in vielerlei Hinsicht zuzustimmen. Das letztlich umschiffte Problem der meisten dieser Vorschläge und ihres Verbindlichkeitsgrads ist, dass sie bereits seit Jahren propagiert werden und ihre fortgesetzte Nichtumsetzung auch zum kritikwürdigen Status quo der Selbstverwaltung gehört.
Für die Diskussion der Gründe und Ursachen liefern aber auch die Kasseler- und GVG-Studien eine Fülle systematischer und empirischer Hinweise und Anhaltspunkte. Auch wenn es Anzeichen gibt, dass sich an den politischen Rahmenbedingungen der Sozialwahlen (die nächste Wahl findet im Jahr 2011 statt) und den Selbstverständnissen der wichtigsten aktuellen Akteure der Selbstverwaltung in keine der vorgestellten Richtungen etwas ändern wird, kann dies zumindest nicht mehr mit einem Mangel an Kenntnissen und Erkenntnissen gerechtfertigt werden.
Das 105 Seiten umfassende Gutachten "Zur Reform der sozialen Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung - Kasseler Konzept" von Wolfgang Schroeder ist kostenlos als PDF-Datei aber auch für 12 € als Buch erhältlich.
Eine pointierte vierseitige Zusammenfassung der Positionen dieses Gutachtens ist unter dem Titel Soziale Selbstverwaltung und Sozialwahlen. Traditionsreiche Institutionen auch von morgen? von Wolfgang Schroeder und Benjamin Erik Burau in der Reihe "Analysen und Konzepte zur Sozial- und Wirtschaftspolitik der Friedrich Ebert Stiftung direkt" im November 2008 erschienen und kostenlos erhältlich.
Die 110 Seiten des von der GVG bereits 2007 herausgegebenen Memorandums "Zur Bedeutung der Selbstverwaltung in der deutschen Sozialen Sicherung. Formen, Aufgaben, Entwicklungsperspektiven" ist komplett nur als kostenpflichtiges Buch (nanos Verlag, Bonn) erhältlich. Lediglich eine Leseprobe von 11 Seiten steht kostenlos zur Verfügung.
Bernard Braun, 6.1.09
Schwedische Studie zeigt: Bürger befürworten bei Schwerstkranken mehr Hochleistungsmedizin als Ärzte
 Welche medizinischen Eingriffe sollten bei einem schwerstkranken älteren Patienten noch unternommen werden? Sollten Operationen auch dann noch durchgeführt werden, wenn sie vielleicht lebensrettend, aber mit sehr großen Risiken verbunden sind? Dieser Frage nach ethischen Standards für medizinische Interventionen ist eine schwedische Forschungsgruppe nachgegangen und hat dazu Bürger wie auch Ärzte anhand eines fiktiven Beispiels befragt. Dabei zeigte sich, dass Bürger in sehr viel stärkerem Maße als Ärzte ein medizinisches Eingreifen auch dann noch befürworteten, wenn das Ergebnis ungewiss und das Risiko hoch ist.
Welche medizinischen Eingriffe sollten bei einem schwerstkranken älteren Patienten noch unternommen werden? Sollten Operationen auch dann noch durchgeführt werden, wenn sie vielleicht lebensrettend, aber mit sehr großen Risiken verbunden sind? Dieser Frage nach ethischen Standards für medizinische Interventionen ist eine schwedische Forschungsgruppe nachgegangen und hat dazu Bürger wie auch Ärzte anhand eines fiktiven Beispiels befragt. Dabei zeigte sich, dass Bürger in sehr viel stärkerem Maße als Ärzte ein medizinisches Eingreifen auch dann noch befürworteten, wenn das Ergebnis ungewiss und das Risiko hoch ist.
In einer schriftlichen Befragung konfrontierten die Wissenschaftler knapp 1000 zufällig ausgewählte schwedische Bürger und knapp 400 Ärzte mit einem fiktiven Fallbeispiel und fragten sie, wie man ihrer Meinung nach jeweils medizinisch vorgehen solle. Das vorgestellte Fallbeispiel beschrieb drei Situationen:
• (1) Eine 72jährige wird im Koma in die Notaufnahme einer Klinik eingeliefert, man vermutet einen Schlaganfall und eine Gehirnblutung. Eine Computertomografie zeigt tatsächlich eine große Blutung im linken Zentralbereich des Gehirns. Eine Operation ist in diesem Hirnbereich überaus schwierig und riskant. Ohne chirurgischen Eingriff wird sich der Hirndruck andererseits jedoch so stark erhöhen, dass der Patient mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Tage sterben wird. Die Frage ist: Soll man operieren?
• (2) Es wird der Fall unterstellt, die Operation sei durchgeführt worden. Dabei zeigt sich auch nach 10 Tagen immer noch, dass die Patientin ohne Bewusstsein ist und künstlich beatmet werden muss. Eine neue CT-Aufnahme zeigt dann eine Vielzahl von Krebs-Metastasen im Gehirn, die über kurz oder lang lebensbedrohlich sind. Die Frage ist jetzt: Soll die künstliche Beatmung trotzdem fortgesetzt werden?
• (3) In der dritten Frage wird dann folgende Situation geschildert: Die Ärzte beenden die künstliche Beatmung und informieren die Angehörigen. Die Patientin atmet überraschenderweise danach auch ohne Hilfe, jedoch sehr gepresst und hat offensichtlich sehr starke Schmerzen. Die Ärzte überlegen, ob sie Medikamente wie Morphium und Beruhigungsmittel gegen die Schmerzen verabreichen sollen - was jedoch das Risiko erhöht, dass dadurch die Atmung lebensbedrohlich beeinträchtigt wird. Dritte Frage: Soll die Patientin Morphium und Tranquilizer erhalten?
Zu den drei Fragen wurden dann jeweils mehrere Statements vorgegeben, wie man vorgehen sollte und warum diese Entscheidung gerechtfertigt sei. Dabei wurde deutlich, dass Ärzte sehr viel häufiger als Laien auf weitere medizinische Eingriffe verzichten würden. Bürger haben sehr viel weiterreichende Erwartungen an das, was Medizin auch in Extremsituationen noch unternehmen sollte. Beispiel für eins der hierzu gestellten vielen Statements war: "Es sollte operiert werden, um Euthanasie-Verdächtigungen zu vermeiden" - Stimmen Sie völlig zu, eher zu, eher nicht zu, überhaupt nicht zu?"
Es zeigten sich folgende Unterschiede: Zu Frage (1) antworten 78% der Bevölkerung, aber nur 13% der Ärzte, es solle operiert werden, weil es allererste Aufgabe der Medizin sei, Leben zu retten. Umgekehrt meinten 83% der Ärzte, man solle auf die Operation verzichten, weil die Lebensqualität des Patienten erheblich sinken würde, nur 41% der befragten Bürger war dieser Meinung. Eine Fortsetzung der künstlichen Beatmung unter Hinweis auf mögliche Euthanasie-Verdächte wird von 28% der Bevölkerung, aber nur 6% der Ärzte bejaht.
In einigen Aspekten zeigten sich allerdings auch Übereinstimmungen, so befürworteten über 95% der Ärzte wie Laien eine Morphium- und Tranquilizer-Behandlung trotz der damit verbundenen Risiken. Und über 80% in beiden Gruppen waren auch gegen eine Fortsetzung der künstlichen Beatmung nach Diagnose der Metastasen (Frage 2).
Die Studie erfasst zwar nicht das reale Verhalten von Ärzten in der Notfall- und Intensivmedizin. Sie zeigt allerdings, dass die in der Bevölkerung weit verbreitete Annahme, Mediziner würden in vielen Fällen "todkranke Patienten künstlich am Leben erhalten", auch gegen den Willen von Angehörigen, so nicht zutrifft. Die Wissenschaftler reißen auch kurz die Frage an, ob sich aus diesen unterschiedlichen Erwartungen mögliche Konfliktlinien abzeichnen, zwischen Patienten (und Angehörigen), Ärzten und Krankenversicherungen als Financiers kostspieliger medizinischer Interventionen. Auf diese Frage geben sie allerdings keine Antwort.
• Die Studie ist hier im Volltext (PDF) nachzulesen: Anders Rydvall, Niels Lynoe: Withholding and withdrawing life-sustaining treatment: a comparative study of the ethical reasoning of physicians and the general public (Critical Care 2008, 12:R13doi:10.1186/cc6786)
• Hier ist ein Abstract
Gerd Marstedt, 16.2.2008
"Milupa oder Hängebrust" - Qual der Wahl oder unbegründeter Mythos für junge Mütter?
 Im Gesundheitswesen gibt es nicht selten scheinbar gesicherte und hochplausible Gewissheiten, welche die mit ihnen konfrontierten Personen vor die Wahl zwischen Scylla und Charybdis stellen. In unserem konkreten Fall sind es junge Mütter, die sich scheinbar unentrinnbar zwischen den körperlichen und seelischen Vorteilen des Stillens ihrer neugeborenen Kinder und der ihr künftiges körperliches und seelisches Wohlbefinden möglicherweise beeinträchtigenden Absenkung oder Ptosis ihrer Brüste (vulgo: "Hängebusen") entscheiden müssen.
Im Gesundheitswesen gibt es nicht selten scheinbar gesicherte und hochplausible Gewissheiten, welche die mit ihnen konfrontierten Personen vor die Wahl zwischen Scylla und Charybdis stellen. In unserem konkreten Fall sind es junge Mütter, die sich scheinbar unentrinnbar zwischen den körperlichen und seelischen Vorteilen des Stillens ihrer neugeborenen Kinder und der ihr künftiges körperliches und seelisches Wohlbefinden möglicherweise beeinträchtigenden Absenkung oder Ptosis ihrer Brüste (vulgo: "Hängebusen") entscheiden müssen.
Dass es sich dabei eventuell um eine Pseudo-Alternative handelt, der eine der vielen Mythen im Gesundheitsberich zugrundeliegt, zeigt eine kleine Studie des an der Universität von Kentucky praktizierenden plastischen Chirurgen Brian Rinker, die er auf der Anfang November 2007 in Baltimore stattfindenden Jahrestagung der "American Society of Plastic Surgeons" vorgestellt hat.
Rinker hatte in Gesprächen mit Frauen, die ihn wegen eines Brustliftíngs oder anderen plastischen Operationen an ihren Brüsten aufsuchten, immer wieder erklärt bekommen, der Zustand ihrer Brüste hinge mit dem Stillen ihrer Kinder zusammen.
Ob dies wirklich und zwingend der Fall war, wollte er schließlich genauer wissen. Dazu befragten er und einige seiner Kollegen zwischen 1998 und 2006 132 durchschnittlich 39 Jahre alten Frauen/Patientinnen zu der Anzahl ihrer Schwangerschaften (93% waren mindestens einmal schwanger gewesen) und der Häufigkeit des Stillens (58% hatten mindestens eines ihrer Kinder gestillt). Zusätzlich erhoben sie die medizinische Vorgeschichte der Frauen, ihren Body Mass Index, die Brustgröße vor der Schwangerschaft und ihr Rauchverhalten.
Das Ergebnis ist eindeutig: Es gab keinen statistisch signifikanten Unterschied der Brustabsenkung zwischen Frauen, die stillten und solchen die dies nicht gemacht hatten.
Als Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Brustabsenkung förderten, identifizierten die Forscher dafür vor allem das Rauchen (das Rauchen zerstört ein Protein - Elastin -, das insbesondere in der Jugend einen großen Einfluss auf die Elastizität der Haut hat), das Alter der Frauen und die Anzahl der Schwangerschaften.
Auch wenn es sich hier sicherlich nicht um eine repräsentative oder gar randomisierte kontrollierte Studie handelt, gibt sie wichtige Hinweise auf die Notwendigkeit, den Nutzen und die Machbarkeit systematischen Zweifels gegenüber scheinbar plausiblen Gewissheiten, der auch vor vielen anderen vergleichbaren Annahmen etc. nicht Halt machen sollte. Sie entlastet auch nachgewiesenermaßen gesundheitsfördernde Aktivitäten wie das Stillen vom Hemmnis oder Dilemma, sich möglicherweise selber Ungutes anzutun.
Eine Zusammenfassung des Vortrags zum Zusammenhang von Stillen und Brustabsenkungen findet sich auf der Homepage der "University of Kentucky".
Bernard Braun, 11.11.2007
Patientenzentrierte Versorgung im NHS-Großbritannien: "more rhetoric than reality"!?
 Trotz des auch in Großbritannien hoch entwickelten Politiker-Talk vom "Kunden Patient", der im Zentrum der gesundheitlichen Versorgung steht, zweifeln Forscher, die in Großbritannien gerade Patienten und Gesundheitspersonal zur Nutzung von Beschwerdemöglichkeiten und die praktische Nutzung der Ergebnisse befragt haben, erheblich am Hochglanzbild.
Trotz des auch in Großbritannien hoch entwickelten Politiker-Talk vom "Kunden Patient", der im Zentrum der gesundheitlichen Versorgung steht, zweifeln Forscher, die in Großbritannien gerade Patienten und Gesundheitspersonal zur Nutzung von Beschwerdemöglichkeiten und die praktische Nutzung der Ergebnisse befragt haben, erheblich am Hochglanzbild.
Die britische Konsumentenorganisation "Which?", eine im weitesten Sinn mit der "Stiftung Warentest" vergleichbare Organisation mit rund 650.000 Mitgliedern, befragte hierzu 1.000 Patienten des "National Health Service (NHS)" und kam zu folgenden Ergebnissen:
• 49 % der Patienten waren mit irgendeinem Aspekt ihres Krankenhausaufenthalts unzufrieden oder unglücklich: vom Essen über die Sauberkeit bis zur Versorgungsorganisation.
• Nur weniger als die Hälfte dieser Patienten beschwerte sich aber trotz der Existenz von Beschwerdesystemen nicht direkt über diese Zustände. Sie begründeten dies entweder damit, dass sie Nachteile bei ihrer Behandlung bis hin zu Schäden befürchten (10 %) oder sogar mehrheitlich davon ausgehen, dadurch ändere sich ja sowieso praktisch nichts.
• Nebenbei kam bei der Befragung heraus, dass Patienten keineswegs durchgängig zu ihren Wahrnehmungen gehört werden: Nur 17 % der Patienten wurden tatsächlich nach ihrer Sicht und Bewertung der Behandlung gefragt.
• In seltsam gegensätzlicher Weise sehen die Ergebnisse eines anderen, aber inhaltlich ähnlich fokussierten Survey aus, in dem 250 Krankenhausbeschäftigte im NHS nach ihrer Beurteilung von Patientensichtweisen gefragt wurden: 99 % gaben an, sie würden gerne mehr über die Belange ihrer Patienten in Erfahrung bringen und die meisten der Befragten meinten, dies würde zu Verbesserungen führen.
Eine auch außerhalb des NHS-Systems, also auch in Deutschland, wichtige Konsequenz aus derartigen Ergebnissen ist, überhaupt einmal schnell nutzbare, robuste, unabhängige und möglichst nicht direkt im Krankenhaus=Behandlungsalltag angesiedelte Beschwerdeforen zu schaffen. Diese müssten dann aber glaubwürdig den Eindruck erwecken, sie sammelten wirklich alle Beschwerden oder auch positive Wahrnehmungen der Patienten und bearbeiteten sie auch praktisch. Dass letzteres z. B. in deutschen Krankenhäusern funktioniert, muss aufgrund von Ergebnissen mehrfacher Ärzte- und Pflegekräftebefragungen zwischen 2003 und 2006 in deutschen Akutkrankenhäusern bezweifelt werden: Vielfach werden zwar Patientenbefragungen durchgeführt, ihre Ergebnisse spielen aber aus Sicht der Beschäftigten keine Rolle im Versorgungsalltag.
Einen kurzen Bericht über die "Which?"-Befragung findet sich in einer BBC-News-Meldung vom 5. Oktober 2007.
Bernard Braun, 12.10.2007
Geburt per Kaiserschnitt: Wie der Wandel gesellschaftlicher Normen auch die Wünsche Schwangerer beeinflusst
 Die Zahl der Kaiserschnitt-Geburten hat sich in vielen Ländern drastisch erhöht. In zehn Jahren stieg der Anteil dieser Entbindungen in deutschen Krankenhäusern von 17 auf 27 Prozent. Über die Ursachen dieser Entwicklung gab es viele Hypothesen. Da auch der Anteil der sogenannten Risiko-Schwangerschaften ähnliche Steigerungsraten zeigt (in deutschen Bundesländern heute bis zu 75% aller Geburten), verweisen Gynäkologen auf medizinische Hintergründe. Eine Studie im Auftrag der Gmünder ErsatzKasse GEK aus dem Jahre 2006 zeigte indes, dass nur bei zwei Prozent der Frauen ursprünglich von einem "Wunschkaiserschnitt" ausgegangen werden kann.
Die Zahl der Kaiserschnitt-Geburten hat sich in vielen Ländern drastisch erhöht. In zehn Jahren stieg der Anteil dieser Entbindungen in deutschen Krankenhäusern von 17 auf 27 Prozent. Über die Ursachen dieser Entwicklung gab es viele Hypothesen. Da auch der Anteil der sogenannten Risiko-Schwangerschaften ähnliche Steigerungsraten zeigt (in deutschen Bundesländern heute bis zu 75% aller Geburten), verweisen Gynäkologen auf medizinische Hintergründe. Eine Studie im Auftrag der Gmünder ErsatzKasse GEK aus dem Jahre 2006 zeigte indes, dass nur bei zwei Prozent der Frauen ursprünglich von einem "Wunschkaiserschnitt" ausgegangen werden kann.
Wie aber ist dann der sehr viel höhere Anteil dieser Geburtsart zu erklären, werden Frauen dazu im Verlauf der Geburtsvorbereitung und der körperlichen Untersuchungen gegen ihren ursprünglichen Willen überredet, werden ihnen medizinische Befunde entgegengebracht, gegen die nur schwer zu argumentieren ist? Sind also Mediziner demzufolge die eigentlichen Urheber, sei es aus Gründen der zeitlichen Organisation (immerhin fand eine Studie, dass es kaum noch "Sonntagskinder" gibt), sei es aus finanziellen Gründen (für einen Kaiserschnitt bekommt ein Krankenhaus etwa 3000 Euro vergütet, doppelt so viel wie für ein normale Geburt) ?
Eine australische Studie, die qualitative Interviews mit Gynäkologen, Hebammen und Frauen durchführte, die in den letzten zwei Jahren eine Kaiserschnitt-Geburt hatten, hat dazu jetzt einige interessante Befunde vorgelegt. Die Untersuchung nähert sich dem Problem von sozialwissenschaftlicher Seite. Es wird versucht, in den Denkmustern und Begründungen der Beteiligten (Mediziner, Hebammen, Frauen) allgemeinere gesellschaftliche Normen und Werte zu finden, die dann auch maßgeblich werden für die Frage: Wie möchte ich mein Kind zur Welt bringen?
In den Interviews werden verschiedene Argumentationsmuster deutlich, die nach Ansicht der Wissenschaftler auch Einiges verraten über den Wandel kultureller Normen.
• Die Betonung eines "autonomen Konsumenten" wird in fast allen Äußerungen deutlich. Frauen weisen darauf hin, dass sie die selbstverantwortlichen Entscheidungsträger sind, auch in der Frage, für welche Art der Geburt sie ihre Wahl treffen. Ärzte und Hebammen sind in diesem Zusammenhang medizinische Dienstleister, die Informationen übermitteln und auf medizinischer Ebene praktische Tätigkeiten verrichten. Alle Beteiligten verweisen auf das Grundrecht der Entscheidungsfreiheit. Erkannt wird in diesen Äußerungen von den Forschern ein Kernelement neoliberaler Ideologien, durch die hier Schwangere als autonome und in ihrer Entscheidung souveräne Konsumenten einer medizinischen Dienstleistung definiert werden.
• Die Unanzweifelbarkeit medizinischer Argumente wird ebenfalls in vielen Stellungnahmen deutlich. Unabhängig von der Frage, ob tatsächlich eine Risiko-Schwangerschaft (durch Steißlage des Kindes, Diabetes oder andere Erkrankungen der Mutter) vorliegt, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass medizinische Befunde nicht diskutiert werden können und ein ultimativer Grund sind, sich gegen eine Vaginalgeburt und für einen Kaiserschnitt zu entscheiden.
• Der Sicherheitsgedanke und die mit dem Kaiserschnitt verbundene Assoziation von Ordnung und Planbarkeit ist ein weiteres Element in den Äußerungen der Interviewpartner/innen. In einer überaus starken (und so unzutreffenden) Schwarz-Weiß-Malerei wird die Vaginalgeburt als gesundheitsriskant und problematisch wahrgenommen, während gleichzeitig der Kaiserschnitt als weitestgehend risiko- und beschwerdefrei dargestellt wird. Ebenso kommt dieses Vorgehen dem Wunsch (wiederum aller Beteiligten) nach Ordnung, Kontrolle und Planbarkeit nahe, während die Vaginalgeburt eher angstbesetzte Assoziationen von Chaos und unbeherrschten äußeren Mächten auslöst.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen:
Joanne Bryant u.a.: Caesarean birth: Consumption, safety, order, and good mothering (Social Science & Medicine, Volume 65, Issue 6, September 2007, Pages 1192-1201)
vgl. zum Thema "Kaiserschnitt" auch im Forum Gesundheitspolitik:
Immer weniger Sonntagskinder, immer mehr Wunsch-Kaiserschnitte
Kaiserschnitt-Geburt: Kein Wunsch von Frauen
Gerd Marstedt, 24.8.2007
"Are Medical Care-Givers Perfect Agents?" - Was die Gesundheitsökonomie zur Arzt-Patientenbeziehung annimmt und belegt!
 Die Beziehung von Patienten und Ärzten oder anderen Dienstleistern im Gesundheitsbericht wird von einer Reihe von Ökonomen (z. B. von Vertretern der Neuen Institutionenökonomik) mit dem Theorem des Verhältnisses von "Prinzipal und Agent" zu beschrieben und als prinzipiell unperfekt zu erklären versucht.
Die Beziehung von Patienten und Ärzten oder anderen Dienstleistern im Gesundheitsbericht wird von einer Reihe von Ökonomen (z. B. von Vertretern der Neuen Institutionenökonomik) mit dem Theorem des Verhältnisses von "Prinzipal und Agent" zu beschrieben und als prinzipiell unperfekt zu erklären versucht.
Wichtige Grundannahmen und Elemente dieser Theorie sind: "Im Modell gibt es einen Auftraggeber (Prinzipal), der einen Auftragnehmer (Agent) mit einer Aufgabe betraut. Jeder Vertragspartner handelt annahmegemäß im eigenen Interesse und sind begrenzt rationale Subjekte, die in ihrer Entscheidungsfindung eingeschränkt sind. Da die beiden aber unterschiedliche Ziele verfolgen können, kann das zu Konflikten führen....Die Prinzipal-Agent-Theorie geht von assymmetrischen Informationen aus. Daher ist die allerbeste Lösung, die im Falle symmetrischer Informationen theoretisch denkbar wäre, nicht gegeben. Geht man somit nun von asymmetrischen Informationen aus und werden nun die Informationsmängel nicht korrigiert, so kann nur eine drittbeste Lösung erreicht werden. Ziel muss es daher sein bei den gegebenen Informationsmängel dennoch wenigstens eine zweitbeste Lösung zu erzielen. Hierfür müssen jedoch Agenturkosten aufgebracht werden." (Wikipedia-Stichwort Prinzipal-Agent-Theorie)
Diese Bedingungen führen zu folgender Konstellation: "Der Prinzipal nutzt den Agenten, um eigene Ziele zu verfolgen. Er erwartet vom Agenten, dass sich dieser voll und ganz für die Auftragserfüllung einsetzt, also nicht seine eigenen Ziele, sondern die Ziele des Prinzipals verfolgt. Der Prinzipal kann jedoch das Engagement und/oder die Qualitäten seines Agenten nur mit Einschränkungen erkennen und sieht - wenn überhaupt - nur das Ergebnis von dessen Bemühungen. Demgegenüber hat der Agent einen Informationsvorsprung, da er sein eigenes Verhalten im Hinblick auf Erfolg besser beurteilen kann." (Wikipedia-Stichwort Prinzipal-Agent-Theorie)
Wieder etwas konkreter auf die Patient/Prinzipal-Arzt/Agent-Beziehung angewandt, war Vertretern dieses Ansatzes immer schon theoretisch klar, dass die Unvollständigkeit und die Probleme dieser Beziehung auch darauf beruhen, dass die Ärzte eine lückenhafte oder verzerrte Wahrnehmung der Patienteninteressen haben. Dies wurde aber bisher nicht oder noch nicht oft empirisch überprüft.
In einem Aufsatz, der in der Discussion-Paperreihe des Bonner Forschungsinstituts "Bonner "Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA)" (IZA DP No. 2727) im April 2007 veröffentlicht wurde, haben zwei israelische Ökonominnen Ergebnisse eine Studie vorgestellt, die die Prinzipal-Agent-Theorie in einer empirischen Studie in Israel empirisch untersuchte.
In ihrer Studie "Agency in Health-Care: Are Medical Care-Givers Perfect Agents?" untersuchten Einat Neuman und Shoshana Neuman mit einem so genannten Discrete Choice Experiment (DCE) die fundamentale Annahme des "Agentenmodells", dass Gesundheitsprofessionals verstehen, was ihre Patienten wollen. Dazu erhoben sie simultan in einer Gruppe von schwangeren Patientinnen authentische Erwartungen der Frauen für fünf Merkmale der Entbindungsstation (z. B. Anzahl der Betten, Informationsdichte) und kontrastierten dies mit den ebenfalls erfragten Vorstellungen, die sich die Ärzte und Pflegekräfte dieser Patientinnen über deren Präferenzen machten.
Das Ergebnis war klar und eindeutig: Alle Agenten (Ärzte und Krankenschwestern) hatten eine verzerrte Wahrnehmung davon, was für die Prinzipale/Patientinnen Vorrang hatte. Es gab also keine vollständige oder perfekte Agenten/Prinzipalsbeziehung.
Mit ihrem bewusst zurückhaltend klassifizierten Beitrag ("Our findings add a novel empirical contribution to the agency relationship literature.") wollen sie erstens zu weiterer Forschung über die Erwartungen von Patienten mit anderen Problemen anregen. Außerdem empfehlen sie, die Erbringer gesundheitlicher Leistungen, die sich dieser Diskrepanzen bewusst sind, besser über die Präferenzen der Patienten zu informieren und dadurch die Behandlung zu verbessern und die Zufriedenheit der Patienten zu erhöhen.
Den 14-seitigen Aufsatz "Agency in Health-Care: Are Medical Care-Givers Perfect Agents?" kann man hier als PDF-Datei kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 4.7.2007
Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Arbeitsqualität von Ärzten - Wichtige Zusammenhänge für Ärzte und Patienten
 Auch wenn die Autoren - sämtlich Mitarbeiter des privaten Berliner "Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES)" - dazu raten, "Ergebnisse der vorliegenden Übersicht in ihrer Übertragbarkeit auf Deutschland mit Vorsicht zu interpretieren", liefert ihre im Rahmen der Förderinitiative "Versorgungsforschung" der Bundesärztekammer entstandene Übersicht der internationalen Literatur über die "Arbeits- und Berufsunzufriedenheit von Ärzten einige beachtenswerte Ergebnisse.
Auch wenn die Autoren - sämtlich Mitarbeiter des privaten Berliner "Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES)" - dazu raten, "Ergebnisse der vorliegenden Übersicht in ihrer Übertragbarkeit auf Deutschland mit Vorsicht zu interpretieren", liefert ihre im Rahmen der Förderinitiative "Versorgungsforschung" der Bundesärztekammer entstandene Übersicht der internationalen Literatur über die "Arbeits- und Berufsunzufriedenheit von Ärzten einige beachtenswerte Ergebnisse.
Zum einen ist das die Erkenntnis des auch hier erkennbaren Mangels an Studien, die sich mit dem Einfluss des komplexen Bündels von Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit mit der Berufs- und Arbeitssituation und der ernsthaften Auswirkungen auf die Arzt- und Patientenseite beschäftigen. Angesichts der gesundheitlichen, ökonomischen, kulturellen und politischen Bedeutung der gesundheitlichen Versorgung oder sogar der rein quantitativen Bedeutung der allein in Deutschland jährlich stattfindenden vielen Hundertmillionen Arzt-Patientkontakten eigentlich unvorstellbar. Einige der jüngeren journalistischen Zusammenfassungen von Fallstudien über die Auswirkungen ihrer Arbeitsbedingungen auf die psychische und somatische Gesundheit von Ärzten in Deutschland (z.B. der am 25.1. 2007 in der Wochenzeitung "Die Zeit" erschienene Artikel "Guter Arzt, kranker Arzt") belegen nur die dringende Notwendigkeit systematischerer und repräsentativerer Untersuchungen.
Zu recht konstatieren die Autoren aber auch, dass der "Einfluss, den die Veränderung von Arbeitsbedingungen und professionellem Selbstverständnis von Ärzten auf die gesundheitliche Versorgung der Patienten und die Attraktivität des Arztberufes ausübt" auch schon vor der Durchführung von Studien wenig beachtet wird.
Zum anderen trägt der IGES-Review dann aber doch eine Reihe gesicherter Erkenntnisse über die vielschichtige Relevanz der Arbeitsunzufriedenheit der Ärzte zusammen.
Ihrer Recherche liegt ein so genanntes "Physician-Factor"-Modell zugrunde, das die folgenden 9 Einflussfaktoren umfasst: ökonomische Anreize und Einkommen sowie Arrangements der Risikoteilung, Organisationsform/Betriebstyp, Steuerung klinisch-ärztlicher Entscheidungen/Kooperation Medizin-Management, administrative Aufgaben, Autonomie versus Erfahrung externer Kontrolle, ärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, ärztliches Berufsprestige/gesellschaftliche Anerkennung und soziodemografische und psychosoziale Aspekte. Bei den Ergebnisparametern unterscheiden die Berliner Reviewer arzt-, versorgungs- und patientenbezogene Resultate, die von "weichen" Faktoren wie der Zufriedenheit mit Familie und Freizeit" bis zu den "harten" Indikatoren der Kosten und Inanspruchnahmefrequenz reichen.
Die Resultate der Sichtung von letztlich 77 Publikationen, die allerdings überwiegend aus dem angloamerikanischen Gesundheitssystem stammen, lassen sich so zusammenfassen:
• Im Mittelpunkt der Studien standen vor allem die Auswirkungen neuer Organisationsformen ärztlicher Tätigkeit rings um die Managed Care-Umstrukturierung und von speziellen ökonomischen Anreizen in der Vergütung. Dabei zeigt sich z. B. eine hohe Assoziation von restriktiven Kopfpauschalen mit niedriger Arbeitszufriedenheit.
• In 44 % der berücksichtigten Studien wurden explizit Auswirkungen niedrigerer Arbeitszufriedenheit auf die medizinische Versorgung untersucht und auch gefunden. Dabei handelt es sich um Behandlungsfehler, Fehler bei der Arzneimitteltherapie und Nachlässigkeiten beim aufwändigen Herstellen eines für den Behandlungserfolg wichtigen Arzt-Patient-Zusammenhalts und der ebenfalls wichtigen Patienten-Compliance.
• Eine Reihe von Untersuchungen zeigen auch negative Auswirkungen individueller, beruflicher und organisationaler Faktoren auf die Prävalenz psychischer Erkrankungen von Ärzten (27 % der befragten Ärzte einer Studie hatten in einem standardisierten und validierten Fragebogen Werte, die auf eine psychische Erkrankung hinwiesen) auf gehäuftes Auftreten von Angstsymptomen und Depressionen und eine deutlich erhöhte Selbstmordrate.
Der Aufsatz über die wesentlichen Ergebnisse des Reviews endet mit einer Reihe methodischer Überlegungen für die Messung von Zufriedenheit, den Methodentyp (weg von der Dominanz von Querschnittsanalysen) und eine stärker ergebnisorientierte Forschung (z. B. durch Einbeziehung von Routinedaten der GKV) in der künftigen, evtl. ja auch mal in Deutschland stattfindenden, Forschung. Vorbildlich ist die komplette bibliografische Dokumentation der 77 reviewten Studien im Anhang des Aufsatzes.
Der Aufsatz von Gothe, Köster, Storz, Nolting und Häussler "Arbeits- und Berufszufriedenheit von Ärzten. Eine Übersicht der internationalen Literatur" ist am 18. Mai 2007 im "Deutschen Ärzteblatt" (Jg. 104, Heft 20: A 1394-1399 mit bibliografischem Anhang A1 bis A3) veröffentlicht und hier u.a. als PDF-Datei herunterladbar.
Bernard Braun, 29.5.2007
Erkrankte Ärzte in der Patienten-Rolle: Eine ganz andere Wahrnehmung der Zeit
 Für Patienten wie Ärzte gleichermaßen spielt die Erfahrung von Zeit im medizinischen Versorgungssystem eine immer größere Rolle. Patienten klagen, dass Ärzte sich für sie zu wenig Zeit nehmen, dass sie zu lange auf Termine oder Untersuchungsbefunde warten müssen. Ärzte kritisieren, dass sie immer mehr Zeit für Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben verwenden müssen. Die Perspektive von Ärzten und Patienten ist jedoch höchst verschieden, es sei denn, dass Ärzte einmal aufgrund einer gravierenderen Erkrankung gezwungen sind, selbst in die Rolle des Patienten zu schlüpfen. Dass diese Erfahrung trotz aller mit Krankheit verbundenen Ängste und Beschwerden gleichwohl für Ärzte eine große Bereicherung sein und auch dazu beitragen kann, die Arzt-Patient-Kommunikation zu verbessern, hat eine Studie von Robert Klitzman an der Columbia University, New York, gezeigt, die jetzt in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurde.
Für Patienten wie Ärzte gleichermaßen spielt die Erfahrung von Zeit im medizinischen Versorgungssystem eine immer größere Rolle. Patienten klagen, dass Ärzte sich für sie zu wenig Zeit nehmen, dass sie zu lange auf Termine oder Untersuchungsbefunde warten müssen. Ärzte kritisieren, dass sie immer mehr Zeit für Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben verwenden müssen. Die Perspektive von Ärzten und Patienten ist jedoch höchst verschieden, es sei denn, dass Ärzte einmal aufgrund einer gravierenderen Erkrankung gezwungen sind, selbst in die Rolle des Patienten zu schlüpfen. Dass diese Erfahrung trotz aller mit Krankheit verbundenen Ängste und Beschwerden gleichwohl für Ärzte eine große Bereicherung sein und auch dazu beitragen kann, die Arzt-Patient-Kommunikation zu verbessern, hat eine Studie von Robert Klitzman an der Columbia University, New York, gezeigt, die jetzt in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurde.
Basis der Studie sind insgesamt 50 jeweils etwa vierstündige Interviews mit Ärzten, die selbst schwerwiegend erkrankt waren, unter anderem aufgrund von HIV, Krebs, Hepatitis oder einer Herzerkrankung. In den Interviews stand das Thema "Zeit" im Vordergrund, und zwar in unterschiedlichsten Zusammenhängen, als zeitlicher Zwang der eigenen Arbeit oder Anforderung der Klinik, als Erwartung von Patienten, als zeitlicher Verlauf von Krankheiten, als Wartezeit. Dabei wurde den meisten Medizinern erstmals klarer bewusst, dass es unterschiedliche Zeitperspektiven gibt: Die des Patienten, die des Arztes und die der Klinik oder Praxis. Und mehr noch wurde für sie - jetzt in der Rolle des Patienten - nachvollziehbar, dass Patienten andere zeitliche Erwartungen an Ärzte haben: mehr Zeit zur Untersuchung und für das Gespräch, kürzere Wartezeiten auf Termine oder bis zum Vorliegen von Untersuchungsergebnissen.
Sie nahmen in der Rolle des Patienten jetzt auch deutlicher wahr, welche Mechanismen ein Arzt entwickelt um in einem begrenzten Zeitrahmen mit den vielfältigen Erwartungen fertig zu werden: Viele von ihnen tendieren dazu, eine "Verfahrens-Orientierung" zu entwickeln ("procedure-orientation"), also diagnostische Tests durchzuführen anstelle von körperlichen Untersuchungen, Anamnesen oder Patientengesprächen. "Ärzte glauben an die Objektivität und Aussagekraft von Zahlen", erläuterte ein Arzt-Patient im Interview. "Sie sind sehr verfahrens-fixiert und sagen: 'Lass uns noch ein Röntgen machen.' Sie hören nicht auf meine Brust, sondern lassen stattdessen lieber ein Brust-Röntgenbild erstellen."
Unterschiedliche Definitionen und Perspektiven von Arzt und Patient wurden auch deutlich, wenn es um Zeitangaben ging. Ob ein Ergebnis "bald" oder "schnell" vorliegt, ob ein Tumor sich "langsam" entwickelt, oder ob der Arzt sagt "Wir haben noch viel Zeit" - all dies kann völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Ein Interviewter: "Mein Arzt sagte mir, mein Hodgkin's (Lymphdrüsenkrebs) würde sich nicht so schnell ausbreiten. Aber wenn der Krebs erst mal diagnostiziert ist, hat man eine ganz andere Zeitperspektive." Diese Erfahrung wurden von vielen Interviewpartnern gemacht: Als Arzt neigt man dazu, Zeitdimensionen eher objektiv zu betrachten, auf der Basis von Forschungsergebnissen etwa zu Überlebensraten oder anderen Daten. Als Patient hingegen überschattet die Angst das zeitliche Erleben. Und viele der Arzt-Patienten wurden sogar wütend, weil sie länger auf ihren Termin, ihre Untersuchungsbefunde oder das Arztgespräch warten mussten oder weil sie nur vage Angaben zum zeitlichen Ablauf bekamen. "Ärzte und auch Versorgungseinrichtungen", so fasst Robert Klitzmann zusammen, "strukturieren ihre Zeitabläufe so, dass sie ihren eigenen Interessen und Prioritäten am besten entgegenkommen. Unsere Ergebnisse zeigen, in welchem Ausmaß immer noch eine arzt- und institutions-dominierte Medizin praktiziert wird und wie wenig eine Patienten-Orientierung zu finden ist."
Der Wissenschaftler räumt ein, dass die dahinter stehenden Zwänge kaum völlig abgebaut werden können. Er rät dazu, Patienten zumindest deutlich zu machen, dass man ihre Sorgen und Bedürfnisse wahrnimmt ("Entschuldigung, dass ich Sie habe warten lassen.") und Patienten auch nicht mit allzu vagen Zeitangaben ("bald", "schnell", "sofort") im Ungewissen zu lassen.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: "Patient-time", "doctor-time", and "institution-time": Perceptions and definitions of time among doctors who become patients (Patient Education and Counseling, Volume 66, Issue 2, May 2007, Pages 147-155)
Gerd Marstedt, 1.5.2007
Bundessozialgericht: Leistungsentscheidungen der GKV müssen sich primär am wirklichen Patienten orientieren!
 Wenn sich eine Krankenkasse, der Medizinische Dienst der Krankenkasse, ein Landessozialgericht, der Gemeinsame Bundesausschuss und das Bundesministerium für Gesundheit durch Handeln und Nichthandeln einig sind, haben es Patienten schwer, eine Leistung zu bekommen. Weder der verordnende Arzt noch ein Sozialgericht, sondern erst das Bundessozialgericht (BSG) hat in dem hier vorgestellten Fall auf der Basis einer zehnjährigen einschlägigen, also auch bekannten Rechtsprechung, zugunsten des klagenden Patienten interveniert.
Wenn sich eine Krankenkasse, der Medizinische Dienst der Krankenkasse, ein Landessozialgericht, der Gemeinsame Bundesausschuss und das Bundesministerium für Gesundheit durch Handeln und Nichthandeln einig sind, haben es Patienten schwer, eine Leistung zu bekommen. Weder der verordnende Arzt noch ein Sozialgericht, sondern erst das Bundessozialgericht (BSG) hat in dem hier vorgestellten Fall auf der Basis einer zehnjährigen einschlägigen, also auch bekannten Rechtsprechung, zugunsten des klagenden Patienten interveniert.
Der strittige Sachverhalt ist von der schweren unstandardmäßigen Art, der nicht problemlos und ohne eine den realen Patienten berücksichtigende Einfühlsamkeit in eines der Leistungsverzeichnisse der GKV, hier das "Hilfsmittelverzeichnis" passt.
In der Zusammenfassung des BSG hatte es sich mit folgender Situation auseinanderzusetzen: "Der bei der beklagten Krankenkasse versicherte Kläger begehrt Kostenerstattung für eine selbst angeschaffte so genannte Vojta-Liege in Höhe von 2.921,95 Euro. Er leidet seit seiner Geburt am 9.4.2002 an Spina-bifida (auch offener Rücken genannt), die neben ärztlicher Behandlung seit dem 2. Lebensmonat zwei Mal wöchentlich eine Therapie bei einem Physiotherapeuten sowie zusätzlich zwei bis fünf Mal täglich Übungen durch die Mutter des Klägers erforderlich macht. Im November 2002 verordnete deshalb der behandelnde Kinderarzt eine Vojta-Liege, elektrisch höhenverstellbar mit abklappbarem Kopf- und Fußteil, die im Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen nicht aufgeführt ist, aber zur Praxisausstattung von Physiotherapeuten gehört. Der von der Beklagten eingeschaltete Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) kam zu dem Ergebnis, dass zur Durchführung der Vojta-Therapie im häuslichen Bereich eine ausreichend dicke Gymnastikmatte auf dem Boden oder auf einem entsprechend angepassten Tisch ausreiche. Mit dieser Begründung lehnte die Beklagte die Hilfsmittelversorgung ab. Während des anschließenden Klageverfahrens haben die Eltern des Klägers die Liege auf eigene Rechnung angeschafft. Während die Klage vor dem SG Erfolg hatte, hat sie das LSG abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Vojta-Liege sei kein Hilfsmittel, weil es an einem therapeutischen Nutzen für den Kläger fehle. Sie erleichtere allein die Tätigkeit der Hilfsperson."
Dagegen argumentiert der Kläger bzw. seine Klagevertreter, die Liege sei ein Hilfsmittel der Krankenversicherung, weil sie der Sicherung der ärztlichen Behandlung diene, "wenn auch nur mittelbar in der Weise, dass sie die Durchführung der erforderlichen gymnastischen Übungen durch die Mutter erleichtere. Die fehlende Eintragung im Hilfsmittelverzeichnis stehe dem nicht entgegen."
In seinem im November 2006 veröffentlichten Urteil vom 3.8.2006, B 3 KR 25/05 R kommt das BSG zu einem deutlich anderen Urteil als das Landessozialgericht (LSG) und verwirft die von der Krankenkasse und dem MDK mobilisierten Argumente. Das LSG muss daher in einem neuen Verfahren erneut die sachliche Notwendigkeit dieser Liege prüfen.
Die für das BSG wesentlichen Gründe finden sich in einem Beitrag des Juristen Alexander Gagel auf dem auch generell besuchenswerten Diskussionsforum "Teilhabe und Prävention" des "Instituts für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der Deutschen Sporthochschule Köln" (Gagel, Schian, Kohte, Preis und Welti) zusammengefasst und lauten:
• "Die Verordnung und Erbringung eines Hilfsmittels ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass es nicht im Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen aufgeführt ist (dies ist keine abschließende Positivliste - bb).
• Ein Hilfsmittel dient auch dann der Sicherung ärztlicher Behandlung (und dem Patienten - bb), wenn es nur die häusliche Behandlung durch einen Dritten ermöglicht oder wesentlich erleichtert.
• Es spielt keine Rolle, ob das Hilfsmittel ansonsten zur Praxisausstattung von Therapeuten gehört (es zählt nur, ob es geeignet ist, gemäß des § 33 Abs. 1 SGB V den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, Behinderungen auszugleichen oder drohender Behinderung vorzubeugen).
• Bei berechtigter Selbstbeschaffung ist der volle Kaufpreis zu erstatten, wenn der Berechtigte ihn für angemessen halten durfte."
Die aus Sicht der Gesundheits- und Lebensqualität eines Patienten bei allen Leistungen möglichst ganzheitlich zu berücksichtigende Aspekte, hebt das BSG z.B. auch in folgenden Formulierungen hervor:
• "Entscheidend ist danach, ob das Mittel im Einzelfall der behinderten Person dadurch zu Gute kommt, dass die Auswirkungen ihrer Behinderungen behoben oder gemildert werden, selbst wenn dies dadurch geschieht, dass die Pflege durch Dritte erleichtert wird." (Ziffer 12 des BSG-Urteils)
• "Dabei ist zu berücksichtigen, dass angesichts der häufigen und zeitintensiven körperlichen Beanspruchung der Mutter als Pflegeperson, durch deren unentgeltliche Tätigkeit die Solidargemeinschaft erheblich entlastet wird, gewisse Mindestanforderungen an eine ergonomische Ausstattung zu stellen sind, um nicht auf Dauer die Gesundheit der Pflegeperson zu gefährden." (Ziffer 14 des BSG-Urteils)
Zur Ergänzung des letzten Gedankens wäre anzumerken, dass es mit Sicherheit nicht zur psychischen Gesundheit des kranken Kindes beiträgt, wenn seine Mutter körperlich geschädigt wird und dann evtl. auch die familiäre Pflege beenden müsste. Paradoxerweise würde die Krankenkasse dann die außerfamiliäre Pflege in einer physiotherapeutischen Einrichtung auf einer solchen Liege ohne Aufheben bezahlen - auch wenn dies möglicherweise viel teurer wäre.
Zu hoffen bleibt, dass mit entsprechendem patientenorientierten Druck aus dem BMG der G-BA endlich eine eindeutige Klarstellung der nicht abschließenden Bedeutung des Hilfsmittelverzeichnisses vornimmt.
Bernard Braun, 8.2.2007
Patientenzufriedenheit: Entscheidend ist nicht nur der Therapieerfolg, sondern auch die Arzt-Patient-Kommunikation
 Dass Patienten umso zufriedener sind, je erfolgreicher die ärztliche Therapie ist, je schneller sie von einer Krankheit genesen und wieder arbeitsfähig werden oder ihren gewohnten Interessen nachgehen können, ist eine Binsenweisheit. Dass indes noch viele weitere Faktoren eine nachhaltige Rolle für die Patientenzufriedenheit und damit den weiteren Verbleib bei einem Arzt spielen - und dies auch ganz unabhängig vom therapeutischen Erfolg - hat jetzt eine Literaturstudie gezeigt, die im Januar 2007 in der Zeitschrift "Family Practice Management" veröffentlicht wurde. Die Autorin Carolyn Thiedke, Professorin an der Medizinischen Universität von South Carolina, gesteht zu Beginn ihrer Literaturstudie freimütig ein, dass sie Untersuchungen zur Patientenzufriedenheit früher nicht besonders nützlich fand, da ihr Hauptanliegen die Gesundheit und nicht die Zufriedenheit der Patienten war.
Dass Patienten umso zufriedener sind, je erfolgreicher die ärztliche Therapie ist, je schneller sie von einer Krankheit genesen und wieder arbeitsfähig werden oder ihren gewohnten Interessen nachgehen können, ist eine Binsenweisheit. Dass indes noch viele weitere Faktoren eine nachhaltige Rolle für die Patientenzufriedenheit und damit den weiteren Verbleib bei einem Arzt spielen - und dies auch ganz unabhängig vom therapeutischen Erfolg - hat jetzt eine Literaturstudie gezeigt, die im Januar 2007 in der Zeitschrift "Family Practice Management" veröffentlicht wurde. Die Autorin Carolyn Thiedke, Professorin an der Medizinischen Universität von South Carolina, gesteht zu Beginn ihrer Literaturstudie freimütig ein, dass sie Untersuchungen zur Patientenzufriedenheit früher nicht besonders nützlich fand, da ihr Hauptanliegen die Gesundheit und nicht die Zufriedenheit der Patienten war.
Nach der Lektüre und Auswertung einer Vielzahl von Veröffentlichungen zur Patientenzufriedenheit gesteht sie jedoch ein, dass sie daraus Etliches lernen konnte, was auch für die Praxisführung und das Arztverhalten bedeutsam sein kann. Denn Patientenzufriedenheit ist nicht nur ein Wohlfühl-Aspekt für den Patienten als "Kunden einer Arztpraxis", sondern mitentscheidend für den Therapieerfolg, aufgrund der besseren Befolgung ärztlicher Verordnungen ebenso wie aufgrund der psychologischen und emotionalen Effekte. Die Ergebnisse der von ihr ausgewerteten Veröffentlichungen decken sich nicht in allen Punkten, für eine Reihe von Aspekten fand sie jedoch weitgehende Übereinstimmung. Danach wird die Patientenzufriedenheit positiv beeinflusst durch folgende Merkmale.
• Eingehen des Arztes auf Patientenerwartungen: Wichtig für den Arzt ist es herauszufinden, welche Erwartungen und (z.T. unartikulierten) Wünsche der Patient hat. Bisweilen zielen diese sehr viel weniger auf Diagnostik, körperliche Untersuchungen, eine physikalische Therapie oder Medikamentenverschreibung, sondern sehr viel stärker auf ärztliche Informationen oder die Möglichkeit, über psychosoziale Probleme zu sprechen.
• Kommunikation: In einer Studie, in der Patienten wegen arbeitsbedingter Rückenschmerzen in eine Arztpraxis kamen, zeigte sich, dass bei einer intensiven Arzt-Patient-Kommunikation die Zufriedenheit sehr viel höher ausfiel als man aufgrund des (unterschiedlichen) therapeutischen Erfolgs hätte erwarten können.
• Verzicht auf medizinische Dominanz, Partizipation und Mitwirkung des Patienten: Die Patientenzufriedenheit ist höher, wenn Ärzte ihre dominierende und die Konsultation beherrschende Position ein Stückweit aufgeben und den Patienten dazu ermuntern, Fragen zu stellen, Ängste und Hoffnungen freimütig zu äußern.
• Berücksichtigung psychosozialer Aspekte: Patienten sind zufriedener, wenn Ärzte nicht nur ihr körperliches Wohlergehen im Auge haben, sondern ebenso auf ihr psychisches Wohlbefinden und ihre sozialen oder beruflichen Probleme eingehen.
• Ausreichende Zeit: Mit der Dauer des Arztgesprächs und ebenso mit dem Gefühl, dass das Arztgespräch länger dauerte als man zuvor erwartet hatte, steigt auch die Zufriedenheit. Darüber hinaus spielt unabhängig von der tatsächlichen zeitlichen Dauer des Arztkontaktes das Gefühl eine Rolle, ob der Arzt gehetzt war und unter Zeitdruck stand.
• Bewertung der Praxismitarbeiter: Engagement, Hilfsbereitschaft und schnelles Eingehen auf Patientenwünsche durch die Mitarbeiter in der Praxis spielen ebenfalls eine Rolle.
Die Wissenschaftlerin berichtet in ihrem Aufsatz auch noch über weitere Aspekte, die die Patientenzufriedenheit beeinflussen, Aspekte allerdings die im Unterschied zu den oben genannten vom Arzt nicht beeinflussbar sind. So haben jüngere Patienten, solche aus unteren Sozialschichten und auch ethnische Minderheiten in einer Reihe von Studien eine Tendenz zu höherer Unzufriedenheit gezeigt.
Zum Schluss ihrer Veröffentlichung, in der sich auch zahlreiche Literaturhinweise für die oben genannten Ergebnisse finden, formuliert sie noch einige Ratschläge an niedergelassene Ärzte: "Behandeln Sie Patienten mit Würde und Respekt und beziehen sie in die Therapieentscheidung mit ein. Versuchen Sie, die Erwartungen des Patienten herauszubekommen, etwa durch Fragen wie 'Was ist Ihre eigene Meinung über diese Beschwerden?' oder 'Wovor haben Sie besonders Angst?'. Versuchen Sie, ihre ärztlichen Tätigkeit mit Freude auszuüben: Mediziner, die mit ihrer Arbeit hoch zufrieden sind, haben einer Studie zufolge auch zufriedenere Patienten."
Hier ist die Veröffentlichung nachzulesen: What Do We Really Know About Patient Satisfaction? A review of the literature reveals practical ways to improve patient satisfaction and compelling reasons to do so (Family Practice Management , January 2007, Vol. 14, No. 1, pages 33-6)
Gerd Marstedt, 7.2.2007
Patientenzentrierung und -mitwirkung nicht "nur" zum Wohlfühlen, sondern sie verbessern den gesundheitlichen Outcome
 Auch in den USA gibt es zahlreiche Klagen über einen Mangel an Krankenbehandlung, die patientenzentriert ("Patient-centered care") ist und die Patienten mitwirken lässt ("collaborative care"). Das US-amerikanische "Institute of Medicine" definiert dabei patientenzentrierte Versorgung als eine, "die gegenüber Neigungen, Bedürfnissen und Werten von Patienten Respekt und Verantwortung an den Tag legt" und hält sie für eine der Schlüsselzutaten einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung.
Auch in den USA gibt es zahlreiche Klagen über einen Mangel an Krankenbehandlung, die patientenzentriert ("Patient-centered care") ist und die Patienten mitwirken lässt ("collaborative care"). Das US-amerikanische "Institute of Medicine" definiert dabei patientenzentrierte Versorgung als eine, "die gegenüber Neigungen, Bedürfnissen und Werten von Patienten Respekt und Verantwortung an den Tag legt" und hält sie für eine der Schlüsselzutaten einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung.
Der beklagte Mangel wird häufig dadurch zu erklären versucht, dass es sich bei den genannten Merkmalen der Behandlung vorrangig um "Wohlfühlfaktoren" handle, die angenehm sind, aber wenig oder nichts zur Qualität und zum Ergebnis der Behandlung beitragen. Sie können daher auch unter Kostendruck weggelassen werden. Demgegenüber steht die Meinung, Patientenzentrierung und die Mitwirkung von Patienten an der Behandlung trage wesentlich zum "harten" Erfolg dieser Behandlung bei oder mindere ihn, wenn diese Elemente nicht aufträten.
In einer großen Befragung von 24.609 Erwachsenen zwischen 15 und 69 Jahren, die an geläufigen chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes erkrankt waren sowie an Schmerzen und emotionalen Problemen litten und deren Ergebnisse 2006 veröffentlicht wurden ("Patients Report Positive Impacts of Collaborative Care" im "Journal of Ambulatory Care Management. Technology for Patient-centered, Collaborative Care. 29(3):199-206, July/September 2006), versuchten John Wasson et al. von der "Dartmouth Medical School" zweierlei herauszubekommen: Wie viele dieser Patienten erhielten eine patientenzentrierte und auf ihre Mitwirkung bedachte Behandlung und welche Auswirkungen hatte dies auf die Outcomes?
Dabei wurde "collaborative care" als gut bewertet, wenn die Patienten von ihren Ärzten nützliche Informationen über ihr Leiden erhielten und außerdem Vertrauen in ihre Fähigkeit vermittelt bekamen sowie besaßen, ihren Zustand kontrollieren und managen zu können. Sie wurde für noch gut genug ("fair") gehalten, wenn eines der beiden Elemente erfüllt war. Schlecht ("poor") war sie, wenn keines der beiden Elemente eine Rolle in der Behandlung spielte.
Das Ergebnis sieht so aus: 21 % der Befragten charakterisierten ihre Möglichkeiten zur Mitwirkung und Beteiligung als gut, 36 % als "fair" und 43 % als schlecht. Kritisch zu bewerten ist dies, weil eine gute patientenzentrierte und -beteiligende Behandlung in mehrfacher Hinsicht die Prozess- und vor allem Ergebnisqualität der Behandlung spürbar positiv beeinflusste.
Konkret heißt dies beispielsweise, dass nach der Adjustierung von mehreren soziodemografischen Merkmalen der Befragten (z.B. Alter, Geschlecht), ihrer Krankheitslast, ihrem Gesundheitsverhalten und der Gesamtqualität der Gesundheitsversorgung
• die Kontinuität der Behandlung bei einem Leistungserbringer besser war,
• der Zugang zu weiteren Behandlungsangeboten leichter war,
• die Ergebnisse der Behandlung wie z.B. der Blutdruckwert, Blutzuckerwert oder die Schmerzbewältigungsfähigkeit erheblich besser aussahen,
• im höheren Maße präventive Angebote genutzt wurden sowie
• weniger Arbeitsunfähigkeitstage oder bettlägrige Tage zu Hause anfielen.
Das Resumé der Forscher lautete: "Good collaborative care is very likely to increase quality care and lower its costs."
• Zusammenfassungen der Ergebnisse dieser und anderer Studien finden sich in einer 2seitigen Zusammenfassung der dazu veröffentlichten Aufsätze: Commonwealth Fund: "In the Literature"
• Das komplette Heft ist im Volltext (kostenlos) als PDF-Datei verfügbar auf der Seite von "www.howsyourhealth.org": Journal of Ambulatory Care Management Special Issue: Technology for Patient-Centered, Collaborative Care
• Hier finden Sie kostenfrei ein Abstract des Aufsatzes Patients Report Positive Impacts of Collaborative Care
Bernard Braun, 5.2.2007
"Wertvorstellung und Respekt" - Neuer Leitfaden zur verbesserten Umsetzung von Patientenwünschen
 Zwei von drei Bundesbürgern sterben im Alten- oder Pflegeheim oder im Krankenhaus. In vielen Fällen herrscht bei Pflegepersonal, Ärzten oder Angehörigen Unklarheit über Behandlungswünsche und -möglichkeiten am Lebensende. Aber auch Patienten selbst sind oft unsicher, wie eine rechtsgültige Verfügung aussehen muss für den Fall, dass sie einen Schlaganfall erleiden, ins Wachkoma fallen oder aufgrund von Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer ihren Willen nicht mehr äußern können. Einen neuen Weg aus dieser unbefriedigenden Situation weist der Leitfaden "Wertvorstellung und Respekt", der von einer interdisziplinären Gruppe junger Nachwuchswissenschaftler erarbeitet wurde. In Anlehnung an ein US-amerikanisches Vorbild, hat die Gruppe ein Kommunikations-Modell entwickelt, wonach die in einer Patientenverfügung festgelegten Behandlungswünsche nicht als punktuelles Ereignis begriffen werden, sondern als Teil eines kontinuierlichen Gesprächsprozesses - bei dem sich Wünsche des Patienten auch verändern können. Für die Umsetzung dieses Konzepts in die Praxis sind jedoch neue Strukturen im deutschen Gesundheitssystem notwendig. Der Leitfaden will Verantwortlichen in Kliniken und Heimen, Krankenkassen und Verbänden dabei helfen, diese neuen Wege zu gehen.
Zwei von drei Bundesbürgern sterben im Alten- oder Pflegeheim oder im Krankenhaus. In vielen Fällen herrscht bei Pflegepersonal, Ärzten oder Angehörigen Unklarheit über Behandlungswünsche und -möglichkeiten am Lebensende. Aber auch Patienten selbst sind oft unsicher, wie eine rechtsgültige Verfügung aussehen muss für den Fall, dass sie einen Schlaganfall erleiden, ins Wachkoma fallen oder aufgrund von Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer ihren Willen nicht mehr äußern können. Einen neuen Weg aus dieser unbefriedigenden Situation weist der Leitfaden "Wertvorstellung und Respekt", der von einer interdisziplinären Gruppe junger Nachwuchswissenschaftler erarbeitet wurde. In Anlehnung an ein US-amerikanisches Vorbild, hat die Gruppe ein Kommunikations-Modell entwickelt, wonach die in einer Patientenverfügung festgelegten Behandlungswünsche nicht als punktuelles Ereignis begriffen werden, sondern als Teil eines kontinuierlichen Gesprächsprozesses - bei dem sich Wünsche des Patienten auch verändern können. Für die Umsetzung dieses Konzepts in die Praxis sind jedoch neue Strukturen im deutschen Gesundheitssystem notwendig. Der Leitfaden will Verantwortlichen in Kliniken und Heimen, Krankenkassen und Verbänden dabei helfen, diese neuen Wege zu gehen.
In den letzten Jahren haben immer mehr Bundesbürger eine eigene Patientenverfügung verfasst. Darin werden Behandlungswünsche und Wertvorstellungen für den Fall zum Ausdruck gebracht, dass der Einzelne - vorübergehend oder dauerhaft - nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen unmittelbar zu äußern. Für Ärzte und Pflegepersonal sind diese Verfügungen wichtig, weil sie sich aus rechtlicher und ethischer Sicht am Willen des Patienten zu orientieren haben, wollen sie sich nicht dem Vorwurf einer strafbaren Körperverletzung aussetzen. Die grundsätzliche Verbindlichkeit einer solchen Patientenverfügung wird seit langem von der Bundesärztekammer betont (Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung 1998 und 2004) und ist inzwischen auch vom Bundesgerichtshof (Beschluß vom 17. März 2003 - XII ZB 2/03) ausdrücklich anerkannt worden. Eine gesetzliche Regelung der Patientenverfügung fehlt allerdings bis heute. Eine Gesetzesinitiative zur Reichweite und Verbindlichkeit der Patientenverfügung wird nun von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages erwartet.
In der klinischen Praxis und der ambulanten Versorgung zeigen sich bis heute Schwierigkeiten im Umgang mit diesen Verfügungen. Die beiden Hauptprobleme, die auf der praktischen Ebene bisher nicht zufrieden stellend gelöst sind, beziehen sich 1. auf die medizinische und fachliche Beratung bei der Erstellung der Patientenverfügung/ Vorsorgevollmacht und 2. auf die Implementierung in die klinische und ambulante Versorgung.
Der 12-seitige "Leitfaden zur Implementierung von Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht in die klinische und ambulante Versorgung" richtet sich an alle Akteure im Gesundheitswesen die bereit sind, hilfreiche Veränderungen anzustoßen und zu verwirklichen. Ziel des Leitfadens ist es, Verantwortliche in der Krankenhausleitung, in Alten- und Pflegeheimen, bei Krankenkassen und Ärzteverbänden knapp und gezielt Informationen zu vermitteln, wie sie hilfreich eine Netzwerkstruktur entwickeln können.
Die Broschüre (Hrsg.: Kurt W. Schmidt, Gabriele Wolfslast und Sonja Rothärmel) ist hier als pdf-Datei kostenlos als Download verfügbar.
Leitfaden zur Implementierung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht in die klinische und ambulante Versorgung
Gerd Marstedt, 11.1.2007
Der Unsinn der Bestrafung von Krebskranken bei Nichtinanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen
 Ob die anfängliche Absicht der Bundesregierung im "Wettbewerbsstärkungsgesetz", Krebskranke bei Auftreten einer Krebserkrankung die Ermäßigung der Zuzahlung zu verweigern, wenn sie nicht an den entsprechenden Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teilgenommen haben, im endgültigen Gesetz überlebt, weiß niemand.
Ob die anfängliche Absicht der Bundesregierung im "Wettbewerbsstärkungsgesetz", Krebskranke bei Auftreten einer Krebserkrankung die Ermäßigung der Zuzahlung zu verweigern, wenn sie nicht an den entsprechenden Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teilgenommen haben, im endgültigen Gesetz überlebt, weiß niemand.
Dass derartige Pläne gesundheitswissenschaftlich und -ökonomisch unsinnig sind, steht für das "Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V." fest. In dem seit 2000 existierenden Netzwerk sind Ärzte und Wissenschaftler zahlreicher Fach- und Forschungsrichtungen aktiv, die Konzepte und Methoden der evidenzbasierten Medizin (EbM) in klinischer Praxis, Lehre und Forschung anwenden und weiter entwickeln. Zu dieser Entwicklung gehört auch unabhängige wissenschaftsbasierte Information der Öffentlichkeit.
Am 11. Dezember 2006 lehnt das Netzwerk die Absicht des § 62 aus verschiedenen Gründen eindeutig ab:
• "Die Entscheidung für oder gegen eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung erfordert eine individuelle, ergebnisoffene Abwägung von Nutzen und Schaden. Die Entscheidung für oder gegen eine medizinische Maßnahme muss frei bleiben. Eine Bestrafung bei Nicht-Teilnahme ist mit dem Prinzip der Eigenverantwortung und Autonomie der Bürgerinnen und Bürger unvereinbar.
• Die Wahrscheinlichkeit, als Einzelner von der Früherkennung zu profitieren, ist eher gering. So erspart die Teilnahme am Früherkennungsprogramm für Brustkrebs innerhalb von 10 Jahren etwa einer von 1.000 Teilnehmerinnen den Tod an Brustkrebs. Mit einem Verdachtsbefund müssen innerhalb von 10 Jahren jedoch 200 Frauen rechnen. Dieser Verdachtsbefund erfordert eine weitergehende Abklärung bis hin zu operativen Eingriffen. Die Bundesregierung unterschätzt ganz offensichtlich, dass die Teilnahme an der Krebsfrüherkennung für eine erhebliche Anzahl von Personen mit Belästigungen und Risiken verbunden ist.
• Nicht-Teilnahme an der Krebsfrüherkennung hat für die Versichertengemeinschaft keine nachteiligen Folgen. Es gibt keine ausreichenden Nachweise dafür, dass die Teilnahme an einem Krebsfrüherkennungsprogramm Kosten erspart.
• Krebstherapien können sehr teuer sein. Die Regelung würde ausgerechnet diejenigen finanziell bestrafen, die wegen Ihrer Krankheit ganz besonders der Solidarität bedürfen."
Zur Erläuterung stützen sich die Netzwerker auf entsprechende evidenzbasierten Erkenntnisse des Nutzens und Schadens der verschiedenen Früherkennungsuntersuchungen:
• "Krebsfrüherkennungsprogramme zielen auf die Senkung der Sterblichkeit an der jeweiligen Krebsart. Bislang gibt es nur für drei Methoden einen Nachweis, dass sie die krebsartbezogene Sterblichkeit tatsächlich senken können. Das sind die Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs, der Okkultbluttest für die Früherkennung von Dickdarmkrebs und - mit Einschränkung - der "PAP"-Abstrich für die Früherkennung von Gebär-mutterhalskrebs. Aber auch für diese Methoden gilt, dass aus Sicht der Teilnehmer nur wenige von 1000 durch Früherkennung einen Krebstod vermeiden können. Zum Beispiel lässt sich abschätzen, dass von 1.000 Frauen, die 10 Jahre lang an der Mammographie zur Brustkrebs-früherkennung beteiligen, etwa einer Frau der Tod an Brustkrebs erspart bleibt.
• Jedem Teilnehmer der Krebsfrüherkennungsprogramme, der diesen Nutzen hat, steht jedoch eine zumeist weitaus größere Zahl von Teilnehmern gegenüber, die einen Schaden erleiden. Direkte Schäden entstehen durch die Untersuchung selbst, zum Beispiel durch Röntgenstrahlung oder durch Darmspiegelung. Im deutschen Koloskopie-Programm kam es in 2 bis 7 Fällen von 10.000 Spiegelungen zu Verletzung bis hin zu Durchstoßungen der Darmwand, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machten. Die Wahrscheinlichkeit für solche direkten Schäden ist für den Einzelnen zwar zumeist gering, für denjenigen, der davon betroffen ist, handelt es sich jedoch um ein gravierendes Ereignis. Die möglichen direkten Schäden dürfen daher bei der Aufklärung nicht verschwiegen oder verharmlost werden.
• Wesentlich größere Tragweite haben zumeist die indirekten Risiken, die sich aus dem Befund der Untersuchung ergeben. Dazu gehören vor allem falsch-positive Befunde (Verdachtsbefunde), die eine Abklärung mit weiteren Verfahren erfordern, die ihrerseits zu Belastungen und Schäden führen können. Besonders schwerwiegend ist, dass durch Früherkennung auch Tumore entdeckt werden, die zwar bösartig erscheinen, die aber im weiteren Leben nie auffällig geworden wären. Solche Diagnosen ohne Krankheitswert nennt man Überdiagnosen. Weil diese Tumore fälschlicherweise als gefährlich beurteilt werden, führen sie zu risikobehafteter Übertherapie bis hin zu Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. Bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie schätzen Fachleute, dass sich unter zehn gefundenen Tumoren eine bis fünf solcher Überdiagnosen befindet."
Sie finden den gesamten Text der Presserklärung des "Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin" samt einiger Literaturhinweise hier.
Bernard Braun, 11.12.2006
Patienten-Zwickmühle: Wenig Sorgen über finanzielle Interessenskonflikte ihrer Behandler aber Interesse an Transparenz
 Einen interessanten Einblick in die Sichtweisen und Kritikfähigkeit oder -bereitschaft von Patienten gegenüber ihren Ärzten verschafft eine Studie mit Krebspatienten in klinischen Studien, die danach gefragt wurden, ob und wie sie mögliche finanzielle Interessenskonflikte der sie behandelnden Forscher wahrnehmen und bewerten.
Einen interessanten Einblick in die Sichtweisen und Kritikfähigkeit oder -bereitschaft von Patienten gegenüber ihren Ärzten verschafft eine Studie mit Krebspatienten in klinischen Studien, die danach gefragt wurden, ob und wie sie mögliche finanzielle Interessenskonflikte der sie behandelnden Forscher wahrnehmen und bewerten.
Konkret geht es um die gerade in letzter Zeit immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit geratenden finanziellen Zuwendungen der Pharmaindustrie oder anderer Firmen, die Gesundheitsprodukte herstellen, an medizinische Forscher, die häufig gerade erst den Nutzen dieser Produkte in den Forschungsprojekten überprüfen wollen oder sollen.
Die Ergebnisse aus Interviews mit 253 Patienten in 5 medizinischen Zentren der USA sind von Hampson et al. unter der Überschrift "Patients' Views on Financial Conflicts of Interest in Cancer Research Trials" in der Ausgabe 22 vom 30. November 2006 (Volume 355: 2330-2337) der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlicht worden.
Zu den teilweise unerwarteten und nachdenklich stimmenden Details der Befragung zählen z.B.:
• Mehr als 90 % der Patienten waren über die finanziellen Bindungen der Wissenschaftler an Pharmafiormen wenig oder nicht besorgt,
• 82 % der Befragten sagten, sie hätten an der Studie auch teilgenommen, wenn klar gewesen wäre, dass ein Pharmahersteller Redehonorare an die Behandler zahlte; 75 % hätten keine Probleme, wenn Geld für Beratung geflossen wäre und 76 %, wenn ihr Forscher Anteile an einer solchen Firma gehabt hätte.
• Ähnlich große Anteile der Befragten hätten auch mit finanziellen Zuwändungen dieser Art an ihr Krankenhaus keine Probleme.
• Rund vier Fünftel der befragten Krebspatienten hielten solche Zuwendungen auch für ethisch vertretbar.
• Eine qualifizierte Minderheit der Befragten verlangt aber in jedem Fall die uneingeschränkte Transparenz über die finanziellen Interessen der Forscher (31 %) und des dafür vorhandenen Überprüfungssystem (40 %). Lediglich 17 % betrachten solche Enthüllungen als für Patienten nicht notwendig.
Hier finden Sie das Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 30.11.2006
Immer weniger Sonntagskinder, immer mehr Wunsch-Kaiserschnitte
 Die Anzahl der Geburten an Wochenenden und insbesondere an Sonntagen geht in Deutschland immer weiter zurück. Professor Alexander Lerchl von der International University Bremen (IUB) analysierte über 700.000 Geburten zwischen 1988 und 2003 und verglich die Erhebungen mit älteren Daten. Verglichen mit dem Freitag, dem Wochentag mit den meisten Geburten, sind im Jahre 2003 über 26% weniger Kinder an Sonntagen zur Welt gekommen. Für Samstage sank die Anzahl um immerhin ca. 23%. "Dieser Trend begründet sich durch die zunehmende Anzahl an Geburten, die medikamentös eingeleitet werden sowie durch Kaiserschnitte. Diese ersetzen gegenüber früheren Jahren mehr und mehr die spontane Geburt", erklärte Lerchl. "Ursachen der Entwicklung sind vermutlich praktische und finanzielle Gesichtspunkte, denn Geburten an Wochenenden sind durch Zuschläge an Ärzte und Hebammen teurer." Oft werde den Müttern aus medizinischen Gründen zur künstlichen Einleitung der Geburt oder Kaiserschnitt geraten, dabei seien Risiken einer eingeleiteten Geburt nicht zu unterschätzen. Bluthochdruck der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Säugling könnten Nebenwirkungen sein. Aktuell sieht Lerchl zwar noch natürliche Geburten in der Überzahl, die Tendenz zur eingeleiteten Geburt sei jedoch deutlich.
Die Anzahl der Geburten an Wochenenden und insbesondere an Sonntagen geht in Deutschland immer weiter zurück. Professor Alexander Lerchl von der International University Bremen (IUB) analysierte über 700.000 Geburten zwischen 1988 und 2003 und verglich die Erhebungen mit älteren Daten. Verglichen mit dem Freitag, dem Wochentag mit den meisten Geburten, sind im Jahre 2003 über 26% weniger Kinder an Sonntagen zur Welt gekommen. Für Samstage sank die Anzahl um immerhin ca. 23%. "Dieser Trend begründet sich durch die zunehmende Anzahl an Geburten, die medikamentös eingeleitet werden sowie durch Kaiserschnitte. Diese ersetzen gegenüber früheren Jahren mehr und mehr die spontane Geburt", erklärte Lerchl. "Ursachen der Entwicklung sind vermutlich praktische und finanzielle Gesichtspunkte, denn Geburten an Wochenenden sind durch Zuschläge an Ärzte und Hebammen teurer." Oft werde den Müttern aus medizinischen Gründen zur künstlichen Einleitung der Geburt oder Kaiserschnitt geraten, dabei seien Risiken einer eingeleiteten Geburt nicht zu unterschätzen. Bluthochdruck der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Säugling könnten Nebenwirkungen sein. Aktuell sieht Lerchl zwar noch natürliche Geburten in der Überzahl, die Tendenz zur eingeleiteten Geburt sei jedoch deutlich.
Parallel zu diesen Beobachtungen gibt es seit geraumer Zeit auch Erkenntnisse über die immer weiter steigende Zahl von Kaiserschnitten auf Wunsch der Mütter. Nach Informationen des Sozialministeriums in Stuttgart hat die Zahl der Kaiserschnitte in den vergangenen 15 Jahren um mehr als die Hälfte zugenommen. In den Krankenhäusern Baden-Württembergs wurden im Jahre 2003 insgesamt 95 216 Frauen entbunden, darunter 25 574 mit Kaiserschnitt, 4 842 mithilfe der Saugglocke (Vakuumextraktion) und 715 mithilfe der Geburtszange. Möglicher Hintergrund: Fallpauschalen der Kliniken fördern den Trend. werde. Marianne Dirks, Vorsitzende des Hebammenverbandes Baden-Württemberg: "Für einen Kaiserschnitt bekommt ein Krankenhaus 3000 Euro vergütet - etwa doppelt so viel wie für ein normale Geburt." Zu Anfang der Schwangerschaft wünschen sich nur vier Prozent der Frauen einen Kaiserschnitt, erklärte Dirks. Viele Schwangere würden jedoch zunehmend im Laufe der Schwangerschaft verunsichert. In einem Bericht im Statistischen Monatsheft Baden-Württemberg "Immer mehr Kaiserschnitte bei immer weniger Geburten" finden sich viele weitere Details zu diesen Beobachtungen.
Im Forschungsprojekt "Technisierung der 'normalen' Geburt - Interventionen im Kreißsaal" wurden an der Universität Osnabrück Daten von mehr als einer Million Geburten analysiert. Das Fazit der Wissenschaftlerinnen Clarissa M. Schwarz und Beate A. Schücking heißt: "Eine Risikoschwangerschaft ist zur Regel geworden und eine normale Schwangerschaft zur Ausnahme. Unsere Studie bestätigt, dass drei von vier Schwangeren als "risikoschwanger" definiert werden und in unserem Gesundheitssystem nach wie vor die Tendenz besteht, die überzuversorgen, die es am wenigsten brauchen." Nach den Ergebnissen der Studie hat sich der Zustand der Neugeborenen jedoch nicht weiter verbessert. Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse findet sich hier: Adieu, normale Geburt? Ergebnisse eines Forschungsprojekts sowie in diesem Aufsatz: Selbstbestimmt und risikolos? Wunschkaiserschnitt
Gerd Marstedt, 7.10.2005