



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Websites"
Deutschland: Gesundheits- und Sozialstatistik |
Alle Artikel aus:
Websites
Deutschland: Gesundheits- und Sozialstatistik
Vom "Gesundheitsbericht für Deutschland" 1998 zum Bericht "Gesundheit in Deutschland" 2015: Die "weißen Flecken" werden weniger
 Nach seinen Vorgängern des Jahres 1998 und 2006 liegt nun seit November 2015 mit 516 Seiten Umfang der dritte Bericht "Gesundheit in Deutschland" vor und wird damit eine wichtige Grundlage für eine Fülle gesundheitsbezogener epidemiologischer, ökonomischer oder versorgungs- und gesundheitspolitischen Debatten der nächsten Jahre sein.
Nach seinen Vorgängern des Jahres 1998 und 2006 liegt nun seit November 2015 mit 516 Seiten Umfang der dritte Bericht "Gesundheit in Deutschland" vor und wird damit eine wichtige Grundlage für eine Fülle gesundheitsbezogener epidemiologischer, ökonomischer oder versorgungs- und gesundheitspolitischen Debatten der nächsten Jahre sein.
Dazu liefert der Bericht eine Fülle systematischer Sichtweisen und empirischer Daten in den Hauptabschnitten
• Wie steht es um unsere Gesundheit?
• Welche Faktoren beeinflussen die Gesundheit? (z.B. sozioökonomischer Status, Arbeit, Arbeitslosigkeit, Migration)
• Wie steht es um Prävention und Gesundheitsförderung?
• Wie haben sich Angebot und Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung verändert? (z.B. Versorgung nach Sektoren, Qualitätssicherung)
• Wie viel geben wir für unsere Gesundheit aus?
• Welche Bedeutung kommt Gesundheitszielen im Gesundheitswesen zu?
• Wie gesund sind die älteren Menschen?
• Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung?
• Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?
• und für LeserInnen mit wenig Zeit 11 Seiten: Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Der Bericht Gesundheit in Deutschland ist herausgegeben und koordiniert vom Robert Koch Institut (RKI) und Destratis Bestandteil der Gesundheitsberichterstattung des Bundes und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.3.16
Der Datenfriedhof ist mittlerweile ganz schön lebendig oder Routinedaten in der Gesundheitsforschung
 Seitdem in den 1970er Jahren personenbezogene Daten zur Soziodemografie, ausgewählten Charakteristika der gesundheitlichen Lage und der gesundheitlichen Versorgung wie Behandlung für die rund 90% der Bevölkerung, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert waren und sind, in elektronischer Form gespeichert werden, gab es Bemühungen, diesen Datenschatz nicht nur als Datenablage und für Abrechnungszwecke zu nutzen.
Seitdem in den 1970er Jahren personenbezogene Daten zur Soziodemografie, ausgewählten Charakteristika der gesundheitlichen Lage und der gesundheitlichen Versorgung wie Behandlung für die rund 90% der Bevölkerung, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert waren und sind, in elektronischer Form gespeichert werden, gab es Bemühungen, diesen Datenschatz nicht nur als Datenablage und für Abrechnungszwecke zu nutzen.
Welche Möglichkeiten und Aktivitäten es gab und gibt, fasst nun ein rund 130 Seiten umfassendes Gutachten einer Reihe von Routine- oder Sekundärdatenforscher aus Köln und Magdeburg zusammen.
Es enthält u.a.
• eine Beschreibung der Daten der Sozialversicherungsträger GKV, SPV, GRV und GUV
• die Darstellung der Daten der amtlichen Statistik inklusive der Forschungsdatenzentren und der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (z.B. Krankenhausstatistik, Todesursachenstatistik, Pflegestatistik, Schwerbehindertenstatistik sowie die Daten der Bundesanstalt für Arbeit
• eine Information über den Datenbeistand bei der Privaten Krankenversicherung
• eine kurze Darstellung der Datenbestände, die von einzelnen Akteuren oder Institutionen im Gesundheitswesen erhoben und gepflegt werden und die, sofern es sich um Primärerhebungen handelt, z.T. für Wissenschaftler für eine Sekundärnutzung zur Verfügung stehen (z.B. Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, Daten des DAPI (Deutsches Arzneimittelprüfinstitut), Daten des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus - InEK-Institut, Survey- und Paneldaten, Nationale Kohorte
• Information über die Umsetzung des Datentransparenzparagraphen und den Datenbestand nach §§ 303a-e SGB V und
• Hinweise auf datenschutzrechtliche Regelungen, die Leitlinie Gute Praxis Sekundärdatenanalyse sowie auf ausgewählte Aspekte des Datenmanagements und der Operationalisierung von Fragestellungen.
Das im Auftrag des "Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" erstellte Gutachten: Daten für die Versorgungsforschung. Zugang und Nutzungsmöglichkeiten von Ingrid Schubert et al. ist im Juli bzw. Oktober 2014 erschienen und kostenlos erhältlich.
Zu hoffen ist, dass nicht nur weitere NutzerInnen dieser Daten und Nutznießer der damit erhältlichen Erkenntnisse gewonnen werden, sondern deren Analysen auch dem dazu verfügbaren Stand des Wissens entsprechen.
Bernard Braun, 3.12.14
"Nichts ist unmöglich" oder SchülerInnenzahl in Pflegefachberufen nimmt zwischen 2007/08 und 2011/12 kräftig zu
 Zu den häufig als unvermeidbar oder unumkehrbar dargestellten und linear problematischer werdenden Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen gehört der Mangel an Fachkräften in den wichtigsten 17 gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufen. Die Brisanz solcher Prognosen ergibt sich hauptsächlich aus der ebenfalls als naturgegeben prognostizierten Zunahme kranker und pflegebedürftiger älteren Personen und die für den beruflichen Nachwuchs besonders unattraktiv charakterisierten und kommunizierten Arbeitsbedingungen in pflegerischen Berufen.
Zu den häufig als unvermeidbar oder unumkehrbar dargestellten und linear problematischer werdenden Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen gehört der Mangel an Fachkräften in den wichtigsten 17 gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufen. Die Brisanz solcher Prognosen ergibt sich hauptsächlich aus der ebenfalls als naturgegeben prognostizierten Zunahme kranker und pflegebedürftiger älteren Personen und die für den beruflichen Nachwuchs besonders unattraktiv charakterisierten und kommunizierten Arbeitsbedingungen in pflegerischen Berufen.
Eine Reihe von nationalen und international vergleichenden Studien zeigen allerdings, dass beide Trends nicht zwangsläufig oder zumindest nicht in dem dramatisierten Umfang eintreten müssen.
Eine am 17. Juli 2014 veröffentlichte Auswertung der Entwicklung der SchülerInnenzahl in Gesundheitsfachberufen zwischen 2007/08 und 2011/12 durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) liefert eine bemerkenswerte und zum Teil unerwartete Momentaufnahme für die Personalentwicklung.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten so:
• mit rund 187.000 Schülerinnen und Schülern im Jahr 2011/2012 im Vergleich zum Schuljahr 2007/2008 ist ein Anstieg um 5,9 % in allen nicht-akademischen Erstausbildungen der Gesundheitsfachberufe zu verzeichnen.
• Der Anteil der SchülerInnen in den drei Pflegeberufen "Altenpflege", "Gesundheits- und Krankenpflege" sowie "Gesundheits- und Kinderkrankenpflege" an allen SchülerInnen beträgt beinahe 66%.
• Zunahme der SchülerInnen für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege um 4,7 %, für Gesundheits- und Krankenpflege um 7,6 %, für RettungsassistentInnen um 21,6 %), für Podologen/zur Podologin um 29,7 % und für AltenpflegerInnen um 36,2%.
• Insbesondere bei den SchülerInnen für Altenpflege verstärkt sich die Zunahme sogar gegen Ende des Untersuchungszeitraums mit jährlich +5,3% sogar kräftig.
• Eine Abnahme der SchülerInnenzahlen gibt es dagegen bei den PhysiotherapeutInnen (-10,1 %), ErgotherapeutInnen (-23,7 %), MasseurInnen und medizinischen BademeisterInnen (-28,1 %) DiätassistentInnen (-42,2 %).
Die Entwicklung kommentiert der BIBB-Präsident so: "Wenn der momentane Trend sich verstetigt, besteht die Chance, dass wir den gerade in dieser Branche erwarteten Fachkräftemangel abmildern können". Ob dieser Kommentar nicht zu weit geht, werden die nächsten Jahre und vergleichbare Untersuchungen belegen müssen. Wenigstens an der Unvermeidbarkeit des Umfangs des Personalnotstands im Pflegebereich lässt sich aber mit diesen aktuellen Trends schon zweifeln.
Die als Heft 153 der "Wissenschaftlichen Diskussionspapiere" des BIBB erschienene Studie Gesundheitsfachberufe im Überblick von Maria Zöller et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
"Das wissenschaftliche Diskussionspapier fasst die Ergebnisse der statistischen Analysen der bundesrechtlich geregelten nicht-akademischen Ausbildungen in Gesundheitsfachberufen zusammen. Darüber hinaus werden Ansatzpunkte zur Modernisierung der Ausbildungen aufgezeigt. Ergänzend werden Forschungsprojekte und Publikationen des Bundesinstituts für Berufsbildung sowie Hinweise zu Portalen mit weiterführenden Informationen übersichtlich dargestellt. Abgerundet wird der Bericht durch eine aktuelle BIBB-Auswahlbibliografie zu Gesundheitsfachberufen."
Bernard Braun, 20.7.14
Keine Trendwende bei der Beschäftigungssituation von 55+-Personen - "Verbesserungen" bei gering entlohnten Teilzeitbeschäftigungen
 In den aktuellen Debatten über die Einführung und die Verhinderung des möglichen Missbrauchs der Altersrente ab 63 stellt die angesichts der demografischen Entwicklung notwendige und angeblich auch mögliche Beschäftigung von 55+-Personen ein wichtiges Argument dar. Wie die Situation für diese Altersgruppe wirklich aussieht und welche Chancen der Neueinstellung 55- bis 64-jährige Personen haben, untersucht seit einigen Jahren der "Altersübergangsreport" des "Instituts für Arbeit und Qualifikation" der Universität Duisburg/Essen im Auftrag der Hans Böckler Stiftung.
In den aktuellen Debatten über die Einführung und die Verhinderung des möglichen Missbrauchs der Altersrente ab 63 stellt die angesichts der demografischen Entwicklung notwendige und angeblich auch mögliche Beschäftigung von 55+-Personen ein wichtiges Argument dar. Wie die Situation für diese Altersgruppe wirklich aussieht und welche Chancen der Neueinstellung 55- bis 64-jährige Personen haben, untersucht seit einigen Jahren der "Altersübergangsreport" des "Instituts für Arbeit und Qualifikation" der Universität Duisburg/Essen im Auftrag der Hans Böckler Stiftung.
Die aktuelle Ausgabe 2/2014 dieses Reports fasst die Entwicklungen im Zeitraum 1993 bis 2010 folgendermaßen zusammen:
• "Entgegen der Annahme, dass angesichts einer steigenden Alterserwerbsbeteiligung auch die Eintrittsraten der Älteren gestiegen seien, lässt sich derzeit noch kein klarer Trend bei der Einstellungshäufigkeit von Älteren erkennen. Zwar nimmt die Anzahl der älteren neu Eingestellten zu, dem stehen aber demografisch bedingt und wegen längerer Erwerbsphasen steigende Zahlen an älteren Beschäftigten gegenüber.
• Die Altersungleichheit von Neueinstellungen ist in Großbetrieben besonders hoch: Dort werden anteilig mehr Jüngere als Ältere eingestellt. Gleichwohl ist in jeder Betriebsgrößenklasse, auch den Großbetrieben, die Altersungleichheit langfristig zurückgegangen.
• Neueinstellungen verhalten sich spiegelbildlich zur Beschäftigungsstabilität, d.h. sie kommen dort häufig vor, wo die Beschäftigungsstabilität niedrig ist. So sind beispielsweise die Eintrittsraten bei Teilzeitbeschäftigten und Frauen hoch und in Großbetrieben niedrig."
Offensichtlich muss weiterhin deutlich zwischen der beschäftigungs- und ruhestandspolitischen Rhetorik und der Wirklichkeit der Beschäftigungs- und Einkommenssituation der 55- bis 65-Jährigen unterschieden werden. Die u.a. mit der Teilzeitbeschäftigung verbundenen niedrigen Einkommen, wirken sich daher auch weiter negativ auf die Sozialabgaben und die Einnahmesituation der Sozialversicherungsträger aus.
Ausführliche Belege aus einem speziellen Datensatz mitr Individual- und Betriebsdaten enthält der Altersübergangsreport 2-2014 von Martin Brussig und Katarina Eggers, der komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 1.7.14
Wer viel Zeit hat, stellt sich Zeitreihen selber zusammen, wer weniger, schaut in "histat" nach.
 Wie viele Krankenhäuser gab es vor 1918 im deutschen Kaiserreich, wie entwickelte sich die Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeit nach 1883 mit dem gesetzlichen Start der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), wie entwickelt sich die Anzahl der Hauptschulabsolventen oder die der Nicht-Krankenversicherten seit Gründung der BRD - und vieles auch noch im internationalen Vergleich? Solche und noch jede Menge weiterer Fragen nach der zeitlichen Entwicklung sozial-, bildungs- oder wirtschaftspolitischer Kennzahlen hat man immer wieder und findet Antworten häufig nur nach zeitraubenden Recherchen in jeder Menge Originalliteratur.
Wie viele Krankenhäuser gab es vor 1918 im deutschen Kaiserreich, wie entwickelte sich die Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeit nach 1883 mit dem gesetzlichen Start der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), wie entwickelt sich die Anzahl der Hauptschulabsolventen oder die der Nicht-Krankenversicherten seit Gründung der BRD - und vieles auch noch im internationalen Vergleich? Solche und noch jede Menge weiterer Fragen nach der zeitlichen Entwicklung sozial-, bildungs- oder wirtschaftspolitischer Kennzahlen hat man immer wieder und findet Antworten häufig nur nach zeitraubenden Recherchen in jeder Menge Originalliteratur.
Seit 2004 und grundlegend überarbeitet seit 2012 gibt es zur Beantwortung solcher Fragen die Online-Datenbank "histat". Sie enthält zu den Schwerpunkten Bildung, Arbeit, Bevölkerung, Sozialstaat und vielen weiteren Themenbereichen auch zahlreiche Zeitreihen zum Bereich Gesundheit - darunter 3.001 Zeitreihen zum Heilpersonal und Krankenhauswesen 1950-1985 oder 1.205 Zeitreihen über die Basisdaten zur Entwicklung der Gesundheitsverhältnisse in Deutschland in den Jahren 1816 bis 2010. Insgesamt finden die derzeit rund 3.000 registrierten NutzerInnen 308.564 Zeitreihen mit 6.347.027 Werten, die aus über 360 einzelnen Studien zusammengestellt wurden.
Auf einige für eigene Recherchen und Datennutzung wichtigen Besonderheiten weisen deren Organisatoren aus dem Leibnizinstitut für Sozialwissenschaften "gesis" so hin: "histat bietet zu jeder Studie, aus der Daten angeboten werden, umfangreiche "Metainformationen" an: neben einer ausführlichen Studienbeschreibung auch detaillierte Hinweise zu den in der Studie verwendeten Quellen, zum Untersuchungsgebiet sowie weitere Anmerkungen. Diese Metadaten sind das Ergebnis vieler Jahre Arbeit des Teams Datenservice Historische Studien. Sämtliche Metadaten stehen allen Nutzerinnen und Nutzern mit einer komfortablen Suchfunktion kostenfrei und ohne Registrierung zur Verfügung. Da wir die Daten von unseren Datengeberinnen und Datengebern, oftmals schon vor vielen Jahren, unter bestimmten Weitergabe-Bedingungen erhalten haben, sind wir verpflichtet, die Nutzung dieser Daten zu belegen. Aus diesem Grund hatten wir mit dem Beginn der Bereitstellung der Daten 2004 eine Registrierung vorgesehen. Im Zeitalter von "open data" sollten Daten offen angeboten werden, wenn dem weder Datenschutz- noch Copyright-Probleme im Wege stehen. Wir werden daher sukzessive in den nächsten Monaten solche Daten frei anbieten, bei denen das unserer Ansicht nach unzweifelhaft möglich ist. Sie erkennen diese Studien daran, dass der Zugang zu den Daten nicht über ein orangenes, sondern über ein grünes Feld erfolgt. Der download solcher Daten wird ab sofort auch ohne vorherige Registrierung und Anmeldung möglich sein."
Wie aus dem Zitat hervorgeht, ist die Nutzung der Datenschätze zwar kostenlos, erfordert aber auf der Startseite von histat für den größten Teil eine persönliche Registrierung, die keine erkennbaren Nachteile (z.B. Werbesendungen) hat.
Bernard Braun, 12.6.14
Zwischen 14 und 20% aller abhängig Beschäftigten haben nach Einführung des Mindestlohns Anspruch auf Lohnerhöhung
 Die aktuelle Ausgabe des seit Jahren vom "Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ)" der Universität Esssen-Duisburg erarbeiteten Niedriglohnbeschäftigungs-Report für das Jahr 2012 zeigt, dass sich entgegen manchen interessierten Debatten das Niedriglohnproblem für die Betroffenen aber auch die einkommensabhängig finanzierten Sozialversicherungsträger keineswegs "im Aufschwung" erledigt hat.
Die aktuelle Ausgabe des seit Jahren vom "Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ)" der Universität Esssen-Duisburg erarbeiteten Niedriglohnbeschäftigungs-Report für das Jahr 2012 zeigt, dass sich entgegen manchen interessierten Debatten das Niedriglohnproblem für die Betroffenen aber auch die einkommensabhängig finanzierten Sozialversicherungsträger keineswegs "im Aufschwung" erledigt hat.
Auf der Basis der Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) präsentiert der Report u.a. folgende Daten:
• Im Jahr 2012 arbeiteten 24,3% aller abhängig Beschäftigten für einen Stundenlohn unterhalb der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle von 9,30 €. Diese Schwelle liegt bei zwei Drittel des mittleren Stundenlohns (Median) in Deutschland. Die Stundenlöhne wurden auf der Basis der Angaben zum Bruttomonatsverdienst und zur tatsächlich geleisteten Arbeitszeit berechnet. Es handelt sich demnach um die effektiven Stundenlöhne, die von vertraglich vereinbarten Stundenlöhnen abweichen können - etwa, wenn unbezahlte Mehrarbeit geleistet wurde.
• Die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten ist seit 1995 von 5,9 auf 8,4 Millionen im Jahr 2012 gestiegen, was einer Zunahme um rund 2,5 Millionen (bzw. 42,1%) entspricht. Der prozentuale Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung war in Westdeutschland weitaus höher als in Ostdeutschland.
• Der Anteil der Beschäftigten, die bei einem Mindestlohn von 8,50 € Anspruch auf eine Lohnerhöhung hätten, liegt je nach Berechnungsweise des Stundenlohns und der Grundgesamtheit zwischen 13,6% und 19,7% der abhängig Beschäftigten. Diese Anzahl von Beschäftigten würden daher auch etwas mehr an Sozialversicherungsabgaben zahlen - einen also nicht unerheblichen Betrag.
• Nicht zuletzt wegen dieser Zahlen warnen die Autoren vor einer quantitativ relevanten Ausdehnung der Ausnahmen vom Mindestlohn und fürchten andernfalls einen Wettbewerb zwischen Mindestlohn- und Nicht-Mindestlohngruppen bei den Beschäftigten. Außerdem würde durch die dann notwendigen Kontrollen ein sehr hoher Verwaltungsaufwand entstehen, den dann die jetzt Verantwortlichen wieder dem Mindestlohn anhängen und dessen Finanzierung an anderer Stelle Mangel erzeugt.
Der Report 2/2014 des IAQ Niedriglohnbeschäftigung 2012 und was ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € verändern könnte von Thorsten Kalina und Claudia Weinkopf ist 15 Seiten lang und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.3.14
Datenreport 2013: Ein "Sozialatlas über die Lebensverhältnisse in Deutschland" jenseits von Wahlkampfphrasen und Kopflangertum
 Passend zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsgehalt des Mantras von Angela Merkel und der Mehrheit der so genannten Wirtschaftsweisen (z.B. in der Zeit vom 21. November 2013: "Deutschland geht es gut. Die Beschäftigung nimmt seit Jahren zu … zudem wird oft der falsche Eindruck geweckt, die Ungleichheit der Einkommen habe jüngst stark zugenommen und viele Beschäftigten lebten in prekären Verhältnissen: Die verfügbaren Einkommen sind jedoch deutlich weniger ungleich verteilt als noch im Jahr 2005."), noch nie habe es so viele Beschäftigte gegeben und damit glückliche und zufriedene, auf jeden Fall nicht-arme BürgerInnen in Deutschland, erschien wie bereits in den Vorjahren der renommierte "Datenreport 2013. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland".
Passend zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsgehalt des Mantras von Angela Merkel und der Mehrheit der so genannten Wirtschaftsweisen (z.B. in der Zeit vom 21. November 2013: "Deutschland geht es gut. Die Beschäftigung nimmt seit Jahren zu … zudem wird oft der falsche Eindruck geweckt, die Ungleichheit der Einkommen habe jüngst stark zugenommen und viele Beschäftigten lebten in prekären Verhältnissen: Die verfügbaren Einkommen sind jedoch deutlich weniger ungleich verteilt als noch im Jahr 2005."), noch nie habe es so viele Beschäftigte gegeben und damit glückliche und zufriedene, auf jeden Fall nicht-arme BürgerInnen in Deutschland, erschien wie bereits in den Vorjahren der renommierte "Datenreport 2013. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland".
In diesem vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), dem Statistischen Bundesamt und der Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) herausgegebenen und u.a. auf der Basis des Sozioökonomischen Panels erarbeiteten Report sieht die bundesdeutsche Sozialwelt aktuell und leider auch seit einiger Zeit etwas anders aus.
Aus der Fülle der Daten und Analyseergebnisse sind z.B. folgende Aspekte besonders wichtig:
• Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zwar in der Tat 2012 auf das Allzeit-Hoch von 41,5 Millionen gestiegen. Das Arbeitsvolumen, d.h. die Anzahl der geleisteten und bezahlten Stunden ist aber nicht nur nicht gestiegen, sondern nimmt seit Jahren stetig ab, ohne dass dies Folge einer tarifvertraglichen Arbeitszeitverkürzung gewesen wäre. Wichtigste Ursache: Die enorm zunehmende Teilzeitarbeit.
• Zugenommen hat zwischen 2007 und 2011 aber auch der Anteil der armutsgefährdeten Personen (an der Gesamtbevölkerung von 15,2% auf 16,1%. Besonders betroffen sind die 55- bis 64-Jährigen, unter denen dieser Anteil 2011 nach einer Zunahme von drei Prozentpunkten bei 20,5% lag. Als arm gelten in diesem Report Personen, die 2011 weniger als monatlich 980 Euro zur Verfügung hatte.
• Für die soziale Situation der Betroffenheit aber auch der einkommensabhängigen Beiträge dieser Personen zu den diversen gesetzlichen Sozialversicherungen ist besonders kritisch, dass sich die Armutsgefährdung bei vielen dieser Personen zu einem Dauerzustand entwickelt hat. Waren im Jahr 2000 "nur" 27% der damals Armutsgefährdeten auch bereits in den 5 Jahren davor arm gewesen, lag dieser Anteil 2011 bei 40%.
• Eine für die arme Bevölkerung noch wesentlich drastischere Folge ihrer Situation ist die für die Lebenserwartung. Auch wenn es sich auch hier um keinen im strengen Sinn kausalen Zusammenhang handelt, haben arme Männer und Frauen gegenüber nichtarmen BürgerInnen ein 2,7-fach bzw. 2,4-fach erhöhtes Sterberisiko. In Lebensjahren: Arme Männer sterben im Durchschnitt fast elf Jahre vor nichtarmen Männern. Die Differenz beträgt bei Frauen noch rund acht Jahre.
• Auf der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Datenreports führte einer der Herausgeber noch einen weiteren Punkt an: Die gerade zitierten "Differenzen gelten auch in der sogenannten ferneren Lebenserwartung ab einem Alter von 65 Jahren. Hier beträgt die Differenz bei den Männern 5,3 Jahre und bei Frauen 3,5 Jahre. Überspitzt könnte man diese Befunde treffend so charakterisieren: Arme sterben früher. Das liegt natürlich nicht an der Einkommenslage an sich, sondern daran, dass mit steigenden Einkommen in aller Regel auch steigende materielle, kulturelle und soziale Ressourcen verbunden sind. Solche Ressourcen sind als Mechanismen zu verstehen, mit physischen und psychischen Belastungen im Lebensverlauf besser 'umzugehen'".
• Auch das "Risiko, einen weniger guten oder schlechten allgemeinen Gesundheitszustand zu haben, ist bei Männern aus der armutsgefährdeten Gruppe im Verhältnis zu Männern aus der hohen Einkommensgruppe um den Faktor 3,2 erhöht, bei Frauen beträgt das entsprechende Verhältnis 2,2:1. Daneben kann gezeigt werden, dass Männer und Frauen, die von Armut betroffen sind, in fast allen Altersgruppen deutlich häufiger stark übergewichtig (adipös) sind als Männer und Frauen in höheren Einkommensgruppen."
Eine knappe Übersicht über einige der vielen wichtigen Ergebnisse des Reports und Links auf mehrere Herausgeber-Statements gibt es als WZB-Pressemitteilung vom 26.11.2013 kostenlos.
Wer an allen anderen Inhalten auf den 432 Seiten des Datenreports 2013 interessiert ist, kann ihn komplett kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 26.11.13
Die Lichtseite eines Teils der oft beklagten Dokumentationsarbeit im Krankenhaus: Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik 2011
 Auch wenn unter den Bedingungen der Arbeitsverdichtung und des spezifischen Personalmangels in Krankenhäusern alle dort Beschäftigten über die patientenfernen Dokumentationsarbeiten verständlicherweise klagen, wird auf dieser Basis eine facettenreiche Gesundheitsberichterstattung über das stationäre Versorgungsgeschehen erstellt.
Auch wenn unter den Bedingungen der Arbeitsverdichtung und des spezifischen Personalmangels in Krankenhäusern alle dort Beschäftigten über die patientenfernen Dokumentationsarbeiten verständlicherweise klagen, wird auf dieser Basis eine facettenreiche Gesundheitsberichterstattung über das stationäre Versorgungsgeschehen erstellt.
Zu den jährlichen Veröffentlichungen zählt die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik, deren Ausgabe für das Jahr 2011 am 25. Oktober erschienen ist.
Zu den wesentlichen Ergebnissen zählen die folgenden Angaben:
• Im Jahr 2011 wurden insgesamt 17,7 Mill. Patientinnen und Patienten aus der vollstationären Krankenhausbehandlung entlassen. Dies waren 1,6 % mehr als im Jahr zuvor. 53,1 % der Behandelten waren weiblich, 46,9 % männlich. Im Durchschnitt waren die Patientinnen und Patienten 55 Jahre alt (Frauen 54 Jahre, Männer 55 Jahre).
• Die durchschnittliche Verweildauer in den Einrichtungen lag bei 6,7 Tagen und nahm im Vergleich zum Vorjahr weiter um 0,1 Tage ab.
• Bei 52,5 % der Fälle erfolgte der Krankenhausaufenthalt aufgrund der Einweisung durch einen Arzt und bei 40,4 % aufgrund eines Notfalls. Die Behandlung wurde bei 87,6 % der Patientinnen und Patienten regulär beendet. In 2,1 % der Fälle wurde die Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet.
• Die meisten Behandlungsfälle gab es in der Fachabteilung Innere Medizin.
• Je Krankenhausfall wurden durchschnittlich 2,8 Operationen und medizinische Prozeduren erbracht. Insgesamt summierte sich dies zu rund 49 Millionen Operationen und medizinische Prozeduren auf. Die Zunahme gegenüber 2010 belief sich auf 4,2%.
• Auch wenn es mittlerweile fast 1.200 abrechenbare DRGs gibt (am Anfang standen etwas über 400) gibt machen 2% aller DRGs rund ein Viertel des gesamten vollstationären Leistungsspektrums aus. Die zwanzig häufigsten DRGs deckten 23% und die fünfzig häufigsten DRGs 39 % des gesamten DRG-Leistungsspektrums ab.
• Die Versorgung gesunder Neugeborener (528.422 Fälle), die Speiseröhrenentzündung, Magen-Darm-Entzündung oder verschiedene Krankheiten der Verdauungsorgane (448.994 Fälle) und die Entbindungen ohne komplizierende Diagnose (313.364 Fälle) waren im Jahr 2011 die insgesamt am häufigsten abgerechneten DRGs.
• Die Häufigkeit der Hauptdiagnosegruppen veränderte sich gegenüber dem Jahr 2010 zum Teil kräftig - ohne, dass die Statistik-Fachserie Erklärungen liefert. So nahm die Gruppe der Polytrauma um 8,1 % zu, die der infektiösen und parasitären Krankheiten um 6,9 % ebenso wie die Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten mit +6,4 %. Abgenommen haben die Fälle mit den Diagnosen endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (-6,6 %), HIV (-2,7 %) und Neugeborene (-2,5 %).
Der als Fachserie Fachserie 12 Reihe 6.4 des Statistischen Bundesamtes jährlich veröffentlichte Statistikband "Gesundheit. Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) Diagnosen, Prozeduren, Fallpauschalen und Case Mix der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern 2011" ist eine Fundgrube für viele weiteren Informationen zum stationären Versorgungsgeschehen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.12
Nicht nur für Landeskinder und Medizinalstatistiker: Landesgesundheitsbericht 2011 des Landes Nordrhein-Westfalen
 Die Zeiten als Gesundheitsberichte der Landesministerien oder des öffentlichen Gesundheitsdienstes problemfreie Medizinalstatistik-Datenwüsten waren, sind erfreulicher Weise vorbei. Stattdessen gibt es zunehmend von epidemiologisch und gesundheitswissenschaftlich qualifizierten ExpertInnen verfasste, fundierte problemorientierte Darstellungen der gesundheitlichen Verhältnisse als soziale Verhältnisse.
Die Zeiten als Gesundheitsberichte der Landesministerien oder des öffentlichen Gesundheitsdienstes problemfreie Medizinalstatistik-Datenwüsten waren, sind erfreulicher Weise vorbei. Stattdessen gibt es zunehmend von epidemiologisch und gesundheitswissenschaftlich qualifizierten ExpertInnen verfasste, fundierte problemorientierte Darstellungen der gesundheitlichen Verhältnisse als soziale Verhältnisse.
Ein anregendes Beispiel ist der gerade erschienene "Landesgesundheitsbericht 2011" für das Land Nordrhein Westfalen, der unter der Leitung des Düsseldorfer Allgemeinmediziners und Versorgungsforschers Heinz Harald Abholz erstellt wurde.
Zu den auch außerhalb von NRW interessanten Ergebnissen zählen u.a. die folgenden verständlich formulierten und gut illustrierten Erkenntnisse:
• In der Debatte über die Folgen des demografischen Wandels ist die Feststellung wichtig, dass nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Zahl der gesunden Lebensjahre, hier gemessen an der durchschnittlichen Lebenszeit, die eine Person frei von Behinderungen höheren Grades (> 50 %) verbringen kann. Dabei nahm in den Jahren 2000 bis 2009 die beschwerdefreie Lebenszeit sogar stärker zu als die Zeit der mittleren Lebenserwartung: "Der Gewinn an Lebensjahren geht also mit einem Gewinn an Gesundheit einher und relativiert so die immer wieder öffentlich formulierten Befürchtungen, dass mit dem Älterwerden der Bevölkerung pauschal eine mehr oder weniger zwangsläufige Zunahme von Krankheiten, Behandlungsbedarf und Kosten im Gesundheitswesen verbunden sei."
• Die AutorInnen sehen angesichts der auch im Bericht erkennbaren Zunahme multimorbider Patientinnen und Patienten das Ideal einer an evidenzbasierten Leitlinien orientierten Versorgung an Grenzen stoßen. Die damit verbundenen Herausforderungen sehen so aus:"Leitlinien richten sich bisher auf die Behandlung einer Erkrankung und können im Falle des Auftretens von mehreren Erkrankungen nicht einfach additiv eingesetzt werden. Weitere Erkrankungen stellen oft Kontraindikationen zu dem dar, was zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung vorgegeben wird."
• An eine besonders problematische Grenze stößt der Versuch multimorbide Menschen additiv zu behandeln auf dem Gebiet der Medikation: "Mit der Zahl der verordneten Medikamente sinkt tendenziell die Möglichkeit der Kontrolle von Wechsel- und Nebenwirkungen. Zugleich ist mit dem Auftreten von Nebenwirkungen und der Einschränkung der individuellen Lebensqualität die sog. Therapietreue der Patientinnen und Patienten gefährdet." Zu den von Polypharmazie betroffenen Personen zählen insbesondere ältere PatientInnen. Der Vorschlag auch und gerade wegen des u.a. für die Polypharmazie verantwortlichen Nebeneinanders mehrerer Ärzte den Hausazt stärker zu einer koordinierenden Stelle aufzuwerten, ist eine Möglichkeit hier Abhilfe zu schaffen. Dies erfordert aber nach allem was über die Qualität der Hausärzte bekannt ist, noch eine wesentliche Verbesserung ihrer kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten.
• Für den bereits angesprochenen Demografiediskurs sind auch die Angaben zur Entwicklung von Morbidität und Mortalität im Alter von großer Bedeutung. Was dabei Berichte wie der vorliegende leisten können, zeigen die folgenden Argumente zur Krebsmortalität exemplarisch: "2010 starben etwas mehr als 50.000 Personen an Krebs, darunter 23.300 Frauen und 27.200 Männer. Mit rund einem Viertel aller Todesfälle bleiben die bösartigen Neubildungen nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten insgesamt die zweithäufigste Todesursache. Da viele Krebsarten erst im höheren Alter auftreten, ist mit dem Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung auch zukünftig eine anhaltend hohe bzw. eventuell sogar steigende Zahl von Krebstoten und ein hoher Anteil der Krebserkrankungen an allen Todesursachen verbunden. Diese auf den ersten Blick alarmierende Prognose ist allerdings tendenziell irreführend, wenn es darum geht, das allgemeine Risiko einer vorzeitig zum Tode führenden Krebserkrankung zu beurteilen. Denn seit Jahrzehnten sinkt die altersstandardisierte Krebssterblichkeit kontinuierlich ab - allein in den vergangenen zehn Jahren für Frauen insgesamt um etwa 10 % und für Männer sogar um 16 %."
• Erfrischend unaufgeregt und differenziert sind auch die vorgestellten Daten zu den Schuleingangsuntersuchungen: "2009 waren insgesamt rund 7.000 Kinder in NRW (4,3 % der Mädchen und 4,6 % der Jungen) zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung als adipös einzustufen (Referenzwerte nach Kromeyer-Hauschild). Dementsprechend befindet sich im Durchschnitt in jeder ersten Grundschulklasse mindestens ein adipöses Kind, dazu kommen jeweils noch etwa zwei übergewichtige Kinder. Seit einigen Jahren bleiben die Prävalenzen für Übergewicht und Adipositas im Einschulungsalter stabil. Auffällig sind allerdings regionale Unterschiede mit der Tendenz zu mehr adipösen Kindern im Bereich des Ruhrgebiets und angrenzender Regionen."
• Und schließlich nimmt der Bericht auch ausgesprochene Eisen in die Hand, die weit über das Selbstverständnis und den engen Zuständigkeitshorizont der traditionellen Landesgesundheitsberichterstattung hinaus gehen. Ausgangspunkt ist ein positiv bewerteter Rückgang der Hormontherapie für post-menopausale Frauen. Trotzdem liegt die aktuelle Verordnungspraxis immer noch über dem Niveau anderer europäischer Länder, wie etwa den Niederlanden. Hinzu kommt, dass über 60 % der Anwenderinnen die Hormontherapie länger als 3 Jahre fortführen. Die VerfasserInnen des Berichts bewerten diesen Zustand als eine Über- bzw. Fehlversorgung. Zu den Ursachen dieser unerwünschten Behandlungssituation und zum "ob" und "wie" einer Änderung des Zustands führt der Bericht Folgendes aus: "Es hat sich gezeigt, dass die Anwendungsdauer der Hormontherapie bei der Mehrzahl der Frauen als viel zu lang eingestuft werden muss. Hierfür gibt es verschiedene Gründe: Zum einen verordnen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte zu lange, zum anderen erscheint die Risikoaufklärung noch immer nicht ausreichend und schließlich fehlt eine wirksame Unterstützung beim Absetzen der Präparate. Hierzu bedarf es Anlaufstellen, die neutral und evidenzbasiert informieren bzw. beraten können und die die Frauen aktiv bei den Problemen der Wechseljahre begleiten und unterstützen. Dies scheint unerlässlich, wenn man bedenkt, dass es Frauen schwer zu fallen scheint, die einmal begonnene Einnahme von Hormonpräparaten wieder zu beenden. Für die Gesundheit der Frauen wie auch für das Gesundheitswesen insgesamt scheint es derzeit das Beste zu sein, wenn mit einer Hormontherapie erst gar nicht begonnen wird, da ein gewisses Abhängigkeitspotenzial offenbar nicht ausgeschlossen werden kann."
Der "Landesgesundheitsbericht 2011. Informationen zur Entwicklung von Gesundheit und Krankheit in Nordrhein-Westfalen" wurde im Auftrag des .Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW von Heinz-Harald Abholz (Universität Düsseldorf) und sieben weiteren WissenschaftlerInnen verschiedener Universitäten und wissenschaftlichen Mitarbeitern landeseigener Einrichtungen verfasst und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.3.12
"vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens" zum sechzehnten Mal erschienen!
 Bereits in der 16. Auflage, und immer leserlicher geworden, sind gerade die "vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2011 / 2012" erschienen. Auf 64 Seiten fassen die AutorInnen meist weit verstreute aber in mancher gesundheitspolitischen oder -wissenschaftlichen Diskussion "irgendwie" zusammenhängend benötigten Daten kompakt zusammen. Dort wo es wichtig ist, liefern die Basisdaten auch Zeitreihen, die zum Teil bis 2010 reichen.
Bereits in der 16. Auflage, und immer leserlicher geworden, sind gerade die "vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2011 / 2012" erschienen. Auf 64 Seiten fassen die AutorInnen meist weit verstreute aber in mancher gesundheitspolitischen oder -wissenschaftlichen Diskussion "irgendwie" zusammenhängend benötigten Daten kompakt zusammen. Dort wo es wichtig ist, liefern die Basisdaten auch Zeitreihen, die zum Teil bis 2010 reichen.
Bei den Themenblöcken handelt es sich um
• Bevölkerung (z.B. Geburten- und Sterbefälle, Lebenserwartung bei der Geburt)
• Versicherte (z.B. Pflichtmitglieder/freiwillige Mitglieder/Rentner, PKV-Versichertenstruktur,ganz aktuell: PKV-GKV-Wanderungsbewegungen)
• Einnahmen (u.v.a. Gesundheitsfonds-Funktionsweise, Finanzierungssäulen der GKV)
• Ausgaben nach Versorgungssektoren und Krankenkassen (z.B. auch das immer diskutierte Thema Verwaltungsanteile bei GKV und PKV, Zuzahlungen)
• Soziale Pflegeversicherung.
Den positiven Gesamteindruck stört höchstens, dass der "Verband der Ersatzkassen" unbedingt meint, auch hier wettbewerbspolitische Watschen austeilen zu müssen. Für ihn steht nämlich fest: "Die Verteilungskriterien nach dem Morbi-RSA sind immer wieder Anlass für Kritik. So erhalten manche Kassenarten wie z. B. die AOKen mehr Zuweisungen aus dem Fonds, als sie für die Versorgung ihrer Versicherten tatsächlich benötigen, andere Kassenarten wie die Ersatzkassen weisen eine Unterdeckung auf. Hier sind Korrekturen erforderlich, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden." Egal, ob dies so undifferenziert stimmt, hat es in einer Basisdatensammlung nichts zu suchen, und für ein angemessenes inhaltliches Verstehenkönnen, müsste es dann sowieso schon noch mehr Informationen geben.
Eine PDF-Version der vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2011/2012 gibt es kostenlos auf der Website des Verbandes.
Bernard Braun, 21.1.12
Sozial-"Datenreport 2011": Zunahme von gesundheitlicher Ungleichheit zwischen Gering- und Vielverdienern seit den 1990er Jahren
 Auch 2011 ist einer der Klassiker einer umfassenden Sozialberichterstattung in Deutschland (vgl. dazu auch den Forums-Bericht über den "Datenreport 2008") erschienen.
Auch 2011 ist einer der Klassiker einer umfassenden Sozialberichterstattung in Deutschland (vgl. dazu auch den Forums-Bericht über den "Datenreport 2008") erschienen.
Der alle zwei Jahre vom Statistischen Bundesamt, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) herausgegebene Bericht beruht im Wesentlichen auf Erhebungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, auf Daten des Mikrozensus, einer jährlich durchgeführten Haushaltsstichprobe, an der ein Prozent der Privathaushalte in Deutschland teilnehmen und den langjährigen Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP).
Zu den Oberthemen des Datenreports gehören die Bevölkerung, Familie/Lebensformen und Kinder, Bildung, Wirtschaft und öffentlicher Sektor, Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit, Einkommen/Ausgaben/Ausstattung privater Haushalte, Sozialstruktur und soziale Lagen, Wohnverhältnisse und Wohnkosten, öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung, Räumliche Mobilität und regionale Unterschiede, Umwelt und Nacvhhaltigkeit, Freizeit und gesellschaftliche Partizipation, Demokratie und politische Partizipation, subjektives Wohlbefinden und Wertorientierungen, Deutschland in Europa sowie Gesundheit und soziale Sicherung.
Neben den schon immer dargestellten Eckdaten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung und den Ressourcen der Gesundheitsversorgung oder den Einstellungen zur Gesundheit und dem gesundheitsbezogenen Verhalten enthält der neueste Report erstmals auch Daten zum Thema gesundheitliche Ungleichheit in der erwachsenen Bevölkerung
Zunächst werden anhand der klassischen Ungleichheitsdimensionen Einkommen, Bildung und Berufsstatus Ungleichheiten in der gesundheitlichen Lage und im Gesundheitsverhalten aufgezeigt. Im Anschluss werden Bezüge zu Arbeitslosigkeit und zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund hergestellt. Eine abschließende Betrachtung der Entwicklung gesundheitlicher Ungleichheiten im Verlauf der letzten 15 Jahre rundet den Beitrag ab.
Wesentliche Erkenntnisse lauten beispielsweise so:
• Die Unterschiede bei der Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes - einem wichtigen und validen Gesundheitsindikator - haben zwischen den Angehörigen der unteren und oberen Einkommensgruppe in den letzten Jahren fast durchweg zugenommen: "Für die 18- bis 64-jährige Bevölkerung zeigt sich im Vergleich von drei Beobachtungszeiträumen (1994 bis 1999, 2000 bis 2005 und 2006 bis 2009), dass in der niedrigen Einkommensgruppe der Anteil der Männer und Frauen, die ihren allgemeinen Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht beurteilen, im Verlauf der letzten 15 Jahre zugenommen hat. In der hohen Einkommensgruppe und bei Frauen auch in der mittleren Einkommensgruppe ist eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Bezüglich des Risikos eines weniger guten oder schlechten allgemeinen Gesundheitszustandes lässt sich nach Kontrolle des Alterseinflusses die Aussage treffen, dass die Differenz zwischen der niedrigen und hohen Einkommensgruppe bei Männern um 46% und bei Frauen um 39 % zugenommen hat." (257)
• Auch der "objektive" Gesundheitsindikator, nämlich die Häufigkeit mit der viele Krankheiten und Beschwerden in der Bevölkerung vorkommen, belegt ein vermehrtes Erkrankungsrisiko bei Personen mit geringem Einkommen, unzureichender Bildung und niedriger beruflicher Stellung. So treten bei Menschen mit niedrigem Einkommen in der Altersgruppe ab 45 Jahre Herzinfarkte, Schlaganfälle, Hypertonie, Diabetes oder Depressionen häufiger auf.
• Selbst wenn sich eine Komponente des gesundheitlichen Verhaltens insgesamt positiv entwickelt, wie zum Beispiel die körperliche-sportliche Aktivität, zeigen sich signifikante Ungleichheiten: "Für die Sportbeteiligung ist im Zeitraum 1994 bis 2009 eine deutliche Zunahme festzustellen. Dabei fällt auf, dass in der Altersspanne von 18 bis 44 Jahren der Anteil der Männer und Frauen, die in den letzten vier Wochen keinen Sport getrieben haben, in allen Bildungsgruppen abgenommen hat. Bei Personen mit hoher Bildung zeichnet sich diese Entwicklung aber noch deutlicher ab als bei Personen mit mittlerer und nied riger Bildung. Nach Kontrolle des Alterseffektes kann die Zunahme des Risikos für sportliche Inaktivität im Vergleich der niedrigen zur hohen Bildungsgruppe bei Männern mit 61 % und bei Frauen mit 72 % beziffert werden." (258)
• Als Ursachen und Gründe der ungleichen Gesundheitsrisiken verweisen die AutorInnen an vorderster Stelle "auf den Tabak- und Alkoholkonsum, die Ernährung und körperlich-sportliche Aktivität sowie zum Teil auch die Inanspruchnahme von Präventions- und Versorgungsangeboten." (258) Diesem stark individuellen und verhaltensorientierten Erklärungsversuch folgt zwar noch der Hinweis auf den eher kollektiven und verhältnisorientierten Einflussfaktor der Arbeitslosigkeit, die sie in materieller wie psychosozialer Sicht "mit einer schlechteren Gesundheit assoziiert" sehen. Was leider fehlt, sind sowohl theoretische Hinweise wie auch empirische Belege für weitere soziale Determinanten von Gesundheit wie die Bildungs- oder auch Weiterbildungschancen, die so genannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse oder die Diskriminierung von älteren Erwerbsfähigen oder auch Rentnerinnen in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Leben.
Der 451 Seiten umfassende zweibändige Datenreport 2011. Ein Sozialbericht fur die Bundesrepublik Deutschland und damit auch das von Thomas Lampert, Lars Eric Kroll Benjamin Kuntz und Thomas Ziese verfasste Kapitel über "Gesundheitliche Ungleichheit" sind weiterhin für deutsche Verhältnisse vorbildlich komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.10.11
Gleichstellungsbericht: Nachteile für individuelle Verwirklichungschancen und die künftige soziale Sicherheit von Frauen.
 Ganz so schwer zu finden, wie die Süddeutsche Zeitung am 17.Juni 2011 unkte, ist der "Erste Gleichstellungsbericht" für die Bundesrepublik Deutschland im Internet zwar nicht, aber bequem ist er aus Sicht des Auftraggebers Bundesregierung mit Sicherheit nicht.
Ganz so schwer zu finden, wie die Süddeutsche Zeitung am 17.Juni 2011 unkte, ist der "Erste Gleichstellungsbericht" für die Bundesrepublik Deutschland im Internet zwar nicht, aber bequem ist er aus Sicht des Auftraggebers Bundesregierung mit Sicherheit nicht.
Neben den Sachbereichen Gleichstellungspolitik in der Lebensverlaufsperspektive (und nicht mehr Lebensphasenperspektive), Rollenbilder und Recht, Zeitverwendung, Alter und Bilanzierung des Lebensverlaufs sowie Bildung befasst sich der 332 Seiten umfassende Bericht auch mit Fragen der Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen.
Dort werden die folgenden nicht nur gleichstellungspolitischen sondern auch für die Finanzierung der Sozialversicherungsträger relevanten Trends angesprochen:
• "Zwar ist die Erwerbstätigenquote von Frauen in (West-)Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, kaum jedoch - wie in fast allen anderen europäischen Ländern - ihre Erwerbsbeteiligung gemessen in Vollzeitäquivalenten. Die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen hat sich überwiegend auf der Basis einer steigenden Zahl kleiner Arbeitsverhältnisse und einer Umverteilung des Erwerbsvolumens unter Frauen vollzogen. Durch diese Fragmentierung weiblicher Beschäftigungsverhältnisse ist ein Großteil der Frauen trotz eigener Erwerbstätigkeit von einer eigenständigen Existenzsicherung noch weit entfernt."
• "Der Unterschied in den Stundenlöhnen zwischen Männern und Frauen ist mit etwa 23 % so hoch wie in kaum einem anderen europäischen Land. Frauen haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko wie Männer, niedrig entlohnt zu werden. Der Anteil der gering bezahlten Frauen lag 2007 bei 29,3 % gegenüber 13,8 % bei Männern. Aufgrund der höheren Betroffenheit sind mehr als zwei Drittel aller Niedriglöhner in Deutschland Frauen. Frauen sind zudem besonders von Niedrigstlöhnen mit Stundenlöhnen unter 5 oder 6 Euro betroffen. Zusätzlich sind die Chancen für Frauen, aus dem Niedriglohnsektor in eine besser bezahlte Tätigkeit aufzusteigen, signifikant geringer als für Männer. Nur ein Teil dieser Geschlechterdifferenz bei den Löhnen" lässt sich durch Unterschiede bei den Ausstattungsmerkmalen, wie z.B. Qualifikationen, Erwerbserfahrung oder Branchenzugehörigkeit, erklären. Nach wie vor umfasst die Lohnlücke auch einen - schwer zu quantifizierenden - Anteil an Diskriminierung."
• "Der Grundsatz "gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit" ist bisher nicht flächendeckend umgesetzt. - Teilzeitarbeit als weibliche Domäne hat sich inzwischen stark ausdifferenziert und ist unterschiedlich zu bewerten. Sozialversicherungspflichtige Teilzeit wird von vielen Frauen (bisher selten von Männern) gewünscht und stellt sich für bestimmte Lebensphasen als geeignetes Vereinbarkeitsinstrument dar - insbesondere, wenn sie mit Rückkehroptionen auf eine Vollzeittätigkeit verbunden ist."
• "Als besondere erwerbsbiografische "Falle" für Frauen zeigt sich dagegen das politisch geförderte Segment der Minijobs. Kurzfristig mag die Aufnahme eines Minijobs wegen der Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse über den Ehepartner und des Erhalts des Einkommensvorteils infolge des Ehegattensplittings vorteilhaft sein. In der Lebensverlaufsperspektive erweisen sich Minijobs jedoch häufig als Sackgasse, da der Übergang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schwierig ist. Zudem ist eine eigenständige Existenzsicherung in der Erwerbs- und Nacherwerbsphase auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung, die zudem zu über 85 % nur mit einem Niedriglohn entgolten wird, unmöglich."
• "Viele der in den letzten Jahren entstandenen zusätzlichen Arbeitsplätze im Bereich sozialer und personenbezogener Dienstleistungen sind als Helferinnen-, Assistentinnen- und Zuverdienerinnen-Stellen konzipiert. Sie sind aufgrund herkömmlicher Arbeitsplatzbewertungen tendenziell mit schlechten Verdienstmöglichkeiten ausgestattet. Hinzu kommt, dass die Entlohnung gerade in Dienstleistungsbranchen mit hohen Frauenanteilen in den letzten 15 Jahren zunehmend von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt wurde."
Die bisher genannten Bedingungen sind nicht "nur" schlecht für die aktuellen individuellen Verwirklichungschancen der Frauen, sondern stellen auch eine "volkswirtschaftlich bedenkliche Vergeudung von Ressourcen dar, die vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels nicht tragfähig ist." Sie tragen außerdem in erheblichem Maße zur Erosion der Einnahmesituation der über einkommensabhängige Beiträge finanzierten Sozialversicherungsträger bei.
Die Gutachter sprechen sich daher u.a. dafür aus, die Sonderstellung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen abzuschaffen, die Fehlanreize für Unternehmen und Beschäftigte abzuschaffen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in wenig zukunftsträchtige, aktuell aber steuer- und sozialabgabenfreie Minijobs aufzuteilen: "Ziel muss es daher sein, alle Erwerbsverhältnisse sozialversicherungspflichtig zu machen."
Das im Januar 2011 dem Ministerium überreichte Gutachten der Sachverständigenkommission Neue Wege - Gleiche Chancen Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf. Erster Gleichstellungsbericht von Ute Klammer, Marion Schick, Gerhard Bosch, Cornelia Helfferich, Tobias Helms, Uta Meier-Gräwe, Paul Nolte, Margarete Schuler-Harms und Martina Stangel-Meseke, samt einer Vielzahl von ExpertInnen zu einzelnen Themen ist auf der Website des "Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend" kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.6.11
Absenkung der Arbeitskosten durch Senkung der Sozialbeiträge für Geringverdiener schafft keine Arbeitsplätze, sondern Probleme!
 Die Einkommensabhängigkeit der Beiträge zur Sozialversicherung und die Erhebung von Beiträgen bereits bei niedrigen Einkommen förderte seit dem ersten Auftreten von Massenlosigkeit und vor allem von Langzeitarbeitslosigkeit Überlegungen, die Beschäftigungschancen dieser Personengruppe durch die Absenkung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen im unteren Einkomnmensbereich zu verbessern. Dies war auch mit der Hoffnung verbunden, dass sich an diesen (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt eine bessere und besser bezahlte Weiterbeschäftigung anschließt. In diesem Fall käme es zu einer "win-win-win"-Situation für Sozialversicherungen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Den vorübergehend geringeren Sozialbeitragseinnahmen bei Renten- und Krankenversicherung stünden z.B. bald höhere Beitragssummen von höheren Einkommen gegenüber. Das höhere "netto vom brutto" bei den Arbeitnehmern wäre ein wichtiger Beleg dafür, dass sich auch diese einfache Einstiegstätigkeit lohnt. Und die Arbeitgeber hätten endlich die Entlastung von den angeblich zu hohen Lohnnebenkosten und könnten Arbeitsplätze schaffen.
Die Einkommensabhängigkeit der Beiträge zur Sozialversicherung und die Erhebung von Beiträgen bereits bei niedrigen Einkommen förderte seit dem ersten Auftreten von Massenlosigkeit und vor allem von Langzeitarbeitslosigkeit Überlegungen, die Beschäftigungschancen dieser Personengruppe durch die Absenkung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen im unteren Einkomnmensbereich zu verbessern. Dies war auch mit der Hoffnung verbunden, dass sich an diesen (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt eine bessere und besser bezahlte Weiterbeschäftigung anschließt. In diesem Fall käme es zu einer "win-win-win"-Situation für Sozialversicherungen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Den vorübergehend geringeren Sozialbeitragseinnahmen bei Renten- und Krankenversicherung stünden z.B. bald höhere Beitragssummen von höheren Einkommen gegenüber. Das höhere "netto vom brutto" bei den Arbeitnehmern wäre ein wichtiger Beleg dafür, dass sich auch diese einfache Einstiegstätigkeit lohnt. Und die Arbeitgeber hätten endlich die Entlastung von den angeblich zu hohen Lohnnebenkosten und könnten Arbeitsplätze schaffen.
Ob die temporäre Senkung der Sozialversicherungsbeiträge im unteren Einkommensbereich aber wirklich nur Gewinner kennt, war und ist umstritten. Ein im Auftrag der Friedrich-Ebertstiftung erstelltes Gutachten gibt auf einer breiten empirischen Basis und durch die rechnerische Simulation der Verteilungseffekte etc. verschiedener Modelle ein paar klare Antworten.
Zu den wichtigsten Hinweisen, Daten und Schlussfolgerungen des Gutachtens zählen:
• Der Hinweis, dass in dem auch für die Sozialbeitragssenkung relevanten Niedriglohnsektor mittlerweile eine immer noch leicht wachsende Anzahl von Beschäftigten tätig ist - rund 20%. Es geht also eigentlich gar nicht mehr um atypische Beschäftigung, sondern um einen quantitativ gewichtigen Bereich von Normalbeschäftigung.
• Die Feststellung, dass bei den Senkungskonzepten offen bleibt, wie der Verlust an Einnahmen kompensiert wird. Wenn es nicht zu Leistungskürzungen kommen soll, muss der Staat durch Zuschüsse aus dem Steuerhaushalt die Lücken füllen. Woher oder von wem der Staat aber die zusätzlichen Steuereinnahmen bekommt, bleibt offen. Kommt es aber zu Leistungskürzungen gehören dieselben Personen, deren Sozialbeiträge abgesenkt oder sogar gestrichen werden, zu den Hauptverlierern.
• Selbst wenn dies alles doch noch sozial abgefedert werden kann, kommen die Gutachter aber zu dem zentralen Ergebnis, dass die weitere Absenkung der Arbeitskosten, sei es durch die Senkung der Sozialabgaben oder zum wesentlich kleineren Teil durch Senkung der steuerlichen Belastungen, nicht zu dem erhofften Mehr an auch noch besser bezahlten Beschäftigung führt.
• Mittel- und langfristig kommt es nicht nur zu keiner "win-win-win"-Situation, sondern sogar zu "lose-lose"-Effekten. Die beiden Autoren fassen dies so zusammen: "Zudem steht zu erwarten, dass geringfügige Beschäftigungsverhältnisse vor allem auf Seiten der Unternehmen an Attraktivität gewinnen werden, weil die Abgabenquote mit 10 Prozent deutlich niedriger als beim derzeitigen Status quo ausfällt. Insofern spricht viel für die Annahme, dass es bei einer tatsächlichen Umsetzung dieses Progressivmodells zu einer erheblichen Zunahme des Angebotes an geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen kommen wird. Wenn in diesem Zuge vormals sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse (Beschäftigungsverhältnisse über 400 Euro) verlorengehen, ist zu befürchten, dass sich die kalkulierbaren Einnahmeminderungen sogar noch verschärfen und das Modell zur Kostenfalle zu werden droht." (64)
• Auch hier stellt sich die Frage warum stattdessen nicht über die lange Reihe von Methoden diskutiert wird, die bereits seit Jahrzehnten als zusätzliche Finanzierungsquellen und Grundlagen für eine mögliche Senkung der prozentualen Beiträge bekannt sind: eine Erhöhung der Bruttolöhne, die flächendeckende Einführung von Mindestlöhnen, Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze.
Das 72 Seiten umfassende, sehr materialreiche Gutachten Progressive Sozialversicherungsbeiträge. Entlastung der Beschäftigten oder Verfestigung des Niedriglohnsektors? von Gerhard Bäcker und Andreas Jansen von der Universität Duisburg-Essen ist im Mai 2011 erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.6.11
OECD: Einkommensungleichheit wächst - Deutschland an der Spitze - "Wegheiraten" keine Lösung und der Ruf nach Regierungstransfers.
 Ausgerechnet die in der Vergangenheit nicht gerade sozialkritische OECD hat für ein Treffen der Sozialminister der OECD-Mitgliedsländer am 2. Mai 2011 eine aktuelle Analyse zu den auch aus ihrer Sicht für den sozialen und wirtschaftlichen Frieden nachteiligen zwischen Mitte der 1980er und den späten 2000er Jahren zugenommenen Einkommensunterschiede in der Mehrzahl der Mitgliedsländer erstellt.
Ausgerechnet die in der Vergangenheit nicht gerade sozialkritische OECD hat für ein Treffen der Sozialminister der OECD-Mitgliedsländer am 2. Mai 2011 eine aktuelle Analyse zu den auch aus ihrer Sicht für den sozialen und wirtschaftlichen Frieden nachteiligen zwischen Mitte der 1980er und den späten 2000er Jahren zugenommenen Einkommensunterschiede in der Mehrzahl der Mitgliedsländer erstellt.
Aktuell ist im OECD-Durchschnitt das durchschnittliche Einkommen der reichsten 10% der Bevölkerung über neun Mal so hoch wie das der einkommensärmsten 10%.
Dahinter verbergen sich aber unterschiedliche Ländertrends:
• In den Ländern, die schon bisher eine hohe Einkommensungleichheit hatten, wie z.B. den USA oder Israel, erweitert sich die Lücke sogar nochmals besonders kräftig. In Israel betrug z.B. die jährliche Veränderungsrate in dem untersuchten Zeitraum für die ärmsten 10% minus 1,1%, die der reichsten 10% aber plus 2,4%.
• In Ländern wie Chile, Mexiko oder der Türkei verringerte sich dagegen die Einkommenslücke.
• Schließlich stellte die OECD fest, dass die Bevölkerung in Ländern wie Dänemark, Schweden oder eben auch Deutschland nicht länger vor wachsender Einkommensungleichheit bewahrt geblieben ist. Fakt ist, dass die Ungleichheit in diesen Ländern sogar am stärksten zugenommen hat. Während die Differenz der jährlichen Einkommenszuwächse in den beiden Extremgruppen der Einkommensverteilung in der 29 Länder umfassenden OECD 0,6 Prozentpunkte betrug, erreichte dieser Unterschied in Deutschland 1,5 Prozentpunkte (Zunahme in der ärmsten Gruppe 0,1% und Zunahme in der reichsten Gruppe 1,6%) und in Schweden sogar 2 Prozentpunkte.
Zu den wichtigsten Gründen der wachsenden Einkommensungleichheit rechnet die OECD vor allem die nachlassende Wirkung steuer- und sozialpolitischer Mittel um die sogar noch wesentlich größere so genannte Markt-Einkommensungleichheit abzumildern. In einigen Ländern nahm im letzten Jahrzehnt die redistributive Wirkung von Steuern und Sozialausgaben sogar ab. Der Hinweis auf die Wichtigkeit von "government transfers … in cash and in-kind" für die Absicherung der unteren Einkommensgruppen vor dem weiteren Absturz ihrer Einkommen ist richtig und für die früher oft marktgläubige OECD sogar ungewohnt radikal. Trotzdem kommen bei den verantwortlichen Akteuren die Wirtschaftsunternehmen, die ja schließlich maßgeblich und primär die Höhe der Einkommen ihrer Beschäftigten bestimmen, nicht wirklich oder prominent vor.
Mit dieser allerdings gravierenden Einschränkung ist der OECD trotzdem zuzustimmen, wenn sie als staatliche oder gesellschaftliche Maßnahmen zum Abbau der Einkommensungleichheiten empfiehlt, die Zugangsmöglichkeiten zur Beschäftigung für einige soziale Gruppen zu verbessern, den hohen Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse ("non-standard forms of employment") wie Teilzeitarbeit, Minijobs oder befristete Arbeitsverträge zu reduzieren, bessere Weiterbildungsangebote für gering Qualifizierte anzubieten ("up-skilling") oder auch die schulische Ausbildung von Grund auf zu verbessern.
Schließlich zerstört die OECD aber auch noch eine besonders "nette" Hoffnung wie Ungleichheit abgebaut werden könnte, auf die man allerdings auch erst einmal kommen muss. Es geht darum, ob mindestens die Einkommensungleichheiten zwischen Haushalten nicht durch die Heirat von Personen mit hohen und niedrigen Einkommen eingeebnet werden könnten.
Nur leider sieht die Heiratsrealität genau umgekehrt aus: Nicht Ärzte heiraten Krankenschwestern, sondern dann schon lieber Ärztinnen. Vor 20 Jahren waren es 33% aller Ehepartner in der OECD, die im selben Berufs- und Einkommensbereich arbeiteten (das so genannte "assortative mating"), 2010 bereits 40%. Hinzu kommt, dass die Beschäftigungsrate der Ehepartner mit Spitzenverdienst sogar am stärksten angestiegen ist. So nahm die Haushaltseinkommen-Ungleichheit sogar besonders kräftig zu.
Der 14 Seiten umfassende OECD-Bericht Growing Income Inequality in OECD Countries: what drives it and how can policy tackle it? ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.5.11
Mehr Frauen erwerbstätig aber mit sinkender Arbeitszeit - deutscher "Sonderweg": Ein notwendiger Nachtrag.
 Wenn es darum geht, dass 9 Millionen der überhaupt erwerbstätigen Frauen aktuell in Teilzeit arbeitet (vgl. dazu z.B. diesen Bericht im "Forum-Gesundheitspolitik"), und um die problematischen Folgen für die finanzielle Situation dieser Frauen und die geringeren Beiträge zu Kranken- und anderen Sozialversicherungen, wird oft behauptet, die Frauen wollten ja gar nicht länger arbeiten.
Wenn es darum geht, dass 9 Millionen der überhaupt erwerbstätigen Frauen aktuell in Teilzeit arbeitet (vgl. dazu z.B. diesen Bericht im "Forum-Gesundheitspolitik"), und um die problematischen Folgen für die finanzielle Situation dieser Frauen und die geringeren Beiträge zu Kranken- und anderen Sozialversicherungen, wird oft behauptet, die Frauen wollten ja gar nicht länger arbeiten.
Dass es sich dabei um einen der vielen Mythen im deutschen Sozialsystem handelt, zeigen nun die Ergebnisse einer vom "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit durchgeführten Analyse der bevölkerungsrepräsentativen Befragungsdaten des Sozioökonomischen Panels (SOEP).
Dabei ergab sich folgendes Bild:
• "Der Anteil der Frauen an den Beschäftigten hat seit 1991 um 5,7 Prozentpunkte zugenommen. Damit war 2010 die Hälfte aller Beschäftigten weiblich. Im gleichen Zeitraum stieg ihr Anteil am Arbeitsvolumen um 4,5 Prozentpunkte und lag 2010 bei nur 43 Prozent." (IAB)
• Die Hälfte der teilzeitbeschäftigten Frauen gab bei den Befragungen an, dass sie ihre vereinbarte Arbeitszeit gerne ausweiten würde.
• Insbesondere die geringfügig beschäftigten Frauen sowie die Frauen, welche regelmäßig Überstunden leisten, haben Verlängerungswünsche.
• Frauen, die gerne länger arbeiten wollen, haben oft eine niedrige berufliche Qualifikation und ein unterdurchschnittliches Einkommen.
• Frauen in Ostdeutschland und junge Frauen im Alter von 25 bis 34 Jahren wünschten sich häufiger eine längere Wochenarbeitszeit.
• Im Schnitt würden regulär teilzeitbeschäftigte Frauen ihre vereinbarte Wochenarbeitszeit gerne um vier Stunden erhöhen. Geringfügig beschäftigte Frauen würden gerne neun Stunden länger arbeiten
• Wenn alle Verlängerungswünsche berücksichtigt werden könnten, würde sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Frauen um 2,6 Stunden auf rund 32 Stunden erhöhen. Hochgerechnet entspräche dies einem Arbeitsvolumen von 40,5 Millionen Stunden wöchentlich, umgerechnet in Vollzeitäquivalente wären dies circa eine Millionen Vollzeitarbeitsplätze.
• Die Autorin des Studienberichts weist schließlich darauf hin, dass die Zahl der Arbeitnehmerinnen seit 1991 zwar um 16 Prozent zugenommen hat, das Arbeitsvolumen von Frauen in derselben Zeit jedoch nur um vier Prozent gestiegen ist. Damit werde heute ein etwas höheres Arbeitsvolumen von deutlich mehr weiblichen Beschäftigten erbracht als früher.
Der acht Seiten umfassende IAB-Kurzbericht 9/2011 Ungenutzte Potenziale in der Teilzeit Viele Frauen würden gerne länger arbeiten von Susanne Wanger ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.5.11
Frauen zurück an den Herd? Zur Empirie der Einnahmenschwäche der GKV.
 Immer wenn keine der sonstigen "Gesundheitspolitik-Säue" durch das Mediendorf getrieben wird, wie etwa die "Lohnnebenkosten" oder die "demographische Bedrohung", müssen schon mal die meist weiblichen Ehepartner von GKV-Mitgliedern als Grund für Finanz- und andere Probleme der GKV herhalten. Sind sie nicht erwerbstätig, geht es um die im Wesentlichen familienpolitisch induzierte beitragsfreie Mitversicherung in der GKV bei vollem Leistungsumfang. Und sind sie erwerbstätig, sind es die meist geringen Beiträge wiederum bei vollem Leistungsumfang. Dass dafür die trotz jahrelanger Kritik stabile und auch schon mehrmals im forum-gesundheitspolitik dargestellte "gender pay gap" verantwortlich ist, d.h. die rund 25 % betragende Einkommenslücke zwischen erwerbstätigen Männern und Frauen mit vergleichbaren Arbeitsqualitäten, fällt bei dieser Art von "Treibjagden" meist unter den Tisch. Noch weniger Aufmerksamkeit findet aber, ob für die trotz Erwerbstätigkeit geringen Beiträge nicht auch der geringe Umfang der regelmäßigen Arbeitszeiten von Müttern verantwortlich ist.
Immer wenn keine der sonstigen "Gesundheitspolitik-Säue" durch das Mediendorf getrieben wird, wie etwa die "Lohnnebenkosten" oder die "demographische Bedrohung", müssen schon mal die meist weiblichen Ehepartner von GKV-Mitgliedern als Grund für Finanz- und andere Probleme der GKV herhalten. Sind sie nicht erwerbstätig, geht es um die im Wesentlichen familienpolitisch induzierte beitragsfreie Mitversicherung in der GKV bei vollem Leistungsumfang. Und sind sie erwerbstätig, sind es die meist geringen Beiträge wiederum bei vollem Leistungsumfang. Dass dafür die trotz jahrelanger Kritik stabile und auch schon mehrmals im forum-gesundheitspolitik dargestellte "gender pay gap" verantwortlich ist, d.h. die rund 25 % betragende Einkommenslücke zwischen erwerbstätigen Männern und Frauen mit vergleichbaren Arbeitsqualitäten, fällt bei dieser Art von "Treibjagden" meist unter den Tisch. Noch weniger Aufmerksamkeit findet aber, ob für die trotz Erwerbstätigkeit geringen Beiträge nicht auch der geringe Umfang der regelmäßigen Arbeitszeiten von Müttern verantwortlich ist.
Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse einer Untersuchung aus dem "Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ)" der Universität Duisburg-Essen zu den beruflichen Arbeitszeiten verheirateter Mütter in den Jahren 2000 und 2007 fasst die Autorin so zusammen: Mütter arbeiten heute zwar etwas häufiger, aber deutlich weniger Stunden pro Woche als noch im Jahr 2000. Vor allem der Anteil der vollzeitbeschäftigten Mütter ist zurückgegangen.
Auf der Basis von amtlichen Mikrozensusdaten stellt die IAQ-Arbeitsmarktforscherin Christine Franz zunächst fest, dass westdeutsche Frauen durchschnittlich je nach Alter ihrer (minderjährigen) Kinder ein Wochenpensum zwischen 6,3 und 19,1 Arbeitsstunden haben. Selbst die Mütter der 15- bis 17-Jährigen stehen damit dem Arbeitsmarkt nur mit halber Kraft zur Verfügung und verdienen entsprechend wenig.
In Ostdeutschland arbeiten zwar schon die Mütter von 3- bis 5-Jährigen durchschnittlich 20 Wochenstunden, aber auch hier steigt der Wert nur auf 25 Stunden bei Frauen mit fast volljährigen Kindern. "Der Vergleich von 2000 zu 2007 zeigt, dass die Arbeitsvolumina in fast allen Altersgruppen gesunken sind", so die Wissenschaftlerin.
Erwartungsgemäß hoch ist unabhängig vom Alter ihrer Kinder dagegen die Erwerbsbeteiligung der west- wie ostdeutschen Männer. So arbeiteten 2007 nur ca. 3 bis 4 % der westdeutschen Väter Teilzeit.
Ob es sich bei der niedrigen Erwerbsbeteiligung von Müttern und ihrer dann sogar noch schrumpfenden Arbeitszeit um das Resultat freiwilliger Entscheidungen der Frauen oder um Wirkungen entsprechender Arbeitsmarkt- und Geschlechterpolitik oder gesellschaftlicher Einstellungen handelt, kann mit den Daten des Mikrozensus nicht beantwortet werden.
• Der anhaltende Mangel an dann auch noch bezahlbaren Krippen-, Kindergarten-, Betriebskindergarten- und Ganztagsschulplätzen,
• die zögerliche Verbreitung betrieblicher Programme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
• die im Vergleich zu Ländern wie Schweden weiterhin viel zu gering entwickelte und spürbare Kultur der Frauengleichberechtigung
• und speziell noch die Arbeitsmarktbedingungen in Ostdeutschland
deuten allerdings darauf hin, dass politische Rahmenbedingungen einen erheblichen Teil des hier identifizierten Arbeitszeit- und damit Beitragstrends beeinflussen. Dass diese Bedingungen auch wesentlich für die ebenfalls meist nur den individuellen Entscheidungen der Frauen und ihren Partnern zugewiesene geringe Kinderhäufigkeit verantwortlich sind, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Die bisher nur vorliegende Pressemitteilung zu der Studie mit einer Reihe Grafiken von Christine Franz ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.4.11
"Statistisches Jahrbuch 2010" für Deutschland kostenlos erhältlich
 Auch für 2010 gibt es die 745 Seiten des "Statistischen Jahrbuchs" des Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland als PDF-Dokument zum Herunterladen und zur persönlichen Nutzung.
Auch für 2010 gibt es die 745 Seiten des "Statistischen Jahrbuchs" des Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland als PDF-Dokument zum Herunterladen und zur persönlichen Nutzung.
Zu nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen findet sich eine Fülle von statistischen Angaben, die zusammen genommen ein facettenreiches Bild der sozialen, demografischen, wirtschaftlichen, qualifikatorischen, politischen und natürlich auch gesundheitlichen Verhältnisse in Deutschland liefern.
Im rund 30-seitigen Gesundheitsteil finden sich etwa Angaben zum Gesundheitszustand, zum gesundheitsrelevanten Verhalten wie etwa zu den Rauchgewohnheiten, zur Körpergröße, zum Körpergewicht und zum Body-Mass-Index, zur Anzahl der Sterbefälle und den Todesursachen, der Anzahl und der Art von Schwangerschaftsabbrüchen, zu wichtigen Indikatoren der stationären Versorgung und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, zu den Gesundheitsausgaben, zum Gesundheitspersonal und zu den direkten Krankheitskosten.
Im Kapitel "Unternehmen" liefert das "Jahrbuch" für 2007 auch Angaben zu den Einnahmen von Arztpraxen. Dort erfährt man beispielsweise, dass die rund 96.000 Arztpraxisinhaber (angesichts der aktuellen Debatten und vorläufig gescheiterten Bemühungen über den Ausstieg der Hausärzte aus dem "Kassensystem" "immerhin" oder "nur"?) 71 % ihrer Einnahmen aus ihrer Tätigkeit als Kassenarzt beziehen, 25,9 % aus der Behandlung von privat krankenversicherten Patienten und 3,1 % aus sonstigen Tätigkeiten stammen. Von den durchschnittlich 294.000 € Bruttoeinnahmen verblieb jedem Praxisinhaber nach Abzug aller Praxiskosten, also auch der eigenen Krankenversicherung ein Reinertrag oder Nettoeinkünfte von 48.300 €.
Im Anhang des "Jahrbuchs" finden sich schließlich für eine Auswahl von Indikatoren auch internationale Angaben.
Das "Statistische Jahrbuch 2010" ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.1.11
Trotz Aufschwung: Auch 2010 stagniert die Bruttolohnquote als eine Basis der GKV-Einnahmen auf dem erreichten niedrigen Niveau
 Wie die Entwicklung der Lohneinkommen als einer Grundlage für die einkommensbezogene Finanzierung der GKV und anderer Sozialversicherungsträger aussieht, illustriert der aktuelle Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung.
Wie die Entwicklung der Lohneinkommen als einer Grundlage für die einkommensbezogene Finanzierung der GKV und anderer Sozialversicherungsträger aussieht, illustriert der aktuelle Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung.
Neben vielen anderen verteilungspolitisch relevanten Erkenntnissen, belegt der Bericht mit amtlichen Daten folgende Verhältnisse:
• Die Bruttolohnquote, d.h. der Anteil der Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zur Sozialversicherung am Volkseinkommen fiel zwischen 1991 und 2008 von 71 % auf 65,4 %. 2009 stieg sie unter dem Einfluss der krisendämpfenden arbeitspolitischen Aktivitäten (z.B. Intensivierung der Kurzarbeit und Auflösung von Arbeitszeitkonten) entgegen dem sonstigen wirtschaftlichen Trend auf 68,4 %. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der Rückkehr der alten Verteilungsnormalität in Deutschland, fiel die Bruttolohnquote aber bereits im ersten Halbjahr wieder auf 65,5 % zurück.
• Strukturbereinigt, d.h. ohne den Effekt der veränderten Erwerbstätigenstruktur in den Untersuchungsjahren bewegte sich die Bruttolohnqoute im selben Zeitraum von 71 % auf 64,7 %. Die Basis für prozentuale Beiträge wird also auch nach der Krise nicht größer werden, sondern wahrscheinlich noch etwas kleiner.
• Ein interessanter Beleg für das Thema "Aufschwung-Gewinner": Die Bruttogewinnquote stieg von 1991 bis zum 1. Halbjahr 2010 von 29 % auf 34,5 %..
• Die Nettolohnquote, also das was vom Bruttoeinkommen nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen übrigbleibt, sank vor und nach der Krise noch deutlicher: Der Betrag fiel von 1991 mit 48,1 % (oder nach einer anderen Berechnungsmethode 40,3 %) auf 40,9 % (34,3 %) im Jahr 2008, stieg aus den genannten Gründen 2009 auf 41,1 % (35,7 %) und fiel dann im 1. Halbjahr 2010 sogar auf 39,4 % (34 %).
• Auch ohne dass z.B. die neuen Zusatzbeiträge in der GKV, die Praxisgebühr, die konstant bleibenden Zuzahlungen zu rund 75 % der GKV-Leistungen oder die Eigenleistungen für Gesundheitsausgaben, die nicht mehr von der GKV bezahlt werden dabei eingerechnet sind, stieg die Belastung der Bruttoeinkommen durch Sozialbeiträge von 14,3 % (1991) auf 18,2 % (1. Halbjahr 2010).
• Die Belastung von Gewinn- und Vermögenseinkommen durch Pflicht- und freiwillige Beiträge stieg im selben Zeitraum von 3,1 % über den zwischenzeitlichen Spitzenbetrag von 3,7 % (1997) auf 3,4 %.
Der faktenreiche Aufsatz "Zukunftsgefährdung statt Krisenlehren - WSI-Verteilungsbericht 2010" von Claus Schäfer ist in den WSI-Mitteilungen 12-2010 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.12.10
8% Lohnkluft zwischen Männern und Frauen von insgesamt 23 % ist Ungleichbehandlung Gleicher oder Diskriminierung
 Jetzt wollte auch das Statistische Bundesamt bzw. das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend genau wissen was Andere schon vor längerem geklärt hatten: Warum verdienen Frauen in Deutschland so häufig weniger als Männer? Liegt dies an strukturellen Gründen wie der unterschiedlichen Qualifikation oder Bereitschaft und Möglichkeit, sich mit betrieblichen Bedingungen zu arrangieren oder werden gleich gut qualifizierte Frauen "einfach" massiv benachteiligt? Es nutzte dazu die Daten der Verdienststrukturerhebung des Jahres 2006.
Jetzt wollte auch das Statistische Bundesamt bzw. das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend genau wissen was Andere schon vor längerem geklärt hatten: Warum verdienen Frauen in Deutschland so häufig weniger als Männer? Liegt dies an strukturellen Gründen wie der unterschiedlichen Qualifikation oder Bereitschaft und Möglichkeit, sich mit betrieblichen Bedingungen zu arrangieren oder werden gleich gut qualifizierte Frauen "einfach" massiv benachteiligt? Es nutzte dazu die Daten der Verdienststrukturerhebung des Jahres 2006.
Im Untersuchungsjahr 2006 betrug der so genannte "Gender Pay Gap" 23 % zu Ungunsten der erwerbstätigen Frauen. Während Frauen im Jahr 2006 einen Bruttostundenlohn von 13,91 Euro erzielten, belief sich der Durchschnittsverdienst der Männer auf 17,99 Euro.
Rund zwei Drittel dieses Unterschieds sind auf strukturell verschiedene arbeitsplatzrelevante Merkmale zurückzuführen, wie die sich deutlich von den Männern unterscheidende Berufs- und Branchenwahl (erklären 4 Prozentpunkte der Lohnkluft), die Führungsbereitschaft und Qualifikation (erklären 5 Prozentpunkte), die höhere Bereitschaft bzw. der wegen familiären Bedingungen vorhandene Zwang Teilzeit zu arbeiten und die Beschäftigung in geringfügigen Tätigkeiten (erklärt 2 Prozentpunkte).
8% der Lohnkluft treten aber auch dann auf, wenn Männer und Frauen die gleiche Tätigkeit ausübten, über einen äquivalenten Ausbildungshintergrund verfügten, in einem vergleichbar großen privaten bzw. öffentlichen Unternehmen tätig wären, das auch regional ähnlich zu verortet ist (Ost/West; Ballungsraum/kein Ballungsraum), einer vergleichbaren Leistungsgruppe angehörten, einem ähnlich ausgestalteten Arbeitsvertrag (befristet/unbefristet; mit/ohne Tarifbindung, Altersteilzeit ja/nein, Zulagen ja/nein) unterlägen, das gleiche Dienstalter und die gleiche potenzielle Berufserfahrung aufwiesen sowie einer Beschäftigung vergleichbaren Umfangs (Vollzeit/Teilzeit) nachgingen.
Auch wenn die Vorzeichen der gegenwärtigen Gesundheitspolitik auf einkommensunabhängiger Finanzierung stehen, spielt der hier genauer quantifizierte und qualifizierte Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen im Bereich der einkommensabhängigen Beitragsfinanzierung z.B. der GKV eine gewichtige Rolle. Auch dieser Teil der Einnahmenschwäche der GKV ist also sozial oder politisch vermeidbar.
Das ungleiche Bild zeigt u.a. noch die folgenden Facetten:
• "Bei zusätzlicher Berücksichtigung des Alters ergaben die Auswertungen, dass sich der Unterschied im Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern mit dem Übergang von einer Altersklasse zur nächsten sukzessiv erhöht. Insbesondere in den Altersklassen, in denen die Familienplanung einsetzt, ließ sich ein deutlicher Anstieg des Gender Pay Gap feststellen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass gerade diese Phase bei Frauen häufig durch schwangerschafts- und erziehungsbedingte Erwerbsunterbrechungen sowie eine anschließende Reduzierung der Arbeitszeit bestimmt wird."
• Insbesondere bei Wirtschaftsprüfern bzw. Steuerberatern (44 %) und Geschäftsfüh- rern (37 %), aber auch bei Verkäufern (31 %), Bankkaufleuten (30 %) sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern (28 %) fällt der Gender Pay Gap überdurchschnittlich hoch aus. Die Tatsache, dass es die Lücke auch bei Frauen in Leitungspositionen gibt (größer als 25%), also in Tätigkeiten mit einer gewissen Machtfülle, unterstreicht die Beobachtung, dass Frauen prinzipiell nicht offensiv genug auf einem mit Männern vergleichbaren Einkommen bestehen. Bei Kassierern (sieben Prozent), Krankenschwestern bzw. -pflegern, Kellnern (jeweils sechs Prozent) und Köchen (drei Prozent) ließen sich hingegen nur geringe Unterschiede im Bruttostundenverdienst beobachten.
• Eine mit knapp 16 % eher unterdurchschnittliche Lohnspreizung zwischen Männern und Frauen ließ sich für Beschäftigte mit Tarifbindung konstatieren. Bei den Arbeitnehmern, die keiner derartigen Bindung unterliegen, fällt der Gender Pay Gap mit rund 30 % annähernd doppelt so hoch aus. Neben vergleichsweise geringen Unterschieden in der Leistungsgruppenstruktur, stellt auch die Existenz von Arbeitnehmervertretungen einen möglichen Erklärungsansatz für den eher geringen Verdienstabstand der Beschäftigten mit Tarifbindung dar.
Die Vermutung, dass die möglicherweise durch Diskriminierung erklärbare Lohnkluft von 8 % noch kleiner würde, wenn weitere Determinanten der Verdiensthöhe mitberücksichtigt würden, wird hoffentlich in weiteren Studien untersucht werden.
Der im Oktober 2010 erschienene, 91 Seiten umfassende Projektbericht "Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen 2006" des Statistischen Bundesamtes ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.10.10
9 Jahre ambulante Versorgung und Gesundheitspolitik aus Versichertensicht: "Gesundheitsmonitor"-Daten frei zugänglich!
 Hat sich die Bewertung der Zukunft der sozialen Krankenversicherung im Laufe der letzten 9 Jahre verändert und wirkten sich die großen Gesundheitsreformgesetze daraif aus? Gibt es Ost-West-Unterschiede, wenn es darum geht, ob die Solidarausgleiche im GKV-System für gerecht gehalten werden? Wo informieren sich Angehörige unterer sozialen Geschichten vorrangig über gesundheitsbezogene Angelegenheiten? Wie schnell verbreitet sich Informationen zum Inhalt der Gesundheitsreformen in der Bevölkerung und gibt es Gruppen, bei denen davon nichts ankommt?
Hat sich die Bewertung der Zukunft der sozialen Krankenversicherung im Laufe der letzten 9 Jahre verändert und wirkten sich die großen Gesundheitsreformgesetze daraif aus? Gibt es Ost-West-Unterschiede, wenn es darum geht, ob die Solidarausgleiche im GKV-System für gerecht gehalten werden? Wo informieren sich Angehörige unterer sozialen Geschichten vorrangig über gesundheitsbezogene Angelegenheiten? Wie schnell verbreitet sich Informationen zum Inhalt der Gesundheitsreformen in der Bevölkerung und gibt es Gruppen, bei denen davon nichts ankommt?
Wer nach bevölkerungsrepräsentativen Antworten auf diese oder eine Vielzahl ähnlicher Fragen sucht, die etwas mit der Inanspruchnahme ambulanter Versorgung im Gesundheitssystem, der Zukunft des sozialen Krankenversicherungssystem und der Bewertung von Reformoptionen im Gesundheitssystem zu tun haben, und wer dann noch wissen will, ob sich an den Antworten und Bewertungen in den letzten Jahren etwas verändert hat, findet seit Jahren in den jährlichen Buchausgaben des "Gesundheitsmonitors" der Bertelsmann Stiftung und den regelmäßig veröffentlichten "Newsletter"-Ausgaben eine Menge theoretisch aufbereitete und empirisch fundierte Antworten.
Die einmalige Wissensquelle sind die Ergebnisse einer seit dem November 2001 halbjährlich stattfindende Befragung einer bevölkerungsrepräsentativen Gruppe von rund 1.500 Personen. Die vorläufig letzte sechzehnte Welle fand im Frühjahr 2009 statt. Die Fragebögen werden von Beginn an u.a. von Sozialforschern des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen entwickelt, enthalten einen inhaltlich identischen Teil über die Inanspruchnahme der ambulanten Versorgung, eine Fülle von soziodemografischen Angaben und inhaltlich variable Teile zu jeweils aktuellen Fragestellungen.
Trotz der zahlreichen Veröffentlichungen gibt es nicht wenige Fragen, die niemals oder nur relativ einfach ausgewertet worden sind oder deren Auswertung im Zeitverlauf nur partiell erfolgte. Wer dies für seine aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten oder gesundheitspolitische Debatten nachholen will, ältere Auswertungen selbst nachvollziehen, anders gewichtet oder zeitlich ergänzen will oder für eigene primären Forschungsarbeiten nach repräsentativen Referenzgrößen sucht, der kann dies nun - Sachkunde vorausgesetzt - mit Hilfe der als "public use file" zugänglichen Daten aller Befragungswellen des "Gesundheitsmonitors" nachholen.
Dazu liegen die Umfragedaten für jede der 16 Befragungswellen für die sozialwissenschaftlichen Statistikprogramme SPSS und SAS vor. Die Daten der einzelnen Wellen sind unter Angabe der Feldzeit zusammen mit den jeweiligen Datensatzbeschreibungen nach Jahren sortiert. Zusätzlich liegen die Daten für Fragen, die mehrfach gestellt wurden, also Zeitreihen-Analysen erlauben, als Zeitreihendatensatz vor.
Zusätzlich stehen nicht nur sämtliche Originalfragebögen zur Verfügung, sondern es gibt auch einen groben Überblick über alle abgefragten Themenfelder sowie Erläuterungen zur Bildung des Sozialschichtindex und methodische Hintergrundinformationen zur Stichprobenbildung, Erhebungsmethode (Access Panel) und einigen Qualitätsaspekten der Ergebnisse, die auch zum gründlichen Studium heruntergeladen werden können. Lohnenswert ist sicherlich auch ein Blick in die Details zur Handhabung. Dort finden sich unter anderem Angaben zu unterstützten Programmversionen sowie ein Hinweis auf den Gewichtungsfaktor, der für bestimmte Auswertungsprozeduren eingeschaltet werden muss.
Da weder für die letzten Jahre eine inhaltlich vergleichbare Wissensquelle vorliegt noch Initiativen bekannt sind, solche oder ähnliche Daten auch künftig zu generieren, sollte der "public use file" noch genutzt werden solange seine Inhalte "warm" sind und damit neben dem konkreten wissenschaftlichen oder politischen Nutzen auch der Nutzen einer Fortsetzung illustriert werden.
Alle Daten-Dateien und die genannten Erläuterungen des "Gesundheitsmonitor-Public use file" sind online kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 19.5.10
Sprungbrett in die Sackgasse oder "von nichts kommt nichts"! Wie sehen Niedriglöhne in Deutschland aus und was bewirken sie?
 Egal, ob sich die derzeitige Bundesregierung entschließt, "ganz langsam" in ein Kopfpauschalensystem um- und einzusteigen und damit über kurz oder lang Milliarden Euro aus Steuereinnahmen zum Sozialausgleich zu brauchen oder es mit einkommensbezogenen Beiträgen weitergeht: Eine stagnierende oder gar sinkende Bruttolohnsumme verschlechtert die Basis sämtlicher Finanzierungsmodelle. Daher ist auch die Entwicklung der Löhne am unteren Rand oder die Existenz oder Nichtexistenz von Niedrig- und Mindestlöhnen eine sowohl einkommenspolitisch als auch für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme äußerst relevante sozialpolitische Bedingung.
Egal, ob sich die derzeitige Bundesregierung entschließt, "ganz langsam" in ein Kopfpauschalensystem um- und einzusteigen und damit über kurz oder lang Milliarden Euro aus Steuereinnahmen zum Sozialausgleich zu brauchen oder es mit einkommensbezogenen Beiträgen weitergeht: Eine stagnierende oder gar sinkende Bruttolohnsumme verschlechtert die Basis sämtlicher Finanzierungsmodelle. Daher ist auch die Entwicklung der Löhne am unteren Rand oder die Existenz oder Nichtexistenz von Niedrig- und Mindestlöhnen eine sowohl einkommenspolitisch als auch für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme äußerst relevante sozialpolitische Bedingung.
Wie es damit aussieht, hat Ende 2009 eine Gruppe von WissenschaftlerInnen vom "Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ)" der Universität Duisburg-Essen für die Friedrich-Ebert-Stiftung ermittelt und zusammengefasst.
Die wichtigsten empirischen Ergebnisse des Reports lauten:
• Der Umfang der Niedriglohnbeschäftigung ist in Deutschland ist seit Mitte der 1990er Jahre deutlich gewachsen und liegt inzwischen deutlich über dem europäischer Nachbarländer. Sogar das hohe Niveau der USA ist fast erreicht. Absolut ist die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten zwischen 2006 und 2007 um rund 350.000 auf etwa 6,5 Millionen angestiegen. Im Vergleich zu 1995 hat die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten also um knapp 49% zugelegt
• Zwischen 1995 und 2006 sind die durchschnittlichen Stundenlöhne im unteren Einkommensquartil inflationsbereinigt um fast 14% gesunken. Selbst im Wirtschaftsaufschwung seit 2004 ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten weiter angestiegen und stellt damit eine Seite der generell gespreizteren Schere zwischen unteren und mittleren Einkommen dar.
• Dabei steigt besonders der Anteil von Beschäftigten mit Niedrigstlöhnen von weniger als 50% oder sogar einem Drittel des Medians deutlich an.
• "Immer mehr Menschen arbeiten in Deutschland also für Löhne, die selbst für vollzeitarbeitende Alleinstehende kaum zur Bestreitung des Lebensunterhaltes ausreichen."
• Unabhängig von der bereits geringen Höhe der tatsächlichen Mindestlöhne und damit der besteuerbaren- oder als Beitragsbasis tauglichen Einkommen haben die durchschnittlichen Stundenlöhne im Niedriglohnsektor sogar n den letzten Jahren real an Wert verloren und sich in den letzten Jahren teilweise sogar nominal verringert. Die durchschnittlichen Stundenlöhne im Niedriglohnsektor lagen 2007 mit 6,88 € in West- und 5,60 € in Ostdeutschland sowohl nominal als auch real weiter unter den jeweiligen Niedriglohnschwellen als noch 1995. Obwohl die Möglichkeit des baldigen Übergangs in besser bezahlte Tätigkeiten als werbendes Argument für die Erwerbstätigkeit in diesem Sektor existiert, ist faktisch der bescheidene wirtschaftliche Aufschwung gerade an den Niedriglohnbeschäftigten vorbeigegangen.
• Obwohl gering Qualifizierte ein besonders hohes Niedriglohnrisiko aufweisen, ist die große und wachsende Mehrheit der Niedriglohnbezieher formal höher qualifiziert: 2007 arbeiteten 43,3% der Beschäftigten ohne Berufsausbildung für einen Niedriglohn und damit deutlich mehr als 1995. Unter allen Niedriglohnbeschäftigten stellten aber gering Qualifizierte 2007 jedoch nur noch gut ein Fünftel. Personen mit beruflicher Ausbildung oder akademischem Abschluss stellen 2007 daher rund 80 % der gering Verdienenden.
• Entgegen den verbreiteten Erwartungen, sind Frauen zwar mehr von Niedriglohnarbeit betroffen als Männer, diese "holen" aber "auf". Außerdem stellen Beschäftigte mittleren Alters die Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten.
• Und schließlich erweist sich auch die Hoffnung oder das politische Versprechen, Niedriglohnjobs stellten ein Sprungbrett in besser bezahlte Beschäftigung, als trügerisch. Es handelt sich eher um eine Sackgasse. Die Chancen, aus dem Niedriglohnsektor schnell wieder herauszukommen ist sogar im europäischen Vergleich besonders gering und wird durch mehrere Studien schlüssig belegt.
Angesichts der Ergebnisse neuerer Forschung, dass selbst wesentlich höhere Niedriglöhne als die in Deutschland existieren oder über die hierzulande nachgedacht wird, in anderen Ländern positive Effekte auf der betrieblichen Ebene und auf dem Arbeitsmarkt insgesamt haben können, plädieren die IAQ-WissenschaftlerInnen auch für Deutschland entschieden für eine angemessene untere Lohngrenze bzw. einen Mindestlohn, der über den realen Niedriglöhnen liegt.
Zutreffend ist dabei sicherlich, eine solche Maßnahme "in ein größeres Reformpaket, das darauf abzielt, den sozialen Zusammenhalt nachhaltig und umfassend zu stärken" eingebettet werden muss.
Die umfangreiche und materialreiche Analyse "Mindestlöhne in Deutschland" von Gerhard Bosch, Claudia Weinkopf und Thorsten Kalina ist in der Reihe WISO-Diskurs der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung im Dezember 2009 erschienen und kostenlos erhältlich.
Als kurze sozialpolitische Ergänzung gibt es zusätzlich von denselben AutorInnen die ebenfalls bei der Ebert Stiftung erhältliche Argumentensammlung "Warum Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn braucht".
Bernard Braun, 10.2.10
Überblick über die "Gesundheitsgeschichte" der Bundesrepublik Deutschland seit dem Fall der Mauer.
 Pünktlich, d.h. bereits im November 2009, legte das Robert-Koch-Institut in seiner Veröffentlichungsreihe zur Gesundheitsberichterstattung ein mit 302 Seiten außergewöhnlich dickes, aber sicherlich nicht zu dickes "Heft" zur gesundheitlichen Entwicklung im wiedervereinigten Deutschland vor. Wesentliche Datengrundlage sind die im Rahmen des neu am RKI etablierten Gesundheitsmonitorings laufend erhobenen Daten des telefonischen Gesundheitssurveys des RKI.
Pünktlich, d.h. bereits im November 2009, legte das Robert-Koch-Institut in seiner Veröffentlichungsreihe zur Gesundheitsberichterstattung ein mit 302 Seiten außergewöhnlich dickes, aber sicherlich nicht zu dickes "Heft" zur gesundheitlichen Entwicklung im wiedervereinigten Deutschland vor. Wesentliche Datengrundlage sind die im Rahmen des neu am RKI etablierten Gesundheitsmonitorings laufend erhobenen Daten des telefonischen Gesundheitssurveys des RKI.
Die, wie bei den Heften zur Gesundheitsberichterstattung gewohnt, sehr gut empirisch belegten Gesundheitsverhältnisse in den alten wie neuen Bundesländern haben sich danach für die VerfasserInnen des Berichts folgendermaßen entwickelt:
• Nach 20 Jahren gemeinsamer Entwicklung sind die markantesten Unterschiede von Gesundheitsindikatoren beim Vergleich der neuen Bundeslander mit den alten Bundeslandern nicht mehr zu finden. Die meisten der kurz nach der Wiedervereinigung festgestellten Unterschiede sind mittlerweile verschwunden, was einen Erfolg darstellt. Dies wird insbesondere im Vergleich mit den Nachbarlandern Polen und Tschechien deutlich: Die noch vorhandenen innerdeutschen Unterschiede verblassen im Vergleich mit der Situation in diesen ehemals sozialistischen Staaten.
• Eine Fortführung der bislang gängigen Ost-West-Vergleiche erscheint ihnen nicht mehr erforderlich, darum wird es wohl auch keinen ähnlichen Bericht anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalles im Jahr 2019 mehr geben.
• Grund zur allgemeinen Zufriedenheit ist das aber nicht, denn die Differenzierung zwischen den einzelnen Bundeslandern, egal ob neu oder alt, ist weiter vorangeschritten, die Unterschiede machen sich ganz stark an Armut oder Reichtum der Regionen fest. Damit liegt der Ansatz für eine handlungsorientierte bundesdeutsche Gesundheitsberichterstattung künftig in einer regional feiner differenzierten Darstellung. Wie der "Dartmouth Atlas" in den USA seit vielen Jahren zeigt, stellen die regionalen Variationen der Morbidität und Mortalität sowie Versorgungsunterschiede eine der großen Herausforderungen für Gesundheitspolitik dar.
• Die Differenzierung zwischen den einzelnen Bundeslandern ist weiter voran geschritten, die Unterschiede machen sich ganz stark an Armut oder Reichtum der Regionen fest.
• Fur Kinder und Jugendliche in Deutschland ist es nicht so sehr von Bedeutung, ob sie in den neuen oder in den alten Bundeslandern geboren wurden, sondern welche Bildungschancen sie haben und unter welchen sozialen Bedingungen sie aufwachsen.
Der Bericht legt Daten und Bewertungen zu folgenden Fragen und Sachbereichen vor:
• Wie haben sich die Rahmenbedingungen für Gesundheit seit der Wiedervereinigung verändert?
• Wie hat sich die Gesundheit der Menschen in Ost- und Westdeutschland entwickelt?
• Welche Faktoren beeinflussen die Gesundheit in den neuen und alten Bundeslandern, was ist heute anders als vor 20 Jahren?
• Wie werden Angebote zu Prävention und Gesundheitsförderung genutzt?
• Wie haben sich Angebot und Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung in den neuen und alten Bundesländern verändert?
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen der sozialen und gesundheitlichen Lage (mit den Indikatoren Einkommen, Bildung und Arbeitslosigkeit) in den neuen und alten Bundeslandern?
Als Anhang gibt es neben einem Glossar Ergebnisse aus einer in Deutschland einmaligen intensiven Regionalanalyse, der Study of Health in Pomerania (SHIP).
Der Bericht "20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Wie hat sich die Gesundheit in Deutschland entwickelt?" ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.2.10
"Das Design bestimmt das Bewusstsein" nicht nur in Bayern - Wissenswertes und Hilfreiches für Jedermann zu Gesundheitsberichten
 Immer mehr Bundesländer erstellen eine qualitativ weit über die traditionelle Seuchen- und Medizinalstatistik hinausgehende Gesundheitsberichterstattung und stellen die Ergebnisse dem interessierten landes- und bundesweiten Publikum auch über das Internet zur Verfügung.
Immer mehr Bundesländer erstellen eine qualitativ weit über die traditionelle Seuchen- und Medizinalstatistik hinausgehende Gesundheitsberichterstattung und stellen die Ergebnisse dem interessierten landes- und bundesweiten Publikum auch über das Internet zur Verfügung.
Dies gilt auch für das Land Bayern, das diese Aufgabe im Wesentlichen dem "Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit" übertragen hat. Dessen Arbeiten verdienen außerbayrisch weniger wegen der "Pflicht", d.h. der Erstellung von regelmäßigen Gesundheitsberichten (in Bayern unter der Bezeichnung "Gesundheitsmonitor") Aufmerksamkeit (außer man sucht nach Daten über die Gesundheit in Bayern), sondern wegen einiger "Kür"-Arbeiten, die wissenschaftlich und praktisch auch außerhalb Bayerns ausgesprochen nützlich sind.
Einen Überblick über das gesamte Internetangebot des Landesamtes listet dies u.a. nach den Schwerpunkten Arbeitsschutz und Produktsicherheit (z.B. Heben und Tragen von Lasten - Ratgeber zur ergonomischen Lastenhandhabung), Gesundheit (z.B. Neugeborenen-Hörscreening: Vierter Zwischenbericht), Umweltmedizin (z.B. Mobilfunk: Mobilfunkbasisstationen und menschliche Befindlichkeit), Lebensmittel und schließlich Gesundheitsberichterstattung auf.
Vier der erwähnten Kür-Berichte aus dem Bereich Gesundheitsberichterstattung (GBE) sollen etwas ausführlicher vorgestellt werden. Zwei der drei Berichte beschäftigen sich mit der Erklärung von regionalen Sterblichkeitsunterschieden im allgemeinen und speziell zwischen Nord- und Südbayern. Der Band 3 der "Gesundheitsberichterstattung für Bayern" geht von der bereits vorher bekannten Tatsache der regionalen Unterschieden der Sterblichkeit aus und erhebt sowie bewertet auf 48 Seiten das unterschiedliche Gesundheitsverhalten als wichtigen zwischen sozioökonomischen Bedingungen und Mortalitätsunterschieden vermittelnden Faktor.
Zusätzlich stellt eine 42-seitige für das Landesamt erstellte Studie die verschiedenen sozialepidemiologischen Erklärungen für regionale Morbiditäts- und Mortalitätsunterschiede dar. Als Erklärungsansätze werden kurz, vollständig und verständlich die Bevölkerungszusammensetzung, der regionale soziale Status, die Environmental Justice, die Einkommensungleichheit und das soziale Kapital dargestellt.
Die erste der beiden "Handlungshilfen" beschäftigt sich auf lediglich 34 Seiten in sehr praxisorientierter und wissenschaftlich klarer wie differenzierter Art u.a. mit Grundbegriffen und Maßzahlen der Epidemiologie wie Kausalität und Assoziation, Prävalenz und Inzidenz und verschiedenen Effektmaße, mit statistischen Methoden in der Epidemiologie wie Altersstandardisierung und Signifikanzprüfung sowie einem anschaulichen Überblick über Typen epidemiologischer Studien und dabei mit den Evidenzklassen, der Objektivität, Reliabilität, Sensitivität und Spezifität von Studien.
Ebenfalls sehr anschaulich und konzentriert befasst sich der Band 4 der Handlungshilfen für die GBE-Praxis unter dem Motto "das Design bestimmt das Bewusstsein" mit medialen Aspekten der GBE. Hier geht es darum, mit welchen Darstellungs- und Abbildungsformen die Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen an die interessierte politische Öffentlichkeit vermittelt werden können und was man dabei zum eigenen Nutzen nicht machen sollte.
Nach ein wenig Theorie über das Prinzip "form follows function", geht es wiederum mit guten und schlechten Beispielen illustriert um das Layout und die Gestaltung von Gesundheitsberichten und deren Vermarktung in Presseerklärungen und barrierefreien Internetdokumenten. Viele der Hinweise sind auch für die Erstellung von Bachelorarbeiten oder Fakten-Papieren hilfreich. Sicherlich trägt zum Nutzen dieser Handlungshilfe bei, dass sie sich praktisch an den eigenen Ratschlägen orientiert, also nicht nur Tipps auflistet, sondern selber eine Art "model of good practice" darstellt.
Der 48-seitige Band 4 der Schriftenreihe "GBE-Praxis" "Mediale Aspekte der Gesundheitsberichterstattung Handlungshilfe" steht kostenlos zur Verfügung.
Dies gilt auch für
• die 48-Seiten-Studie "Gesundheit regional Gesundheitsberichterstattung für Bayern 3. Eine Untersuchung zu regionalen Unterschieden des Gesundheitsverhaltens,
• die theoretische Fundierung zur Erklärung regionaler Gesundheitsunterschiede in dem Band "Erklärungsmodelle regionaler Gesundheitsunterschiede Fachinformation Gesundheit. Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz für das Projekt "Gesundheit regional" Eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zum Gesundheitsverhalten in Bayern.
42 Seiten, und für
• die Handlungshilfe 2"Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung Begriffe, Methoden, Beispiele".
Bernard Braun, 31.3.09
GBE-Heft "Hypertonie" : Zu geringe Bekanntheit, unter- und fehlbehandelt, schlecht kontrolliert, unzureichende Lösungsvorschläge!
 Einer der führenden Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Hypertonie (Bluthochdruck). Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen in Deutschland mit 43 % (Stand 2007) die häufigste Todesursache dar. Bluthochdruck ist in Deutschland weit verbreitet und tritt nach Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 ungefähr bei jedem zweiten Erwachsenen zumindest vorübergehend auf (44 % der Frauen und 51 % der Männer im Alter von 18 - 79 Jahren).
Einer der führenden Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Hypertonie (Bluthochdruck). Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen in Deutschland mit 43 % (Stand 2007) die häufigste Todesursache dar. Bluthochdruck ist in Deutschland weit verbreitet und tritt nach Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 ungefähr bei jedem zweiten Erwachsenen zumindest vorübergehend auf (44 % der Frauen und 51 % der Männer im Alter von 18 - 79 Jahren).
In der jüngsten telefonischen Gesundheitsbefragung des Robert Koch-Instituts bejahten über 50 % der Teilnehmer über 65 Jahre die Frage "Hat ein Arzt bei Ihnen jemals Bluthochdruck/Hypertonie festgestellt?"
Hypertonie ist eine komplexe Gesundheitsstörung. Bei der häufigsten Form, der primären Hypertonie, geht man von einer Entstehung durch das Zusammenwirken erblicher Veranlagung mit verschiedenen Risikofaktoren aus. Zu den Risikofaktoren zählen insbesondere Übergewicht, hoher Kochsalzkonsum (bei gesteigerter Salzempfindlichkeit), Bewegungsmangel, hoher Alkoholkonsum - nach Schätzungen werden bis zu 30 % der Hypertoniefälle auf Alkoholkonsum zurückgeführt - sowie Umwelteinflüsse wie starke Lärmbelästigung oder psychosozialer Stress im Beruf.
Bluthochdruck ist aber nicht nur in der Bevölkerung weit verbreitet, sondern stellt auch einen wesentlichen Teil der alltäglichen ärztlichen Erfahrungspalette dar. Die Ergebnisse des Patienten-Arzt-Panels zur Morbiditätsanalyse (ADT-Panel, Behandlungsdaten von Patienten des GKV-Bereiches aus circa 450 Arztpraxen in der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein) zeigen, dass die essentielle Hypertonie die häufigste Diagnose bei Allgemeinärzten sowie bei fachärztlichen und hausärztlich tätigen Internisten ist. Im 1. Quartal 2008 wurde bei 30,9 % aller Patienten von Allgemeinärzten dieser Region eine primäre Hypertonie diagnostiziert.
Da Bluthochdruck eine praktisch symptomlose Veränderung des körperlichen Geschehens ist, stellt allerdings der entdeckte Bluthochdruck mit Sicherheit nur einen Teil des tatsächlichen Geschehens dar. Ob umgekehrt ein Teil des in der Arztpraxis einmal gemessenen Bluthochdrucks nicht auf Messfehlern beruht oder der erhöhte Wert ausschließlich iatrogen ist, also auf einer temporären Aufregung des Patienten vor der Messung beruht, kann angenommen werden, ist aber schwierig zu quantifizieren.
Angesichts der gerade gezeigten Relevanz von Bluthochdruck mag es dann schon wundern, dass erst das 43. Heft der Gesundheitsberichtstattungs(GBE)-Reihe des Robert-Koch-Instituts (RKI) sich mit seiner Epidemiologie, Diagnostik, Therapie und Prävention beschäftigt.
Das nun aber im Dezember 2008 erschienene Heft beschäftigt sich auf 38 Seiten mit einer Fülle von Aspekten des Bluthochdrucks.
Schwerpunktmäßig betrachten und bewerten die drei Verfasserinnen, Katrin Janhsen, Helga Strube und Anne Starker, das Geschehen nach dem Bekanntheits-, dem Behandlungs- und dem Kontrollgrad der Hypertonie.
Dabei zeigt sich auf der Basis der Daten des Bundesgesundheitssurvey (BGS98) 1998 ein Missverhältnis zwischen entdeckter, behandelter und kontrollierter Hypertonie in der Bevölkerung. Danach hat bei 23,1 % der Befragten ein Arzt eine Hypertonie festgestellt - häufig durch Zufall -, 18,6 % erhalten eine Behandlung ihrer Hypertonie und 4,4 % gelten als kontrolliert hyperton. Das entspricht einer Kontrollrate unter den Hypertonikern (Anteil der kontrollierten Hypertoniker an den behandelten Hypertonikern) von nur 23,8 %.
Zumindest für die Zeit vor dem BGS98 zeigen die regionalen Daten der MONICA-(Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease)Region Augsburg über den beobachteten 10-Jahres-Zeitraum (1984 - 1994) insgesamt keine oder lediglich geringe Veränderungen: Der Be-kanntheitsgrad der Hypertonie hat sich kaum verändert, der Behandlungsgrad hingegen erhöhte sich bei beiden Geschlechtern in geringem Maße. Der Kontrollgrad zeigte bei den Frauen eine leichte Verbesserung; bei den Männern blieb er nahezu unverändert.
Wird ein Bluthochdruck aber entdeckt und behandelt, zeigten deutsche Studien erhebliche qualitative Behandlungsdefizite:
In der Auswertung der WHO-MONICA-Daten für Bremen (Optional Study on Drugs) wurde festgestellt, dass etwa die Hälfte der Patienten, bei denen mittels Medikamenten keine Blutdruckkontrolle erreicht wurde, d.h. das Behandlungsziel verfehlt wurde, lediglich mit einem blutdrucksenkenden Wirkstoff behandelt wurde. Neben der Lebensstiländerung zur Reduktion vorhandener Risikofaktoren (z. B. Rauchen, Übergewicht) gehen die Leitlinien zur Therapie der Hypertonie davon aus, dass ein großer Teil der Patienten eine Kom-binationstherapie aus mehreren Wirkstoffen benötigt, um die gewünschten Zielblutdruckwerte zu erreichen. Bei den genannten Patienten wird demnach das verfügbare therapeutische Spektrum der medikamentösen Therapie nicht ausgeschöpft.
Dies hängt im Kern von Wissensdefiziten ab, welche die RKI-Autorinnen so zusammenfassen: "Die Studien zeigen aber auch, dass das Wissen und die Umsetzung von Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der Hypertonie unzureichend sind. Allgemeine Schulungsmaßnahmen, wie z. B. die Verbesserung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens, wie auch andere verhaltensmedizinische Interventionen werden den Patienten zu selten angeboten und eingesetzt. Von der Möglichkeit, Patienten an dafür spezialisierte Dienste zu überweisen, machen Ärzte zu wenig Gebrauch. Auch bei der medikamentösen Hypertonietherapie bestehen Defizite. Allein durch eine Verringerung des Anteils therapierter, aber nicht kontrollierter Hypertoniker könnte das Risiko für die Hypertoniefolgen aber deutlich gesenkt werden. Der Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen fordert daher eine stärkere Beachtung der Leitlinien bei der Therapie der Hypertonie."
Diese Kritik wird durch eine umfangreiche und verständliche Darstellung der mit dem Bluthochdruck assoziierten spezifischen Risiken und ihrer Therapiemöglichkeiten hinterlegt.
An praktischen Ansätzen, die von ihnen referierten Defizite lösen zu können, enthält das RKI-Heft mehrerlei: Zum einen betonen die Autorinnen insbesondere die für einen höheren Entdeckungs- oder Bekanntheitsgrad große Bedeutung der nach dem SGB V jedem über 35 Jahre alten GKV-Versicherten zustehenden so genannten "Gesundheitsuntersuchung ab 35". Aus ihrer Sicht ist diese Untersuchung "ein umfassender systematischer Ansatz der Primärprävention".
Auf gesellschaftlicher Ebene heben sie die Bedeutung des Eckpunktepapier "Gesunde Ernährung und Bewegung - Schlüssel für mehr Lebensqualität" der Bundesregierung hervor, das eine Vielzahl der bereits bestehenden vielfältigen Initiativen in einer nationalen Strategie für die Bereiche Ernährung und Bewegung zusammenzuführen und fortzuentwickeln versucht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ebenfalls der im Juni 2008 von den Bundesministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie für Gesundheit entwickelte "Nationale Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten".
Dass die zitierten Forderungen bzw. Appelle von Sachverständigen oder noch so große und medienwirksamen nationalen Pläne alleine, d.h. ohne genaue Kenntnis der mit Sicherheit komplexen Ursachen der erkannten Nichtbeachtung wichtiger Erkenntnisse bei einem alltäglich so häufig existierenden Handlungsanlass, nutzlos sind, sollte aber langsam auch in der politiknahen Beratung und der Politik selber zur Kenntnis genommen und vorrangig angegangen werden. Dabei wird unterstellt, dass es sich bei den Mängeln nicht oder zumindest nicht vorrangig um die Folgen von "Dummheit" oder "Faulheit" bespielsweise der so handelnden Ärzte handelt.
Ohne hier auf die zum Teil problematischen Inhalte dieser Initiativen im Detail eingehen zu wollen und zu können (z.B. sieht die Evidenz für den Nutzen einiger Kernelemente der in den regierungsoffiziellen Aktionsplänen dort propagierten Interventionen im Bereich Bewegung und Ernährung keineswegs eindeutig aus), liegt ihren praktischen Schritten eben eben nicht eine Analyse zugrunde, warum und wie es zu den erkannten und weitgehend konsensualen Mängeln und zum partiellen Therapieversagen auf Arzt- und Patientenseite kommt und wie dies verhindert werden kann. Hier wird man den Verdacht nicht los, dass die Darstellung auch stark den Interessen des staatlich-politischen Auftraggebers RKI folgt.
Auch wenn es aber zum Beispiel gelänge, den mit rund 20% niedrigen Nutzungsgrad der Gesundheitsuntersuchung anzuheben, könnte dies ohne begleitende Veränderungen bedeuten, dass zwar möglicherweise mehr Personen mit Bluthochdruck entdeckt, diese dann aber ähnlich defizitär behandelt werden wie es bereits geschieht. Hinzu kommt das bisherige Fehlen einer systematischen Evaluation dieser seit einigen Jahren angebotenen Vorsorgeuntersuchung und die gegen einige ihrer diagnostischen Standardtools (z.B. der bei Angina pectoris geringe prädiktive Nutzen von EKGs) geäußerten Zweifel an Verlässlichkeit und Nutzen.
Das Heft gliedert sich in die jeweils materialreiche und sehr verständlich verfassten Kapitel Krankheitsbild, Epidemiologie, Risiko- und Begleitfaktoren, präventive und therapeutische Maßnahmen, Versorgungsangebote, Inanspruchnahme des Versorgungssystems und Kosten auf.
Das komplette GBE-Heft "Hypertonie" kann als PDF-Datei heruntergeladen werden oder schriftlich kostenlos bestellt werden (Robert Koch-Institut, GBE, General-Pape-Straße 62, 12101 Berlin, E-Mail: gbe@rki.de, Fax: 030-18754-3513).
Bernard Braun, 18.12.08
Alle 4 Jahre wieder - "Angaben zur Krankenversicherung" aus dem Mikrozensus 2007 des Statistischen Bundesamtes
 2007 waren in Deutschland durchschnittlich 196 000 Personen nicht krankenversichert und besaßen auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Damit waren 0,2% der Gesamtbevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz. Zum größten Teil handelte es sich dabei um Männer (68%). Besonders häufig haben die Erwerbstätigen ohne Krankenversicherungsschutz einen niedrigen beziehungsweise keinen schulischen oder beruflichen Abschluss (76%). Gut 23% gaben an, mindestens einen mittleren Abschluss erworben zu haben. Ein Prozent der Befragten machten keine Angaben zum beruflichen Abschluss.
2007 waren in Deutschland durchschnittlich 196 000 Personen nicht krankenversichert und besaßen auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Damit waren 0,2% der Gesamtbevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz. Zum größten Teil handelte es sich dabei um Männer (68%). Besonders häufig haben die Erwerbstätigen ohne Krankenversicherungsschutz einen niedrigen beziehungsweise keinen schulischen oder beruflichen Abschluss (76%). Gut 23% gaben an, mindestens einen mittleren Abschluss erworben zu haben. Ein Prozent der Befragten machten keine Angaben zum beruflichen Abschluss.
Dies zeigen die Ergebnisse des alle vier Jahre erhobenen Zusatzprogramms "Angaben zur Krankenversicherung" im Mikrozensus, der mit rund 50.000 PflichteilnehmerInnen größten jährlichen Haushaltsbefragung in Europa. Seine wichtigsten und aktuellsten Daten im Bereich Krankenversicherungsschutz sind am 11. Dezember 2008 in der Fachserie 13 Reihe 1.1 des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht worden.
In der Publikationen finden sich zum Themenbereich Krankenversicherung folgenden faktenreichen Auswertungen:
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenversicherungsschutz und ausgewählten Merkmalen
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses und Beteiligung am Erwerbsleben
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Alter und Geschlecht sowie Art des Versicherungsverhältnisses
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses, Geschlecht sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Stellung im Beruf
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses, Alter sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Stellung im Beruf
• Bevölkerung im Jahr 2007 nach Geschlecht, Krankenkasse/-versicherung, Art des Versicherungsverhältnisses sowie monatlichem Nettoeinkommen
Ferner finden sich in der Publikation das für den Mikrozensus relevante Gesetz, der Fragebogen des gesamten Mikrozensus und eine Reihe wichtiger Anmerkungen zur Qualität und Qualitätssicherung der mit dieser Erhebung gewonnenen Daten.
Die 87 Seiten der Mikrozensus-Fachserie "Krankenversicherungsschutz" sind kostenlos als PDF-Datei über die Website "destatis" des Statistischen Bundesamtes erhältlich. Es ist aber auch möglich, die Ergebnisse in Broschürenform zu bestellen.
Bernard Braun, 11.12.08
Komponenten der GKV-Einnahmeschwäche: Mehr Frauen erwerbstätig aber mit sinkender Arbeitszeit - deutscher "Sonderweg".
 Auf den engen Zusammenhang zwischen den Strukturen des Arbeitsmarktes bzw. der Beschäftigung und ihren gewaltigen Veränderungen innerhalb der letzten Jahre mit der einkommensabhängigen Finanzierung der Sozialversicherungssysteme in Deutschland wurde im Forum-Gesundheitspolitik als einer Ursache der Einnahmeschwäche von Sozialversicherungsträgern bereits mehrfach hingewiesen.
Auf den engen Zusammenhang zwischen den Strukturen des Arbeitsmarktes bzw. der Beschäftigung und ihren gewaltigen Veränderungen innerhalb der letzten Jahre mit der einkommensabhängigen Finanzierung der Sozialversicherungssysteme in Deutschland wurde im Forum-Gesundheitspolitik als einer Ursache der Einnahmeschwäche von Sozialversicherungsträgern bereits mehrfach hingewiesen.
Auf die Auswirkungen eines deutschen "Sonderwegs" im Bereich der Frauenerwerbstätigkeit weist jetzt eine im Auftrag der Hans Böckler Stiftung (HBS) am Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen erstellte Studie hin. Dort geht es darum, dass in Deutschland zwar langfristig und zäh die Erwerbstätigkeit von Frauen zunimmt aber die Arbeitszeit und damit das Einkommen der erwerbstätigen Frauen genauso langfristig abnimmt.
Die Studie basiert auf einer Sonderauswertung, den so genannten IAQ/HBS-Arbeitszeitmonitor, des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes für den Zeitraum 2001 bis 2006. Die Datenbasis ist die größte repräsentative Erhebung zu den Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland.
Die wichtigsten Trends:
• Der Anteil der Frauen in Deutschland, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, nimmt langfristig zu und betrug 2006 61,5% aller Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren. Auf Vollzeitstellen umgerechnet stagniert dieser Anteil jedoch seit Beginn des Jahrzehnts, weil vor allem durch den Minijob-Boom die Arbeitszeit pro Person abnimmt.
• Der deutsche Sonderweg ist dadurch charakterisiert, dass die auf Vollzeitstellen umgerechnete Beschäftigungsquote von Frauen in den letzten Jahren unter den EU-Durchschnitt gesunken ist. Die Arbeitszeiten von Frauen (Vollzeit und Teilzeit zusammengenommen) sind die zweitkürzesten in Europa, bei den Teilzeitbeschäftigten sogar die kürzesten. Der so genannte "gender gap", d.h. die Differenz zwischen den vollzeitäquivalenten Beschäftigungsverhältnissen für Männer und Frauen in Prozentpunkten hat mit 22,9 % in Deutschland den dritthöchsten Wert in Europa (Durchschnitt der EU 27 = 20,6 %).
• Auch wenn der Anteil der Männer an den Teilzeitbeschäftigten sich in den letzten Jahren erhöht hat, ist Teilzeitarbeit insbesondere in Westdeutschland ein mehrheitlich weibliches Phänomen: 2006 waren rund 87 % aller Teilzeitbeschäftigten Frauen. Die Teilzeitbeschäftigung liegt dann aber auch stundenmäßig recht niedrig, nämlich durchschnittlich 16,9 Stunden bei den Männern und 18,2 Stunden bei den Frauen.
• Bei den Durchschnittsarbeitszeiten aller Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten nimmt die Kluft zwischen den Arbeitszeiten von Männern und Frauen in Deutschland insgesamt weiter zu.
• Trotz aller öffentlichen Debatten über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich der Einfluss von Ehe und Kindern auf die Arbeitszeiten von Frauen in den letzten Jahren weiter verstärkt. Verheiratete Frauen und Frauen mit Kindern arbeiten heute mit 29,1 Stunden mehr als eine Stunde pro Woche weniger als 2001, und die Schere zwischen ihren Arbeitszeiten und denen von Männern mit Kindern hat sich weiter geöffnet. Männer arbeiten in Deutschland 2006 im Durchschnitt 38,4 Wochenstunden, d.h. fast genauso lange wie 2001. 2001 arbeiteten Männer 8,8 Stunden länger als Frauen. 2006 betrug der Unterschied 9,3 Stunden.
• Außerdem sinkt bei Frauen die Anzahl der Arbeitsstunden mit steigender Anzahl der Kinder, während dies bei den Vätern genau umgekehrt verläuft. Mütter mit zwei Kindern arbeiteten 2006 im Durchschnitt 23 Stunden in der Woche, Väter mit ebenfalls zwei Kindern dagegen 41,5 Stunden.
Neben den einkommens- und familienpolitischen Auswirkungen dieser Entwicklung verschlechtert sich durch sie bei unveränderten Beitragssätzen auch das Volumen der Beitragseinnahmen z. B. der Gesetzlichen Krankenversicherung, ohne dass die GKV daran etwas verändern kann. Hier handelt es sich also um die Verlagerung der belastenden Wirkungen eines gesellschaftspolitisch gewünschten oder beeinflussten Zustands in ein Solidarsystem bzw. einen kleinen "Zug" im "Verschiebebahnhof-Geschehen".
Die als IAQ-Report 2008-04 Immer mehr Frauen sind erwerbstätig - aber mit kürzeren Wochenarbeitszeiten" von Angelika Kümmerling, Andreas Jansen und Steffen Lehndorff veröffentlichten Ergebnisse sind auf 12 Seiten komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.12.08
Ein Klassiker: "Datenreport 2008: Ein Sozialbericht für Deutschland"
 Wie hoch sind die Ausgaben des Staates für die sozialen Sicherungssysteme? Wie groß ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Sozialstaat? Wie viel Geld haben die Haushalte in Deutschland zur Verfügung und wie hat sich die Einkommensverteilung in den letzten Jahren entwickelt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wenn es um die Lebensqualität der Bürger geht? Wie hoch ist der Anteil der Ausgaben für Gesundheit, den die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) trägt?
Wie hoch sind die Ausgaben des Staates für die sozialen Sicherungssysteme? Wie groß ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Sozialstaat? Wie viel Geld haben die Haushalte in Deutschland zur Verfügung und wie hat sich die Einkommensverteilung in den letzten Jahren entwickelt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wenn es um die Lebensqualität der Bürger geht? Wie hoch ist der Anteil der Ausgaben für Gesundheit, den die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) trägt?
Antworten auf diese und viele andere Fragen zur sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland gibt der gerade zum zwöften Mal in seiner fast 25-jährigen Geschichte erschienene Datenreport 2008. Er wird vom Statistischen Bundesamt, vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), der Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Struktureinrichtungen (GESIS) und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) herausgegeben.
Das Besondere am Datenreport ist, dass er Ergebnisse der amtlichen Statistik und der sozialwissenschaftlichen Forschung gemeinsam in Form eines umfassenden Sozialberichts für Deutschland präsentiert. Der Datenreport enthält insgesamt mehr als 40 Beiträge zu verschiedenen Aspekten der objektiven Lebensverhältnisse und des subjektiven Wohlbefindens der Bürger.
Detailliert untersucht werden in den 16 Sachkapiteln unter anderem: die Entwicklung der sozialen und gesundheitlichen Sicherung der Menschen und ihre subjektiven Einstellungen zum Sozialstaat und zur Sozialpolitik, die Entwicklung und Verteilung der Einkommen, die Zufriedenheit der Menschen mit verschiedenen Lebensbereichen (Haushaltseinkommen, Gesundheit, Demokratie), die soziale Schichtung und soziale Lagen, das Bedeutung von Europa für Deutschland sowie die politische und soziale Partizipation und Integration.
Die genaueren Angaben sahen beispielsweise in den folgenden Sachbereichen so aus:
• Im Jahr 2005 trug die gesetzliche Krankenversicherung 56,8 % der Gesundheitsausgaben. Das entspricht 135,9 Milliarden Euro. Der Studie zufolge waren die privaten Haushalte der zweitgrößte Ausgabenträger. Sie wendeten 32,4 Milliarden Euro auf und hatten einen Anteil von 13,5 % an den gesamten Gesundheitsausgaben. An dritter Stelle folgte mit 22 Milliarden Euro (9,2 %) die private Krankenversicherung. Die soziale Pflegeversicherung übernahm mit 17,9 Milliarden Euro rund 7,5 % der Ausgaben.
• Trotz des heute schon hohen Eigenanteils an den Gesundheitsausgaben ist die Mehrheit der Bürger im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Befragung dafür, dass der Einzelne in allen Bereichen der sozialen Sicherung mehr Verantwortung als bisher übernehmen sollte.
• Nach dem Report ist die Zufriedenheit mit der sozialen Sicherung mit Werten von 5 in Ostdeutschland und 5,5 in Westdeutschland auf der von 0 bis 10 reichenden Skala inzwischen auf das niedrigste Niveau der letzten 25 Jahre gefallen. Allerdings bringen immerhin zwei Drittel der Bevölkerung der Krankenversicherung derzeit großes oder etwas Vertrauen entgegen. Dieses Vertrauen bescheinigen jeweils nur ein Drittel der Bürger der Rentenversicherung und der Grundsicherung für Arbeitssuchende.
• Der Report fasst auch Daten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung zusammen. So bezeichneten sich im Jahr 2005 insgesamt 13 % der Bevölkerung, die Angaben zur Gesundheit machten, als krank oder unfallverletzt. Mit zunehmendem Alter ist ein Anstieg der gesundheitlichen Beschwerden zu beobachten. Während der Anteil der Kranken und Unfallverletzten bei Personen im Alter von 15 bis 39 Jahren im Jahr 2005 rund neun % betrug, lag er bei den 40- bis 64-Jährigen bereits bei zwölf %. Von den über 65-Jährigen bezeichnete sich fast jeder Vierte als krank oder unfallverletzt. Frauen waren etwas häufiger von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen als Männer.
Der 456 Seiten umfassende Report kann in Buchform für 4 Euro plus Versandspesen u.a. bei der Bundeszentrale für politische Bildung bezogen werden.
Als PDF-Datei ist der Datenreport 2008 auch kostenlos über die Websites der Herausgeberinstitute zu erhalten.
Bernard Braun, 22.11.08
Daten, Fakten und Trends zum demographischen Wandel
 Schon immer veröffentlichte das "Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)" fundierte und materialreiche Studien zum demographischen Wandel in Buchform und im Internet. In den kostenlos erhältlichen "BiB-Mitteilungen" standen wichtige empirische Analysen zu vielen Aspekten, Ursachen und Wirkungen mit demographischem Hintergrund.
Schon immer veröffentlichte das "Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)" fundierte und materialreiche Studien zum demographischen Wandel in Buchform und im Internet. In den kostenlos erhältlichen "BiB-Mitteilungen" standen wichtige empirische Analysen zu vielen Aspekten, Ursachen und Wirkungen mit demographischem Hintergrund.
Mit der neu gestalteten Homepage setzt das Institut diese Tradition fort.
Auf der aktuellen Startseite findet sich ein
• Link zum Heft 1/2008 der BiB-Mitteilungen mit Zusammenfassungen ausgewählter Originaltexte auf 60 Seiten.
• Dann kann man sich die Studie "Die demographische Lage in Deutschland 2007" herunterladen.
• Auf 80 Seiten der Broschüre "Bevölkerung: Daten, Fakten Trends zum demographischen Wandel in Deutschland" werden weitere aktuelle statistischen Daten zugänglich gemacht.
Weitere Hinweise auf Bücher und Konferenzen runden das Angebot ab.
In einem speziellen Bereich "Download-Center" werden Materialien zu Themenbereichen wie Weltbevölkerung, Sterblichkeit, Wanderungen, Alterung und Fertilität präsentiert. Im Bereich "Fertilität" umfassen die Materialien u.a. solche zu den "Kinderwünschen in Deutschland", die Ergebnisse der Population Policy Acceptance Study (PPAS), eine Studie von Juliane Roloff zum Thema "Mögliches Verhalten von Frauen in West- und Ostdeutschland bei einer ungewollten Schwangerschaft und die Akzeptanz des Schwangerschaftsabbruchs" oder eine Dokumentation der ersten Welle der Hauptbefragung des "Generations and Gender Survey" 2007 von Kerstin Ruckdeschel, Andreas Ette, Gert Hullen und Ingo Leven.
Im Bereich "Materialien" sind u.a. eine Reihe der vom BiB herausgegebenen umfangreichen "Materialien zur Bevölkerungswissenschaft" kostenlos herunterladbar.
In Planung befindet sich ein umfangreiches Wöterbuch für demographische Fachbegriffe und ein Auftritt in englischer Sprache.
Hier erreicht man den neuen Internetauftritt des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung.
Bernard Braun, 14.6.2008
Das "Statistische Jahrbuch 2007 für die Bundesrepublik Deutschland" - komplett und kostenlos!
 Ein unentbehrlicher Helfer bei der Grundorientierung über die statistisch abbildbaren sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahren das vom Statistischen Bundesamt erstellte "Statistische Jahrbuch". Auch die neueste Ausgabe für das Jahr 2007 ist neben "der klassischen Buchausgabe in hochwertiger Verarbeitung zu einem attraktiven (?) Preis" von 71 Euro in einer insgesamt oder in 25 Kapiteln plus einem Anhang mit internationalen Übersichten herunterladbaren kostenfreien Version erhältlich.
Ein unentbehrlicher Helfer bei der Grundorientierung über die statistisch abbildbaren sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahren das vom Statistischen Bundesamt erstellte "Statistische Jahrbuch". Auch die neueste Ausgabe für das Jahr 2007 ist neben "der klassischen Buchausgabe in hochwertiger Verarbeitung zu einem attraktiven (?) Preis" von 71 Euro in einer insgesamt oder in 25 Kapiteln plus einem Anhang mit internationalen Übersichten herunterladbaren kostenfreien Version erhältlich.
Die Themen reichen von den hier besonders interessierenden Sozialleistungen und Gesundheitswesen bis hin zu Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Umwelt, Verkehr, Produzierendes Gewerbe, Außenhandel, Verdienste und Arbeitskosten, Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen oder Zahlungsbilanz. In den Fachkapiteln finden sich im Allgemeinen umfassende Definitionen der statistischen Werte und Indikatoren, ausführliche statistische Daten in der Regel für die Jahre 2004 bis 2006 und in nicht wenigen Fällen auch kleine Zeitreihen von den 1990er Jahren bis 2006 und schließlich knappe Kommentierungen der Daten.
Herunterladbar sind die 742 Gesamt-Seiten des "Statistischen Jahrbuchs 2007 für die Bundesrepublik Deutschland" als rund 6,5 MB umfassende PDF-Datei hier. Die entsprechend kleineren Kapitel-Dateien finden sich auch hier.
Bernard Braun, 19.10.2007
Angebot von interaktiven "Ad hoc-Tabellen" des Statistischen Bundesamtes - Von der "Standard"- zur "Maß"-Tabelle
 Das Statistische Bundesamt bietet mit den so genannten "Ad hoc-Tabellen" seit Anfang 2007 eine interessante und sicherlich schnell expandierende Informationsquelle u.a. auch für die Bereiche Sozial- und Gesundheitspolitik an.
Das Statistische Bundesamt bietet mit den so genannten "Ad hoc-Tabellen" seit Anfang 2007 eine interessante und sicherlich schnell expandierende Informationsquelle u.a. auch für die Bereiche Sozial- und Gesundheitspolitik an.
Der Grund für diesen neuen Bestandteil des Informationssystems des Bundes und seine Art besteht in den Worten des Bundesamtes darin: "Vorgefertigte Tabellen entsprechen mitunter nicht den Bedürfnissen des Benutzers. Aus diesem Grunde hat die Gesundheitsberichterstattung des Bundes in ihrem Informationssystem das Konzept der Ad-hoc-Tabelle eingeführt. In diesen Tabellen können Sie über Links die Gliederungstiefe (z.B. "Alte Bundesländer/Neue Bundesländer" oder einzelne Bundesländer) bestimmen, über Auswahlfelder einen bestimmten Ausschnitt der Informationen (z.B. Deutschland oder Hamburg) herausgreifen und zum Teil auch die Anordnung der Merkmale in Zeilen und Spalten selbst wählen. Zur Zeit stehen Ihnen im Rahmen der Ad-hoc-Tabellen über 800 Millionen Werte für Analysezwecke zur Verfügung. Sie werden ständig erweitert und aktualisiert." Hinzu können in vielen Tabellen Informationen im Zeitverlauf oder für einzelne Jahre dargestellt werden. Der Betrachtungszeitraum reicht meistens bis an den Anfang des Jahrzehnts aber auch bis weit in die 1990er Jahre zurück.
Dabei ist zu unterscheiden nach Tabellen aus dem Berichtsbereich des Statistischen Bundesamtes und von Institutionen außerhalb Statistisches Bundesamt.
Beispiele für die aktuell rund 30 Datenquellen des Statistischen Bundesamtes sind etwa:
• alte Gesundheitsausgabenrechnung (1970-1998)
• Gesundheitsausgabenrechnung 1992-2004
• Gesundheitspersonalrechnung 1997-2004
• Krankenhausstatistik - Grunddfaten 1994-2004
• Todesursachenstatistik 1980-2005
• Mikrozensus - Fragen zur Gesundheit 1992-2005
Beispiele für die aktuell über 60 Datenquellen von Institutionen außerhalb des Statistischen Bundesamtes sind beispielsweise:
• AIDS-Fallregister des RKI 1982-2006
• Ärztestatistik der BÄK 1985-2005
• Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung 1995-2005
• Leistungen des Rettungsdienstes 1994-2001
In beiden Bereichen gibt es zusätzlich auch noch statische Datensammlungen.
Bernard Braun, 18.1.2007
Arbeits- und Sozialstatistik des Bundesarbeitsministeriums 2006 erschienen
 Wer nach der abendlichen Polit-Talkshow schnell mal nachhalten will,
Wer nach der abendlichen Polit-Talkshow schnell mal nachhalten will,
• ob die Behauptung stimmt, Deutschlands Sozialquote sei im internationalen Vergleich mit riesigem Abstand zu hoch und nehme auch noch unentwegt zu
• oder die These prüfen will, dass in den letzten 10 Jahren kaum mehr reale Lohnzuwächse aber durchaus kräftige Erhöhungen der Unternehmens- und Gewinneinkommen zu verzeichnen sind
• oder sehen will, ob und wie sich der Krankenstand nach unten entwickelt,
findet in den "Statistischen Taschenbüchern" des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) rasch üppige Erste Hilfe. Die im Internet in der Form von meist unkommentierten Excel-Tabellen erhältlichen Daten reichen sehr oft bis zum Anfang der 1960er Jahre zurück. Die Statistiken gibt es aber auch als Broschüre oder auf CD ROM.
Hier finden Sie die Ausgabe für das Jahr 2006.
Bernard Braun, 29.11.2006
Basisdaten GKV
 Wer mehr über den aktuellen Stand und die Entwicklung der Rahmendaten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), den Krankenversicherungsschutz, die Mitglieder- und Einnahmenentwicklung, den Risikostrukturausgleich, die Leistungsausgaben sowie die Angebotskapazitäten oder die Zuzahlungen wissen will, findet viele, meist auch nach Krankenkassenarten differenzierte Angaben in den vom Verband der Angestelltenkrankenkassen (VdAK) zusammengestellten und jährlich erscheinenden "Ausgewählten Basisdaten des Gesundheitswesens" (zuletzt für die Ausgaben 2004 und 2005). Die Datensammlung kann entweder komplett als Datei heruntergeladen oder online im Detail betrachtet werden. Es gibt die Rubriken:
Wer mehr über den aktuellen Stand und die Entwicklung der Rahmendaten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), den Krankenversicherungsschutz, die Mitglieder- und Einnahmenentwicklung, den Risikostrukturausgleich, die Leistungsausgaben sowie die Angebotskapazitäten oder die Zuzahlungen wissen will, findet viele, meist auch nach Krankenkassenarten differenzierte Angaben in den vom Verband der Angestelltenkrankenkassen (VdAK) zusammengestellten und jährlich erscheinenden "Ausgewählten Basisdaten des Gesundheitswesens" (zuletzt für die Ausgaben 2004 und 2005). Die Datensammlung kann entweder komplett als Datei heruntergeladen oder online im Detail betrachtet werden. Es gibt die Rubriken:
• Rahmendaten
• Krankenversicherungsschutz und Mitgliederentwicklung
• Risikostrukturausgleich
• Beitragssätze und beitragspflichtige Einnahmen
• Leistungsausgaben
• Angebotskapazitäten
• Soziale Pflegeversicherung
• Zuzahlungen und Befreiungsmöglichkeiten
Weitere Informationen und Downloadmöglichkeit der Basisdaten 2004 und 2005
Bernard Braun, 26.10.2006
Robert-Koch-Institut: Themenhefte zur Gesundheitsberichterstattung (GBE)
 Das Robert-Koch-Institut hat hier unter dem Titel "Gesundheit A-Z" eine sehr große Zahl von Aufsätzen online gestellt, die sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen: Gesundheitsverhalten (Alkoholkonsum, Adipositas und Übergewicht, Ernährung usw.), Erkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Hauterkrankungen), Gesundheit und Lebensqualität, soziale Lage, Umwelt und Gesundheit. Bei den weit über 100 Artikeln handelt es sich teilweise um kürzere Abstracts aus eigenen Forschungsvorhaben, die Hinweise zu weiterführender Literatur enthalten.
Das Robert-Koch-Institut hat hier unter dem Titel "Gesundheit A-Z" eine sehr große Zahl von Aufsätzen online gestellt, die sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen: Gesundheitsverhalten (Alkoholkonsum, Adipositas und Übergewicht, Ernährung usw.), Erkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Hauterkrankungen), Gesundheit und Lebensqualität, soziale Lage, Umwelt und Gesundheit. Bei den weit über 100 Artikeln handelt es sich teilweise um kürzere Abstracts aus eigenen Forschungsvorhaben, die Hinweise zu weiterführender Literatur enthalten.
Zu einem Großteil findet man hier aber auch Themenhefte aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes, die hier incl. aller Grafiken und Tabellen als komplette PDF-Dateien heruntergeladen werden können. Hier steht eine große Zahl aktueller und wichtiger Themenhefte zur Auswahl. Zur Zeit (März 2008) werden folgende Themenhefte zum Download angeboten:
• Altersdemenz - GBE-Heft 28
• Angststörungen - GBE-Heft 21
• Arbeitslosigkeit und Gesundheit - GBE-Heft 13
• Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten - GBE-Heft 38
• Armut bei Kindern und Jugendlichen - GBE-Heft 4
• Brustkrebs - GBE-Heft 25
• Bürger- und Patientenorientierung - GBE-Heft 32
• Chronische Schmerzen - GBE-Heft 7
• Dekubitus - GBE-Heft 12
• Diabetes mellitus - GBE-Heft 24
• Doping beim Freizeit- und Breitensport - GBE-Heft 34
• Gebärmuttererkrankungen - GBE-Heft 37
• Gesundheit alleinerziehender Mütter und Väter - GBE-Heft 14
• Gesundheit im Alter - GBE-Heft 10
• Gesundheitsbedingte Frühberentung - GBE-Heft 30
• Gesundheitsprobleme bei Fernreisen - GBE-Heft 3
• Harninkontinenz - GBE-Heft 39
• Hautkrebs - GBE-Heft 22
• Heimtierhaltung - Chancen und Risiken für die Gesundheit - GBE-Heft 19
• Hörstörungen und Tinnitus - GBE-Heft 29
• Inanspruchnahme alternativer Methoden in der Medizin - GBE-Heft 9
• Koronare Herzkrankheit und akuter Myokardinfarkt - GBE-Heft 33
• Körperliche Aktivität - GBE-Heft 26
• Lebensmittelbedingte Erkrankungen - GBE-Heft 6
• Medizinische Behandlungsfehler - GBE-Heft 5
• Organtransplantation und Organspende - GBE-Heft 17
• Prostataerkrankungen - GBE-Heft 36
• Schlafstörungen - GBE-Heft 27
• Schuppenflechte - GBE-Heft 11
• Selbsthilfe im Gesundheitsbereich - GBE-Heft 23
• Sterbebegleitung - GBE-Heft 2
• Übergewicht und Adipositas - GBE-Heft 16
• Ungewollte Kinderlosigkeit - GBE-Heft 20
Hier ist die Übersichtsseite Gesundheit A-Z
Gerd Marstedt, 26.10.2006
Basisdaten der GKV und des Gesundheitswesens in Deutschland 2005
 Die neue Auflage der Broschüre "Ausgewählte Basisdaten des Gesundheitswesens 2005", herausgegeben vom Verband der Angestelltenkrankenkassen (VdAK), ist jetzt online verfügbar. Alle Tabellen und Grafiken der Broschüre stehen zum Download in einer Datei (ZIP-Archiv) zur Verfügung, können aber auch online einzeln betrachtet werden (PDF-Dateien). Die Broschüre enthält unter anderem folgende Daten:
Die neue Auflage der Broschüre "Ausgewählte Basisdaten des Gesundheitswesens 2005", herausgegeben vom Verband der Angestelltenkrankenkassen (VdAK), ist jetzt online verfügbar. Alle Tabellen und Grafiken der Broschüre stehen zum Download in einer Datei (ZIP-Archiv) zur Verfügung, können aber auch online einzeln betrachtet werden (PDF-Dateien). Die Broschüre enthält unter anderem folgende Daten:
• Rahmendaten: GKV - Ausgaben und Einnahmen, GKV - Ausgaben und Einnahmen - je Mitglied, Solidarität in der GKV, Zahl der Krankenkassen
• Krankenversicherungsschutz und Mitgliederentwicklung: Anzahl der Mitglieder, Familienversicherten und Versicherten, Mitgliederstruktur in der GKV, PKV-Versicherungsbestand, Wechsel zwischen PKV und GKV
• Risikostrukturausgleich: Altersstruktur nach Kassenarten, Funktionsweise des RSA, RSA-Transfersummen nach Kassenarten 1994 - 2003, RSA-Transferzahlungen - 2003
• Beitragssätze und beitragspflichtige Einnahmen: Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2004/2005, Beitragssätze und Beitragssatzspannen in der GKV, Verteilung der Mitglieder nach Beitragssätzen, VdAK/AEV - allgemeine Beitragssätze , Beitragssatzentwicklung in der GKV
• Leistungsausgaben: Träger der Ausgaben für Gesundheit, GKV-Leistungsausgaben - alte und neue Bundesländer, Anteile der Ausgabenbereiche in der GKV, GKV-Ausgaben nach Leistungsbereichen in Mio. EUR, GKV-Ausgaben nach Leistungsbereichen - je Mitglied
• Angebotskapazitäten: Niedergelassene Ärzte nach Bundesländern, Vertragsärzte nach Arztgruppen, Zu- und Abgang von Kassen- / Vertragsärzten, Allgemeine Krankenhäuser und Betten nach Trägern und Bundesländern, im Krankenhaus tätige Ärzte nach Bundesländern, Krankenhauspersonal nach Berufsgruppen, Krankenhausindikatoren: Krankenhäuser, Betten, Pflegetage und Fälle, Krankenhausbetten im internationalen Vergleich, Apotheken nach Bundesländern, Wertschöpfung im Pharmabereich, Arzneimittelverordnungen nach Packungsgrößen, Arzneimittelverbrauch in Endverbraucherpreisen
• Zuzahlungen und Befreiungsmöglichkeiten: Zuzahlungen nach Leistungsbereichen, Teilweise Befreiung von der Zuzahlungspflicht, Zuzahlungen der Versicherten bei Arzneimitteln
• Soziale Pflegeversicherung: Ambulante und stationäre Pflege - Leistungsempfänger, Ambulante Pflege - Verteilung der Leistungsempfänger auf die Pflegestufen, Stationäre Pflege - Verteilung der Leistungsempfänger auf die Pflegestufen, Einnahmen und Leistungsausgaben, Entwicklung der Leistungsausgaben nach Bereichen
Die jährlich vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) aktualisierten Basisdaten des Gesundheitswesens sind über die Website des Verbandes kostenlos erhältlich.
Gerd Marstedt, 28.12.2005
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
 Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen veröffentlicht auf dieser Seite seine Gutachten, die im Abstand von 2-3 Jahren erscheinen und sich mit aktuellen Fragen der gesundheitlichen Versorgung und der Finanzierung des Gesundheitswesens beschäftigen. Die Titel der Gutachten klingen immer ein wenig trocken ("Koordination und Qualität im Gesundheitswesen", "Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit") und motivieren nicht gerade zur Lektüre. Jedoch: Diese Gutachten bieten immer eine außerordentlich detaillierte und fundierte Übersicht über neuere Forschungsbefunde, sie sind in gewisser Hinsicht das, was in der wissenschaftlichen Szene als Übersichtsartikel zum Forschungsstand gilt. Schwerpunkte im aktuellen Gutachten sind Forschungsbefunde über Gesundheit und soziale Ungleichheit, Prävention sowie Fragen der Arzneimittelverordnung. Im Gutachten 2003 lagen Schwerpunkte bei den Themen "GKV" und "Patienteninformation". Die Gutachten der letzten Jahre sind alle als (meist sehr umfangreiche) PFD-Dateien verfügbar.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen veröffentlicht auf dieser Seite seine Gutachten, die im Abstand von 2-3 Jahren erscheinen und sich mit aktuellen Fragen der gesundheitlichen Versorgung und der Finanzierung des Gesundheitswesens beschäftigen. Die Titel der Gutachten klingen immer ein wenig trocken ("Koordination und Qualität im Gesundheitswesen", "Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit") und motivieren nicht gerade zur Lektüre. Jedoch: Diese Gutachten bieten immer eine außerordentlich detaillierte und fundierte Übersicht über neuere Forschungsbefunde, sie sind in gewisser Hinsicht das, was in der wissenschaftlichen Szene als Übersichtsartikel zum Forschungsstand gilt. Schwerpunkte im aktuellen Gutachten sind Forschungsbefunde über Gesundheit und soziale Ungleichheit, Prävention sowie Fragen der Arzneimittelverordnung. Im Gutachten 2003 lagen Schwerpunkte bei den Themen "GKV" und "Patienteninformation". Die Gutachten der letzten Jahre sind alle als (meist sehr umfangreiche) PFD-Dateien verfügbar.
Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
Gerd Marstedt, 29.7.2005
Zahlen und Fakten zur Gesundheit
 Die Bundeszentrale für politische Bildung hat diese Daten-Sammlung ins Netz gestellt und beschreibt ihr Informationsangebot so: "Welche gesellschaftlichen Kosten verursacht Arbeitslosigkeit? Wie viele Menschen leben im Jahr 2050 in Deutschland? Zahlen und Fakten gibt Antworten: Mehr als 140 kommentierte Grafiken versammeln die wichtigsten Daten zur sozialen Situation in Deutschland."
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat diese Daten-Sammlung ins Netz gestellt und beschreibt ihr Informationsangebot so: "Welche gesellschaftlichen Kosten verursacht Arbeitslosigkeit? Wie viele Menschen leben im Jahr 2050 in Deutschland? Zahlen und Fakten gibt Antworten: Mehr als 140 kommentierte Grafiken versammeln die wichtigsten Daten zur sozialen Situation in Deutschland."
Auch in der Rubrik "Gesundheit" findet man eine große Zahl solcher Diagramme, zum Beispiel Krankenstand der Arbeitnehmer 1980-heute, Arbeitsunfähigkeit nach Berufsgruppen und Krankheitsarten, Gesetzliche Krankenkassen und Mitglieder, Pflegebedürftige heute und im Jahr 2020, Krankheitskosten nach Geschlecht, Alter und Krankheitsart.
Bundeszentrale für politische Bildung Zahlen und Fakten zur Gesundheit
Gerd Marstedt, 27.7.2005
Gesundheits-, Arbeits- und Sozialstatistik
 Das vom Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung herausgegebene "Statistische Taschenbuch - Arbeits- und Sozialstatistik" enthält neben Grunddaten der sozialen Sicherung aus allen Sozialversicherungsbereichen (z.B. Art und Umfang von Leistungen) ausführliche gesamtwirtschaftliche Daten (z.B. Bruttoinlandsprodukt, Lohnquoten, Beschäftigung, Preise oder Lohnstückkosten) in mehrjähriger Darstellung.
Das vom Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung herausgegebene "Statistische Taschenbuch - Arbeits- und Sozialstatistik" enthält neben Grunddaten der sozialen Sicherung aus allen Sozialversicherungsbereichen (z.B. Art und Umfang von Leistungen) ausführliche gesamtwirtschaftliche Daten (z.B. Bruttoinlandsprodukt, Lohnquoten, Beschäftigung, Preise oder Lohnstückkosten) in mehrjähriger Darstellung.
Die nationalen und internationalen Zeitreihen reichen in vielen Fällen bis ins Jahr 1950 zurück. Die stets aktualisierten Daten können entweder im Internet als Excel-Tabellen angesehen werden oder komplett als Datei heruntergeladen werden.
Hier findet sich das Statistische Taschenbuch - Arbeits- und Sozialstatistik
Bernard Braun, 27.7.2005
Statistisches Taschenbuch Gesundheit 2005
 Alle zwei Jahre veröffentlicht das Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung das "Statistische Taschenbuch Gesundheit", das die Lücken zwischen den Bänden der "Daten des Gesundheitswesens" schließt.
Alle zwei Jahre veröffentlicht das Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung das "Statistische Taschenbuch Gesundheit", das die Lücken zwischen den Bänden der "Daten des Gesundheitswesens" schließt.
Die jüngste Ausgabe (Stand Oktober 2005, 170 Seiten) enthält ausführliche Zusammenstellungen von Daten zu den Bereichen Demographie, Morbidität, Verhaltensrisiken, Mortalität, Arzneimittel, stationäre Versorgung, Finanzierungsfragen und Gesundheitsausgaben. Die in teilweise langen Zeitreihen aufbereiteten Daten können nach Sachgebieten getrennt im Internet angeschaut werden oder auch alle gemeinsam heruntergeladen werden.
Download: Statistisches Taschenbuch Gesundheit 2005
Bernard Braun, 27.7.2005
Soziale und gesundheitliche Indikatoren in Zeitreihen
 Das "System Sozialer Indikatoren" wird von der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) herausgegeben. Es bietet Zeitreihen (oft seit 1960) für sehr unterschiedliche statistische Daten aus Deutschland aus den Bereichen sozio-ökonomische Gliederung und Schichteinstufung, Arbeitsmarkt und Beschäftigungsbedingungen, Einkommen und Verteilung, Einkommensverwendung und Versorgung, Verkehr, Wohnung, Bildung, Umwelt, Öffentliche Sicherheit und Kriminalität, Partizipation und andere mehr. "Die knapp 400 Indikatoren und über 3000 Zeitreihen, die das System sozialer Indikatoren gegenwärtig umfasst, vermitteln ein empirisches Bild der Veränderung der Lebensbedingungen der Bevölkerung und des Wandels von Makrostrukturen der Gesellschaft. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich vom Beginn der fünfziger Jahre bis zur Gegenwart und umfasst damit die gesamte Zeit der Existenz der Bundesrepublik Deutschland."
Das "System Sozialer Indikatoren" wird von der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) herausgegeben. Es bietet Zeitreihen (oft seit 1960) für sehr unterschiedliche statistische Daten aus Deutschland aus den Bereichen sozio-ökonomische Gliederung und Schichteinstufung, Arbeitsmarkt und Beschäftigungsbedingungen, Einkommen und Verteilung, Einkommensverwendung und Versorgung, Verkehr, Wohnung, Bildung, Umwelt, Öffentliche Sicherheit und Kriminalität, Partizipation und andere mehr. "Die knapp 400 Indikatoren und über 3000 Zeitreihen, die das System sozialer Indikatoren gegenwärtig umfasst, vermitteln ein empirisches Bild der Veränderung der Lebensbedingungen der Bevölkerung und des Wandels von Makrostrukturen der Gesellschaft. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich vom Beginn der fünfziger Jahre bis zur Gegenwart und umfasst damit die gesamte Zeit der Existenz der Bundesrepublik Deutschland."
In der Rubrik "Gesundheit" findet man gut 30 Indikatoren, die für die letzten Jahrzehnte Veränderung oder auch Stagnation aufzeigen: Lebenserwartung, Tabakkonsum, Teilnahme an Früherkennung, Sterblichkeit durch unterschiedliche Erkrankungen, Zahl der Ärzte usw. Die Tabellen für jeweils einen Bereich können als PDF-Dateien heruntergeladen werden, separat dazu gibt es eine kurze Beschreibung der Indikatoren.
Hier findet man das GESIS System Sozialer Indikatoren
Gerd Marstedt, 25.7.2005
Gesundheitsberichterstattung des Bundes
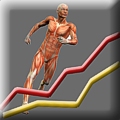 Die (bislang noch) frei und kostenlos zugängliche Datenbank des Bundes mit vielen statistischen und epidemiologischen Daten und auch Übersichtsartikeln zu vielen Themen: Gesundheitsberichterstattung, Rahmenbedingungen, Gesundheitliche Lage, Gesundheitsverhalten und -gefährdungen, Krankheiten und Gesundheitsprobleme, Ressourcen der Gesundheitsversorgung, Leistungen, Inanspruchnahme, Ausgaben, Kosten, Finanzierung, Ausgewählte OECD-Daten ("Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung"), Ausgewählte WHO-Daten. Alle Artikel sind angereichert durch Tabellen und Diagramme, die Themenpalette wird häufig aktualisiert und erweitert.
Die (bislang noch) frei und kostenlos zugängliche Datenbank des Bundes mit vielen statistischen und epidemiologischen Daten und auch Übersichtsartikeln zu vielen Themen: Gesundheitsberichterstattung, Rahmenbedingungen, Gesundheitliche Lage, Gesundheitsverhalten und -gefährdungen, Krankheiten und Gesundheitsprobleme, Ressourcen der Gesundheitsversorgung, Leistungen, Inanspruchnahme, Ausgaben, Kosten, Finanzierung, Ausgewählte OECD-Daten ("Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung"), Ausgewählte WHO-Daten. Alle Artikel sind angereichert durch Tabellen und Diagramme, die Themenpalette wird häufig aktualisiert und erweitert.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes
Gerd Marstedt, 12.7.2005
Sozialpolitik aktuell
 Die Website bietet nach eigener Angabe "aktuelle und umfassende Informationen zu allen Bereichen der Sozialpolitik" in Deutschland. Tatsächlich findet man hier Links zu sehr vielen Dokumenten im Web: Bundestags-Drucksachen, Papiere von Enquete-Kommissionen, Stellungnahmen von Verbänden, Parteien und Gewerkschaften. Auch viele sozialpolitische Datensammlungen und Statistiken sind im Fundus der Website, die sehr häufig aktualisiert wird und damit auch neuere und sehr frisch auf den Markt gekommene Dokumente anbietet. Die Hauptrubriken sind gegliedert nach unterschiedlichen Interessen-Kriterien (Grundinformationen, Berichte und Dokumente, Kontrovers usw.), in den Unterrubriken (Gesundheitswesen, Europa, Arbeitsmarkt usw.) findet man noch einmal eine thematische Aufgliederung. Ein sehr umfassender Fundus an Dokumenten und Informationen!
Die Website bietet nach eigener Angabe "aktuelle und umfassende Informationen zu allen Bereichen der Sozialpolitik" in Deutschland. Tatsächlich findet man hier Links zu sehr vielen Dokumenten im Web: Bundestags-Drucksachen, Papiere von Enquete-Kommissionen, Stellungnahmen von Verbänden, Parteien und Gewerkschaften. Auch viele sozialpolitische Datensammlungen und Statistiken sind im Fundus der Website, die sehr häufig aktualisiert wird und damit auch neuere und sehr frisch auf den Markt gekommene Dokumente anbietet. Die Hauptrubriken sind gegliedert nach unterschiedlichen Interessen-Kriterien (Grundinformationen, Berichte und Dokumente, Kontrovers usw.), in den Unterrubriken (Gesundheitswesen, Europa, Arbeitsmarkt usw.) findet man noch einmal eine thematische Aufgliederung. Ein sehr umfassender Fundus an Dokumenten und Informationen!
Sozialpolitik aktuell
Gerd Marstedt, 10.7.2005