



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Spezielle Krankheiten |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Spezielle Krankheiten
Zwei neue Studien: COVID-19 ist gef�hrlicher als die saisonale Influenza
 Eine Studie aus Frankreich befasst sich mit der Frage, wie sich COVID-19 und Influenza bezüglich Morbidität und Mortalität unterscheiden. Verglichen wurden dazu Krankenhauspatient*innen zum Zeitpunkt der Entlassung. Dazu wurden die Daten von 89.530 COVID-19-Patient*innen aus dem Zeitraum 1.3.-30.4.2020 mit 45.819 Influenza-Patienten aus dem Zeitraum 1.12.2018 bis 28.2.2019 verglichen. Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie. Die Diagnosen und Prozeduren (abrechenbare Behandlungsmaßnahmen) aller Patienten, die in öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Frankreich behandelt werden, stehen in einer nationalen Datenbank (Programme de médicalisation des systèmes d'information) zur Verfügung.
Eine Studie aus Frankreich befasst sich mit der Frage, wie sich COVID-19 und Influenza bezüglich Morbidität und Mortalität unterscheiden. Verglichen wurden dazu Krankenhauspatient*innen zum Zeitpunkt der Entlassung. Dazu wurden die Daten von 89.530 COVID-19-Patient*innen aus dem Zeitraum 1.3.-30.4.2020 mit 45.819 Influenza-Patienten aus dem Zeitraum 1.12.2018 bis 28.2.2019 verglichen. Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie. Die Diagnosen und Prozeduren (abrechenbare Behandlungsmaßnahmen) aller Patienten, die in öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Frankreich behandelt werden, stehen in einer nationalen Datenbank (Programme de médicalisation des systèmes d'information) zur Verfügung.
Im Krankenhaus verstarben 15.104 der 89.530 COVID-19-Patienten (16,9%) und 2640 der 45.819 Influenza-Patient*innen (5,8%). Das Sterberisiko war also 2,9 mal höher für COVID-19-Patient*innen als für Influenza-Patient*innen, altersadjustiert war das Risiko mit 2,82 geringfügig niedriger.
Auf die Intensivstation (ICU) wurden mehr COVID-19-Patient*innen aufgenommen (16,3% vs. 10,8%), die Dauer des ICU-Aufenthaltes war länger (15 vs. 8 Tage), der Anteil der mechanisch Beatmeten unter den ICU-Patient*innen war höher (71,5% vs. 61,0%).
Der Anteil der Verstorbenen (Fallsterblichkeitsrate) war erhöht bei
• ICU-Patienten (27,1% vs. 18%),
• ICU-Patienten mit mechanischer Beatmung (31,8% vs. 26)
• ICU-Patienten ohne mechanische Beatmung (17,2% vs. 5,4%).
Das Durchschnittsalter der COVID-19-Patient*innen war höher (65 vs. 59 Jahre), insbesondere war der Anteil jüngerer Patienten niedriger, so waren 1,4% der COVID-19-Patient*innen unter 18 Jahre im Vergleich zu 19,5% der Influenza-Patient*innen. Der Anteil der Männer war bei COVID-19 höher (53,0% vs. 48,3%).
Folgende Ko-Morbiditäten waren bei COVID-19-Patient*innen mit statistischer Signifikanz erhöht: Bluthochdruck (33,1% vs. 28,2%), Übergewicht (11,3% vs. 6,1%), Adipositas (9,6% vs. 5,4%), Diabetes (19,0% vs. 16,0%), Fettstoffwechselstörung (5,0% vs. 4,5%). Bei der Influenza waren mit statistischer Signifikanz häufiger: chronische Atemwegserkrankungen (4,0% vs. 1,6%), Immunschwäche (4,4% vs. 3,8%).
Folgende Ereignisse während des Krankenhausaufenthaltes waren bei COVID-19-Patient*innen erhöht: akutes Lungenversagen (27,2% vs. 17,4%), Lungenembolie (3,4% vs. 0,9%), septischer Schock (2,8% vs. 2,0%), akutes Nierenversagen (6,4% vs. 4,9%). Bei Influenza waren häufiger: Herzinfarkt (Herzinfarkt 1,1% vs. 0,6% und Vorhofflimmern (15,8% vs. 12,4%).
Zusammenfassend hat COVID-19 in Frankreich in 2 Monaten im Jahr 2020 zu fast doppelt so vielen Krankenhausaufenthalten geführt, als die Influenza in 3 Monaten um die Jahreswende 2018/19. Die Komplikationsraten waren höher, die Verläufe ungünstiger und die Sterblichkeit (Fallsterblichkeitsrate) im Krankenhaus fast 3fach erhöht.
Eine methodisch ähnliche amerikanische Studie mit den Daten der mehr als 9 Mio. Personen, die über das US Department of Veterans Affairs gesundheitlich versorgt werden, ergab ähnliche Ergebnisse (Xie et al. 15.12.2020). Verglichen wurden 3641 COVID-19-Patient*innen, die zwischen dem 1.2. und 17.6 2020 ins Krankenhaus aufgenommen wurden mit 12.676 Influenza-Patient*innen zwischen 2017 und 2019. Bei Patient*innen mit der Diagnose COVID-19 war das Sterberisiko um den Faktor 4,97 erhöht, Die Wahrscheinlichkeit für mechanische Beatmung 4,01fach und die Wahrscheinlichkeit für die Verlegung auf die ICU 2,41fach (alle Werte für Alter und weitere Einflussfaktoren adjustiert).
Zusammenfassend handelt es sich um zwei Studien mit soliden Daten einer jeweils großen Population (alle Krankenhauspatienten in Frankreich bzw. alle Veterans Affairs-Versicherten in den USA). Der Vergleich der Patient*innen mit der Diagnose COVID-19 und Influenza ergibt in beiden Populationen eine deutlich erhöhte Sterblichkeit und ein höheres Risiko für Komplikationen und schwere Verläufe für COVID-19.
Im Zusammenhang mit der Übersterblichkeit der ersten und jetzt auch zweiten SARS-CoV-2-Infektionswelle dürfte für die These, COVID-19 sei nicht gefährlicher als eine Grippe, kein Raum mehr bleiben.
Piroth L, Cottenet J, Mariet A-S, Bonniaud P, Blot M, Tubert-Bitter P, et al. Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. The Lancet Respiratory Medicine. Veröffentlicht 17.12. 2020. Download
Xie Y, Bowe B, Maddukuri G, Al-Aly Z. Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. BMJ. 2020;371:m4677. Veröffentlicht am 15.12.2020 Link
Vertiefung: Zusatzkapitel Corona (fortlaufende Aktualisierung) zum Lehrbuch Sozialmedizin - Public Health - Gesundheitswissenschaften. 4. Auflage März 2020.
Download: www.sozmad.de
David Klemperer, 25.12.20
Sars-CoV-2 und Covid-19: Anmerkungen zur aktuellen Krise und was lernen wir daraus?!
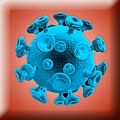 Dies ist kein verspäteter Einstieg in eine regelmäßige Berichterstattung über Studien etc. zum neuen Sars-CoV-2 oder Covid-19, kein vollständiger Überblick über die Entwicklung der letzten Wochen und Monate und auch kein vollständiger Überblick über künftig einfach und unaufwändig zu nutzenden qualitativ hochwertigen Informationsquellen. Stattdessen soll dieser Beitrag einige Aspekte der so genannten "Coronakrise" als etwas euphemistischer Oberbegriff für eine Fülle von gesundheitlichen, ökonomischen, sozialen und kommunikativen Krisen aufgreifen und darstellen, was daraus für die künftige Gesundheitspolitik und möglicherweise vergleichbare oder gar schlimmere Krisensituationen folgt. Dabei konzentrieren wir uns eher auf wissenschaftliche Daten und Beiträge als auf amtliche Quellen wie z.B. die regelmäßige Berichterstattung durch das Robert-Koch-Institut (RKI), die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder den vergleichbaren internationalen Institutionen.
Dies ist kein verspäteter Einstieg in eine regelmäßige Berichterstattung über Studien etc. zum neuen Sars-CoV-2 oder Covid-19, kein vollständiger Überblick über die Entwicklung der letzten Wochen und Monate und auch kein vollständiger Überblick über künftig einfach und unaufwändig zu nutzenden qualitativ hochwertigen Informationsquellen. Stattdessen soll dieser Beitrag einige Aspekte der so genannten "Coronakrise" als etwas euphemistischer Oberbegriff für eine Fülle von gesundheitlichen, ökonomischen, sozialen und kommunikativen Krisen aufgreifen und darstellen, was daraus für die künftige Gesundheitspolitik und möglicherweise vergleichbare oder gar schlimmere Krisensituationen folgt. Dabei konzentrieren wir uns eher auf wissenschaftliche Daten und Beiträge als auf amtliche Quellen wie z.B. die regelmäßige Berichterstattung durch das Robert-Koch-Institut (RKI), die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder den vergleichbaren internationalen Institutionen.
These/Behauptung: Die Sars-CoV-2- oder Covid-19-Epidemie überraschte die Gesundheitspolitik und zwang sie vom Punkt Null des Wissens und Handelns zu starten!
Nein! Die Wahrscheinlichkeit, Art und Umfang der Risiken einer Coronavirus-Epidemie oder gar Pandemie und ein Repertoire von Vorsorgemaßnahmen wie Kriseninterventionen waren seit 2003 und in regelmäßigen Abständen aktualisiert Ausgangspunkt für zahlreiche auch wissenschaftlich fundierte offizielle und öffentlich bekannt gemachte Szenarien, Maßnahmenkataloge und explizite Pandemiepläne auf Bundes- wie Landesebene.
Im Einzelnen sind dies:
• Die Erfahrungen mit der Sars (Severe acute respiratory syndrome)-Pandemie in den Jahren 2002 und 2003, deren Verursacher ein bis dahin unbekanntes Coronavirus war - das Sars-assoziierte Coronavirus (Sars-CoV).
• Ein weiteres, vorher unbekanntes Coronavirus (MERS-CoV) war Verursacher einer erstmals 2012 beobachteten schweren Atemwegserkrankung - von MERS (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus).
• Mehrere wissenschaftliche Studien wiesen darauf hin, dass es noch wesentlich mehr Coronaviren gibt, die potenziell Epidemien auslösen könnten und gegen die es auch zum Untersuchungszeitpunkt weder Impfstoffe noch Medikamente gab. Die Frage war also nicht ob, sondern wann weitere CoV-Epidemien starteten. Darauf wies ein 2016 in den "Proceedings of the National Academy of Science" der USA veröffentlichter Aufsatz über "Sars-like CoVs" nachdrücklich hin: "The recent outbreaks of Ebola, influenza, and MERS-CoV underscore the threat posed by viruses emerging from zoonotic sources. Coupled with air travel and uneven public health infrastructures, it is critical to develop approaches to mitigate these and future outbreaks."
• Dabei blieb es gerade in Deutschland nicht bei wissenschaftlichen Studien oder Laborberichten. So hatten Expert*innen im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren 2012 eine umfangreiche Risikoanalyse über zwei Großkrisenereignisse erstellt, die als "Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012" am 3.1.2013 als Drucksache 17/12051 dem Bundestag überreicht wurde. Eines der simulierten Risiken war eine Pandemie durch das fiktive Virus Modi-Sars. Dabei lagen die Annahmen zur Anzahl der infizierten und erkrankungsbedingt gestorbenen Personen zum Teil deutlich über der aktuellen Realität. Die Dauer und Anzahl der Infektionswellen bis zum Vorliegen eines Impfstoffs (3 Jahre, 3 Wellen) könnten aber zutreffen. Was in jedem Fall aber realistisch erkannt wurde, ist der drohende Mangel an Schutzausrüstungen für die Bevölkerung und die im Gesundheitsbereich Beschäftigten.
• Wenn man nicht mehr nur untersucht, wie in Deutschland der Wissensstand über das bevölkerungsbezogene Erkrankungsrisiko explizit durch Coronaviren war und wie die Gesundheitspolitik damit umzugehen beabsichtigte, landet man bei seit 2005 mehrmals fortgeschriebenen Pandemieplänen und Verordnungen auf Bundes- wie Länderebene. Dort wird explizit von der Herausforderung durch eine allgemeiner gefasste Influenzapandemie ausgegangen. Dass aber auch von der "H1N1-Influenzapandemie" (dazu zählen mehrere Viren, die die so genannte "spanische Grippe" von 1918 verursacht haben und aktuell das Schweinegrippevirus) gesprochen wird, zeigt, dass es hier nicht "nur" um die jährliche Grippeinfluenzaepidemie geht. In dem vor der Covid-19-Pandemie zuletzt 2016/17 aktualisierten zweibändigen "Nationalen Pandemieplan" des RKI heißt es im Vorwort des Bandes über "wissenschaftliche Grundlagen": "Bei einer Influenzapandemie ist davon auszugehen, dass im Vergleich zur saisonalen Influenza sowohl die Erkrankungsrate insgesamt als auch der Anteil schwerer Verläufe deutlich erhöht ist. Auch unter der Prämisse einer möglichst effektiven ambulanten Versorgung ist mit einer außergewöhnlichen Belastungssituation in den Krankenhäusern zu rechnen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das medizinische Personal selbst von krankheitsbedingten Ausfällen betroffen ist. Der massenhafte Anfall von stationär behandlungsbedürftigen Patienten, die teilweise beatmungspflichtig sind, erfordert in den Krankenhäusern im Vorfeld klare Festlegungen bezüglich der organisatorischen Umsetzung." Und die Forderung bzw. Absicht zur "Bevorratung bzw. Managementkonzept für rasche Beschaffung im Ereignisfall" umfasst "Antibiotika, Schmerzmittel, Sedativa, Einmalhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz und FFP2-Masken/FFP3-Masken für risikoträchtige Tätigkeiten". Im Band über die wissenschaftlichen Grundlagen findet sich auch eine Vielzahl von Hinweisen auf im Jahr 2016/17 vorhandene wie auf fehlende Studien über die Wirkung und die Machbarkeit von Interventionen wie das Tragen von Masken, Schulschließungen und Kontaktverbote etc. Ab Seite 51 stehen schließlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit zahlreiche Hinweise auf "zu erfassende Parameter zu Beginn einer Pandemiewelle und mögliche Studienansätze" sowie deren Vor- und Nachteile und den Aufwand für ihre Erstellung, worüber in den letzten Wochen zum Teil erst wieder nachgedacht und mit Zeitverzögerungen gehandelt wurde. Bei der Lektüre der 222 Seiten wird es aber irgendwann gebetsmühlenartig: Keine Studien, daher zu 8 zentralen Interventionsarten "großer Forschungsbedarf". Der "Nationale Pandemieplan Teil I Strukturen und Maßnahmen und der Nationale Pandemieplan Teil II Wissenschaftliche Grundlagen sind frei erhältlich und in einer Krisenpause immer noch lesenswert.
• Sehr praktische Hinweise auf Maßnahmen im Falle einer Influenzapandemie lagen seit 2006 (zuletzt aktualisiert 2012) mit dem Beschluss 609 "Arbeitsschutz beim Auftreten einer nicht ausreichend impfpräventablen humanen Influenza" des "Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe (ABAS)" vor. Dort heißt es u.a.: "Im Falle einer Influenzapandemie werden nicht alle benötigten Materialien in entsprechender Menge lieferbar sein. Deshalb sollten sie bereits rechtzeitig vor Eintreten des Pandemiefalls (interpandemische Phase) bevorratet werden." Und die umfangreiche Liste der zu bevorratenden Materialien reicht von "einfachem Mund-Nasen-Schutz (MNS) für betroffene (infektionsverdächtige) Patienten - ein MNS pro Patient" über "Händedesinfektionsmittel (begrenzt viruzid nach RKI-Empfehlung) - 5 ml pro Vorgang … einfachem Mund-Nasen-Schutz (MNS) für das medizinische Personal - mindestens ein MNS pro Person und Tag/Schicht: bei Erregern der Risikogruppe 2" bis zu "Atemschutzmasken (FFP2) für das medizinische Personal - mindestens eine Maske pro Person und Tag/Schicht".
• Zu den unbedingt notwendigen präventiven Maßnahmen gehörten in der Risikoanalyse zur simulierten Modi-Sars-Pandemie aus dem Jahr 2013 auch klare Angaben zur Risikokommunikation. So wurde nicht nur allgemein "die Wichtigkeit einer frühzeitigen und ernsthaften Beschäftigung mit der Thematik und einer entsprechenden Sensibilisierung der Bevölkerung betont". Dies begann mit der richtigen Einschätzung, dass es "bisher … keine Richtlinien (gibt), wie mit einem Massenanfall von Infizierten bei einer Pandemie umgegangen werden kann. Diese Problematik erfordert komplexe medizinische, aber auch ethische Überlegungen und sollte möglichst nicht erst in einer besonderen Krisensituation betrachtet werden" (65). Wie die gesundheitspolitische Debatte nach Veröffentlichung der Risikoanalyse hätte aussehen können bzw. müssen, zeigen zwei Passagen aus der Bundestagsdrucksache: "Die im Rahmen der Risikoanalyse gewonnenen Erkenntnisse bilden den Ausgangspunkt für ein ganzheitliches Risiko- und Krisenmanagement, welches auch eine entsprechende gesamtgesellschaftliche Diskussion umfassen muss. Denn während die Analyse der Risiken ein fachlicher Prozess ist, werden die Risikobewertung und die daraus folgende Abwägung und Auswahl z. B. von risikomindernden Maßnahmen in erheblichem Umfang von politischen und gesellschaftlichen Aspekten mitbestimmt. Folglich muss ein entsprechender Dialog zwischen Fachbehörden, Wissenschaft, Politik und Bevölkerung stattfinden. In diesem Zusammenhang ist es zwingend erforderlich, Schutzziele festzulegen, um die Ergebnisse der Risikoanalysen mit damit abgleichen und mögliche Defizite identifizieren zu können. So lässt sich auch feststellen, ob das Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes in Deutschland für alle zu erwartenden Schadenslagen hinreichend ausgelegt und vorbereitet ist, oder ob für Bund, Länder und Kommunen Handlungsbedarf besteht, und falls ja, wo." (12)]. Und ["Für die Akzeptanz der kommunizierten Botschaften ist essentiell, dass die Behörden 'auf Augenhöhe' mit der Bevölkerung kommunizieren. Der Bürger sollte als Partner, nicht als 'Befehlsempfänger' verstanden werden. (68).
These/Behauptung: Die besten Modelle taugen ohne Daten nichts, aber kann man an der Datenlage etwas ändern?
Jein! Trotz mittlerweile wochenlanger Datenerfassung und täglicher Berichte des RKI ist die Datenlage über viele Details der Epidemie immer noch dürftig bis nichtexistent. Da sie aber zur Begründung des Starts und des möglichen Endes von Maßnahmen dient, handelt es sich nicht um das übliche Statistik-Bashing, sondern um existenzielle Sachverhalte.
Exemplarisch zeigt sich dies am Status quo des zentralen Risikoindikators der Anzahl von "bestätigten Infektionen". Vor jeder empirischen Situation hätte jedem klar sein müssen, dass für valide und praktisch hilfreiche Berechnungen sowohl Zähler wie Nenner eindeutige und vollständige Angaben enthalten müssen und dass man dafür durch entsprechende Meldevorschriften sorgen kann und muss. Dies traf über lange Zeit weder für den Zähler noch den Nenner zu. In den Zähler ging bisher ein wildes Gemisch der Erkrankungsmeldungen von 412 Gesundheitsämtern und 16 Landesministerien, die nachgemeldeten Fälle von verschiedenen Tagen und in verschiedenen Erkrankungsstadien (richtig Neuerkrankte und bereits stationär Behandelte) ein. Noch schlimmer sah und sieht es mit den Angaben im Nenner aus. Bei noch so vielen "testen, testen-testen"-Appellen der WHO, ist nämlich in Deutschland bis heute unbekannt wie viele Tests täglich durchgeführt und damit Erkrankte entdeckt werden können. Simpel ausgedrückt: Ein Anstieg der entdeckten und bisher tagtäglich von RKI aber auch von der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität gemeldeten Erkrankten könnte ausschließlich auf der Zunahme der durchgeführten Tests beruhen und die mögliche Abnahme von Erkrankten auf der Abnahme der Testanzahl.
Dass es auch anders geht und welche wichtigen praktischen Erkenntnisse daraus gewonnen werden können, zeigt das "Epidemiologische Bulletin" Nr. 17 des RKI vom 9. April 2020 mit der Darstellung von Ergebnissen einer neuen Methode zur "Schätzung der aktuellen Entwicklung der Sars-CoV-2-Epidemie in Deutschland" namens Nowcasting. Zusammengefasst enthält Nowcast nicht mehr das oben beschriebene Gemisch von Daten, sondern meldet dank einer aufwändigen, aber seriösen statistischen Aufarbeitung ("multiple Imputation" von fehlenden Daten) die Anzahl von Personen, deren Erkrankung tagesgenau beginnt. Damit lässt sich der Effekt von Interventionen besser als mit den immer kommunizierten "ein bis zwei Wochen später" bestimmen. Die wichtigsten neuen und statistisch aussagekräftigeren Ergebnisse lauten:
• Die so genannte Reproduktionszahl R, d.h. die Anzahl von Personen, die eine infizierte Person mit CV ansteckt, sank vom Maximum von über 3 (dies war die Schubkraft für den immer wieder berichteten exponentiellen Anstieg der Erkrankten) um den 10. März 2020 auf die Werte 1 bis 1,2 zwischen Ende März und dem 4. April.
• Die Anzahl der mit Nowcast präziser erfassten Erkrankten fiel … auf … stieg in den letzten Tagen aber wieder leicht an.
• Beide Indikatoren zeigen einen deutlichen Effekt des Verbots von Großveranstaltungen und Schulschließungen am 9. März 2020 und 16. März 2020 aber praktisch keinen Effekt der bundesweiten Kontaktverbote vom 23. März 2020. Ob das wirklich so ist, lässt sich aber ohne Kenntnis der Anzahl getesteter Personen oder der Art der vielfach nur geschätzten Zahlen nicht sagen.
Dass es auch anders gehen kann, zeigen die österreichischen Daten. Dort findet sich auf dem "Amtlichen Dashboard Covid 19" seit längerer Zeit die Anzahl der Testungen. Am 16.4. waren dies insgesamt 156.801 Testungen, die zu 14.420 positiv getesteten Personen führte. Zu hoffen ist also, dass auch in Deutschland bald genaue Daten zur Testanzahl vorliegen.
Wer nicht nur für ein Land, eine oder zwei Interventionen oder für einen bestimmten Zeitpunkt etwas über die Existenz von Maßnahmen gegen die Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus und deren mögliche Wirkungen auf die Anzahl von Covid-19-Fälle wissen will, findet dies laufend im so genannten "Oxford Covid-19-Government Response Tracker (OxCGRT)" ("Variation in government responses to Covid-19" von Thomas Hale et al.). Dort werden 13 Indikatoren für politische Maßnahmen von Schulschließungen, Kontaktverboten, Verbot von Veranstaltungen bis zur Testpolitik für 146 Länder tagesgenau dokumentiert und klassifiziert und zu einem "Government response stringency index" zusammengefasst. Dieser Wert wird dann mit der Anzahl der Covid-19-Fälle zusammengebracht und auf Assoziationen untersucht. Eine Zeitreihe der Maßnahmen für alle Länder und den Indexwert beginnend am 1. Januar 2020 und tagesaktuell endend gibt es zum Herunterladen als Excel-Datei. Aber auch hier hängen viele Ergebnisse von der jeweiligen nationalen Datenlage ab.
Die Diskussion der Relevanz und Qualität von Indikatoren, die Fortschritte bei der Eindämmung oder Reduktion des Erkrankungsgeschehens anzeigen sollen, bei Modellierungen und bei politischen Entscheidungen genutzt werden, weist schließlich auf einen bisher erheblichen Mangel bei deren Auswahl und Kommunikation hin. War es wochenlang und bei fast allen Virologen die Verringerung der Zeitspanne in der sich die Anzahl der identifizierten Covid-Fälle (dabei spielte die Schwäche dieses Indikators keine Rolle) verdoppelten, die erreicht werden musste, um die "Tsunamiwelle" für die Intensivbetten verhindern sollte, rutschte die Marke von zunächst über 10 auf fast 20 Tage und war rechnerisch sogar noch länger, ist es seit Mitte April 2020 plötzlich die Reproduktionsrate R mit einem Wert unter 1. Dass auch hier viel geschätzt werden muss, wird im Moment noch wenig thematisiert und auch, dass ein zu niedriger Wert nicht uneingeschränkt positiv ist. Solange es nämlich keinen Impfstoff gibt, ist eine zu geringe Anzahl von Infizierten und damit möglicherweise corona-immunen Personen wegen der damit verbundenen Verlängerung der Erkrankungskrise nicht uneingeschränkt erstrebenswert.
These/Behauptung: Es gibt aktuell und auf absehbare Zeit keine oder zu wenige und auch qualitativ oft nicht hilfreiche wissenschaftlichen Studien über das Sars-CoV-2 oder Covid-19 und wichtige Maßnahmen!
Jein! Der sich immer noch beträchtlich erhöhenden Anzahl von Covid-19-Infizierten steht eine mindestens genauso kräftig wachsende Anzahl von fast durchweg frei zugänglichen wissenschaftlichen Studien über das Virus und die Erkrankung gegenüber, woran sich auch nichts ändern wird. Ob es sich bei der richtigen Beschreibung als "Pandemie des Wissens" (Werner Bartens in der Süddeutschen Zeitung vom 18./19.4. 2020) wirklich um eine uneingeschränkt "erfreuliche Nebenwirkung der Seuche" handelt, ist, wie die folgenden Beobachtungen zeigen, fraglich. Das Ideal von einem wissens- und evidenzbasierten Verständnis einer Erkrankungssituation und hilfreicher politischer Entscheidung für und gegen bestimmte Interventionen steht damit zum einen vor einem quantitativen Problem. Zum anderen zeigt aber die laufende öffentliche Debatte, dass auch erhebliche qualitative Herausforderungen angesichts widersprüchlicher oder methodisch dürftiger Studienergebnisse existieren.
Einen ersten Einblick in die rapide Zunahme der Anzahl von in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer Review und hohen Veröffentlichungsstandards publizierten Fachaufsätze bzw. Studienergebnisse zum Virus und zur Erkrankung liefert ein Auswertungstool von Pubmed, der weltweit größten Datenbank für derartige Publikationen.
Laut "Pubmed Bibliometry" wurden zwischen dem 1. November 2019 und dem 18. April 2020 in 1.355 dieser Zeitschriften 5.965 Aufsätze (2018=81) veröffentlicht, in deren Überschrift und/oder Abstract das Stichwort "Covid-19" auftaucht. Vor etwa einem Monat, genau am 21.3. 2020 waren es "nur" 1.303 Aufsätze in 353 Zeitschriften. Alleine am 18.4. wurden 301 neue Aufsätze veröffentlicht. Selbst wenn mittels des Indikators Altmetric für die Stärke der Resonanz einer Publikation nur noch die Veröffentlichungen gezählt werden, deren Wert über 500 liegt, gab es am 18.4. noch 418 Covid-Aufsätze (Auswertung Altmetric > 500 am 18.4.2020). Wer sich mit systematischen Reviews beschäftigt hat, weiß, dass es selbst mit hohem Personalaufwand unmöglich ist, in kurzer Zeit einen soliden Überblick und eine Bewertung einer derartigen Menge von dann noch permanent zunehmenden Menge von Publikationen zu schaffen. Hinzu kommt, dass durch zusätzliche Suchen mit Suchworten, die z.B. nur ein im Zusammenhang mit Covid-19 relevantes Medikament oder eine Maßnahme wie Schulschließung beinhalten, noch zahlreiche weitere Publikationen zu Tage gefördert werden.
Dafür spricht auch die Anzahl von "more than 32,000 articles, chapters, and other resources related to Covid-19, other coronaviruses, and related epidemics have already been made available in this manner", die als Ergebnis einer beispiellosen Initiative der 150 Mitglieder der "International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)" zu deren Beginn der interessierten Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung standen und stehen. Diese Mitglieder, darunter Wissenschafts-Großverlage wie Elsevier und Wiley mit Zeitschriften wie dem "British Medical Journal" oder "Lancet", veröffentlichen in 20 Ländern rund 66% aller wissenschaftlichen Publikationen, also auch die zu Covid-19. Zu den Zusammenstellungen der Verlage über ihre frei erhältlichen Publikationen zu den genannten Themen kommt man über "Coronavirus (Covid-19)".
Wer sich bei PubmedCentral (PMC) noch umfassender über den Forschungsstand zu Covid-19, Coronavirus, 2019-nCoV, Sars-CoV, MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome oder Middle East Respiratory Syndrome informieren will, fand am 18.4. 2020 57.995 Quellen - mit der bekannt großen täglichen Zunahme.
Natürlich gibt es jetzt in mehreren Ländern und von mehreren nationalen oder internationalen Institutionen spezielle Angebote unterschiedlichsten Umfangs und unterschiedlichster inhaltlicher Fülle, die einen Teil des Recherche- und Lektüreaufwands in den bisher genannten Primärquellen ersetzen können, aber selber auch sehr viel Arbeitsaufwand verlangen. Stellvertretend sei hier auf die Website "Finding the Evidence: Coronavirus" von Public Health England hingewiesen und dort speziell auf den "PHE International Epidemiology Daily Evidence Digest".
Und es gibt auch erste Zusammenfassungen oder Reviews des Forschungsstands, die häufig auch praktische Bedeutung haben. Hier sei exemplarisch auf den Review Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)A Review von James Sanders et al. in der Fachzeitschrift JAMA (online am 13.4.2020) verwiesen. Der kostenlos erhältliche Aufsatz kommt trotz einiger abweichender Statements und Handlungsempfehlungen (z.B. "compassionate use"-Ausnahmen für schwer an Covid-19 Erkrankte) zu dem Schluss: "No therapies have been shown effective to date."
Und dass sich an der Menge der veröffentlichten Studienergebnisse mit Sicherheit nichts ändert und die inhaltliche Vielfalt noch zunehmen wird, darauf verweisen die Anzahl laufender oder geplanter Forschungsprojekte. So waren am 16.4. 2020 auf der Website Clinicaltrials, wo sich zumindest die Mehrzahl der Projekte zu Beginn ihrer Arbeit mit Protokollen anmelden, insgesamt 621 Studien mit dem Thema Covid-19 angemeldet, darunter 202 Studien, die sich mit dem Virus Sars-CoV-2 beschäftigen wollten.
Wer wissen will wie viele und welche klinischen Forschungsprojekte und Studien zum Sars-CoV-2-Virus und zu Covid-19 in Deutschland laufen oder geplant sind, welche nicht-interventionelle Studien stattfinden oder welche Best Practice-Beispiele es gibt, findet diese auf der Website Klinische Studien des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) - mit Links zu den Studien.
Und schließlich gibt es einige Websites, die auch für die Zukunft versprechen wichtige Informationen und Debattenbeiträge zu liefern.
Dazu zählt z.B. das von bisher 18 wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Public Health-Verbänden aus dem deutschsprachigen Raum (z.B. Deutsche Gesellschaft für Public Health, Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft) und einem internationalen Partner getragene Kompetenznetz Public Health zu Covid-19. Die hier aktiven 7 Arbeitsgruppen dürften in absehbarer Zeit wichtige Erkenntnisse präsentieren.
Mit dem erklärten Schwerpunkt auf weltweit laufenden Studien zu den ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Coronakrise gibt seit kurzem das von diversen akademischen Institutionen gegründete und getragene World Pandemic Research Network einen hervorragenden Überblick. Für die derzeit (20.4. 2020) 55 Projekte werden jeweils der fachliche Schwerpunkt, kurze Projektbeschreibungen, die Forscher*innen und das methodische Design angegeben. Anmeldungen eigener Projekte sind Online möglich.
Und stellvertretend für eine Menge inhaltlich hilfreichen nichtinstitutionellen Blogs und von Angehörigen der "scientific community" organisierten Mailforen sei auf das von österreichischen Public Health-Experten, Medizinern und Angehörigen von Gesundheitsberufen bereits vor Beginn der Coronakrise geschaffene "PublicHealthForum" hingewiesen, das sich nicht nur mit der österreichischen Entwicklung beschäftigt, sondern auch auf eine Vielzahl von internationalen Beiträgen aufmerksam macht.
Aber selbst dann, wenn die Quantität der Studienergebnisse bewältigt ist oder wäre, gibt es ausgerechnet zu zentralen Aspekten der Coronakrisenbewältigung inhaltlich unklare und widersprüchliche Studien. Dies betrifft z.B. die Wirkung des Maskentragens. Auch wenn mittlerweile weitgehend klar ist, dass insbesondere die nicht-medizinischen Masken nicht den Träger vor einer Infektion schützen, sondern nur seine soziale Umgebung, dass verschiedene Arten von Masken unterschieden werden müssen und für Tragepflichten nachwievor zu wenig Masken erhältlich sind, liefern die wenigen aktuellen Studien nur widersprüchliche und oft nicht belastbaren Erkenntnisse zum Nutzen. So sieht eine am 24.3. 2020 veröffentlichte Studie des "Oxford Covid-19 Evidence Service Team" der Universität Oxford ("What is the efficacy of standard face masks compared to respirator masks in preventing Covid-type respiratory illnesses in primary care staff?" von Trish Greenhalgh et al.) zwar einen Nutzen von Masken, relativiert dies aber selber sofort mehrfach: "…this conclusion were not in a Covid-19 population, and only one was in a community setting. It is clear from the literature that masks are only one component of a complex intervention which must also include eye protection, gowns, behavioural measures to support proper doffing and donning, and general infection control measures." Insgesamt basierten Empfehlungen nur auf "indirect evidence".
Und auch die aktuellste "interim guidance" der WHO zum Gebrauch und Nutzen von Masken gegen das Sars-CoV-2-Virus (Advice on the use of masks in the context of Covid-19)sieht auch nur höchstens "limited evidence" dafür, "that wearing a medical mask by healthy individuals in the households or among contacts of a sick patient, or among attendees of mass gatherings may be beneficial as a preventive measure." Medizinische Masken sollten außerdem dem Gesundheitspersonal überlassen bleiben. Für alle anderen Maskentypen gibt es "no evidence that wearing a mask (whether medical or other types) by healthy persons in the wider community setting, including universal community masking, can prevent them from infection with respiratory viruses, including Covid-19." In jedem Fall sei das alleinige Tragen von Masken "insufficient to provide an adequate level of protection, and other measures should also be adopted. Whether or not masks are used, maximum compliance with hand hygiene and other IPC measures is critical to prevent human-to-human transmission of Covid-19."
Und das Ergebnis eines in der renommierten Medizinzeitschrift "Annals of Internal Medicine"am 6. April 2020 veröffentlichten Experiments mit 4 (!!) Teilnehmer*innen wird so zusammengefasst: "In conclusion, both surgical and cotton masks seem to be ineffective in preventing the dissemination of Sars-CoV-2 from the coughs of patients with Covid-19 to the environment and external mask surface." In dem Experiment durchdringen Viren die Masken und erreichen vor den Probanden aufgestellte Petrischalen. Weitere Aspekte (z.B. die "Reichweite" von Viren mit oder ohne Masken) wurde nicht untersucht. (Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking Sars-CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients von Seongman B. et al.). Als Erklärung für dieses frappierende Ergebnis boten die Autoren des Berichts, den das Deutsche Ärzteblatt auf der Online-Seite aerzteblatt.de am 7. April 2020 zu dieser Studie veröffentlichte folgende mögliche, aber nicht unbedingt praktisch hilfreiche Erklärung an: "Die Probanden wurden in der Studie nicht gebeten zu husten. Es könnte demnach sein, dass die Masken die Viren beim normalen Atmen aufhalten, der starken Beschleunigung der Partikel bei einem Hustenreiz jedoch nicht standhalten."
Was bedeutet dies alles für die Zeit nach Covid-19?
Egal ab wann die aktuelle Sars-CoV-2- und Covid-19-Krise für beendet erklärt wird, wird es eine Zeit danach geben, die, so eigentlich alle aktuellen Protagonisten, völlig anders aussieht als vor der Krise. Man werde auf der Basis der national wie EU-weit gestarteten Forschungsprogramme lernen und für künftige vergleichbare Krisen besser gerüstet sein.
Darauf zu vertrauen, dass dies wirklich geschieht und dazu noch in einer Art Selbstlauf, ist nach den Erfahrungen mit den Pandemieplänen und der Risikoanalyse 2013 naiv. Ohne die Vereinbarung ausdrücklicher und zeitlich verbindlicher Ziele und Schritte wie diese "Zeit danach" aussehen soll und erreicht wird, werden andere, und ja durchaus wichtige Probleme die politische Agenda bestimmen.
Zu den Maßnahmen, die dies verhindern helfen könnten und eventuell auch für den Umgang mit anderen gesellschaftlichen Krisen nützlich sind, gehören:
• Die Umsetzung der u.a. bereits in der "Risikoanalyse 2013" enthaltenen Aktivitäten und vieler neuer aktueller Handlungsempfehlungen muss durch öffentliche pflicht- und regelmäßige Fortschrittsberichte gesichert werden. Dazu gehören auch die Vereinbarung und Testung qualitativ hochwertiger und umsetzbarer Indikatoren, die auch über den unmittelbaren Bereich der Virologie oder Krankenversorgung hinausgehen und z.B. soziale Effekte bestimmter gesundheitsbezogener Maßnahmen oder systematische Risikostratifizierung umfasst. Es darf nicht sein, dass über die Bedeutung der Differenzierung nach soziodemografischen Merkmalen erst während einer Krise diskutiert wird und Maßnahmen wie Home-schooling systematisch an der Lebenswirklichkeit großer, bereits ohne eine Pandemie benachteiligter Bevölkerungsgruppen vorbeigeht (z.B. verfügen viele Familien aus unteren Sozialschichten weder über Laptops noch Wlan).
• Abkehr von einer Risikokommunikation, die politisch entschiedene Maßnahmen als "alternativlos" bezeichnet und vermitteln will.
• Genereller Verzicht auf "Angst" und "Erregung" als dominantes Mittel von Risikokommunikation. Was darunter zu verstehen ist, hat die Autorin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin Juli Zeh so zusammengefasst: "Wir wissen aus Erfahrung, wie gefährlich Angstmechanismen sind. Deshalb würde ich von verantwortlicher Politik und auch von verantwortlichen Medien verlangen, dass sie niemals Angst zu ihrem Werkzeug machen. Leider passiert seit Jahrzehnten das Gegenteil … Anstatt uns hoffnungsfroh Ziele für die Zukunft zu setzen, ist es seit der Jahrtausendwende quasi zur Tradition geworden, ein apokalyptisches Szenario nach dem anderen auszurufen und damit die Aufmerksamkeitsökonomie zu bedienen … Jede politische Richtung hat ihr eigenes Untergangsszenario, mit dem sie Werbung macht. Die Massenerregbarkeit der Gesellschaft ist immer größer geworden … zur Sachlichkeit zurückzukehren und die Bevölkerung als mündige Bürger zu behandeln." ("Es gibt immer eine Alternative" - Interview mit Juli Zeh in der Süddeutschen Zeitung vom 4./5. April 2020 - leider nicht kostenlos erhältlich). Diese Mahnung gilt auch für die Art der Kommunikation anderer Krisen und Probleme wie beispielsweise der über den Klimawandel.
• Angesichts des nicht nur im Falle der Coronakrise für Politiker und Wissenschaftler existierenden Zwangs, Entscheidungen und Empfehlungen auf unvollständiger, widersprüchlicher, unsicherer oder quantitativ wie qualitativ unübersichtlicher Faktenlage treffen und geben zu müssen, sollte verstärkt darüber nachgedacht werden ob und wie mittels Heuristiken mit weniger Aufwand schneller mehr erreicht werden kann (vgl. dazu die zahlreichen Aufsätze von Gerd Gigerenzer wie z.B. Rationales Entscheiden unter Ungewissheit ≠ Rationales Entscheiden unter Risiko. Dabei ist das Problem der Informations- und Wissensfülle, die mit dem Ziel, Handlungskonsequenzen daraus ableiten zu wollen, ohne entsprechende Methodiken kaum zu bewältigen ist, gerade im Gesundheitsbereich keineswegs neu. Zu denken ist z.B. daran, dass praktisch tätige Ärzte, deren Patient*innen häufig multimorbide sind, dann, wenn sie sich an wissenschaftlichen Leitlinien orientieren wollen, mit Texten mit Hunderten von Seiten zu tun haben, die zum Teil auf mindestens genau so lange und wichtige Quellen verweisen.
• Im Lichte der in der Coronakrise gesammelten negativen Erfahrungen sollten wesentliche gesundheitsbezogene Ressourcen und Angeboten endgültig nicht mehr "dem Markt" überlassen bleiben, sondern in öffentlicher Verantwortung als Elemente der Daseinsvorsorge organisiert werden.
Bernard Braun, 21.4.20
Wie selten sind eigentlich seltene Krankheiten und wann gilt eine Krankheit als selten? Es betrifft um die 4% der Weltbevölkerung!
 Auch wenn seltene Krankheiten mit entsprechenden selten oder nie gelesenen "exotischen" Bezeichnungen seit einiger Zeit intensiver öffentlich diskutiert werden, fehlt ein Gesamtbild und wird allein wegen der vermuteten geringen Betroffenheit gar nicht versucht es zu erarbeiten.
Auch wenn seltene Krankheiten mit entsprechenden selten oder nie gelesenen "exotischen" Bezeichnungen seit einiger Zeit intensiver öffentlich diskutiert werden, fehlt ein Gesamtbild und wird allein wegen der vermuteten geringen Betroffenheit gar nicht versucht es zu erarbeiten.
Eine gerade veröffentlichte Analyse der in der speziellen Datenbank Orphanet gesammelten Daten aus weltweit erstellten Studien über 6.172 seltene Krankheiten (für 5.304 gab es Angaben zur Prävalenz), macht diesem Nichtstun und der Geringschätzung bzw. der Unterschätzung ein Ende.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt:
• 71,9% sind genetischer Natur, und 69,9% treten bereits im Kindesalter auf.
• 84,5% der Krankheiten mit Prävalenzangaben hatten eine Punktprävalenz, die kleiner als 1 Fall pro 1.000.000 Personen ist - waren also wirklich selten.
• 77,3% bis 80,7% der durch seltene Krankheiten verursachten Erkrankungslast der Bevölkerung resultieren aus den 4,2% oder 149 seltenen Krankheiten, deren Prävalenz zwischen einem und fünf Fällen pro 10.000 Personen beträgt.
• An Stelle der weit verbreiteten Definition der Seltenheit von Krankheiten zwischen 5 und 80 Fällen pro 100.000 Personen orientieren sich die ForscherInnen an der europäischen Definition von weniger als 5 Fällen pro 10.000 Personen. Ausgeschlossen werden aus der Analyse seltene Krebsarten, Infektionserkrankungen und Vergiftungen.
• Die ForscherInnen gehen auf ihrer Datenbasis davon aus, dass zwischen 3,5% und 5,9% der Weltbevölkerung an seltenen Krankheiten leiden. Dies entspricht einer Anzahl von 253 bis 446 Millionen Personen.
Der 9-seitige Aufsatz Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. von den am französischen "Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)" forschenden Stéphanie Nguengang Wakap, Deborah M. Lambert, Annie Olry, Charlotte Rodwell, Charlotte Gueydan, Valérie Lanneau, Daniel Murphy, Yann Le Cam und Ana Rath ist am 24.10.2019 online veröffentlicht worden und wird im "European Journal of Human Genetics" erscheinen. Der Text ist als Open Access-Text komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.10.19
Multimorbidität: Alles klar oder doch eher Vorsicht vor Vielfalt und Uneindeutigkeit?
 In epidemiologischen Analysen und Prognosen, in gesundheitspolitischen Debatten über den künftigen gesundheitsbezogenen Bedarf an Ressourcen oder in Gesundheitssystemvergleichen spielt Multimorbidität eine bedeutende Rolle. Zu dieser Rolle gehört, dass eindeutig klar zu sein scheint, was Multimorbidität ist.
In epidemiologischen Analysen und Prognosen, in gesundheitspolitischen Debatten über den künftigen gesundheitsbezogenen Bedarf an Ressourcen oder in Gesundheitssystemvergleichen spielt Multimorbidität eine bedeutende Rolle. Zu dieser Rolle gehört, dass eindeutig klar zu sein scheint, was Multimorbidität ist.
Ob es diese eindeutige Definition wirklich gibt, versuchte nun ein dänisches Gesundheitswissenschaftler-Team durch einen systematischen Review von 163 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu finden. Diese Suche schloss nicht nur die quantitative Definition des "Multi", sondern auch qualitativ ein, ob es sich um eine bestimmte Anzahl von Krankheiten, Risikofaktoren oder Symptomen handelte. Hinzu kam die Quelle des Wissens über Multimorbidität.
Das Ergebnis zeigte eindeutig, dass es die eindeutige Definition von Multimorbidität nicht gibt, sondern eine ausgesprochene Vielfalt an Defintionen existiert:
• In 37% aller untersuchten wissenschaftlichen Versuche einer Definition lag der Schnittpunkt für das Vorliegen von Multimorbidität bei zwei oder mehr gesundheitlicher Zustände (Krankheiten, Risikofaktoren oder Symptome). In 7% der Studien fängt Multimorbidität bei drei Zuständen an, in 2% sogar schon bei einem. 34% der Studien spezifizierten die in ihnen gewählten Schnittpunkte überhaupt nicht.
• Die meisten Defintionen bezogen sich auf die allgemeine Bevölkerung (42%) und die primäre Krankenversorgung (25%).
• In 42% der Veröffentlichungen lagen den Definitionen selbst wahrgenommene Gesundheitszustände zugrunde.
• In 115 Aufsätzen finden sich individuell konstruierte Defintionen von Multimorbidität. In allen dieser Definitionen treten Krankheiten auf, am meisten Diabetes mellitus Typ 2. Die Anzahl der für die Definition herangezogenen Gesundheitsprobleme bewegte sich zwischen 4 und 147 und die Diagnostik bewegte sich zwischen engen (z.B. Herzinfarkt) und weiteren Diagnosen (z.B. Herzerkrankungen). Risikofaktoren oder Symptome werden in weniger, nämlich in 85% oder 62% dieser Aufsätze genannt. Die verbreitete Mitberücksichtigung von Risikofaktoren trägt maßgeblich zur hohen Prävalenz von Multimorbidität bei.
• Die Schwere der Multimorbidität wird nur noch in 23% der Definitionsversuche berücksichtigt, und dazu auch noch in verschiedenen Weisen.
• Das große Gewicht von Krankheiten und Risikofaktoren und das geringe der Schwere von gesundheitlichen Problemen ist wesentlich dafür verantwortlich, dass die Definitionen eher etwas für Epidemiologen als für den klinischen Alltag von Ärzten oder gar für PatientInnen sind.
Angesichts der eingangs skizzierten großen Bedeutung der Art und der Prävalenz von Multimorbidität ist der offenkundigen Uneindeutigkeit und qualitativen Verschiedenartigkeit ihrer Definition künftig eine wesentlich größere Aufmerksamkeit zu widmen als bisher und in Vergleichen vermieden werden, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Wichtige Hinweise liefert der am 8. März 2016 im "Scandinavian Journal of Primary Health Care" erschienene und komplett kostenlos erhältliche Aufsatz The role of diseases, risk factors and symptoms in the definition of multimorbidity - a systematic review von Tora Grauers Willadsen, Anna Bebe, Rasmus Křster-et al.
Bernard Braun, 3.4.16
Anteil falsch positiver Diagnosen auch bei prognostisch schweren Erkrankungen teilweise groß: Das Beispiel Morbus Parkinson
 Ein zentrales Problem der medizinisch-ärztlichen Diagnostik sind falsch positive Diagnosen, also Diagnosen von Erkrankungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dass es sich dabei nicht um ein verzeihbares "Irren ist menschlich"- oder Bagatellproblem handelt, sondern dadurch die Lebensqualität und Gesundheit der zu Unrecht als krank diagnostizierten Personen dramatisch belastet und verschlechtert wird, verdeutlicht eine gerade veröffentlichte Studie über die Diagnosequalität bei Morbus Parkinson.
Ein zentrales Problem der medizinisch-ärztlichen Diagnostik sind falsch positive Diagnosen, also Diagnosen von Erkrankungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dass es sich dabei nicht um ein verzeihbares "Irren ist menschlich"- oder Bagatellproblem handelt, sondern dadurch die Lebensqualität und Gesundheit der zu Unrecht als krank diagnostizierten Personen dramatisch belastet und verschlechtert wird, verdeutlicht eine gerade veröffentlichte Studie über die Diagnosequalität bei Morbus Parkinson.
Die Schwere der Fehldiagnose ergibt sich durch die damit prognostizierte oder assoziierte Hauptcharakteristika dieser Erkrankung: Parkinson ist nicht heilbar, ihre Entwicklung ist medikamentös nicht zu stoppen und sowohl der körperliche (z.B. zittrige Hände oder die maskenartige Veränderung des Gesichts) als auch der psychische (z.B. Depressionen) Zustand der Erkrankten verschlechtert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in späteren Phasen der Erkrankung.
Das diagnostische Dilemma ist aber auch, dass eine absolut sichere Diagnose im Moment nur durch Gewebeuntersuchungen aus bestimmten Gehirnbereichen möglich ist, d.h. erst nach dem Tod der erkrankten Person. Davor erfolgt eine Diagnose anhand einer Reihe von äußeren Veränderungen wie der Verlangsamung von Bewegungen, Steifheit von Muskeln z.B. im Gesicht, dem Zittern anderer Muskeln und der Reaktion auf einen Arzneimittelwirkstoff.
Die an der Mayo-Klinik in den USA durchgeführte Studie mit Daten der "Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders" untersuchte nun, ob und wie stark die ärztlichen Diagnosen von Parkinson mit dem Ergebnis der Gewebeuntersuchung nach dem Tod dieser Personen übereinstimmten:
• Bei 97 Patienten, deren Erkrankung nach der gesamten Symptomatik und ihrer Dauer für "wahrscheinlich" gehalten wurde, stimmten 82% der Diagnosen mit dem Befund überein. Es gab aber je nach Dauer der Erkrankung auch deutliche Unterschiede,: Erfolgte die Diagnose bei einer Erkrankungs-/Symptomzeit unter 5 Jahren stimmten nur 57% der Diagnosen mit dem Gewebebefund überein. Waren es mehr als 5 Jahre stieg dieser Wert auf 88%.
• Bei den 34 Patienten, deren Parkinsonerkrankung nach den Symptomen für "möglich" gehalten wurde, wurden lediglich 26% der Diagnosen durch den Gewebebefund bestätigt.
• In der dritten Gruppe von Personen bei denen eine Parkinsonerkrankung nach den Symptomen diagnostisch ausgeschlossen wurde, stimmte diese Diagnose in 91% der Fälle. Der Anteil falsch negativer Fälle betrug daher nur 9%.
Selbst wenn die Studienverantwortlichen anmerken, dass die Behandlung auch bei einer anderen Diagnose nicht völlig anders ausgesehen hätte - ein Teil der Patienten litt an einer anderen neurodegenerativen Krankheit -, halten sie wegen der oben beschriebenen psychischen Beeinträchtigung der Patienten durch eine Parkinsondiagnose die Suche nach weiteren Symptomen (z.B. Beeinträchtigung des Geruchssinns) und nach verlässlichen Biomarkern für unbedingt notwendig. Dies ist umso nötiger, weil sich an dem hohen Anteil falsch positiver Parkinsondiagnosen seit geraumer Zeit nichts geändert hat.
Der Aufsatz Low clinical diagnostic accuracy of early vs advanced Parkinson disease. Clinicopathologic study. von C.H. Adler, et al. ist am 29. Juli 2014 in der Zeitschrift "Neurology" (83 (5): 406-412) erschienen und ein Abstract ist kostenlos verfügbar.
Bernard Braun, 23.8.14
NEJM-Journal Watch: Wissenschaftliche Publikationen über Ebola 1995-2014
 Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO den aktuellen Ausbruch von Ebola zum dritten internationalen Gesundheitsnotfall ("Public Health Emergency of International Concern, PHEIC") der letzten 10 Jahre (die beiden anderen Erkrankungsnoptfälle waren die befürchteten Schweinegrippe- und Kinderlähmungs-Epidemien) erklärt hat, hilft u.a. die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen über das Entstehen, die Prävention und die Behandlung von Ebolainfektionen bzw. der daran erkrankten Personen den bisherigen Verlauf und das Bedrohungspotenzial zu bewerten.
Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO den aktuellen Ausbruch von Ebola zum dritten internationalen Gesundheitsnotfall ("Public Health Emergency of International Concern, PHEIC") der letzten 10 Jahre (die beiden anderen Erkrankungsnoptfälle waren die befürchteten Schweinegrippe- und Kinderlähmungs-Epidemien) erklärt hat, hilft u.a. die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen über das Entstehen, die Prävention und die Behandlung von Ebolainfektionen bzw. der daran erkrankten Personen den bisherigen Verlauf und das Bedrohungspotenzial zu bewerten.
Auf der von AutorInnen der Zeitschrift "New England Journal of Medicine" verfassten Website "Journal Watch" gibt es hierzu eine erste Zusammenstellung von 34 zwischen 1995 und 2014 in verschiedenen Fachzeitschriften und bei "Journal Watch" veröffentlichten Beiträge.
Die meisten, fast immer über Links erreichbaren Beiträge sind frei zugänglich. Wahrscheinlich wird die Textsammlung in der weiteren Zukunft noch erweitert.
Hierüber erreicht man die "Ebola-Literatur-Website".
Bernard Braun, 12.8.14
Warum Ebola keine globale Gesundheitsbedrohung ist und was aus Public Health-Sicht trotzdem dagegen getan werden muss.
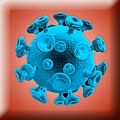 Offensichtlich gehören regelmäßige mediengetragene oder -verstärkte gesundheitsbezogene Schreckensszenarien oder -Hypes zum unvermeidbaren Repertoire der Gesundheits- oder Krankheitskommunikation. Waren es vor Jahren Sars, die Hühner- oder die Schweinegrippe, welche weltweit Hunderte von Public Health-Institutionen, Milliarden von Menschen und milliardenschwere Geldströme bewegten, zeichnet sich dies im Moment bei Ebola ab - und zwar weltweit.
Offensichtlich gehören regelmäßige mediengetragene oder -verstärkte gesundheitsbezogene Schreckensszenarien oder -Hypes zum unvermeidbaren Repertoire der Gesundheits- oder Krankheitskommunikation. Waren es vor Jahren Sars, die Hühner- oder die Schweinegrippe, welche weltweit Hunderte von Public Health-Institutionen, Milliarden von Menschen und milliardenschwere Geldströme bewegten, zeichnet sich dies im Moment bei Ebola ab - und zwar weltweit.
Ohne das damit verbundene im Detail schreckliche Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko der Bevölkerung in mehreren westafrikanischen Staaten verharmlosen zu wollen und ohne die Hunderte von Millionen US-Dollar für unnötig zu halten, die von WHO und Worldbank für "Maßnahmen" zur Verfügung gestellt werden, stellt sich aber auch hier die Frage, ob die Reaktion der wirklichen Situation quantitativ und qualitativ angemessen ist.
Nach Lektüre eines am 30. Juli 2014 in der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Nature" veröffentlichten und auch in deutscher Übersetzung vorliegenden Aufsatzes, sind hier Zweifel berechtigt.
Zu den dafür wesentlichen Argumenten gehören:
• Von vorrangiger Bedeutung ist aus Public Health-Perspektive der qualitative Hinweis auf die spezifischen sozialen und kulturellen Ursachen der Verbreitung der Erkrankung: Dabei geht es um mangelndes Vertrauen der Bevölkerung in ihre Gesundheitsakteure (z.B. gelten Sanitäter als Einschlepper der Infektion und werden am Zutritt in die Dörfer mit Kranken gehindert) und mangelnde Kooperation(sbereitschaft) und besondere Beerdigungsrituale mit direktem Kontakt zu den Leichen. Ohne Einflussnahme auf die soziokulturellen Faktoren könnte die Millionenunterstützung, die für den Aufbau einer Behandlungsinfrastruktur sicherlich notwendig ist, also wirkungslos bleiben. "Ebola 20.0" könnte man dann in den 10-Jahreskalender eintragen.
• Ebola ist eine insgesamt seltene Krankheit, und befällt auch bisher nur relativ kleine Bevölkerungsteile. Seit ihrem erstmaligen Auftreten im Jahr 1976 gab es 19 Ausbrüche mit mehr als 10 Opfern und nur sieben Ausbrüche betrafen mehr als 100 Personen. Insgesamt starben bisher offiziell 2.000 Menschen durch Ebola. Auch wenn der Tod jedes Einzelnen schlimm ist, sollte beachtet werden, dass im Moment weltweit täglich 3.200 Menschen wegen einer Malariainfektion und 4.000 wegen einer Durchfallerkrankung sterben - vielfach vermeidbar.
• Im Moment (27. Juli 2014) gibt es nach WHO-Schätzungen relativ wenige, nämlich 1.323 infizierte Personen, von denen 729 gestorben sind. Dies ist der bisher größte Ausbruch.
• Da das Virus nur durch einen direkten Kontakt von Schleimhäuten oder verletzter Haut mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person übertragen wird, und nicht durch die Luft, ist die Ansteckungsgefahr relativ gering. Auch wenn insbesondere in der US-Öffentlichkeit angesichts von zwei per Flugzeug in die USA gekommenen Erkrankten ein total anderer Eindruck vermittelt wird (eine besondere Mischung bieten z.B. die in der öko-alternativ-konservativen Szene in den USA weit verbreiteten Artikel der "Natural News"-Website Twenty-one questions about Ebola: government propaganda, medical corruption and bioweapons experiments oder Ebola 'dirty bomb' the next big fear: are large cities vulnerable to biological attack?), hält z.B. das "Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC)" das Risiko einer Übertragung durch infizierte Passagiere für "sehr gering".
Unabhängig von den Details der Kommunikation über die Risiken von Ebola und in der sicheren Erwartung des nächsten Krankheits-Hypes sollte endlich das Nachdenken über die Ursachen stattfinden, die zu solchen spezifischen Überschätzungen und Fehldarstellungen und zu einem öffentlichen Diskurs führen, der trotz einer ständigen Verbesserung der gesundheitlichen Situation eine Zunahme der Erkrankungsrisiken für real hält.
Der "Nature"-Artikel Largest ever Ebola outbreak is not a global threat. Although the virus is exerting a heavy toll in West Africa, it does not spread easily von Declan Butler ist in Englisch und deutscher Übersetzung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.8.14
"Je niedriger desto besser" gilt zumindest für den Blutdruck nicht uneingeschränkt.
 Das mit den meisten Risikofaktoren wie erhöhtem Blutdruck, hohen Blutzuckerwerten oder überdurchschnittlichem Gewicht verbundene mechanische und lineare Verständnis der damit assoziierten gesundheitlichen Risiken und deren Vermeidung hat zweierlei zur Folge: Erstens steigt auf dem Boden dieses Verständnisses das Erkrankungsrisiko linear mit den jeweils höheren Körperwerten und zweitens sinkt das Risiko mit sinkenden Körperwerten ebenfalls linear. Zu Ende gedacht: Je tiefer oder geringer desto besser oder gesünder.
Das mit den meisten Risikofaktoren wie erhöhtem Blutdruck, hohen Blutzuckerwerten oder überdurchschnittlichem Gewicht verbundene mechanische und lineare Verständnis der damit assoziierten gesundheitlichen Risiken und deren Vermeidung hat zweierlei zur Folge: Erstens steigt auf dem Boden dieses Verständnisses das Erkrankungsrisiko linear mit den jeweils höheren Körperwerten und zweitens sinkt das Risiko mit sinkenden Körperwerten ebenfalls linear. Zu Ende gedacht: Je tiefer oder geringer desto besser oder gesünder.
Empirisch belegte Zweifel an dieser Dynamik gibt es für Übergewicht mit einem BMI zwischen 25 und 29 sowie gegenüber dem Sinn und Nutzen von Blutzucker-/HbA1c-Werten unter 7 bzw. 6.5% für jedes Individuum bereits seit längerem.
Dass dies auch bei Blutdruckwerten zutrifft, zeigen nun die Ergebnisse einer am 16. Juni 2014 veröffentlichten Beobachtungsstudie mit 4.480 zu Beginn der Studie kardiovaskulär nicht erkrankten erwachsenen TeilnehmerInnen, deren Blutdruckentwicklung samt des Auftretens von kardiovaskulären Ereignissen über 22 Jahre hinweg von us-amerikanischen Epidemiologen verfolgt wurde. Bei den Werten des so genannten systolischen Blutdruckwerts wurden die TeilnehmerInnen danach unterschieden, ob sie einen "schlechten" Wert von 140mmHg oder höher, einen "Standard"-Wert zwischen 120 und 139 mmHg oder einen "guten/niedrigen" Wert von 120 mmHg und niedriger hatten.
Bei dem im Durchschnitt nach 21,8 Jahren erfolgten Follow up hatten 1.622 TeilnehmerInnen ein schweres kardiovaskuläres Ereignis (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall) hinter sich.
TeilnehmerInnen mit einem systolischen Blutdruck von mehr als 120mmHg hatten eine signifikant höhere Rate (hazard ratio 1,46) neu aufgetretener kardiovaskulärer Ereignisse als die TeilnehmerInnen mit einem systolischen Blutdruck unter 120 mmHg.
Keine signifikanten Unterschiede gab es jedoch bei der Inzidenz solcher Ereignisse zwischen den TeilnehmerInnen mit einem systolischen Bludruck unter 120 mmHg und denen mit einem Wert zwischen 120 und 139 mmHg - auch nach einer Adjustierung nach Alter, Geschlecht, Diabetesstatus, Body Mass Index, erhöhtem Cholesterinwert, Raucherstatus und Aufnahme von Alkohol. Zusätzliche Adjustierungen nach der Art der medikamentösen Behandlung des systolischen und die des diastolischen Blutdruckwerts, änderten an diesem Ergebnis nichts.
Praktisch empfiehlt der Leitautor des Aufsatzes bereits an Herzerkrankungen oder Diabetes leidenden Personen, einen systolischen Druck unter 120mmHg anzustreben, Gesunden Personen empfiehlt er dagegen: "The notion of 'lower is better' across the board should probably be questioned, and there should be a discussion with your doctor."
Der Aufsatz Systolic Blood Pressure Levels Among Adults With Hypertension and Incident Cardiovascular EventsThe Atherosclerosis Risk in Communities Study von Carlos J.Rodriguez et al. ist in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" am 16. Juni 2014 online first erschienen. Das Abstract ist kostenlos.
Bernard Braun, 31.7.14
Bewohner sozial schlecht gestellter Landkreise in Deutschland haben höhere Krebssterberisiken als Bewohner anderer Landkreise
 Zahlreiche internationale wie nationale so genannte "small-aerea"-Studien haben gezeigt, dass Erkrankungsrisiken sowohl zwischen durchaus vergleichbaren Staaten aber auch innerhalb von Staaten ungleich verteilt sind. Weniger untersucht wurde bisher, ob die Chancen einer erfolgreichen Behandlung oder Überlebensrisiken ebenfalls regional unterschiedlich verteilt sind. Sowohl in Erkrankungsrisiko- wie Behandlungschancen-Studien spielt der mögliche Zusammenhang mit der sozialen Lage eine wichtige Rolle.
Zahlreiche internationale wie nationale so genannte "small-aerea"-Studien haben gezeigt, dass Erkrankungsrisiken sowohl zwischen durchaus vergleichbaren Staaten aber auch innerhalb von Staaten ungleich verteilt sind. Weniger untersucht wurde bisher, ob die Chancen einer erfolgreichen Behandlung oder Überlebensrisiken ebenfalls regional unterschiedlich verteilt sind. Sowohl in Erkrankungsrisiko- wie Behandlungschancen-Studien spielt der mögliche Zusammenhang mit der sozialen Lage eine wichtige Rolle.
Für Deutschland hat sich nun eine Analyse der zwischen 1997 und 2006 in 10 regionalen Krebsregistern gesammelten Daten über die Überlebenschancen der an 25 der häufigsten Krebsarten (z.B. Lungen-, Darm-, Prostata-, Brust- und Hautkrebs) erkrankten Personen beider Fragen angenommen.
Die vor allem am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) tätigen WissenschaftlerInnen konnten zeigen, dass Patienten, deren Wohn-Landkreis zum Fünftel der sozioökonomisch schwächsten Landkreise gehörte (gemessen durch Einkommen, Arbeitslosenquote, Kriminalität etc.), durchweg ein höheres Sterberisiko hatten als Mitpatienten aus allen anderen Regionen, d.h. früher starben. Dies traf bei 21 der 25 ausgewählten Krebsarten zu.
Zeitlich gestaffelt war das Sterberisiko der Krebspatienten in den 20% sozial schlechtgestelltesten Landkreisen
• nach drei Monaten um 24%,
• nach 9 Monaten um 16% und
• nach 4 Jahren immer noch um 8%
höher als in allen anderen Landkreisen.
Wie es in den restlichen 6 Bundesländern aussieht, konnten die DKFZ-WissenschaftlerInnen mangels vergleichbarer Registerdaten nicht ermitteln. An der Schlussfolgerung, diese Ungleichheiten "indicate a potential for improving cancer care and survival in Germany" ändert dies aber nichts.
Für praktische Interventionen hinderlich ist lediglich, dass die bisher vorliegenden Daten nicht erklären können, wodurch die Ungleichheit zustandekommt. So könnte entweder die medizinische Versorgung in den sozioökoomisch schwachen Landkreisen schlechter sein oder die Krankheitslast z.B. durch mehr oder schwerere Komorbidität höher sein. In Frage kommen könnte auch eine Kumulation beider Effekte.
Weitere Erklärungsfaktoren wie z.B. die Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen bzw. unterschiedliche Tumorstadien bei der Entdeckung der Krebserkrankung schließen die ForscherInnen aber bereits jetzt aus.
Der Aufsatz Socioeconomic deprivation and cancer survival in Germany: An ecological analysis in 200 districts in Germany von Lina Jansen et al. (Mitglieder der GEKID Cancer Survival Working Group ) ist am 2. Dezember 2013 online erschienen und wird im "International Journal of Cancer" erscheinen. Ein Abstract liegt kostenlos vor
Bernard Braun, 1.2.14
Wie häufig erhielten GKV-Versicherte 2008-2012 Hüft-/Knie-Endoprothesen und welche Leistungen erhielten sie vor- und nachoperativ?
 Die Endoprothetik - der operative Einsatz von Implantaten in den Körper, um Arthrose-geschädigte Gelenke dauerhaft zu ersetzen - verbessert die Lebensqualität vieler Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen und ist aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Experten sind jedoch überzeugt, dass rund zehn Prozent der Operationen in Deutschland unnötig sind. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland nach einem im Frühjahr 2013 veröffentlichten Bericht der "Organisation für Economic Co-operation and Development (OECD)" Spitzenreiter oder liegt nach anderen Berichten bei der endoprothetischen Versorgung mit Hüft- und Kniegelenken auf einem der Medaillenränge. Ärzte und Krankenhäuser müssen sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, das eigene wirtschaftliche Interesse über das ihrer Patienten zu stellen. Wird in Deutschland zu schnell operiert?
Die Endoprothetik - der operative Einsatz von Implantaten in den Körper, um Arthrose-geschädigte Gelenke dauerhaft zu ersetzen - verbessert die Lebensqualität vieler Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen und ist aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Experten sind jedoch überzeugt, dass rund zehn Prozent der Operationen in Deutschland unnötig sind. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland nach einem im Frühjahr 2013 veröffentlichten Bericht der "Organisation für Economic Co-operation and Development (OECD)" Spitzenreiter oder liegt nach anderen Berichten bei der endoprothetischen Versorgung mit Hüft- und Kniegelenken auf einem der Medaillenränge. Ärzte und Krankenhäuser müssen sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, das eigene wirtschaftliche Interesse über das ihrer Patienten zu stellen. Wird in Deutschland zu schnell operiert?
Diese und weitere Versorgungsdetails zur Prävalenz von endoprothetischen Operationen des Knie- und Hüftgelenks in den Jahren 2008 bis 2012 untersucht Bernard Braun, Gesundheitswissenschaftler am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen anhand von Routinedaten in einem Ende November 2013 veröffentlichten Gesundheitsreport für die überwiegend in Nordwestdeutschland lebenden Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse hkk.
Zusätzlich zu den vor kurzem auch bereits mit den Routinedaten anderer GKV-Kassen - z.B. denen der AOK im Faktencheck Gesundheit Knieoperationen (Endoprothetik) - Regionale Unterschiede und ihre Einflussfaktoren der Bertelsmann Stiftung - untersuchten Häufigkeiten dieser Operationen analysierte der hkk-Report auch erstmalig die in den Kassendaten dokumentierte vor- und nachoperative (jeweils 6 Monate) Inanspruchnahme ausgewählter Leistungen wie ambulant-ärztliche Behandlungsfälle, Heil- und Hilfsmittel sowie Arzneimittel.
Die Ergebnisse lauten u.a. so:
• Im Untersuchungszeitraum steigt die Anzahl der Operationen bei hkk-Versicherten nahezu kontinuierlich an. Während im Jahr 2008 noch 598 operierte Hüft-Endoprothesen registriert wurden, waren es 2012 bereits 723 - ein Anstieg von 21 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Knie-Endoprothesen mit 347 Fällen in 2008 sowie 432 Fällen in 2012, was einer Steigerung von 24,5 Prozent entspricht.
• Bundesweit stagniert laut Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) die Anzahl der erstimplantierten Hüft- und Knie-Endoprothesen seit 2009 auf dem erreichten hohen Niveau. Um die Vergleichbarkeit der hkk-Daten mit anderen Studien zu gewährleisten, nutzt die Studie die Zahl der Fälle pro 100.000 Versichertenjahre (VJ) als gemeinsame Berechnungsgrundlage. Dabei ergibt sich erwartungsgemäß, dass die durchschnittlich jüngeren hkk-Versicherte im Vergleich zum bundesweiten Behandlungsgeschehen seltener eine Knie-Prothese erhalten: Im Referenzjahr 2011 waren es 118,2 Erstimplantationen je 100.000 VJ, während der bundesweite Vergleichswert bei AOK-Versicherten 129,5 betrug. Im gleichen Jahr wurden bei der hkk 175,8 Hüft-Endoprothesen je 100.000 VJ erstmals eingesetzt. In diesem Fall liegen jedoch keine Referenzzahlen für den Bundesdurchschnitt vor.
• Der hkk Gesundheitsreport zeigt einen deutlichen Anstieg von Revisionen und Wechseln bei hkk-Versicherten: Von 2008 bis 2012 zeigte sich bei Hüft-Endoprothesen ein prozentualer Anstieg von 75 Prozent; bei Knie-Endoprothesen lag dieser Wert bei 45 Prozent. Bundesweit nahmen die Revisionen und Wechsel bei Knie-Endoprothesen im Vergleichszeitraum mit 43 Prozent ähnlich stark zu; die Anzahl der Hüft-Endoprothesen ist jedoch seit 2009 leicht rückläufig.
• Bei der Analyse der Inanspruchnahme ausgewählter Leistungen fällt vor-operativ der im Vergleich mit dem gesamten vor- und nachoperativen Leistungsvolumen relativ geringe Umfang der nachweislich hilfreichen (vgl. dazu den entsprechenden Forum-Beitrag "Evidenz für den Nutzen von Gewichtsabnahme, Bewegungssport und Muskelaufbau als Methoden für Patienten mit Knie-/Hüft-Arthrose") Heilmittelleistungen, also von Physiotherapie etc. auf. Hier könnte es sich um eine Unter- und Fehlversorgung handeln. Für die 6 Monate nach der Operation ist besonders der noch lang andauernde spezifische Behandlungsbedarf gegen offensichtich starke (indiziert durch die Verordnung von Opioden) Schmerzen und Bewegungsprobleme auffällig.
• Die zum Teil in diesem Umfang nicht erwarteten Häufigkeiten des vor- und nachoperativen Befindens und Behandlungsgeschehens begründen die Notwendigkeit einer noch besseren Information und Aufklärung der an Arthrose erkrankten Personen über die konservativen Behandlungsmöglichkeiten und die realistischen Erfolge einer Operation. Personell könnte dies durch unabhängige Ärzte erfolgen. Als Instrument könnten so genannte evidenzbasierte Entscheidungshilfen oder "decision aids" eingesetzt werden, die sich bei der Vermeidung noch nicht notwendiger Operationen bzw. der Initiierung konservativer Behandlung von Gelenkerkrankungen bereits als erfolgreich erwiesen haben (siehe dazu den entsprechenden Forumbeitrag "Der Boom der Knie- und Hüftgelenks-Endoprothesen-Operationen kann durch "decision aids" signifikant gebremst werden").
• Unabhängig von den genannten Maßnahmen unterstützt der Verfasser des Reports und die hkk die Bemühungen um den Aufbau und eine zeitnahe Auswertung eines Endoprothesenregisters.
Den hkk-Gesundheitsreport zum Thema Knie- und Hüft-(Total-)Endoprothesen 2008 bis 2012 von Bernard Braun ist komplett kostenlos erhältlich.
Ein Interview mit Dr. Bertram Regenbrecht, Zentrum für Endoprothetik, Fußchirurgie, Kinder- und Allgemeine Orthopädie der Roland Klinik, Bremen, das aus Sicht des klinischen Praktikers die Ergebnisse des Reports kommentiert und erweitert, ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Jens Holst, 1.1.14
Passivrauchen und Demenz: Studie in China belegt signifikante Assoziationen und Dosis-Wirkungszusammenhänge
 Assoziationen oder sogar Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen passiv aufgenommenem Tabakrauch aus der Umgebungsluft, bestimmten Krebsformen, Erkrankungen der oberen Atemwege und kardiovaskulären Erkrankungen sind seit längerem bekannt. Ob dies für weitere schwere Erkrankungen und hier besonders für die Demenz auch zutrifft, war dagegen unklar. Keine Studie hatte bisher auch untersucht, ob es hier einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang gibt.
Assoziationen oder sogar Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen passiv aufgenommenem Tabakrauch aus der Umgebungsluft, bestimmten Krebsformen, Erkrankungen der oberen Atemwege und kardiovaskulären Erkrankungen sind seit längerem bekannt. Ob dies für weitere schwere Erkrankungen und hier besonders für die Demenz auch zutrifft, war dagegen unklar. Keine Studie hatte bisher auch untersucht, ob es hier einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang gibt.
In China gibt es mindestens 350 Millionen RaucherInnen, die bisher auch nahezu ungehindert an ihren Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten rauchen. Daher untersuchte jetzt eine chinesisch-britische ForscherInnengruppe im Zeitraum von 2007 bis 2009 mit Standardinstrumenten und -methoden sowohl das Demenzrisiko als auch die Passivrauch-Belastung in einer Gruppe von 5.921 Personen im Alter von 60 und mehr Jahren aus vier Provinzen Chinas.
Dabei zeigte sich u.a.,
• dass 626 TeilnehmerInnen (10,6%) am Ende des Untersuchungszeitraums ernsthaft dement waren und 869 (14,7%) mäßig dement waren und
• dass TeilnehmerInnen, die gegenüber Passivrauch exponiert waren, ein signifikant höheres Risiko für eine schwerwiegende Demenz (adjustiertes relatives Risiko [RR]: 1,29) hatten.
• Das Risiko für eine schwere Demenz war außerdem signifikant dosisabhängig, d.h. je höher die Dosis des Passivrauchs war und/oder je länger die untersuchten Personen exponiert waren, desto höher war ihr relatives Risiko ernsthaft demenzkrank zu sein.
• Signifikante und ähnliche Assoziationen von Passivrauchen und schwerer Demenz gab es sowohl bei Personen, die niemals rauchten als auch bei Ex-Rauchern wie aktuell rauchenden Personen. In der Studiengruppe bestimmte hauptsächlich das Passivrauchen am Arbeitsplatz das Demenz-Risiko.
• Wenn zum Beispiel jemand an seinem Arbeitsplatz keinen Kontakt mit Passivrauch hatte, betrug sein Demenzrisiko nicht signifikante 1,12 (p=0,581). Wer 20 bis 39 Jahre exponiert war, hatte ein RR von knapp nicht signifikanten 1,86 (P=0,060). Bei 40 und mehr Jahren Passivrauchen lag das RR hochsignifikant bei 2,39 (p=<0.001).
• Keine signifikanten Assoziationen fanden die chinesischen WissenschaftlerInnen zwischen Umgebungs-Passivrauch und mäßigen Demenzsyndromen.
Der Aufsatz "Association between environmental tobacco smoke exposure and dementia syndromes" von Ruoling Chen et al. ist Anfang 2013 gedruckt in der Fachzeitschrift "Occupational Environmental Medicine" (2013;70:1 63-69 Published Online First: 26 October 2012) erschienen und dank der "open access"-Politik der Zeitschrift komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.1.13
1953, 1971, 2011: US-Soldaten (sterben) mit immer gesünderen Gefäßen. Ursachen: Gesünderes Verhalten oder Selektion?!
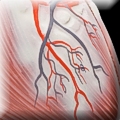 Für die solide und valide statt "gefühlte" Darstellung der Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Krankheiten sollte möglichst auf Längsschnittuntersuchungen zurückgegriffen werden, die ihrerseits möglichst mit objektiven Daten angelegt sind. Viele "Epidemien" oder "dramatische Zunahmen" von Krankheiten beruhen nur auf den Ergebnissen von ein oder zwei in kurzen Abständen und mit unterschiedlichen Fragen durchgeführten Querschnittsbefragungen und viel ihrer angeblichen Dynamik basiert auf einem Detektions- oder Publikationsbias oder der Entstigmatisierung bestimmter Krankheiten mit anschließender Zunahme spezifischer Diagnosen und öffentlicher Kommunikation. Prominente aktuelle Beispiele sind die "Zunahme" psychischer Erkrankungen und ein Teil der "Zunahme" von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen.
Für die solide und valide statt "gefühlte" Darstellung der Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Krankheiten sollte möglichst auf Längsschnittuntersuchungen zurückgegriffen werden, die ihrerseits möglichst mit objektiven Daten angelegt sind. Viele "Epidemien" oder "dramatische Zunahmen" von Krankheiten beruhen nur auf den Ergebnissen von ein oder zwei in kurzen Abständen und mit unterschiedlichen Fragen durchgeführten Querschnittsbefragungen und viel ihrer angeblichen Dynamik basiert auf einem Detektions- oder Publikationsbias oder der Entstigmatisierung bestimmter Krankheiten mit anschließender Zunahme spezifischer Diagnosen und öffentlicher Kommunikation. Prominente aktuelle Beispiele sind die "Zunahme" psychischer Erkrankungen und ein Teil der "Zunahme" von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen.
Ein interessantes Beispiel, was bezogen auf eine seit vielen Jahren breit diskutierte krankhafte Veränderung der Gefäße mit hohem Risiko von schweren Folgeerkrankungen bei einer zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen Datenbasis herauskommt, liefert eine vergleichende Analyse des Auftretens von Koronarsklerose bei gefallenen Soldaten der US-Armee im Korea-, Vietnam- sowie in den Golf- und Afghanistankriegen.
Bei den immer deutlich unter 30 Jahren alten Soldaten sank der Anteil an erkennbarer Koronarsklerose Leidenden bei der routinemäßigen Obduktion von 77% bei den in Korea (Anfang der 1950er Jahre) Gefallenen, über 45% bei den obduzierten Gefallenen im Vietnamkrieg (1960 und Anfang der 1970er Jahre) auf 8,5% bei den in diesem Jahrhundert im Golf- und Afghanistankrieg Gefallenen. Die Häufigkeit von Stenosen, welche die Koronararterie um mehr als 50% verengten, bewegte sich zwischen 15%, 0% und 2,3%. Die Soldaten mit einer Koronarsklerose litten auch deutlich häufiger als ihre Altersgenossen an Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck oder Adipositas.
Unter Würdigung aller von den Autoren zum großen Teil selbst diskutierten Limitationen ihrer Studienmethodik kommt ein Editorialist zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens: "Consequently, it is highly likely that the main finding of this study is valid: the prevalence of atherosclerosis in young men today is much lower than the prevalence in the Korean or Vietnam War eras. If these findings are generalizable to the US population as a whole, then the cardiovascular health of the US population may have improved appreciably over the past 6 decades." Zweitens: "Advances in primary (but not secondary) prevention are likely to explain the declines in coronary atherosclerosis across the 3 autopsy studies."
Zu den zahlreichen sensibilisierenden und fruchtbaren Hinweisen, welche diese Studie für die aktuelle Versorgungsforschung liefert, gehört z.B. die Schwierigkeit solide Längsschnittstudien über viele Jahrzehnte durchzuführen. Dies gilt besonders dann, wenn es sich um ein retrospektives Design handelt, das die Ergebnisse von sich methodisch in mehreren Details unterscheidenden Studien nutzt. Außerdem ist die Erklärung, es handle sich um Effekte eines gesünderen Lebensstils und einer positiv wirkenden Primärprävention, nicht zwingend. Erste Kommentare weisen auf die Möglichkeit einer Art "healthy soldier"-Effekt hin. Danach könnten durch entsprechende Musterungsuntersuchungen immer gesündere junge Männer in die Armee eingetreten und gefallen sein. Solche Selektionseffekte könnten allerdings auch bei randomisierten Studien mit unterschiedlichen Rekrutierungszeitpunkten in beide Richtungen (immer gesündere oder immer kränkere StudienteilnehmerInnen) existieren, ohne dass dies auf den ersten Blick auffällt.
Was eine gründliche Beschäftigung mit dem Ergebnis also auf jeden Fall mit sich bringt, ist eine verschärfte Nachdenklichkeit über die Beschränktheit und Schlüssigkeit mancher Querschnitts-Szenarien und den notwendigen, aber nicht einfachen methodischen Aufwand solider Verlaufsstudien.
Der am 26. Dezember 2012 erschienene Aufsatz Prevalence of and Risk Factors for Autopsy-Determined Atherosclerosis Among US Service Members, 2001-2011 von Bryant J. Webber et al. (JAMA. 2012;308(24): 2577-2583) ist komplett kostenlos zugänglich.
Dies ist ebenso bei dem Editorial Combating the Epidemic of Heart Disease von Daniel Levy (JAMA. 2012; 308(24): 2624-2625) der Fall.
Der am 18. Juli 1953 erschienene Korea-Aufsatz CORONARY DISEASE AMONG UNITED STATES SOLDIERS KILLED IN ACTION IN KOREA PRELIMINARY REPORT von William F. Enos; Robert H. Holmes, James Beyer (JAMA. 1953;152(12): 1090-1093) ist auch kostenlos erhältlich.
Den am 17. Mai 1971 veröffentlichten Aufsatz Coronary Artery Disease in Combat Casualties in Vietnam von J. Judson McNamara et al. (JAMA. 1971;216(7): 1185-1187) gibt es ebenfalls kostenlos.
Bernard Braun, 29.12.12
"Burnout" - keine valide Diagnostik und kein Wirksamkeitsnachweis für die meisten Therapien
 Zu den positiven Leistungen der medizinisch-ärztlichen Versorgung gehört es, körperlichen oder psychischen Störungen Namen zu geben bzw. Diagnosen zuzuweisen und damit einen Teil der mit solchen Störungen verbundenen und auch zusätzlich krankheitsfördernden Ungewissheit oder diffuse Angst zu beenden und außerdem den Eindruck zu vermitteln, es gäbe auch eine Lösung. Problematisch wird es, wenn Diagnosen lediglich Wortgeklingel sind (z.B. psychovegetatives Syndrom), natürliche oder soziale Phänomene medikalisiert (so genanntes "disease mongering") oder schwer fassbare und unterschiedliche Krankheitsphänomene mit einem diagnostischen Begriff zu fassen versucht werden.
Zu den positiven Leistungen der medizinisch-ärztlichen Versorgung gehört es, körperlichen oder psychischen Störungen Namen zu geben bzw. Diagnosen zuzuweisen und damit einen Teil der mit solchen Störungen verbundenen und auch zusätzlich krankheitsfördernden Ungewissheit oder diffuse Angst zu beenden und außerdem den Eindruck zu vermitteln, es gäbe auch eine Lösung. Problematisch wird es, wenn Diagnosen lediglich Wortgeklingel sind (z.B. psychovegetatives Syndrom), natürliche oder soziale Phänomene medikalisiert (so genanntes "disease mongering") oder schwer fassbare und unterschiedliche Krankheitsphänomene mit einem diagnostischen Begriff zu fassen versucht werden.
Das aktuelle Paradebeispiel ist das "Burnout"-Syndrom, das in der "Internationalen Klassifikation der Erkrankungen" (ICD-10) als "Ausgebranntsein" und "Zustand der totalen Erschöpfung" bezeichnet oder umschrieben wird. In der Systematik des ICD-10 handelt es sich damit um "Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung". Zu den Entstehungsbedingungen von Burnout gehören arbeitsplatzbezogene Faktoren, eine Vielzahl individueller Faktoren oder Auslöser und auch bereits bestehende körperliche und psychische Krankheiten. Diese dynamischen Zusammenhänge erschweren sowohl die Diagnostik aber auch die Therapie der subjektiv zum Teil erheblich belastenden und die soziale Existenz gefährdenden Symptome.
Dies bestätigen auch zwei im Auftrag des "Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" erstellten "Health Technology Assessment (HTA)"-Berichte zur "Differentialdiagnostik des Burnout-Syndroms" (erschienen 2010) und "Therapie des Burnout-Syndroms" (erschienen 2012).
Für den ersten HTA-Bericht wurden alle zwischen 2004 und 2009 in deutscher oder englischer Sprache veröffentlichten Studien zur medizinischen Diagnostik und Differentialdiagnostik, zu den ökonomischen Auswirkungen und den ethischen Aspekten des Burnout erfasst. Von den 852 Funden gingen 25 medizinische Publikationen in die weitere Untersuchung ein. Das "zentrale Ergebnis" ihres Berichts lautet, "dass es bisher kein standardisiertes, allgemeines und international gültiges Vorgehen gibt, um eine Burnout-Diagnose zu stellen. Derzeit liegt es im ärztlichen Ermessen, Burnout zu diagnostizieren. Die Schwierigkeit besteht darin, etwas zu messen, das nicht eindeutig definiert ist. Die bisher diskutierten Burnout-Messinstrumente erfassen größtenteils verlässlich ein dreidimensionales Burnout-Konstrukt. Die bisher gelieferten Cutoff-Punkte erfüllen jedoch nicht den Anspruch der diagnostischen Gültigkeit, da die Generierung dieser Werte nicht der wissenschaftlichen Testkonstruktion entspricht. Die verwendeten Burnout-Messinstrumente sind nicht differentialdiagnostisch validiert. Von differentialdiagnostischer Bedeutung sind vor allem Depressionen, Alexithymie, Befindlichkeitsstörungen und das Konzept der anhaltenden Erschöpfung. Ein phasenhafter Zusammenhang der Konzepte ist denkbar. Burnout geht zudem mit verschiedenen Beschwerden wie z. B. Schlafstörungen einher und kann sich durch eine Beeinträchtigung der Arbeitsleistung auf andere (z. B. auf Patienten) negativ auswirken. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Stigmatisierung Burnout-Betroffener vor."
Zusätzlich wurde die Qualität der Studien insgesamt schlecht bewertet. Kritisch vermerkt wurde außerdem der überwiegende Einsatz von Selbstbeurteilungsinstrumenten, vor allem des Maslach Burnout-Inventars (MBI): "Objektive Daten wie z. B. Gesundheitsparameter, Gesundheitszustand, Krankmeldungen oder Beurteilungen durch Dritte werden extrem selten in die Untersuchungen einbezogen. Die Sample-Auswahl ist meist zufällig und enthält oft niedrige Rücklaufraten. Zudem fließen kaum longitudinale Studien in die Auswertung ein. Hierdurch können keine zeitlichen Zusammenhänge verschiedener Symptome und Konzepte eruiert werden. Die definitorischen Unklarheiten in der Diagnosestellung werden in den Studien weitgehend vernachlässigt."
Auch wenn sich an der Diagnostik von Burnout seitdem einiges geändert haben dürfte, beschäftigt sich die zum Teil personenidentische Wissenschaftlergruppe in ihrem jüngsten Bericht damit, ob und wenn ja welche Therapien eine nachweisbare Wirkung auf ein - wie auch immer diagnostiziertes Burnout-Syndrom haben.
Für den Bericht wurden 17 Studien ausgewertet, die insgesamt eine hohe methodische Qualität besitzen (vier Reviews, acht randomisierte kontrollierte Studien).
Die wesentlichen Ergebnisse sehen so aus:
• Als zur Behandlung von Burnout geeignete Therapien werden derzeit Psychotherapie, insbesondere Kognitive Verhaltenstherapie (KVT), Phytotherapie, Physiotherapie, adjuvante Pharmakotherapie und komplementäre Verfahren, wie Musiktherapie oder körperzentrierte Therapien angeboten.
• "13 der 17 Studien befassen sich mit der Wirkung von Psychotherapie und psychosozialen Interventionen (teilweise in Kombination mit anderen Techniken) auf die Reduktion von Burnout. Der Einsatz kognitiver Verhaltenstherapie (KVT) führt in der Mehrheit der Studien zu Verbesserungen der emotionalen Erschöpfung. Die Evidenz der Wirkung von Stressmanagementtraining auf die Reduktion des Burnout ist ebenso wie die Wirkung von Musiktherapie uneinheitlich. Zwei Studien zur Wirksamkeit der Qigong-Therapie kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Durch eine Studie mit dem Evidenzgrad 1B wird die Wirksamkeit von Rhodiola rosea (Rosenwurz) belegt. Physiotherapie wird nur in einer Studie isoliert untersucht und ist dort der Standardtherapie nicht überlegen."
• "Einige Autoren berichten beträchtliche Effekte natürlicher Erholung."
• Auch in diesem Bericht wird bemängelt, dass sich die Diagnostik und die Messung der Outcomes von Burnout-Therapien überwiegend auf das Maslach Burnout Inventar beschränkt, "dessen klinische Validität" nach Ansicht der Autoren "nicht bewiesen" ist.
• Kritisch merken die HTA-Autoren ferner an, dass in den untersuchten Studien ethische, soziale (z.B. die generelle Leistungsorientierung in der Arbeitswelt) und rechtliche Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt werden.
• Angesichts der großen Rolle, die die Arbeitsbedingungen anerkanntermaßen bei der Entstehung von Burnout spielen, verwundert es umso mehr, dass bisher nicht hinreichend untersucht ist, welche Bedeutung sie für die Wirksamkeit von Therapien spielen - ob sie also den Erfolg verhindern oder auch fördern können.
Der 2010 erschienene HTA-Bericht 105 "Differentialdiagnostik des Burnout-Syndroms" von Korczak D; Kister C und Huber B und der 2012 erschienene HTA-Bericht 120 "Therapie des Burnout-Syndroms" von Dieter Korczak, Monika Wastian und Michael Schneider sind komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.7.12
Hohe Übereinstimmung der Vorhersage der Gesamtsterblichkeit durch subjektive und "objektiv"/ärztliche Gesundheitsbewertung
 Vorhersagen des gesamten Sterberisikos durch die Bewertung des Gesundheitszustandes durch Ärzte auf Basis "objektiver" Symptome und Diagnosen und von Individuen auf der Basis subjektiver Symptome, funktionaler Einschränkungen und der Lebensqualität stimmen erneut bemerkenswert überein. Unterschiede gibt es bei der Vorhersage der Sterblichkeit durch Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen.
Vorhersagen des gesamten Sterberisikos durch die Bewertung des Gesundheitszustandes durch Ärzte auf Basis "objektiver" Symptome und Diagnosen und von Individuen auf der Basis subjektiver Symptome, funktionaler Einschränkungen und der Lebensqualität stimmen erneut bemerkenswert überein. Unterschiede gibt es bei der Vorhersage der Sterblichkeit durch Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen.
Dies ist das Ergebnis einer Kohortenstudie (der so genannten "Zutphen Elderly Study") mit 710 zu Hause lebenden niederländischen Männer im Alter von 64 bis 84 Jahren, die bis zu ihrem Tod oder maximal 15 Jahre Studienteilnehmer waren. Zu Beginn der Studie im Jahr 1985, fühlten sich 352 der Männer (49,6%) gesund und 225 (31,7%) bekamen auch von ihrem Arzt eine gute Gesundheit attestiert.
Nach 15 Jahren sahen die Ergebnisse so aus:
• 503 oder 70,8% der Männer verstarben in dieser Zeit. 229 (45,5%) starben an einer kardiovaskulären Erkrankung und 144 (28,6%) an Krebs.
• Diejenigen Personen, die ihren Gesundheitszustand subjektiv als schlecht und sehr schlecht bewertet hatten, hatten statistisch signifikant ein 72% höheres Gesamt-Sterberisiko als diejenigen, die ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut bewertet hatten. Dieses Risiko war bei den Personen deren Gesundheitszustand durch ärztliche Diagnosen etc. als schlecht oder sehr schlecht bewertet wurden, um 77% höher, unterschied sich von der subjektiven Bewertung nur unwesentlich.
• Bei der Vorhersage der Sterblichkeit an einem Krebsleiden hatten die Personen mit subjektiv schlecht bewerteten Gesundheitszustands ein signifikant um 141% höheres Risiko als die Personen, die ihren Gesundheitszustand als gut bewerteten. Bei der Vorhersage des Risikos an einem kardiovaskulären Leiden zu sterben gab es keine eindeutigen, d.h. statistisch signifikanten Prädiktionswerte.
• Bei der Prädiktion des Risikos z.B. an einem Herzinfarkt zu sterben, war zwar die ärztliche, "objektive" Bewertung des Gesundheitszustands besser und die Risikoerhöhung der Personen mit schlechterem ärztlich ermittelten Gesundheitszustand signifikant um 113% höher. Bei der Vorhersage der Krebssterblichkeit auf derselben Datenbasis war die Risikoerhöhung der Personen mit schlechtem ärztlich diagnostizierten Gesundheitszustandes nur gering höher als bei ihren besser bewerteten Ko-Teilnehmern. Der Unterschied war auch nicht signifikant.
Obwohl die Studie keine schlüssige oder abschließende Erklärung für die unterschiedliche Stärke der erkrankungsbezogenen Vorhersagemuster liefert, unterstreicht sie die hohe Verlässlichkeit des subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustands z.B. als prediktiver Indikator für das Risiko, an sämtlichen Ursachen zu versterben.
Der Aufsatz "Self-rated health and physician-rated health as independent predictors of mortality in elderly men"
von Erik J. Giltay et al. ist am 16. Dezember 2011 in der Fachzeitschrift "Age Aging" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.12.11
25 Jahre nach dem Tschernobyl-GAU: Kein Nachlassen des Risikos an Schilddrüsenkrebs als Expositions-Spätfolge zu erkranken
 Drei Tage nachdem das "Deutsche Ärzteblatt" noch einen Bericht über die Ereignisse um das japanische Atomkraftwerk (AKW) Fukushima mit der Formulierung überschrieb "Fukushima: Vorerst geringe Auswirkungen der Radioaktivität", veröffentlichte eine ukrainisch-us-amerikanische ForscherInnengruppe am 17. März 2011 online eine wesentlich pessimistischere und wahrscheinlich auch realistischere Studie über die Langzeit- und Spätfolgen des letzten "Größten anzunehmenden Unfalls (GAU)" eines AKW im ukrainischen Tschernobyl im April 1986.
Drei Tage nachdem das "Deutsche Ärzteblatt" noch einen Bericht über die Ereignisse um das japanische Atomkraftwerk (AKW) Fukushima mit der Formulierung überschrieb "Fukushima: Vorerst geringe Auswirkungen der Radioaktivität", veröffentlichte eine ukrainisch-us-amerikanische ForscherInnengruppe am 17. März 2011 online eine wesentlich pessimistischere und wahrscheinlich auch realistischere Studie über die Langzeit- und Spätfolgen des letzten "Größten anzunehmenden Unfalls (GAU)" eines AKW im ukrainischen Tschernobyl im April 1986.
In dieser Studie wurde eine Kohorte von 12.514 Personen, die 1986 jünger als 18 Jahre alt waren und in mehreren nachweisbar u.a. mit Jod-131 kontaminierten Nachbarbezirken des havarierten AKW wohnten, mehrere Male gründlich auf Risikofaktoren und ihren gesundheitlichen Zustand untersucht. Dies begann mit einer Bestimmung der Dosis des für seine karzinogene Wirkung auf die Schilddrüse bekannten radioaktiven Jod-131 zwei Monate nach dem Unfall und endete u.a. in vier Screeninguntersuchungen auf Schilddrüsenkrebs in den Jahren 1998 bis 2007.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Das Auftreten von 65 Neuerkrankungen bei den Kohortenmitgliedern. Das Auftreten in jüngeren als für diese Krebserkrankung üblichen Lebensjahren ist ein erster Hinweis auf Zusammenhänge mit der konkreten Exposition.
• Mehrere angewendete Risikoberechnungsmodelle weisen auf ein zusätzliches Erkrankungsrisiko zwischen 1,91 und 2,21, also rund eine Verdoppelung des Risikos hin. Wegen der geringen Fallzall kommt es aber zu keinen statistisch signifikanten Unterschieden.
• Gegen die damit zulässigen methodischen Zweifel an einem kausalen Zusammenhang spricht aber der ebenfalls nachgewiesene durchweg lineare Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung. Mit jeder zusätzlichen Portion der Jod-131-Exposition verdoppelt sich das Risiko von Schilddrüsenkrebs. Derartige über solch lange Zeiten existierenden linearen Dosis-Wirkungs-Beziehungen lassen nach Meinung der ExpertInnen keinen Zweifel an einem kausalen Zusammenhang zu.
• Die vorgelegte Langzeitstudie zeigt schließlich auch heute noch kein Nachlassen dieses Erkrankungsrisikos. Nach Meinung der Wissenschaftler besteht dieses Risiko vielmehr insgesamt mindestens 30 Jahre nach der Exposition und wird sich wahrscheinlich erst nach 40 Jahren, d.h. erst im letzten Drittel der Lebenszeit der als Kinder und Jugendliche exponierten Personen normalisiert haben.
Die Ergebnisse zeigen also unabhängig von den methodischen Schwierigkeiten solcher Studien, dass diese und mit Sicherheit viele weiteren gesundheitlichen Spätfolgen eines solchen Unfalls nicht ebenfalls mit dem schnellen Tod der extrem verstrahlten Angehörigen der AKW-Havarie-Besatzungen und mit dem Überstülpen eines Sarkophags verschwunden sind.
Das 32 Seiten umfassende Forschungspapier "I-131 Dose-Response for Incident Thyroid Cancers in Ukraine Related to the Chornobyl Accident" von Brenner AV, Tronko MD, Hatch M, Bogdanova TI, Oliynik VA, Lubin JH et al. ist in der Veröffentlichungsreihe "Environmental Health Perspectives" des staatlichen US-"National Institute of Environmental Health Sciences" am 17. März 2011 online veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.11
Oberschicht-Angehörige haben bei Krebserkrankungen eine deutlich längere Überlebensrate
 Eine kanadische Studie, die knapp 40.000 Krebserkrankungen in der kanadischen Provinz Ontario untersucht hat, kam jetzt zu dem Ergebnis, dass Angehörige oberer Sozialschichten eine deutlich höhere Überlebensrate haben als Unterschicht-Angehörige. Diese jetzt in der Fachzeitschrift "Cancer" veröffentlichten Ergebnisse sind insofern überraschend, als sich bei der Erstdiagnose kein Unterschied im Schweregrad und Stadium der Krebserkrankung gezeigt hatte, wenn man Erkrankungen in den verschiedenen Sozialschichten miteinander verglich.
Eine kanadische Studie, die knapp 40.000 Krebserkrankungen in der kanadischen Provinz Ontario untersucht hat, kam jetzt zu dem Ergebnis, dass Angehörige oberer Sozialschichten eine deutlich höhere Überlebensrate haben als Unterschicht-Angehörige. Diese jetzt in der Fachzeitschrift "Cancer" veröffentlichten Ergebnisse sind insofern überraschend, als sich bei der Erstdiagnose kein Unterschied im Schweregrad und Stadium der Krebserkrankung gezeigt hatte, wenn man Erkrankungen in den verschiedenen Sozialschichten miteinander verglich.
Die Forschungslage zum Zusammenhang von Krebserkrankungen und Sozialschicht ist nicht nur in Deutschland recht unbefriedigend. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen fasst den Erkenntnisstand in seinem Gutachten "Koordination und Qualität im Gesundheitswesen" so zusammen: "Bei folgenden Lokalisationen ist offenbar eine erhöhte Prävalenz in der unteren sozialen Schicht vorhanden: Magen-/Darmkrebs, Lungenkrebs, Nieren-/Blasenkrebs, Leukämie und maligne Lymphome. (…) Ein entsprechender Zusammenhang ist aber nicht durchgängig für alle Arten von Neubildungen zu erkennen." Die Differenzen sind dabei nicht unbeträchtlich. Männliche Angehörige der unteren Sozialschicht haben zum Beispiel ein 70% höheres Risiko an Magen-/Darmkrebs zu erkranken als Mitglieder der Oberschicht. (S. 74)
Die jetzt in Ontario durchgeführte Studie erfasste in den Jahren 2003 bis 2007 alle in den acht regionalen Krebsregistern der Provinz Ontario gemeldeten Krebserkrankungen, sofern es sich um Brustkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder Kehlkopfkrebs handelte. Für jeden einzelnen Fall wurde registriert: Das vom jeweiligen Arzt diagnostizierte Stadium der Erkrankung (abhängig z.B. von Metastasen), Alter und Geschlecht des Patienten, die exakte Diagnose der Krebsart (ICD-Klassifikation) und schließlich auch die Schichtzugehörigkeit. Diese wurde näherungsweise errechnet anhand der Wohnadresse des Patienten und verfügbarer Informationen über das durchschnittliche Einkommen in diesem Wohnquartier. Alle Patienten wurden so einer von 5 Sozialschichten zugeordnet, von der Oberschicht über obere Mittelschicht, Mittelschicht und untere Mittelschicht bis hin zur Unterschicht. Erfasst wurden überdies auch die den Krebsregistern gemeldeten Todesfälle.
In den statistischen Analysen zeigten sich dann erhebliche Unterschiede, wenn man 5-Jahres-Überlebensraten allgemein (ohne Berücksichtigung der Todesursache) und krebsspezifische 3-Jahres-Überlebensraten in den verschiedenen Sozialschichten miteinander verglich. So betrugen beispielsweise die 5-Jahres-Überlebensraten innerhalb der fünf Sozialschichten (von unten nach oben):
• Brustkrebs: 77%, 79%, 81%, 83%, 84%
• Darmkrebs: 52%, 53%, 54%, 57%, 60%
• Gebärmutterhalskrebs: 63%, 71%, 71%, 73%, 79%
Ähnliche, wenngleich nicht ganz so hohe Differenzen zwischen den Schichten ergaben sich bei einem Vergleich der krebsspezifischen 3-Jahres-Überlebensraten, bei denen nur die jeweils diagnostizierte Krebserkrankung als Todesursache für die Analysen berücksichtigt wurde.
Um zu überprüfen, ob für die signifikant unterschiedlichen Überlebensraten ursächlich sein könnte, dass bei Angehörigen unterer Sozialschichten (etwa durch spätes Aufsuchen eines Arztes) im Durchschnitt ein sehr viel späteres Krebsstadium bei der Erstdiagnose vorliegt, wurden dann im Rahmen multivariater Analysen auch diese Informationen über das Stadium und ebenso das Lebensalter berücksichtigt. An den Ergebnissen änderte sich jedoch nur wenig. Hier zeigte sich dann etwa, dass bei Brustkrebs die Wahrscheinlichkeit, 5 Jahre nach der Erstdiagnose noch zu leben, bei Oberschicht-Patienten (im Vergleich zu Unterschicht-Angehörigen) um 47% höher ist, bei Darmkrebs um 36%.
Die Wissenschaftler zeigen sich überrascht von ihren Befunden, da es in Kanada - im Unterschied zu den benachbarten USA - eine medizinische Versorgung gibt, die für alle Bevölkerungsgruppen verfügbar ist. Sie diskutieren verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für ihre Befunde. Denkbar ist einerseits dass das schichtenspezifische Gesundheitsverhalten (z.B. höhere Raucherquoten in der Unterschicht) eine Rolle spielen könnte. Möglich sind nach ihrer Meinung aber auch unterschiedliche Versorgungsleistungen, in Abhängigkeit allein von der Sozialschicht. So hatte eine schwedische Studie 2008 herausgefunden: Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger. Und ähnlich hatte eine US-amerikanische Studie gezeigt: Hohes Einkommen und Bildungsniveau steigern die Überlebenszeit nach einem Herzinfarkt deutlich
Hier ist ein Abstract der jetzt veröffentlichten kanadischen Studie zu schichtspezifischen Überlebensraten bei Krebs: Christopher M. Booth et al: The impact of socioeconomic status on stage of cancer at diagnosis and survival. A population-based study in Ontario, Canada (Cancer, Early View, Published Online: 2 Aug 2010)
Gerd Marstedt, 5.8.10
Ist es sporadisch und selten, wenn in Japan 99,7 % der Schweinegrippeviren gegen Tamiflu resistent sind? Die WHO meint ja!
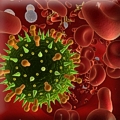 Die interessierte Welt hat durch einen Aufsatz in renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" (vgl. dazu auch eine Zusammenfassung der Aussagen dieses Aufsatzes und anderer Texte im "forum-gesundheitspolitik") erfahren, dass mehrere Experten mit der WHO bekannten finanziellen Verbindungen zu Pharmafirmen, die finanzielle Interessen an einer bestimmten medikamentösen Art der Schweinegrippebekämpfung hatten, bei der Abfassung von WHO-Richtlinien beteiligt waren, die z.B. allen Nationalstaaten empfahlen, bestimmte antivirale Medikamente millionenfach anzuschaffen und kurativ und prophylaktisch im Kampf gegen die Vogelepidemie und Schweinegrippe-Pandemie einzusetzen.
Die interessierte Welt hat durch einen Aufsatz in renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" (vgl. dazu auch eine Zusammenfassung der Aussagen dieses Aufsatzes und anderer Texte im "forum-gesundheitspolitik") erfahren, dass mehrere Experten mit der WHO bekannten finanziellen Verbindungen zu Pharmafirmen, die finanzielle Interessen an einer bestimmten medikamentösen Art der Schweinegrippebekämpfung hatten, bei der Abfassung von WHO-Richtlinien beteiligt waren, die z.B. allen Nationalstaaten empfahlen, bestimmte antivirale Medikamente millionenfach anzuschaffen und kurativ und prophylaktisch im Kampf gegen die Vogelepidemie und Schweinegrippe-Pandemie einzusetzen.
Dabei war u.a. auch der WHO stets die Gefahr bewusst, eine allzu häufige und vor allem prophylaktische Einnahme der Wirkstoffe Oseltamivir (die bekannteste und verbreiteste Arzneimittelmarke ist Tamiflu von der Firma Roche) und Zanamivir (bekannt durch das allerdings seltener eingesetzte Markenmedikament Relenza der Firma GlaxoSmithKline) könne zur raschen Resistenzbildung führen und damit die weitere Bekämpfung des Virus eher erschweren. In der WHO-Empfehlung "Antiviral use and the risk of drug resistance. Pandemic (H1N1) 2009 briefing note 12" vom 25. September 2009 wird dies auch bereits im Titel zum Ausdruck gebracht.
Die noch immer uneingeschränkt (geprüft am 18.6.2010) auf der WHO-Website stehenden Empfehlungen bagatellisieren aber in ihren Schlussfolgerungen das Risiko erheblich. Insbesondere werden Resistenzfälle als "sporadisch und selten" dargestellt und es gäbe keine Evidenz, dass oseltamivir-resistente Schweinegrippeviren in bestimmten Regionen oder gar weltweit zirkulierten.
Trotzdem brauchen sich die Public Health-Akteure keine Sorgen zu machen: "WHO and its network of collaborating laboratories are closely monitoring the situation and will issue information and advice on a regular basis as indicated."
Schon zum Zeitdruck der ersten Veröffentlichung dieser Empfehlungen hätte der WHO aber eigentlich die Existenz eines erheblichen Resistenzbildungsproblems vor allem in Japan bekannt sein müssen. Offensichtlich waren aber die damaligen Daten noch zu schwach um gegen die Verharmlosungsrhetorik der auch am Umsatzwohl der beiden Pharmariesen interessierten Expertenschar und gegen die sorgsam gehegte Furcht vor einer "1918/1919 II"-Pandemie mit zig Millionen Personen anwirken zu können.
Spätestens mit der Veröffentlichung einer Studie der "Working group for Influenza Virus Surveillance in Japan" in der Juni-2010-Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift "Emerging infectious diseases" (Heft 6 Juni 2010; Volume 16, Number 6-June 2010), hätten diese industriefreundlichen Grundeinstellungen aber schlagartig und radikal verändert werden müssen.
Diese Studie stellt nämlich eine Reihe empirischer Zustände in Japan vor, die angesichts der weltseit Millionen eingelagerter Packungen Tamiflu, mal wirklich als dramatisch bezeichnet werden können:
• Als erstes wird nämlich berichtet, dass die Resistenzrate für Tamiflu und Produkte mit demselben Wirkstoff in Japan zwischen der 2007/08- und der 2008/2009-Grippesaison von 2,6 % auf 99,7 % angestiegen ist. Tamiflu ist damit zumindest zur Prophylaxe und Behandlung von Menschen, die an einer H1N1-Infektion leiden, praktisch wertlos.
• Dafür ist evtl. auch der geballte Einsatz von Tamiflu u. Co. maßgeblich verantwortlich, da Japan den weltweit höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Medikamenten dieser Wirkstoffgruppe hatte.
• Positiv wird immerhin vermeldet, dass u.a. das H1N1-Virus nicht zugleich gegen alle anderen Wirkstoffe resistent geworden ist. Dies sollte aber nicht als Freibrief für den Umstieg in den Masseneinsatz dieser Wirkstoffe verstanden werden, wenn man bedenkt, wie schnell sich unter einem massiven prophylaktischen und kurativen Einsatz Resistenzen entwickeln können.
• Die wesentliche Schlussfolgerung aus der japanischen Wissenschaftler lautet: "Although oseltamivir remains a valuable drug for treatment of pandemic (H1N1) 2009, many ORVs (Oseltamivir-resistente Viren) were isolated after prophylaxis with a half dose of the drug. Therefore, prophylaxis with oseltamivir may not be recommended as stated by WHO".
• Eine weitere Beobachtung der japanischen Virologen relativiert allerdings mindestens die aktuelle gesundheitliche Bedeutung der Entstehung von resistenten Viren etwas. Die Symptome und die Einweisungsraten in Krankenhäuser unterscheiden sich nämlich nicht zwischen Menschen mit ORVs und Menschen mit OSV, d.h. Oseltamivir-sensitiven Viren. Selbst wenn dies für den Moment etwas Dramatik aus den Folgen der Resistenzbildung nimmt, kann es nicht als Plädoyer für den weiteren üppigen Gebrauch dieses Wirkstoffs interpretiert werden.
In keinem Fall sollte eine Public Health-Einrichtung wie die WHO weiter die Häufigkeit der Resistenzbildung ignorieren oder kleinschreiben und dem prophylaktischen Einsatz unkritisch gegenüber stehen oder ihn gar fördern. Wenn, ja wenn da nicht die erwiesene Nähe maßgeblicher Ratgeber und Richtlinienverfasser zu der Firma wäre, die natürlich bald wieder weltweit die Lagerhallen mit "Kampfmitteln" gegen die nächste Grippewelle füllen möchte.
Der Aufsatz "Oseltamivir-resistant influenza A (H1N1) viruses during 2007-2009 influenza seasons, Japan" von Ujike M, Shimabukuro K, Mochizuki K, Obuchi M, Kageyama T, Shirakua M, et al. ist in "Emerging Infectious Diseases" erschienen, einer Zeitschrift, die von den "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" herausgegeben wird, einer wissenschaftlichen Einrichtung des US-Gesundheitsministeriums.
Bernard Braun, 18.6.10
"Spanien" lag in "Indien" oder was wäre, wenn heute wirklich eine neue "spanische Grippe" a la 1918/20 ausbräche?
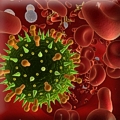 Trotz monatelanger Prophezeiungen der "pandemischen Herausforderung" durch die Schweinegrippe, dem dazu instrumentalisierten Menetekel von bis zu 100 Millionen an der "spanischen Grippe" von 1918/19 verstorbenen Menschen und trotz der prophezeiten "zweiten" Welle oder der im Winter auf der nördlichen Halbkugel drohenden Supermutation des Virus: Die Anzahl der weltweit infizierten oder besser gesagt der durch Tests bestätigten und gemeldeten Fälle von Schweinegrippe stagniert oder geht zurück - auf niedrigerem Niveau als eine "normale" Wintergrippe. Ähnlich sieht es bei der Anzahl der Toten aus. Außerdem handelt es sich bei den Infizierten wie vor allem den Gestorbenen fast immer um Menschen mit mehr oder weniger schweren Zusatzerkrankungen oder Risikofaktoren. Entsprechend zurückhaltend lassen sich in Deutschland selbst Angehörige von wahrscheinlichen Risikogruppen oder auch Angehörige der Gesundheitsberufe nur zu 5% oder 15% mit dem für viele Hundert Millionen Euro für 60% der Bevölkerung eingekauften Impfstoff impfen. Das Impfrisiko erscheint höher als das Erkrankungs- oder gar Sterberisiko der Schweinegrippe.
Trotz monatelanger Prophezeiungen der "pandemischen Herausforderung" durch die Schweinegrippe, dem dazu instrumentalisierten Menetekel von bis zu 100 Millionen an der "spanischen Grippe" von 1918/19 verstorbenen Menschen und trotz der prophezeiten "zweiten" Welle oder der im Winter auf der nördlichen Halbkugel drohenden Supermutation des Virus: Die Anzahl der weltweit infizierten oder besser gesagt der durch Tests bestätigten und gemeldeten Fälle von Schweinegrippe stagniert oder geht zurück - auf niedrigerem Niveau als eine "normale" Wintergrippe. Ähnlich sieht es bei der Anzahl der Toten aus. Außerdem handelt es sich bei den Infizierten wie vor allem den Gestorbenen fast immer um Menschen mit mehr oder weniger schweren Zusatzerkrankungen oder Risikofaktoren. Entsprechend zurückhaltend lassen sich in Deutschland selbst Angehörige von wahrscheinlichen Risikogruppen oder auch Angehörige der Gesundheitsberufe nur zu 5% oder 15% mit dem für viele Hundert Millionen Euro für 60% der Bevölkerung eingekauften Impfstoff impfen. Das Impfrisiko erscheint höher als das Erkrankungs- oder gar Sterberisiko der Schweinegrippe.
Bevor sich die Risiko-Debatte neuen Risiken oder Pseudorisiken zuwendet, Luft für die "dritte" Welle der Schweinegrippe holt, oder gar jemand entdeckt, dass es eigentlich keinen natürlichen Grund gibt, dass die Anzahl der Grippetoten nicht auch deutlich über der der "spanischen Grippe liegen könnte, sollten die soliden Analysen der quantitativen Risiken und qualitativer Profile früherer und heutiger Grippe-Pandemien doch noch einmal gründlicher betrachtet werden. Dafür lohnt ein Blick auf die Ergebnisse einer bereits 2006 nach der Beinahe-Vogelgrippe-Pandemie des Jahres 2005 in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichten genauen Analyse der Höhe und vor allem sozialen Verteilung der tatsächlichen Risiken der "spanischen Grippe".
Die wesentlichen Erkenntnisse aus den dafür differenziert analysierten Datenquellen "Berkeley Human Mortality Database" und der "Mitchell's International Historical Statistics Series" für die Jahre 1915 bis 1923 lauten:
• Obwohl damals wie heute vor allem und am meisten in sozial besser gestellten Ländern über die Pandemie diskutiert und nach Gegenmaßnahmen gesucht wird, starben die meisten Menschen in armen Ländern mit kargen Ressourcen im Bereich der normalen gesundheitlichen Versorgung. Die zusätzliche Mortalität oder Übersterblichkeit ("excess mortality") in den rund drei Dutzend Ländern und Regionen für die Daten vorlagen unterschied sich maximal um das Dreißigfache. Bei einer durchschnittlichen Rate der durch die "spanische Grippe" bedingten zusätzlichen Sterblichkeit von 1,06%, lag Dänemark bei 0,2% und Indien bei 4,4%. Die damals auch schon verslumte Megastadt Bombay erreichte mit 6,18% einen Spitzenplatz. Deutschland hatte trotz seiner durch den ersten Weltkrieg physisch und psychisch geschwächten Militär- und Zivilbevölkerung mit 0,76% einen unterdurchschnittlichen Wert. Auch wenn die Bezeichnung "spanische Grippe" das Gegenteil suggeriert: Bezogen auf ihr Sterberisikopotenzial war die 1918/20-Grippewelle eher eine "indische".
• Der wesentliche Faktor, der die regional unterschiedliche Mortalität erklärte, war das Pro-Kopfeinkommen.
• Rechnet man nun die damaligen Verteilungen auf die Weltbevölkerung des Jahres 2004 hoch, würden bei völlig identischem Niveau und Verlauf wie 1918-20 schätzungsweise weltweit 62 Millionen Menschen zusätzlich an der "Pandemie-Grippe" sterben. 96% dieser Sterbefälle fänden auch oder gerade heute in der so genannten Dritten Welt statt. • Konzentrierte sich diese Mortalität in einem einzelnen Jahr, erhöhte sich die weltweite Mortalität um 114%.
Selbst oder gerade wenn man also das Risiko einer "1918-20-II"-Pandemie ernst nimmt, wird das gegenwärtige extreme Missverhältnis zwischen epidemiologischer Betroffenheit, Katastrophenkommunikation und meist pharmakologischen Interventionskaskaden in der Ersten und Dritten Welt noch offenkundiger.
Dies ist umso verwunderlicher und vor allem kurzfristig gedacht als in denselben Ländern der Dritten Welt, die fast immer ein vielfach höheres Risiko bei gleichzeitig vielfach schlechteren Chancen der Versorgung haben, auch die meisten der großen pandemischen Erkrankungswellen (z.B. die Lungeninfektion SARS, die letzte Vogelgrippewelle und wahrscheinlich auch die aktuelle Schweinegrippewelle) gestartet sind und wegen der dortigen sozialen, hygienischen und gesundheitlichen Bedingungen auch künftig starten werden. Auch wenn die trotz "mildem Verlauf" der Schweinegrippe hartnäckig alarmistische Risikokommunikation die Risiken für die Bevölkerung Mitteleuropas und Nordamerikas überschätzt, darf dies nicht dazu führen die potenzielle Gefährlichkeit der Virusgrippe insbesondere für die Bevölkerung der Dritten Welt und die dortigen Entstehungsbedingungen für mögliche weitere Erkrankungswellen entweder gar nicht wahrzunehmen oder zu unterschätzen.
Die Wissenschaftler weisen aber vorsorglich auf die wegen der heutigen sozialen Rahmenbedingungen insgesamt wahrscheinlich wesentlich geringere Sterbelast einer ansonsten mit 1918-20 vergleichbaren Grippe-Pandemie hin. Dies liegt ihres Erachtens u.a. an einem besseren Symptommanagement oder dem zumindest in Ländern der Ersten Welt besseren bzw. finanzierbaren Zugang zu potenten Antibiotika oder auch speziellen Grippemitteln wie Tamiflu und Relenza (wie eine Reihe von Veröffentlichungen im aktuellen "British Medical Journal" aber belegt, fehlt immer noch- und dies dank von Informationsblockaden des Tamiflu-Herstellers Roche - ein wirklich unabhängiger wissenschaftlicher Nachweis der Wirkung des Neuroaminidasehemmers gegen Komplikationen der Virusgrippe - das forum-gesundheitspolitik wird darüber noch ausführlicher berichten) gegen die gefährlichen infektiösen Folgeerkrankungen der Grippe (z.B. Lungenentzündungen).
Zu dem Aufsatz "Estimation of potential global pandemic influenca mortality on the basis of vital registry data from the 1918-20 pandemic: a quantitative analysis" von C. Murray et al. (The Lancet, Vol. 368. 23. Dezember/30. 2006: 2211-2218) gibt es ohne die einfache, kostenlose und hinsichtlich unerwünschter Spams folgenlose Anmeldung als Leser nur ein Abstract kostenlos. Wer sich anmeldet, bekommt problemlos einen kostenlosen Zugriff auf den kompletten 8-seitigen Text.
Bernard Braun, 14.12.09
Bandscheibenversorgung mit Lücken - Versorgungsforschung im Zeitverlauf mit GKV-Routinedaten
 Jeder 20. Versicherte der Gmünder Ersatzkasse (GEK) erhält einmal im Jahr eine Bandscheibendiagnose, jeder 60. Versicherte wird deswegen zeitweise oder dauerhaft arbeitsunfähig. Je nach Schweregrad und Therapieform entstehen jährlich direkte Kosten von 200 bis 4.500 Euro pro Fall. Hierbei handelt es sich auch nicht um ein stagnierendes Geschehen, sondern ums genaue Gegenteil: Allein das Neuauftreten (Inzidenz) einer ambulant neu diagnostizierten Bandscheibenverlagerung im Bereich der Lendenwirbelsäule (lumbal) stieg zwischen 2004 und 2007 um 20 Prozent. Die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten aufgrund eines Bandscheibenschadens im selben Rückenbereich nahm im selben Zeitraum um 40 Prozent zu. In beiden Fällen ist der denkbare Effekt unterschiedlicher Alters- und Geschlechtsstrukturen ausgeschlossen.
Jeder 20. Versicherte der Gmünder Ersatzkasse (GEK) erhält einmal im Jahr eine Bandscheibendiagnose, jeder 60. Versicherte wird deswegen zeitweise oder dauerhaft arbeitsunfähig. Je nach Schweregrad und Therapieform entstehen jährlich direkte Kosten von 200 bis 4.500 Euro pro Fall. Hierbei handelt es sich auch nicht um ein stagnierendes Geschehen, sondern ums genaue Gegenteil: Allein das Neuauftreten (Inzidenz) einer ambulant neu diagnostizierten Bandscheibenverlagerung im Bereich der Lendenwirbelsäule (lumbal) stieg zwischen 2004 und 2007 um 20 Prozent. Die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten aufgrund eines Bandscheibenschadens im selben Rückenbereich nahm im selben Zeitraum um 40 Prozent zu. In beiden Fällen ist der denkbare Effekt unterschiedlicher Alters- und Geschlechtsstrukturen ausgeschlossen.
Grundlage dieser Ergebnisse war die in Deutschland erstmals durchgeführte individuenbezogene Längsschnittanalyse von ambulanten und stationären Routinedaten zu vier Bandscheiben-Diagnosen (Schäden und Verlagerungen im unteren [lumbalen] und oberen [zervikalen] Rückenbereich) von 1,1 Millionen GEK Versicherten aus den Jahren 2005 bis 2007. Da die GEK-Versicherten durchschnittlich jünger als die Versicherten in der GKV sind und Bandscheibenerkrankungen im Lebensalter zwischen 50 und 59 Jahren kumulieren, sind die Versicherten einer Reihe von gesetzlichen Krankenkassen eher mehr von den hier dokumentierten Problemen betroffen und garantiert nicht weniger.
In dem am 14. September 2009 veröffentlichten "Bandscheiben-Report" finden sich außerdem eine Reihe weiterer wichtiger Hinweise für das seit kurzem eingeführte Recht der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement (§ 11 Abs. 4 SGB V):
• So haben Patienten mit der ambulanten Diagnose "Rückenschmerzen" eine um 90% bis 127% höhere Wahrscheinlichkeit an einer der vier Bandscheibenerkrankungen zu leiden als Personen ohne "Rückenschmerzen". Diese nicht ernst zu nehmen kann also weitreichende Folgen haben.
• Bei 65 Prozent der Patienten, die im ersten Jahr nach Erstdiagnose weiterhin spezifische Diagnosen erhielten, aber ohne Therapie blieben, leiden auch noch im zweiten Jahr an der Erkrankung bzw. bekommen entsprechende Diagnosen ohne erkennbare Therapie.
Bewertet man die gefundenen Versorgungswirklichkeiten mit Hilfe der in Leitlinien konsentierten Behandlungsempfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften und Versorgungsträgern, zeigen sich sowohl erfreuliche Übereinstimmungen oder leitlinienkonforme Behandlungsmuster als auch erhebliche Verbesserungsbedarfe:
• Das verbreitet zu findende eher abwartende und primär auf Schmerzreduktion und Entspannung setzende Behandeln ist leitlinienkonform. Ebenso die insgesamt nur selten zu beobachtenden Lagerungen und Immobilisationen der Patienten.
• Zu gering und nicht leitlinienkonform ist der relativ geringe Anteil der Bandscheibenerkrankten, die eine Rehabilitation durchführen: 22 Prozent der operierten Bandscheibenpatienten erhalten nach dem Krankenhausaufenthalt eine Anschlussheilbehandlung oder eine aktivierende Reha-Maßnahme.
• Bei bis zu 40 Prozent der stationär eingewiesenen Patienten ist keine anschließende stationäre oder ambulante Behandlung dokumentiert.
• Obwohl die Empfehlung, die Abfolge von notwendigen kurativen und rehabilitativen Leistungen möglichst nahtlos und zügig durchzuführen, eindeutig ist, sieht es in Wirklichkeit zum Teil etwas anders aus: Auffällig ist z.B. die durchschnittlich vierwöchige Lücke zwischen klinischer und postklinischer Behandlung bei über 40 Prozent der Patienten. Erst nach zwölf Wochen reduziert sich deren Anteil auf 20 Prozent.
• Ein großer Verbesserungsbedarf besteht bei der Durchführung von präventiven Leistungen, die sehr selten in den Versorgungsdaten zu finden sind.
• Ähnliches gilt für explizit erbrachte spezielle rehabilitative Leistungen zur schnellen Reintegration in Beruf und Alltag - einem der wichtigsten Mittel, Chronifizierung zu verhindern.
• Der Anteil von Erkrankten, die nur passive oder passivierende statt aktivierende Leistungen erhalten, ist mit rund einem Viertel im Lichte der Leitlinienempfehlungen zu hoch.
Schließlich zeigten die Analysen eine Reihe von ungleichen Behandlungen bei gleichen Diagnosen oder auch Unterversorgung:
• Erwerbspersonen erhalten generell häufiger und mehr Rehabilitationsleistungen als Nichterwerbspersonen. Dies erklärt zum Teil, dass Frauen diese Leistungen seltener erhalten als Männer.
• Kräftige Unterschiede gibt es aber auch zwischen Erwerbstätigen mit höherem beruflichen Status und ihren KollegInnen mit geringerer Qualifikation: Die Wahrscheinlichkeit für versicherte Techniker und qualifizierte Angestellte dann, wenn sie an lumbalen Bandscheibenschäden oder -verlagerungen leiden, eine Rehamaßnahme zu erhalten ist 1,9-mal bis 2,5-mal so hoch wie bei Geringerqualifizierten und nicht Erwerbstätigen.
Zeigt der Report einerseits die Machbarkeit solcher Analysen mit Routinedaten, so greift eine ausschließlich auf diesen Daten beruhende Analyse manchmal zu kurz und erlaubt z.B. keine weiterreichende Identifikation von Ursachen der schlechteren Versorgung und Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen bei den weiblichen Erkrankten. Um mehr über Hintergründe und Einflussfaktoren auf Entscheidungen zu erfahren, bedarf es aber mündlicher Befragungen von Leistungserbringern, Krankenkassensachbearbeitern und Patienten.
Der von Wissenschaftlern des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen (Maren Bauknecht, Bernard Braun und Rolf Müller) erstellte 141 Seiten umfassende "GEK-Bandscheiben-Report" ist komplett und kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 15.9.09
Brustkrebs-Früherkennung durch Mammographie: Ein Drittel aller Karzinome ist harmlos und überdiagnostiziert
 Etwa jedes dritte Brustkrebs-Karzinom, das bei bevölkerungsweiten Screenings mithilfe der Mammographie entdeckt wird, ist nach Befunden einer Studie, die jetzt im British Medical Journal veröffentlicht wurde, überdiagnostiziert. Solche Tumore wachsen entweder nur sehr langsam oder sie bilden sich auch spontan zurück, so dass sie in keinem Falle gefährliche oder lebensbedrohliche Formen einnehmen. Die Patientinnen würden in diesem Falle an anderen Ursachen sterben. Ein Problem ist allerdings, dass die Medizin bis heute noch nicht vorhersagen kann, welche Tumore harmlos bleiben und welche sich zu einem tödlichen Risiko entwickeln. Von daher werden alle diagnostizierten Brustkrebs-Tumore medizinisch behandelt - mit der Folge einer Überdiagnostik und Überversorgung.
Etwa jedes dritte Brustkrebs-Karzinom, das bei bevölkerungsweiten Screenings mithilfe der Mammographie entdeckt wird, ist nach Befunden einer Studie, die jetzt im British Medical Journal veröffentlicht wurde, überdiagnostiziert. Solche Tumore wachsen entweder nur sehr langsam oder sie bilden sich auch spontan zurück, so dass sie in keinem Falle gefährliche oder lebensbedrohliche Formen einnehmen. Die Patientinnen würden in diesem Falle an anderen Ursachen sterben. Ein Problem ist allerdings, dass die Medizin bis heute noch nicht vorhersagen kann, welche Tumore harmlos bleiben und welche sich zu einem tödlichen Risiko entwickeln. Von daher werden alle diagnostizierten Brustkrebs-Tumore medizinisch behandelt - mit der Folge einer Überdiagnostik und Überversorgung.
Um das Ausmaß dieser Überversorgung zu erkennen, analysierten Karsten Jřrgensen und Peter Gřtzsche vom "Nordic Cochrane Centre" die Inzidenzraten (Häufigkeit neu auftretender Fälle) von Brustkrebs vor und nach der Einführung bevölkerungsweiter Screening-Programme in fünf Ländern: United Kingdom, Kanada, Australien, Schweden und Norwegen. Um Verzerrungen bei den Daten zu vermeiden, schlossen sie Zeiträume von zumindest sieben Jahren vor und nach der Einführung des Screenings ein. Überdies analysierten sie die Ergebnisse von Gruppen mit und ohne Mammographie und unterteilten diese auch in Altersgruppen. Auch andere Einflussfaktoren wurden berücksichtigt, so unter anderem sinkende Brustkrebsquoten bei älteren, schon gescreenten Frauen.
Heraus kam bei den Analysen eine Zunahme der Inzidenzquoten, die eng zusammenhing mit der Einführung des Screening. Dieser Befund ist jedoch zu erwarten, denn neben den klinisch relevanten werden auch kleinere Tumore entdeckt. Einige Jahre später sollte die Inzidenz jedoch wieder auf das ursprüngliche Niveau aus dem Zeitraum vor Einführung des Screenings zurückgehen. Dies jedoch war in keinem der untersuchten fünf Länder der Fall. Die Wissenschaftler schätzten dann das Ausmaß der Überdiagnostik folgendermaßen ein: United Kingdom etwa 57%, Manitoba (Kanada) 59%, New South Wales 53%, Schweden 46%, Norwegen 52%. Insgesamt schätzen sie die Überdiagnostik auf 52%. Dies schließt sog. Carcinome in-situ mit ein (eine Krebs-Vorstufe), die üblicherweise medizinisch auch behandelt werde. Für gravierende Krebsformen schätzten sie die Überdiagnostik auf 35%.
Diese Befunde, so schreibt Prof. H. Gilbert Welch in einem Editorial des British Medical Journal, stimmen überein mit einer wachsenden Evidenz aus vielen anderen Studien, die darauf hinweisen, dass die Einführung des Brustkrebs-Screening mit Mammographie eine gravierende Überdiagnostik bewirkt. Ohne Zweifel würde das Screening vielen Frauen helfen, bei anderen aber auch schwere Schäden im Gefolge der Therapie verursachen. Es gibt daher keine objektiv richtige Antwort auf die Frage: Zur Früherkennung gehen oder nicht? Dies sei eine persönliche Entscheidung jeder Frau. Allerdings müsse man diese besser informieren und ihnen auch quantitativ deutlich machen, welche Nutzen und welche Risiken sich aus der Früherkennungs-Untersuchung für sie ergeben.
• PDF der Studie: Karsten Juhl Jřrgensen, Peter C Gřtzsche: Overdiagnosis in publicly organised mammography screening programmes: systematic review of incidence trends
(BMJ 2009;339:b2587; doi:10.1136/bmj.b2587)
• Abstract der Studie
• Editorial von H Gilbert Welch: Overdiagnosis and mammography screening
Gerd Marstedt, 10.8.09
Ein "kühler" Nachtrag zu einem "heißen" Thema - Warum gab und gibt es keine Vogelgrippe-Pandemie?
 Auch wenn man im Jahr der Schweinegrippe nicht mehr viel über die insgesamt bis heute geringe Verbreitung der anfänglich auch als Gefahr für die ganze Welt kommunizierten Vogelgrippe hört, ist es nicht nur von historischem Interesse, warum es nicht zu einer weltweiten Verbreitung gekommen ist.
Auch wenn man im Jahr der Schweinegrippe nicht mehr viel über die insgesamt bis heute geringe Verbreitung der anfänglich auch als Gefahr für die ganze Welt kommunizierten Vogelgrippe hört, ist es nicht nur von historischem Interesse, warum es nicht zu einer weltweiten Verbreitung gekommen ist.
Die jetzt von angelsächsischen Virologen in "PLoS Pathogens" (2009; 5: e1000424) veröffentlichten Ergebnisse einer Untersuchung bietet dafür eine verblüffend einfache, experimentell mehrfach bestätigte Erklärung an: Die menschlichen Nasenschleimhaut ist den spezifischen Vogelgrippeviren schlicht und einfach zu kalt.
In der menschlichen Nase als Haupteintrittspforte für Grippe- und andere Krankheitserrreger herrscht eine Temperatur von 32 Grad Celsius. Die H5N1- oder Vogelgrippen-Viren sind aber in den Därmen ihrer Wirts-Lebewesen 40 Grad Celsius gewohnt. In Experimenten gelang es den ForscherInnen im Labor , menschlichen Grippeviren, die ihre Wirkung auch bei 32 Grad Celsius entfalten können, das für die Temperaturempfindlichkeit der Vogelgrippe-Viren verantwortliche Gen einzubauen. Dies trug unmittelbar dazu bei, dass auch die menschlichen Grippeviren nicht mehr bei 32 Grad Celsius funktionierten.
Die ForscherInnen fassten ihre Ergebnisse,nachdem sie die bekannt geringe Häufigkeit von Vogelgrippefällen bei Menschen ("Transmission of avian influenza viruses from bird to human is a rare event") konstatieren, so zusammen: "These data suggest that influenza viruses bearing avian or avian-like surface glycoproteins have a reduced capacity to establish productive infection at the temperature of the human proximal airways. This temperature restriction may limit zoonotic transmission of avian influenza viruses".
Mit dem Halbsatz, dass ihre Ergebnisse auch Hinweise enthalten, "that adaptation of avian influenza viruses to efficient infection at 32°C may represent a critical evolutionary step enabling human-to-human transmission", deuten sie aber an, dass Viren zu den Lebewesen mit der höchsten Veränderbarkeit gehören und man das Ergebnis der ForscherInnengruppe nicht als völlige Entwarnung missverstehen darf.
Fragt sich nur, ob es nicht möglich ist, alle Viren "kälteempfindlicher" zu machen?
Angesichts der auch bei der Vogelgrippe dramatischen Risikokommunikation und der damals geradezu panikartigen Einlagerung von Millionen Packungen des Medikaments "Tamiflu" stellt sich im Lichte dieser Ergebnisse die Frage, warum eigentlich nicht bereits damals die Temperaturreagibilität von Viren und die höheren Temperaturen von Vögeln (die ist selbst von Laien fühlbar, wenn sie mal einen Vogel in die Hand nehmen) bekannt waren und Nachdenklichkeit erzeugt haben?!
Offensichtlich muss bei vergleichbar bedrohlich erscheinenden Krankheitsrisiken, also auch bei der aktuellen Schweinegrippe, weit über die "Scheuklappen" Arzneimittel und Mundschutz (beides natürlich auch wichtig) hinaus gedacht werden.
Der 10 Seiten umfassende und verständlicherweise stark naturwissenschaftlich argumentierende Aufsatz "Avian Influenza Virus Glycoproteins Restrict Virus Replication and Spread through Human Airway Epithelium at Temperatures of the Proximal Airways" von Scull MA, Gillim-Ross L, Santos C, Roberts KL, Bordonali E et al. in "PLoS Pathogens" (5[5]: e1000424. doi:10.1371/journal.ppat.1000424) ist dank der vorbildlichen Open Access der PloS-Publikationen komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.5.09
"Cochrane Reviews of Prevention and Treatment of Influenza" - Zu Evidenzen bei der Prävention und Behandlung von Virusgrippe
 Die qualitativ hochwertigen Reviews der Cochrane Collaboration sind wegen ihrer wissenschaftlichen Gründlichkeit meist oder zunächst nicht geeignet, aktuelle Antworten zu tagesaktuellen gesundheitlichen Problemen zu liefern. Dies gilt auch für die Frage, ob und wie die Schweinegrippe zu verhindern, zu behandeln oder zumindest in ihrer Verbreitung behindert werden kann.
Die qualitativ hochwertigen Reviews der Cochrane Collaboration sind wegen ihrer wissenschaftlichen Gründlichkeit meist oder zunächst nicht geeignet, aktuelle Antworten zu tagesaktuellen gesundheitlichen Problemen zu liefern. Dies gilt auch für die Frage, ob und wie die Schweinegrippe zu verhindern, zu behandeln oder zumindest in ihrer Verbreitung behindert werden kann.
Da es sich weder bei der Virusgrippe im allgemeinen noch bei der Schweinegrippe und ihrer Prävention wie Behandlung um völlig neue Probleme handelt, existieren aber trotz der mangelnden Tagesaktualität aus der jüngeren Vergangenheit verschiedene Cochrane-Reviews, die sich mit dem Forschungsstand zu den genannten Fragen zum Teil und mit der gewohnten Seriosität beschäftigt haben.
Die Cochrane Collaboration hat diese Reviews nun in einem speziellen Bereich der "Cochrane Reviews of Prevention and Treatment of Influenza" inhaltlich zusammengestellt und sie in den meisten Fällen kostenlos als PDF-Dateien zugänglich gemacht.
Zu den Aspekten, zu denen dort meist sehr ausführliche Original-Reviews verfpügbar gemacht werden, gehören
• Interventionen, um die Verbreitung des Grippevirus zu verhindern, mit den inhaltlichen Schwerpunkten "physical methods" und "dugs".
• Impfung gegen die Grippe bei "healthy people" und "people with other illnesses".
• Interventionen zur Behandlung der Grippe mit den Schwerpunkten "drugs", "Complementary and alternative medicines" und "other interventions".
Die Seite der "Cochrane Reviews of Prevention and Treatment of Influenza" auf der dann weit über 20 Reviews mit speziellen Untersuchungen zur Evidence der Behandlung von Virusgrippen verfügbar sind, gewährt kostenlosen Zugang zu kompletten wissenschaftlichen Aufsätzen und Studien zum Thema.
Bernard Braun, 18.5.09
Ausbreitung der Schweinegrippe "seems unlikely", aber sorgfältiges Monitoring notwendig - Das NEJM-"H1N1 Influenca Center"
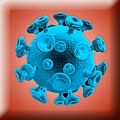 Es ist gerade einen Monat her, dass die ersten aktuellen Fälle einer Erkrankung an dem unter der griffigen Bezeichnung "Schweinegrippe" kommunizierten H1N1-Grippevirus beobachtet wurden und bisher auch eine wider Erwarten geringe Anzahl von Erkrankten an dieser Erkrankung verstarb.
Es ist gerade einen Monat her, dass die ersten aktuellen Fälle einer Erkrankung an dem unter der griffigen Bezeichnung "Schweinegrippe" kommunizierten H1N1-Grippevirus beobachtet wurden und bisher auch eine wider Erwarten geringe Anzahl von Erkrankten an dieser Erkrankung verstarb.
Seriöse Experten, Institutionen und Medien kommen zu zwei Zwischenerkenntnissen, die in klarem Gegensatz zu der seit zwei Wochen insbesondere in zahlreichen Massenmedien betriebenen Pandemie-Weltuntergangsstimmung stehen.
Offensichtlich kommt die Kommunikation gesundheitlicher Risiken seit einigen Jahren nicht mehr ohne die regelmäßige (Neu-)Entdeckung von Killer- (so im Titel eines ARD-Filmes) oder "Weltviren" (so der Titel der SPIEGEL-Ausgabe vom 4.5.2009) aus: Zu den prominenten und zu Beginn ähnlich kommunizierten Vorgängern gehören neben der "normalen" Virusgrippe SARS und die Vogelgrippe, massenhaft kommunizierte bakterielle Weltbedrohungen waren in der Vergangenheit z.B. Ebola oder Denge. Dem Menetekel und dem häufig bemühten aber grottenschiefen Vergleich mit der Grippepandemie der Jahre 1918/19 mit ihren rund 50 Millionen Toten folgt aber zumindest in den Massenmedien nur selten eine Darstellung und Bewertung der weiteren Verläufe der Krankheit und ihrer zum Teil erfolgreichen Bekämpfung. So kommt es auch zu solch bizarren Informationssituationen, dass z.B. die jährlich rund 500.000 Toten der "normalen" Virusgrippe ganz zu schweigen von den Millionen von Menschen, die jährlich an Malaria oder an Durchfallerkrankungen weitgehend vermeidbar versterben, gegenüber den bisher an der Vogel- und Schweinegrippe verstorbenen mehreren hundert Menschen (jeder Tote ist selbstverständlich einer zu viel) fast ignoriert werden. Unbekannt bleibt bzw. es wird nicht dargestellt, dass an der ebenfalls als potenziell pandemisch kommunizierten SARS-Erkrankung seit Jahren maximal 1.000 Menschen starben.
Umso wichtiger ist es aus gesundheitswissenschaftlicher wie -politischer Sicht endlich eine inhaltlich klare, wissenschaftlich solide und korrekte, ohne Verängstigung verlaufende öffentliche Risikokommunikation zu gewährleisten.
Das angesehene US-Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" versucht dies nun für die Schweinegrippe hin zu bekommen und formuliert zum Beginn seiner Bemühungen in einem Editorial seiner Ausgabe vom 7.Mai 2009 zwei wichtige Ausgangsaspekte:
• "It seems unlikely that this outbreak will lead to widespread, severe illness and deaths."
• "However, this may be just the first wave, and we will carefully monitor this outbreak"
Um nicht selbst bei nächster Gelegenheit dem Hang zur selbstorganisierten Vergesslichkeit zu verfallen, richtet die NEJM-Redaktion ab sofort ein allen Interessenten offenes und kostenlos zur Verfügung stehendes "H1N1 Influenca Center" ein, das auf einem vorrangig an "health professionals" gerichteten Niveau Forschungsarbeiten und andere wissenschaftliche Artikel des NEJM zum Thema dokumentiert sowie Zusammenfassungen anderer Arbeiten aus der "Journal Watch"-Redaktion und andere Kommentare wichtiger Artikel in anderen Publikationsorganen an einem Ort zugänglich macht.
Damit entfällt zum Teil das oft gehörte Argument, der Zeitaufwand, sich diesen Wissensstand selber im Internet und Bibliotheken zu verschaffen, sei zu hoch.
Zusätzlich findet auf der Center-Seite auch stets aktualisierte Überblicke über den Stand der Verbreitung und unerwünschten Folgen der Schweinegrippe und das dafür verwandte Datenmaterial der WHO und der US-"Centers for disease control and prevention". Für die immer größer werdende Zahl von Menschen, deren Problemwahrnehmung blickorientiert verläuft, gibt es auch noch eine interaktive Landkarte mit den wichtigsten Eckdaten der Schweinegrippenentwicklung in den USA und dem Rest der Welt.
Ergänzt werden die Publikationen zur aktuellen Entwicklung durch historische Arbeiten über vergangene Grippe- und auch Schweinegrippeepidemien und -pandemien z.B. 1976 in den USA oder eben auch die in der Tat bedrohliche Referenz-Pandemie des Jahres 1918. Die Artikel aber durchaus noch zurück bis zum Jahre 1837.
Ergänzend zu diesen Aufsätzen lohnt sich die Lektüre einer gerade vom "Institute of Medicine (IOM)" der USA als freies PDF-Dokument wiederveröffentlichten Studie über den Verlauf und den Umgang mit einer bereits 1976 in den USA aufgetretenen Schweinegrippen-Epidemie. Der darüber von Richard E. Neustadt und Harvey V. Fineberg 1978 verfasste Report hat den Titel "Swine Flu Affair Decision-Making on a Slippery Disease", enthält auf 166 Seiten eine ausführliche Darstellung des von der damaligen US-Regierung verabschiedeten Immunisierungsprogramms und stellt zum Teil hochaktuelle "lessons" dar, "to help cope with similar situations in the future". Zu den Problemen des Umgangs mit dieser Erkrankung deutet bereits der Titel der Studie eine wesentliche Grundbedingung an, ihre schlechte Fassbarkeit. Entsprechend charakterisierten Neustadt und Fineberg die damalige Intervention als eine Abfolge von Kontroversen, Verspätungen, Verwaltungsdurcheinander, gesetzliche Unklarheiten, unvorgesehene Nebeneffekten und einem fortschreitenden Verlust der Glaubwürdigkeit der damaligen Public Health-Autoritäten. Selbst wenn viele Einzelheiten dieses Berichts keinen unmittelbaren Nutzen haben, stellt er ein bemerkenswertes Beispiel dar, wie komplex und flexibel wirksame gesundheitliche Programme aussehen müssen und was sie gefährdet.
Die Studie von Neustadt und Fineberg "Swine Flu Affair Decision-Making on a Slippery Disease" ist vom IOM kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Das NEJM-Editorial "H1N1 Influenza A Disease — Information for Health Professionals" von Lindsey R. Baden, Jeffrey M. Drazen, Patricia A. Kritek, Gregory D. Curfman, M.D., Stephen Morrissey, Ph.D. und Edward W. Campion, M.D. ist kostenlos erhältlich. Die direkte Adressierung bedeutet aber nicht, dass Nicht-Ärzte nichts mit Informationen anfangen könnten.
Das H1N1 Influenca Center ist entweder über das Editorial oder direkt zu erreichen und steht mit seinen Inhalten zumindest im Moment kostenlos jedermann zur Verfügung.
Dies gilt auch für die "Gesundheits- oder Krankheits-Landkarte".
Bernard Braun, 10.5.09
Malaria in den Zeiten von Vogel- und Schweinegrippe. Wer oder was entscheidet über die Wichtigkeit von Krankheiten?
 Frühlings- und Sommerzeit sind in Mitteleuropa oder Nordamerika auch die Monate der Fliegen- und Mücken"plage", Fliegenklatschen, Mückensprays, "harmlosen" Chrysanthemenextrakt-Plättchen und Fliegenfallen. Und wenn man doch gestochen wird oder vor lauter Mückengesirre nicht einschlafen kann, helfen kühlende Gels, Ohrenstöpsel und die jährlichen Innovationen der Hersteller einschlägiger Anti-Mückenmittel weiter.
Frühlings- und Sommerzeit sind in Mitteleuropa oder Nordamerika auch die Monate der Fliegen- und Mücken"plage", Fliegenklatschen, Mückensprays, "harmlosen" Chrysanthemenextrakt-Plättchen und Fliegenfallen. Und wenn man doch gestochen wird oder vor lauter Mückengesirre nicht einschlafen kann, helfen kühlende Gels, Ohrenstöpsel und die jährlichen Innovationen der Hersteller einschlägiger Anti-Mückenmittel weiter.
In diesem alljährlichen "Kampf" wird allzu gern vernachlässigt, dass Hunderte Millionen Menschen in großen Teilen der wärmeren Gefilde der Erde gerne unsere Probleme hätten, d.h. gerne auf die dort drohenden Krankheits- und Todesfolgen des Stichs einer bestimmten Mückensorte verzichten würden.
Es handelt sich um Malaria, d.h. einer durch den Stich der Anophelesmücken-Weibchen übertragenen Infektionskrankeit mit den Erregern Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi und Plasmodium semiovale. Von diesen führt besonders der erste Erreger häufig zu einem tödlichen Ausgang der ansonsten vor allem mit hohem und schubweisem Fieber und Krämpfen einhergehenden Akuterkrankung führt.
Sie ist mit rund 515 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr die mit Abstand weltweit häufigste parasitäre Infektionserkrankung. Die Anzahl der jährlich an Malaria sterbenden Menschen beträgt mehr als 3 Millionen Personen, darunter 850.000 Kinder.
Malariaerkrankungen und -todesfälle konzentrieren sich auf die tropischen Regionen Afrikas, Asiens, Süd- und Mittelamerikas, die Karibik und Teile des Pazifiks. Die gefährlichste Variante mit dem Erreger Plasmodium Falciparum tritt besonders stark im Subsaharabereich Afrikas auf. Dort wird aber auch deutlich, dass die Gefährlichkeit der Malaria sich nicht nur aus der Existenz des Anopheles-Moskito ergibt, sondern auch unangemessene Malariakontroll- und -präventionsdienste wesentlich zur Erkrankungshäufigkeit und den unerwünschtesten Folgen beitragen.
Da es angesichts der Fülle sozialer und kollektiver Probleme offensichtlich nicht mehr anders möglich ist, vergeht mittlerweile fast kein Tag (wen ein Überblick über diese Art von Tagen interessiert schaue in den "Stadtplan Gesundheit") ohne eines offiziellen Gedenkens an HIV, Behinderte, Wasserknappheit oder einer untergehenden Tierart als kulturellem Ritual das jeweilige Problem zu thematisieren. Der 25. April jeden Jahres ist daher der "Weltmalariatag".
Das internationale, von der Weltbank gegründete und u.a. von der WHO und der Gates-Stiftung unterstützte "Disease Control Priorities Project (DCPP)" hat dies zum Anlass genommen, auf einige seiner Standarddokumente (z.B. das 20 Seiten umfassende Kapitel "Conquering Malaria" eines umfangreicheren Handbuchs) zu den Themen Ursachen, Prävention und Behandlung von Malaria hinzuweisen und unter der Überschrift "WORLD MALARIA DAY 2009. Elimination of Deadly Parasitic Disease is Possible" eine Fülle weiterer wichtiger epidemiologischer, medizinischer und gesundheitsökonomischer Informationsquellen zusammenzustellen und zum Teil per Link zugänglich zu machen.
Die Themenschwerpunkte sind u.a.:
• Malaria and its Impact on Maternal, Perinatal, and Child Health
• New evidence for conquering malaria: Operations, Costs and Cost-Effectiveness
• Defining and Defeating the Intolerable Burden of Malaria
• Undernutrition as an underlying cause of malaria morbidity and mortality
• The Public Health Burden of Plasmodium falciparum Malaria in Africa: Deriving the Numbers
• New Perspectives on the Causes and Potential Costs of Malaria: The Growth and Development of Children. What Should We be Measuring and How Should We be Measuring It?
• Do Malaria Control Interventions Reach the Poor?: A View Through the Equity Lens
• The economic burden of illness for households: A review of cost of illness and coping strategy studies focusing on malaria, tuberculosis and HIV/AIDS
• The Intolerable Burden Of Malaria: What's New, What's Needed
Bevor sich unsere Aufmerksamkeit dem heutigen Tag des geistigen Eigentums und dem AKW-Unfall in Tschernobyl oder dem Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am 28.4. zuwendet, lohnt sich vielleicht das kurze Nachdenken darüber, warum Malaria fast schon wieder vergessen, das neueste Risiko einer "weltweit drohenden" Schweinegrippe aber wahrscheinlich noch monatelang die erkrankten Menschen, Staaten, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Hunderte Millionen Zeitungsleser und TV-Zuschauer beschäftigen wird. Nachdem der "Vorgänger" der jetzt angeblich drohenden Epidemie, nämlich die Vogelgrippe-Pandemie erfreulicherweise "irgendwo" steckengeblieben ist, scheint die Schweinegrippe der willkommene Nachfolger für schlagzeilengierige Berichterstatter und die Hersteller von Medikamenten mit dem Wirkstoff Oseltamivir darunter vor allem der Marktführer Roche mit dem Marken- und Blockbusterpräparat Tamiflu zu sein. Die WHO meint immerhin schon sagen zu können, dass die in Mexiko und in einigen Südstaaten der USA untersuchten Viren "have been sensitive to oseltamivir, but resistant to both amantadine and rimantadine".
Ein Blick auf die pharmakologische und sehr begrenzte Bedeutung oder Wirkung des Wirkstoffs Oseltamivir und der pharmako-politischen Hintergründe seiner "Erfolgsgeschichte" und Verbreitung und der Ereignisse im Kontext der Vogelgrippe, liefert eine Reihe von ernsthaften Anhaltspunkten, die in der wahrscheinlich bevorstehenden Schweinegrippeepidemie-Zeit beachtet, hinterfragt und zum Inhalt gesundheitswissenschaftlicher Kommunikation des Risikos gemacht werden sollten.
Die genannten Dokumente und Studien über Malaria findet man der DCCP-"Presseerklärung vom 24.4.2009".
Bernard Braun, 26.4.09
Diabetes-Inzidenz in den USA 1997-2007: Insgesamt Verdoppelung aber mit bedeutenden Trendunterschieden in den Bundesstaaten
 Eine Verdoppelung der Inzidenz, also des Neuauftretens einer Diabeteserkrankung, innerhalb eines Jahrzehnts ist eine enorme Entwicklung. Sie ist sogar bedrohlich, wenn man die Wachstumsrate mehr oder weniger linear fortschreibt und diese Entwicklungen für unvermeidbar hält.
Eine Verdoppelung der Inzidenz, also des Neuauftretens einer Diabeteserkrankung, innerhalb eines Jahrzehnts ist eine enorme Entwicklung. Sie ist sogar bedrohlich, wenn man die Wachstumsrate mehr oder weniger linear fortschreibt und diese Entwicklungen für unvermeidbar hält.
Konkret geht es die neuesten statistischen Ergebnisse zur Zunahme von Diabetes unter den erwachsenen BürgerInnen in den USA, von alterstandardisierten, also unter Ausschluss des Einflusses von Alterseinflüssen, 4,8 Fällen pro 1.000 Erwachsenen im Zeitraum 1995-1997 auf 9,1 Fälle pro 1.000 zwischen 2005 und 2007.
Dies berichtet zumindest die Ausgabe des MMWR der CDC (Morbidity and Mortality Weekly Report der Centers for Disease Control and Prevention) der USA vom 31. Oktober 2008 (57[43];1169-1173) als Ergebnis eines umfangreichen Telefonsurveys innerhalb des "Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)" der USA, der über 18-jährige US-BürgerInnen befragt.
Für die Bewertung der Dramatik dieser Entwicklung ist und vor allem beim Versuch zu klären ob es sich hier um einen unvermeidbaren und unbeeinflussbaren Trend handelt, liefert der Survey ebenfalls interessante Daten. Bei dem genannten Trend handelt sich nämlich nicht um einen Einheitstrend, sondern um eine sehr ungleiche Entwicklung. So nehmen die Neuerkrankungen an Diabetes am stärksten im Süden der USA zu, während sie im Mittleren Westen am niedrigsten ist. Nach Bundesstaaten unterschieden liegt die Inzidenzrate 2005-2007 in Westvirginia mit 12,7 Fällen pro 1.000 erwachsenem Einwohner an der Spitze und mit 5,0, also dem Durchschnittswert der gesamten USA von vor 10 Jahren, in Minnesota am niedrigsten.
Diese und weitere Unterschiede berechtigen zu der Annahme, mit geeigneten Mitteln zumindest einen Teil der Zunahme und damit einen Teil der daraus folgenden Leidens- und Behandlungslasten zu vermeiden.
Die Daten des Beitrags "State-Specific Incidence of Diabetes Among Adults - Participating States, 1995-1997 and 2005-2007 im MMWR sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.11.08
BKK Telefon-Umfrage: Rückenschmerzen nehmen zu, viele Betroffene vermuten Ursachen in der Arbeit
 Immer mehr Deutsche leiden unter Rückenschmerzen, aktuell sind zwei Drittel betroffen, zehn Jahre zuvor war es nur etwa jeder Zweite. Vor allem die Zahl derer, die täglich oder mehrmals in der Woche Schmerzen haben, hat deutlich zugenommen: Von 6% (1998) auf 15% (2008). Weniger als ein Drittel (31%) der Befragten hat überhaupt keine Rückenschmerzen. Dies sind Ergebnisse einer Telefonumfrage bei einer repräsentativen Stichprobe von etwa 6.000 Deutschen im Alter von 14 Jahren und älter, die der BKK Bundesverband im April und Mail 2008 durchführen ließ. Weitere Ergebnisse der Untersuchung:
Immer mehr Deutsche leiden unter Rückenschmerzen, aktuell sind zwei Drittel betroffen, zehn Jahre zuvor war es nur etwa jeder Zweite. Vor allem die Zahl derer, die täglich oder mehrmals in der Woche Schmerzen haben, hat deutlich zugenommen: Von 6% (1998) auf 15% (2008). Weniger als ein Drittel (31%) der Befragten hat überhaupt keine Rückenschmerzen. Dies sind Ergebnisse einer Telefonumfrage bei einer repräsentativen Stichprobe von etwa 6.000 Deutschen im Alter von 14 Jahren und älter, die der BKK Bundesverband im April und Mail 2008 durchführen ließ. Weitere Ergebnisse der Untersuchung:
• Immer mehr von Rückenschmerzen Betroffene verzichten auf einen Arztbesuch. 1998 gaben noch 57% an, wegen ihrer Rückenschmerzen einen Arzt aufgesucht zu haben, 2008 sind es nur noch 36%.
• Wer ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, bekommt am häufigsten Medikamente, bevorzugt Schmerzmittel, verschrieben. Diese medikamentöse Therapie hat zugenommen von 47% (1998) auf 64% (2008). Noch deutlicher zugenommen haben allerdings ärztliche Empfehlungen zur Krankengymnastik (von 22% 1998 auf 61% 2008).
• Bei 81% der Rückenschmerzpatienten, denen die jeweils verordneten therapeutischen Maßnahmen geholfen haben, kamen die Schmerzen wieder. Bereits eine Woche nach der Behandlung kommen die Schmerzen bei einem Fünftel der Patienten nach der Behandlung zurück. Ein Zehntel war zwischen einer Woche und 14 Tagen ohne Beschwerden, ein weiteres Zehntel zwischen zwei und vier Wochen. Immerhin fast die Hälfte der Rückenschmerz-Patienten war länger als vier Wochen schmerzfrei. 17% derjenigen, die vom Arzt eine Verordnung bekamen, waren vollständig von ihren Beschwerden befreit.
• Knapp ein Drittel der Betroffenen (29%) führt die Rückenschmerzen auf Belastungen im Beruf zurück, 15% machen schweres Heben und Tragen verantwortlich. Jeweils 9% halten eine falsche Körperhaltung und zu vieles Sitzen für die Ursachen ihrer Rückenbeschwerden, 8% machen körperlichen Verschleiß, 6% Überlastung verantwortlich.
• Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse (PDF, 4 Seiten): BKK Faktenspiegel, November 2008, Schwerpunktthema Rückengesundheit
• Ausführliche Ergebnisse als Tabellen und Diagramme (PDF, 26 Seiten): Bevölkerungsumfrage BKK 2008, Thema: Rückenschmerzen
• Hier sind zum Download weitere Materialien
Gerd Marstedt, 23.11.08
Übergewicht ist nicht allein individuell verschuldet, sondern auch Effekt ungesunder Lebensräume
 Seit einiger Zeit taucht das Thema Übergewicht und Adipositas gehäuft in den Schlagzeilen auf, meist aufgrund neuester Zahlen zur Verbreitung von Fettleibigkeit oder alarmierender Hochrechnungen über damit einhergehende Erkrankungen und medizinische Kosten. Die bislang wohl umfassendste Expertise zu diesem Thema ist nun in Großbritannien veröffentlicht worden, eine von 250 Wissenschaftlern erarbeitete und vom gemeinnützigen "Foresight Institut" finanzierte Expertise "Tackling Obesities" ("Übergewicht stoppen"). In ihrem 164seitigen Bericht fassen die Wissenschaftler den aktuellen Forschungsstand zur Verbreitung von Übergewicht zusammen und schlagen erfolgversprechende Interventionen vor.
Seit einiger Zeit taucht das Thema Übergewicht und Adipositas gehäuft in den Schlagzeilen auf, meist aufgrund neuester Zahlen zur Verbreitung von Fettleibigkeit oder alarmierender Hochrechnungen über damit einhergehende Erkrankungen und medizinische Kosten. Die bislang wohl umfassendste Expertise zu diesem Thema ist nun in Großbritannien veröffentlicht worden, eine von 250 Wissenschaftlern erarbeitete und vom gemeinnützigen "Foresight Institut" finanzierte Expertise "Tackling Obesities" ("Übergewicht stoppen"). In ihrem 164seitigen Bericht fassen die Wissenschaftler den aktuellen Forschungsstand zur Verbreitung von Übergewicht zusammen und schlagen erfolgversprechende Interventionen vor.
Das Besondere der Expertise ist jedoch: Während viele frühere Studien nicht müde wurden, den ungesunden individuellen Lebensstil (zu wenig Bewegung, falsche Ernährung usw.) als maßgebliche Ursache der neuen Volkskrankheit zu brandmarken, werden im Foresight-Report erstmals auch in dieser ausführlichen und expliziten Form die gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe als Verursachungs-Bedingungen genannt. Der ungesunde moderne Lebensstil wird auch in der Studie detailliert beschrieben, er erscheint dort jedoch nicht als individuell verschuldete Verhaltensorientierung, sondern resultiert (fast zwangsläufig) aus "übergewichtsträchtigen" Lebensräumen ("obesogenic environments"), die durch politische Entscheidungen in der Verkehrs-, Wohnungs- oder Umweltpolitik so gestaltet wurden
So werden in dem Bericht explizit folgende Rahmenbedingungen genannt, die für ein mangelhaftes "Energiegleichgewicht" (Kalorienaufnahme und -verbrauch) bei Bürgerinnen und Bürgern maßgeblich sind:
• mangelnde Bewegung am Arbeitsplatz und zu Hause
• Freizeitaktivitäten, die zunehmend zu Hause und im Sitzen ausgeübt werden
• eingeschränkte Bedeutung des Sportunterrichts an Schulen
• Hilfsmittel (Fahrstühle, Rolltreppen, automatische Türen usw.) an Öffentlichen Plätzen, Gebäuden oder Einkaufszentren, die den natürlichen Bewegungsimpuls still legen
• schlecht gestaltete und notdürftig instand gehaltene Außeneinrichtungen (Parks, Sport- und Spielplätze usw.), die kaum zu einem Besuch und einer Nutzung einladen
• ein öffentliches Bewusstsein, das den Aufenthalt im Freien zunehmend als risikoträchtig definiert
• gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen und Normen, die Kinder zunehmend davon abhalten, sich im Freien zu bewegen (Unfallrisiken im Verkehr, Übergriffe durch fremde Personen, Verletzungsgefahren)
• Städtische Bauplanungen, die dem motorisierten Verkehr Priorität geben und die Bewegungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer einengen
• allenthalben verfügbare Einkaufs- und Verzehrmöglichkeiten für Fast Food und Convenience Food, im Vergleich dazu sehr viel ungünstigere Angebote für gesunde Nahrungsmittel mit der Folge von "Nahrungsmittel-Wüsten".
Der Foresight-Report zeigt anhand veröffentlichter Studien auf, welche Bedeutung diese Faktoren für den ungesunden Lebensstil des Durchschnittsbürgers haben. Und er spricht sehr drastische Warnungen aus: Falls nicht sofort umfassende und einschneidende Maßnahmen in allen Politikbereichen in die Wege geleitet werden, wird sich Großbritannien im Jahr 2050 einer dramatischen Epidemie ausgeliefert sehen. 60% der Männer, 50% der Frauen und 26% der Kinder und Jugendlichen werden übergewichtig sein, die Verbreitung von Diabetes wird um 70% zunehmen, Schlaganfälle um 30%, Herzerkrankungen um 20%.
Diskutiert werden im Berichtsteil "Qualitative Modelling of Policy Options" auch erfolgversprechende Maßnahmen, um diesem Horror-Szenario zu entgehen. Darunter finden sich steuerpolitische Instrumente (erhöhte Steuern für bestimmte Nahrungsmittel), städtebauliche Überlegungen, aber auch pädagogische und bildungspolitische Ansätze sowie notwendige Forschungsaktivitäten.
Der Gesamtbericht (164 Seiten, 15 MB), eine Zusammenfassung der Ergebnisse und auch einzelne Berichtsteile sind von dieser Seite aus herunterzuladen: Foresight - Tackling Obesities: Future Choices
Gerd Marstedt, 5.11.2007
Krebs ist durch emotionale Stärke nicht besiegbar, sagt eine Studie. Doch Wissenschaftler kritisieren dieses Fazit
 Bei der Diagnose einer Krebserkrankung herrscht unter Ärzten wie Patienten weitgehend die Meinung, dass der Ausgang der Erkrankung und der Erfolg einer Therapie auch mitbeeinflusst werden durch die Willensstärke oder den Überlebenswillen eines Patienten. Dass diese Ansicht nicht mit wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen im Einklang steht, behaupten jetzt Autoren einer Studie, die in der Zeitschrift "Cancer" veröffentlicht wurde. Zwar könne emotionale Stärke, angestoßen beispielsweise durch die Inanspruchnahme psychotherapeutischer Hilfe oder Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, ein positiveres Lebensgefühl und eine bessere Lebensqualität während der Erkrankung vermitteln, nicht aber die Lebenserwartung verlängern.
Bei der Diagnose einer Krebserkrankung herrscht unter Ärzten wie Patienten weitgehend die Meinung, dass der Ausgang der Erkrankung und der Erfolg einer Therapie auch mitbeeinflusst werden durch die Willensstärke oder den Überlebenswillen eines Patienten. Dass diese Ansicht nicht mit wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen im Einklang steht, behaupten jetzt Autoren einer Studie, die in der Zeitschrift "Cancer" veröffentlicht wurde. Zwar könne emotionale Stärke, angestoßen beispielsweise durch die Inanspruchnahme psychotherapeutischer Hilfe oder Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, ein positiveres Lebensgefühl und eine bessere Lebensqualität während der Erkrankung vermitteln, nicht aber die Lebenserwartung verlängern.
Die Wissenschaftler hatten im Rahmen einer 5-Jahres-Studie Daten von Patienten näher analysiert, die an Hautkrebs im Kopf- und Hals-Bereich erkrankt waren und an zwei unterschiedlichen Therapie-Studien teilnahmen. Zu Beginn der Verlaufsstudie wurden so Daten von knapp 1.100 Patienten erfasst, im Zeitverlauf verstarben dann bis zum Ende der Studie insgesamt 646 Teilnehmer. Die Teilnehmer hatten auch einen Fragebogen ("The Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) Scale") ausgefüllt, in dem 53 Fragen gestellt wurden: Zur empfundenen Lebensqualität, zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden, zu Behinderungen und Funktionseinschränkungen durch die Krankheit. 5 Einzelfragen daraus wurden von den Wissenschaftlern verwendet, um die emotionale Stärke der Patienten gegenüber der Krebserkrankung näher zu beschreiben, dort wurden Fragen gestellt, die auf einer Skala von 1-4 (trifft überhaupt nicht zu bis trifft voll und ganz zu) zu beantworten waren: Ich fühle mich traurig. Ich verliere nicht die Hoffnung beim Kampf gegen meine Krankheit. Ich fühle mich nervös. Der Gedanke ans Sterben beunruhigt mich. Ich mache mir Sorgen, dass mein Zustand sich verschlimmert. Die Antworten hierauf wurden dann zugesammengefasst zu einem Gesamtwert "emotionales Wohlbefinden".
Bei einer einfachen ersten Analyse zeigte sich dann, dass die Sterberate nach dem 5jährigen Untersuchungszeitraum keine Unterschiede zeigte für Patienten mit einem niedrigem oder hohem Wert auf dieser Skala. Dies bestätigte sich auch, wenn die Wissenschaftler nur Teilgruppen betrachteten, etwa differenziert nach Geschlecht oder Besonderheiten des Krebsstadiums. Bei einer multivariaten Analyse, also der gleichzeitigen Berücksichtigung sehr vieler unterschiedlicher Einflussgrößen, zeigte sich dann andererseits, dass andere Faktoren einen recht deutlichen Effekt für die Sterberate hatten. Dies traf etwa zu für das Lebensalter, die Einstufung der Bösartigkeit der gefundenen Tumorzellen (T1-T4), die Bewertung des Lymphknotenbefalls oder auch das Rauchen, für die sich höhere Sterbequoten in der Größenordnung von 1,3 bis 1,9 ergaben.
In der Bilanz ihrer Ergebnisse erheben die Wissenschaftler Kritik an früheren Studien, die mit sehr kleinen Gruppen und Patienten mit unterschiedlichen Krebsarten gearbeitet hatten und das gegenteilige Ergebnis herausgefunden hatten. Ihre Studie, die sich auf eine Krensart beschränkt und über 600 Todesfälle analysiert habe, sei damit sehr viel aussagekräftiger. Allerdings machen sie auch eine Einschränkung, nämlich dass ihr Befund möglicherweise für andere Tumorerkrankungen nicht so gelten können, etwa bei Brust- oder Prostatakrebs, wo endokrine (mit den Drüsen zusammenhangende) Vorgänge eine größere Rolle spielen.
In den meisten Medienberichten wurden die Ergebnisse der Studie aus der vom Forschungsteam verbreiteten Pressemitteilung kommentar- und kritiklos übernommen und in griffige Schlagzeilen überführt wie "Willenstärke kann den Krebs nicht besiegen" oder "Emotionale Stärke hat bei Krebs keine Chance". Aber es gab auch einige kritische Stimmen, die etwa in einem Artikel in der "Washington Post" zu Worte kamen: Madeline Vann: Emotional State Doesn't Affect Cancer Survival. Dort wurde von Wissenschaftlern etwa bemängelt, dass die emotionale Grundhaltung der Patienten gegenüber ihrer Erkrankung mit einem äußerst dürftigen Instrument (lediglich 5 Fragen) erfasst wurde, dass dies auch nur zu einem einzigen Zeitpunkt geschah, obwohl gerade die Stimmung von Krebserkrankten massiv schwankt, und ebenso, dass eher Befindlichkeiten, also Ängste und Stimmungen, erfasst werden als die grundsätzliche Haltung des Patienten, sein Überlebenswillen und die Bereitschaft anzukämpfen. Problematisiert wird dort auch die Stichprobenziehung, die aufgrund der besonderen Krebserkrankung nur geringe Differenzen in der Lebenserwartung aufweist.
Die an der Studie beteiligten Forscher betonen zwar in ihrer Pressemitteilung "Penn Researchers Find Emotional Well-being Has No Influence on Cancer Survival", es könne für Krebs-Patienten einige emotionale und soziale Vorteile bringen, psychotherapeutische Hilfe oder Unterstützung in Selbsthilfegruppen in Anspruch zu nehmen. Man solle sich aber nicht der Illusion hingeben, dies würde die Lebenserwartung verlängern. In der Verallgemeinerung ihrer Studienergebnisse ist diese Aussage allerdings auch als Vorherrschaftsanspruch naturwissenschaftlich orientierterer Onkologen zu bewerten, die in Anbetracht neuerer Befunde zur Placebo-Forschung mit einigen Fragezeichen zu versehen ist.
Problematisch erscheint in der Tat, dass eine Studie, die sich zentral mit der Frage nach dem Einfluss psychischer Faktoren auf eine Erkrankung beschäftigt, eben diese Einflussdimension dermaßen dürftig erfasst: Mit lediglich 5 Fragen, erhoben zu nur einem Zeitpunkt. Warum, so fragt man sich, wurden nicht zeitliche Veränderungen erhoben, warum blieb völlig außen vor, ob psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen wurde, ob psychosoziale Unterstützung aus dem familiären Umfeld oder aus Selbsthilfegruppen kam?
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier zu finden: James C. Coyne u.a.: Emotional well-being does not predict survival in head and neck cancer patients. A radiation therapy oncology group study (Cancer, Published Online: 22 Oct 2007, doi: 10.1002/cncr.23080)
Eine Kieler Langzeitstudie hatte unlängst den Effekt einer "psycho-onkologischen" Unterstützung aufgezeigt. 271 Patienten, bei denen man Anfang der 90er Jahre Tumore in Magen, Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse oder Darm diagnostizierte, wurden (nach dem Zufallsprinzip) entweder einer Kontrollgruppe mit Standard-Betreuung zugeordnet oder einer Interventionsgruppe, die auch eine umfassende psychotherapeutische Unterstützung erhielt. Zehn Jahre später zeigte sich dann, dass aus der Interventionsgruppe doppelt so viele Patienten überlebt hatten. Abstract der Studie: Thomas Küchler u.a.: Impact of Psychotherapeutic Support for Patients With Gastrointestinal Cancer Undergoing Surgery: 10-Year Survival Results of a Randomized Trial (Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 19 (July 1), 2007: pp. 2702-2708) Eine andere Studie bei 122 Brustkrebs-Patienten hatte andererseits herausgefunden, dass eine zusätzliche, wöchentlich für anderthalb Stunden durchgeführte Gruppentherapie nur bei einer Teilgruppe zu einer längeren Lebenserwartung führt: David Spiegel u.a.: Effects of supportive-expressive group therapy on survival of patients with metastatic breast cancer (Cancer. 2007 Sep 1;110(5):1130-8).
Unter dem Strich bleibt daher in jedem Fall festzuhalten, dass das generalisierte Fazit "Emotionale Stärke und Psychotherapie haben bei Krebserkrankungen keinerlei Einfluss auf das Überleben" so nicht zu halten ist und es weiterer Forschung bedarf, um die speziellen Voraussetzungen (Krebsart, Besonderheiten der Patienten wie auch der Therapie) der hier wirksamen und unwirksamen Einflüsse näher zu bestimmen.
Gerd Marstedt, 24.10.2007
Erste bevölkerungsbezogene Berechnungen des Risikos sich im Gesundheitsbetrieb u.a. mit Lungenentzündungserregern anzustecken
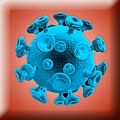 In der weltweiten Debatte über die Risiken der im Krankenhaus oder anderen medizinischen Versorgungseinrichtungen erworbenen Infektionen, den so genannten nosokomialen Infektionen, spielen Ansteckungen mit Pneumokokken, die u. a. Lungenentzündungen oder Gehirnhautentzündungen auslösen, eine gewichtige Rolle.
In der weltweiten Debatte über die Risiken der im Krankenhaus oder anderen medizinischen Versorgungseinrichtungen erworbenen Infektionen, den so genannten nosokomialen Infektionen, spielen Ansteckungen mit Pneumokokken, die u. a. Lungenentzündungen oder Gehirnhautentzündungen auslösen, eine gewichtige Rolle.
Die Kenntnis über den tatsächlichen Umfang des Risikos beschränkte sich bisher auf Studien über einzelne Krankenhäuser. Das bevölkerungsbezogene Risiko und damit ein wichtiger Indikator für Präventionsbemühungen war bisher unbekannt. Dies betrifft auch bevölkerungsbezogene Kenntnisse über die Chsrakteristika der Infektion, die Risikofaktoren und die End-Risiken für die Infizierten. Auch das Verhältnis von nosokomialen und außerhalb von Krankenhäusern, d.h. in der Öffentlichkeit erworbenen Pneumokokken-Infektionen war ebenfalls unklar.
Die meisten dieser "weißen Flecken" beseitigte jetzt eine von finnischen Wissenschaftlern durchgeführte Analyse aller zwischen 1995 und 2002 in Finnland mit Laborparametern im Blut oder in einer Gehirnwasserkultur nachgewiesenen Infektionen. Diese Daten wurden mit weiteren Gesundheits-Registerdaten über die PatientInnen verknüpft und die Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2007; 167 (15): 1635-1640) veröffentlicht.
Eine Infektion wurde als nosokomial bewertet, wenn ihr erster positiver Nachweis im Blut nach mehr als 2 Tagen Aufenthaltsdauer im Krankenhaus erfolgte oder die Erkrankten in den 7 Tagen vor dem ersten Infektionsnachweis mehr als 2 Tage in einem Krankenhaus behandelt wurden.
Bei 9,7 % oder 387 Infektionen bzw. Infizierten von insgesamt 3.973 wegen einer Pneumokokkeninfektion stationär behandelten Personen handelte es sich um eine im Krankenhaus (n=266) oder im sonstigen Gesundheitsversorgungsbereich (n=121) erworbene Infektion. Der Rest hatte sich anderweitig angesteckt.
Zu den Charaktistika der Patienten mit einer nosokomialen Pneumokokkeninfektion und den weiteren Erkenntnissen der Studie gehören:
• statistisch signifikant höheres Alter (67 Jahre zu 52 Jahre),
• signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, an mindestens einer zusätzlichen Hochrisiko-Erkrankung erkrankt zu sein (59,2 % zu 34,6 %).
• durchschnittliche jährliche Inzidenzrate für nosokomiale Pneumokokkeninfektionen betrug 0,9 Fälle pro 100.000 Einwohner, die der nicht-nosokomialen Erkrankungen 9,9 Fälle per 100.000 Einwohner.
• Während der 90 Tage nach dem ersten positiven Nachweis einer nosokomialen Pneumokokkeninfektion starben 121 oder 31,3 % der Infizierten. Davon waren 72,7 % älter als 65 Jahre. Das Risiko für Männer war 1,5 mal höher als für Frauen.
• Mehr als 70 % der bei den nosokomial Infizierten entdeckten Antikörper hätten über eine Impfung entwickelt werden können, die bei einer Reihe der bereits erwähnten Ko-Erkrankungen dieser Personengruppe empfohlen wird.
• Einer der Vorschläge aus der Studie lautet daher auch, gezielte Impfungen für chronisch Kranke zu intensivieren.
International lagen die in der gesamten finnischen Bevölkerung entdeckten Risiken nosokomialer Infektionen unterhalb des langjährigen Wertes von 25 bis 41 % in Spanien, den 27 bis 59 % in den USA, aber in etwa gleichauf mit den 10 % in Frankreich und den ganz aktuellen 10 bis 14 % in Spanien. Die nichtfinnischen Werte stammen nicht aus bevölkerungsbezogenen Studien.
Ein kostenfreies Abstract des Aufsatzes "Defining the Population-Based Burden of Nosocomial Pneumococcal Bacteremia" von Lyytikainen et al. ist hier erhältlich.
Bernard Braun, 24.9.2007
Vitamin C gegen Erkältungen: Cochrane-Studie erkennt einen Nutzen nur bei Extrembelastungen
 Wenn Sie kein Marathonläufer oder Soldat in der Antarktis sind, hilft Ihnen Vitamin C zur Vorbeugung oder auch Therapie von Erkältungen so gut wie gar nicht. Bei Personen, die unter extremen körperlichen Belastungen stehen, ist das altbekannte Hausmittel allerdings durchaus hilfreich zur Vorbeugung. Dies ist die Kernbotschaft einer jetzt in der "Cochrane Library" veröffentlichten Meta-Analyse schon veröffentlichter Studien, in denen die Einnahme von Vitamin C zur Prävention oder auch Therapie von Erkältungen untersucht wurde. Berücksichtigt wurden dabei nur Untersuchungen, in denen auch eine Kontrollgruppe einbezogen war, der man ein Placebo-Medikament gab. Einbezogen wurden weiterhin nur Studien, bei denen zumindest 200 Milligramm Vitamin C pro Tag eingenommen wurden - dies entspricht etwa dem Gehalt von 0,25 Litern Orangensaft.
Wenn Sie kein Marathonläufer oder Soldat in der Antarktis sind, hilft Ihnen Vitamin C zur Vorbeugung oder auch Therapie von Erkältungen so gut wie gar nicht. Bei Personen, die unter extremen körperlichen Belastungen stehen, ist das altbekannte Hausmittel allerdings durchaus hilfreich zur Vorbeugung. Dies ist die Kernbotschaft einer jetzt in der "Cochrane Library" veröffentlichten Meta-Analyse schon veröffentlichter Studien, in denen die Einnahme von Vitamin C zur Prävention oder auch Therapie von Erkältungen untersucht wurde. Berücksichtigt wurden dabei nur Untersuchungen, in denen auch eine Kontrollgruppe einbezogen war, der man ein Placebo-Medikament gab. Einbezogen wurden weiterhin nur Studien, bei denen zumindest 200 Milligramm Vitamin C pro Tag eingenommen wurden - dies entspricht etwa dem Gehalt von 0,25 Litern Orangensaft.
Über die Bedeutung von Vitamin C (Ascorbinsäure) zur Vorbeugung gegen Husten und Schnupfen oder auch zur Bekämpfung der Symptome wird seit etwa 60 Jahren unter Medizinern gestritten, spätestens seit der Nobelpreisträger Linus Pauling in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts den Wirkstoff chemisch isolieren konnte. Als Hausmittel wurden Vitamin-C-Sprudeltabletten oder heißer Zitronensaft dann in den 70er Jahren besonders populär. Die ersten Studien von Pauling zeigten auch deutliche Erfolge der Ascorbinsäure im Kampf gegen die weit verbreitete Erkältungskrankheit - auch im Vergleich mit Placebos.
Wissenschaftler der Australian National University und der University of Helsinki wollten nun wissen, ob wirklich etwas dran ist an der Popularität des Hausmittels. In ihre Meta-Analyse bezogen sie insgesamt 30 veröffentlichte Studien mit insgesamt über 11.000 Teilnehmern ein. Als Ergebnis zeigte sich im Einzelnen:
• Als Mittel zur Verhütung einer Erkältung zeigte sich im Vergleich zu Gruppen mit Placebo-Einnahme unter dem Strich kein Effekt durch die Einnahme von Vitamin C.
• Bei einigen Studien jedoch, in denen Personen mit sehr schweren körperlichen Belastungen einbezogen waren (Marathonläufer, Soldaten in der Antarktis, Skiläufer), zeigte sich andererseits, dass hier das Risiko einer Erkrankung um die Hälfte reduziert war.
• Studien, in denen überprüft worden war, ob die Dauer der Erkältungskrankheit durch eine Einnahme von Ascorbinsäure vor Eintritt der ersten Symptome reduziert werden kann, zeigten eine eher schwache, aber doch statistisch signifikante Wirkung. Dort sank die Zeitdauer bei Erwachsenen um 8%, bei Kindern um 14%.
• Wird Vitamin C hingegen eingenommen, nachdem die ersten Krankheitssymptome schon bemerkbar sind, so hat dies keinen Effekt mehr auf das Auftreten oder die Dauer der Erkältung.
• Ob eine besonders hohe Dosierung der Vitamin-C-Einnahme möglicherweise bessere Wirkung zeigt, ließ sich mit den verfügbaren Studien nicht abschließend beurteilen. Die Befunde der dazu veröffentlichten Studien waren überaus widersprüchlich und überdies war ihre methodische Qualität durchweg eher schwach.
• Ein kostenloses Abstract der Meta-Analyse ist hier nachzulesen: Vitamin C for preventing and treating the common cold
• Der komplette Cochrane-Bericht ist kostenpflichtig bzw. setzt ein Abonnement voraus: Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000980. DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub3
Gerd Marstedt, 23.7.2007
Krebspatienten haben in den USA teilweise längere Überlebensraten als in Deutschland
 In einer jetzt veröffentlichten Studie mit neueren Daten zum Langzeitüberleben bei 23 verschiedenen Krebserkrankungen hat sich gezeigt: Bei einigen häufigen Krebsarten überleben US-Patienten länger als deutsche. Besonders deutliche Differenzen, wie sie für das Überleben nach Brustkrebs gefunden wurden, sind vermutlich auf Unterschiede in der Beteiligung an Früherkennungsmaßnahmen zurückzuführen. Ein neuartiges Berechnungsverfahren ermöglichte zum ersten Mal einen aktuellen, direkten Vergleich der Langzeit-Überlebensraten von Krebspatienten in Deutschland und in den USA. Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum stellten für 23 verschiedene Krebserkrankungen die 5- und 10-Jahres-Überlebensraten beider Länder einander gegenüber.
In einer jetzt veröffentlichten Studie mit neueren Daten zum Langzeitüberleben bei 23 verschiedenen Krebserkrankungen hat sich gezeigt: Bei einigen häufigen Krebsarten überleben US-Patienten länger als deutsche. Besonders deutliche Differenzen, wie sie für das Überleben nach Brustkrebs gefunden wurden, sind vermutlich auf Unterschiede in der Beteiligung an Früherkennungsmaßnahmen zurückzuführen. Ein neuartiges Berechnungsverfahren ermöglichte zum ersten Mal einen aktuellen, direkten Vergleich der Langzeit-Überlebensraten von Krebspatienten in Deutschland und in den USA. Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum stellten für 23 verschiedene Krebserkrankungen die 5- und 10-Jahres-Überlebensraten beider Länder einander gegenüber.
Für mehrere Krebsarten unterscheiden sich die Prognosen in beiden Ländern deutlich: Beim Magenkrebs fällt die 5-Jahres-Überlebensrate in Deutschland günstiger aus, ebenso die 10-Jahres-Überlebensraten bei Magen- und Lungenkrebs. Deutlich und statistisch signifikant höhere 5- und 10-Jahres-Überlebensraten hatten dagegen amerikanische Patienten mit Prostata, Brust, Gebärmutterhals- und Mundhöhlenkrebs. Darmkrebspatienten in den USA überleben geringfügig länger als in Deutschland. Weiterhin hat die Studie gezeigt:
• Amerikanische Brustkrebspatientinnen haben durchgehend und unabhängig vom Erkrankungsalter eine bessere Prognose als deutsche. Während bei jüngeren Patientinnen die Ergebnisse beider Länder noch annähernd identisch sind, nimmt die 5-Jahres-Überlebensrate in Deutschland mit höherem Erkrankungsalter ab und erreicht zwischen der jüngsten und der ältesten Patientengruppe (unter 54 sowie über 75 Jahren) eine Differenz von zwölf Prozent.
• US-Amerikaner überleben die ersten fünf Jahre nach der Diagnose Prostatakrebs zu annähernd hundert Prozent. Bei Deutschen liegt die 5-Jahres-Überlebensrate deutlich niedriger. Vor allem bei den jüngsten und den ältesten Patienten (unter 54 sowie über 75 Jahren) beträgt die Differenz zwischen beiden Ländern rund 18 Prozent.
• Bei 14 Krebsarten jedoch sind die Überlebensraten in Deutschland und den USA identisch. Dazu zählen insbesondere solche Erkrankungen, für die effiziente Therapien zur Verfügung stehen wie bestimmte Leukämien, Hoden- und Schilddrüsenkrebs.
Wo es die Datenlage ermöglichte, verglichen die Epidemiologen die Stadienverteilung bei Diagnosestellung. Während bösartige Tumoren der Lunge und des Darms in beiden Ländern in vergleichbar fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert werden, wird Brustkrebs in den USA deutlich früher entdeckt: In den USA werden 63 Prozent der Tumoren in einem lokal begrenzten Stadium diagnostiziert, in Deutschland nur rund 50 Prozent. Die Forscher interpretieren daher die Überlebens-Differenzen nach Brustkrebs als Resultat einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Krebsfrüherkennung und nicht als Folge von Behandlungsunterschieden: In den USA gaben 80 Prozent der Frauen über 40 Jahre an, innerhalb der letzten zwei Jahre an einer Früherkennungs-Mammographie teilgenommen zu haben - in Deutschland dagegen wurden Mammographie-Screeningprogramme erst ab 2004 schrittweise eingeführt.
Die Überlebensraten von Krebspatienten konnten mit traditionellen Analysemethoden häufig erst erheblich zeitverzögert erhoben werden. Die Wissenschaftler entwickelten mit der so genannten Periodenanalyse ein Verfahren, das auf wesentlich aktuelleren Daten beruht und dadurch auch jüngste Veränderungen erfasst, die aus neuen Diagnose- und Therapieverfahren resultieren. Die Arbeit basiert auf Daten des Saarländischen Krebsregisters und des amerikanischen "SEER"-Programms, das Krebsneuerkrankungen in neun verschiedenen Regionen der USA erfasst.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Studienergebnisse tatsächlich belegen, dass auch die Sterblichkeit bei Krebserkrankungen durch die in den USA teilweise frühere Diagnose beeinflusst wird. Erst kürzlich hatte eine Studie zum Lungenkrebs deutlich gemacht, dass ein frühzeitigeres Screening zwar die Überlebenszeit verlängert (weil die Diagnose früher gestellt wird und sich dadurch der Zeitraum zwischen Diagnose und Tod automatisch erhöht), dass dies aber keinen Einfluss auf die Sterblichkeit hat. vgl. Artikel in dieser Rubrik: "Lungenkrebs-Screening verlängert die Überlebenszeit - aber nicht die Sterblichkeit"
Ein Abstract der Sdtudie ist hier zu finden: Cancer survival in Germany and the United States at the beginning of the 21st century: An up-to-date comparison by period analysis (International Journal of Cancer, Published Online: 19 Mar 2007, DOI: 10.1002/ijc.22683)
Eine Pressemitteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums ist hier: Überleben nach Krebs: US-Patienten haben bei häufigen Krebsarten noch immer günstigere Prognose
Gerd Marstedt, 21.3.2007
Lungenkrebs-Screening verlängert die Überlebenszeit - aber nicht die Sterblichkeit
 In einer großen New Yorker Studie wurden in den Jahren von 1993 bis 2005 knapp 32.000 Personen mit einer sog. Mehrschicht-Spiral- Computer-Tomographie, einem Röntgen-Verfahren zur Krankheits-Diagnose, untersucht. Es handelte sich durchweg um Personen ohne Symptome einer Erkrankung oder gar Lungenerkrankung. Die Untersuchungen wurden bei jedem Teilnehmer mehrfach wiederholt, meist im Abstand von einem halben bis anderthalb Jahren. Insgesamt wurde bei 484 Personen Lungenkrebs diagnostiziert. Die 10-Jahres-Überlebensrate in dieser Gruppe wurde von den Autoren mit 88% angegeben.
In einer großen New Yorker Studie wurden in den Jahren von 1993 bis 2005 knapp 32.000 Personen mit einer sog. Mehrschicht-Spiral- Computer-Tomographie, einem Röntgen-Verfahren zur Krankheits-Diagnose, untersucht. Es handelte sich durchweg um Personen ohne Symptome einer Erkrankung oder gar Lungenerkrankung. Die Untersuchungen wurden bei jedem Teilnehmer mehrfach wiederholt, meist im Abstand von einem halben bis anderthalb Jahren. Insgesamt wurde bei 484 Personen Lungenkrebs diagnostiziert. Die 10-Jahres-Überlebensrate in dieser Gruppe wurde von den Autoren mit 88% angegeben.
In einer Untergruppe von 302 Personen, die sich unmittelbar nach der Diagnose einer Operation unterzogen hatte, lag sie mit 92% sogar noch ein wenig höher. Vergleicht man die aktuelle 10-Jahres-Überlebensrate für Lungenkrebs in den USA, die nur etwa 10% beträgt, mit den Daten der Screening-Studie, dann leuchtet das Fazit der Wissenschaftler sofort ein: "Ein jährliches Screening auf Lungenkrebs mit einer Spiral-Computer-Tomographie kann Lungenkrebs-Erkrankungen finden, die heilbar sind." Ein Abstract der im Oktober 2006 im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie ist hier: Survival of Patients with Stage I Lung Cancer Detected on CT Screening.
Die Ergebnisse der Studie schienen anzudeuten, dass ein möglichst frühzeitiges (also in jüngeren Lebensjahren) eingesetztes Screening auf Lungenkrebs, durchgeführt mit der im Vergleich zum traditionellen Röntgen sehr viel sensibleren Computertomografie ein lohnenswertes Unterfangen wäre. Krebs wird frühzeitig entdeckt und die Patienten haben daher eine sehr hohe Überlebensrate. Nur kurze Zeit später allerdings verdeutlichte eine zweite Studie, veröffentlicht im März 2007 im "Journal of the American Medical Association", dass die Bilanz der New Yorker Studie etwas zu rosig ausgefallen war.
In dieser Studie waren etwa 3.200 Patienten, alles Personen, die knapp 40 Jahre oder mehr geraucht hatten, in mehreren medizinischen Versorgungszentren der USA seit 1998 über einen mittleren Zeitraum von vier Jahren beobachtet worden. Es wurden mehrere CT-Untersuchungen vorgenommen, zu Beginn der Studie und später in jährlichen Abständen mindestens noch dreimal. Die Quoten der Patienten, bei denen ein Lungenkrebs gefunden wurde, verglich man mit Daten, die in früheren sehr großen Studien gewonnen worden waren, Daten, die das "normale" Risiko eines solchen Tumors beziffern. Es zeigte sich, dass die entdeckten Lungenkrebs-Raten dreimal so hoch waren wie zu erwarten (144 entdeckte, 45 erwartete Fälle). Betrachtete man jedoch die Zahl der Todesfälle, so wurde deutlich: 38 Fälle wurden beobachtet, erwartet wurden annähernd genau so viele, nämlich 39. Fazit der Wissenschaftler zu dieser Studie war: Die Sterberate aufgrund von Lungenkrebs kann durch frühzeitige und systematische Untersuchungen mit CT nicht verändert werden. Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Computed Tomography Screening and Lung Cancer Outcomes (JAMA. 2007;297:953-961)
Die Studie weist auf eine problematische Folgen eines umfassenden Screening hin: Moderne CT-Verfahren kommen sehr viel häufiger auch zu Krebs-Diagnosen, die - hätte man sie nicht gefunden - nicht lebensgefährlich sind oder erst in einem extrem späten Stadium kritisch werden. Aufgrund der Diagnose werden jedoch weitere, zum Teil überaus gesundheitsriskante diagnostische Verfahren eingesetzt oder auch riskante Therapien (wie Lungenresektion) durchgeführt, die ohne entsprechendes Screening unterblieben wären. So hat die in JAMA veröffentlichte Studie gezeigt: Wenn 1.000 Personen über einen Zeitraum von 5 Jahren untersucht werden, würde man 48 zusätzliche Fälle von Lungenkrebs finden und es würden zusätzlich 46 Operationen durchgeführt, ohne dass ein einziger Todesfall durch Lungenkrebs vermieden wird.
Deutlich wird aus dem Vergleich beider Studien aber auch, dass die in Zeitungen und Zeitschriften oft kritiklos übernommenen Schlagzeilen medizinischer Studien Fallstricke enthalten. Wenn von einer "Verlängerung der Lebenserwartung" oder "längerer Überlebenszeit" berichtet wird, muss dies nicht unbedingt eine segensreiche Botschaft sein. Es kann schlicht daraus resultieren, dass eine Diagnose etwa aufgrund einer Reihenuntersuchung früher als bei anderen gestellt wird. Das bedeutet aber nicht automatisch auch: Die Betroffenen erreichen ein höheres Alter.
In einem Aufsatz in der New York Times "How Two Studies on Cancer Screening Led to Two Results" setzen sich mehrere Autoren hiermit auseinander und verdeutlichen die scheinbare Paradoxie an einem Beispiel: "Man stelle sich zwei Personen vor, die beide Lungenkrebs haben. Auch wenn beide im Alter von 70 Jahren sterben - der Patient, bei dem mit 59 Jahren durch CT Screening die Krankheit diagnostiziert wurde, hat eine längere Überlebenszeit als der andere Patient, bei dem im Alter von 67 Jahren der Krebs gefunden wurde, weil er wegen ganz anderer Beschwerden beim Arzt war. Der erste Patient überlebt 11 Jahre, der zweite nur 3 Jahre. Aber beide sterben im selben Alter von 70. Die Überlebenszeit ist ersten Fall ist höher, aber die Mortalität ist genau so groß."
Gerd Marstedt, 15.3.2007
Gesundheitsbericht des RKI zu Prostata-Erkrankungen: Eine vertane Chance
 Mit dem Heft 36 "Prostataerkrankungen" ist vom Robert-Koch-Institut als Herausgeber eine weitere Publikation im Rahmen der "Gesundheitsberichtserstattung des Bundes" erschienen. Die Qualität eines Produktes darf und muss sich am eigenen Anspruch messen lassen. Um es vorneweg zu sagen: Das Heft 36 "Prostataerkrankungen" erfüllt den erhobenen Anspruch nur zum Teil und in vielen Fragen überhaupt nicht. Prinzipiell unterscheidet es sich nicht grundsätzlich von den vielen anderen Druckerzeugnissen zum Thema z.B. von diversen Pharmaunternehmen aus dem Hormontherapiebereich, aus dem urologisch-ärztlichen Bereich oder von anderen Interessenverbänden. Da hätte man sich an manchen Stellen schon mehr an kritischer Beurteilung einer in diesem Bereich leider sehr schwachen Datenlage erwartet, etwa im Abschnitt "Epidemiologie" beim Prostatakrebs.
Mit dem Heft 36 "Prostataerkrankungen" ist vom Robert-Koch-Institut als Herausgeber eine weitere Publikation im Rahmen der "Gesundheitsberichtserstattung des Bundes" erschienen. Die Qualität eines Produktes darf und muss sich am eigenen Anspruch messen lassen. Um es vorneweg zu sagen: Das Heft 36 "Prostataerkrankungen" erfüllt den erhobenen Anspruch nur zum Teil und in vielen Fragen überhaupt nicht. Prinzipiell unterscheidet es sich nicht grundsätzlich von den vielen anderen Druckerzeugnissen zum Thema z.B. von diversen Pharmaunternehmen aus dem Hormontherapiebereich, aus dem urologisch-ärztlichen Bereich oder von anderen Interessenverbänden. Da hätte man sich an manchen Stellen schon mehr an kritischer Beurteilung einer in diesem Bereich leider sehr schwachen Datenlage erwartet, etwa im Abschnitt "Epidemiologie" beim Prostatakrebs.
Angesprochen als Leser- und Nutzerkreis der GBE-Produkte sind "Gesundheitspolitikerinnen und -politiker, Expertinnen und Experten in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und die Fachöffentlichkeit. Zur Zielgruppe gehören auch Bürgerinnen und Bürger, Patientinnen und Patienten, Verbraucherinnen und Verbraucher und ihre jeweiligen Verbände." Angesichts dieses Leserkreises hätte man sich in einer neueren Veröffentlichung mehr an kritischer Beurteilung erwartet, etwa im Abschnitt "Epidemiologie" beim Prostatakrebs.
• Da beispielsweise nach neueren Studien (vgl. Hölzel et al. 2002: Qualität der Angaben von Todesbescheinigungen: Ist die Todesursachenstatistik zu Krebserkrankungen besser als ihr Ruf?) ca. 30% der Todesbescheinigungen recht fehlerhaft ausgestellt sind, kann folglich keinesfalls geschlossen werden, dass 11 000 Todesfälle jährlich (wie zu lesen ist) auf diese Erkrankung zurückzuführen sind. Die Rate liegt sicherlich deutlich niedriger. Wahrscheinlich sterben die allermeisten Männer nicht an sondern mit ihrem Prostatakrebs und die scheinbar hohe Mortalität ist eher darin begründet, dass das mittlere Erkrankungsalter mit ca. 72 Jahren sehr hoch liegt und damit auch andere Todesursachen nahe sind.
• Ob sich die Überlebensrate in den letzten Jahren verbessert hat, wie im Text zu lesen steht, erscheint ebenso fraglich. Ist es vielleicht nicht eher so, dass durch den PSA-Test der Diagnosezeitpunkt nur vorverlegt wurde?
• Oder an anderer Stelle: Wie und wodurch lässt sich denn die Aussage stützen, dass durch die "Früherkennung" des gesetzlichen Früherkennungsprogramms bei Prostatakrebs "mit besseren Aussichten auf Heilung behandelt werden kann"? Der einfache Tatbestand, dass es sich bei den meisten Prostatakrebsen um eine nicht lebensbegrenzende Erkrankung handelt (sog. insignifikantes Karzinom oder "Haustierkrebs") und es sich bei den wenigsten um eine hoch aggressive Art ("Raubtierkrebs") handelt, sowie die Bedeutung für die Diagnostik und die Therapie, kommt nirgendwo im Heft 36 deutlich zum Ausdruck.
• Und doch gibt es im Gegensatz zur Meinung der Autoren des Heftes eine Methode (die DNA-Zytometrie, vgl. Prostatakrebs: Diagnose und Prognose), die einen wichtigen Beitrag zur Risikoabschätzung der Aggressivität des Tumors leisten kann und das auch noch für äußerst wenig Geld.
Hier liegt sogar eine bedenkliche Lücke in der Recherche vor. Ebenso wird nichts berichtet wird über die Feinnadelaspirationsbiopsie als Biopsiemethode, die bei höherer Trefferquote für die betroffenen Männer außerdem nebenwirkungsärmer und schonender ist sowie für die Kostenträger wesentlich preiswerter. Erwartet hätte man sich bei den avisierten Zielgruppen der Broschüre weiterhin selbstverständlich auch eine detailliertere Darstellung der Nebenwirkungen bei den verschiedenen Therapieverfahren, sollte der Inhalt des Heftes in irgendeiner Weise Betroffenen oder Informationsvermittlern Hilfen bei der Therapiewahl bieten sollen.
Unkritisch und undiskutiert wird auch einfach festgestellt, dass ein "kontrolliertes Zuwarten" als Therapieoption (wohlgemerkt sind die allermeisten Prostatakrebse auch ohne Therapie nicht lebensbegrenzend!) in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ selten verfolgt wird (Man fragt sich: Was könnte da wohl die Ursache sein?). Dass eine Hormonentzugs-Therapie in vielen Fällen und in Abhängigkeit vom Malignitätsgrad ausgesprochen lebensverkürzend sein kann (vgl. Tribukait 1993: Nuclear deoxyribonucleic acid determination in patient with prostate carcinomas: Clinical research and application. Eur Urol 23 (suppl 2), 64-76), bleibt ebenfalls unerwähnt, obgleich diese Therapieform allein oder in Kombination mit einer anderen hierzulande fast an der Tagesordnung ist - und das selbstverständlich nicht nur bei organüberschreitenden Prostatakrebs. Und, so möchte man im Gegensatz zum unkommentierten tabellarischen Dahinschreiben der Autoren hinzufügen (siehe Tab.2 in der Broschüre auf Seite 18): Sie ist noch reichlich teuer und wahrscheinlich trotzdem meist nutzlos und überflüssig.
Kurz: Nichts Neues aus dem RKI. Schade, eine Chance wurde vertan, endlich einmal gründlich zu recherchieren und etwas Fundiertes und Kritisches für den Umgang mit dem Thema zu schreiben, was dringend notwendig wäre angesichts der Bedeutung von Prostataerkrankungen und insbesondere angesichts des Problems des Prostatakrebses.
Dr. med. Walter Samsel
Hier finden Sie das Heft 36 zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes Prostataerkrankungen, Herausgeber: Robert Koch-Institut
ws, 2.2.2007
Warum sterben so wenig Berliner, Bremer und Hamburger am Herzinfarkt? - Überraschungen aus dem "Herzbericht 2005"
 Die Differenz zwischen 18 Infarkttoten pro 100.000 Berlinern und 103 Herzinfarkt-Gestorbenen pro 100.000 der benachbarten Brandenburgern zeigt es am deutlichsten: Ob jemand einen Herzinfarkt überlebt, hängt spürbar auch von seinem Wohnort ab. Während die Sterbeziffern in den drei Stadtstaaten und gerade noch im Flächenland Hessen unterdurchschnittlich sind, liegen sie in den anderen Flächenländern und den ostdeutschen Bundesländer über dem Durchschnitt. Als Erklärung hält der langjährige private "Macher" des 18. so genannten "Herzberichts", der ehemals in Niedersachsen für die Krankenhausplanung verantwortliche Ministerialbeamte Dr. Ernst Bruckenberger, teilweise die "bessere Versorgungsstruktur in den Städten" bzw. die "kurzen Wege zur Klinik" für "wahrscheinlich".
Die Differenz zwischen 18 Infarkttoten pro 100.000 Berlinern und 103 Herzinfarkt-Gestorbenen pro 100.000 der benachbarten Brandenburgern zeigt es am deutlichsten: Ob jemand einen Herzinfarkt überlebt, hängt spürbar auch von seinem Wohnort ab. Während die Sterbeziffern in den drei Stadtstaaten und gerade noch im Flächenland Hessen unterdurchschnittlich sind, liegen sie in den anderen Flächenländern und den ostdeutschen Bundesländer über dem Durchschnitt. Als Erklärung hält der langjährige private "Macher" des 18. so genannten "Herzberichts", der ehemals in Niedersachsen für die Krankenhausplanung verantwortliche Ministerialbeamte Dr. Ernst Bruckenberger, teilweise die "bessere Versorgungsstruktur in den Städten" bzw. die "kurzen Wege zur Klinik" für "wahrscheinlich".
Weitere wichtige Daten zur Risiko- und Versorgungssituation für Herz-/Kreislauferkrankte in Deutschland zeigen ein differenziertes und ambivalentes Bild:
• Regionale Unterschiede zeigen sich auch, wenn man nicht allein den Herzinfarkt betrachtet, sondern die Sterblichkeit an der koronaren Herzkrankheit, an Herzklappenerkankungen, Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz: Diese liegt in den drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen sowie in Baden-Württemberg (in diesem Land ist die Versorgungssituation am besten) um 10 bis 20 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt und in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen dagegen rund 17 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. "Von einer homogenen Versorgungsstruktur in der deutschen Herzmedizin kann nicht die Rede sein." (Bruckenberger)
• Trotzdem ist für das Berichtsjahr 2004 auch Erfreuliches zu berichten: Die Sterbeziffer (Gestorbene pro 100.000 Einwohner) für die häufigsten Herzerkrankungen sank seit 1980 um 9 %. Die stationäre Morbiditätsziffer (Zahl der vollstationären Fälle pro 100.000 Einwohner) sank 2004 ebenfalls weiter.
• Ein im Bericht vorgenommener Vergleich der Sterbe-, Erkrankungs- und Versorgungsziffern in Deutschland mit denen in Österreich und der Schweiz vertreibt allerdings den Glanz der zuerst einmal positiven Zahlen in Deutschland schnell. Bei Morbidität und Mortalitätsziffern lag Deutschland nämlich an der Spitze. Die stationäre Morbidität lag hierzulande um 6,3 % höher als in Österreich und sogar um 115 % höher als in der Schweiz. Bei der Sterbeziffer überragte der Wert in Deutschland den aus Österreich um 20,6 % und den der Schweiz um 52,6 %. Auch das Pflegetagvolumen pro 1 Million Einwohner lag in beiden Alpenstaaten deutlich niedriger als in Deutschland. Zu beachten ist, dass diese Unterschiede durch mehrere Faktoren bedingt werden.
• Was im Berichtszeitraum stieg war die Anzahl mehrerer spezifischer Untersuchungen und Interventionen im Herz-/Kreislaufsystem: Die Zahl der Linksherzkatheter-Untersuchungen stieg um 7,9 Prozent auf 772.137 Untersuchungen und die Zahl der Ballondilatationen stieg um 8,9 Prozent auf 270.964. Bei der Implantation von Stents zur Erweiterung verengter Gefäße gibt es eine steigende Tendenz: 2005 wurden mit insgesamt 230.580 um 13,6 Prozent mehr Stents eingesetzt als 2004, der Anteil der Arzneimittelbeschichteten Stents hat sich im Vergleich zum Jahr davor von 13 auf 28 Prozent erhöht.
• Vergleicht man auch hier die Angebotsstrukturen und -mengen in Österreich, der Schweiz mit denen in Deutschland nimmt letzteres fast immer den Spitzenplatz ein: Nur bei den Herzzentren pro 1 Million Einwohnern lag Deutschland mit 0,9 Herzentren hinter der Schweiz (2,3) und Österreich (1,1) auf Platz drei. Die meisten Linksherzkatheterplätze in Zentren oder Labors pro 1 Million Einwohner existierten in Deutschland (4,8) vor Österreich mit 3,9 und der Schweiz mit 3,6.
Diese Reihenfolge findet man auch bei den Linksherzkatheter-Messplätzen. Vergleicht man nun auch noch wie häufig diese Messeinrichtungen genutzt wurden, finden sich plastische und drastische Belege für das Phänomen der angebotsinduzierten Nachfrage. Pro 1 Million deutsche BürgerInnen wurde bei 9.366 eine Linksherzkatheteruntersuchung durchgeführt. Dies geschah in Österreich nur bei 5.537 Menschen und in der Schweiz sogar lediglich bei 4.885 Personen pro 1 Million Einwohner.
Die so genannte "Perkutane transluminale coronare Angioplastie (PTCA)", eine Ausdehnung von verengten Herzkranzgefäßen mittels eines Katheters, erfolgte in Deutschland bei 3.287, in der Schweiz bei 2.229 und in Österreich bei 2.072 Menschen pro 1 Million Einwohner. Die Rangfolge bei den Heroperationen sah ähnlich aus.
Wohlgemerkt: Ohne, dass diese Versorgungsdichte durch irgendwelche besseren und Gesundheitsergebnissen gerechtfertigt würden oder gar die Österreicher und Schweizer unterversorgt wirkten.
• Der Schlussfolgerung des Präsidenten der deutschen Kardiologie-Gesellschaft: "Bei der Betrachtung der therapeutischen Leistungszahlen begründen die vorliegenden Zahlen nicht zwangsläufig die Annahme einer Überversorgung" kann daher nicht ohne weiteres gefolgt werden.
• Auch wenn, wie Bruckenberger berichtet "von 2002 bis 2004 die Krankheitskosten, entgegen dem bei anderen Krankheitsbildern meist anders verlaufenden Trend, für die ischämischen Herzkrankheiten um 5,5 Prozent und für die angeborenen Herzfehler um 3,2 Prozent abgenommen (haben)" und es nur bei der Behandllung der Herzinsuffizienz zu einem geringfügigen Anstieg von 0,9 % kam, rechtfertigt dies nicht die zumindest vordergründig nicht durch Gesundheitsfaktoren begründete Überversorgung mit den genannten medizinischen Interventionen. Jede dieser Untersuchungen ist nämlich mit einem teilweise erheblichen iatrogenen Risiko verbunden.
Schade ist, dass der von mehreren Fachgesellschaften und Professionsgruppen wie beispielsweise den Chefärzten der Herzchirurgien unterstützte Bericht, nicht als Gesamttext kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt wird. Die dafür bemühten Argumente überzeugen im Zeitalter von DSL und Flatrates nicht mehr. Der 18. Herzbericht bzw. die "Versorgungsanalyse zur Kardiologie und Herzchirurgie in Deutschland für das Jahr 2005" mit einem Umfang von 226 Seiten muss für 35 Euro im A4 Format mit über 220 farbigen Abbildungen und 80 Tabellen aber zumindest hier bestellt werden.
Hier finden sie auch noch eine ausführlichere Zusammenfassung.
Bernard Braun, 9.1.2007
Malaria: Informationen über eine exotisch-stille Massenkrankheit.
 "Malaria, one of the world's most common and serious tropical diseases, causes at least one million deaths every year - the majority of which occur in the most resource-poor countries. More than half of the world's population is at risk of acquiring malaria, and the proportion increases each year because of deteriorating health systems, growing drug and insecticide resistance, climate change, natural disasters and armed conflict." (Kaiser Family Foundation)
"Malaria, one of the world's most common and serious tropical diseases, causes at least one million deaths every year - the majority of which occur in the most resource-poor countries. More than half of the world's population is at risk of acquiring malaria, and the proportion increases each year because of deteriorating health systems, growing drug and insecticide resistance, climate change, natural disasters and armed conflict." (Kaiser Family Foundation)
Weitere Daten zum Auftreten und zur Behandlung dieser vielfach unterschätzten Welt-Krankheit, darunter Zahlen zur regions- und länderspezifischen Anzahl der Erkrankungs-Fälle, der Krankheitsraten pro 1000 Einwohner und der Sterbefälle, liefert die auch allgemein erneut für alle quantitativen Daten zum weltweiten Krankheits- und Versorgungsgeschehen empfohlene und von der "Kaiser Family Foundation" gesponsorte Website "globalhealthfacts.org".
Eine weitere faktenreiche Informationsquelle über die Malaria, aber auch über TB und HIV/AIDS ist der wöchentlich kostenlos erscheinende Informationsdienst "Global health reporting.org", der entweder online gelesen oder als Email bezogen werden kann. Hier finden sich neueste Daten über die Epidemiologie der Erkrankungen, ihre Behandlung, wissenschaftliche und politische Entwicklungen und entsprechende "models of good practice".
Bernard Braun, 12.12.2006
25 Jahre HIV und AIDS: Zwei material- und hilfreiche Informationsquellen
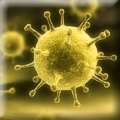 Anlässlich der 25-jährigen Wiederkehr des Tages, nämlich des 5. Juni 1981, an dem die "U.S. Centers for Disease Control and Prevention" das erste Mal öffentlich vor der Verbreitung einer Erkrankung warnte, die bald als AIDS bekannt wurde, stellte die Kaiser Family Foundation zahlreiche historische und aktuelle Informationen zu AIDS und HIV auf einer speziellen Website zusammen. Unter dem Titel "aids@25" finden sich u.a. eine Übersicht zur Entwicklung dieser Epidemie, spezielle Surveys zur us-amerikanischen aber auch internationalen epidemiologischen und Behandlungssituation oder ein multimedialer und interaktiver Zeitkalender ("Timeline") mit den wichtigsten erkrankungsbezogenen Ereignissen seit 1981.
Anlässlich der 25-jährigen Wiederkehr des Tages, nämlich des 5. Juni 1981, an dem die "U.S. Centers for Disease Control and Prevention" das erste Mal öffentlich vor der Verbreitung einer Erkrankung warnte, die bald als AIDS bekannt wurde, stellte die Kaiser Family Foundation zahlreiche historische und aktuelle Informationen zu AIDS und HIV auf einer speziellen Website zusammen. Unter dem Titel "aids@25" finden sich u.a. eine Übersicht zur Entwicklung dieser Epidemie, spezielle Surveys zur us-amerikanischen aber auch internationalen epidemiologischen und Behandlungssituation oder ein multimedialer und interaktiver Zeitkalender ("Timeline") mit den wichtigsten erkrankungsbezogenen Ereignissen seit 1981.
Eine andere wichtige wissenschaftliche Informationsquelle über die Ursachen, Verbreitung und Behandlungsmöglichkeiten von HIV/AIDS ist die Homepage der "The Cochrane Collaborative Review Group on HIV Infection and AIDS", deren Zentrum sich an der Universität San Francisco befindet. Die von der Cochrane Collaboration, der Internationalen AIDS-Gesellschaft, dem Institut für globale Gesundheit an der Universität von San Francisco und dem an der gleichen Universität angesiedelten AIDS Forschungsinstitut getragene Gruppe ist ein internationales Netzwerk von Gesundheitsversorgungs-Profis, Forschern und Nutzern, die systematische Reviews wissenschaftlicher Arbeiten über die Prävention und die Behandlung der HIV-Infektion und AIDS vorbereiten, verfassen und verbreiten.
Zu den wichtigsten dort zusammengestellten wissenschaftlichen Informationsquellen und handlungsrelevanten Forschungsüberblicken gehören:
• Ein so genanntes "Evidence Assessment" aus dem Jahre 2004, in dem auf der Basis von 60 systematischen Reviews und Meta-Analysen (also aus der Perspektive der "Evidence based Medicine" hochwertigen wissenschaftlichen Quellen) Strategien zur Prävention, Behandlung und Versorgung von an diesen Krankheiten Erkrankten vorgestellt und bewertet werden.
• Hinweise auf "Systematic Reviews" der Gruppe, die durchgeführt oder in Arbeit sind und
• eine aktuelle Termin- und Publikationen-Übersich
Wie häufig in den Arbeiten der Cochrane Collaboration, die insgesamt in der "Cochrane Library" - und in den meisten Fällen nur kostenpflichtig - erhältlich sind, enthalten viele der Arbeiten auch gesundheitswissenschaftlich weit über die konkrete Erkrankung hinausgehende Hinweise. Insofern lohnt ein Blick in diese Materialien auch für Nicht-AIDS-ExpertInnen.
Bernard Braun, 19.11.2006
Rückenschmerzen sind weiter im Vormarsch
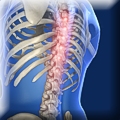 Die Zahl der von Rückenschmerz geplagten Bundesbürger hat in den letzten acht Jahren um 30 Prozent zugenommen: Heute geben fast 70 Prozent der Bundesbürger an, dass sie Rückenbeschwerden haben, wenn auch die meisten nur gelegentlich. Noch vor acht Jahren betraf dies lediglich jeden Zweiten (53 Prozent). Allerdings hat sich auch die Zahl der Menschen mit ständigen Schmerzen mehr als verdoppelt: Sagten 1998 nur sechs Prozent der Befragten, ihnen schmerze der Rücken täglich, sind es 2006 bereits 15 Prozent. Dies ergab die aktuelle Repräsentativbefragung des BKK Bundesverbandes bei über 6.000 Personen ab 14 Jahren.
Die Zahl der von Rückenschmerz geplagten Bundesbürger hat in den letzten acht Jahren um 30 Prozent zugenommen: Heute geben fast 70 Prozent der Bundesbürger an, dass sie Rückenbeschwerden haben, wenn auch die meisten nur gelegentlich. Noch vor acht Jahren betraf dies lediglich jeden Zweiten (53 Prozent). Allerdings hat sich auch die Zahl der Menschen mit ständigen Schmerzen mehr als verdoppelt: Sagten 1998 nur sechs Prozent der Befragten, ihnen schmerze der Rücken täglich, sind es 2006 bereits 15 Prozent. Dies ergab die aktuelle Repräsentativbefragung des BKK Bundesverbandes bei über 6.000 Personen ab 14 Jahren.
Einige zentrale Befunde:
• In den letzten Jahren gingen immer weniger Menschen wegen Rückenschmerzen zum Arzt. Ein Viertel meinte, dass die Schmerzen nicht schlimm genug gewesen seien. 13 Prozent glaubten, die Beschwerden verschwinden von allein und zwölf Prozent behandeln ihren Rücken lieber selbst.
• Laut Auskunft der Befragten sagen 2006 die meisten Ärzte (63 Prozent), dass die Beschwerden vor allem auf Verspannungen zurückzuführen seien.
• Befragt nach der ärztlichen Therapie gegen Rückenschmerzen werden 2006 am häufigsten Medikamente benannt und Schmerzmittel der Muskelentspanner häufiger angegeben als noch vor acht Jahren. Krankengymnastik verordnen die Ärzte aktuell jedem Zweiten und auch der Anteil chiropraktischer Maßnahmen hat enorm zugenommen.
Ausführliche Darstellung dieser und weiterer Ergebnisse finden sich in der PDF-Datei Bevölkerungsumfrage Rückenschmerzen
Gerd Marstedt, 29.10.2006
Patienten mit Gelenkschmerzen sind in Deutschland stark unterversorgt
 Millionen Deutsche leiden unter Schmerzen in den Gelenken (Arthrose). Schätzungen zu Folge belastet die Krankheit das Gesundheitssystem jährlich mit 3,5 bis 5,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig gibt es bisher für Deutschland nur wenige Daten und Studien zur Häufigkeit von Gelenkschmerzen. Die Initiative "Stark gegen den Schmerz" möchte dies mit der Herner Arthrose-Studie (HERAS) ändern. Die Herner Arthrose-Studie (HERAS) ist als aufwändige Querschnittstudie angelegt. Mit repräsentativen Daten möchte sie die wissenschaftliche Neubewertung von Bewegungsschmerz-Therapien anschieben. In einem ersten Teil der Studie erhielten in Herne etwa 8.000 männliche und weibliche Bürger ab einem Alter von 40 Jahren einen Fragebogen. In diesem Fragebogen wurde u.a. erhoben, ob, wie oft und mit welchen Konsequenzen die Befragten unter Gelenkschmerzen leiden. Bis September 2005 waren etwa 3.700 ausgefüllte Fragebögen abgegeben worden. Im zweiten Teil der Studie ist eine klinische Untersuchung aller Betroffenen vorgesehen, die im Fragebogen über Bewegungsschmerzen im Knie- oder Hüftgelenk geklagt haben.
Millionen Deutsche leiden unter Schmerzen in den Gelenken (Arthrose). Schätzungen zu Folge belastet die Krankheit das Gesundheitssystem jährlich mit 3,5 bis 5,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig gibt es bisher für Deutschland nur wenige Daten und Studien zur Häufigkeit von Gelenkschmerzen. Die Initiative "Stark gegen den Schmerz" möchte dies mit der Herner Arthrose-Studie (HERAS) ändern. Die Herner Arthrose-Studie (HERAS) ist als aufwändige Querschnittstudie angelegt. Mit repräsentativen Daten möchte sie die wissenschaftliche Neubewertung von Bewegungsschmerz-Therapien anschieben. In einem ersten Teil der Studie erhielten in Herne etwa 8.000 männliche und weibliche Bürger ab einem Alter von 40 Jahren einen Fragebogen. In diesem Fragebogen wurde u.a. erhoben, ob, wie oft und mit welchen Konsequenzen die Befragten unter Gelenkschmerzen leiden. Bis September 2005 waren etwa 3.700 ausgefüllte Fragebögen abgegeben worden. Im zweiten Teil der Studie ist eine klinische Untersuchung aller Betroffenen vorgesehen, die im Fragebogen über Bewegungsschmerzen im Knie- oder Hüftgelenk geklagt haben.
Erste Zwischenergebnisse der Studie wurden jetzt vorgestellt:
• Mehr als die Hälfte (57%) der befragten Herner Bürger litten zum Zeitpunkt der Befragung an akuten Gelenkbeschwerden. 68 % der Befragten hatten im zurückliegenden Monat mit Schmerzen zu kämpfen, 71 % während der vergangenen zwölf Monate. Diese Zahlen belegen, dass Gelenkschmerz in Deutschland eines der häufigsten Krankheitssymptome bei Menschen über 40 Jahren ist.
• Viele jüngere Menschen sind betroffen. Bekannt ist, dass vor allem ältere Menschen unter Gelenkschmerzen und Arthrose leiden. Weniger bekannt ist, dass auch jüngere betroffen sind. Am Befragungstag klagten mehr als die Hälfte (52,3 %) der 40- bis 49-Jährigen über Schmerzen des Bewegungsapparates. In allen Altersgruppen waren Frauen häufiger betroffen (im Schnitt 10 % mehr Frauen als Männer).
• Jeder Vierte der befragten Herner Bürger gab an, nur unter starken Schmerzen auf Ebenen gehen zu können. Etwa jeder Zehnte sagte, er habe dabei "stärkste Schmerzen". Jeder Fünfte klagte über Schmerzen beim Stehen. Es ist nicht verwunderlich, dass sich Patienten mit solch starken Beschwerden immer mehr aus dem sozialen Leben zurückziehen.
• Ein Fünftel der Studienteilnehmer fühlt sich durch die Krankheit selbst bei leichten Haushaltstätigkeiten beeinträchtigt. 85 % aller Patienten mit Kniebeschwerden können sich ihre Socken nur mit Mühe oder gar nicht anziehen, etwa die Hälfte kann sich nur unter Schmerzen auf die Toilette setzen und wieder aufstehen.
• Unterversorgung mit nicht-medikamentösen Therapien: Nur ein Viertel aller befragten Herner Bürger, die unter Gelenkbeschwerden leiden, haben in den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung eine Physiotherapie oder eine andere nicht-medikamentöse Therapie erhalten. Da besonders Krankengymnastik als integraler Bestandteil einer Behandlung von Gelenkbeschwerden gilt, sprechen die Daten für eine Unterversorgung bei nicht-medikamentösen Therapien.
• Unterversorgung mit Medikamenten. Von allen Teilnehmern, die in den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung unter Gelenkbeschwerden litten, hat nur knapp ein Drittel von ihrem Arzt Schmerzmittel erhalten. 20 % der Befragten, die zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen zwölf Monaten Schmerzmittel eingenommen haben, klagten über schwere oder sogar extreme Schmerzzustände. Diese Zahlen wecken den Verdacht, dass viele Schmerzpatienten nicht ausreichend schmerztherapeutisch versorgt sind.
Weitere Details zur Studie (Untersuchungsdesign, Zwischenergebnisse, medizinische Ratschläge) finden sich auf der Website der Initiative "Stark gegen den Schmerz"
Gerd Marstedt, 7.1.2006
Eine Million Ältere von Demenz betroffen, jährlich 200.000 Neuerkrankungen
 Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ein neues Themenheft "Altersdemenz" veröffentlicht, in dem zahlreiche epidemiologische Befunde für Deutschland (Verbreitung, Neuerkrankungen) zu finden sind, aber auch Aspekte der Therapie und gesundheitlichen Versorgung (Pflege, Altenheime, Inanspruchnahme von Ärzten). Wichtige Ergebnisse des Berichts:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ein neues Themenheft "Altersdemenz" veröffentlicht, in dem zahlreiche epidemiologische Befunde für Deutschland (Verbreitung, Neuerkrankungen) zu finden sind, aber auch Aspekte der Therapie und gesundheitlichen Versorgung (Pflege, Altenheime, Inanspruchnahme von Ärzten). Wichtige Ergebnisse des Berichts:
Demenzielle Erkrankungen sind gekennzeichnet durch fortschreitenden Gedächtnisverlust und Abbau kognitiver Fähigkeiten. Etwa zwei Drittel aller Demenzerkrankungen entfallen auf die Alzheimerkrankheit, 15 bis 20% auf vaskuläre Demenzen, der Rest auf Mischformen und andere seltene Demenzerkrankungen. Die Häufigkeit demenzieller Erkrankungen steigt mit zunehmendem Alter stark an. Bezogen auf die 65-Jährigen und Älteren sind in Deutschland etwa eine Million Menschen von einer mittelschweren oder schweren Demenz betroffen und in der Regel nicht mehr zur selbstständigen Lebensführung in der Lage; erstmals an einer Demenz erkranken jährlich nahezu 200.000 Menschen.
Neben einer medikamentösen Therapie stehen verschiedene psychosoziale Interventionen zur Verfügung, die das Fortschreiten kognitiver Störungen verzögern und dem Verlust an Alltagskompetenz entgegenwirken können. Etwa 60% der Demenzkranken leben in Privathaushalten. Vor allem die zusätzlich zu den kognitiven Störungen auftretenden Verhaltensprobleme Demenzkranker erhöhen die Belastungen pflegender Angehöriger erheblich und führen häufig zu einer Heimaufnahme. Etwa zwei Drittel der Bewohner in Altenpflegeheimen leiden an einer Demenz. Demenzen sind nicht nur sehr häufig unter Heimbewohnern, sie sind auch der wichtigste Grund für den Eintritt in ein Heim.
Demenz gehört zu den teuersten Krankheitsgruppen im Alter. In Deutschland wurden für die Alzheimerdemenz pro Patient und Jahr durchschnittlich Kosten von 43.767 Euro ermittelt, wobei 67,9% auf die Familie entfallen, 29,6% auf die gesetzliche Pflegeversicherung und 2,5 % auf die gesetzliche Krankenversicherung. Für das Jahr 2050 ist aufgrund der demografischen Entwicklung zu erwarten, dass über zwei Millionen der 65-Jährigen und Älteren in Deutschland an einer Demenz leiden werden.
PDF-Datei Altersdemenz - GBE-Heft 28
Gerd Marstedt, 3.12.2005
Zwei von drei Deutschen leiden unter Rückenschmerzen
 Zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland leiden unter Rückenschmerzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des BKK Bundesverbandes bei rund 4.000 repräsentativ ausgewählten Personen ab 14 Jahren. Betroffen sind vor allem Übergewichtige, Ältere (über 50 Jahre) und Frauen. Auch Teenager sind von dem Problem schon betroffen, vier von zehn Teenagern (41 Prozent der 14- bis 19-Jährigen) kennen regelmäßig auftretende Probleme mit dem Rücken aus eigener Erfahrung. Bei den unter 30-Jährigen (20 bis 29 Jahre) klagt schon jeder Zweite über Rückenschmerzen (52 Prozent).
Zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland leiden unter Rückenschmerzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des BKK Bundesverbandes bei rund 4.000 repräsentativ ausgewählten Personen ab 14 Jahren. Betroffen sind vor allem Übergewichtige, Ältere (über 50 Jahre) und Frauen. Auch Teenager sind von dem Problem schon betroffen, vier von zehn Teenagern (41 Prozent der 14- bis 19-Jährigen) kennen regelmäßig auftretende Probleme mit dem Rücken aus eigener Erfahrung. Bei den unter 30-Jährigen (20 bis 29 Jahre) klagt schon jeder Zweite über Rückenschmerzen (52 Prozent).
Unter Rückenproblemen leiden 61 Prozent der Befragten, jedoch nur knapp die Hälfte von ihnen begibt sich auch in medizinische Behandlung. Auf die Frage, warum sie auf einen Arztbesuch verzichtet haben, antwortet ein Viertel, dass die Schmerzen nicht schlimm genug gewesen seien. 13 Prozent glauben, dass die Beschwerden von selbst wieder verschwinden und zwölf Prozent behandeln ihren Rücken lieber selbst. Acht Prozent haben keine Zeit zum Arzt zu gehen oder glauben, der Arzt könne ihnen nicht helfen. Nur vier Prozent geben an, dass sie aus Kostengründen auf medizinische Behandlung verzichten.
Je älter die Befragten sind, desto häufiger therapieren sie ihre Rückenschmerzen lieber selbst. Fast ein Fünftel der über 60-Jährigen (17 Prozent), die nicht beim Arzt waren, greift auf bewährte Hausmittel zurück. Bei den unter 30-Jährigen dagegen verlassen sich viele auf ein ärztliches Urteil. Nur fünf Prozent setzen auf Selbsttherapie.
Die Befragung wurde von tns healthcare (emnid) durchgeführt. Auf der Homepage des BKK Bundesverbandes gibt es umfangreiches Informationsmaterial zum Thema Rückenschmerzen und auch die Ergebnisse der Befragung stehen als PDF-Datei zur Verfügung.
Rückengesundheit - Zusammenfassung der Ergebnisse einer Repräsentativbefragung des BKK-Bundesverbandes
Gerd Marstedt, 30.11.2005
AIDS-Bericht der UN: Zahl der HIV-Infizierten auf Höchststand
 Nach dem neuen UNAIDS (United Nations Aids)und WHO-Bericht müssen die Anstrengungen zur HIV-Prävention und Behandlung deutlich verstärkt werden, um eine Verlangsamung und Umkehr in der Entwicklung der AIDS-Epidemie zu erreichen. Der neue und jetzt vorgestellte Bericht zeigt auf, dass die Gesamtzahl der HIV-Infektionen weiterhin ansteigt, auch wenn die HIV-Infektionsraten unter Erwachsenen in einigen Ländern zurückgegangen sind. Im Jahr 2005 kam es zu fünf Millionen Neuinfektionen. Die Zahl der HIV-Positiven weltweit hat mit schätzungsweise 40,3 Millionen Menschen (im Vergleich zu 37,5 Millionen im Jahr 2003) einen neuen Höchststand erreicht. Täglich stecken sich 14.000 Menschen neu an, etwa alle sechs Sekunden wird ein Mensch neu infiziert. 95 Prozent der Betroffenen leben in Entwicklungs- oder Schwellenländern.
Nach dem neuen UNAIDS (United Nations Aids)und WHO-Bericht müssen die Anstrengungen zur HIV-Prävention und Behandlung deutlich verstärkt werden, um eine Verlangsamung und Umkehr in der Entwicklung der AIDS-Epidemie zu erreichen. Der neue und jetzt vorgestellte Bericht zeigt auf, dass die Gesamtzahl der HIV-Infektionen weiterhin ansteigt, auch wenn die HIV-Infektionsraten unter Erwachsenen in einigen Ländern zurückgegangen sind. Im Jahr 2005 kam es zu fünf Millionen Neuinfektionen. Die Zahl der HIV-Positiven weltweit hat mit schätzungsweise 40,3 Millionen Menschen (im Vergleich zu 37,5 Millionen im Jahr 2003) einen neuen Höchststand erreicht. Täglich stecken sich 14.000 Menschen neu an, etwa alle sechs Sekunden wird ein Mensch neu infiziert. 95 Prozent der Betroffenen leben in Entwicklungs- oder Schwellenländern.
Mehr als drei Millionen Menschen, darunter 500.000 Kinder, starben im Jahr 2005 an Krankheiten, die mit AIDS in Beziehung stehen. Nach dem Bericht von UNAIDS gab es in Osteuropa und Zentralasien mit einem Anstieg um 25% auf 1,6 Millionen Betreoffene sowie in Ostasien die höchsten Steigerungsraten. Das südliche Afrika ist jedoch mit 64% der Neuinfektionen (das sind mehr als 3 Millionen Menschen) weltweit weiterhin am stärksten betroffen. Weltweit zugenommen hat der Anteil der infizierten Frauen. Ende 2005 sind 17,5 Millionen Frauen betroffen, eine Million mehr als 2003. Eine der Ursachen ist die sexuelle Diskriminierung von Frauen in vielen afrikanischen Ländern: Gegen ungeschützten Geschlechtsverkehr können sie sich nur selten zur Wehr setzen.
Während die Mutter-Kind-Übertragung in den Industrieländern praktisch besiegt ist und das Angebot an Leistungen sich vielerorts verbessert hat, sind in den meisten Ländern im südlichen Afrika noch immer große Defizite zu erkennen. Ein beschleunigter Ausbau von Leistungsangeboten ist jedoch dringend erforderlich, um diesen unvertretbar hohen Preis nicht mehr zahlen zu müssen. Das Wissen über "Safe Sex" und HIV ist in zahlreichen Ländern immer noch niedrig.
In Deutschland haben sich nach Mitteilung Robert Koch-Instituts (RKI) im 1.Halbjahr 2005 über 1.100 Personen neu infiziert, rund 20 Prozent mehr als im 1.Halbjahr 2004. Damit steigt die deutschlandweite Aidsrate auf 24.269 Infizierte. Ursachen erkennt das RKI vor allem in einer Vernachlässigung von "Safer Sex": Selbst bei neuen oder kaum bekannten Sexpartnern werde immer öfter auf Kondome verzichtet.
Der jährlich veröffentlichte Bericht "AIDS Epidemic Update" stellt die neuesten Entwicklungen in der weltweiten AIDS-Epidemie dar. Mit Karten und regionalen Schätzungen liefert die Ausgabe 2005 die neuesten Schätzungen zum Umfang der Epidemie und ihre Opfer, untersucht neue Trends in der Entwicklung der Epidemie und widmet sich in einem besonderen Kapitel dem Thema HIV-Prävention. Das angebote Informationsmaterial auf der Homepage von UNAIDS umfasst unter anderem den
Ausführlichen Status-Bericht: Die AIDS Epidemie. Dezember 2005, deutsch, 112 Seiten, 5,8 MB
Gerd Marstedt, 21.11.2005
Überschätzung der "Krankheitslasten": Das Beispiel "offenes Bein"
 Es gibt Wochen, in denen man leicht vier oder fünf Zeitungsberichte finden kann, nach denen Millionen Menschen an einer Krankheit leiden und behandelt werden oder werden müssten. Der gesundheitspolitisch folgenreiche Schluss, die Bevölkerung würde immer mehr und schwerer krank (fachwissenschaftlich als "Medikalisierungsthese" diskutiert), drängt sich dann dem Durchschnittsleser schnell auf. Dies gilt ebenso für Befürchtungen, diese Morbiditätslast könne bald nicht mehr mit den begrenzten Mitteln der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bewältigt werden und Rationierung notwendiger Behandlungen wären unvermeidlich.
Es gibt Wochen, in denen man leicht vier oder fünf Zeitungsberichte finden kann, nach denen Millionen Menschen an einer Krankheit leiden und behandelt werden oder werden müssten. Der gesundheitspolitisch folgenreiche Schluss, die Bevölkerung würde immer mehr und schwerer krank (fachwissenschaftlich als "Medikalisierungsthese" diskutiert), drängt sich dann dem Durchschnittsleser schnell auf. Dies gilt ebenso für Befürchtungen, diese Morbiditätslast könne bald nicht mehr mit den begrenzten Mitteln der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bewältigt werden und Rationierung notwendiger Behandlungen wären unvermeidlich.
Ohne dass damit solche Entwicklungen voll gegenstandslos werden, zeigen die Ergebnisse einer gerade veröffentlichten Studie, dass die "Last" mancher Krankheit durchaus um ein Vielfaches übertrieben wird oder überschätzt sein kann. Es handelt sich dabei um das so genannte "offene Bein" (Ulcus cruris venosum - UCV), an dem nach einem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)verbreiteten Versorgungs-Mustervertrag "Chronische Wunde" ca. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland leiden sollen.
In einer eigenen, methodisch anspruchsvollen und repräsentativen Studie in allgemeinärztlichen Praxen untersuchten die an der Universität Düsseldorf arbeitenden Allgemeinmediziner Stefan Wilm (der außerdem noch niedergelassener Allgemeinmediziner ist) und Josta Meidl, ob diese Angabe zur Prävalenz (Anzahl der bereits Erkrankten) realistisch ist.
Das bereits im August 2005 im Vorfeld der Jahrestagung der Fachgesellschaft für Gefäßkunde in dem Newsletter "MedReport" veröffentlichte Ergebnis ist beeindruckend: Es gibt gegenwärtig nur ca. 50.000 Menschen mit einem offenen Bein, also etwa 1/24tel der von der KBV angenommenen und verbreiteten Anzahl. In dem Artikel erfährt man außerdem, dass auch die Inzidenz, also das Neuauftreten dieser Krankheit, wesentlich niedriger liegt als bisher angenommen wurde. In den letzten 20 Jahren ist ferner die Zahl der Personen mit offenen Beinen zurückgegangen.
Auf einen trivialen aber folgenträchtigen Grund solcher Differenzen weist Wilm in einem Beitrag in der Ärzte Zeitung vom 25.10. 2005 zu seinem Forschungsprojekt selber hin: "Die vorherigen Studien haben sich nicht auf die Bevölkerung bezogen". Bisherige Studien hätten mit Daten aus Spezialambulanzen gearbeitet, die zwangsläufig ein überhöhtes Bild lieferten.
Wilm ist im selben Zeitungsbeitrag davon überzeugt, daß auch bei anderen Erkrankungen die Zahlen über die Verbreitung zu hoch angesetzt sind: "Wenn man die Zahlen für alle chronischen Erkrankungen zusammenzählt, kommt man zu dem Schluß, daß 124 Prozent der Deutschen chronisch krank sind".
Hier finden Sie die PDF-Datei des Berichts (Seite 5): "Offenes Bein" viel seltener als befürchtet
Bernard Braun, 6.11.2005
Langschläfer sterben früher. Aber jeder 10. Deutsche klagt über Schlafstörungen
 Einer von fünf Patienten in Allgemeinarzt-Praxen gibt Schlafstörungen an, wenn gezielt danach gefragt wird. Betroffen sind mehr Frauen als Männer. Nach einem Bericht der Ärzte-Zeitung "Was hat Schlafdauer mit Lebenszeit zu tun?" wies Professor Dieter Riemann von der Universität Freiburg beim Kongreß der World Association of Sleep Medicine (WASM) jetzt aber auf einen bislang wenig beachteten Sachverhalt hin. Eine große Erhebung in Heidelberg mit über 5.000 Teilnehmern im Alter von durchschnittlich 53 Jahren hat ergeben, dass Personen, die jede Nacht besonders lange schlafen, nämlich neun Stunden und mehr, früher sterben als andere. In dieser Gruppe ist die Mortalitätsrate innerhalb von zehn Jahren höher als bei Menschen, die weniger schlafen.
Einer von fünf Patienten in Allgemeinarzt-Praxen gibt Schlafstörungen an, wenn gezielt danach gefragt wird. Betroffen sind mehr Frauen als Männer. Nach einem Bericht der Ärzte-Zeitung "Was hat Schlafdauer mit Lebenszeit zu tun?" wies Professor Dieter Riemann von der Universität Freiburg beim Kongreß der World Association of Sleep Medicine (WASM) jetzt aber auf einen bislang wenig beachteten Sachverhalt hin. Eine große Erhebung in Heidelberg mit über 5.000 Teilnehmern im Alter von durchschnittlich 53 Jahren hat ergeben, dass Personen, die jede Nacht besonders lange schlafen, nämlich neun Stunden und mehr, früher sterben als andere. In dieser Gruppe ist die Mortalitätsrate innerhalb von zehn Jahren höher als bei Menschen, die weniger schlafen.
Lang- und Normalschläfer wurden seit 1990 beobachtet. Jetzt, 15 Jahre später, zeigte sich: Die Sterberate bei Personen mit 7-8 Stunden Schlaf betrug 5%, bei Personen mit 9 und mehr Stunden lag sie bei 11-12%. Diese Erkenntnis stimme mit Daten aus den USA und Japan überein, berichtete Prof. Riemann. Der Grund für diesen Zusammenhang sei unklar. Vielleicht hätten Menschen, die lange schlafen, ein unerkannte Krankheit, etwa nächtliche Atemstörungen.
Passend zur Pressemeldung kam jetzt ein neues Heft aus der Reihe "Gesundheitsberichterstattung des Bundes" heraus. Das GBE-Heft 27 beschäftigt sich nur mit dem Thema "Schlafstörungen". Berichtet wird, dass 25% der Bevölkerung über Schlafstörungen klagen und 11% ihren Schlaf als "häufig nicht erholsam" erleben. Dargestellt werden im Berichtsheft detailliert die unterschiedlichen Formen von Schlafstörungen, aber auch deren Verbreitung nach Alter und Geschlecht auf der Basis neuerer empirischer Erhebungen. Auch Möglichkeiten der Prävention werden vorgestellt, geeignete und weniger sinnvolle (Schlaftabletten). Das Heft (48 Seiten) kann als PDF-Datei heruntergeladen werden.
GBE-Heft 27 "Schlafstörungen"
Gerd Marstedt, 26.10.2005
Zahl der HIV-Infektionen steigt an
 Die Zahl der neu erkannten HIV-Infektionen ist im ersten Halbjahr 2005 mit 1.164 um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum angestiegen. Das geht aus den vom Robert Koch-Institut jetzt veröffentlichten Zahlen zu HIV/AIDS hervor. Am stärksten steigen die Diagnosezahlen bei Männern, die Sex mit Männern haben. Die Zahl der HIV-Erstdiagnosen in dieser Betroffenengruppe, die im Jahr 2001 mit ca. 300 pro Halbjahr einen Tiefststand erreicht hatte, erreichte jetzt ein Niveau von 550 Neudiagnosen pro Halbjahr, eine Steigerung um 80% innerhalb von 4 Jahren. Auch bei den Personen, bei denen ein heterosexueller Übertragungsweg angegeben wird, setzt sich ein bereits im 2. Halbjahr 2004 zu beobachtender Anstieg der Erstdiagnosen verstärkt fort. Der Halbjahresbericht I/2005 des Robert Koch-Instituts zu HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen in Deutschland kann hier herunter geladen werden: RKI Halbjahresbericht I/2005
Die Zahl der neu erkannten HIV-Infektionen ist im ersten Halbjahr 2005 mit 1.164 um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum angestiegen. Das geht aus den vom Robert Koch-Institut jetzt veröffentlichten Zahlen zu HIV/AIDS hervor. Am stärksten steigen die Diagnosezahlen bei Männern, die Sex mit Männern haben. Die Zahl der HIV-Erstdiagnosen in dieser Betroffenengruppe, die im Jahr 2001 mit ca. 300 pro Halbjahr einen Tiefststand erreicht hatte, erreichte jetzt ein Niveau von 550 Neudiagnosen pro Halbjahr, eine Steigerung um 80% innerhalb von 4 Jahren. Auch bei den Personen, bei denen ein heterosexueller Übertragungsweg angegeben wird, setzt sich ein bereits im 2. Halbjahr 2004 zu beobachtender Anstieg der Erstdiagnosen verstärkt fort. Der Halbjahresbericht I/2005 des Robert Koch-Instituts zu HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen in Deutschland kann hier herunter geladen werden: RKI Halbjahresbericht I/2005
In einem Aufsatz von Rolf Rosenbrock, Leiter der Forschungsgruppe Public Health im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Mitglied im Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen sowie Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), werden die Gründe des heute leider unbestreitbaren Rückgangs von präventivem Verhalten und einige Gedanken zur Überwindung dieser Defizite aufgezeigt. Der Aufsatz liegt hier als PDF-Datei vor: Aids-Prävention - eine Innovation in der Krise
Gerd Marstedt, 9.10.2005
Versorgungsforschung: Wirksamkeit von Grippeschutzimpfung für Ältere meist "bescheiden"
 Manche gesundheitsbezogenen Aktivitäten und Maßnahmen erscheinen derart selbstverständlich, plausibel und gesundheitsförderlich, dass ihre Wirkung und Existenzberechtigung gar nicht mehr hinterfragt werden. Ein Paradebeispiel ist die Grippeschutzimpfung für ältere Personen, die ohne Einschränkung "weltweit empfohlen" wird.
Manche gesundheitsbezogenen Aktivitäten und Maßnahmen erscheinen derart selbstverständlich, plausibel und gesundheitsförderlich, dass ihre Wirkung und Existenzberechtigung gar nicht mehr hinterfragt werden. Ein Paradebeispiel ist die Grippeschutzimpfung für ältere Personen, die ohne Einschränkung "weltweit empfohlen" wird.
Ob dies berechtigt ist oder ob es sich möglicherweise um eine Fehlversorgung oder eine hohle Versprechung handelt, wollten nun aber doch Wissenschaftler (Jefferson, T.; Rivetti, D. et al.) durch einen systematischen Review der medizinischen Studien überprüfen, die sich mit der Wirksamkeit dieser Impfung bei Personen über 65 Jahren beschäftigten.
Die gerade unter dem Titel "Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review" in der Fachzeitschrift "Lancet" (The Lancet 2005; 366:1165-1174) veröffentlichten Ergebnisse dämpfen die populären Erwartungen beträchtlich und sind außerdem von sehr spezifischer Art:
• Nachweisbar hochwirksam ist danach eine Grippeschutzimpfung nur bei älteren Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben. Zumindest zum Teil hilft sie dort gegen die mit einer Grippe verbundenen Komplikationen.
• Für ältere Personen, die nicht pflegebedürftig sind und in Privathaushalten leben, war der Nutzen der Impfung dagegen insgesamt nur bescheiden ("modest") und auch nicht immer nachweisbar.
Wer zusätzlich zum kostenlosen englischsprachigen Abstract der Studie auch noch den Volltext ebenfalls kostenlos als PDF-Datei lesen will, kann dies nach einer kurzen Anmeldung auf der Homepage der Zeitschrift machen. Danach kann ein Teil der im "Lancet" veröffentlichten Arbeiten auch zukünftig kostenlos als Abstract und Langtext heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 9.10.2005