



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Patientensicherheit, Behandlungsfehler |
Alle Artikel aus:
Patienten
Patientensicherheit, Behandlungsfehler
Wie kann der Vorrang der Patientensicherheit gegenüber Wirtschaftlichkeit arbeitsrechtlich erstritten werden?
 Zu den von vielen in Krankenhäusern aber auch Medizinischen Versorgungszentren angestellten ÄrztInnen Arbeitsbelastungen und kritischen Situationen gehört der Mangel an für die gute Qualität der Behandlung notwendigem zusätzlichem insbesondere pflegerischen Personal. Dass trotzdem ein Teil des Operationsbetriebs mit reduziertem Personal unverändert stattfindet, stellt nicht nur eine zusätzliche Belastung des Behandlungspersonals dar, sondern auch ein gesundheitliches Risiko für die PatientInnen. Dass es "zur Not" mit weniger Personal geht, birgt außerdem die Gefahr in sich, dass die Geschäftsführungen der Kliniken mangels Information glauben, dies ginge auf Dauer so und daran müsse nichts geändert werden und bei den beteiligten Beschäftigten der Ausnahme- zum nicht mehr strittigen oder thematisierten Dauer- oder Normalzustand wird.
Zu den von vielen in Krankenhäusern aber auch Medizinischen Versorgungszentren angestellten ÄrztInnen Arbeitsbelastungen und kritischen Situationen gehört der Mangel an für die gute Qualität der Behandlung notwendigem zusätzlichem insbesondere pflegerischen Personal. Dass trotzdem ein Teil des Operationsbetriebs mit reduziertem Personal unverändert stattfindet, stellt nicht nur eine zusätzliche Belastung des Behandlungspersonals dar, sondern auch ein gesundheitliches Risiko für die PatientInnen. Dass es "zur Not" mit weniger Personal geht, birgt außerdem die Gefahr in sich, dass die Geschäftsführungen der Kliniken mangels Information glauben, dies ginge auf Dauer so und daran müsse nichts geändert werden und bei den beteiligten Beschäftigten der Ausnahme- zum nicht mehr strittigen oder thematisierten Dauer- oder Normalzustand wird.
Anhand eines "Fall des Monats Dezember 2018" von eskalierendem Anästhesie-Pflegemangel des Bundesverbands Deutscher Anästhesisten, der das "Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Sicherheit am Beispiel einer chronischen Unterbesetzung des Anästhesiepflegepersonals thematisiert", weisen die Autoren auf zwei schon etwas ältere, gleichwohl rechtskräftige Urteile hin, die an handfesten arbeitsvertraglichen und -rechtlichen Streitfällen, verdeutlichen was der immer wieder beschworene Vorrang von Patientensicherheit gegenüber Wirtschaftlichkeitserwägungen im Ernstfall konkret bedeutet.
Das Arbeitsgericht Wilhelmshaven hatte bereits 2004 darüber zu urteilen, ob ein Chefarzt bzw. ein leitender Arzt einer Anästhesieabteilung einen Anspruch auf eine Mindestzahl von Assistenzärzten hat und sein Arbeitgeber, ein Krankenhaus, diesem materiell gerecht werden muss und dies notfalls per Klage durchsetzen muss
In einer Zusammenfassung des Urteils heißt es: "Der Chefarzt war der Auffassung, dass das Krankenhaus verpflichtet sei, so viele Assistenzärzte zu beschäftigen, dass die tariflichen und gesetzlichen Arbeitszeitvorgaben eingehalten werden können. Ohne eine Mindestanzahl von Assistenzärzten sei die Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllbar, weshalb ein einklagbarer Anspruch auf die erforderlichen personellen Mittel bestehe. Er beantragte daher vor dem Arbeitsgericht Wilhelmshaven das Krankenhaus zu verurteilen, die mindestens erforderlichen Assistenzärzte zur Verfügung zu stellen. Hilfsweise für den Fall des Unterliegens beantragte er ihn aus der Verantwortung des Arbeitsvertrages zu entlassen sowie die Bestellung zum Arbeitszeitbeauftragten aufzuheben."
Im Urteil wird diese Auffassung des klagenden Chefarztes folgendermaßen unterstützt: ""Kann ein Arbeitnehmer seine vertragsgemäße Arbeit nur zusammen mit anderen Arbeitnehmern oder mit deren Mithilfe ausüben, muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass diese anderen Personen zur Verfügung stehen. So ist es selbstverständlich, dass dort, wo aus Sicherheitsgründen mindestens zwei Arbeitnehmer zusammenarbeiten müssen, die Verpflichtung des Arbeitgebers besteht, das Vorhandensein des erforderlichen zweiten Arbeitnehmers zu garantieren."
Das Argument des beklagten Krankenhauses, der klagende Chefarzt greife mit seiner Klage in die Entscheidungen des Krankenhauses als Arbeitgeber und Unternehmen ein, ließ das Gericht nicht gelten und gab dem Kläger uneingeschränkt recht.
Das Urteil des Arbeitsgericht Wilhelmshaven vom 23.09.2004 - Az.: 2 Ca 212/04) ist in einer sehr schlechten PDF-Qualität komplett zu erhalten.
2013 spielte die Unterausstattung mit Personal auch in einem vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg gelandeten Fall eine wichtige Rolle. Hier hatte ein leitender Krankenhausarzt praktisch die "Handbremse" gezogen und sein Arbeitsverhältnis wegen der Personalunterbesetzung außerordentlich gekündigt. Da der frühere Arbeitgeber dies für nicht gerechtfertigt hielt und auch auf die nachteiligenb Folgen für sich hinwies, kam es zum Rechtsstreit.
Das Gericht stellte als erstes fest: "a) Nach § 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer es dem Kündigenden bei Berücksichtigung aller Umstände und der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist aufrechtzuerhalten".
Konkret bedeutet dies nach Meinung des LAG: "Die außerordentliche Eigenkündigung eines leitenden Krankenhausarztes kann begründet sein, wenn ihm der Krankenhausträger entgegen seinen vertraglichen Verpflichtungen trotz Abmahnung kein ausreichendes nichtärztliches Personal zur Verfügung stellt. b) Das wiederholte vertragswidrige Vorenthalten von Personal kann in einem Arbeitsverhältnis wie dem Vorliegenden grundsätzlich dessen außerordentliche Kündigung begründen, weil die Vertragsbeziehungen massiv gestört werden. Mit der unzureichenden Personalausstattung wird zunächst die vertragsgemäße Beschäftigung des Arztes in Frage gestellt. Das berührt ihn nicht nur in seiner Vertragsposition als Gläubiger des Beschäftigungsanspruchs. Es berührt ihn auch in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, hier in Erscheinung des Rechts auf berufliche Entfaltung seiner Persönlichkeit (vgl. BAG GS, Beschluss vom 27.02.1985, GS 1/84, AP Nr. 14 zu § 611 BGB Beschäftigungspflicht Bl. 7 f.). Zudem wirkt sich eine unzureichende Personalausstattung - hier - unmittelbar auf die Vergütung des Arztes aus. Der Operationsbetrieb muss eingeschränkt werden, sowohl die erlösabhängigen Zusatzentgelte als auch die Einkünfte aus der Nebentätigkeit mindern sich. Schließlich leidet der Ruf als zuverlässiger Arzt, wenn dieser gezwungen ist, bereits vereinbarte Operationstermine kurzfristig zu verlegen. Diese erheblichen Vertragsstörungen können an sich die außerordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses begründen."
"Angesichts dieser Pflichtverletzungen bestand für den Beklagten gem. § 626 Abs. 1 BGB ein wichtiger Grund, das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin außerordentlich zu kündigen. Es gelten dieselben Grundsätze wie bei einer außerordentlichen Kündigung des Arbeitgebers (vgl. BAG, Urteil vom 12.03.2009, 2 AZR 894/07, NZA 2009, 840, Rn. 14)."
Das Urteil vom 11.10.2013 - 12 Sa 15/13 ist komplett und gut lesbar zu erhalten.
Bernard Braun, 7.4.19
Gesundheitslegenden - Der Fall "Kochsalzreduktion"
 Ein Teil der Empfehlungen zu Dingen und Verhaltensweisen, die angeblich einen hohen präventiven oder kurativen Nutzen für die Gesundheit vieler Menschen haben oder dieser und diesen schaden, sind derartig plausibel, dass es relativ lange braucht bis sich Studien um sie kümmern. Dazu gehören etwa viele Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, das tägliche Gläschen Rotwein, die tägliche Einnahme einer oder auch mehrerer Aspirintabletten aber auch das Ersetzen von Butter durch Margarine oder die Reduktion von Kochsalz.
Ein Teil der Empfehlungen zu Dingen und Verhaltensweisen, die angeblich einen hohen präventiven oder kurativen Nutzen für die Gesundheit vieler Menschen haben oder dieser und diesen schaden, sind derartig plausibel, dass es relativ lange braucht bis sich Studien um sie kümmern. Dazu gehören etwa viele Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, das tägliche Gläschen Rotwein, die tägliche Einnahme einer oder auch mehrerer Aspirintabletten aber auch das Ersetzen von Butter durch Margarine oder die Reduktion von Kochsalz.
Das jüngste Beispiel dafür was dann bei gründlicher Überprüfung herauskommen kann, ist ein systematischer Review von neun randomisierten kontrollierten Studien an denen 479 PatientInnen mit Herzschwäche teilgenommen hatten, welcher der Frage nachging, ob die Reduktion oder gar der Verzicht auf Salz PatientInnen mit Herzschwäche gesundheitlich nutzt oder nicht.
Die am 5. November 2018 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlichte Studie "found no clinically relevant data on whether reduced dietary salt intake affected outcomes such as cardiovascular associated or all-cause mortality, cardiovascular-associated events, hospitalization, or length of hospital stay." In drei Studien mit ambulant behandelten PatientInnen, die weniger Salz zu sich nahmen, fanden sich allerdings Verbesserungen einiger klinischer Werte und Symptome.
Alles in Allem existiert also Unsicherheit über die Robustheit und Evidenz der weit verbreiteten Ratschläge an PatientInnen mit Herzproblemen, ihre gesundheitlichen Risiken durch die Reduktion von Salz zu reduzieren.
Der renommierte Kardiologe Harlan Krumholz (u.a. Editor für kardiologische Studien in der Zeitschrift "New England Journal of Medicine") bewertet die Studie als "an important study for what it doesn't find, which is a lack of evidence to support salt restriction. For all the burden we have imposed on patients with this strategy, it turns out we have too little evidence to support the practice."
Sie ist ein guter Beleg dafür, dass der oft gehörte praktisch gemeinte Rat, doch nicht zu jeder Diagnostik oder Therapie eine aufwändige randomisierte kontrollierte Studie oder einen systematischen Review durchzuführen, die Fortexistenz von gesundheitlich unwirksamen Legenden oder Patentrezepten und mehr oder weniger große Einschränkungen des täglichen Lebens und der Lebensqualität von vielen PatientInnen bedeuten kann.
Diese Ergebnisse bedeuten nicht, dass sowohl PatientInnen mit Herzschwäche als auch Personen, die "nur" einen erhöhten Blutdruck haben, jetzt sorglos den Salzstreuer schütteln können oder sollten. Sie sollten aber weder vom Verzicht auf Salz noch vom Weitersalzen allein bedeutende positive oder negative gesundheitliche Wirkungen erwarten. Trotzdem sollten sich Liebhaber gewürzter Speisen nicht von der Suche nach geschmacklich besseren Würzalternativen abhalten lassen.
Die Studie Reduced Salt Intake for Heart Failure von K. Mahtani et al. ist am 5.11.2018 in der Onlineausgabe der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.11.18
Weltweite Über- und Fehlversorgung von stationär behandelten Kindern mit Antibiotika zur Prophylaxe und nicht zur Behandlung
 Die ambulante Verschreibung von Antibiotika zur "Behandlung" meist viraler Infektionen der oberen Atemwege bei Kindern und Erwachsenen wird weltweit als wirkungslose Fehlversorgung, Verschwendung von Ressourcen und wegen der damit verbundenen Gefahr von Resistenzbildung kritisiert und mit vielfältigen Mitteln der Aufklärung von Ärzten und Patienten zu vermeiden versucht. Leider gibt es noch keinen durchschlagenden Erfolg.
Die ambulante Verschreibung von Antibiotika zur "Behandlung" meist viraler Infektionen der oberen Atemwege bei Kindern und Erwachsenen wird weltweit als wirkungslose Fehlversorgung, Verschwendung von Ressourcen und wegen der damit verbundenen Gefahr von Resistenzbildung kritisiert und mit vielfältigen Mitteln der Aufklärung von Ärzten und Patienten zu vermeiden versucht. Leider gibt es noch keinen durchschlagenden Erfolg.
Ein jetzt veröffentlichter Report über die Verordnung von Antibiotika für 6.818 von 17.693 Kindern in 226 pädiatrischen Klinikstationen in weltweit 41 Ländern an einem Stichtag im Jahr 2012 liefert ein noch problematischeres Bild:
• Es gab insgesamt 11.899 Verordnungen von Antibiotika.
• 28,6 % dieser Verordnungen erfolgten prophylaktisch. Dies bedeutet, dass von den stationär behandelten Kindern, die wenigstens eine Antibiotika-Verordnung erhielten, 32,9% (2.242 Kinder) Antibiotika erhielten, um eine potenzielle Infektion zu verhindern und nicht zur Behandlung einer vorhandenen Infektion.
• 26,6% aller dieser prophylaktisch verordneten Antibiotika wurden verordnet, um mit einer bevorstehenden Operation assoziierte mögliche Infektionen zu verhindern. Von diesen PatientInnen erhielten rund Dreiviertel das Antibiotikum länger als einen Tag. Die restlichen 73,4% wurden prophylaktisch gegen andere Typen einer möglichen Infektion verordnet.
• Auch im Krankenhaus war die Mehrheit der prophylaktisch verordneten Antibiotika (51,8%) Breitband-Antibiotika, was die Gefahr von damit bewirkten Mehrfachresistenzen erhöht.
• In 36,7% der Verordnungen wurden offensichtlich "für alle Fälle" gleichzeitig zwei oder mehr systemisch wirkende Antibiotika verordnet.
Die Vorschläge diese Verordnungspraxis durch mehr Aufklärung der verordnenden Ärzte über zum größten Teil vorhandene Behandlungs-Leitlinien und die stärkere Kontrolle der Umsetzung dieser Leitlinien zu verändern, wirken angesichts der eigentlich jedem Arzt bekannten Problematik einer derartigen Verordnungspraxis ziemlich hilflos.
Der Aufsatz High Rates of Prescribing Antimicrobials for Prophylaxis in Children and Neonates: Results From the Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children Point Prevalence Survey. von Markus Hufnagel et al. ist am 22. März 2018 in der Fachzeitschrift "Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society" veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.3.18
Digitale rektale Prostata-Untersuchung wegen Risiko von Über-/Fehldiagnostik nicht empfehlenswert, nur was sind die Alternativen?
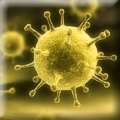 Die als "unangenehm" empfundene Untersuchung der Prostata mittels des in den After eingeführten Fingers des Urologen als Bestandteil der Früherkennungsuntersuchung auf ein Prostatakarzinom hindert wahrscheinlich Millionen von Männern, das Früherkennungsangebot in Anspruch zu nehmen. Viele Männer dürften aber auch versuchen, ihre Prostatagesundheit lediglich durch den via Blutprobe ermittelbaren PSA-Wert (Bestimmung eines prostataspezifischen Antigens) bestimmen zu lassen - selbst wenn sie von den Schwächen der Prädiktivität dieses Wertes schon einmal gehört haben. Hauptsache nicht "diese Untersuchung".
Die als "unangenehm" empfundene Untersuchung der Prostata mittels des in den After eingeführten Fingers des Urologen als Bestandteil der Früherkennungsuntersuchung auf ein Prostatakarzinom hindert wahrscheinlich Millionen von Männern, das Früherkennungsangebot in Anspruch zu nehmen. Viele Männer dürften aber auch versuchen, ihre Prostatagesundheit lediglich durch den via Blutprobe ermittelbaren PSA-Wert (Bestimmung eines prostataspezifischen Antigens) bestimmen zu lassen - selbst wenn sie von den Schwächen der Prädiktivität dieses Wertes schon einmal gehört haben. Hauptsache nicht "diese Untersuchung".
Nach der aktuellen Veröffentlichung einer Metaanalyse von 7 Studien (aus 8.217 themenbezogenen Studien) mit 9.142 Teilnehmern, die sowohl eine "digital rectal examination (DRE)" bei einem Primärarzt als auch in deren Folge eine Biopsie ihrer Prostata hinter sich haben, ergibt sich folgendes Bild:
• Die zusammengefasste Sensitivität betrug 0,51, d.h. nur 51% der tatsächlich erkrankten Personen werden durch die DRE-Untersuchung erkannt.
• Die zusammengefasste Spezifität der DRE betrug 0,59, d.h. es wurden 59% der tatsächlich gesunden Personen als solche identifiziert. In diesem Fall werden also gesunde Personen z.B. weiter mittels der invasiven Biopsie untersucht, also ohne Not psychisch belastet und den zahlreichen Risiken der Gewebeentnahme (z.B. Inkontinenz, erektile Dysfunktion) ausgesetzt.
• Der für die Leistungsfähigkeit von Tests wie der DRE berechenbare positive oder negative prädiktive Wert betrug 0,41 bzw. 0,64 - beides relativ geringe Werte.
• Die Qualität der Evidenz in den berücksichtigten Studien ist sehr gering.
Wegen der drohenden Über- oder Fehldiagnostik kommen die AutorInnen zu folgendem Schluss: "we do not recommend routine screening for prostate cancer using DRE in primary care, so as to minimize unnecessary diagnostic testing, overdiagnosis, and overtreatment."
Auch wenn damit die DRE als Screeninguntersuchung ausscheidet oder vermieden werden sollte, bleibt die Frage wie Männer sich angesichts regelmäßiger Berichte über Prostatakarzinome zu einem frühstmöglichen Zeitpunkt vergewissern können, ob ihre Prostata noch gesund ist oder nicht.
Der Aufsatz Digital Rectal Examination for Prostate Cancer Screening in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis von Leen Naji et al. ist im März 2018 in der Fachzeitschrift "Annals of Family Medicine" (vol. 16 no. 2: 149-154) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.3.18
Patientensicherheit leichter gemacht - "Papers of the Month" der Stiftung "Patientensicherheit Schweiz"
 Wer möglichst unaufwändig, in knapper verständlicher Form aber wissenschaftlich gesichert etwas darüber erfahren will, wie man die Polypharmazie von Pflegeheim-BewohnerInnen ohne negative gesundheitliche Folgen erheblich senken kann und welchen Aufwand es dafür bedarf oder warum die Reaktionszeiten auf physiologische Monitoralarme so lang sind (z.B.: "Besonders interessant ist, dass sich die Reaktionszeit erheblich (um 15%) verlängerte mit jeder Stunde, die die Pflegefachperson bereits im Dienst war (6.1 Min in der zweiten Dienststunde vs. 14.1 Min in der achten Dienst-stunde)), findet darauf und auf noch zahlreiche weitere Fragen zur Patientensicherheit auf der Website "Paper of the Month" der Stiftung "Patientensicherheit Schweiz" Antworten.
Wer möglichst unaufwändig, in knapper verständlicher Form aber wissenschaftlich gesichert etwas darüber erfahren will, wie man die Polypharmazie von Pflegeheim-BewohnerInnen ohne negative gesundheitliche Folgen erheblich senken kann und welchen Aufwand es dafür bedarf oder warum die Reaktionszeiten auf physiologische Monitoralarme so lang sind (z.B.: "Besonders interessant ist, dass sich die Reaktionszeit erheblich (um 15%) verlängerte mit jeder Stunde, die die Pflegefachperson bereits im Dienst war (6.1 Min in der zweiten Dienststunde vs. 14.1 Min in der achten Dienst-stunde)), findet darauf und auf noch zahlreiche weitere Fragen zur Patientensicherheit auf der Website "Paper of the Month" der Stiftung "Patientensicherheit Schweiz" Antworten.
Das Ziel ihrer Initiative beschreiben die Macher so: "Mit dem «Paper of the Month» möchten wir diejenigen Personen ansprechen, die einerseits bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen up-to-date sein möchten, andererseits nicht über die Ressourcen verfügen, das gesamte Feld zu beobachten. Rund alle vier Wochen stellen wir eine aktuelle wissenschaftliche Studie zur Patientensicherheit und ihre Kernergebnisse vor. Dafür wählen wir internationale Studien aus, die einerseits eine hohe Qualität aufweisen und die wir andererseits subjektiv als wichtig beurteilen."
Bis März 2018 liegen 72 Papers vor, die jeweils auf einer Seite in deutscher oder französischer Sprache die Ergebnisse von überwiegend englischsprachigen Originalaufsätzen in Fachjournalen zusammenfassen und auch Links auf die Originalpublikationen enthalten.
Der Zugang zu den Papers of the Month ist kostenlos.
Im Bereich Wissenschaftliche Publikationen finden sich außerdem noch eine Vielzahl von Fachpublikationen, die nicht nur für schweizerische GesundheitspraktikerInnen und -.wissenschaftlerInnen interessant sind.
Bernard Braun, 10.3.18
Erwünschte und unerwünschte Effekte eines Anreizes zur Reduktion der Wiedereinweisungen in Krankenhäusern
 Zu den wenig bekannten Inhalten des "Patient Protection and Affordable Car Act" oder Obamacare aus dem Jahr 2010 gehören finanzielle Anreize für Krankenhäuser bei PatientInnen, die in der steuerfinanzierten Krankenversicherung für ältere Personen, Medicare, versichert sind, die Häufigkeit von Wiedereinweisungen zu vermeiden - das so genannte "Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP)".
Zu den wenig bekannten Inhalten des "Patient Protection and Affordable Car Act" oder Obamacare aus dem Jahr 2010 gehören finanzielle Anreize für Krankenhäuser bei PatientInnen, die in der steuerfinanzierten Krankenversicherung für ältere Personen, Medicare, versichert sind, die Häufigkeit von Wiedereinweisungen zu vermeiden - das so genannte "Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP)".
Gelingt ihnen dies nicht bzw. können sie nicht nachweisen, dass der weitere stationäre Aufenthalt nichts mit Komplikationen beim ersten Aufenthalt zu tun hat, wird der zweite Aufenthalt nur zu einem geringen Teil bezahlt.
Der erwünschte Effekt trat auch ein. Ob es auch wie bei den meisten komplexen Interventionen im Gesundheits- aber auch anderen sozialen Bereichen, unbeabsichtigt unerwünschte Effekte gab, sollten mehrere Untersuchungen feststellen.
Eine gerade veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der UCLA und der Harvard Universität mit den zwischen 2006 (also die Zeit vor Obamacare) und 2014 erhobenen Daten von 115.245 an einem Herzfehler leidenden Medicare-PatientInnen an 416 Krankenhäusern zeigt zweierlei:
— Nach der Implementation des Reduktionsprogramms sank sowohl die Häufigkeit der Wiedereinweisung 30 Tage nach Entlassung als auch die nach einem Jahr signifikant.
— Gleichzeitig stieg aber unter diesen PatientInnen wider Erwarten und gegen die jahrzehntelange Abnahme der Sterblichkeit wegen Herzschwäche die Sterblichkeit signifikant an.
— Beide Trends bleiben auch nach umfangreichen Adjustierungen z.B. nach Ethnie oder Erkrankungsschwere bestehen. Ob es derartige Effekte auch bei PatientInnen mit anderen Erkrankungen gibt, ist noch nicht untersucht, aber durchaus möglich.
Die AutorInnen vermuten, dass viele Krankenhäuser es geschafft haben, das "game" des HRRP mitzuspielen und z.B. durch verzögerte Aufnahmen oder Verlegungen innerhalb und außerhalb der Klinik (Intensivstation, Hospiz) versuchen, den Strafzahlungen des HRRP zu entgehen. Die Anreize des Gesetzes seien zu stark oder ausschließlich auf Kostenreduktion durch Vermeidung von Wiederaufnahmen gerichtet und berücksichtigten zu wenig oder gar nicht eine Verbesserung der Behandlungsqualität und der Outcomes für diese Patientengruppe.
Der Anreiz könne daher durchaus zum folgenden zynischen Schluss führen: "If a patient dies, then that patient cannot be readmitted."
Sollten sich die Ergebnisse dieser Studie in weiteren Untersuchungen bestätigen, müsse der Ansatz des HRRP deutlich verändert werden. Untersucht wird aber auch noch, ob die unerwünschten Auswirkungen auf die Sterblichkeit eventuell nur in bestimmten Krankenhaustypen auftreten - wofür allerdings bisher wenig spricht.
Die Studie Association of the Hospital Readmissions Reduction Program Implementation With Readmission and Mortality Outcomes in Heart Failure von Adrian F. Hernandez, Eric D. Peterson, Roland A. Matsouaka, Clyde W. Yancy, Gregg C. Fonarow ist online am 12. November 2017 in der Fachzeitschrift "JAMA Cardiology" erschienen und kostenlos erhältlich.
Aktueller Nachtrag: Nachtrag: Am 2. August 2017 veröffentlichte die Kaiser Family Foundation unter der Überschrift Medicare's Readmission Penalties Hit New High die folgenden Daten über Strafzahlungen bzw. Abzüge bei der Honorierung von stationären Leistungen für sechs Erkrankungen (darunter die Herzinsuffizienz): 2.597 Krankenhäusern, dies sind rund 50% aller Krankenhäuser in den USA, wurde wegen zu häufiger Wiedereinweisungen 528 Millionen US-Dollar nicht bezahlt. Der im Gesetz vorgesehene Maximalabzug vom Gesamthonorar in Höhe von 3% erfolgte bei 49 Kliniken. In den letzten 5 Jahren wurden 1.621 Kliniken jedes Jahr für zu hohe Wiedereinweisungsraten bestraft.
Bernard Braun, 15.11.17
Mehr Stillstand und Rück- statt Fortschritt - Aktuelle Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel
 "Seit 2011 werden neu in den Markt eingeführte Medikamente oder bereits etablierte Arzneien mit erweitertem Indikationseinsatz einer sogenannten "frühen Nutzenbewertung" durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) unterzogen. Gesetzliche Basis ist das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG). Es hinterfragt, ob ein neues Medikament gegenüber bereits verfügbaren Präparaten einen Zusatznutzen aufweist. Es geht dabei nicht um die Qualität, Wirksamkeit oder Sicherheit einer neuen Therapie. Dies wurde bereits vor der Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft. Die Ergebnisse dieser Bewertung dienen vielmehr den Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem GKV-Spitzenverband." Soweit die Zusammenfassung dessen was Gegenstand einer umfassenden Analyse der Ergebnisse aller AMNOG-Verfahren von 2011 bis 2016 durch eine Ad-hoc-Kommission (20 Mitglieder aus verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften) der "Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e.V." war, die im Mai 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
"Seit 2011 werden neu in den Markt eingeführte Medikamente oder bereits etablierte Arzneien mit erweitertem Indikationseinsatz einer sogenannten "frühen Nutzenbewertung" durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) unterzogen. Gesetzliche Basis ist das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG). Es hinterfragt, ob ein neues Medikament gegenüber bereits verfügbaren Präparaten einen Zusatznutzen aufweist. Es geht dabei nicht um die Qualität, Wirksamkeit oder Sicherheit einer neuen Therapie. Dies wurde bereits vor der Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft. Die Ergebnisse dieser Bewertung dienen vielmehr den Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem GKV-Spitzenverband." Soweit die Zusammenfassung dessen was Gegenstand einer umfassenden Analyse der Ergebnisse aller AMNOG-Verfahren von 2011 bis 2016 durch eine Ad-hoc-Kommission (20 Mitglieder aus verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften) der "Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e.V." war, die im Mai 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Die Ergebnisse:
• Ende 2016 waren 224 Verfahren mit 469 ausgewerteten Subgruppen abgeschlossen.
• Bei 61,1% war der Zusatznutzen durch die u.a., von den Herstellern vorgelegten Unterlagen nicht belegt, bei 15,8% war der Zusatznutzen gering und bei 12,1% beträchtlich.
• Der Anteil von Verfahren deren Zusatznutzen nicht belegt war, schwankte zwischen 88% im Fachgebiet Diabetologie und 45% im Bereich Infektiologie.
• In Verfahren auf der Basis von nicht randomisierten klinischen Studien betrug der Anteil mit quantifizierbarem Zusatznutzen nur 12%.
• Der G-BA entscheidet nicht nur über den Zusatznutzen, sonderen berichtet auch die jeweilige Aussagesicherheit. Für 343 aller Subgruppen (73,1%) macht er keine Aussage, was überwiegend Arzneimittel ohne Zusatznutzen betrifft. Für 68 (14,5% gibt es für die Sicherheit der Aussage Anhaltspunkte, für 53 (11,3%) Hinweise und für lediglich 5 (1,1%) Belege. Auf die mit dieser Nichtfestlegung zur Aussagesicherheit verbundenen Probleme weist die AWMF-Kommission ausdrücklich hin: "Das ist kritisch, weil diese Festlegung auf einer sehr unterschiedlichen Studienlage basieren kann, vom Fehlen ausreichender Daten bis zum negativen Ergebnis in einer Metaanalyse. Die hohe Datenunsicherheit der frühen Nutzenbewertung zeigt sich auch darin, dass in der Hälfte der Subgruppen bei Neubewertungen eine andere Festlegung als im ersten Verfahren getroffen wurde."
• Schließlich kritisiert die AWMF, dass auch im AMNOG und folgerichtig bei den G-BA-Bewertungen Indikatoren des patientenbezogenen Outcomes (z.B. Schmerzen statt ausschließlich Morbidität im allgemeinen) weitgehend fehlen - ein weitverbreiteter Mangel bei den Endpunkten vieler Studien und Bewertungen von Behandlungsmethoden und -mittel.
Ob die offen geäußerte Befürchtung der AWMF, die dargestellten Entwicklungen würden "aktuell den langfristigen Wert des Verfahrens in Frage (stellen)", eintreten, hängt sicherlich auch von der öffentlichen Diskussion der Ergebnisse des AWMF-Berichts ab.
Die Ergebnisbroschüre Frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel in Deutschland 2011 - 2016. Analysen und Impulse. ist kostenlos erhältlich.
Ebenso das Positionspapier der Ad-hoc-Kommission Frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel 2017.
Bernard Braun, 25.5.17
Polypharmazie - Wie werden welche Krankenversicherten von wem und warum mit zu vielen Medikamenten versorgt?
 Seit mehreren wird international wie national über die gesundheitliche Bedeutung der so genannten Polypharmazie und die Notwendigkeit wie Möglichkeiten diskutiert sie einzuschränken oder abzubauen. Dabei stehen zweierlei Risiken der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - dies ist die am meisten verwendete Definition von Polypharmazie - im Vordergrund: Erstens nimmt die Wahrscheinlichkeit von oftmals unbekannten unerwünschten Wechselwirkungen mit der Anzahl von Arzneimitteln rasch zu und zweitens steigt das sowieso schon bei rund der Hälfte der verordneten Medikamente vorhandene Problem einer nicht korrekten Einnahme mit der Anzahl der einzunehmenden Medikamente kräftig an - mit ebenfalls möglichen zusätzlichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen.
Seit mehreren wird international wie national über die gesundheitliche Bedeutung der so genannten Polypharmazie und die Notwendigkeit wie Möglichkeiten diskutiert sie einzuschränken oder abzubauen. Dabei stehen zweierlei Risiken der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - dies ist die am meisten verwendete Definition von Polypharmazie - im Vordergrund: Erstens nimmt die Wahrscheinlichkeit von oftmals unbekannten unerwünschten Wechselwirkungen mit der Anzahl von Arzneimitteln rasch zu und zweitens steigt das sowieso schon bei rund der Hälfte der verordneten Medikamente vorhandene Problem einer nicht korrekten Einnahme mit der Anzahl der einzunehmenden Medikamente kräftig an - mit ebenfalls möglichen zusätzlichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen.
Wer hoffte, dass die Diskussion die Sensibilität für Polypharmazie mit praktischen Folgen erhöht und ihre Häufigkeit sich verringert, wird durch die Ergebnisse aktueller Studie enttäuscht.
Was dies konkret heißt zeigt zuletzt eine im April 2017 veröffentlichte Studie über das Verordnungsgeschehen bei den Versicherten der Handelskrankenkasse Bremen (hkk), die im Jahr 2015 ganzjährig versichert waren und mindestens ein Medikament verordnet bekamen. Analysiert wurde, wie viele hkk-Versicherte fünf oder mehr pharmazeutisch unterschiedliche Medikamente gleichzeitig verordnet bekamen. Auch in dieser Studie konnte nicht ermittelt werden, wie viel weitere oft stark wirksame Arzneimittel sich die untersuchten Personen zusätzlich ohne Rezept in einer Apotheke gekauft haben, der Umfang und die Risiken von Polypharmazie also zum Teil noch beträchtlich ausgeprägter sein dürfte.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Von allen im Jahr 2015 durchgängig bei der hkk Versicherten waren 26,7 % von Polypharmazie betroffen. Von den Angehörigen der Verordnungspopulation, d.h. aller ganzjährig in der hkk versicherten Personen, die mindestens ein Arzneimittel verordnet bekamen, waren 2015 bei ganzjähriger Betrachtung 35 % von Polypharmazie betroffen. Bei den älteren Versicherten dieser Population ab 65 Jahren waren es 61,5 %.
• Bei quartalsweiser Betrachtung waren in jedem Quartal zwischen 15,6 % und 16,6 % aller Angehörigen der hkk-Verordnungspopulation von Polypharmazie betroffen. Dieser Wert schwankte bei den über 64-jährigen zwischen 33,1 % im zweiten und 34,4 % im vierten Quartal.
• Es gibt einen starken Zusammenhang von Polypharmazie und Polymorbidität. Klassifiziert man Versicherte mit jährlich mehr als 20 unterschiedlichen ambulant gestellten Diagnosen als multimorbide, waren dies 17,6 % aller medikamentös behandelten hkk-Versicherte.
• Ein alternder Organismus reagiert generell anders auf Medikamente als ein junger, was womöglich deren Wirksamkeit beeinflusst oder die Gefahr für Neben- und Wechselwirkungen erhöht. Verschärft werden diese Risiken, weil besonders ältere Menschen oft an mehreren Erkrankungen gleichzeitig leiden und entsprechend viele Medikamente benötigen. Als Anhaltspunkt für eine möglichst sichere Arzneimitteltherapie im Alter haben Experten in verschiedenen Ländern Listen mit "potenziell inadäquaten Medikamenten (PIM)" zusammengestellt. Das Ergebnis der deutschen Untersuchung, die finale so genannte Priscus-Liste, umfasst 83 Wirkstoffe, die als potenziell ungeeignet für älter Menschen gelten und 18 verschiedenen Arzneistoffklassen aus einem breiten Spektrum an Behandlungsgebieten entstammen (durchweg hoch wirksame und oft Abhängigkeit erzeugende Schlaf- und Beruhigungsmittel bzw. Neuroleptika). Im Jahr 2015 erhielten 18,6 % der über 64-jährigen hkk-Versicherten, die in diesem Jahr wenigstens ein Medikament verordnet bekamen, mindestens ein nach der PRISCUS-Liste potenziell inadäquates, d.h. ein möglicherweise gesundheitlich riskantes Arzneimittel oder einen derartigen Wirkstoff.
• Ein grober Vergleich mit einer ähnlichen Analyse von Polypharmazie bei den Versicherten der hkk im Jahr 2010, bestätigt den Eindruck, dass sich an der Häufigkeit von Polypharmazie prinzipiell nichts geändert hat.
Die bisher erprobten Strategien und Instrumente zur Beeinflussung von Polypharmazie haben oft gar keine oder nicht die erhoffte Wirkung. Das Hoffen auf die eine Patentlösung sollte daher aufgegeben werden und durch einen mehrdimensionalen Ansatz ersetzt werden.
Dieser sollte mindestens drei Handlungsebenen oder Ansatzpunkte umfassen:
• An die Stelle der weit verbreiteten Behandlungsform von Multimorbidität jede einzelne Erkrankung auf der Basis krankheitsspezifischer evidenzbasierter Leitlinien optimal oder maximal zu behandeln führt in bester Absicht gerade bei älteren Patienten zu Polypharmazie. Um dieses Dilemma zu vermeiden braucht es ebenfalls evidenzbasierte Leitlinien für die Behandlung von Multimorbidität für Ärzte und PatientInnen.
• Die Absicht, Art und Umfang von Polypharmazie zu beeinflussen erfordert eine kontinuierliche, systematische und verständliche Information von Ärzten und polypharmazeutisch behandelte PatientInnen. Dies kann in gesonderten Beratungsgesprächen für PatientInnen durch die verordnenden Ärzte erfolgen. Als aktueller Anlass bietet sich die gesetzlich seit Oktober 2016 vorgeschriebene Aushändigung eines schriftlichen Medikationsplans für alle PatientInnen mit mindestens drei verordneten Arzneimitteln an. Hier bietet sich auch die Möglichkeit an, mehr über den Erwerb und die Einnahme von OTC-Medikamenten zu erfahren und damit noch ein Stück näher an die Realität von Polypharmazie heranzukommen.
• Im Rahmen des ebenfalls für gesetzliche Krankenkassen gesetzlich verpflichtenden Versorgungsmanagement sollte eine regelmäßige Berichterstattung über den Umfang und die Art der Arzneimittelverordnungen mit dem Schwerpunkt Polypharmazie auf dem Hintergrund der Informationen der Krankenkassen über ambulante und stationäre Diagnosen, Ärzte und Krankenhausaufenthalte stattfinden.
Der 47-seitige hkk-Gesundheitsreport 2017 Polypharmazie. Eine Analyse mit hkk-Routinedaten des Bremer Gesundheitswissenschaftlers Bernard Braun ist kostenlos erhältlich. Zusätzlich zu den Auswertungen des Verordnbungsgeschehens enthält der Report kurze Überblicke über andere Studien zur Polypharmazie und zur Literatur über die Art und Wirksamkeit von Strategien und Maßnahmen zur Reduktion von Polypharmazie.
Bernard Braun, 16.5.17
Welche Erwartungen haben Ärzte zum Nutzen und zu Nachteilen von Screenings, Behandlungen und Tests und sind sie korrekt? Oft nicht
 Bei Entscheidungen von Ärzten über die Diagnostik und Behandlung von PatientInnen spielen u.a. auch ihre Erwartungen zu deren möglichem Nutzen und Nachteilen oder unerwünschten Wirkungen eine wichtige Rolle. Wie viel der Ärzte aber welche Erwartungen haben und daraus möglicherweise praktische Handlungsschritte ableiten, war bisher nicht klar.
Bei Entscheidungen von Ärzten über die Diagnostik und Behandlung von PatientInnen spielen u.a. auch ihre Erwartungen zu deren möglichem Nutzen und Nachteilen oder unerwünschten Wirkungen eine wichtige Rolle. Wie viel der Ärzte aber welche Erwartungen haben und daraus möglicherweise praktische Handlungsschritte ableiten, war bisher nicht klar.
Dies ändern jetzt die Ergebnisse eines systematischen Reviews von 48 Studien, an denen 13.011 überwiegend us-amerikanische ÄrztInnen beteiligt waren, erheblich.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• 20 der 48 Studien konzentrierten sich auf Behandlungen, 8 auf Screening, und weitere 20 auf bildgebende Diagnostik.
• 67% der Studien bewerteten ausschließlich Erwartungen von Nachteilen, 20% Erwartungen von Nutzen und 13% Erwartungen von Nutzen und Nachteilen.
• In den Studien, welche die Häufigkeit der Erwartungen von Nutzen mit der aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht korrekten Antwort verglichen, lieferten die meisten der StudienteilnehmerInnen nur bei 3 von 28 untersuchten Behandlungen, Tests etc. (11%) eine korrekte Bewertung oder Einschätzung.
• Beim Vergleich der Erwartung von unerwünschten Wirkungen der befragten Ärzte bei 69 Outcomes mit den korrekten Antworten bewertete die Mehrheit der Ärzte nur bei 9 (13%) der Outcomes die nachteilige Wirkung korrekt.
• Alles in allem überschätzten die ÄrztInnen den Nutzen von 32% näher betrachteten Maßnahmen und unterschätzten den Nutzen bei 9% dieser Maßnahmen. Genau umgekehrt sah es bei erwarteten Nachteilen aus: Bei 34% der dazu untersuchten Maßnahmen unterschätzten die Ärzte die Nachteile und überschätzten den Nachteil bei 5% der Tests etc.
Die australischen Wissenschaftler fassen diese Ergebnisse so zusammen: "Clinicians rarely had accurate expectations of benefits or harms, with inaccuracies in both directions. However, clinicians more often underestimated rather than overestimated harms and overestimated rather than underestimated benefits. Inaccurate perceptions about the benefits and harms of interventions are likely to result in suboptimal clinical management choices."
Der in der programmatischen Rubrik "Less is more" im März 2017 veröffentlichte Aufsatz Clinicians' Expectations of the Benefits and Harms of Treatments, Screening, and Tests. A Systematic Review von Tammy C. Hoffmann und Chris Del Mar ist in der Fachzeitschrift "JAMA Intern Med." (2017;177(3):407-419) veröffentlicht worden und das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.5.17
CT, MRT oder doch lieber Ultraschall? Evidenzbasierte Entscheidungshilfe der "Library of Evidence" hilft
 Auch wenn sich mittlerweile bei vielen Ärzten und anderen Anvbietern gesundheitsbezogener Leistungen durchsetzt, Entscheidungen über diagnostische und therapeutische Maßnahmen möglichst evidenzbasiert zu treffen, ist die Erreichbarkeit solchen Wissens und dessen Verständlichkeit immer noch nicht einfach.
Auch wenn sich mittlerweile bei vielen Ärzten und anderen Anvbietern gesundheitsbezogener Leistungen durchsetzt, Entscheidungen über diagnostische und therapeutische Maßnahmen möglichst evidenzbasiert zu treffen, ist die Erreichbarkeit solchen Wissens und dessen Verständlichkeit immer noch nicht einfach.
Deshalb verspricht die im Januar 2017 richtig startende Initiative einer "Library of Evidence" der "Harvard Medical School" und einer Reihe anderer kompetenter us-amerikanischer Gesundheitsexperten sehr hilfreich zu sein.
Nach der Selbstdarstellung der Träger dieser Website bzw. Datenbank beruht ihre Initiative auf zwei hierzulande eher unbekannten US-Reformgesetzen, dem für die technische Infrastruktur wichtigen "Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH)" und dem für die Inhalte maßgebliche "Protecting Access to Medicare Act (PAMA)" vom 1. April 2014. PAMA schreibt den Anbietern von Gesundheitsleistungen vor, "clinical decision support" (CDS)-Systeme mit bewährten und qualitätsgesicherten Entscheidungskriterien zu nutzen. Die maßgeblichen Kriterien sollen sein "only developed or endorsed by national professional medical specialty societies or other provider-led entities, to assist ordering professionals and furnishing professionals in making the most appropriate treatment decision for a specific clinical condition for an individual. To the extent feasible, such criteria shall be evidence-based."
Nachdem die in der "Library of Evidence" enthaltenen Erkenntnisse in die klinikeigenen Informationssysteme eingebunden sind, erhält ein Arzt, der z.B. für einen Patienten mit Rückenschmerzen eine Computer-Tomographie verordnet den Alternativvorschlag samt Begründung für eine Ultraschalluntersuchung.
Beginnen soll diese evidenzbasierte Entscheidungsprozedur im Bereich der bildgebenden Diagnostik und peu à peu auf die Verordnung von Medikamenten, anderer Tests und Prozeduren ausgedehnt werden. Die gesetzliche Vorschrift sich dieser Art von evidenzbasierten "clinical decision supports" bedienen zu müssen, wird 2018 für den Bereich der Behandlung von Medicare-PatientInnen "scharfgeschaltet". Ab dann hängt die Bezahlung bestimmter Leistungen für Medicare-Versicherte durch ihre steuerfinanzierte Krankenversicherung davon ab, ob die Entscheidung unter CDS-Nutzung getroffen wurde.
Der Zugang zur "Library of Evidence" ist weltweit frei, wobei es sogar Möglichkeiten eines Feedbacks von ärztlichen NutzerInnen geben soll, die Library also nicht nur eine Datenbasis sein muss.
Wer bereits heute mehr über die Ziele, Rechtsgrundlagen, die Modalitäten des Zugangs, die Verantwortlichen oder Trainingsmaterialien wissen will, schafft dies über Harvard Medical School Library of Evidence. THE FUTURE OF CLINICAL DECISION SUPPORT CONTENT. Und ab dem 1. Januar 2017 hilft bei Entscheidungen im Bereich bildgebender Diagnostik sicherlich ein erneuter Blick oder die Anmeldung als NutzerIn.
Bernard Braun, 16.9.16
Und es geht doch schnell! Wie die Evidenz zur nicht notwendigen Entfernung bestimmter Lymphknoten bei Brustkrebs im OP ankommt.
 Zu den fast schon gebetsmühlenartigen Beobachtungen im Rahmen von Versorgungsforschung gehört, dass selbst vielfach in Studien oder Leitlinien als evident, nützlich und wirtschaftlich belegte Therapien noch längere Zeit nach ihrer Veröffentlichung gar nicht oder nur bei einer Minderheit der Ärzte angekommen sind.
Zu den fast schon gebetsmühlenartigen Beobachtungen im Rahmen von Versorgungsforschung gehört, dass selbst vielfach in Studien oder Leitlinien als evident, nützlich und wirtschaftlich belegte Therapien noch längere Zeit nach ihrer Veröffentlichung gar nicht oder nur bei einer Minderheit der Ärzte angekommen sind.
Dass dies auch anders und dazu noch schnell gehen kann, zeigt eine im Juliheft 2016 der Fachzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichte Studie zur operativen Entfernung von Lymphknoten in den Achselhöhlen von Brustkrebspatientinnen vor und nach einer bahnweisenden Studie.
Diese Operation gehörte lange Zeit trotz einer Reihe unerwünschter Folgeeffekte zur Standardtherapie bei Brustkrebs, sollte die weitere Verbreitung von Brustkrebs verhindern und das Risiko eines Rezidivs signifikant senken helfen.
In einer großen kontrollierten Studie zwischen 2004 und 2012 wurden 891 Brustkrebspatientinnen genauer untersucht, bei denen eine brusterhaltende Operation ("lumpectomy") samt postoperativer Bestrahlungstherapie durchgeführt wurde, die einen T1- oder T2-Tumor ("early stage tumor") mit weniger als 5 Zentimeter Durchmesser und einen oder zwei positiv getestete Lymphknoten hatten, aber vor der Operation nicht chemotherapeutisch behandelt wurden.
In dieser Studie erwies sich, dass die 5-Jahres-Überlebensraten bei den operierten und nichtoperierten Frauen nahezu identisch waren: 91,8% bei den Frauen mit Entfernung der Achsel-Lymphknoten und 92,5% bei den Frauen ohne Entfernung dieser Knoten - letztere auch noch ohne die genannten unerwünschten Folgewirkungen.
Diese Ergebnisse wurden 2010 und 2011 auf einer Onkologietagung und in einer us-amerikanischen Medizin-Fachzeitschrift veröffentlicht (Axillary Dissection vs No Axillary Dissection in Women With Invasive Breast Cancer and Sentinel Node Metastasis. A Randomized Clinical Trial von Armando E. Giuliano et al. in "JAMA" (2011;305(6):569-575) und komplett kostenlos erhältlich).
Für die Versorgungsstudie untersuchten nun Versorgungsforscher auf der Basis zweier Brustkrebsregister mit 22.571 PatientInnen, die den oben genannten Brustkrebscharakteristika entsprachen, ob und wie sich der Anteil der Patientinnen mit Lymphknotenentfernung zwischen 2008 (nach einem Maximalanteil von 64,3% operierter Patientinnen) und 2012, also von vor bis nach Bekanntheit des fehlenden Nutzens verändert hatte. Der Anteil fiel nach der Adjustierung nach weiteren Patientinnenmerkmalen von rund 62% um mehr als 50% oder 32,6 Prozentpunkte auf unter 30%.
Als Erklärung dieses fast sofort nach Bekanntwerden der Studienergebnisse erkennbaren praktischen Effekts einer wissenschaftlichen Erkenntnis, nannte der Hauptautor zweierlei: Erstens handle es sich um hochspezialisierte Chirurgen, die einen besseren Überblick zur Forschungslage in ihrem Fachbereich haben. Zweitens handle es sich bei Brustkrebspatientinnen (in den USA) im Vergleich zu anderen PatientInnen um sehr aktive und gut über die neueste Evidenz informierte Patientinnen: "This puts additional pressure on physicians to look at evidence."
Die Studie Contrary To Conventional Wisdom, Physicians Abandoned A Breast Cancer Treatment After A Trial Concluded It Was Ineffective von David H. Howard ist in "Health Affairs" (35, no.7 (2016):1309-1315) erschienen. Ein Abstract ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.7.16
Viel hilft viel - auch bei rezeptfreien Arzneimitteln nicht zu empfehlen, wie viel nicht schadet, kann aber reichlich unklar sein.
 Wer es nicht schon immer gewusst hat, dass rezeptfreie Arzneimittel nicht nur gegen Beschwerden wirksam sein können, sondern auch gravierende, ja lebensgefährliche Nebenwirkungen haben können, erfährt dies für ein häufig genutztes Mittel gegen Durchfall heute durch eine Warnmeldung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Sie hat darauf hingewiesen, dass eine Überdosierung des Wirkstoffs Loperamid zu schwerwiegenden Nebenwirkungen am Herzen führen kann.
Wer es nicht schon immer gewusst hat, dass rezeptfreie Arzneimittel nicht nur gegen Beschwerden wirksam sein können, sondern auch gravierende, ja lebensgefährliche Nebenwirkungen haben können, erfährt dies für ein häufig genutztes Mittel gegen Durchfall heute durch eine Warnmeldung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Sie hat darauf hingewiesen, dass eine Überdosierung des Wirkstoffs Loperamid zu schwerwiegenden Nebenwirkungen am Herzen führen kann.
Wie verbreitet der Wirkstoff seit langem ist, zeigt der folgende Auszug aus der Herstellerinformation eines loperamidhaltigen Markenmedikaments: "Loperamid ist in Deutschland schon seit 1976 unter IMODIUM® erhältlich und als IMODIUM® akut die Nummer 1 in der Selbstmedikation von akutem Durchfall."
Während auf derselben Website nur noch von vielen positiven Eigenschaften berichtet wird (Stand: 10. Juni 2016), äußert sich der AMK-Vorsitzende Martin Schulz unmissverständlich so: "Rezeptfrei heißt nicht harmlos: Wenn Loperamid missbräuchlich oder aus Versehen überdosiert wird, kann das lebensgefährlich sein".
Wie schwierig es aber auch bei solchen Medikamenten für PatientInnen ist, sich verlässliche Informationen zu verschaffen und sich vor Schäden zu bewahren, zeigt das Informationsgeschehen dieser Woche mehrfach.
• Erstens folgt die Meldung der AMK einer bereits am 7. Juni 2016 von der US-amerikanischen "Food and Drug Administration (FDA)" verbreiteten Meldung (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse). Dort wird zu der Menge des Wirkstoffs, die zu den gefährlichen Nebenwirkungen führen kann, folgendes gesagt: "The maximum approved daily dose for adults is 8 mg per day for OTC use and 16 mg per day for prescription use." Ergänzt wird diese Information noch durch deutliche Hinweise, Arzneimittel mit diesem Wirkstoff nicht länger als 2 Tage einzunehmen.
• Zweitens verbreitet eine Presseinformation der ABDA die Warnung der AMK am 10. Juni 2016 um 9.16 Uhr mit dem ausdrücklichen Hinweis, "die empfohlene Höchstdosis für Loperamid liegt für Erwachsene bei 16 Milligramm pro Tag". Da die "meisten Präparate ... 2 Milligramm pro Kapsel (enthalten)", "darf die Tageshöchstdosis von 8 Kapseln...nicht überschritten werden".
• Drittens meldet schließlich eine weitere ABDA-Presseinformation um 11.57 Uhr desselben Tages, dass in der ersten Meldung ein "Fehler unterlaufen" sei und die Tageshöchstdosis 12 Milligramm betrüge, was 6 Kapseln entspräche. Dies empfiehlt im Übrigen auch der Hersteller von Imodium selber auf seiner Website und wahrscheinlich auch schon längere Zeit im Beipackzettel.
Am Ende der informationsträchtigen Woche stellt sich also die Frage, ab welcher Menge des Wirkstoffs es denn jetzt für Erwachsene gefährlich werden kann: 8 mg oder 16 mg der FDA (diese Empfehlung gibt es offensichtlich auch schon länger, ohne dass selbst bei Lektüre der gesamten Information klar wird, warum 16 mg auf Rezept und mit verordnendem Arzt (?) keine gefährlichen Nebenwirkungen haben) oder doch lieber die fehlerfreien 12 mg der AMK bzw. des Herstellers? Und was, wenn die einzelne Kapsel oder Tablette mehr oder weniger als 2 mg Loperamid enthält - was man hoffentlich weiß und findet?
Und wenn sich offensichtlich im Moment verschiedene Experten nicht auf eine einfache mg-Höchstdosis einigen können, wirkt der zusätzliche Hinweis der AMK, "dass auch durch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln das Risiko für Nebenwirkungen von Loperamid steigt" und Personen, die z.B. Imodium einnehmen, "sollten in der Apotheke nach möglichen Wechselwirkungen fragen" nicht wirklich hilfreich. Es darf geraten werden: Auf wie viel Milligramm Loperamid muss man verzichten, um das genannte Risiko wieder zu senken und auf welches Niveau?
Klar ist also bei Reisedurchfall: so wenig wie möglich auch wenn trotz aller Informationsfülle nicht klar ist, was wenig ist und dies nicht länger als 48 Stunden ohne Arzt. Was zu tun ist, wenn kein gut informierter Arzt oder Apotheker in Reichweite des mit der Rache des Montezuma oder den Wirkungen sonstiger sommerlicher Salmonellenzuchtbasen (z.B. Tiramisu oder Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Ei) kämpfenden Reiseapotheken-Urlaubers ist, bleibt hier mal offen.
Die Größe des Risikos unerwünschter gesundheitlicher Wirkungen im Falle des Überschreitens einer der Höchstdosen sieht in den USA laut FDA so aus: Von 1976 bis 2015 wurden der FDA 48 Berichte über schwere, mit der Anwendung von Loperamid-assozierte Herzprobleme gemeldet. In 10 Fällen verstarben die Patienten. Der Anteil der geschädigten PatientInnen, die versehentlich eine zu hohe Dosis eingenommen hatten war sogar kleiner, da die FDA vermutet, dass Loperamid in einigen Fällen absichtlich in hohen Dosen konsumiert wurde, um Sucht-Entzugssymptome zu lindern oder Euphoriegefühle auszulösen.
Bernard Braun, 11.6.16
Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und deren Arbeitsbedingungen relevant für ungeplante Wiedereinweisung von Patienten
 Erneut (vgl. dazu auch schon eine Studie von L. Aiken et al.) bestätigt eine Analyse der Behandlungsdaten von 112.017 älteren erwachsenen Medicare-PatientInnen, die im Jahr 2006 in 495 Kliniken in Kalifornien, Florida, New Jersey und Pennsylvania künstliche Knie- oder Hüftgelenke implantiert bekamen, überwiegend signifikante Zusammenhänge des Risikos einer Wiedereinweisung wegen unerwünschter Folgewirkungen der Operation innerhalb von 10 oder 30 Tagen mit der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und der Qualität deren Arbeitsbedingungen.
Erneut (vgl. dazu auch schon eine Studie von L. Aiken et al.) bestätigt eine Analyse der Behandlungsdaten von 112.017 älteren erwachsenen Medicare-PatientInnen, die im Jahr 2006 in 495 Kliniken in Kalifornien, Florida, New Jersey und Pennsylvania künstliche Knie- oder Hüftgelenke implantiert bekamen, überwiegend signifikante Zusammenhänge des Risikos einer Wiedereinweisung wegen unerwünschter Folgewirkungen der Operation innerhalb von 10 oder 30 Tagen mit der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und der Qualität deren Arbeitsbedingungen.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• 5,64% aller PatientInnen mussten innerhalb von 30 Tagen ungeplant wegen Folgeproblemen erneut in einem Krankenhaus behandelt werden, mehr als die Häfte davon innerhalb von 10 Tagen. Die häufigsten Gründe waren postoperative Infektionen oder Osteoarthritis.
• Nach der Adjustierung nach Patienten- und Klinikmerkmalen erhöhte sich die Chance für eine Wiedereinweisung innerhalb von 30 Tagen statistisch signifikant um 8% (odds ratio 1,08) für jeden zusätzlichen Patienten pro Pflegekraft. Diese Chance betrug bei Patienten, die innerhalb von 10 Tagen wiedereingewiesen wurden, 12% (odds ratio 1,12).
• Wie bereits aus anderen Untersuchungen bekannt, wirkt sich aber nicht nur das quantitative Verhältnis von Patienten pro Pflegekraft auf unerwünschte Folgewirkungen einer Krankenhausbehandlung aus, sondern auch die Qualität der Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte. Wenn die mit dem Standardinstrumnent "Practice Environment Scale of the Nursing Work Index" gemessene Arbeitsqualität gut war, war die patienten- und klinikadjustierte Chance für eine Wiedereinweisung innerhalb von 30 Tagen um 12% (odds ratio 0,88) geringer als wenn sie von geringer Qualität war. Bei den Patienten, die innerhalb 10 Tagen ungeplant in stationärer Behandlung waren, war zwar die Chance bei guten Arbeitsbedingungen ebenfalls geringer, aber der Unterschied statistisch nicht signifikant. Die für die Qualität der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften wichtigsten Merkmale waren kollegiale Beziehungen zu Ärzten, Möglichkeiten autonomen Handelns und kompetente und wirksame Führungskräfte.
Der Aufsatz Nurse staffing and the work environment linked to readmissions among older adults following elective total hip and knee replacement von Karen B. Lasater und Matthew D. Mchugh ist zuerst online im "International Journal for Quality in Health Care" (2016, 28(2), 253-258) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.4.16
Gesundheits-Apps: ja, aber
 Im Moment dürfte kein Tag vergehen an dem nicht irgendeine neue gesundheitsbezogene Applikation oder App für den Gebrauch auf iOS- oder Android-Smartphones angeboten und in kürzester Zeit hunderttausend- wenn nicht sogar millionenfach installiert und gebraucht wird. Ein Teil von ihnen ist sicherlich für alle oder zumindest einen Teil der NutzerInnen nützlich, handhabbar (auch hier könnte mangelnde Health literacy aber eine hemmende Rolle spielen) sowie nachteils- oder schadensfrei. Trotzdem müssen die Hersteller dies nicht solide nachweisen und entsprechende Tests bereits in Gebrauch befindlicher Programme zur Messung zahlreicher Körperwerte, Haut- oder sonstigen Veränderungen, zurückgelegter Schritte etc. hinken der Anzahl dieser Apps und ihrer Nutzungsempirie weit hinterher.
Im Moment dürfte kein Tag vergehen an dem nicht irgendeine neue gesundheitsbezogene Applikation oder App für den Gebrauch auf iOS- oder Android-Smartphones angeboten und in kürzester Zeit hunderttausend- wenn nicht sogar millionenfach installiert und gebraucht wird. Ein Teil von ihnen ist sicherlich für alle oder zumindest einen Teil der NutzerInnen nützlich, handhabbar (auch hier könnte mangelnde Health literacy aber eine hemmende Rolle spielen) sowie nachteils- oder schadensfrei. Trotzdem müssen die Hersteller dies nicht solide nachweisen und entsprechende Tests bereits in Gebrauch befindlicher Programme zur Messung zahlreicher Körperwerte, Haut- oder sonstigen Veränderungen, zurückgelegter Schritte etc. hinken der Anzahl dieser Apps und ihrer Nutzungsempirie weit hinterher.
Dadurch wird sowohl die prinzipielle Problematik der massenhaften Anwendung vieler dieser Apps zu wenig debattiert als auch zu wenig untersucht, welche von ihnen völlig nutzlos sind, aber das Gegenteil suggerieren oder gravierende qualitative Mängel aufweisen.
Zu den prinzipiellen Problemen gehört die mit diesen Apps geförderte dauerhafte Selbstbeobachtung, die Konzentration auf messbare Körperwerte als verlässliche Indikatoren für Gesundheit und Krankheit und damit ein Rückfall in längst vergangen geglaubte Zeiten des Risikofaktoren-Reduktionismus und nicht zuletzt der Anreiz zur oder die Förderung des Zwangs permanenter Selbstoptimierung.
Zwei in den letzten Wochen veröffentlichten Studien zeigen, um welche Mängel es sich dabei handeln kann.
Eine Studie für den "Commonwealth Fund" untersuchte für 1.046 Apps mit dem Anspruch bzw. Nutzenversprechen, Patienten mit chronischen Erkrankungen beim Selbstmanagement ihrer Erkrankung zu unterstützen, ob diese das auch leisten. Das ernüchternde Ergebnis lautet, dass gerade mal 43 Prozent der iOS- und 27 Prozent der Android-Apps diesem Anspruch zu genügen scheinen ("appeared likely to be useful"). Dies bedeutet in anderen Worten, dass Patienten mit der Mehrheit beider Apps-Varianten entweder nichts anfangen können oder sogar falsche und möglicherweise gesundheitsgefährdende Schlüsse aus Outputs ihrer Apps ziehen. Die AutorInnen stellen außerdem Vorschläge zu den Kriterien für die Nützlichkeit/Tauglichkeit von Patienten-Apps vor.
Eine weitere Studie weist nicht nur die gesundheitsgefährdenden Ergebnisse einer App für die Blutdruckmessung nach, sondern auf ein brisantes Problem der Verbreitung fehlerhafter Apps hin.
Bei einem Vergleich der Blutdruckmesswerte der zwischen Juni 2014 und Juli 2015 rund 148.000 mal erworbenen iPhone-App "Instant Blood Pressuregroup (IBP)" mit traditionellen Messmethoden zeigte sich, dass IBP niedrige Werte über- und hohe Werte unterschätzte (die Differenz betrug beim systolischen Wert 12,4 mmHg und beim diastolischen Wert 10,1 mmHg). Dies führte dazu, dass 77,5 Prozent der Testpersonen mit hohem Blutdruck ein niedriger bzw. normaler Blutdruckwert vorgegaukelt wurde, und damit möglicherweise gesundheitsgefährdende Informationen.
Wie die Datumsangabe zeigt, hatte dies selbst der Hersteller gemerkt und die App vom Markt genommen. Das Problem ist freilich, dass theoretisch alle Käufer immer noch diese App nutzen und ihren Ergebnissen trauen könnten. Außerdem weisen die AutorInnen der Studie darauf hin, dass eine Reihe anderer Apps mit ähnlichen, wahrscheinlich fehlerproduzierenden Messmethoden immer noch angeboten, gekauft und eingesetzt werden - ohne dass für sie geprüft ist, ob sie nicht ähnliche Messfehler produzieren.
Ein Kommentator der Studie fordert daher auch eine Zertifizierungspflicht für sämtliche Apps oder andere Produkte, die vorgeben Patienten oder Gesunden Informationen über ihre Gesundheit zu geben.
Sofern man nicht der Ansicht ist, dass es sich um einmalige Ergebnisse oder die sprichwörtlichen "schwarze Schafe" handelt, ist systematische Skepsis gegenüber dem Nutzen und einem möglichen Schadenspotenzial weiterer zahlreich eingesetzten Apps angebracht und die Forderung nach Zertifizierung sinnvoll.
Die 12-seitige Studie Developing a Framework for Evaluating the Patient Engagement, Quality, and Safety of Mobile Health Applications von Karandeep Singh, Kaitlin Drouin, Lisa P. Newmark, Ronen Rozenblum, Jaeho Lee, Adam Landman, Erika Pabo, Elissa V. Klinger und David W. Bates ist im Februar 2016 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Der am 2. März 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" online first erschienene Forschungsbrief Validation of the Instant Blood Pressure Smartphone App von Timothy B. Plante, Bruno Urrea, Zane T. MacFarlane et al. ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.3.16
Soll die Flut der diagnostischen Tests staatlich reguliert werden? Eine Einführung in die Pro und Contra-Debatte in den USA
 Zum medizinisch-technischen Fortschritt wird u.a. die in den letzten Jahren rasch zunehmende Anzahl von diagnostischen Labortests gezählt, die von einfachen Bestimmungen von Körperwerten bis zu prädiktiven Tests für hochkomplexe Risikokonstellationen im menschlichen Körper reichen. Diese Tests werden zum Teil - so zumindest in den USA - sogar zum Selbsttest angeboten, dessen Ergebnisse der Nutzer bzw. Patient per Post an ein Labor schickt, das ihm dann auf demselben Weg auch die Ergebnisse über das Vorhandensein von Risiken oder Erkrankungen zusendet. Viele dieser Tests basieren auf Erkenntnissen der Genom-Medizin.
Zum medizinisch-technischen Fortschritt wird u.a. die in den letzten Jahren rasch zunehmende Anzahl von diagnostischen Labortests gezählt, die von einfachen Bestimmungen von Körperwerten bis zu prädiktiven Tests für hochkomplexe Risikokonstellationen im menschlichen Körper reichen. Diese Tests werden zum Teil - so zumindest in den USA - sogar zum Selbsttest angeboten, dessen Ergebnisse der Nutzer bzw. Patient per Post an ein Labor schickt, das ihm dann auf demselben Weg auch die Ergebnisse über das Vorhandensein von Risiken oder Erkrankungen zusendet. Viele dieser Tests basieren auf Erkenntnissen der Genom-Medizin.
Ob die Entwicklung, die Vermarktung und der Einsatz solcher Tests durch die für die Zulassung von Medizinprodukten wie Arzneimittel oder Medizingeräten zuständigen staatlichen Einrichtungen reguliert werden sollte, wird nun in den USA seit einigen Monaten intensiv diskutiert. Dafür spricht, dass eine Reihe dieser diagnostischen Tests falsch-positive aber auch falsch-negative Ergebnisse liefern und Ärzte wie Patienten kritische Entscheidungen im Dunkeln treffen müssen, die u.U. zu Fehlbehandlungen führen - so die Befürworter einer systematischen Kontrolle der Wirksamkeit und des Schadenspotenzials der Tests. Eine zu starke Regulierung verhindert nach Ansicht der Warner vor einem solchen Schritt den gerade möglich erscheinenden Nutzen der Genforschung, die Entwicklung besserer genetischer Tests und das Versprechen der "genomic medicine".
Wer sich einen Überblick über den derzeitigen Stand der Debatte in den USA verschaffen will, kann dies jetzt kostenlos in zwei kurzen pro und contra-"Viewpoint"-Beiträgen beginnen, die am 5. Januar 2015 online in der Fachzeitschrift "JAMA" erschienen sind.
Es handelt sich um den Aufsatz FDA Regulation of Laboratory-Developed Diagnostic Tests Protect the Public, Advance the Science. Should the FDA regulate laboratory-developed diagnostic tests? —Yes. von Joshua Sharfstein, und den Aufsatz Genetic Testing and FDA RegulationOverregulation Threatens the Emergence of Genomic Medicine. Should the FDA regulate laboratory-developed diagnostic tests? —No. von James P. Evans und Michael S. Watson.
Mehr zum Thema Laboratory Developed Tests, darunter zahlreiche Gutachten, findet sich auf einer Website der für die Regulierung potenziell zuständigen "U.S. Food and Drug Administration (FDA".
Bernard Braun, 5.1.15
"Milch macht müde Männer munter", "Vorsicht Milch" oder Vorsicht Beobachtungsstudie?
 Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.
Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.
Doch zunächst zu den Ergebnissen der Studie: Bei den Angehörigen zweier großer Kohorten von 61.433 schwedischen Frauen, die im Startzeitraum 1987-90 39 bis 74 Jahre alt waren, und von 45.339 schwedischen Männer, die zum Startzeitpunkt 1997 45 bis 79 Jahree alt waren, wurden regelmäßig die Ernährungsgewohnheiten erhoben - darunter auch der Konsum von Milch. Nach einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit von 20,1 Jahren waren 15.541 Frauen gestorben und 17.252 hatten einen Knochenbruch hinter sich, 4.259 eine Hüftfraktur. Nach durchschnittlich 11,2 Jahren Beobachtungszeit waren 10.112 der Männer tot und 5.066 hatten einen Knochenbruch, 1.166 einen Bruch der Hüfte.
Unter Berücksichtigung einer Reihe weiterer Faktoren berechneten die ForscherInnen, ob es eine statistische Assoziation zwischen der Menge des Milchkonsums, der generellen Sterblichkeit und von Knochenbrüchen gab. Aus bisherigen teils kleineren oder wesentlich kürzeren Studien war erwartet worden, dass sich Milch positiv auswirkt. Das Gegenteil war aber der Fall: Bei den Frauen, die drei oder mehr Gläser Milch pro Tag tranken, war das Sterblichkeitsrisiko fast doppelt so hoch wie bei Frauen, die nur ein Glas pro Tag tranken (hazard ratio 1,93). Bei den Männern war diese Assoziation mit einer hazard ratio von 1,10 kleiner aber immer noch signifikant. Hinzu kommt, dass zumindest bei Frauen das allgemeine Risiko einer Fraktur und das besondere einer Hüftfraktur mit dem Konsum von Milch zunahmen.
Vor jeder weiteren Diskussion sei erwähnt, dass die AutorInnen der Studie selber eine unabhängige Replikation ihrer Ergebnisse für notwendig halten "before they can be used for dietary recommendations."
Wenn aber ein Nahrungsmittel, das geradezu volkstümlich und fast von der Wiege bis zur Bahre als "gesund" betrachtet, verabreicht und in jeder Form zu sich genommen wird, plötzlich so an Glanz verliert und in zweifacher Hinsicht eher "ungesund" erscheint, stellt sich die Frage, wie damit umgegangen wird.
• Erstens könnten und sollten solche Ergebnisse die Sensibilität für die Möglichkeiten und Grenzen bzw. die Aussagekraft der gewählten Studienmethodik schärfen. Zu Recht monieren die Kritiker der Ergebnisse es handle sich um "eine reine Beobachtungsstudie, deren Ergebnisse immer sehr vorsichtig interpretiert werden müssen." Dass die im selben Atemzug dagegen gehaltene "allgemeine Studien- und Datenlage", die "klar den Gesundheitswert von Milch und Milchprodukten (belegt)" auch zum großen Teil aus Beobachtungsstudien oder Schlussfolgerungen von Inhaltsstoffen der Milch auf eine gesundheitliche Wirksamkeit und nicht aus randomisierten kontrollierten Studien bestehen, wird dabei lieber verschwiegen. So könnten also auch die beobachteten positiven gesundheitlichen Effekte der Milch in der von der Milchwirtschaft präferierten Studien die Wirkung anderer Nahrungsmittel oder Einwirkungen sein.
• Zweitens demonstrieren die Ergebnisse aber die Notwendigkeit, auch den Nutzen und die Schadensfreiheit vieler natürlicher und nahezu automatisch als "gesund" geltender Stoffe und Lebensmittel systematisch zu überprüfen.
Die am 28. Oktober 2014 im BMJ (349: g6015) publizierte Studie Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies von Karl Michaëlsson et al. ist komplett kostenlos erhältlich uind enthält noch eine Fülle weiterer interessanter Hinweise auf mögliche Erklärungen für die gewonnenen Ergebnisse.
Eine kurze kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der schwedischen Studie lieferte z.B. die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. unter der Überschrift Milchstudie sorgt für Aufregung am 31. Oktober 2014 und will die Studie weiter durchleuchten lassen.
Bernard Braun, 2.11.14
USA: Umfang und Art von Medikationsfehlern bei Kleinkindern unter Obhut ihrer Eltern.
 Kinder in den ersten Lebensjahren gehören aus vielen nachvollziehbaren Gründen (z.B. wegen der zahlreichen Infektionserkrankungen) zu den Bevölkerungsgruppen denen relativ viel Arzneimittel verordnet werden. Deren Einnahme geschieht überwiegend unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer Erwachsenen.
Kinder in den ersten Lebensjahren gehören aus vielen nachvollziehbaren Gründen (z.B. wegen der zahlreichen Infektionserkrankungen) zu den Bevölkerungsgruppen denen relativ viel Arzneimittel verordnet werden. Deren Einnahme geschieht überwiegend unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer Erwachsenen.
Anders als über die Einnahmetreue von und Einnahmefehler bei Erwachsenen wusste man über die Korrektheit der von Eltern bestimmten Einnahme von Medikamenten bei kleinen und größeren Kindern bisher relativ wenig.
Einige in den letzten Jahren veröffentlichten Studien zeigten allerdings beispielsweise, dass z.B. die Rechenschwächen von Eltern in den USA zu spürbaren Medikationsfehlern führte (siehe die Studienzusammenfassung Parents' Poor Math Skills May Lead to Medication Errors auf der Website der "American Academy of Pediatrics") und auch den Aufsatz über den kräftigen Anstieg der Anzahl der Kinder, die zwischen 2001 und 2008 in den USA mit schweren Medikamentenvergiftungen in Notfallstationen eingewiesen wurden, (der dies genau schildernde Aufsatz The Growing Impact of Pediatric Pharmaceutical Poisoning. von G. Randall Bond, Randall W. Woodward und Mona Ho. ist 2011 im "The Journal of Pediatrics" (Volume 160, Issue 2: 265-270) erschienen).
Eine am 20. Oktober 2014 veröffentlichte Studie zeigte mit Daten des "Nation Poison Database System" der USA für den Zeitraum von 2002 bis 2012 und für insgesamt 696.937 Kinder unter 6 Jahren mit berichteten Medikationsfehlern zahlreiche Details dieser Fehler in häuslicher Umgebung:
• Im Durchschnitt gab es jährlich über 63.000 derartiger Ereignisse oder jede achte Minute bekam ein Kind dieses Alters von seinen Eltern eine falsche Dosis, gar keines des verordneten oder ein falsches Medikament verabreicht.
• Die jährliche Rate der Medikationsfehler betrug daher 26,42 pro 10.000 Angehörigen dieser Kinderjahrgänge.
• Neben einer signifikanten Abnahme von Fehlern bei der Einnahme von Erkältungsarzneimitteln über die gesamten 11 Jahre um 42,9% stieg die Rate der Fehler bei allen anderen Arzneimitteln um 37,2%.
• Anzahl und Rate der Einnahmefehler fielen mit zunehmendem Alter der Kinder. Auf die unter Einjährigen entfielen 25,2% aller Episoden.
• Schmerzmittel und Mittel gegen Erkältungskrankheiten waren an rund 50% der fehlerhaften Einnahmen beteiligt.
• 27% der Einnahmefehler beruhten auf unachtsames Einnehmen oder die zweifache Einnahme einer Portion.
• 93,5% der Ereignisse fanden außerhalb einer Gesundheitseinrichtung statt, d.h. in alleiniger Verantwortung der Eltern. 4,4% der Kinder mit Einnahmefehlern waren in Gesundheitseinrichtungen behandelt und entlassen worden. 25 Kinder starben wegen der Fehleinnahme.
Die AutorInnen schließen ihre Analyse mit einer Reihe von Präventionsm ethoden technischer Art, zum Beispiel Timer, besser verschließbare Packungen, aber auch die stärkere Berücksichtigung der Lese- und Sprachschwächen der Eltern. Trotzdem räumen sie ein, dass sie zu wenig über die konkreten Abläufe und Ursachen der durch Eltern beeinflussten Medikationsfehler wissen.
Der Aufsatz Out-of-Hospital Medication Errors Among Young Children in the United States, 2002-2012. von Maxwell D. Smith, Henry A. Spiller, Marcel J. Casavant, Thiphalak Chounthirath, Todd J. Brophy und Huiyun Xiang. ist in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (867-876) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.10.14
Pro oder contra Pränataltest: Wirkungen und Nutzen informierter Entscheidung.
 Mit der Marktpräsenz von pränatalen, auf einer Untersuchung des Bluts der Schwangeren basierenden Tests, die nicht mehr, wie die Untersuchung des Fruchtwassers (Amniozentese) ein erhebliches Risiko für den Fötus und damit letztlich auch für die schwangere Frau bedeuteten, wächst das scheinbar sichere und sorgenfreie Angebot und die skrupelfreie Nutzung solcher Tests.
Mit der Marktpräsenz von pränatalen, auf einer Untersuchung des Bluts der Schwangeren basierenden Tests, die nicht mehr, wie die Untersuchung des Fruchtwassers (Amniozentese) ein erhebliches Risiko für den Fötus und damit letztlich auch für die schwangere Frau bedeuteten, wächst das scheinbar sichere und sorgenfreie Angebot und die skrupelfreie Nutzung solcher Tests.
Dabei wird über das auch oder gerade (dies liegt z.B. an der sehr kleinen Menge von DNA-Material des Fötus im Blut der Mutter) bei diesen Tests bestehende Risiko falsch-positiver wie falsch-negativer Ergebnisse weder ausreichend informiert noch zwischen Gynäkologe und Schwangerer wie ihrem Lebenspartner kommuniziert. Dies umfasst auch das Unwissen darüber, dass selbst verschiedene Sprecher von Herstellerfirmen anlässlich der Zulassung seines Tests betonten "positive results should be confirmed with invasive testing" und "it is important to understand [the new tests] don't replace invasive tests yet." Hinzu kommt, dass diese Tests bisher weder in den USA noch in Deutschland von Krankenkassen bezahlt werden und Versicherte damit zwischen 800 und beinahe 3.000 US-Dollar aus eigener Tasche zahlen müssen (vgl. dazu den am 3. April 2013 im Wall Street Journal veröffentlichten Bericht Tough Calls on Prenatal Tests. Companies Race to Promote New Genetic Screen for Down Syndrome; Worries About Patient Confusion).
Eine jetzt veröffentlichte Studie aus den USA stellte diese pränatalen genetischen Tests aber noch auf einen ganz anderen Prüfstand. Untersucht wurde, ob sich werdende Mütter auch nach einer umfassenden allgemeinen Information über die Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Tests für seine Durchführung entscheiden. Dazu wurden zwischen 2010 und 2013 rund 750 Frauen, die bis zur zwanzigsten Woche schwanger waren, zufällig auf eine Gruppe aufgeteilt, die mit einem 45-minütigen computergestützten interaktiven Entscheidungsunterstützungsprogramm informiert und gezielt nach ihren Präferenzen und Zielen in diesem Bereich gefragt wurde (n=357) oder auf eine Gruppe mit der üblichen Behandlung (n=353). Das Programm lieferte am Ende zwar eine personalisierte Empfehlung zum Test, überließ aber den NutzerInnen die Entscheidung. Die Intervention umfasste schließlich auch noch den zuzahlungsfreien Zugang zu diesen Tests. Die Teilnehmerinnen der Gruppe mit üblicher Behandlung erhielten insbesondere dann, wenn sie 35 Jahre und älter waren, die Empfehlung, den Test zu nutzen.
Das Ergebnis sah so aus: Während bei 12,2% der Teilnehmerinnen in der Normalversorgungsgruppe letztlich ein invasiver Test stattfand, waren es in der Interventionsgruppe 5,9%. Der Anteil der Teilnehmerinnen, die sich insgesamt gegen jeden pränatalen Test entschieden, war in der Interventionsgruppe signifikant höher als in der Kontrollgruppe (25,6% versus 20,4%). Die Nutzerinnen des Entscheidungsunterstützungsprogramms besaßen ferner ein generell höheres Wissen über das Schwangerschaftsgeschehen. Insbesondere wussten sie signifikant besser über die Risiken der Fruchtwasserentnahme oder das Risiko Bescheid, ein Kind mit einer Trisomie 21 bzw. einem Down-Syndrom zu gebären (58,7% versus 46,1%). Damit hatten die Teilnehmerinnen in der Interventionsgruppe deutlich mehr Chancen, eine informierte Entscheidung oder Wahl zu treffen.
Im Rahmen der Hinweise auf Grenzen ihrer Studie weisen die VerfasserInnen ausdrücklich darauf hin, dass ihre Erkenntnisse auch nach der Einführung so genannter "zellfreier" DNA-Tests Gültigkeit haben.
Der am 24. September 2014 veröffentlichte Aufsatz Effect of Enhanced Information, Values Clarification, and Removal of Financial Barriers on Use of Prenatal Genetic TestingA Randomized Clinical Trial vonm Miriam Kuppermann et al. ist in der Fachzeitschrift "JAMA" (312(12): 1210-121} online veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.9.14
Anteil falsch positiver Diagnosen auch bei prognostisch schweren Erkrankungen teilweise groß: Das Beispiel Morbus Parkinson
 Ein zentrales Problem der medizinisch-ärztlichen Diagnostik sind falsch positive Diagnosen, also Diagnosen von Erkrankungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dass es sich dabei nicht um ein verzeihbares "Irren ist menschlich"- oder Bagatellproblem handelt, sondern dadurch die Lebensqualität und Gesundheit der zu Unrecht als krank diagnostizierten Personen dramatisch belastet und verschlechtert wird, verdeutlicht eine gerade veröffentlichte Studie über die Diagnosequalität bei Morbus Parkinson.
Ein zentrales Problem der medizinisch-ärztlichen Diagnostik sind falsch positive Diagnosen, also Diagnosen von Erkrankungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dass es sich dabei nicht um ein verzeihbares "Irren ist menschlich"- oder Bagatellproblem handelt, sondern dadurch die Lebensqualität und Gesundheit der zu Unrecht als krank diagnostizierten Personen dramatisch belastet und verschlechtert wird, verdeutlicht eine gerade veröffentlichte Studie über die Diagnosequalität bei Morbus Parkinson.
Die Schwere der Fehldiagnose ergibt sich durch die damit prognostizierte oder assoziierte Hauptcharakteristika dieser Erkrankung: Parkinson ist nicht heilbar, ihre Entwicklung ist medikamentös nicht zu stoppen und sowohl der körperliche (z.B. zittrige Hände oder die maskenartige Veränderung des Gesichts) als auch der psychische (z.B. Depressionen) Zustand der Erkrankten verschlechtert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in späteren Phasen der Erkrankung.
Das diagnostische Dilemma ist aber auch, dass eine absolut sichere Diagnose im Moment nur durch Gewebeuntersuchungen aus bestimmten Gehirnbereichen möglich ist, d.h. erst nach dem Tod der erkrankten Person. Davor erfolgt eine Diagnose anhand einer Reihe von äußeren Veränderungen wie der Verlangsamung von Bewegungen, Steifheit von Muskeln z.B. im Gesicht, dem Zittern anderer Muskeln und der Reaktion auf einen Arzneimittelwirkstoff.
Die an der Mayo-Klinik in den USA durchgeführte Studie mit Daten der "Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders" untersuchte nun, ob und wie stark die ärztlichen Diagnosen von Parkinson mit dem Ergebnis der Gewebeuntersuchung nach dem Tod dieser Personen übereinstimmten:
• Bei 97 Patienten, deren Erkrankung nach der gesamten Symptomatik und ihrer Dauer für "wahrscheinlich" gehalten wurde, stimmten 82% der Diagnosen mit dem Befund überein. Es gab aber je nach Dauer der Erkrankung auch deutliche Unterschiede,: Erfolgte die Diagnose bei einer Erkrankungs-/Symptomzeit unter 5 Jahren stimmten nur 57% der Diagnosen mit dem Gewebebefund überein. Waren es mehr als 5 Jahre stieg dieser Wert auf 88%.
• Bei den 34 Patienten, deren Parkinsonerkrankung nach den Symptomen für "möglich" gehalten wurde, wurden lediglich 26% der Diagnosen durch den Gewebebefund bestätigt.
• In der dritten Gruppe von Personen bei denen eine Parkinsonerkrankung nach den Symptomen diagnostisch ausgeschlossen wurde, stimmte diese Diagnose in 91% der Fälle. Der Anteil falsch negativer Fälle betrug daher nur 9%.
Selbst wenn die Studienverantwortlichen anmerken, dass die Behandlung auch bei einer anderen Diagnose nicht völlig anders ausgesehen hätte - ein Teil der Patienten litt an einer anderen neurodegenerativen Krankheit -, halten sie wegen der oben beschriebenen psychischen Beeinträchtigung der Patienten durch eine Parkinsondiagnose die Suche nach weiteren Symptomen (z.B. Beeinträchtigung des Geruchssinns) und nach verlässlichen Biomarkern für unbedingt notwendig. Dies ist umso nötiger, weil sich an dem hohen Anteil falsch positiver Parkinsondiagnosen seit geraumer Zeit nichts geändert hat.
Der Aufsatz Low clinical diagnostic accuracy of early vs advanced Parkinson disease. Clinicopathologic study. von C.H. Adler, et al. ist am 29. Juli 2014 in der Zeitschrift "Neurology" (83 (5): 406-412) erschienen und ein Abstract ist kostenlos verfügbar.
Bernard Braun, 23.8.14
"Stille- oder Null-Post"-Effekte bei der morgendlichen Übergabe von 40% der nächtlichen Ereignisse durch ärztliches Personal
 Die stationäre Behandlung von PatientInnen ist ein vollkontinuierlicher Prozess in dem rund um die Uhr viel passieren kann und eine Vielzahl von professionellen HelferInnen beteiligt ist. Die Weiter- oder Übergabe von Informationen ist daher eine wichtige Voraussetzung für die bedarfs- und situationsgerechte wie sichere Behandlung der PatientInnen und die professionelle Zufriedenheit. Eine Reihe von Studien im Aus- und Inland haben aber gezeigt, dass dies nicht überall und immer gewährleistet ist.
Die stationäre Behandlung von PatientInnen ist ein vollkontinuierlicher Prozess in dem rund um die Uhr viel passieren kann und eine Vielzahl von professionellen HelferInnen beteiligt ist. Die Weiter- oder Übergabe von Informationen ist daher eine wichtige Voraussetzung für die bedarfs- und situationsgerechte wie sichere Behandlung der PatientInnen und die professionelle Zufriedenheit. Eine Reihe von Studien im Aus- und Inland haben aber gezeigt, dass dies nicht überall und immer gewährleistet ist.
Eine inhaltsanalytische Analyse von 16 Dienstübergaben patientenrelevanter Informationen zwischen Pflegekräften in Krankenhäusern im Rahmen einer Dissertation an der Universität Witten-Herdecke (Andreas Lauterbach: "Stille Post": Qualitative Untersuchung serieller Reproduktionen bei Dienstübergaben; in Buchform 2008 unter dem Titel "... da ist nichts, außer dass das zweite Programm nicht geht: Stille Post. Dienstübergaben in der Pflege" veröffentlicht und auch heute noch unbedingt lesenswert), kam zu folgendem Ergebnis: "Die unhinterfragte These, dass die Informationen zwar fragmentiert, aber homogen und sich puzzleartig ergänzend sind, ist falsch: Die Informationslandschaft ist brüchig, weist Gräben und Verwerfungen auf und ist in Teilen eine terra incognita. Pflegerische Entscheidungen werden in Situationen informationeller Unsicherheit ausgehandelt. Die hohe Arbeitsbelastung wandelt die Funktion der Übergabe: Sie wird zunehmend zum Refugium das der Kompensation der eigenen Arbeitsbelastung dient und einen Rahmen zur Rechtfertigung des eigenen pflegerischen (Nicht-) Handelns bietet. Sie ist mehr als ein "pflegerisches Relikt" (Zegelin-Abt): Sie ist Beispiel für die Reformationsresistenz einer (Semi-) Profession, die ihre Fachsprache noch nicht gefunden hat."
Die Hoffnung, dass es sich hier um Einzelfälle handelt oder das Wissen um Defizite im Rahmen von gezielter Weiterbildung zu deutlichen Verbesserungen gegenüber der Vergangenheit geführt hat, erweist sich im Lichte der Ergebnisse einer in den Jahren 2012 und 2013 durchgeführten quantitativen Analyse aus den internistischen Abteilungen zweier großer kanadischen Kliniken als verfrüht.
Untersucht wurde die morgendliche Weitergabe ("morning handover") von wichtigen patientenbezogenen Informationen und klinischer Verantwortung zwischen dem für die ärztlich-medizinischen Behandlung in der Nacht zuständigen Fachpersonal (dies waren zum Teil Medizinstudenten im dritten Jahr ihres Studiums oder Assistenzärzte im ersten oder zweiten Jahr ihrer Berufstätigkeit).
An den 26 beobachteten Tagen sah das Übergabegeschehen folgendermaßen aus:
• Insgesamt gab es 141 klinisch wichtige und damit unbedingt zu kommunizierende nächtliche Ereignisse.
• Die Angehörigen der Nachtschicht informierten die Angehörigen des Tagteams über 40,4% dieser Ereignisse und die für sie wichtigen Informationen in den morgendlichen Übergabegesprächen nicht.
• Wer vielleicht hofft, dass die notwendigen Informationen zumindest schriftlich in der Patientenakte o.ä. dokumentiert worden sind, wird leider nicht fündig: Zu 85,4% der 141 wichtigen Ereignisse fand sich keinerlei schriftlicher Hinweis.
• Univariate Analysen zeigten, dass das schematische Abarbeiten der Patientenliste ("patient-by-patient") und Gespräche in einer speziellen Räumlichkeit den Umfang und die Qualität der weitergegebenen Informationen verbesserten, während ein störungsreiches Umfeld dies verschlechterte. In einer multivariaten Analyse blieb als einziger unabhängiger Prädiktor für eine gute Informationsübergabe die "patient-by-patient"-Besprechung übrig. Die Wahrscheinlichkeit bzw. Chance für sie erhöhte sich unter dieser Bedingung um das 3,8-Fache (OR).
• Ob das beobachtete Geschehen zu nachweisbaren gesundheitlichen Nachteilen für die PatientInnen führte, wurde in der Studie zwar nicht untersucht, erscheint den Forschern aber zum Teil als wahrscheinlich. Solche und andere genannten Limitationen könnten aber in weiteren Untersuchungen relativ einfach vermieden werden.
Die kanadischen Forscher weisen für die weitere Praxis zum einen auf die Notwendigkeit spezieller Trainingsprogramme für Übergabegespräche hin. Zum anderen müssten für solche Gespräche aber auch Arbeitsabläufe verändert werden, mehr Zeit zur Verfügung stehen und eine möglichst störungsfreie Umgebung geschaffen werden.
Der am 21. Juli 2014 zuerst online veröffentlichte Aufsatz Morning Handover of On-Call IssuesOpportunities for Improvement von Megan K. Devlin et al. ist in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.7.14
"Noncompliance kann tödlich enden" oder warum es beim Entlassungsmanagement in Kliniken manchmal um mehr als warme Worte geht
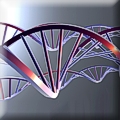 Die Mehrheit der im Krankenhaus behandelten Menschen wird nicht als vollkommen geheilt sondern als mehr oder minder stark behandlungsbedürftig entlassen. Ein Indikator ist, dass diese Personen umden stationären Heilungserfolg erhalten oder verbessern zu können oft kontinuierlich auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sind.
Die Mehrheit der im Krankenhaus behandelten Menschen wird nicht als vollkommen geheilt sondern als mehr oder minder stark behandlungsbedürftig entlassen. Ein Indikator ist, dass diese Personen umden stationären Heilungserfolg erhalten oder verbessern zu können oft kontinuierlich auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sind.
Dass es an der Schnittstelle zur nachstationären Behandlung zu potenziell folgenreichen und unerwünschten Ereignissen kommen kann, zeigt jetzt eine Untersuchung der Einnahme des die Blutgerinnung hemmenden oder "blutverdünnenden" Arzneimittels Clopidogrel nach der Implantation eines Stents. Stents, eine Art gefäßerweiterndes Drahtgeflecht in den Herzkranzgefäßen (mit oder ohne Arzneimittelbeschichtung), werden zur Prävention von schweren oder gar tödlichen Folgen einer Gefäßdurchblutungsstörung eingepflanzt und sind relativ teuer. Damit dieser Schutz wirklich funktioniert, müssen so behandelte Patienten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ohne Unterbrechung das genannte Medikament einnehmen. Wenn die Einnahme um drei oder mehr Tage unterbrochen ist, verdoppelt sein Risiko zu sterben oder innerhalb der zwei Jahre nach der Entlassung mit einem Herzinfarkt erneut in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden - unabhängig von der Art des eingepflanzten Stents. Das höchste Risiko (um das 5,5Fache) für diese Ereignisse besteht in den ersten 30 Tagen nach der Entlassung.
Dass diese dringend notwendige lückenlose medikamentöse Behandlung nicht funktionieren muss, zeigt jetzt eine Untersuchung des gesamten Behandlungsgeschehens von 15.629 Stent-Implantatempfänger im kanadischen British Columbia. Die Patienten, die ihren Stent in den Jahren 2004 bis 2006 erhielten, wurden noch bis zu zwei Jahre nach Entlassung beobachtet. 4.822 von ihnen oder rund 31% hatten das Rezept für das Medikament nicht innerhalb der ersten drei Tage nach Entlassung eingelöst und starteten daher frühestens am vierten Tag mit der notwendigen Behandlung. Die Daten zeigen aber, dass ein Teil der Patienten auch nach fünf und mehr Tagen kein Arzneimittel eingelöst und dann wahrscheinlich auch eingenommen hatte.
Auch wenn nicht geklärt wurde, warum die Patienten ihr Rezept nicht sofort einlösten und unabhängig von einigen methodischen Limitationen der Studie (z.B. keine Randomisierung) sprechen die AutorInnen mit dem folgenden Statement wichtige Leistungen in der Entlassungs- oder Überleitungsphase stationär behandelter Patienten an, die offensichtlich selbst bei derart aufwändigen und riskanten Behandlungen noch nicht überall im Alltag angekommen sind und wichtige Voraussetzungen für die nötige Therapietreue sind: "Interventions to enhance discharge planning, educate patients, simplify regulatory hurdles, and ensure early community pharmacy involvement all have the potential to improve early compliance with medications after hospital discharge and, ultimately, clinical outcomes."
Ob so etwas in Deutschland auch passiert, kann zwar mangels entsprechender Untersuchungen nicht gesichert gesagt oder verneint werden, ist aber angesichts des häufig als verbesserungsbedürftig bewerteten Entlassungsmanagements nicht unwahrscheinlich.
Die am 28. Mai 2014 online in der Fachzeitschrift "Journal of the American Heart Association" veröffentlichte Studie Delay in Filling First Clopidogrel Prescription After Coronary Stenting Is Associated With an Increased Risk of Death and Myocardial Infarction von Nicholas L. Cruden et al. (2014; 3: e000669) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.5.14
Beschneidung von männlichen Kindern mit oder ohne ihre Beteiligung - wenn überhaupt, wann und mit welchem gesundheitlichen Risiko?
 Einer der häufigsten operativen Eingriffe bei männlichen Kindern und Jugendlichen (in medizinischen Einrichtungen der USA jährlich rund 1,4 Millionen Fälle) ist die Entfernung der Vorhaut bzw. die Beschneidung. Sie geschieht überwiegend aus religiösen oder kulturellen Gründen und seltener wegen einer krankhaften, d.h. medizinisch behandlungsbedürftigen Verengung der Vorhaut oder Phimose. In regelmäßigen Abständen, in Deutschland vor zwei Jahren, gibt es Diskussionen darüber, ob es sich bei der religiös oder kulturell motivierten Beschneidung nicht um die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit der oft sehr jungen Kinder handelt, die sich dazu noch komplett über deren Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte hinwegsetzt bzw. mangels Fähigkeit kleiner Kinder hinwegsetzen muss. Da so etwas wie eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit Babys oder sehr jungen Kindern nur sehr schlecht stattfinden kann, gab es immer wieder Forderungen, den Zeitpunkt der Entscheidung pro oder contra Beschneidung ins höhere Kindes- oder Jugendlichenalter zu verschieben.
Einer der häufigsten operativen Eingriffe bei männlichen Kindern und Jugendlichen (in medizinischen Einrichtungen der USA jährlich rund 1,4 Millionen Fälle) ist die Entfernung der Vorhaut bzw. die Beschneidung. Sie geschieht überwiegend aus religiösen oder kulturellen Gründen und seltener wegen einer krankhaften, d.h. medizinisch behandlungsbedürftigen Verengung der Vorhaut oder Phimose. In regelmäßigen Abständen, in Deutschland vor zwei Jahren, gibt es Diskussionen darüber, ob es sich bei der religiös oder kulturell motivierten Beschneidung nicht um die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit der oft sehr jungen Kinder handelt, die sich dazu noch komplett über deren Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte hinwegsetzt bzw. mangels Fähigkeit kleiner Kinder hinwegsetzen muss. Da so etwas wie eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit Babys oder sehr jungen Kindern nur sehr schlecht stattfinden kann, gab es immer wieder Forderungen, den Zeitpunkt der Entscheidung pro oder contra Beschneidung ins höhere Kindes- oder Jugendlichenalter zu verschieben.
Unabhängig von den dagegen wiederum erhobenen religiösen Einwänden, stellt sich die gesundheitliche Frage, ob es einen Zusammenhang von unerwünschten Nebenwirkungen und Lebensalter zum Zeitpunkt der Beschneidung gibt.
Die am 12. Mai 2014 in der Fachzeitschrift "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Ergebnisse einer Analyse der Routinedaten über unerwünschte Ereignisse und Folgen bei der Beschneidung von 1.400.920 us-amerikanischen männlichen Kindern, lauten so:
• Die Inzidenz aller 41 möglichen unerwünschten Effekte betrug 0,5%.
• Sie stieg im Vergleich mit den unter einem Jahr alten männlichen Kindern bei den 1 bis 9-Jährigen auf das Zwanzigfache und bei den 10 Jahre alten und älteren Jungs und jungen Männer auf das Zehnfache dieses Werts.
• Die Rate potenziell ernsthafter Nebenwirkungen reichte von 0,76 Ereignissen pro einer Million Beschneidungen bis zu 703,23 Ereignissen pro eine Million Beschneidungen, wenn eine nicht vollständige Beschneidung nachbehandelt werden musste.
Auch wenn damit eine größere Transparenz existiert, ähnelt die besser informierte Entscheidung einer zwischen Scylla und Charybdis bzw. zwischen dem Gebot, die Operierten an Entscheidungen zu beteiligen und dem mit steigendem Lebensalter ebenfalls steigenden Risiko von unerwünschten Behandlungsfolgen.
Von dem am 12. Mai 2014 "online first" in der Zeitschrift "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Aufsatz Rates of Adverse Events Associated With Male Circumcision in US Medical Settings, 2001 to 2010 von Charbel El Bcheraoui et al. gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 17.5.14
Opioide=Patentmittel gegen chronische Schmerzen? Nebenwirkungsarme Alternativen genauso wirksam oder Nutzen zweifelhaft
 Opioide, sind eine dem Opium ähnliche "uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen" (Wikipedia). Sie gehören zu den stärksten Mitteln gegen schwere chronische Schmerzen, die durch einen Tumor oder andere schmerzintensive Erkrankungen hervorgerufen werden.
Opioide, sind eine dem Opium ähnliche "uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen" (Wikipedia). Sie gehören zu den stärksten Mitteln gegen schwere chronische Schmerzen, die durch einen Tumor oder andere schmerzintensive Erkrankungen hervorgerufen werden.
Da diese Mittel eine erhebliche Menge schwerer Nebenwirkungen haben, gibt es zahlreiche Untersuchungen, die zu klären versuchen, ob Opioide z.B. bei rheumatischen Erkrankungen wie Arthritis, Erkrankungen des Nervensystems oder Problemen mit der Rückenmuskulatur oder Wirbelsäule gegenüber anderen Therapien wirklich so viel wirksamer sind, dass die Nachteile vernachlässigt werden können. Bei den anderen Therapien handelt es sich vor allem um psychologische und physiotherapeutische Verfahren. Die praktische Bedeutung dieses Vergleichs ergibt sich u.a. daraus, dass rund ein Viertel der Bevölkerung an chronischen Schmerzen leidet, die nicht Folge einer Krebserkrankung sind.
Eine von Wissenschaftlern der Berliner Charité und der Technischen Universität Darmstadt durchgeführte Meta-Analyse von 46 randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) mit insgesamt 10.742 TeilnehmerInnen aus insgesamt 3.647 dazu durchgeführten Studien zeigten ein unerwartetes Ergebnis:
• Starke Schmerzmittel, die über einen längeren Zeitraum gegen nicht tumorbedingte chronische Schmerzen eingenommen werden, haben den gleichen Effekt wie eine Behandlung ohne Medikamente, d.h. mit Placebos, psychologischen oder physiotherapeutischen Verfahren. Bei längerfristigen Opioidbehandlungen ist der Anteil der Behandlungsabbrecher außerdem sehr hoch und erschwert unverzerrte Nutzenbewertungen.
• Die Schlussfolgerung des Charité-Autors Stein lautet daher: "Bei der Behandlung chronischer Schmerzen, die nicht durch einen Tumor hervorgerufen werden, sollte ein multidisziplinärer Ansatz, also einer, der nicht nur die medizinischen, sondern auch die psycho-sozialen und physiotherapeutischen Aspekte berücksichtigt, im Vordergrund stehen".
Die Studienergebnisse wurden in dem Aufsatz Analgesic efficacy of opioids in chronic pain - recent meta-analyses von Reinecke H, Weber C, Lange K, Simon M, Stein C und Sorgatz H. in der Fachzeitschrift "British Journal of Pharmacology" am 15. Februar 2014 online veröffentlicht. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ebenfalls auf methodisch hohem Niveau beschäftigte sich bereits am 29. August 2013 ein gegenüber einer älteren Version aus dem Jahr 2006 aktualisierter Cochrane Review damit, welchen Nutzen und welche gesundheitlich unerwünschten Wirkungen eine Opioidbehandlung neuropathischer Schmerzen hat. In den Review gingen 31 RCTs ein. Die VerfasserInnen weisen generell darauf hin, dass es sich dabei häufig um sehr kurzzeitige Behandlungen von wenigen Stunden und Tagen handelt, Untersuchungen der Wirkungen längerer Behandlungen also fehlen. Außerdem sind an den meisten Studien nur sehr wenige PatientInnen beteiligt.
Die Studienlage fassen die Cochrane-Reviewer so zusammen: "Short-term studies provide only equivocal (zweifelhaft, mehrdeutig) evidence regarding the efficacy of opioids in reducing the intensity of neuropathic pain. Intermediate-term studies demonstrated significant efficacy of opioids over placebo, but these results are likely to be subject to significant bias because of small size, short duration, and potentially inadequate handling of dropouts. Analgesic efficacy of opioids in chronic neuropathic pain is subject to considerable uncertainty. Reported adverse events of opioids were common but not life-threatening." Und: "All these features are likely to make effects of opioids look better in clinical trials than they are in clinical practice. We cannot say whether opioids are better than placebo for neuropathic pain over the long term."
Von dem Cochrane Review Opioids for neuropathic pain von McNicol ED, Midbari A und Eisenberg E. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8) ist die Zusammenfassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.4.14
Wenn es darauf ankommt, kann es auch Unterversorgung mit Antibiotika geben - Sepsis-Patienten in Notfallambulanzen
 Viele Untersuchungen über die Verordnung von Antibiotika belegen eine Überversorgung, und wenn man die unerwünschte Folgen von zu vielen und dann noch nicht einmal gesundheitlich notwendigen Antibiotika für die rasch zunehmenden resistenten Bakterienstämme bedenkt, auch eine gesundheitlich folgenschwere Fehlversorgung. Seltener ist, dass es eine gesundheitlich relevante Unterversorgung mit Antibiotika gibt.
Viele Untersuchungen über die Verordnung von Antibiotika belegen eine Überversorgung, und wenn man die unerwünschte Folgen von zu vielen und dann noch nicht einmal gesundheitlich notwendigen Antibiotika für die rasch zunehmenden resistenten Bakterienstämme bedenkt, auch eine gesundheitlich folgenschwere Fehlversorgung. Seltener ist, dass es eine gesundheitlich relevante Unterversorgung mit Antibiotika gibt.
Dass dies selbst bei offensichtlichem Bedarf in gravierendem Umfang passiert, zeigt eine jetzt veröffentlichte Studie zum Einsatz von Antibiotika bei Patienten mit einer Sepsis in den Jahren 1994 bis 2009 in den USA. Die dazu vorhandene Leitlinie empfiehlt eine frühe, zielgerichtete und angemessene Antibiotikatherapie, die den Erkrankungsverlauf positiv beeinflusst und das Sterblichkeitsrisiko reduziert.
Um zu klären, ob und wie dieser Leitlinie entsprochen wird, analysierten US-WissenschaftlerInnen Daten des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey" für alle erwachsenen Patienten in den USA, die wegen einer Sepsis in Notfallstationen von Krankenhäusern versorgt wurden.
Unterschieden wurden dabei Patienten bei denen eine explizite ICD-Diagnose Sepsis gestellt wurde von Patienten mit einer impliziten Sepsis. Dies rekonstruierten die ForscherInnen aus anderen dokumentierten Angaben zur Infektionsart und von Fehlfunktionen von Organen, die einen sicheren Schluss auf Sepsis zuließen.
Die Anzahl der Notfallstations-Aufenthalte mit einer expliziten Sepsis-Diagnose bewegte sich in den 16 untersuchten Jahren nahezu unverändert bei 1,23 Personen pro 1.000 Einwohner. Dies entspricht im Durchschnitt 260.000 Personen. Die Anzahl der Personen mit einer impliziten Sepsis-Diagnose erhöhte sich dagegen alle 2 Jahre um 0,07 Personen pro 1.000 Einwohner.
Von den Notfallpatienten mit expliziter Sepsisdiagnose erhielten zwischen 52% (1994-1997) und 69% (2006-2009) eine medizinisch sofort notwendige Behandlung mit Antibiotika in der Notfallstation und nicht erst möglicherweise später in der endgültigen Krankenhaus-Intensivstation. Obwohl eine Behandlung gegen multiresistente Bakterien vom Typ MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) bei diesen Patienten eigentlich die Regel sein sollte, stellten entsprechende Antibiotika nur 18% der gesamten Verordnungen. Wie gefährlich eine Sepsis und dazu auch noch eine zunächst nicht behandelte Sepsis sein kann, zeigte die Studie auch: 31% der explizit diagnostizierten Sepsispatienten wurden in die Intensivstation aufgenommen, wo 40% verstarben. Die Gesamtsterblichkeit aller Sepsispatienten in Krankenhäusern betrug 17%. In beiden Fällen liefert die Studie allerdings keine Daten für einen Zusammenhang von Nicht-Verordnung und Tod.
Die praktischen Schlussfolgerungen der Autoren lauteten: Als erstes müssen die Diagnostik von Sepsis-Patienten verbessert und so früh und gezielt wie möglich geeignete Antibiotika verordnet werden. Aktuell müsste der Schutz gegen MRSA-Erreger an vorderster Stelle stehen.
Der Aufsatz Sepsis visits and antibiotic utilization in U.S. emergency departments von Filbin MR et al. ist am 6. November 2013 als elektronische Vorab-Veröffentlichung der Fachzeitschrift "Critical Care Medicine" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.12.13
Hauptsache Test, auch wenn für denTest auf Gebärmutterhalskrebs die Gebärmutter fehlt oder die Frau gesund und älter als 65 ist.
 Ein häufig verwendeter Test zur Früherkennung einer Krebserkrankung des Gebärmutterhalses ist der so genannte Papanicolaou-Abstrichtest. Bereits seit 2003 veröffentlichten us-amerikanische medizinische Fachgesellschaften evidenzbasierte Empfehlungen gegen eine drohende Überversorgung. So wird empfohlen, den Test nicht bei Frauen durchzuführen, die wegen einer Totalentfernung der Gebärmutter auch keinen Gebärmutterhals mehr haben und die keine Krebs-Vorerkrankungsgeschichte haben. Und auch für Frauen über 65 Jahre ohne spezifische Vorerkrankung, deren bisherigen Papanicolaou-Tests normal waren und die auch sonst kein erkennbar hohes Erkrankungsrisiko haben, wird der Verzicht auf diesen Test empfohlen.
Ein häufig verwendeter Test zur Früherkennung einer Krebserkrankung des Gebärmutterhalses ist der so genannte Papanicolaou-Abstrichtest. Bereits seit 2003 veröffentlichten us-amerikanische medizinische Fachgesellschaften evidenzbasierte Empfehlungen gegen eine drohende Überversorgung. So wird empfohlen, den Test nicht bei Frauen durchzuführen, die wegen einer Totalentfernung der Gebärmutter auch keinen Gebärmutterhals mehr haben und die keine Krebs-Vorerkrankungsgeschichte haben. Und auch für Frauen über 65 Jahre ohne spezifische Vorerkrankung, deren bisherigen Papanicolaou-Tests normal waren und die auch sonst kein erkennbar hohes Erkrankungsrisiko haben, wird der Verzicht auf diesen Test empfohlen.
In dem für die US-Bevölkerung repräsentativen und mehrfach validierten "National Health Interview Survey (NHIS)" wurde im Jahr 2010 bei den über 18-Jährigen Befragten eine Zusatzbefragung mit dem Schwerpunkt Krebserkrankungen ("cancer control supplement") durchgeführt. Dazu gehörten u.a. auch Fragen nach einer Gebärmutterentfernung, der Durchführung des Papanicolaou-Tests als Screeningmethode und diverse soziodemografische Daten.
Die wichtigsten Ergebnisse zeigen ein erschreckendes Bild mangelnder Orientierung an den evodenzbasierten Empfehlungen -möglicherweise auch der schlichten Unkenntnis:
• Bei 34% der Frauen, deren Gebärmutter völlig entfernt ("total hysterectomy") wurde, erhielten im Jahr vor der Befragung einen Papanicolaou-Test. 64,8% dieser Frauen erhielten in der gesamten nachoperativen Zeit einen derartigen Test.
• Von den über 65-jährigen Frauen ohne Gebärmutterentfernung erhielten in den letzten drei Jahren 58,4% einen Test - 44,4% auch jedes Jahr.
• Damit erhielten insgesamt fast 14 Millionen Frauen einen Test, der mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Nutzen für sie erbrachte.
• Interessant ist schließlich noch, dass u.a. der Anteil der Testempfängerinnen bei den privat Versicherten durchweg am höchsten war (80,3% unter den Frauen mit Gebärmutterentfernung und 88,6% unter den Frauen ohne diese Operation).
Auch wenn die AutorInnen auf mögliche Grenzen ihrer Studie als Studie mit Angaben über das Testgeschehen von den Befragten Frauen hinweisen und auch keine Details zur genauen Art der Gebärmutterentfernung erfragt werden konnten, sehen sie einen beträchtlichen "misuse" des Tests trotz eindeutiger und seit rund einem Jahrzehnt bekannten Empfehlungen. Eine ihrer kritischen Bewertungen: "health care resources could be spent better elsewhere". Kritisch ist der beobachtete missbräuchliche Einsatz des Tests aber nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen der allein mit dem u.U. ängstlichen Warten auf das Testergebnis verbundenen Einschränkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Die Hoffnung, dass die US-Gesundheitsreform daran etwas ändere, klingt angesichts der Zahlen und den auch sonst identifizierten ärztlichen Über- und Fehlversorgungsexzessen (z.B. Krebsfrüherkennung für terminal an Krebs erkrankten älteren Patienten) etwas naiv und unrealistisch.
Und auch hier kann man für Deutschland mangels vergleichbarer Daten mal wieder weder Kritisches noch Entwarnendes sagen.
Der Research Letter Overuse of Papanicolaou Testing Among Older Women and Among Women Without a Cervix von Deanna Kepka et al. ist in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" vom 25. November 2013 komplett kostenlos veröffentlicht worden.
Bernard Braun, 27.11.13
Erhöht Vitamin D die Knochendichte und senkt damit das Frakturrisiko? Nur sehr geringe Evidenz und dann nur bei einzelnen Knochen!
 Die Furcht vor der Verringerung ihrer Knochendichte und der möglichen Folge schwerer Knochenbrüche und damit oft assoziierter langer Erkrankungsdauern oder gar anhaltender Pflegebedürftigkeit plagt relativ viel ältere Menschen ab ihrem 50. Lebensjahr. Als präventiv wirksam gilt u.a. die regelmäßige nahrungsergänzende Einnahme von Vitamin D zusammen mit oder ohne Kalzium. Untersuchungen zeigen, dass bis zur Hälfte der über 50-Jährigen ihre Ernährung so ergänzen. Frühere methodisch hochwertige Meta-Analysen kamen bereits zu dem Schluss, dass Vitamin D allein nicht das Risiko von Knochenbrüchen verringert. In Studien, die zu diametral anderen Ergebnissen kamen, erhielten die TeilnehmerInnen neben Vitamin auch noch Kalzium, das erwiesenermaßen de Knochendichte verbessern kann und daher auch eine präventive Wirkung auf das Risiko von Knochenbrüchen hat.
Die Furcht vor der Verringerung ihrer Knochendichte und der möglichen Folge schwerer Knochenbrüche und damit oft assoziierter langer Erkrankungsdauern oder gar anhaltender Pflegebedürftigkeit plagt relativ viel ältere Menschen ab ihrem 50. Lebensjahr. Als präventiv wirksam gilt u.a. die regelmäßige nahrungsergänzende Einnahme von Vitamin D zusammen mit oder ohne Kalzium. Untersuchungen zeigen, dass bis zur Hälfte der über 50-Jährigen ihre Ernährung so ergänzen. Frühere methodisch hochwertige Meta-Analysen kamen bereits zu dem Schluss, dass Vitamin D allein nicht das Risiko von Knochenbrüchen verringert. In Studien, die zu diametral anderen Ergebnissen kamen, erhielten die TeilnehmerInnen neben Vitamin auch noch Kalzium, das erwiesenermaßen de Knochendichte verbessern kann und daher auch eine präventive Wirkung auf das Risiko von Knochenbrüchen hat.
Einige ForscherInnen waren sich aber nicht sicher, ob die Solo-Wirkung von Vitamin D nicht doch noch durch höhere Dosen oder durch einen gezielten Einsatz in besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen eintreten könnte. Deshalb führten sie einen systematischen Review und eine Meta-Analyse über alle randomisierten kontrollierten Studien durch, welche die Einnahme verschiedenster Vitamin D-Dosen und Kombinationen von Vitamin D mit anderen als hilfreich vermuteten Mitteln auf Personen ab dem 20. Lebensjahr untersuchten. Der primäre Endpunkt der Studien war die prozentuale Veränderung, d.h. im positiven Fall Erhöhung der Knochendichte.
In ihre Studie gingen von 3.930 bis 2012 gefundenen Studien 23 mit einer mittleren Beobachtungszeit von fast 2 Jahren und mit 4.082 TeilnehmerInnen ein. 92% von ihnen waren Frauen, das Durchschnittsalter betrug 59 Jahren. Die Knochendichte wurde an bis zu fünf Stellen bzw. Knochen gemessen: Lendenwirbelsäule, Oberschenkelhalsknochen, am Schenkelring, am Unterarm und am gesamten Körper.
Die Ergebnisse:
• Es gab sechs Studien, in denen es bei der Dichte eine signifikante Erhöhung gab, vier Studien zeigten lediglich bei einem einzigen Knochen eine höhere Knochendichte, zwei Funde zeigten eine signifikante Verschlechterung und die restlichen 11 Studien fanden keinerlei signifikanten Nutzen der Vitamineinnahme für die Knochendichte. Nur eine Studie fand Verbesserungen der Knochendichte bei mehr als einem der untersuchten Knochen(orte).
• Bei der Meta-Analyse ergab sich lediglich für die Dichte des Oberschenkelhalsknochens ein kleiner Nutzen der Vitamineinnahme. Die für diese Analyse einbezogenen Studien waren aber sehr heterogen, was zur Vorsicht bei der Verallgemeinerung des Ergebnisses führen sollte. Umso verwunderlicher ist es trotzdem, dass bei den unmittelbar benachbarten Hüftknochen keinerlei Veränderungen ihrer Dichte gefunden werden konnten.
Die ForscherInnen kommen daher zu dem Ergebnis, dass ihr systematischer Review "provides very little evidence of an overall benefit of vitamin D supplementation on bone density". Kleine Verbesserungen bei einzelnen Knochen seien gegen mögliche unerwünschte Effekte abzuwägen. Und außerdem sei die "number of positive results ... little better than what would have been expected by chance." Auf die teure Messung der Knochendichte und der generellen Einnahme von Vitamin D könne verzichtet werden, außer bei der kleinen Gruppe von erkennbar besonders gefährdeten Personen. Bevölkerungsbezogene Messungen des Vitamin-D-Spiegels in den USA hätten schließlich gezeigt, dass "most adults ... do not need supplementation."
Dass dies die Hersteller und Verkäufer von Vitamin D-Präparaten anders sehen, ihnen dies auch nicht untersagt ist und sie damit auch enorme Verkaufserfolge erzielen, ist ein Beispiel dafür, dass bei allen Produkten, die eine Gesundheitswirkung behaupten oder mit ihr werben, die Hersteller dazu gesetzlich verpflichtet werden müssen, diesen Nutzen und/oder die Schädigungsfreiheit durch unabhängige Studien nachzuweisen. Gelingt ihnen dies nicht, sollten sie in keiner Weise mehr mit der hoch angesehenen und verkaufsfördernden Gesundheitswirkung werben dürfen.
Der Aufsatz Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis. von Ian Reid et al. ist am 11. Oktober 2013 in der Zeitschrift "Lancet" "early online" veröffentlicht worden. Sein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.10.13
Der Boom der Knie- und Hüftgelenks-Endoprothesen-Operationen kann durch "decision aids" signifikant gebremst werden
 Der teilweise oder komplette Ersatz von Knie- und Hüftgelenken, die überwiegend durch Arthrose zerstört wurden oder massiv in ihrer Funktion beeinträchtigt sind, durch künstliche Endoprothesen gehört mittlerweile zu den häufigsten Operationen in deutschen Krankenhäusern. Nach einer Statistik der OECD belegt Deutschland im Vergleich mit den OECD-Ländern bei der Häufigkeit von Knie-Endoprothesen-Operationen Platz 2 und bei der Häufigkeit implantierter künstlicher Hüftgelenke sogar Platz 1. Darüber, ob dies zu viel ist, also eigentlich gesundheitlich nicht notwendige Operationen vor allem aus ökonomischen Kalkülen verstärkt durchgeführt werden, wird gestritten und soll erst eine weitere Studie Klarheit schaffen.
Der teilweise oder komplette Ersatz von Knie- und Hüftgelenken, die überwiegend durch Arthrose zerstört wurden oder massiv in ihrer Funktion beeinträchtigt sind, durch künstliche Endoprothesen gehört mittlerweile zu den häufigsten Operationen in deutschen Krankenhäusern. Nach einer Statistik der OECD belegt Deutschland im Vergleich mit den OECD-Ländern bei der Häufigkeit von Knie-Endoprothesen-Operationen Platz 2 und bei der Häufigkeit implantierter künstlicher Hüftgelenke sogar Platz 1. Darüber, ob dies zu viel ist, also eigentlich gesundheitlich nicht notwendige Operationen vor allem aus ökonomischen Kalkülen verstärkt durchgeführt werden, wird gestritten und soll erst eine weitere Studie Klarheit schaffen.
Selbst stationär tätige Orthopäden scheuen aber bereits heute nicht vor der Behauptung zurück, in Deutschland würde zu schnell operiert. Konkret sagte der Direktor der Orthopädischen Klinik der Universität Regensburg, Joachim Grifka, in einem Interview am 18.9.2013 folgendes: "Ich schätze, dass jede zehnte Gelenkoperation unnötig ist. Bei etwa 200.000 Hüftoperationen im Jahr und rund 160.000 Knie-Ops kommt da einiges zusammen", nämlich rund 36.000 unnötige Operationen, die trotzdem ein hohes Risiko von gefährlichen und teuren Komplikationen oder Krankenhausinfektionen haben.
Bereits vor dem per Gutachten möglichen Ende der Diskussion in mehreren Jahren sollte aber ein erfolgreicher Versuch zur Kenntnis genommen werden, die Häufigkeit der Knie- und Hüftgelenks-OPs und damit das Auftreten unerwünschter Folgen der Operationen und die damit verbundenen Kosten argumentativ zu senken.
In einer Beobachtungsstudie wurden 820 bzw. 3.510 Versicherten eines großen Krankenversicherungsunternehmens im US-Bundesstaat Washington, die eine endoprothetische Operation eines Hüft- bzw. Kniegelenks als elektive Leistung vorhatten, über ihre behandelnden Aerzte so genannte "decision aids" angeboten. "Decision aids" sind medial verständliche und auf der Basis des bestmöglichen Wissens über die Art der Erkrankung und die Folgen einer Operation verfasste Entscheidungshilfen für Patienten und Aerzte.
Sie enthielten realistische Darstellungender vor-operativen Interventionsmöglichkeiten, der nach-operativen Gesundheits- und Lebensqualität und relativieren unrealistische Heilungserwartungen bzw. Erwartungen zum raschen Verschwinden spezifischer Beschwerden wie vor allem der Schmerzen und anhaltender Beweglichkeitsprobleme. Sie beabsichtigen außerdem durch entsprechende Hinweise auf die Dauer der nach-operativen erkrankungsspezifischen Behandlung von vornherein die Therapietreue der Endoprothesen-PatientInnen zu verbessern.
Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe von PatientInnen, die ebenfalls an Kox- oder Gonarthrose litten und eine Endoprothesenoperation planten, ging die Nutzung der Behandlungs-Entscheidungshilfen mit einer über 6 Monate anhaltenden signifikanten Verringerung der Hüft-Endoprothesen-Operationen um enorm viele 26% und der Knie-Endoprothesen-Operationen um 38% einher. In den 6 Beobachtungsmonaten waren die Kosten in der "decision aids"-Gruppe um 12 bis 21% niedriger als in der Patientengruppe ohne Entscheidungshilfen mit einer entsprechend höheren Operationswahrscheinlichkeit.
Eine Schwäche dieser Interventionsstudie ist ihre kurze Beobachtungszeit von 6 Monaten. Möglicherweise haben sich also alle Personen, die unter dem Einfluss der "decision aids" auf eine Hüft- oder Kniegelenks-Operationen verzichtet haben, ab dem siebten Monat doch operieren lassen. Niemand hält die Kritiker des Designs und Zweifler am Nutzen dieser Interventionsart aber davon, die Interventionsmethode zu replizieren und die Untersuchungsgruppe deutlich länger zu beobachten.
Die Studie von Arterburn D. et al. ist bereits im September 2012 unter dem Titel Introducing Decision Aids at Group Health was linked to sharply lower hip and knee surgery rates and costs in der Fachzeitschrift "Health Affairs" (31, No. 9: 2094-2104) erschienen. Davon ist kostenlos das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 18.9.13
USA: Antibiotika ohne gesundheitlichen Nutzen und Breitband-Antibiotika werden anhaltend zu oft verordnet.
 Sowohl die Verordnung von Antibiotika bei offensichtlich damit nicht behandlungsfähigen Erkrankungen (z.B. Virusinfektionen) als auch die Verordnung von Breitband-Antibiotika an Stelle von Antibiotika mit schmalerem oder spezifischerem Wirkungsspektrum, werden seit Jahren kritisch diskutiert. Die dabei vor allem angesprochenen unerwünschten und gefährlichen Effekte stellen die damit verbundenen Resistenzbildungen bei immer mehr bakteriellen Erregern sowie die Kosten dar.
Sowohl die Verordnung von Antibiotika bei offensichtlich damit nicht behandlungsfähigen Erkrankungen (z.B. Virusinfektionen) als auch die Verordnung von Breitband-Antibiotika an Stelle von Antibiotika mit schmalerem oder spezifischerem Wirkungsspektrum, werden seit Jahren kritisch diskutiert. Die dabei vor allem angesprochenen unerwünschten und gefährlichen Effekte stellen die damit verbundenen Resistenzbildungen bei immer mehr bakteriellen Erregern sowie die Kosten dar.
Wie die Verordnungsweise Über mehrere Jahre hinweg aussieht, ob also die Kritik nachweisbare positive Spuren hinterlässt, hat jetzt ein Team us-amerikanischer Spezialisten für die Behandlung von Infektionserkrankungen für die Jahre 2007 bis 2009 in den USA untersucht. Sie nutzten dazu Daten des "National Ambulatory Medical Care Survey" und des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey", repräsentative Datensammlungen zu den Behandlungsvisiten von 238.624 erwachsenen PatientInnen in normalen stationären und ambulanten ärztlichen Sprechstunden und Notfallambulanzen.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• Antibiotika wurden jährlich am Ende von 101 Millionen ambulanten Arztbesuchen, d.h. nach rund 10% aller Arztbesuche verordnet.
• Die jährliche Rate der Antibiotika-Verordnungen veränderte sich in dem dreijährigen Untersuchungszeitraum nicht.
• 41% aller Antibiotika-Verordnungen erfolgten wegen einer Erkrankung der oberen Atemwege, 19% bei Hautinfektionen/Akne und 8% bei Infektionen der Harnwege.
• 61% aller Antibiotika-Verordnungen waren Breitband-Antibiotika.
• Rund 21% aller Behandlungskontakte in Notfallambulanzen endeten in einer Antibiotika-Verordnung. In normalen stationären Arzt-Patientkontakten betrug dieser Anteil nur 9% und in ambulanten Settings 11%. Diese Unterschiede waren statistisch hochsignifikant.
• Insgesamt waren 28% aller Antibiotika-Verordnungen wahrscheinlich unnötig, erfolgten also z.B. bei Erkrankungen gegen die sie wirkungslos waren. Dies trifft u.a. für 68% aller Verordnungen gegen Atemwegsinfektionen zu.
• Der Anteil nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen war in Notfallambulanzen am höchsten und in Kliniksprechstunden für ambulante Patienten am niedrigsten.
• Der Anteil der verordneten Breitband-Antibiotika war u.a. bei vorhandener Komorbidität, bei älteren PatientInnen und privat Krankenversicherten signifikant überdurchschnittlich.
Von der elektronischen Vorveröffentlichung der Studie Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007-09 von Shapiro DJ et al. am 25. Juli 2013 in der britischen Fachzeitschrift "Journal of Antimicrobial Chemotherapy" gibt es ein kostenloses Abstract.
Bernard Braun, 5.9.13
Weniger ist mehr: Das Beispiel der operativen Behandlung von Hautkrebspatienten mit begrenzter Lebenserwartung
 Eine besondere Form der Über- und Fehlversorgung ist die Behandlung von Patienten mit limitierter Lebenserwartung, die den möglichen Nutzen der Therapie nicht mehr erleben können, sondern nur noch deren unerwünschte Wirkungen auf die gesundheitliche Lebensqualität.
Eine besondere Form der Über- und Fehlversorgung ist die Behandlung von Patienten mit limitierter Lebenserwartung, die den möglichen Nutzen der Therapie nicht mehr erleben können, sondern nur noch deren unerwünschte Wirkungen auf die gesundheitliche Lebensqualität.
Ein aktuelles Beispiel liefern die Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie mit 1.536 an einem Nicht-Melanom-Hautkrebs erkranktenPatienten, von denen am Ende noch 1.360 Patienten mit 1.739 dieser Art von Tumoren über durchschnittlich 9 Jahre hinweg genauer untersucht wurden. Von ihnen hatten 332 Patienten nach mehreren anerkannten Kriterien (z.B. älter als 85 Jahre, hoher Komorbiditätsindex) nur noch eine begrenzte Lebenserwartung (limited life expectancy - LLE). Untersucht werden sollte, ob und wie derartige Patienten mit oder ohne begrenzte Lebenserwartung behandelt worden sind. Dies erfolgt vor dem Hintergrund einiger in den USA durchgeführter Studien, die nachwiesen, dass z.B. zahlreiche Patienten mit metastasierendem Krebs und geringer Lebenserwartung noch völlig wertlose Früherkennungsuntersuchungen angeboten bekamen (vgl. dazu den entsprechenden Beitrag in forum-gesundheitspolitik) oder 20% sterbenskranke Medicare-Versicherte im letzten Monat ihres Lebens noch operiert wurden.
Das Ergebnis bei den an Nichtmelanom-Hautkrebs erkrankten Patienten war eindeutig: Ob einer dieser Patienten voraussichtlich bald sterben wird oder nicht, spielte für die Art der Therapie nahezu keine Rolle.
Insgesamt wurden 68,7% der Tumore operativ entfernt. Dies geschah bei 34,2% der Patienten mit der aufwändigen und belastenden so genannten Mohs-Chirurgie, bei 34,5% mit einer einfacheren Methode. Bei weiteren 26,7% wurden die Tumore mit Kälte, Laser, Bestrahlung etc. zerstört. Nur 3,1% erhielten keine Behandlung.
Die Behandlung der Patienten mit begrenzter Lebenserwartung sah so aus: 70,1% von ihnen wurden operiert, 33,9% mit der Mohs-Chirurgie und 36,2% mittels einer einfachen Entfernung. Bei 25,2% wurden die Tumore mit Kälte, Laser etc. entfernt und nur 3,3% blieben unbehandelt. Die Über- und Fehlversorgung solcher Patienten ergibt sich auch dadurch, dass 73% dieser Patientengruppe völlig asymptomatisch waren, also z.B. nicht an Schmerzen litten. Nach 5 Jahren waren aber rund 43% und nach 10 Jahren bereits 77% dieser Patienten gestorben (in der Kontrollgruppe betrug die Sterblichkeit 11% und 33%) - keineinziger wegen seiner Hautkrebserkrankung. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie den möglichen Nutzen der Behandlung erleben konnten, war also tatsächlich gering. Erlebt hatten allerdings 20% dieser Patienten eine Reihe unerwünschter Folgen der Behandlung, nämlich Wundheilungsstörungen, Schmerzen oder Taubheitsgefühle.
Auch wenn die Teilnehmer der Studie aus einer Stadt stammten, viele ehemalige Soldaten waren und es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, sollte künftig bei Interventionsentscheidungen auch die möglicherweise begrenzte Lebenserwartung berücksichtigt werden.
Der in der Reihe "Less is more" der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" am 10. Juni 2013 erschienene Aufsatz Treatment of nonfatal conditions at the end of life von Eleni Linos et al ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.6.13
Hohe Evidenz für die Bedeutung von Patientenerfahrungen als Säule der Versorgungsqualität.
 Eignen sich die Erfahrungen von Patienten als eine der Säulen zur Bewertung der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit von Gesundheitsversorgung oder sollte man dies lieber weiter den Experten überlassen? Wer hier mit "ja" antwortet, muss klären, welche Aspekte und Facetten der Patientenerfahrungen Indikatoren für die klinische Wirksamkeit und die patientenbezogenen Sicherheit bzw. die Ergebnisqualität gesundheitsbezogener Leistungen sind. Und auch hier gilt wie bei medizinischen Indikatoren und Interventionen, dass die Antwort nicht vom "guten Gefühl" bei der Berücksichtigung von Patientenerfahrungen oder -bewertungen abhängig sein darf, sondern von der gesicherten Evidenz ihrer Links oder Assoziationen mit Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit.
Eignen sich die Erfahrungen von Patienten als eine der Säulen zur Bewertung der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit von Gesundheitsversorgung oder sollte man dies lieber weiter den Experten überlassen? Wer hier mit "ja" antwortet, muss klären, welche Aspekte und Facetten der Patientenerfahrungen Indikatoren für die klinische Wirksamkeit und die patientenbezogenen Sicherheit bzw. die Ergebnisqualität gesundheitsbezogener Leistungen sind. Und auch hier gilt wie bei medizinischen Indikatoren und Interventionen, dass die Antwort nicht vom "guten Gefühl" bei der Berücksichtigung von Patientenerfahrungen oder -bewertungen abhängig sein darf, sondern von der gesicherten Evidenz ihrer Links oder Assoziationen mit Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit.
Ein am 3. Januar 2013 im "British Medical Journal (BMJ) Open" veröffentlichter systematischer Review der Ergebnisse von 55 Studien (z-.B. randomisierte kontrollierte Studien, Kohortenanalysen) zu diesen Zusammenhängen liefert zahlreiche Belege für derartige Assoziationen.
Dazu zählen u.a.
• der Nachweis, dass Patientenerfahrungen bei einer Fülle von Erkrankungen, in verschiedenen Studiendesigns (z.B. Surveys, Interviews, strukturierte Patient-Arzt-Gespräche), Settings (z.B. Krankenhäuser, Hausarztpraxen), Bevölkerungsgruppen und Ergebnisparametern (z.B. Anzahl der Arztbesuche, Erkrankungshäufigkeit, Komplikationen) positiv mit Patientensicherheit klinischer Wirksamkeit assoziiert sind, d.h. valide und reliable Hinweise auf die Ausprägungen der beiden Qualitätsparameter liefern,
• die positive und dann auch statistisch signifikante Assoziation von Patientenerfahrungen mit sieben Arten von Behandlungsergebnissen. Dazu zählt das subjektiv wahrgenommene aber auch objektive, d.h. durch Ärzte und andere Experten erhobene oder gemessene Behandlungsergebnis, die Adhärenz bei empfohlenen Medikationen und Behandlungen, die Inanspruchnahme präventiver Versorgungsangebote wie Impfungen und Screening-Untersuchungen, die Anzahl der Besuche oder Inanspruchnahme von Versorgungsressourcen im Krankenhaus oder in ambulanten Arztpraxen, die technische Behandlungsqualität und unerwünschte Ereignisse unter der Behandlung.
• In den 55 berücksichtigten Studien werden für diese sieben Facetten von Behandlungsqualität 312 positive Assoziationen dafür gefunden, dass die Patientenerfahrung verlässliche Hinweise auf die Qualität, d.h. Stärken und Schwächen von Gesundheitsversorgung liefert. Die Anzahl der fehlenden positiven Assoziationen beläuft sich dagegen auf lediglich 66. Überdurchschnittlich häufig finden sich Nachweise für positive Assoziationen bei objektiven Gesundheits-Outcomes (29 positive Assoziationen und 11 Fälle fehlender Assoziation), bei der Adhärenz von Behandlungen (152 und 7) und den unerwünschten Ereignissen (7 und 0). Selbst im Bereich der technischen Behandlungsqualität, wo der Anteil der nachgewiesenen Anzahl positiver Assoziationen unterdurchschnittlich ist, gibt es mit 8 mehr Untersuchungen, die eine positive Assoziation nachweisen als 4 in denen dieser Nachweis nicht zu finden ist.
Die Schlussfolgerungen der britischen Reviewergruppe lauten: Differenzierte und spezifische Patientenerfahrung sollten als einer der "central pillars" in die Bewertung der gesundheitsbezogenen Versorgungsqualität einbezogen werden. Klinische Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenerfahrungen sollten nicht isoliert und einzeln, sondern als Gruppe von Faktoren behandelt werden. Den Erfahrungen von Patienten kommt dabei der evidenzgesicherte Part zu, nutzlose und unsichere Versorgungspraxis verlässlich zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit von Verbesserungen bei der Ergebnisqualität und Sicherheit zu verbessern. Direkt an die Ärzte und andere Experten gewandt weisen die selbst in Krankenhäusern arbeitenden Wissenschaftler abschließend auf eine Schlüsselvoraussetzung für den praktischen Nutzen der von ihnen gefundenen Assoziationen hin: "Clinicians should resist sidelining patient experience measures as too subjective or mood-orientated, divorced from the 'real' clinical work of measuring and delivering patient safety and clinical effectiveness."
Die im deutschen Gesundheitswesen immer noch weit verbreitete Praxis entweder Patienten gar nicht (z.B. in Arztpraxen) und überwiegend nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit (z.B. in Krankenhäusern) zu fragen oder die gewonnenen Ergebnisse als Schrankware zu entsorgen und folgenlos zu machen, sollte nach diesen Ergebnissen ein rasches Ende nehmen.
Auch wenn die Autoren selbst auf Grenzen ihres aktuellen Reviews hinweisen, also z.B. ein Publikationsbias durch die in Veröffentlichungen Bevorzugung von Studien mit positiver Assoziation existieren könnte oder im Moment noch Studien aus den USA relativ stark vertreten sind, verbietet die Ergebnisfülle auf differenzierte Patientenerfahrungen als Qualitätssicherungs-Faktor weiterhin zu verzichten. Trotzdem vorhandene Forschungslücken sollten in weiteren systematischen Reviews möglichst bald geschlossen werden.
Der durch eine vorbildlich informative Dokumentation der berücksichtigten Studien äußerst materialreiche Aufsatz A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness von Cathal Doyle, Laura Lennox und Derek Bell ist in "BMJ Open" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Hilfreich und erneut vorbildlich ist schließlich der Hinweis auf die Möglichkeit, 13 der im Aufsatz zitierten Aufsätze mittels eines entsprechenden Sammellinks ebenfalls komplett kostenlos einsehen zu können.
Bernard Braun, 3.4.13
"Viel hilft viel" - Folgenreicher Irrtum über den Nutzen von Arzneimitteln. Polypharmazie-Studie und Leitlinie Multimedikation
 Polypharmazie oder Multimedikation, d.h. die gleichzeitige Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - so ein Konsens unter Experten -, stellt für viele PatientInnen, Ärzte und Krankenkassen ein quantitativ und qualitativ gewichtiges Problem dar.
Polypharmazie oder Multimedikation, d.h. die gleichzeitige Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - so ein Konsens unter Experten -, stellt für viele PatientInnen, Ärzte und Krankenkassen ein quantitativ und qualitativ gewichtiges Problem dar.
Ein vom Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen erstellter, Ende 2012 veröffentlichter Versorgungsreport der gesetzlichen Krankenkasse hkk, skizziert den derzeitigen Forschungsstand zur Polypharmazie und analysiert mit Routinedaten den Umfang, die Art und die Risiken von Polypharmazie unter den Versicherten dieser Kasse im Jahre 2010.
Die wichtigsten Erkenntnisse der bisherigen Forschung über Polypharmazie sind:
• Ab welcher Anzahl von verordneten oder eingenommenen Arzneimitteln die Fachwelt von Polypharmazie spricht, ist nicht eindeutig. Mehrheitlich gilt aber die Verordnung von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln innerhalb eines festgelegten Zeitraums als Polypharmazie.
• Eine vollständige Erfassung von Polypharmazie ist nur durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Informationsquellen möglich, darunter vor allem Informationen über die Einnahme frei verkäuflicher Medikamente. Bisherige Studien berücksichtigen diesen Aspekt jedoch kaum.
• Die Prävalenz von Polypharmazie in der Gesamtbevölkerung oder in ausgewählten Teilgruppen - wie zum Beispiel Ältere, Frauen oder sozial isolierte Menschen - schwankt je nach Zeitpunkt, Land oder Region erheblich. Dies gilt auch für Verbindungen zwischen Polypharmazie und ausgewählten sozialen Charakteristika untersuchter Personen wie etwa sozialer Status, Alter, Geschlecht oder soziale Situation.
• Polypharmazie wirkt sich in vielerlei Hinsicht und zum Teil auch erheblich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Betroffener aus. Die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Wirkungen (z.B. Wechselwirkungen und viele gleichzeitige Nebenwirkungen, schwächelnde Therapietreue) von Polypharmazie steigt mit dem Alter.
Die wichtigsten Ergebnisse der hkk-Polypharmaziestudie sind:
• 35,6 Prozent aller hkk-Versicherten, die 2010 mindestens ein Arzneimittel verordnet bekamen, sind durchgängig das ganze Jahr von Polypharmazie betroffen. Bei denjenigen, die 65 Jahre und älter sind, steigt dieser Anteil auf 61,3 Prozent.
• Im Falle der hkk-Versicherten gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Anzahl gleichzeitig verordneter, unterschiedlicher Arzneimittel und der Anzahl unterschiedlicher, ambulant gestellter Diagnosen. Polypharmazie ist also in erheblichem Maße die Antwort auf Polymorbidität.
• Untersucht man die gleichzeitige Verordnung unterschiedlicher Arzneimittel in Quartalen, so schwankt der Anteil der Polypharmazie-Betroffenen insgesamt zwischen 15,7 Prozent und 17,4 Prozent. Bei den Versicherten, die 65 Jahre und älter sind, steigt dieser Anteil je nach Quartal auf minimal 33,8 Prozent und maximal 34,8 Prozent an.
• Unter allen pflegebedürftigen hkk-Versicherten waren 83,4 Prozent von Polypharmazie betroffen.
• Der Anteil der von Polypharmazie betroffenen hkk-Versicherten unter denjenigen, die wegen einer unerwünschten Arzneimittelwirkung stationär behandelt werden mussten, betrug 71,2 Prozent.
• Das Risiko von Polypharmazie stieg mit der Anzahl unterschiedlicher Ärzte. Von den hkk-Versicherten, die von fünf und mehr Ärzten behandelt und denen dabei Arzneimittel verordnet wurden, waren fast immer nahezu 100 Prozent von Polypharmazie betroffen.
Will man Polypharmazie in nennenswertem Umfang verringern oder gar vermeiden reichen nach Meinung zahlreicher Wissenschaftler und Versorgungspraktiker weder ein- oder auch mehrmalige Appelle an verordnende Ärzte und betroffene PatientInnen noch einzelne praktische Interventionen oder allein Informationsschriften aus. Vielmehr bedarf es einer langfristigen, kombinierten Strategie für und mit Ärzten und Patienten. Diese muss zunächst ein gemeinsames Problembewusstsein über die Existenz und das damit verbundene Risiko von Polypharmazie sowie die Notwendigkeit verschiedener präventiver und kurativer Maßnahmen erzeugen. Danach müssen diese mit langem Atem und unter Beteiligung aller Akteure einschließlich der Krankenkassen umgesetzt und auf Wirksamkeit untersucht werden. Zu den wichtigsten Voraussetzungen - so auch die Meinung zweier für den Versorgungsreport interviewter Bremer Ärzte - gehört eine Leitlinie für die medikamentöse Behandlung multimorbider PatientInnen, die es ermöglicht bestimmte Medikamente abzusetzen, um damit mögliche unerwünschte Ereignisse durch Polypharmazie zu vermeiden aber keinen gesundheitlichen Schaden anzurichten.
Die am 16. Januar 2013 veröffentlichte fast einhundert Seiten umfassende "Hausärztliche Leitlinie. Multimedikation. Empfehlungen zum Umgang mit Multimedikation bei Erwachsenen und geriatrischen Patienten" der Leitliniengruppe Hessen stellt einen wichtigen Beitrag für die künftige hausärztliche Verordnungs-, Beratungs- und Steuerungspraxis dar. In der Leitlinie findet man auch einen umfassenden Überblick zur Forschungslage und zu Grundfragen des Medikationsprozesses in Hausarztpraxen. Die Leitlinie ist vollständig kostrenlos erhältlich.
Die bis 2016 gültige Leitlinie Multimedikation wurde in Kooperation mit Mitgliedern der »Ständigen Leitlinien-Kommission der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin« (DEGAM), der einzigen wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin in Deutschland, erarbeitet. Die Moderation der Leitliniensitzungen, die wissenschaftliche Begleitung und Konzeption hausärztlicher Leitlinienerarbeitung erfolgt durch die "PMV forschungsgruppe" von der Universität zu Köln. Zur Erstellung der Leitlinie führte das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ, Berlin) eine systematische Literaturrecherche durch. Die erarbeiteten Leitlinien werden über das ÄZQ [www.leitlinien.de] und die PMV forschungsgruppe regelmäßig im Internet veröffentlicht.
Der 45 Seiten umfassende hkk-Versorgungsreport 2012 "Polypharmazie" ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.2.13
Auch bei akuter Bronchitis Älterer schaden Antibiotika mehr als sie nutzen, außer bei begründetem Verdacht auf Lungenentzündung
 Die geläufigsten Argumente, bei Infektionen der oberen und besonders der unteren Atemwege Antibiotika zu verordnen, waren, dass dies "für alle Fälle" zur Verhinderung einer Lungenentzündung erfolge, man ja nie wisse ob es statt eines Virus- ein bakterieller Infekt sei bzw. die Klärung der Infektionsverursachers so aufwändig ist, dass "im Zweifelsfall" lieber Antibiotika verordnet werden und es z.B. bei Bronchitis "gut wäre" ein schnelles Ende zu erreichen, um eine Chronifizierung zu verhindern. Untersucht wurden der Wahrheitsgehalt bzw. die Evidenz für diese Annahmen und der Nutzen dieser Therapie bisher eher selten. Für die möglichen unerfreulichen Nebenwirkungen und vor allem das Risiko von Resistenzbildungen gab es dagegen bereits zahlreiche empirische Belege.
Die geläufigsten Argumente, bei Infektionen der oberen und besonders der unteren Atemwege Antibiotika zu verordnen, waren, dass dies "für alle Fälle" zur Verhinderung einer Lungenentzündung erfolge, man ja nie wisse ob es statt eines Virus- ein bakterieller Infekt sei bzw. die Klärung der Infektionsverursachers so aufwändig ist, dass "im Zweifelsfall" lieber Antibiotika verordnet werden und es z.B. bei Bronchitis "gut wäre" ein schnelles Ende zu erreichen, um eine Chronifizierung zu verhindern. Untersucht wurden der Wahrheitsgehalt bzw. die Evidenz für diese Annahmen und der Nutzen dieser Therapie bisher eher selten. Für die möglichen unerfreulichen Nebenwirkungen und vor allem das Risiko von Resistenzbildungen gab es dagegen bereits zahlreiche empirische Belege.
Eine aktuelle Studie mit 1.038 (Interventionsgruppe) und 1.023 (Kontroll-/Placebogruppe) über 60-jährigen PatientInnen mit Infektionen der unteren Atemwege untersuchte nun den Nutzen und Schaden des bei Bronchitis etc. häufig eingesetzten Antibiotikums Amoxicillin. Ausgeschlossen wurden PatientInnen mit nichtinfektiösen Ursachen ihrer Atemwegsinfekte und Personen bei denen der Verdacht auf eine bereits vorhandene Lungenentzündung bestand.
Die Ergebnisse:
• Mit Symptomen, die im Krankheitsverlauf auftraten oder sich verschlechterten, hatten die Antibiotika-PatientInnen statistisch signifikant weniger häufig zu kämpfen (15,9%) als die Angehörigen der Kontrollgruppe (19,3%). Der Unterschied war aber absolut recht gering.
• Bei der Dauer der Symptome gab es keine Unterschiede.
• Die StudienautorInnen sahen daher keine Evidenz für einen selektiven Nutzen des Antibiotikums Amoxicillins bei über 60-jährigen PatientInnen und empfehlen bei akuter Bronchitis, kein Antibiotikum zu verordnen und einzunehmen. Davon raten sie nur dann ab, wenn ein diagnostisch oder durch den Gesamtzustand des Patienten begründeter Verdacht auf eine Lungenentzündung vorliegt.
• Bei den mit dem Antibiotika behandelten PatientInnen traten Übelkeit, Hautausschläge oder Durchfall statistisch signifikant häufiger auf.
Die Autoren setzen sich selber mit einigen anderslautenden Ergebnissen und Empfehlungen in dem 2004 erschienen und 2010 geupdateten Cochrane-Review "Antibiotics for acute bronchitis" von Smith S, Fahey T, Smucny J, Becker L. auseinander und liefern plausible Begründungen für die Ursache der Unterschiede und für die höhere Gültigkeit ihrer Ergebnisse.
Trotzdem waren auch die Cochrane-Reviewer gegenüber dem Einsatz sämtlicher Antibiotika eher zurückhaltend: "There is limited evidence to support the use of antibiotics in acute bronchitis. Antibiotics may have a modest beneficial effect in some patients with acute bronchitis though data on subsets of patients who may benefit more from treatment is lacking. However, the magnitude of this benefit needs to be considered in the broader context of potential side effects, medicalisation for a self limiting condition, increased resistance to respiratory pathogens and cost of antibiotic treatment."
Von dem Aufsatz "Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial" von Paul Little et al., erschienen in der Februarausgabe 2013 der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" (Volume 13, Issue 2, Pages 123 - 129) gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 28.1.13
Wie wichtig sind bei Generika andere Merkmale als die Bioäquivalenz für die Therapietreue und den gesundheitlichen Nutzen?
 Eine immer größere Anzahl von Arzneimitteln sind Generika, d.h. Mittel mit Wirkstoffen deren Patentschutz ausgelaufen ist und die jetzt von verschiedenen Pharmaunternehmen zumeist preisgünstiger angeboten werden als zuvor vom Patentinhaber. Generika sind also ein gewichtiges Mittel im jahrzehntelangen Versuch, die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung ohne Qualitätseinbußen zu senken oder zumindest nicht weiter zunehmen zu lassen.
Eine immer größere Anzahl von Arzneimitteln sind Generika, d.h. Mittel mit Wirkstoffen deren Patentschutz ausgelaufen ist und die jetzt von verschiedenen Pharmaunternehmen zumeist preisgünstiger angeboten werden als zuvor vom Patentinhaber. Generika sind also ein gewichtiges Mittel im jahrzehntelangen Versuch, die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung ohne Qualitätseinbußen zu senken oder zumindest nicht weiter zunehmen zu lassen.
Unabdingbar für die Qualität der Behandlung mit Arzneimitteln und deshalb auch im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit ist die Pflicht zur Bioäquivalenz, d.h. der Wirkstoffgleichheit und -sicherheit mit dem der Markenpräparate. Für die Form oder die Farbe der Generika gibt es dagegen keine Pflicht, den Markenpräparaten gleich zu sein.
Ob dies ein Problem für die Versorgungsqualität darstellt, untersuchte nun eine us-amerikanische Forschergruppe für die Behandlung von 11.472 PatientInnen, denen wenigstens dreimal hintereinander Anti-Epileptika verordnet wurden und die dann eine Folgeverordnung verpassten, also therapieuntreu wurden (unerwartet nur 1,2% aller PatientInnen) und für 50.050 Anti-Epileptika-PatientInnen einer Kontrollgruppe, die therapietreu geblieben waren. Den meisten dieser PatientInnen wurden sieben der Generika-Präparate gegen epileptische Anfälle, Gemütsleiden oder chronische Schmerzen verordnet. Der Anteil von Generika an allen verordneten Arzneimitteln in diesem Indikationsbereich betrug nahezu 80%. Die Mittel, sämtliche Generika, wurden in 37 Farben und zum Teil in verschiedenen Formen und Größen angeboten.
Analysen des für soziodemografische Merkmale (z.B. Alter) und für Behandlungsformen adjustierten Nutzungsverhalten (damit ist der mögliche Einfluss dieser Merkmale auf das Einnahmeverhalten rechnerisch ausgeschlossen) zeigten Folgendes:
• Die Wahrscheinlichkeit mit der PatientInnen ihre gesundheitlich notwendige Weiterbehandlung unterbrachen, also therapieuntreu wurden, wird signifikant durch eine Veränderung der Farbe des Medikaments erhöht. Sie steigt im Vergleich mit dem Verhalten der PatientInnen ohne ein andersfarbiges Medikament insgesamt um 27%.
• Diese Wahrscheinlichkeit lag bei PatientInnen mit einem behandlungsbedürftigen Anfallleiden sogar um 53% höher.
• Unterschiedliche Formen wirkten sich dagegen nicht auf die Therapietreue aus.
Je mehr Generika eines Wirkstoffs auf den Markt kommen und verordnet werden desto größer wird die Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit, dass ihre Hersteller versuchen, sich voneinander zu unterscheiden. Nach den Ergebnissen der Studie muss dabei gründlicher als bisher bedacht und notfalls reguliert werden, dass alle möglichen Unterschiede zu Marken- oder auch anderen Generika-Medikamenten wegen der möglichen gesundheitlichen Nachteile unzureichender Therapietreue nicht zu groß sein dürfen.
Von dem am 31.12.2012 im "Archives of Internal Medicine" online erschienenen Aufsatz "Variations in pill appearance of antiepileptic drugs and the risk of nonadherence." von Kesselheim AS et al. gibt es den gesamten Text im Moment kostenlos.
Bernard Braun, 23.1.13
OLG-Rechtsprechung zum Zweiten: Wer für ein 'gesundheitsförderndes' Produkt wirbt, muss dies wissenschaftlich beweisen können!
 Nachdem bereits das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main in einem Urteil verlangt hat, dass Produkte für die mit gesundheitlichen Wirkungen geworben wird, diese auch nachweisbar haben müssen (vgl. dazu den ausführlichen Forums-Beitrag) kommt das Oberlandesgericht Koblenz in einem Urteil vom 10. Januar 2013 bezogen auf ein anderes Produkt und seine werbliche Vermarktung praktisch zum selben Ergebnis.
Nachdem bereits das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main in einem Urteil verlangt hat, dass Produkte für die mit gesundheitlichen Wirkungen geworben wird, diese auch nachweisbar haben müssen (vgl. dazu den ausführlichen Forums-Beitrag) kommt das Oberlandesgericht Koblenz in einem Urteil vom 10. Januar 2013 bezogen auf ein anderes Produkt und seine werbliche Vermarktung praktisch zum selben Ergebnis.
Der Entscheidung des OLG Koblenz lag der Prospekt eines Warenhauses zugrunde in dem es für Fitnesssandalen warb. Die Werbung behauptete, die Sandale "kann helfen, Cellulite vorzubeugen", "kann helfen, die Muskulatur zu kräftigen", "unterstützt eine gute Haltung" und die "runde Sohlenform unterstützt die natürliche Rollbewegung des Fußes". Zudem wurde in einer Abbildung eine erhöhte Muskelaktivität der Beine um bis zu 20% im unteren Bereich, bis zu 13% im mittleren Bereich und bis zu 30% im oberen Bereich behauptet.
Dagegen klagte ein Verein zu dessen Aufgabe die Wahrung der Wettbewerbsregeln im Interesse seiner Mitglieder gehört, mit der Feststellung die werbenden Aussagen seien unrichtig und sollten unterlassen werden. Trotz eines Erfolgs dieser Klage beim Landgericht Mainz ging das Warenhaus dann beim OLG in Berufung. Im ersten Prozess hatte ein Sachverständiger gegutachtet, die in der Werbung aufgeführten Effekte seien wissenschaftlich nicht belegt.
In seinem Urteil untersagte der der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz (Urteil vom 10. Januar 2013, Az.: 9 U 922/12) entgültig, die Werbung der Beklagten sei irreführend. Die dazu bisher veröffentlichte Pressemitteilung fasst den Tenor des Urteils so zusammen: "Es sei nicht wissenschaftlich erwiesen, dass das Tragen der Sandalen die behaupteten Effekte zeige. Wer mit gesundheitlichen Wirkungen von Produkten werbe, müsse besonders strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Aussagen erfüllen. Wenn aber eine gesundheitsfördernde Wirkung nicht hinreichend wissenschaftlich belegt werden könne, sei die Werbung zur Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher geeignet und damit irreführend. Aufgrund dieser Irreführung wurde der Beklagten untersagt, mit diesen Aussagen für die Fitnesssandalen zu werben."
Sicherlich ist es nach den beiden Urteilen möglich, den künftigen Verbraucherschutz in Sachen Gesundheit weiteren Land-, Oberlandes- und last not least dem Bundesgerichtshof zu überlassen. Darüber gehen weitere Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt ins Land und in dieser Zeit werden Tausende von Anbieter für Zehntausende weiterer Produkte und Dienstleistungen ohne einen Fetzen von Nutzen- oder Wirksamkeitsnachweis oder sogar trotz nachgewiesener Unwirksamkeit mit "Gesundheits"-Prädikaten werben, damit Milliarden Euro umsetzen und Millionen von Verbrauchern und zum Teil auch PatientInnen täuschen. Die Alternative wären eindeutige gesetzliche Regelungen, deren rechtlich solide Grundlage mit den Urteilsbegründungen der RichterInnen zweier OLGs bereits vorliegt.
Die Pressemitteilung zum Urteil des OLG Koblenz ist kostenlos erhältlich.
Das lesenswerte Urteil ist über die Entscheidungsdatenbank der Justiz Rheinland-Pfalz das o.g. Aktenzeichen und die Suchbegriffe Oberlandesgericht und Sandalen komplett kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 19.1.13
"Gesundheitsmonitoring und -management aus der Hosentasche!" oder wie verlässlich sind Gesundheits-Apps?
 Die Versprechungen und Hoffnungen, die mit der Informationstechnologie und besonders für den Alltag von Gesundenmit den immer zahlreicher werdenden Gesundheits-Applikationen (Apps) für Smartphones verbreitet und gehegt werden, wachsen explosionsartig. Dies gilt unabhängig davon, ob es um die laufende Blutdruck- oder zuckermessung, Erinnerungen an die Einnahme von Arzneimitteln oder die Ermittlung, Dokumentation, Berechnung zahlreicher Körperwerte oder -erscheinungen und deren Online-Weitergabe an medizinisch-technische Zentren geht. Wie leider bei vielen "alten" Gesundheitsleistungen üblich, werden Zweifel an der Verlässlichkeit und dem Nutzen solcher Apps nicht ernst genommen oder als moderne Maschinenstürmerei ins Abseits diskutiert.
Die Versprechungen und Hoffnungen, die mit der Informationstechnologie und besonders für den Alltag von Gesundenmit den immer zahlreicher werdenden Gesundheits-Applikationen (Apps) für Smartphones verbreitet und gehegt werden, wachsen explosionsartig. Dies gilt unabhängig davon, ob es um die laufende Blutdruck- oder zuckermessung, Erinnerungen an die Einnahme von Arzneimitteln oder die Ermittlung, Dokumentation, Berechnung zahlreicher Körperwerte oder -erscheinungen und deren Online-Weitergabe an medizinisch-technische Zentren geht. Wie leider bei vielen "alten" Gesundheitsleistungen üblich, werden Zweifel an der Verlässlichkeit und dem Nutzen solcher Apps nicht ernst genommen oder als moderne Maschinenstürmerei ins Abseits diskutiert.
Dass dies kurzschlüssig ist und möglicherweise gesundheitlich nachteilig, zeigt eine gerade veröffentlichte kleine Studie zur diagnostischen Verlässlichkeit von Apps, die ihren Nutzern versprechen, Hautveränderungen oder -verletzungen und Muttermale visuell untersuchen zu können und dabei Melanome, d.h. eine äußerst aggressive Hautkrebsform erkennen zu können. Dazu wurden von einer Forschergruppe der Universität Pittsburgh 188 Bilder von Melanomen und vorher von Dermatologen als harmlos diagnostizierten Hautflecken zusammengestellt, welche mit den Apps optisch untersucht wurden.
Die Ergebnisse weisen auf ein massives Verlässlichkeitsproblem bei den zum Einsatz gekommenen weit verbreiteten vier Apps hin:
• Die Trefferquote oder Sensitivität der Apps schwankte zwischen 6,8% und 98,1%. Sensitivität gibt an bei wie vielen erkrankten Patienten die jeweilige Krankheit durch die Anwendung des Tests tatsächlich erkannt wird, d.h. ein positives Testresultat auftritt. Die Spezifität, also die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Gesunde, die nicht an der betreffenden Erkrankung leiden, im Test auch als gesund erkannt werden, schwankt zwischen 30,4% und 93,7%
• Drei der vier Programme schätzten mindestens 30% der Melanome als harmlos ein. Sie wiegen ihre Nutzer also in eine falsche Sicherheit, und verhindern damit die bei dieser sehr schnell wachsenden und metastasierenden Krebsart notwendige sofortige Behandlung.
• Dabei erwiesen sich vor allem die Apps als unzuverlässiger oder fehlerhafter, bei denen die Diagnose durch eine spezielle automatische Bildererkennungssoftware mit einem entsprechenden Algorithmus gestellt wurde. Die mehr oder weniger bessere App schickte die Daten zur Beurteilung an ein dermatologisches Diagnose-Zentrum, das dann den Nutzer per Mail oder SMS über das Ergebnis informierte. Dass aber auch bei dieser App Fehldiagnosen auftraten zeigt, dass beim Verdacht auf ein Melanom die letzte Gewissheit einer Bewertung von Hautveränderungen nur durch eine mikroskopische Untersuchung einer Hautprobe durch einen Dermatologen gewonnen werden kann.
Im Lichte dieser Ergebnisse und angesichts der mit Sicherheit von der Gesundheitswirtschaft weiterhin in Hülle und Fülle angebotenen derartigen "do-it-yourself"-Gesundheitshilfen, sollte so frühzeitig wie möglich für zweierlei gesorgt werden:
• Obligatorische Überprüfung der Verlässlichkeit und Qualität aller mit dem Image des "Gesundheits"-Hilfsmittel werbenden Produkte der "neuen" Gesundheitswirtschaft
• Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung entweder das Verbot des Anbietens als "Gesundheits"-Hilfe oder sogar bei entsprechend hohem Risiko von Fehldiagnosen oder falscher Sicherheit ein Verbot des Marktzugangs.
Der am 16. Januar 2013 im Fachjournal "JAMA Dermatology" (2013;():1-4) erschienene Aufsatz "Diagnostic Inaccuracy of Smartphone Applications for Melanoma Detection" von Joel A. Wolf et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.1.13
"Stumme Fehldiagnose" - vermeidbar durch Shared Decision Making
 Das Wort Diagnose bedeutet laut Duden "unterscheidende Beurteilung, Erkenntnis". In der Medizin bezieht sich der Begriff bislang auf die Bestimmung der Krankheit auf Grundlage der Krankheitszeichen. Al Mulley und Kollegen beschreiben in einem Beitrag im British Medical Journal ein erweitertes Verständnis von Diagnose, das sich darauf bezieht, Behandlungsentscheidungen auf das Erkennen bzw. die Diagnose der Präferenz des Patienten "zu gründen.
Das Wort Diagnose bedeutet laut Duden "unterscheidende Beurteilung, Erkenntnis". In der Medizin bezieht sich der Begriff bislang auf die Bestimmung der Krankheit auf Grundlage der Krankheitszeichen. Al Mulley und Kollegen beschreiben in einem Beitrag im British Medical Journal ein erweitertes Verständnis von Diagnose, das sich darauf bezieht, Behandlungsentscheidungen auf das Erkennen bzw. die Diagnose der Präferenz des Patienten "zu gründen.
In dem Beitrag geht es um 2 zwei hypothetische Patientinnen. Beiden wurde wegen Brustkrebs eine Brust operativ entfernt. Eine der Patientinnen erfährt nach der Operation, dass bei ihr kein Krebs vorlag, die Gewebeproben waren vertauscht. Die andere Patientin erfährt, dass bei Patientinnen ihres Alters eine Hormontherapie zu vergleichbaren Ergebnissen führt wie eine Operation und bedauert ihre Einwilligung in die Operation zutiefst.
Bei beiden Patientinnen liegt eine Fehldiagnose vor. Die Fehldiagnose infolge vertauschter Proben ist eine medizinische Fehldiagnose, die nicht unbemerkt bleibt und zu korrigierenden Maßnahmen bezüglich der Abläufe führen dürfte, möglicherweise auch zu juristischen Schritten von Seiten der Patientin.
Die Fehldiagnose infolge unzureichender Information und fehlender Möglichkeit, die bevorzugte Behandlung zu wählen, bezeichnen die Autoren als "Präferenzfehldiagnose". Die Präferenzfehldiagnose sei eine "stumme Fehldiagnose", weil sie zumeist nicht wahrgenommen werde, weder vom Arzt noch vom Patienten.
Die Autoren plädieren daher dafür, den Begriff Diagnose zu erweitern.
Die richtige Behandlung erfordert eine präzise
• medizinische Diagnose und
• Präferenzdiagnose
Die Diagnose der Krankheit ist ein grundlegendes Element ärztlicher Tätigkeit, das seit der Frühzeit der Medizin hohe Aufmerksamkeit erfährt.
Die Diagnose der Päferenz ist dagegen ein neuartiges Konzept, dass durch eine Arzt-Patient-Kommunikation in Sinne des Shared Decision Making realisiert werden kann.
Die Autoren beschreiben dafür eine Arzt-Patient-Kommunikation in drei Schritten, die sie als "team talk", "option talk" und decision talk" bezeichnen.
Im team talk geht es darum, dem Patienten zu vermitteln, dass es mehr als eine Behandlungsoption gibt und die richtige Wahl davon abhängt, was dem Patienten am wichtigsten ist. Dies herauszufinden erfordert "Teamarbeit" von Arzt und Patient und ggf. unter Einschluss von Angehörigen und Freunden.
Option talk umfasst die Darstellung und den Vergleich der Begleitumstände und der zu erwartenden erwünschten und unerwünschten Ergebnisse der Behandlungsoptionen. Ziel ist es, auch emotional belasteten und zu irrationalen Präferenzen tendierenden Patienten realistische Vorstellungen zu vermitteln. Entscheidungshilfen (decision aids) haben sich als unterstützende Maßnahme bewährt.
Decision talk bezieht sich auf die Unterstützung bei der Entscheidung. Dafür bringt der Patient die zu erwartenden Behandlungsergebnisse, nachdem er sie verglichen hat, in eine Rangfolge und wählt die dazu passende Behandlung.
Diese neue Ausformung des Shared Decision Making-Konzepts wird derzeit an 2 Standorten in England und Wales im Rahmen des MAGIC-Programms erprobt. In Newcastle geht es z.B. um Behandlungsentscheidungen bei Brustkrebs (Link). Dafür wird den Patientinnen u.a. ein Option grid zur Verfügung gestellt, eine Darstellung der Kerninformationen zu den Optionen brusterhaltende Operation vs. Brustamputation auf einer Seite (Download).
Mulley AG, Trimble C, Elwyn G. Stop the silent misdiagnosis: patients' preferences matter. BMJ 2012;345. Link
ausführliche Darstellung des Themas:
Mulley A, Chris Trimble, Elwyn G. Patients' preferences matter. Stop the silent misdiagnosis, King's Fund 2012, Website
Download
MAGIC - Making Good Decisions in Collaboration Link
David Klemperer, 3.12.12
Über- und Fehlversorgung mit Antibiotika bei Kleinkindern könnte entzündliche chronische Darmerkrankungen im höheren Alter fördern
 Zu den bekannten unerwünschten Nah- und Fernwirkungen der Verordnung und Einnahme von gesundheitlich nicht notwendigen und damit völlig nutzlosen Antibiotika gehört der Public Health-relevante Effekt der Förderung resistenter Bakterien. Zu diesen Risiken gesellen sich aber auch noch andere langfristige negative Wirkungen für die sinnlos mit Antibiotika behandelten Personen.
Zu den bekannten unerwünschten Nah- und Fernwirkungen der Verordnung und Einnahme von gesundheitlich nicht notwendigen und damit völlig nutzlosen Antibiotika gehört der Public Health-relevante Effekt der Förderung resistenter Bakterien. Zu diesen Risiken gesellen sich aber auch noch andere langfristige negative Wirkungen für die sinnlos mit Antibiotika behandelten Personen.
Eine jetzt abgeschlossene explorative Fall-Kontroll-Studie über mögliche Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit der meist mit Antibiotika behandelten Mittelohrentzündungen im Alter bis 5 Jahren und der Häufigkeit einer Reihe von Darmerkrankungen (z.B. Morbus Crohn) im höheren Kindes- und Jugendlichenalter untermauert diese Zusammenhänge. An der Studie nahmen zum einen 294 Kinder mit einem Durchschnittsalter von 13 Jahren teil, die zwischen 1989 und 2008 an einer entzündlichen Erkrankung des Darmes gelitten hatten. Zum anderen stellten 2.377 Kinder, die im Alter, dem Geschlecht und der Region zu den erstgenannten Kindern passten aber keine Darmentzündungen aufwiesen die Kontrollgruppe.
Das Ergebnis einer aufwändigen multivariaten Analyse der beiden Gruppen sah so aus:
• 5% der Angehörigen der Erkranktengruppe und 12% der Angehörigen der Kontrollgruppe waren vor der Studie nicht an einer Mittelohrentzündung erkrankt.
• Im Alter von 5 Jahren hatten 89% der an einer Darmentzündung erkrankten Kinder mindestens eine Mittelohrentzündung hinter sich, wohingegen es bei den Kontrollkindern 82% waren.
• Die Wahrscheinlichkeit mit der diejenigen Kindern, die im Alter von 5 Jahren mindestens eine mit Antibiotika behandelte Mittelohrentzündung hinter sich hatten, eine Darmentzündung bekamen war statistisch signifikant um das 2,8-Fache höher als bei Kindern ohne eine Mittelohrentzündung in diesem Lebensabschnitt. Die Wahrscheinlichkeit einer Morbus Crohn-Erkrankung war um das 2,7-Fache größer, die der chronisch entzündlichen Colitis ulcerosa um das 3-Fache größer. Das am häufigsten eingesetzte Antibiotikum war Penicillin.
• Die kanadischen ForscherInnen vermuten, dass die frühkindliche Antibiotika-Behandlung die Darmflora so stark verändert hat, dass sich die genannten Darmentzündungen besser entwickeln konnten als bei den Kindern ohne Antibiotika im Zusammenhang mit einer Mittelohrentzündung.
Obwohl die retrospektive Methode der Studie keine kausalen Zusammenhänge nachweist und keine kausalen Schlussfolgerungen zulässt, sollten die statistischen Assoziationen Anlass sein, noch sorgfältiger über die gesundheitliche Notwendigkeit und den Sinn eines kritiklosen Einsatzes von Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen nachzudenken - und natürlich weiter zu forschen.
Von dem am 19. Oktober 2012 elektronisch vorab publizierten Aufsatz "Association between early childhood otitis media and pediatric inflammatory bowel disease: An exploratory population-based analysis" von Shaw SY et al. in der Zeitschrift "Journal of Pediatrics" gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 12.11.12
Ein Lehrbeispiel!? Wie in der größten US-for-profit-Krankenhauskette "outbreaks of stents" oder "EBDITA"-Ärzte zum Alltag gehören
 Öffentlich werdende Vorfälle, dass in Krankenhäusern gesundheitlich nicht notwendige oder gerechtfertigte Untersuchungen und Operationen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen stattfinden, werden fast schon routinemäßig als "einmalige Ausrutscher", als Werk eines "schwarzen Schafs" oder als "Ausreißergeschehen" kleiner, unprofessionell geführter Krankenhäuser charakterisiert.
Öffentlich werdende Vorfälle, dass in Krankenhäusern gesundheitlich nicht notwendige oder gerechtfertigte Untersuchungen und Operationen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen stattfinden, werden fast schon routinemäßig als "einmalige Ausrutscher", als Werk eines "schwarzen Schafs" oder als "Ausreißergeschehen" kleiner, unprofessionell geführter Krankenhäuser charakterisiert.
Umso bedeutender sind die zwischen dem Jahr 2000 und 2010/11 rund 1.200 Ereignisse von vermutlich gesundheitlich nicht notwendigen und damit zum Teil auch für die Gesundheit von PatientInnen gefährlichen Untersuchungen in Herzkatheterlabors oder das Einpflanzen von Gefäßstents in mehreren Kliniken der mit 163 Einrichtungen größten for-profit-Krankenhauskette der USA - HCA (Hospital Corporation of America). Mehr als 80% der Kliniken dieser Kette befinden sich nach eigenen Angaben auch unter den 10% der nach dem staatlichen Qualitäts-Ranking besten Krankenhäuser der USA. Blind darauf zu vertrauen, dass auch die restlichen knapp 20% Musterbetriebe sind, wäre aber eindeutig ein Irrtum. Den unerwünschten Ereignissen wird jetzt mit dem Schwerpunkt im Bundesstaat Florida in einer gerichtlichen Untersuchung nachgegangen. Diese Häuser tragen interessanterweise mit über 20% zum Gewinn von HCA bei.
In einem langen fundierten Beitrag in der angesehenen Tageszeitung "New York Times" (NYT), dokumentieren die Autoren die lange Kette dieser Ereignisse. So wurde in einem vertraulichen internen Bericht aus dem Jahr 2010 für ein HCA-Großkrankenhaus z.B. eingeräumt, dass bei rund der Hälfte teurer invasiver diagnostischer Tests mittels eines Katheters, keine signifikante Herzerkrankung vorlag. Im Jahr 2000 untersuchte das Justizministerium, ob HCA nicht der staatlichen Krankenversicherung Medicare rund 1,7 Milliarden US-Dollar zu viel in Rechnung gestellt hatte. Der damals verantwortliche HCA-Vorstand, Rick Scott, musste sich dafür nie rechtlich und faktisch verantworten und ist heute Governeur von Florida. 2004 stellte eine damit von HCA beauftragte externe Gruppe von Qualitätssicherungsexperten vertraulich fest, dass in einem bereits zuvor auffällig gewordenen Krankenhaus 43% der invasiven Öffnungen und Erweiterungen von verkalkten Arterien, so genannte Angioplastien) in keiner Weise anerkannten Standards entsprachen. Andere bei HCA tätigen Kardiologen fälschten diagnostische Daten so, dass sie kardiologisch relevante Gefäßoperationen durchführen konnten. Aus Blutgefäßen, deren zwischen 33% und 53% durch Verkalkung etc. verkleinert waren, wurden Blockaden zwischen 80% und 90%. Wenn Letzteres der Fall ist, ist eine operative Behandlung indiziert. In anderen Kliniken der Krankenhaus-Kette brachen in mehgreren Jahren medizinisch unerklärbare Wellen der Implantation von teuren Gefäß-Stents aus. Und schließlich warb die Krankenhaus-Kette in einem Business Plan aus dem Jahr 2008 mit einem beschäftigten Arzt als "our leading EBDITA MD". Diese Abkürzung bezieht sich nicht auf eine besondere medizinische oder ärztliche Fähigkeit oder Fertigkeit, sondern auf die Fähigkeit "earnings before interest, taxes, depreciation and amortization" zu generieren, also die Fähigkeit des Arztes, den Gewinn des Krankenhauses zu mehren. Wenige Monate zuvor war demselben Arzt intern vorgehalten worden, er führe zu schnell Katheteruntersuchungen durch und untersuche nicht ausreichend, ob die Patienten den invasiven und damit potenziell gesundheitsgefährdenden und teuren Eingriff benötigten oder nicht.
Auch wenn HCA oder die beteiligten Ärzte viele der Vorwürfe letztlich bestätigen mussten, sprechen sie anderen Vorwürfen ihre Berechtigung ab. Angesichts der seit 2010 bekannt gewordenen Über- oder Fehlversorgungsfälle wird HCA laut NYT aber nichts anderes übrigbleiben als "still more reviews" durchzuführen und zu veröffentlichen.
In Deutschland ist natürlich HCA (bisher) nicht tätig, für andere gewinnorientierte Krankenhausketten in den USA fehlen vergleichbare Ereignisketten und so etwas kommt "natürlich" in keinem deutschen Krankenhaus vor. Besser wäre aber trotzdem eine vergleichbare längsschnittliche krankenhausbezogene Transparenz und Berichterstattung über solche und andere unerwünschten Ereignisse in deutschen Krankenhäusern und Tageszeitungen. Dass viele Qualitätsmerkmale der stationären Behandlung im Rahmen der externen bzw. sektorenübergreifenden vergleichenden Qualitätssicherung von BQS und AQUA noch nicht untersucht werden, die Ergebnisse der untersuchten Indikatoren oder die Ergebnisse der strukurierten Dialoge meist nur anonym berichtet werden, ist aber nicht geeignet Ironie zu dämpfen und uneingeschränktes Vertrauen in das Nichtvorkommen solcher Ereignisketten zu fördern.
Der ausführliche Bericht der NYT vom 6.8.2012 "Hospital Chain Inquiry Cited Unnecessary Cardiac Work" von Reed Abelson und Julie Creswell ist komplett kostenlos erhältlich und verschafft einem dank einiger Links einen guten Blick hinter die Kulissen.
Wer aktuell mehr über die systematischen Bemühungen zur Qualitätstransparenz in deutschen Krankenhäusern erfahren will, kann sich z.B. den kostenlos erhältlichen Abschlussbericht 2011 zum Strukturierten Dialog gemäß §15 Abs. 2 QSKH-RL über die Maßnahmen und Ergebnisse der geführten Strukturierten Dialoge anschauen, die im Jahr 2011 auf Basis der Daten des Erfassungsjahres 2010 durchgeführt wurden. Er kann sich auch den Anhang zum Abschlussbericht 2011 anschauen.
Und wer noch mehr über die Realität der eher bundesland- statt auch krankenhausbezogenen Qualitätsberichterstattung mit den BQS/AQUA-Qualitätsindikatoren wissen will, dem ist der "Bericht zur Schnellprüfung und Bewertung der Indikatoren der externen stationären Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Eignung für die einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung" mit Stand Juni 2011 zu empfehlen. Dort erfährt er u.a. dass und warum "von den 316 geprüften Hauptkennzahlen … 48 ohne Einschränkung zur Veröffentlichung empfohlen (wurden). 134 wurden mit Erläuterungen oder leichter Anpassung zur Veröffentlichung empfohlen. Für 108 Indikatoren wurde eine Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Weitere 26 wurden nicht zur Veröffentlichung empfohlen."
Bernard Braun, 28.10.12
Mehr Wirtschaft als Gesundheit - Staatliche Förderung für IgeL
 Unübersehbaren Optimismus offenbarte zunächst die Berliner Zeitung Ende Juli 2012 mit ihrem Artikel Bundesregierung überprüft Verkaufstrainings für Ärzte. Wie im Forum Gesundheitspolitik bereits Mitte Juni in dem Beitrag Öffentliche Förderung des Verkaufstrainings für IGeL-Angebote nachzulesen war, hat das Haus des ehemaligen Gesundheits- und jetzigen Wirtschaftministers Philipp Rösler das ständige Gerede des Ressortchefs von der Gesundheits-Wirtschaft überaus wörtlich genommen und tatkräftig in die Praxis umgesetzt.
Unübersehbaren Optimismus offenbarte zunächst die Berliner Zeitung Ende Juli 2012 mit ihrem Artikel Bundesregierung überprüft Verkaufstrainings für Ärzte. Wie im Forum Gesundheitspolitik bereits Mitte Juni in dem Beitrag Öffentliche Förderung des Verkaufstrainings für IGeL-Angebote nachzulesen war, hat das Haus des ehemaligen Gesundheits- und jetzigen Wirtschaftministers Philipp Rösler das ständige Gerede des Ressortchefs von der Gesundheits-Wirtschaft überaus wörtlich genommen und tatkräftig in die Praxis umgesetzt.
Laut Medienberichten überprüfte die Bundesregierung zunächst die staatliche Förderung der Marketingseminare, in denen sich ÄrztInnen im Verkauf von IGeLeistungen und anderer Selbstzahler-Angebote schulen lassen können. Im Klartext: Ärzte sollen "Verkaufsstrategien" erlernen, um ihre Patienten besser vom Nutzen solcher Leistungen überzeugen zu können. Mittlerweile hat das Wirtschaftsministerium dem großen öffentlichen Fragezeichen nachgegeben und die Verkaufsförderungsprogramme für niedergelassene ÄrztInnen eingestellt.
Brisant war die bisherige Förderung vor allem deshalb, weil das Wirtschaftsministerium damit die Erbringung von zumeist diagnostischen Verfahren befördert hatte, die nicht nur medizinisch überflüssig und stark umstritten, sondern auch explizit nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten sind. Damit unterlief das Wirtschaftsressort gezielt das subsidiär-korporatistische Entscheidungsgefüge des deutschen Gesundheitswesens. Aber was der liberale Koalitionspartner vom Staat und von öffentlichen Entscheidungsstrukturen hält, zeigt nicht nur das Ressort von Philipp Rösler, sondern auch andere FDP-Minister wie insbesondere BMZ-Leiter Dirk Niebel ja seit der Übernahme der Regierungsverantwortlichkeit mit wachsender Begeisterung.
Allen öffentlichen Regulierungsversuchen trotzt auch beharrlich eine bestimmte Gruppe von MedizinerInnen, die gerne im Namen der "Therapiefreiheit" und ihrer eigenen Freiberuflichkeit handeln mit ihrer subjektiven Wahrnehmung gerne empirische Evidenz aushebeln. Tatsächlich sind es in erster Linie die Leistungserbringer, also die niedergelassenen ÄrztInnen, die ihren PatientInnen einseitig Leistungen ohne erkennbaren medizinischen Nutzen aufdrängen. Allzu oft erbringen sie IGeLeistungen ohne vorausgehende Information und Aufklärung sowie ohne schriftliche Vereinbarung. Nicht selten verkaufen sie den ahnungslosen "KundInnen" auch Leistungen aus dem GKV-Katalog als IGeLeistungen. Bisher haben weder die PatientInnen noch die Kassen in solchen Fällen Anspruch auf Schadensersatz.
Die vollständig aus der eigenen Tasche der Versicherten zu zahlenden Behandlungen stellen mittlerweile eine zusätzliche Einkommensquelle für die Kassenärzte dar. Rund zwei von drei KassenärztInnen bieten IGeLeistungen an, vor allem GynäkologInnen. AugenärztInnen und OrthopädInnen und erzielen damit zusätzliche Einnahmen von etwa 1,5 Mrd. €, was nicht weniger als fünf Prozent der kassenärztlichen Leistungsausgaben entspricht. Für viele Niedergelassene sind die IGeLeistungen heute eine willkommene Zusatzeinnahmequelle, mit der sie zunehmend hemmungslos die subjektiv als beständig schrumpfend empfundenen GKV-Honorare aufbessern und ihre gefühlten Verluste an "Therapiefreiheit" kompensieren können. Unter der konservativen Annahme, dass ÄrztInnen bei der Qualität ihrer Arbeit eine Normalverteilung aufweisen, kann das nichts Gutes für die PatientInnen bedeuten.
Um die geht es allerdings auch einer Reihe von MedizinerInnen allenfalls sekundär. Der Beitrag eines niedergelassenen Gynäkologen im streng GKV-feindlichen Ärztenetzwerk Hippokranet lässt an sozialpolitischem Desinteresse und Verachtung von Menschen mit geringem Einkommen nichts zu wünschen übrig: "Niemand wird gezwungen, sich rein kassenmedizinisch behandeln zu lassen.
Jeder in der Bunzrepublik hat die Wahl. ...ob jeder auch das nötige Geld hat, weiss ich nicht....interessiert mich auch nicht."
Solche und vermutlich auch andere MedizinerInnen interessiert sicherlich viel mehr das wachsende Angebot an verfügbarer Information zu IGeLeistungen, die man beispielsweise auf der Internet-Seite Der Igelarzt vorfindet. Zwar missbilligte der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Frank Ulrich Montgomery, laut Berliner Zeitung vom 30.7.2012 das Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums mit den Worten: "Ärzte sind keine Kaufleute und deshalb brauchen wir auch keine Verkaufsseminare für Individuelle Gesundheitsleistungen." Dies entbehrt allerdings nicht einer gewissen Naivität, haben sich zahlreiche VertreterInnen der Ärzteschaft doch mittlerweile unübersehbar von der Ethik auf die Seite der Monetik geschlagen. Denn irgendwelche Ansprechpartner müssen einschlägige Angebote wie Verkaufen - eine neue Dimension der Praxisarbeit, IGeL seriös anbieten, IGeL anbieten - Wie sag ich`s dem Patienten? oder IGEL und Wahlleistungen sicher anbieten und verkaufen ja finden, sonst würden sie sich wohl kaum in der digitalen Welt des Internets halten.
Auch wenn die schwarz-gelbe Bundesregierung nun die Förderung der Patientenabzocke durch niedergelassene ÄrztInnen "überprüfen" will, die tägliche Praxis der "Halbgötter in Weiß", ihren PatientInnen überflüssige und nicht selten gefährliche und schädliche Leistungen aufzuschwatzen wird diese Koalition nicht in Frage stellen. Die größte Oppositionspartei will nicht nur die Marketing-Förderung des Wirtschaftsministeriums für IGeL-ÄrztInnen beenden, sondern die Ärztezeitung meldete am 31. Juli 2012 auch SPD plant "IGeL-Eindämmungsgesetz".
Immerhin nimmt sich nun der Bundesrat direkt dieses Themas an und dabei die Forderung des GKV-Spitzenverbands auf, als Mindestmaßnahme zum Schutz der PatientInnen eine eintägige Bedenkzeit für IGeLeistungen einzuführen. Abgesehen von einzelnen, eher bürokratischen Leistungen wie Attesten - so berichtet die Ärztezeitung in dem Artikel IGeL-Bedenkzeit-Atteste ausgenommen - gäbe eine derartige Bedenkzeit den informationsbezogen benachteiligten und tendenziell schwächeren NutzerInnen von ambulanten Gesundheitsleistungen eine gewisse Chance, die Notwendigkeit von IGeLeistungen zu überprüfen. Vor allem würde dies die Möglichkeiten der AnbieterInnen verringern, ihre PatientInnen mit dem Zusatzangebot zu überrumpeln.
Die Ablehnung aus der Ärzteschaft ließ nicht lange auf sich warten. Energisch kritisierte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Dr. Johannes Fechner, den Vorschlag des GKV-Spitzenverbands, wie in einem Beitrag im Ärztenetzwerk Facharzt.de nachzulesen ist: "Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum der GKV Spitzenverband IGeL ablehnt und Schranken fordert. Die meisten IGeL erfolgen zum einen auf Patientenwunsch und sind zum anderen medizinisch sinnvoll." Als "abwegig" bezeichnete Fechner die Forderung, IGeLeistungen erst nach 24-stündiger Denkpause zu erbrbringen dürfen. "Der GKV-Spitzenverband zeigt hier mal wieder," so Fechner, "dass er wenig Kenntnis vom Alltag in einer Praxis und der Behandlung von Patienten hat. Warum soll der Arzt einen Patienten, der eine IgeL nachfragt, wieder nach Hause schicken? Die Patienten müssen einen neuen Termin vereinbaren und noch einmal den Aufwand für den Besuch auf sich nehmen, obwohl sie bereits vor dem Arzt stehen. Viele Leistungen ergeben sich zudem erst im Laufe einer Behandlung. Und soll der Arzt die Patienten, deren Kasse die IGeL wie beispielsweise Osteopathie in ihren Leistungskatalog aufgenommen hat, auch erst nach Hause schicken? Das ist Absurdistan und führt zu völligem Unverständnis bei den Patienten."
Allerdings sind in demselben Forum auch andere Stimmen zu lesen: So heißt es in einer Replik: "Nun werden in der Regel die so genannten "IGeL" ja nicht nachgefragt sondern dem Patienten mehr oder weniger nachdrücklich "empfohlen", "nahegelegt" oder schlicht aufgenötigt. Die echte Nachfrage nach derartigen "Wunschleistungen" darf man getrost ziemlich nahe bei Null einordnen."
Die Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten steht kostenfrei online zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 9.8.12
Weniger ist mehr: Antibiotikabehandlung bei milder Sinusitis = wenig Nutzen, viele kurzfristige und langfristige Probleme
 Antibiotika sollten in der ersten Woche einer milden oder mäßigen Sinusitis bzw. Nasennebenhöhlenentzündung nicht verordnet werden. Dies ist die Kernerkenntnis eines Reviews wissenschaftlicher Studien zum Nutzen und Schaden einer Antibiotika-Therapie der daran Erkrankten im Rahmen des Projektes "Promoting Good Stewardship in Clinical Practice" der "National Physicians Alliance (NPA)" in den USA.
Antibiotika sollten in der ersten Woche einer milden oder mäßigen Sinusitis bzw. Nasennebenhöhlenentzündung nicht verordnet werden. Dies ist die Kernerkenntnis eines Reviews wissenschaftlicher Studien zum Nutzen und Schaden einer Antibiotika-Therapie der daran Erkrankten im Rahmen des Projektes "Promoting Good Stewardship in Clinical Practice" der "National Physicians Alliance (NPA)" in den USA.
Nasennebenhöhlenentzündungen stellen einen der häufigsten Gründe für den Besuch einer Allgemeinarztpraxis dar. Die Diagnose einer Sinusitis ist in den USA außerdem die dritt- bis fünfthäufigste Diagnose bei der ein Antibiotikum verordnet wird. Ihre Behandlung löst dort zwischen 15% und 21% aller Antibiotikaverordnungen eines Jahres aus.
In den letzten 10 Jahren sind daher auch vier große Metaanalysen mit den Ergebnissen von 45 randomisierten placebokontrollierten Studien erstellt worden, die den Nutzen und die unerwünschten Effekten der Behandlung einer milden oder mäßigen Sinusitis mit Antibiotika untersucht haben.
Für die Empfehlung der NPA mit dem Tenor "Less is more"waren folgende wissenschaftlichen Ergebnisse maßgeblich:
• Bei einer milden oder mäßigen Sinusitis, d.h. einer Erkrankung ohne hohem Fieber, starken Schmerzen oder Druckschmerzempfindlichkeit war der erwünschte gesundheitliche Effekt innerhalb der ersten zwei Wochen in der Antibiotika-Gruppe statistisch signifikant höher als in der Placebo-Gruppe. Der Unterschied war aber sehr klein: Der Anteil der geheilten oder deutlich von Beschwerden befreiten PatientInnen schwankte in der Antibiotika-Gruppe zwischen 71% und 90% und in der Placebo-Gruppe zwischen 64% und 80%. Der Anteil der PatientInnen mit Heilung oder Linderung war daher in der Antibiotika-Gruppe 7% bis 14% höher.
• Keine Unterschiede gab es zwischen beiden Gruppen beim Auftreten von Komplikationen oder Rückfällen.
• 30% bis 74% der PatientInnen mit Antibiotika-Behandlung litten an ihrer häufigsten unerwünschten Nebenwirkung, dem Durchfall. Er trat 80% häufiger auf als in den Placebo-Gruppen. Hinzu kamen einige seltenere Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Richtige schwere und lebensbedrohliche Wirkungen traten aber in keiner der Studien auf.
• In jedem Fall stellt aber die Anwendung von Antibiotika wegen der Förderung antibiotikaresistenter Erregerstämme eine potenzielle Gefährdung der Bevölkerungsgesundheit dar. Diese Gefährdung ist im Rahmen einer Nutzen-Schadenbilanz umso gravierender desto geringer der individuelle Nutzen ist.
Ähnliche Reviews zur Evidenz von Behandlungskonzepten beabsichtigt die NPA für weitere in einer so genannten "Top 5"-Liste genannten häufigen Erkrankungen zu veröffentlichen.
Von dem Aufsatz "Treatment of mild to moderate sinusitis." von Smith SR, Montgomery LG, Williams JW Jr, erschienen in den "Archives of Internal Medicine" (172(6): 510-3) ist kostenlos ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 5.8.12
Qualitätsmanagement und Hygiene in Arztpraxen. Ergebnisse einer "nicht inzentivierten" Ärztebefragung
 Nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für die Praxen niedergelassener Ärzte mit ihren mehreren hundert Millionen Patient-Arztkontakten ist u.a. mit dem § 135a SGB V ("Vertragsärzte … sind … verpflichtet … einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln.") Qualitätsmanagement (QM) und -sicherung gesetzlich vorgeschrieben. Dass dort auf eine ausreichende Hygiene geachtet wird, ist eigentlich auch ohne das SGB V bereits auf der Basis der hippokratischen Ethik (primum nihil nocere) nicht anders zu erwarten.
Nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für die Praxen niedergelassener Ärzte mit ihren mehreren hundert Millionen Patient-Arztkontakten ist u.a. mit dem § 135a SGB V ("Vertragsärzte … sind … verpflichtet … einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln.") Qualitätsmanagement (QM) und -sicherung gesetzlich vorgeschrieben. Dass dort auf eine ausreichende Hygiene geachtet wird, ist eigentlich auch ohne das SGB V bereits auf der Basis der hippokratischen Ethik (primum nihil nocere) nicht anders zu erwarten.
Die Ergebnisse der gerade veröffentlichten Umfrage "Qualitätsmanagement, Patientensicherheit und Hygiene in der ärztlichen Praxis 2012" der Stiftung Gesundheit bei niedergelassenen Ärzten vermitteln einige interessante Einblicke in die Wirklichkeit.
Interessant und lehrreich sind bereits die Angaben zur Anzahl der befragten und antwortenden Ärzte: Danach haben von den 9.532 online angeschriebenen für die Gesamtheit der ambulant tätigen Ärzte repräsentativen Ärzten und Zahnärzten 290 (Antwortquote: 3,04 Prozent) aussagekräftige Antworten geliefert. Diesen wahrlich nicht gewaltigen Rücklauf rechtfertigen die AutorInnen der Studie mit Argumenten, die für die Ärzteschaft in jeder Hinsicht unschmeichelhaft sind: "Damit liegt der Rücklauf im zu erwartenden Rahmen für eine nicht inzentivierte, unangekündigte Online-Befragung ohne telefonisches Nachfassen."
Die QM- und Hygienewirklichkeit dieser 290 ÄrztInnen sieht dann so aus:
• Auch wenn niedergelassene Ärzte laut Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) seit 2010 die Planungs- und Umsetzungsphase für QM in ihren Praxen abgeschlossen haben müssen, die niedergelassenen Zahnärzte sogar schon seit 2009, geben noch immer 5,9 % der Ärzte und Zahnärzte an, sich bislang für kein QM-System entschieden zu haben. 12,1 % der Mediziner können aber auf Nachfrage nicht den Namen des von ihnen gewählten Systems angeben.
• Mehr als fünf Prozent der antwortenden Praxisbetreiber bescheinigen sich selbst ein schlechtes Hygiene-Niveau und konstatieren auch erhebliche Defizite in der wichtigsten Einzelmaßnahme (Händewaschen). 24,1 % geben ein nur mittelmäßiges Hygieneniveau in ihrer Praxis an und 22,9 % halten das Niveau der Hände-Desinfektion ebenfalls für mittelmäßig. "Insgesamt sehen also jeweils knapp 30 % deutliches Verbesserungspotenzial. Und während sich immerhin mehr als 50 Prozent ein sehr hohes Niveau bei der Hände-Desinfektion bescheinigen, sind es bei der Hygiene insgesamt weniger als 45 Prozent."
• Jede sechste Praxis hat schon einmal einen Hygieneberater in Anspruch genommen.
• "Betracht man die Gruppe derjenigen Praxen separat, die ein nicht optimales Hygieneniveau haben so wird erwartungsgemäß ein höherer Bedarf an Weiterbildung und spezifischen Initiativen gesehen, doch ist der Unterschied nicht sehr ausgeprägt. Auch in dieser Gruppe sehen 42 % keinen Handlungsbedarf - nicht-optimale Hygiene wird hier offenbar als ein verzeihliches Problem gesehen."
• "Bei der Frage, wer das Thema Hygiene bei den niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten koordinieren und voranbringen sollte, liegt die Selbstverwaltung ganz vorn: Die Hälfte aller Nennungen entfielen auf die (Zahn-)Ärztekammern als Koordinator und Treiber. KVen, Fachgesellschaften und das Robert-Koch-Institut stehen mit jeweils etwa 30 % der Antworten an zweiter Stelle (Mehrfachnennungen waren möglich). Dagegen liegen diejenigen Institutionen, die eigentlich eine wichtige Rolle spielen sollten, nämlich die Landesgesundheitsämter, mit 16 % abgeschlagen an dritter Stelle."
Auch wenn die VerfasserInnen der Studie die kritischen Ergebnisse ihrer Umfrage als Zeichen des Vertrauens der Ärzte in die "Marke Stiftung Gesundheit" interpretieren, stellt sich doch die Frage nach ihrer Validität und Verallgemeinerbarkeit. Überträgt man Erfahrungen, dass solche Befragungen eher von denjenigen Personen beantwortet werden, die ihre Situation positiv bewerten, könnte die QM- und Hygienewirklichkeit in den ambulanten Praxen eher schlechter aussehen. Wer also ohne Zuhilfenahme von Incentives, sprich Geld und kostentreibendem enormen Kommunikationsaufwand mehr Ärzte zu einer Antwort bewegen kann, sollte diese inhaltlich wichtige Studie replizieren.
Die 32-seitige Studie "Qualitätsmanagement, Patientensicherheit und Hygiene in der ärztlichen Praxis 2012. Eine deutschlandweite Befragung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte" von Konrad Obermann, Stefanie Woerns und Peter Müller gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 6.5.12
Antioxidative Nahrungsergänzungsmittel von Vitamin A bis Selen: Nicht nur nutzlos, sondern zum Teil sogar lebensverkürzend
 So genannte Antioxidantien gelten seit einiger Zeit als wahre Wundermittel, Körperzellen gegen schädliche äußere Einflusse zu schützen und im Falle des Schutzes vor Krebs auch als lebensverlängernd. Diese Wirkungen wurden auch durch einige Tierexperimente, durch physiologische Modelle und einige Beobachtungsstudien gestützt. Andere Beobachtungsstudien hatten aber auf fehlende positive Wirkungen und sogar unerwünschte schädigende Effekte hingewiesen. Trotzdem boomen das Geschäft und die Einnahme von Beta-Carotin-, Vitamin A-, Vitamin C- und Selenpräparate als so genannte Nahrungsergänzungsmittel.
So genannte Antioxidantien gelten seit einiger Zeit als wahre Wundermittel, Körperzellen gegen schädliche äußere Einflusse zu schützen und im Falle des Schutzes vor Krebs auch als lebensverlängernd. Diese Wirkungen wurden auch durch einige Tierexperimente, durch physiologische Modelle und einige Beobachtungsstudien gestützt. Andere Beobachtungsstudien hatten aber auf fehlende positive Wirkungen und sogar unerwünschte schädigende Effekte hingewiesen. Trotzdem boomen das Geschäft und die Einnahme von Beta-Carotin-, Vitamin A-, Vitamin C- und Selenpräparate als so genannte Nahrungsergänzungsmittel.
Eine 2012 aktualisierte und auf noch breiterer Studienbasis argumentierende Fassung eines so genannten Cochrane-Reviews aus dem Jahr 2008 kommt jetzt aber zum Schluss, dass diese Mittel nicht nur weitgehend nutzlos sind, sondern zum Teil sogar lebensverkürzend wirken.
Dies ist das Ergebnis eines systematischen Reviews von 78 randomisierten kontrollierten klinischen Studien mit 296.707 TeilnehmerInnen, die entweder eines der genannten Nahrungsergänzungsmittel, ein Placebo oder gar nichts einnahmen. Unter den TeilnehmerInnen waren 215.900 gesund und 80.807 litten an verschiedenen Krankheiten wie Magen-Darm-, Herz-Kreislauf oder Hauterkrankungen. Die TeilnehmerInnen waren durchschnittlich 63 Jahre alt und die Dauer der Einnahme der Vitamine und sonstigen Stoffe lag bei durchschnittlich 3 Jahren zwischen 28 Tagen und 12 Jahren.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Insgesamt hatten alle antioxidativen Ergänzungsstoffe in einer Metaanalyse keine statistisch signifikante Wirkung auf die Sterblichkeit. Diese Nichtwirkung war sowohl in primär- als auch in sekundärpräventiv angelegten Studien zu beobachten.
• Wenn auch nur schwach und nicht bei allen Stoffen, war aber die Sterblichkeit unter den NutzerInnen einiger der Mittel oder Stoffe um das 1,03- bis 1,04-Fache höher als bei den jeweiligen NichtnutzerInnen. Die höhere Sterberate trat bei den Personen auf, die Beta-Carotin oder die Vitamine E und A (möglicherweise aber nur bei höheren Dosen) als Ergänzungsmittel einnahmen, nicht aber bei den Konsumenten von Vitamin C und Selen.
Die Reviewer raten daher sowohl gesunden als auch kranken Menschen von einer Nahrungsergänzung mit Antioxidantien wegen deren mangelnder Wirkung und schädlicher Effekte ab. Sie weisen auch darauf hin, dass diese Mittel oft als "natürlich" verharmlost werden und ihr Charakter als medizinische Produkte übersehen wird. Da sie dies aber sind, fordern die WissenschaftlerInnen vor der Marktzulassung solcher Stoffe eine strenge Bewertung. Zu betonen ist noch, dass dies kein Plädoyer gegen die Aufnahme der genannten Vitamine oder Stoffe durch die normale Ernährung ist, sondern sich nur gegen die dann meist auch noch hoch dosierte Aufnahme von Ergänzungsmitteln richtet.
Von dem am 14. März 2012 veröffentlichten aktualisierten Cochrane-Review "Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases" von Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG und Gluud C. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007176) gibt es kostenlos nur das Abstract. Dort findet man aber wie bei Abstract von Cochrane-Reviews gewohnt eine Fülle von quantitativen Daten und auch differenzierte methodische Darstellungen.
Bernard Braun, 25.3.12
WHO-Kompendium zu Gesundheitstechnologien für die 3. Welt: Eine Dauerwerbesendung der Medizintechnikindustrie
 In letzter Zeit wird speziell in Deutschland mehr darüber geredet, auch die Zulassung und den Einsatz von medizintechnischen Apparaten und Verfahren mindestens von einem bei der Zulassung von Arzneimitteln relativ etablierten Nachweis der Wirksamkeit, des Nutzens und der Sicherheit abhängig zu machen. Nicht alles wo "wissenschaftlich-technischer Fortschritt" draufsteht und auf wo ein TÜV-Siegel klebt sollte zum "Menschenversuch" zugelassen werden.
In letzter Zeit wird speziell in Deutschland mehr darüber geredet, auch die Zulassung und den Einsatz von medizintechnischen Apparaten und Verfahren mindestens von einem bei der Zulassung von Arzneimitteln relativ etablierten Nachweis der Wirksamkeit, des Nutzens und der Sicherheit abhängig zu machen. Nicht alles wo "wissenschaftlich-technischer Fortschritt" draufsteht und auf wo ein TÜV-Siegel klebt sollte zum "Menschenversuch" zugelassen werden.
Davon völlig unberührt scheint die weltweite Public Health-Institution Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu sein, wenn es um ein Kompendium zu Gesundheitstechnologien ausgerechnet oder gerade für Entwicklungsländer geht.
Dieses Kompendium ist ein drastisches Beispiel dafür, dass die WHO bei Bedarf nicht mehr die Interessen der Patienten und Krankenversicherten in ihren Mitgliedsländern vertritt, sondern vorrangig die der Anbieter von Gesundheitsleistungen. Die extreme Nähe der WHO bzw. eines Teils ihrer Fachberater zur Herstellerfirma des Schweinegrippe-Medikaments Tamiflu war offensichtlich kein einmaliger Ausrutscher.
Die WHO hebt bei dem Kompendium zunächst dessen Neutralität hervor: "The compendium of new and emerging technologies that address global health concerns has been created as a neutral platform for technologies which are likely to be suitable for use in low-resource settings."
Ihr Kompendium soll zu einem notwendigen Dialog zwischen Gesundheitspolitikern in der Dritten Welt, Produzenten, Ärzten und anderen Akteuren des Gesundheitswesens beitragen und zu einer stärkeren Verbreitung verschiedener Gesundheitstechnologien in den ärmeren Ländern beitragen. So weit, so gut: "The compendium 2011 is a first snapshot of several health technologies which might have the potential to improve health outcomes or to offer a solution to an unmet medical need in low-resource settings. The compendium specifically focuses on innovative technologies that are not yet widely available in developing countries, and product concepts under way."
Die im Kompendium auf jeweils einer Seite vorgestellten und bewerteten in Entwicklung befindlichen oder auch bereits vertriebenen Gesundheitstechnologien wurden von Mitgliedern der internationalen Gesundheitstechnologie-Agentur EuroScan-Gruppe und der WHO "based on data and information provided by the developers of the technologies" ausgewählt.
Die Anbieterabhängigkeit oder -geneigtheit ist aber nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei einigen für die weitere Entscheidungsfindung über den Einsatz der Gesundheitstechnik-Innovationen wichtigen Informationen bestimmend.
In erfreulicher Offenheit heißt es dazu im Kompendium: "However, the evaluation by EuroScan member agencies and WHO has been solely based on a limited assessment of data and information submitted in the developers' applications and, where available, of additional sources of evidence, such as literature search results or other publicly available information. There has been no rigorous review for safety, efficacy, quality, applicability, nor cost acceptability of any of the technologies. Therefore, inclusion in the compendium does not constitute a warranty of the fitness of any technology for a particular purpose. Besides, the responsibility for the quality, safety and efficacy of each technology remains with the developer and/or manufacturer."
Bei der Lektüre der Steckbriefe von insgesamt 44 Gesundheitstechnologien findet man dann auch fast keine unabhängige Bewertung zur Qualität der Innovation, sondern nahezu ausschließlich Herstellerprospekt-Angaben.
Selbst wenn die WHO an einer Stelle beteuert, sie wolle "not be held to endorse nor to recommend any technology included in the compendium", zeigt dies lediglich das eigene Unbehagen über ihren Versuch, in den ärmeren Ländern mit solchen tendenziösen und dürftigen Informationen Aufmerksamkeit für Gesundheitstechnologien zu wecken.
Angesichts der Herstellerorientierung des Kompendiums spielt es schon keine Rolle mehr, was an einzelnen Technologien vorgestellt wird und ob sie wirklich dem Bedarf der BewohnerInnen und Kranken in Ländern der Dritten Welt entsprechen. Bei den in Entwicklung befindlichen Techniken stehen neben durchaus sinnvollen Geräten zur Trinkwasserhygiene telemedizinische und -kommunikative Geräte und Prozeduren im Vordergrund. Wer einmal in den ländlichen Regionen oder den Elendsvierteln der Großstädte eines Entwicklungslandes unterwegs war, wird allerdings Zweifel an der Praxisgerechtigkeit eines "Medical data communication system" oder von "Mobile technology to connect patients to remote doctors" für die meisten der dortigen BewohnerInnen hegen. Tragbare Diagnoseinstrumente und Wasserfilter sind dagegen schon eher von Nutzen.
Das 54-seitige "Compendium of new and emerging health technologies 2011" der WHO gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 17.3.12
Nicht nur in Holland: Mindestmengenanforderungen können Anreiz sein, mehr Operationen zu berichten als tatsächlich gemacht wurden.
 Berichten kleine Krankenhäuser mehr Totaloperationen von Speiseröhren als sie tatsächlich entfernten, wenn die öffentliche Berichterstattung über eine Mindestanzahl von Operationen ein Qualitätsindikator ist? Ja und zwar passiert dies in 7 oder 70% der 10 niederländischen Krankenhäuser deren Meldungen von einer Forschergruppe retrospektiv für die Jahre 2005 und 2006 mit der in Operationsberichten dokumentierten Anzahl dieser Operationen verglichen wurden.
Berichten kleine Krankenhäuser mehr Totaloperationen von Speiseröhren als sie tatsächlich entfernten, wenn die öffentliche Berichterstattung über eine Mindestanzahl von Operationen ein Qualitätsindikator ist? Ja und zwar passiert dies in 7 oder 70% der 10 niederländischen Krankenhäuser deren Meldungen von einer Forschergruppe retrospektiv für die Jahre 2005 und 2006 mit der in Operationsberichten dokumentierten Anzahl dieser Operationen verglichen wurden.
Zum Hintergrund: Jedes Jahr wird in den Niederlanden bei rund 1.500 Personen ein Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Von ihnen erhalten ungefähr 600 die Speiseröhre entfernt. 2005 erschien die multidisziplinäre Leitlinie "Diagnosis and treatment of oesophageal carcinoma" mit einer klaren Mindestmengenempfehlung. Die Operation sollte danach nur in Krankenhäuser stattfinden, die jährlich wenigstens 10 bis 20 solcher Operationen durchführen. Die holländischen Qualitätskontrolleure forderten daher alle 14 Kliniken, die in den Jahren 2003 bis 2005 jährlich weniger als 10 Operationen durchgeführt hatten auf, entweder solche Operationen nicht mehr durchzuführen oder z.B. durch die Kooperation mit anderen Kliniken das Mindestmengenziel zu erreichen oder zu übertreffen. Die Inspektoren befürchteten schon damals, dass dies für einige Krankenhäuser der Anreiz sein könnte, ihre Operationszahlen zu erhöhen bzw. der Leitlinienanforderung anzupassen. Der unmittelbare quantitative Effekt einer Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl von 602 solcher Operationen zwischen 2003 und 2005 auf den Wert von 652 im Jahr 2006 schien diese Befürchtung zu bestätigen.
In der Studie wurden jetzt für den Zeitraum 2003 bis 2006 alle Berichte über die Behandlung der an Speiseröhrenkrebs erkrankten PatientInnen in kleinen Krankenhäusern mit der gemeldeten und auch meistens auf der Website der Kliniken veröffentlichten Anzahl von Speiseröhrenentfernungen verglichen.
Sieht man von einer Reihe zögerlicher Lieferung der anonymisierten OP-Berichte und anderen administrativen Hindernissen ab, ergeben sich im Einzelnen folgende Resultate:
• 2005, d.h. im letzten Jahr ohne Mindestmengenanforderung, berichteten die 10 kleinen Kliniken 82 Speiseröhrenentfernungen. Fünf von diesen "Melde-OPs" erfolgten in Wirklichkeit nicht. Der Unterschied zwischen berichteten und durchgeführten Operationen war so klein, dass der Unterschied statistisch nicht signifikant war (p=0,38).
• 2006, also im ersten Jahr, in dem die dargestellten Anforderungen an eine Mindestmenge galten, berichteten die 10 Krankenhäuser 115 Speiseröhren-OPs. Bei 7 von ihnen oder 70% wurden insgesamt 26 Operationen berichtet, die tatsächlich nicht durchgeführt wurden. Trotz der sehr kleinen Zahlen war der Unterschied zwischen den berichteten und durchgeführten Operationen statistisch signifikant (p=0,01).
• Die drei Krankenhäuser, deren berichtete Operationen mit der Anzahl der durchgeführten voll übereinstimmten, waren Kliniken, die 2006 10 und mehr Entfernungen durchführten.
Die holländischen ForscherInnen gehen davon aus, dass es für die beobachteten Differenzen keine anderen Ursachen als die Anreize der veröffentlichten Mindestmengen-Qualitätsindikatoren gibt. Um daran etwas zu verändern, schlagen sie unter den Bedingungen der Notwendigkeit hohe Zahlen veröffentlichen zu müssen ("need to score") entweder eine stärkere Zentralisierung derartiger Operationen in spezialisierten Krankenhäusern oder eine strenge(re) externe Kontrolle vor.
Der Aufsatz "Does public disclosure of quality indicators influence hospitals' inclination to enhance results?" von Kris H.A. Smolders et al. ist am 7. Februar 2012 online in der Zeitschrift "International Journal for Quality in Health Care" (24 (2): 129-134) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.3.12
Was sollten Hygieniker/Politiker bei einem Infektions-"Ausbruch" sein lassen oder "C'est les microbes qui auront le dernier mot"?
 Man muss die These von Louis Pasteur nicht völlig teilen, um daraus Lehren für den aktuellen Umgang mit Infektionen ziehen zu können. Der mit dem "Ausbruch" gefährlicher oder sogar tödlicher Infektionen häufig verbundene Versuch, den beruhigend gemeinten Eindruck zu erwecken, man könne solche Risiken durch das prinzipiell mögliche Entdecken der Erregerquelle und dem dann möglichen Einsatz geeigneter, meist technisch-hygienischer Mittel prinzipiell verhindern, ist zu einem gewissen Teil symbolischer politischer Aktionismus.
Man muss die These von Louis Pasteur nicht völlig teilen, um daraus Lehren für den aktuellen Umgang mit Infektionen ziehen zu können. Der mit dem "Ausbruch" gefährlicher oder sogar tödlicher Infektionen häufig verbundene Versuch, den beruhigend gemeinten Eindruck zu erwecken, man könne solche Risiken durch das prinzipiell mögliche Entdecken der Erregerquelle und dem dann möglichen Einsatz geeigneter, meist technisch-hygienischer Mittel prinzipiell verhindern, ist zu einem gewissen Teil symbolischer politischer Aktionismus.
Das wäre sogar hinzunehmen, wenn damit nicht falsche Erwartungen geweckt oder falsche Sicherheiten versprochen würden. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer etwas gründlicheren Lektüre von Fachbeiträgen, die in der von deutschen Fachwissenschaftlern im Jahr 2001 gegründeten Online-Fachdatenbank "Outbreak" zugänglich sind. Die Datenbank enthält derzeit Berichte über 2.756 Infektions-"Ausbrüche", die zwischen 1956 und 2011 publiziert wurden. Damit liegen relativ differenzierte Informationen über 259 verschiedene Erreger vor. Ergänzt werden diese "Ausbruch"-Berichte durch wissenschaftliche Überblicksarbeiten über die Dynamik von Infektionserkrankungen und die Charakteristika einzelner Erreger.
Unter einem gesundheitsbezogenen "Ausbruch" versteht man das Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemiologischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird. Wie man am Auftreten und dem Umgang mit dem Auftreten von schweren, d.h. zum Teil lebensbedrohlichen Infektionserkrankungen wie EHEC oder der Verbreitung von teilweise multiresistenten Keimen in diversen "Frühchen-Stationen mehrerer bundesweiter Krankenhäuser sehen konnte, ist trotz dieser Definition für die zuständigen Gesundheitseinrichtungen nicht immer klar, ob es sich um Ausbrüche oder ganz normale, d.h. zunächst nicht dramatische und entsprechende Interventionen verlangende Erkrankungsfälle handelt. Dass die Nichtklassifikation als "Ausbruch" sehr praktische Folgen haben kann, konnte man Ende 2011 an der monatelangen Unterschätzung der von Darmkeiminfektionen in der neonatologischen Abteilung des Bremer Klinikums-Mitte ausgehenden Gefahren für die Frühgeborenen beobachten.
Mit dem Ausbruch von Krankheiten und ihrer Bekämpfung zerbricht einerseits die nicht zuletzt von Gesundheitsdienstleistern mitgeförderte Illusion einer nebenrisikofreien Versorgungs- und Behandlungswelt. Andererseits wird diese Illusion durch das mit dem öffentlichkeitswirksamen Einsatz nationaler Hygiene-Task Force-Einheiten verbundene Versprechen, die Quelle des Ausbruchs zu finden und mit technischen Mitteln auszuschalten, von neuem produziert.
Wer sich mit dem Umgang mit einem "Ausbruch" von Infektionskrankheiten näher beschäftigt, stößt auf zwei zwar verständliche aber letztlich hochproblematische Argumentationsfiguren:
• Die Absicht oder gar das Versprechen, so etwas dauerhaft zu verhindern und
• die Vorstellung, die Erregerquelle rasch finden und sie mit einem Bündel meist technischer Sanierungsmaßnahmen (z.B. Desinfektion der Räumlichkeiten, Hygieneschleusen für Angehörige, neue Vorschriften zur Handhygiene bis hin zu einer Schaffung einer neuen Behandlungslokalität) zum Versiegen bringen zu können.
In der wissenschaftlichen Datenbank "Outbreak" finden sich zahlreiche Beiträge, die zu dem Schluss kommen, dass es allein wegen der Vielzahl von Erregern und deren zum Teil enorme Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit illusorisch ist, zumindest bestimmte Erreger "ausrotten" zu können. Eine dort zugängliche Dissertation über das Verhalten einiger Typen der zur normalen Darmflora gehörenden so genannten Klebsiellen zeigt bereits im Titel die Schwierigkeiten an, Erkrankungen zu verhindern, die durch diese weit verbreiten Darmkeime verursacht werden: "Mechanismen, durch die Klebsiella pneumoniae zum Erreger nicht beherrschbarer nosokomialer Infektionen werden kann". Zu diesen Mechanismen gehören z.B. Fähigkeiten des Erregers, auch an nicht so leicht zugänglichen Orten wie Siphons und Abwasserrohren überleben zu können. Die Autorin umschreibt das Risiko-Szenario so: "Während eines nosokomialen Ausbruchs multiresistenter K. pneumoniae konnten SU et al. … die Ausbruchsstämme aus mehreren Siphons isolieren und vermuteten dort die Quelle der Kontaminationen. KAC et al. konnten durch ein Umgebungsscreening auf einer Intensivstation zeigen, dass trockene Oberflächen frei von ESBL-produzierenden Enterobacteriaceae blieben, diese Stämme jedoch für Wochen und Monate in den feuchten Spalten von Abflüssen und Waschbecken überlebten. Bisher (Erstellungsjahr der Dissertation ist 2007) wurde eine Infektion von Patienten über besiedelte Siphons nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Es ist jedoch anzunehmen, dass es beim Verspritzen des laufenden Wassers sowohl zur Kontamination von Händen und Kontaktflächen als auch zur Aerosolbildung kommen kann."
Selbst ohne diese Art von Hindernissen vor einem Sieg über diese Art von Erregern entstehen aber ständig durch den immer noch viel zu oft erfolgenden Einsatz von Antibiotika bei Menschen und in der Fleischproduktion neue resistente und damit auch sehr persistente Erreger.
Das Versprechen, die Bedrohung durch einen Erreger "auszurotten", steht und fällt u.a. damit, die Erregerquelle zu finden und alle sie fördernden Bedingungen dauerhaft verändern zu können. Ein in der "Outbreak"-Datenbank zu findender Beitrag über wichtige Details von 225 "Ausbrüchen" unter Beteiligung dreier Erregergruppen (darunter 59 "Ausbrüche" von multiresistenten Enterobakterien à la Klebsiella insbesondere in neonatologischen Krankenhausstationen) aus dem Jahr 2011, weist auf die praktisch durchweg hohe Rate der trotz intensiver Suche unbekannt gebliebenen Erregerquellen zwischen 68% und 37% hin. Die Quelle der Enterobakterien, also der Darmkeime konnte in 58% der Fälle nicht entdeckt werden.
Schließlich sind die mehr oder weniger aufwändigen technisch-hygienischen oder baulichen Veränderungen in Krankenhausstationen mit einem "Ausbruch" zwar notwendig, aber bei weitem nicht hinreichend. Wie aber sowohl Untersuchungen über die Compliance von Hygienevorschriften bei Pflegekräften und vor allem Ärzten zeigen (vgl. dazu den Forums-Beitrag "Schrecklich, mit den Frühchen"! Aber: Ärzte und Pflegekräfte halten sich bei 52% bzw. 66% der Gelegenheiten an Hygienepflichten") aber auch positive Beispiele für eine dauerhafte Absenkung von "Ausbruchs"-Risiken in einzelnen Krankenhäusern (vgl. dazu u.a. die 2011 erschienene Studie von Sillow-Caroll et al.), sind ständige beschäftigtenbezogene und soziale Maßnahmen zur Verinnerlichung von Hygienevorschriften und deren Einbau in tagtägliche Verhaltensroutinen mindestens genauso wichtig. Anders gesagt: Absolut perfekte Handhygienevorrichtungen, das Scannen von Angehörigen und ein einwöchiger Hygienekurs für Pflegekräfte und interessierte Ärzte alleine versprechen Erfolge, die sie nicht erreichen oder halten können.
Die von verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen an deutschen Kliniken getragene "Outbreak Database" ist kostenlos zugänglich.
Die erwähnte rer nat.-Dissertation "Mechanismen, durch die Klebsiella pneumoniae zum Erreger nicht beherrschbarer nosokomialer Infektionen werden kann" von Sonja Burak ist ebenfalls in ganzer Länge (179 Seiten) kostenlos erhältlich.
Von dem Kongressbeitrag "A systematic review of nosocomial outbreaks caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria von Zhuchenko, K. Graf und R.P. Vonberg gibt es lediglich das Abstract und eine aussagekräftige Tabelle über weitere Details der "Ausbrüche" kostenlos herunterzuladen.
Ein letztes Beispiel zu den aktuell interessanten Beiträgen, auf die man über "Outbreak" Zugriff bekommt, ist die ebenfalls auf einer Dissertation basierende Übersichtsarbeit "Healthcare Associated infections in Pediatrics" der finnischen Medizinerin Emmi Sarvikivi aus dem Jahre 2008.
Die 16-seitige Studie "Eliminating Central Line Infections and Spreading Success at High Performing Hospitals." von Sharon Silow-Carroll und Jennifer Edwards ist als "Commonwealth Fund Publication 1559, Vol. 21" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.3.12
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) mit Krankenhausaufenthalt beruhen zu 67% auf Effekten von vier Arzneimitttelgruppen
 In den USA nehmen 40% der 65 Jahre alten und älteren BürgerInnen regelmäßig und gleichzeitig 5 bis 9 unterschiedliche Arzneimittel und 18% sogar10 und mehr. Die Einnahme von 5 und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln wird in Fachkreisen als Polypharmazie bezeichnet, die mit mehreren gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dazu gehört, dass mit der Anzahl unterschiedlicher Mittel die Therapietreue, d.h. die Einnahme der korrekten Menge zum richtigen Zeitpunkt, abnimmt und unerwünschte Wechselwirkungen auftreten können. Bei älteren Menschen modifizieren außerdem physiologische Veränderungen die Pharmakokinetik und -dynamik in unkalkulierbarem Umfang.
In den USA nehmen 40% der 65 Jahre alten und älteren BürgerInnen regelmäßig und gleichzeitig 5 bis 9 unterschiedliche Arzneimittel und 18% sogar10 und mehr. Die Einnahme von 5 und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln wird in Fachkreisen als Polypharmazie bezeichnet, die mit mehreren gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Dazu gehört, dass mit der Anzahl unterschiedlicher Mittel die Therapietreue, d.h. die Einnahme der korrekten Menge zum richtigen Zeitpunkt, abnimmt und unerwünschte Wechselwirkungen auftreten können. Bei älteren Menschen modifizieren außerdem physiologische Veränderungen die Pharmakokinetik und -dynamik in unkalkulierbarem Umfang.
Eine ForscherInnengruppe untersuchte nun mit den USA-repräsentativen Daten des "National Electronic Injury Surveillance System-Cooperative Adverse Drug Event Surveillance Project" für die Jahre 2007 bis 2009, wie viele unerwünschte Polypharmaziefolgen in Gestalt von Notfällen in Krankenhäuser es bei 65+-Personen gab und was die wichtigsten Ursachen waren.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• In jedem der drei Jahre gab es schätzungsweise und im Durchschnitt 99.628 Notfalleinweisungen und -aufenthalte in Krankenhäusern wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Damit gab es mehr oder vergleichbar viele Krankenhaus-Fälle wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen als für Delirium, Demenz sowie Hautinfektionen.
• 48,1% dieser Notfälle passierten bei 80+-Personen. Die arzneimittelassoziierte Einweisungsrate in Krankenhäuser war bei 85+-Personen 3,5 mal so hoch wie bei den 65- bis 69-Jährigen. Die Rate bei den hochbetagten Personen blieb auch unabhängig von der Anzahl der Einnahme unterschiedlicher Arzneimittel gegenüber der Rate bei jüngeren Personen signifikant erhöht.
• Wenn aus einem notwendigen Besuch einer Notfallstation eine Einweisung in das Krankenhaus wurde, lag dies vor allem an der unbeabsichtigten Einnahme einer Überdosis (65,7% versus 45,7%) und war dann notwendig, wenn der Patient 5 oder mehr unterschiedliche Arzneimittel eingenommen hatte (54,8% versus 39,9%).
• 65,7% aller Krankenhauseinweisungen waren wegen der unbeabsichtigten Überdosierung eines Arzneimittels notwendig gewesen.
• 67% aller Einweisungen beruhten auf unerwünschten Wirkungen der Einnahme eines oder mehrerer Arzneimittel aus einer Gruppe von weit verbreiteten und von jedem Arzt häufig verordneten Standardarzneimitteln: Warfarin, ein blutverflüssigendes Arzneimittel, das in Deutschland als Marcumar im Einsatz ist (33,3% aller medikamentenbedingten Notfälle). Insulin (13,9%), orale Thrombozytenaggregationshemmer wie z.B. ASS, Clodioprogrel (13,3%) und orale hypoglykämische Medikamente bei Diabetes mellitus Typ 2 wie z.B. Sulfonylharnstoffe (10,7%). Risikoreiche und auch oft nicht so häufig verordnete Arzneimittel waren dagegen wider Erwartungen nur bei 1,2% der Krankenhauseinweisungen wegen einer unerwünschten Arzneimittelwirkung beteiligt.
Wer die Arzneimittelsicherheit für ältere Menschen spür- und messbar verbessern will, braucht sich nach den Ergebnissen dieser Studie nicht mit Vorrang, allein oder zunächst mit der möglicherweise sehr komplexen und komplizierten Wirk- und Nebenwirkweise zahlreicher riskanter Arzneimittel beschäftigen. Er oder sie kann und sollte sich auf eine Verbesserung des Managements und des Umgangs mit antithrombotischen und antidiabetischen Arzneimitteln konzentrieren, die in den USA 67% der insgesamt rund 66.000 unerwünschten stationär behandelten Notfälle bedingen. Dies ist umso wichtiger, weil die genannten Arzneimittelgruppen meist gegen chronische Erkrankungen und damit über lange Zeiten eingesetzt werden, d.h. das Risiko langsam aber sicher steigt.
Dazu sollte sicherlich noch genauer untersucht werden, welche Wirkungen im Zusammenhang mit diesen Arzneimittelgruppen auftreten und ob sie auf fehlende oder gar fehlerhafte Erklärungen des Arztes oder auch des Apothekers zum Medikament beruhen oder ob die PatientInnen etwas durcheinander bringen bzw. mangels besseren Wissens etwas falsch machen.
Der Aufsatz "Emergency Hospitalizations for Adverse Drug Events in Older Americans" von Daniel S. Budnitz et al. ist im November 2011 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" erschienen. Er ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.2.12
Was kostet Patientenzufriedenheit? Warum haben zufriedendste Patienten ein höheres Mortalitätsrisiko als völlig unzufriedene?
 Für viele Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanitärhäuser oder Versorgungsforscher gehören eine "alles-in-allem"-Frage oder auch mehrere detailliertere Fragen zur Zufriedenheit ihrer Patienten zum Standardrepertoire der Messung, Sicherung und Demonstration von Versorgungsqualität. Auch Versicherte oder PatientInnen orientieren sich bei Wahlentscheidungen für ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis häufig am Grad der Zufriedenheit früherer Nutzer der in Frage kommenden Behandlungseinrichtungen. Schließlich halten sich zufriedene PatientInnen auch mehr an ärztliche Empfehlungen und sind auch loyaler gegenüber Ärzten als unzufriedene PatientInnen. Eigentlich könnten also alle Beteiligte am Behandlungsgeschehen zufrieden mit der Zufriedenheit sein.
Für viele Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanitärhäuser oder Versorgungsforscher gehören eine "alles-in-allem"-Frage oder auch mehrere detailliertere Fragen zur Zufriedenheit ihrer Patienten zum Standardrepertoire der Messung, Sicherung und Demonstration von Versorgungsqualität. Auch Versicherte oder PatientInnen orientieren sich bei Wahlentscheidungen für ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis häufig am Grad der Zufriedenheit früherer Nutzer der in Frage kommenden Behandlungseinrichtungen. Schließlich halten sich zufriedene PatientInnen auch mehr an ärztliche Empfehlungen und sind auch loyaler gegenüber Ärzten als unzufriedene PatientInnen. Eigentlich könnten also alle Beteiligte am Behandlungsgeschehen zufrieden mit der Zufriedenheit sein.
Viele Untersuchungen weisen aber darauf hin, dass summarische Fragen nach der Zufriedenheit mit einem Krankenhausaufenthalt ein zu positives oder verzerrtes Bild liefert. Ein wichtiger Grund ist der, dass gerade PatientInnen glauben, ihre hohe Zufriedenheit sei ein sozial erwünschtes Antwortverhalten und dies dann aus Loyalität oder Angst vor möglichen Folgen einer anderen Antwort auch "abliefern".
Andere Studien haben gezeigt, dass es oft nur einen spärlichen Link zwischen Patientenzufriedenheit und objektiver Behandlungsqualität sowie den Behandlungsergebnissen gibt. Gerade bei besonders bedürftigen, verletzlichen und meist älteren PatientInnengruppen gibt es zum Beispiel keine Assoziation zwischen ihrer Zufriedenheit und der technischen Qualität geriatrischer Behandlung. Und "subjektive" Patientenzufriedenheit korreliert überhaupt nicht oder nur sehr wenig mit den von den Leistungserbringern gemessenen "objektiven" Qualitätsindikatoren. Und da PatientInnen auch an Leistungen interessiert sind, die keinen oder nur sehr wenig Nutzen haben, deren Inanspruchnahme sie aber tatsächlich oder vermutlich zufriedener macht, bieten Ärzte oder Krankenhäuser, deren Bezahlung wenigstens zum Teil von der Zufriedenheit ihrer PatientInnen abhängt, auch häufiger Leistungen an, die wenig oder keinen bewiesenen Nutzen haben. Patientenzufriedenheit kann also durchaus zu einem Verhalten von Ärzten und Patienten führen, das für beide Akteure mehr Nach- als Vorteile hat.
Mit den Daten mehrerer Wellen der des für die US-Bevölkerung repräsentativen "Medical Expenditure Panel Survey (MEPS)" untersuchten nun US-ForscherInnen für den Zeitraum 2000 bis 2005/07 die Entwicklung einer Fülle von soziodemografischen Merkmalen, den Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten, mögliche Confounder, die Sterblichkeit. die Nutzung von Notfallabteilungen in Krankenhäusern, die Intensität der Arzneimittelverordnungen und die Nutzung sonstiger stationärer Versorgungsangebote von 51.946 (ohne Sterblichkeitsdaten aber mit allen anderen Daten bis 2007) bzw. 36.428 (mit Sterblichkeitsdaten bis zum Jahr 2006) Erwachsenen. Für diese Personen wurde auch jeweils jahresmittig mit vier Standardfragen die Patientenzufriedenheit erhoben. Mit diesen Daten konnte dann untersucht werden wie sich der Gesundheitszustand und das Inanspruchnahmeverhalten der im ersten Untersuchungsjahr mit ihrem Gesundheitszustand und der Behandlung im Gesundheitssystem zufriedenen Personen im zweiten Jahr entwickelte und wie in einem Beobachtungszeitraum von bis zu 3,9 Jahre die Sterblichkeit der anfänglich zufriedenen Personen aussah.
Nach einer umfassenden Standardisierung nach soziodemografischen und gesundheitlichen Merkmalen, d.h. dem Ausschluss des Einflusses derartiger Faktoren auf die Ergebnisse, ergab sich ein unerwartetes Bild:
• Die Wahrscheinlichkeit in einer Notfallstation aufgenommen und behandelt zu werden, war unter dem Viertel der am meisten zufriedenen Untersuchten fast durchweg signifikant niedriger als bei Angehörigen des Viertels der Untersuchten mit der geringsten Zufriedenheit.
• Das Viertel der Personen mit der im ersten Jahr höchsten Zufriedenheit hatte im zweiten Jahr im Vergleich mit dem Viertel der StudienteilnehmerInnen mit der geringsten Zufriedenheit Gesundheitsausgaben, die signifikant um 8,8% höher und Arzneimittelausgaben, die ebenfalls signifikant um 9,1% höher waren. An diesen Assoziationen änderte sich selbst dann nichts als die AutorInnen alle Untersuchungspersonen mit sehr schlechtem selbst wahrgenommenem Gesundheitszustand und mit 3 oder mehr chronischen Erkrankungen aus ihrer Untersuchung ausschlossen.
• Noch verblüffender war, dass das Mortalitätsrisiko des Viertels der Personen, die am zufriedendsten war um signifikante 26% höher war als das des am wenigsten zufriedenen Viertels (p=0,02).
Ihre eigenen Versuche, diese unerwarteten oder verwirrenden Assoziationen von hoher Patientenzufriedenheit und erhöhten Behandlungs- und sogar Sterberisiken zu erklären, wägen zwar eine Reihe vertrackter Wechselwirkungen zwischen Ärzteverhalten und Patientenerwartungen ab, liefern aber auch keine plausible Erklärung.
Die AutorInnen plädieren zwar zu Recht dagegen, regelmäßige differenzierte Zufriedenheitsmessungen bei PatientInnen ab sofort zu ignorieren oder als Indikatoren zur Qualitätssicherung auszumustern. Ihre Daten zeigen aber, dass nicht vollständig klar ist, welche messbaren Faktoren die Patientenzufriedenheit letztlich bestimmen oder wie sie sich auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und deren Ergebnisse auswirken.
Insofern gehört der Schlusssatz des Aufsatzes nicht nur zum Ritual wissenschaftlicher Studien, sondern enthält eine ernst zu nehmende Botschaft für die Praxis der Patientenzufriedenheitserhebungen und -nutzungen: "Without additional measures to ensure that care is evidence based and patient centered, an overemphasis on patient satisfaction could have unintentended adverse effects on health care utilization, expenditures, and outcomes."
Der Aufsatz "The Cost of Satisfaction. A National Study of Patient Satisfaction, Health Care Utilization, Expenditures, and Mortality" von Joshua J. Fenton, Anthony F. Jerant, Klea D. Bertakis und Peter Franks ist am 13. Februar 2012 "online first" in der US-Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" erschienen und bisher noch komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.2.12
USA: Qualität von Krankenhaus-Entlassberichten unterscheidet sich je nach Arbeitsbelastung der Ärzte erheblich
 Rund 18 Millionen Mal wird aus deutschen Krankenhäusern pro Jahr ein Patient entlassen. Der Großteil der Entlassenen ist weiter behandlungsbedürftig oder bedarf einer sonstigen nachstationären Unterstützung. Ein wichtiges Bindeglied zwischen der Behandlung im und außerhalb des Krankenhauses und für die Bedarfsgerechtigkeit, Nahtlosigkeit und Zügigkeit der weiteren Behandlung ist der Entlassbericht. Dieser enthält Informationen zur Krankengeschichte, zum stationären Behandlungsverlauf, zur Entlassungsplanung und Hinweise oder Empfehlungen zur Behandlungskontinuität.
Rund 18 Millionen Mal wird aus deutschen Krankenhäusern pro Jahr ein Patient entlassen. Der Großteil der Entlassenen ist weiter behandlungsbedürftig oder bedarf einer sonstigen nachstationären Unterstützung. Ein wichtiges Bindeglied zwischen der Behandlung im und außerhalb des Krankenhauses und für die Bedarfsgerechtigkeit, Nahtlosigkeit und Zügigkeit der weiteren Behandlung ist der Entlassbericht. Dieser enthält Informationen zur Krankengeschichte, zum stationären Behandlungsverlauf, zur Entlassungsplanung und Hinweise oder Empfehlungen zur Behandlungskontinuität.
Nachdem eine Reihe von empirischen Studien für die letzten 10 Jahre Hinweise lieferten, dass die Vorbereitung von PatientInnen auf ihre Entlassung, das so genannte Entlassungs- oder Schnittstellenmanagement, in vielen Krankenhäusern nicht optimal verläuft, stellt sich die Frage, wie die Qualität der Entlassberichte oder Arztbriefe aussieht und wie man eventuelle Defizite beheben kann. Vermutet wird, dass die bei allen Berufsgruppen zu beobachtende Verdichtung der Arbeit, d.h. die Notwendigkeit eine ständig wachsende Anzahl von PatientInnen oder "Fälle" zu behandeln, auch unerwünschte Auswirkungen auf die Qualität der Entlassberichte haben könnte.
Diese Fragen lassen sich im Moment für die deutschen Krankenhäuser nicht beantworten. Die Ergebnisse einer 2011 veröffentlichten Studie über die Qualität der in den USA verfassten Entlassberichte zeigen aber, dass es hier mehr Probleme gibt als erwartet, aber auch konkrete Ursachen und Lösungswege.
Dazu wurden 142 in einem Zeitraum von 3 Monaten erstellte Entlassberichte von insgesamt 61 internistischen Krankenhausärzten in einem Lehrkrankenhaus per Zufall ausgesucht und untersucht. Die Vollständigkeit und die Qualität der verblindeten Berichte wurde mit einem einheitlichen Instrument bewertet. Die Mitglieder einer Interventionsgruppe waren Fachärzte im ersten Berufsjahr mit einer durchschnittlichen Anzahl von 6 entlassenen PatientInnen pro Woche. In der Kontrollgruppe befanden sich erfahrene Internisten, die durchschnittlich 11 PatientInnen pro Woche entließen oder entlassen mussten. Die wöchentlichen Arbeitszeiten waren in etwa gleich. Die Länge der Entlassberichte (in Worten) auch.
Die Analyse ergab folgende Ergebnisse:
• Von den in dem Bewertungsinstrument insgesamt für wichtig gehaltenen Elemente eines Entlassberichts enthielten die Berichte der Interventionsgruppe signifikant mehr als die der Kontrollgruppe (74% versus 65%).
• Die von den geringer belasteten Ärzten im Interventionsteam erstellten Berichte waren praktisch bei allen wichtigen Inhalten vollständiger. So enthielten 65,7% der ärztlichen Entlassberichte aus der Interventionsgruppe praktisch alle wichtigen Informationen zur Patientengeschichte, was hochsignifikant weniger, nämlich nur 36,1% der Berichte aus der stärker mit Arbeit belasteten Kontrollgruppe schafften. Die jeweils statistisch signifikant unterschiedlichen Werte betrugen bei Angaben zur innerstationären Behandlungsverlauf 47,1% versus 22,2%, bei Angaben zur Entlassungsplanung 20% versus 5,5% und bei Angaben/Hinweisen zur Weiterbehandlung bzw. Behandlungskontinuität 24,3% zu 6,9%.
• Weniger als ein Viertel der Berichte enthielten Hinweise auf Entlassungsinstruktionen, Informationen zur Weiterbehandlung oder eine Liste der Medikamente, die zum Zeitpunkt der Entlassung eingenommen wurden.
Auch wenn nachvollziehbar ist, dass die unterschiedliche Arbeitslast im Krankenhausalltag hier nur durch den Vergleich der Arbeit von noch geringer belasteten ärztlichen Berufsanfängern und voll belasteten berufserfahrenen Ärzten abgebildet werden kann, wäre natürlich ein Vergleich unterschiedlich belasteter Ärzte in derselben Berufsaltergruppe noch interessanter.
Trotzdem ist dem Schluss zuzustimmen, dass eine Reduktion der Arbeitsbelastung wahrscheinlich die Qualität der Entlassberichte signifikant verbessern kann und damit auch die Behandlungsqualität vieler PatientInnen.
Der Aufsatz "The effect of workload reduction on the quality of residents' discharge summaries." von Coit MH, Katz JT ist im Journal of General Internal Medicine (2011 Jan; 26(1): 28-32) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.2.12
Elternberichte über Sicherheitsmängel bei der Krankenhaus-Behandlung ihrer Kinder: Qualitativ relevant und starker Wissenszuwachs!
 Für die USA und Kanada wird geschätzt, dass bei rund einem Prozent der stationär behandelten Kinder ein unerwünschtes Ereignis auftritt. 60% dieser Sicherheitsmängel oder Fehlbehandlungen können bei einer entsprechenden Sicherheits- und Fehlerkultur vermieden werden. Deshalb werden weltweit dafür geeignete, anonyme aber auch offene Melde- und Bewertungssysteme eingeführt, in denen Ärzte, Pflegekräfte und andere Beschäftigte im Krankenhaus unerwünschte Ereignisse oder Sicherheitslücken melden können, was wiederum gezielte Prävention auslösen kann.
Für die USA und Kanada wird geschätzt, dass bei rund einem Prozent der stationär behandelten Kinder ein unerwünschtes Ereignis auftritt. 60% dieser Sicherheitsmängel oder Fehlbehandlungen können bei einer entsprechenden Sicherheits- und Fehlerkultur vermieden werden. Deshalb werden weltweit dafür geeignete, anonyme aber auch offene Melde- und Bewertungssysteme eingeführt, in denen Ärzte, Pflegekräfte und andere Beschäftigte im Krankenhaus unerwünschte Ereignisse oder Sicherheitslücken melden können, was wiederum gezielte Prävention auslösen kann.
Auch wenn diese Art der Fehler- und Sicherheitsmängelkultur in den Reihen der Beschäftigten zum Teil noch umstritten ist, gab es bisher wenig systematische Untersuchungen über die Größe der dadurch möglichen Unterfassung der Risiken und vor allem kaum Untersuchungen über mögliche Ergänzungen oder Alternativen.
Für eine Methode oder Quelle, nämlich die Abfrage von wahrgenommenen unerwünschten Ereignissen, Beinahe-Ereignissen oder Sicherheitsrisiken bei den Eltern der behandelten Kinder oder den älteren Kindern, gibt es nun eine vergleichende Analyse aus Kanada.
Vom 1. November 2008 bis zum 30. November 2009 wurden die Angehörige von 544 Familien mit einem stationär behandelten Kind in einem Kinderhospital in der kanadischen Provinz British Columbia bei dessen Entlassung mittels eines Fragebogens nach ihrer Wahrnehmung der genannten Ereignisse befragt. Die Berichte der Familien wurden durch zwei unabhängige Experten auf ihre sachliche Glaubwürdigkeit hin untersucht. Das Erkenntnisinteresse lag auf drei Aspekten: Erstens wollten die ForscherInnen wissen, ob die allen Krankenhaus-MitarbeiterInnen bekannte Existenz dieses Familienberichtssystems etwas an der Anzahl der Fehler- und Sicherheitsberichten von Beschäftigten verändert. Die WissenschaftlerInnen erwarteten einen spürbaren Anstieg der Anzahl derartiger Berichte. Zum zweiten sollte ermittelt werden, ob die Familienberichte (96% von Eltern und 4% von dem behandelten Kind oder anderen Personen) auch tatsächlich relevante Sicherheitsprobleme enthielten oder z.B. spekulative oder gar denunziatorische Berichte überwiegen. Drittens sollte auch die Übereinstimmung oder Schnittmenge der Beschäftigten- mit der Familienberichte untersucht werden.
Die Studienenergebnisse sahen so aus:
• In den 12 Monaten vor dem Start des Familienberichtssystems lieferten die Beschäftigten des Krankenhauses 175 Sicherheitsmängelberichte. In den 13 Monaten des Modellversuchs erhöhte sich die Anzahl nur unwesentlich auf 226 Berichte.
• 37% der Familien mit einem behandelten Kind berichteten über einen oder mehrere Ereignisse, welche dessen gesundheitliche Sicherheit beeinträchtigte. 63% der Familien berichteten kein einziges dieser Ereignisse. Von den insgesamt 321 gemeldeten unerwünschten Ereignissen tangierten 48% auch im Urteil der unabhängigen Gutachter die gesundheitlichen Belange der PatientInnen. Innerhalb der Studienperiode trat aber kein Todesfall auf und war nur eine kleine Anzahl von Ereignissen von sehr schwerer Natur. 62% der 544 Familien waren auch bereit, ihre Antworten nicht anonym zu geben und waren bereits ggfls. das Krankenhaus bei der Beseitigung seiner Sicherheitsprobleme zu unterstützen.
• Von den 321 ernsthaften Familienberichten fanden sich 313 nicht in den Berichten der Krankenhaus-Beschäftigten. Umgekehrt fanden sich aber auch die Inhalte von 218 der 226 Berichte von Beschäftigten nicht in Familienberichten. 76% der Familien, die über wahrgenommene Sicherheitsprobleme berichteten, waren schließlich der Überzeugung, den Beschäftigten seien diese Probleme bekannt oder bewusst. Ein Grund für diese Überzeugung war, dass die Familienangehörigen 139 Entschuldigungen von Beschäftigten für Medikationsproblemen, Ausstattungsmängel und Kommunikationsmängel erhalten hatten.
Obwohl die Studie weder für die kanadischen Krankenhäuser noch andere Krankenhäuser repräsentativ ist und auch noch eine Reihe weiterer Begrenzungen enthält (z.B. keine Berücksichtigung der speziellen Erkrankungen und der familiären Verhältnisse), ist ein Laien- oder patientennahes zusätzliches Sicherheitsmängel-Berichtssystem wahrscheinlich geeignet, das Wissen über Sicherheitsprobleme in der Krankenhausbehandlung quantitativ und qualitativ zu vergrößern bzw. zu erweitern und praktisch zu ihrer Prävention beizutragen. Erst längere Erprobungszeiten könnten auch klären, ob die Nichtreaktion der Beschäftigten auf ein familienbasiertes Sicherheitsinformationssystem von Dauer ist oder doch eine bessere und offenere Fehlerkultur der Angehörigen von Gesundheitsberufen anstößt und verstetigt.
Der Aufsatz "Identification by families of pediatric adverse events and near misses overlooked by health care providers" von Jeremy P. Daniels et al. ist am 10. Januar 2012 in dem Fachorgan der kanadischen Medizinervereinighung "CMAJ" (vol. 184 no. 1 29-34) erschienen und komplett kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 10.1.12
Avastin bei Eierstockkrebs: Länger leben ohne Krankheitsverschlimmerung aber mit Nebenwirkungen und insgesamt nicht länger!?
 Während der Pharmakonzern Roche pünktlich vor Weihnachten 2011 von der "European Medicines Agency (EMA)" die Zulassung ihres Medikaments Avastin für die Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt, zögert das us-amerikanische Tochterunternehmen Genentech nach einem Gespräch mit der US-Zulassungsbehörde "Food and Drug Administration (FDA)" und dem Vorliegen zweier von ihr mitfinanzierten Studien, die Zulassung in den USA aktiv zu betreiben. Unter der Überschrift "Avastin Disappoints Against Ovarian Cancer" zitiert die Nachrichtenagentur "Associated Press" jedenfalls am 28. Dezember 2011 unwidersprochen einen Sprecher der Firma so: "We do not believe the data will support approval".
Während der Pharmakonzern Roche pünktlich vor Weihnachten 2011 von der "European Medicines Agency (EMA)" die Zulassung ihres Medikaments Avastin für die Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt, zögert das us-amerikanische Tochterunternehmen Genentech nach einem Gespräch mit der US-Zulassungsbehörde "Food and Drug Administration (FDA)" und dem Vorliegen zweier von ihr mitfinanzierten Studien, die Zulassung in den USA aktiv zu betreiben. Unter der Überschrift "Avastin Disappoints Against Ovarian Cancer" zitiert die Nachrichtenagentur "Associated Press" jedenfalls am 28. Dezember 2011 unwidersprochen einen Sprecher der Firma so: "We do not believe the data will support approval".
Die Zulassung und Verordnung des Krebsmedikaments Avastin zur Behandlung unterschiedlicher Krebsarten entwickelt sich somit in kürzester Zeit zu einem Lehrstück über verschiedene interregionale Besonderheiten und Probleme der Arzneimittelzulassung und die unterschiedliche Bewertung des Nutzens solcher mit großen Heilungserwartungen entwickelten und vermarkteten Medikamente.
Über den ersten dramatischen Akt dieses Lehrstücks im Bereich der Behandlung von metastasierten Brustkrebs berichteten wir im "forum-gesundheitspolitik" bereits ausführlich. Nach langer fachlicher Debatte zog die FDA für die USA die Anerkennung von Avastin als dafür geeignetes Arzneimittel mit der offiziellen Begründung zurück: "There is no benefit to breast cancer patients that would justify its risks." Trotzdem ist Avastin in Europa auch weiter für die Behandlung von Brustkrebspatientinnen zugelassen.
Im zweiten, wiederum überwiegend in den USA spielenden Akt, verschließen selbst die Hersteller des Medikaments nicht ihre Augen vor den Ergebnissen zweier am 29. Dezember 2011 im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichten und von ihnen mitfinanzierten Studien über die empirischen gesundheitlichen Effekte einer Behandlung von Eierstockkrebs mit Avastin.
Man unterscheidet dabei zwei Wirkungen: Um wieviel die progressionsfreie, d.h. ohne Verschlimmerung der Erkrankung erlebbare Zeit verlängert und um wieviel Wochen, Monate oder auch Jahre das Gesamtüberleben nach dem Erstauftritt der Erkrankung verlängert wird. In beiden Fällen muss abgewogen werden, welche zusätzlichen gesundheitlichen Risiken oder gravierenden Nebenwirkungen mit der Einnahme des Medikaments verbunden sind und möglicherweise die sonstige Lebensqualität gewaltig verschlechtern.
Die doppelblinde, placebokontrollierte Studie von Burger et al. mit 1.873 teilnehmenden Frauen mit Eierstockkrebs untersuchte als primären Endpunkt ihrer Intervention das progressionsfreie Überleben durch das während der Chemotherapie und den 10 Monaten nach ihrer Beendigung eingenommene Avastin.
Das Ergebnis weist für die mit einer Standardchemotherapie und einem Placebo behandelte Kontrollgruppe von Partientinnen 10,3 Monate progressionsfreies Überleben nach. In der Gruppe, die zu allen Zeitpunkten ihrer Behandlung Avastin erhielt, betrug diese Zeit 14,1 Monate. Avastin verlängerte also wahrscheinlich diese Art des Überlebens um 4 Monate. Auf der Schattenseite war die Rate derjenigen Angehörigen der Avastin-Gruppe, die sich wegen höheren Blutdrucks und schweren Magen-/Darmstörungen behandeln lassen mussten, signifikant höher als in der Kontrollgruppe.
Auch in der zweiten Studie (Perren et al.) mit 1.528 Frauen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung ihrer Eierstöcke von wurde primär die Verlängerung des progressionsfreien Lebens untersucht. 36 Monate nach Beginn der Therapie fanden die ForscherInnen in der Kontrollgruppe mit Chemotherapie und ohne Avastin ein progressionsfreies Überleben von 20,3 Monaten und von 21,8 Monaten in der Avastin-Gruppe. Der Unterschied war statistisch signifikant. In einer zusätzlichen Analyse nach 42 Monaten betrug das progressionsfreie Überleben in der Kontrollgruppe 22,4 Monate und lag in der Avastingruppe bei 24,1 Monate. Auch wenn sich die Abstände der progressionsfreien Zeiten zwischen den beiden Gruppen gegenüber der ersten Studie verringert hatten, war der Unterschied immer noch statistisch signifikant. Zu den letztlich nicht eindeutig kausal zu klärenden Beobachtungen dieser Studie gehört, dass die Wirkung von Avastin, das progressionsfreie Überleben zu verlängern, nicht zu jedem Zeitpunkt der Studie existierte. Während die Wirkung nach 12 Monaten der Intervention eindeutig auftrat, war sie nach 24 Monaten so schwach, dass die Chance des progressionsfreien Überlebens für die Nutzerinnen der Standardtherapiegruppe sogar leicht höher war.
Auch bei den Teilnehmerinnen dieser Studie traten eine Reihe der bereits genannten Art in schwerem Maße wie z.B. schwerer Bluthochdruck auf.
Auch wenn beide ForscherInnen-Gruppen nicht das Gesamtüberleben als primären Endpunkt der Avastin-Intervention untersuchten bzw. Burger et al. sogar während der laufenden Studie auf diesen Endpunkt zugunsten des progressionsfreien Überlebens verzichteten, muss man auf gesicherte Daten darüber, ob Avastin das Gesamtüberleben verlängert bei Perren et al. noch bis 2013 warten. Burger et al. liefern eher nebenbei einige Daten, die belegen, dass Avastin die Chance, die Erkrankung insgesamt zu überleben, nicht erhöht bzw. Unterschiede nicht signifikant sind. Angehörige der Placebo-Kontrollgruppe überlebten danach 39,3 Monate, die nur zeitweise mit Avastin behandelten Frauen 38,7 Monate und die in der gesamten Behandlungszeit auch mit Avastin behandelten Frauen 39,7 Monate. Wenn also eine Behandlung mit Avastin überhaupt das Gesamtüberleben verlängert, ist der maximale Lebensgewinn 12 Tage.
Das Lehrstückhafte der aktuellen Debatten über und Entscheidungen zu Avastin besteht u.E. darin; dass sich in diesem Zusammenhang nicht zum ersten Mal einige bedeutende und schwierige Fragen aufdrängen: Was ist der Grund für die beträchtlichen Bewertungsunterschiede des Nutzens von bestimmten Therapien zwischen europäischen und us-amerikanischen Arzneimittel-Zulassungsinstitutionen? Warum bewerten die europäischen Experten die Studienlage, die z.B. in den USA zu einem einstimmigen Urteil über den mangelnden Nutzen von Avastin zur Brustkrebsbehandlung beigetragen hat, völlig anders? Warum freuen sich Vertreter des Herstellers Roche auf der Grundlage ein- und desselben Wissens über die Zulassung von Avastin zur Eierstockkrebstherapie in Europa und scheuen andere Vertreter des Unternehmens in den USA davor zurück, das Mittel dort für diese Indikation zuzulassen? In beiden Ländern generiert ein Jahr Behandlung mit Avastin im Übrigen einen Umsatz von rund 100.000 US-Dollar.
Noch drängender sind Fragen, wie im Rahmen der "evidence-based-medicine"-Orientierung neben der wissenschaftlichen Evidenz für den Nutzen einer Behandlung gleichrangig die "patient values" aussehen bzw. erfasst werden können: Welche "Überlebens"-Variante ist aus Sicht der Kranken wichtiger: die möglichst lange Zeit der Nichtverschlimmerung oder des Nichtwiederauftretens einer Erkrankung nach ihrem ersten Auftreten oder das möglichst lange Überleben der Erkrankung? Bei welchen Größenordnungen (z.B. wenige Monate und wenige Tage) von positiven Wirkungen im Bereich des progressionsfreien oder Gesamtüberlebens nehmen PatientInnen das Risiko von schweren Nebenwirkungen in Kauf und ist die Therapie mit Mitteln wie Avastin aus Patientensicht gerechtfertigt? Ist die Annahme, Kranke griffen zu jedem "Strohhalm", der ihnen Hilfe verspricht, "koste es, was es wolle", wirklich realistisch
Antworten erhält man darauf mit Sicherheit nicht mit noch so aufwändigen "hazard of death"-, "Was-wäre-wenn"- oder Survival-Analysen, sondern wahrscheinlich nur durch qualitative Studien, in denen die letztlich entscheidenden Wahrnehmungen, Entscheidungskalküle und Erfahrungen der betreffenden Patientinnen ernst genommen und systematisch erhoben werden.
Von den am 29. Dezember 2011 veröffentlichten Studien "Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer" von Robert A. Burger et al. (New England Journal of Medicine 2011; 365: 2473-2483) und "A Phase 3 Trial of Bevacizumab in Ovarian Cancer" von Timothy J. Perren et al. (New England Journal of Medicine 2011; 365: 2484-2496) sind Abstracts erhältlich.
Bernard Braun, 6.1.12
Nackenschmerzen? Es muss nicht immer ein nichtsteroidales Antirheumatikum sein: Anderes ist mehr!
 An Nackenschmerzen leiden ca. 70% aller Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens. Umso verwunderlicher ist der Mangel an Untersuchungen, die bei der Wahl von Therapien gegen das akute oder auch bereits chronische Auftreten dieser Schmerzen Entscheidungshilfen liefern können. Vielfach greifen daher Ärzte und Patienten zu den symptomatisch meist wirksamen nichtsteroidalen Antirheumatika - Schmerzmittel mit entzündungshemmender Zusatzwirkung.
An Nackenschmerzen leiden ca. 70% aller Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens. Umso verwunderlicher ist der Mangel an Untersuchungen, die bei der Wahl von Therapien gegen das akute oder auch bereits chronische Auftreten dieser Schmerzen Entscheidungshilfen liefern können. Vielfach greifen daher Ärzte und Patienten zu den symptomatisch meist wirksamen nichtsteroidalen Antirheumatika - Schmerzmittel mit entzündungshemmender Zusatzwirkung.
Dass es auch anders und ohne die nicht seltenen und mehr oder weniger schweren Nebenwirkungen dieser Arzneimittel geht, unterstreicht nun eine Studie, welche die Wirkung einer jeweils zwölfwöchigen Behandlung mit diesen Arzneimitteln mit der von chiropraktischen Interventionen im Bereich der Wirbelsäule und des Rückens und häuslichen körperlichen Übungen (vorbereitet in zwei externen Übungsterminen) vergleicht.
Die Studie wurde bei 272 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt, die zwischen 2 und 12 Wochen an unspezifischen Nackenschmerzen litten. Der primäre Endpunkt zur Beurteilung der Wirksamkeit war das Auftreten von Schmerzen nach 2, 4, 8, 12, 26 und 52 Wochen nach der Aufteilung der StudienteilnehmerInnen auf die Interventionsgruppen. Zusätzlich wurden als sekundärer Outcome u.a. die Lebensqualität, der Grad der Behinderung und die Beweglichkeit des Nackens an verschiedenen Zeitpunkten gemessen.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Die chiropraktische Intervention hatte fast zu jedem Zeitpunkt nach Beginn der UIntervention einen statistisch signifikanten Vorteil gegenüber der Behandlung mit den genannten Arzneimitteln.
• Auch die Wirksamkeit der häuslichen Gymnastik war gegenüber der von Arzneimitteln zumindest nach 26 Wochen statistisch signifikant besser.
• Bei der Wirksamkeit gegen Schmerzen gab es zu keinem Zeitpunkt wichtige Unterschiede zwischen den chiropraktischen und eigenaktiven Interventionen.
• Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den verschiedenen Merkmalen des sekundären Outcomes der Interventionen.
Egal, ob man sich immer noch lieber in die Hände von Experten, d.h. hier in die von ChiropraktikerInnen begibt oder die Therapie doch gut vorbereitet in die eigenen Hände nimmt, sind die Effekte auf Nackenschmerzen und sonstige gesundheitliche Merkmale stärker als die der entzündungshemmenden Schmerzmittel. Die wenigen von den AutorInnen eingeräumten Grenzen ihrer Studie (z.B. keine Verblindung der Interventionsformen) ändern an dieser grundsätzlichen Erkenntnis nichts.
Der am 3. Januar 2012 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (vol. 156 no. 1 Part 1: 1-10) erschienene Aufsatz "Spinal Manipulation, Medication, or Home Exercise With Advice for Acute and Subacute Neck Pain. A Randomized Trial" von Gert Bronfort et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.1.12
Mehr und ausgeruhte Pflegekräfte=weniger Wiedereinweisungen und Ausgaben sowie bessere Entlassung: Spinnerei oder Wirklichkeit?
 Was bedeutet ein Mangel an Pflegepersonen oder ein Mangel an Pflegekräften mit bestimmten Qualifikationen für die Behandlungsqualität von KrankenhauspatientInnen? Wer dazu verlässliche Antworten in entsprechend konzipierten und methodisch hochwertigen wissenschaftlichen Untersuchungen sucht, kann sich durch eine Fülle von insbesondere internationalen Fachzeitschriften wühlen oder findet auf der Website "Truth About Nursing" eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über Veröffentlichungen zu diesen meist in den angelsächsischen Ländern durchgeführten empirischen Studien. Die Seite wird von der nicht gewinnorientierten internationalen Organisation "Truth" mit Sitz in Baltimore gepflegt, deren erklärtes Ziel es ist, der Öffentlichkeit die zentrale Rolle nahezubringen, welche Pflegekräfte in der Gesundheitsversorgung spielen.
Was bedeutet ein Mangel an Pflegepersonen oder ein Mangel an Pflegekräften mit bestimmten Qualifikationen für die Behandlungsqualität von KrankenhauspatientInnen? Wer dazu verlässliche Antworten in entsprechend konzipierten und methodisch hochwertigen wissenschaftlichen Untersuchungen sucht, kann sich durch eine Fülle von insbesondere internationalen Fachzeitschriften wühlen oder findet auf der Website "Truth About Nursing" eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über Veröffentlichungen zu diesen meist in den angelsächsischen Ländern durchgeführten empirischen Studien. Die Seite wird von der nicht gewinnorientierten internationalen Organisation "Truth" mit Sitz in Baltimore gepflegt, deren erklärtes Ziel es ist, der Öffentlichkeit die zentrale Rolle nahezubringen, welche Pflegekräfte in der Gesundheitsversorgung spielen.
Die Informationen sind nach den Abschnitten "Reports on nurse staffing levels and their effects", "Research", Analysis and first accounts of effects of nurse staffing levels" und Recruit and retain nurses in the workforce" gegliedert. An eine kurze Überschrift schließt sich meist das offizielle Abstract oder seine Zusammenfassung und ein Link zu Pubmed oder der Zeitschrift selber an. Abgeschlossen wird die Seite mit einer Darstellung der von der "American Nurses Association" getragenen Kampagne "Safe staffing saves lives".
Zu den Beiträgen gehören zum Beispiel
• der komplett kostenlos erhältliche Aufsatz "Implications of the California Nurse Staffing Mandate for Other States" von Linda H. Aiken, Douglas M. Sloane, Jeannie P. Cimiotti, Sean P. Clarke, Linda Flynn, Jean Ann Seago, Joanne Spetz und Herbert L. Smith (in der Zeitschrift "Health Services Research" Volume 45, Issue 4, 2010: 904-921) , der u.a. über die Effekte des Unterschreitens der im Bundesstaat Kalifornien gesetzlich festgelegten Mindestrelationen zwischen Pflegekräften und Patienten auf die Mortalität berichtet (z.B. Medical-surgical 1:5, Pädiatrie 1:4, Intensivversorgung 1:2, Onkologie 1:5, Geburtshilfe 1:3)
• und das hier nur kostenlos erhältliche Abstract des Aufsatz "Quality and Cost Analysis of Nurse Staffing, Discharge Preparation, and Postdischarge Utilization" von Marianne E. Weiss1, Olga Yakusheva und Kathleen L. Bobay (in der Oktoberausgabe 2011 der Zeitschrift "Health Services Research", Volume 46, Issue 5: 1473-1494) in dem der empirische Nachweis erbracht wird, dass der Umbau von Pflegekräfte-Überstunden in zusätzliche Pflegekräftestellen nicht nur der Versorgungsqualität der PatientInnen zugutekommt (z.B. weniger Wiedereinweisungen), sondern sich auch für das Wirtschaftsunternehmen Krankenhaus rechnet.
Auf der Truth-Seite kann auch ein regelmäßig erscheinender Newsletter bestellt werden.
Die "Truth About Nursing"-Literaturübersichtsseite lohnt sich regelmäßig zu besuchen.
Bernard Braun, 7.12.11
Sind Haus- und Geburtshausgeburten riskanter als Krankenhausgeburten? Was eine britische Studie wirklich dazu findet!!
 Die Veröffentlichung einer großen britischen Studie über die Risiken von außer- und innerstationären Geburten war der Anlass für eine in zahlreichen Medien fast wortgleich verbreitete Schlussfolgerung zweier deutscher Verbandsexperten: "Bei einer Hausgeburt können Geburtsstillstand, Blutungen bei der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Kind auftreten, warnen die Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und des Berufsverbandes der Frauenärzte, Prof. Klaus Friese und Christian Albring. In Deutschland müsse fast jede zehnte Schwangere, die ihre Entbindung als Hausgeburt begonnen hat, während der Geburt wegen Komplikationen in ein Krankenhaus gebracht werden. In mehr als der Hälfte dieser Fälle sei dann ein Kaiserschnitt oder der Einsatz einer Saugglocke oder Zange nötig." So exemplarisch alarmisierend die Meldung im Web-Angebot der Illustrierten "Stern", die dann auch in der impliziten Aufforderung mündet, lieber sofort im Krankenhaus gebären zu wollen.
Die Veröffentlichung einer großen britischen Studie über die Risiken von außer- und innerstationären Geburten war der Anlass für eine in zahlreichen Medien fast wortgleich verbreitete Schlussfolgerung zweier deutscher Verbandsexperten: "Bei einer Hausgeburt können Geburtsstillstand, Blutungen bei der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Kind auftreten, warnen die Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und des Berufsverbandes der Frauenärzte, Prof. Klaus Friese und Christian Albring. In Deutschland müsse fast jede zehnte Schwangere, die ihre Entbindung als Hausgeburt begonnen hat, während der Geburt wegen Komplikationen in ein Krankenhaus gebracht werden. In mehr als der Hälfte dieser Fälle sei dann ein Kaiserschnitt oder der Einsatz einer Saugglocke oder Zange nötig." So exemplarisch alarmisierend die Meldung im Web-Angebot der Illustrierten "Stern", die dann auch in der impliziten Aufforderung mündet, lieber sofort im Krankenhaus gebären zu wollen.
Nachdem es den ärztlichen und stationären Geburtshilfeexperten in Deutschland bis heute gelang, die weltweit relativ seltene Situation zu perpetuieren, dass mehr als 95% der Geburten in Krankenhäusern stattfinden, kann sich am Beispiel der Rezeption dieser im "British Medical Journal (BMJ)" am 24. November 2011 frei zugänglich veröffentlichten Studie jeder ein eigenes Bild von der Härte der berufspolitischen Auseinandersetzung um Schwangere und ihre Kinder machen und der Bereitschaft, dafür sehr selektiv zu lesen und zu argumentieren.
In dieser prospektiven Kohoertenstudie wurden im Zeitraum zwischen April 2008 und April 2010 das Geburtsgeschehen und die dabei auftretenden Komplikationen, Interventionen und unerwünschten Wirkungen bei 79.774 britischen Schwangeren untersucht, unter denen 64.538 ein niedriges Schwangerschaftsrisiko hatten. Frauen, die eine geplante Kaiserschnittentbindung machen oder eine ungeplante Hausgeburt hatten, wurden aus der Studie ausgeschlossen.
Die Studie lieferte folgende Erkenntnisse:
• Sie bestätigte zum einen, dass gesunde schwangere Frauen, die eine Entbindung in einer Hebammeneinrichtung planen, im Vergleich zu Entbindenden in einer Krankenhaus-Entbindungsstation mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Entbindung mit wenigen ärztlichen und medizinischen Interventionen haben.
• Sie bestätigte auch, dass es bisher immer noch einen Mangel an Evidenz zur Ergebnisqualität im Bereich der seltenen aber ernsten unerwünschten Geburtsereignissen für alle Gebär-Settungs gibt. Die Studie will daran etwas ändern, erwartete selber aber wenig Nachteiliges für die außerstationären Angebote.
• Für gesunde Erstgebärende (nulliparous), die ein geringes Schwangerschaftsrisiko aufweisen, "the risk of an adverse perinatal outcome seems to be higher for planned births at home, and the intrapartum transfer rate (in ein Krankenhaus) is high in all settings other than obstetric unit." Die Rate der ungeplanten Überführungen von Gebärenden in eine stationäre Geburtshilfeeinrichtung schwankte zwischen 36% und 45%. Die Anzahl unerwünschter Ereignisse während der Geburt war aber trotzdem so gering, dass deswegen bestimmte Wahrscheinlichkeitswerte nicht berechnet werden konnten. Andererseits ist die Rate erwünschter Ergebnisse wie z.B. dem Stillen der Neugeborenen bei außerstationären Geburten signifikant höher als bei den Krankenhaus-Neugeborenen und ihren Müttern.
• Für gesunde Frauen, die geringe Schwangerschaftsrisiken aufwiesen, ist die Inzidenz unerwünschter Ereignisse rund um die Geburt herum (perinatal) in allen Geburts-Settings niedrig.
• Was beim innerdeutschen Kampf um die Krankenhaus-Geburt als Normalfall dann komplett unterschlagen wird, ist folgendes: Für gesunde Frauen, die das zweite oder ein weiteres Kind gebären (multiparous), und wiederum ein geringes Schwangerschaftsrisiko aufweisen, gibt es im Vergleich zu den im Krankenhaus gebärenden Mehrfachgebärenden und im Vergleich der unterschiedlichen außerstationären Gebärmöglichkeiten keinen statistisch signifikanten Unterschied des Auftretens unerwünschter Ereignisse.
• Für diejenigen LeserInnen, die wissen wollen, über welche "Feinheiten" deutsche Lobbyisten fürs stationäre und ärztliche Gebären hinweglesen (lassen), sei hier die sorgfältig differenzierende Zusammenfassung der Studie durch ihre AutorInnen zitiert: "The results support a policy of offering healthy women with low risk pregnancies a choice of birth setting. Women planning birth in a midwifery unit and multiparous women planning birth at home experience fewer interventions than those planning birth in an obstetric unit with no impact on perinatal outcomes. For nulliparous women, planned home births also have fewer interventions but have poorer perinatal outcomes."
Dank der vorbildlichen "open access"-Politik des BMJ kann sich jeder daran Interessierte von den weiteren Details und quantitative Belegen der Studie "Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study" kostenlos ein vollständiges Bild verschaffen und in Zukunft noch skeptischer gegenüber Äüßerungen von Anbieterverbandsvertretern sein. Die von der "Birthplace in England Collaborative Group" unter Leitung von Peter Brocklehurst durchgeführte Studie ist im BMJ (343 doi: 10.1136/bmj.d7400) erschienen.
Bernard Braun, 1.12.11
"Schrecklich, mit den Frühchen"! Aber: Ärzte und Pflegekräfte halten sich bei 52% bzw. 66% der Gelegenheiten an Hygienepflichten
 Die seit einigen Tagen laufenden öffentlichen Debatten über die Ursachen und die Vermeidbarkeit des Todes dreier so genannter "Frühchen" in der neonatologischen Spezialabteilung eines großen Bremer Krankenhauses, machen zum wiederholten Male innerhalb der letzten Jahre darauf aufmerksam, dass es auch in Krankenhäusern gesundheitliche oder auch tödliche Risiken gibt. Trotz aller professionellen Ethik und den ab dem 1.1. 2012 sogar bundesweit geltenden Infektionsschutz- oder Hygienevorschriften (bis 2011 gab es in mehreren Bundesländern solche Vorschriften überhaupt nicht), gilt neben der durch übermäßigen Antibiotikaeinsatz immer größer werdenden Anzahl multi-resistenter Krankheitserreger auch mangelnde Handhygiene als eine wichtige zum größten Teil vermeidbare Ursache für den jährlichen Tod von zig Frühgeborenen (die genaue Anzahl ist nicht bekannt) und mindestens 15.000 erwachsenen Patienten in Krankenhäusern.
Die seit einigen Tagen laufenden öffentlichen Debatten über die Ursachen und die Vermeidbarkeit des Todes dreier so genannter "Frühchen" in der neonatologischen Spezialabteilung eines großen Bremer Krankenhauses, machen zum wiederholten Male innerhalb der letzten Jahre darauf aufmerksam, dass es auch in Krankenhäusern gesundheitliche oder auch tödliche Risiken gibt. Trotz aller professionellen Ethik und den ab dem 1.1. 2012 sogar bundesweit geltenden Infektionsschutz- oder Hygienevorschriften (bis 2011 gab es in mehreren Bundesländern solche Vorschriften überhaupt nicht), gilt neben der durch übermäßigen Antibiotikaeinsatz immer größer werdenden Anzahl multi-resistenter Krankheitserreger auch mangelnde Handhygiene als eine wichtige zum größten Teil vermeidbare Ursache für den jährlichen Tod von zig Frühgeborenen (die genaue Anzahl ist nicht bekannt) und mindestens 15.000 erwachsenen Patienten in Krankenhäusern.
Wer bisher glaubte, dass das noch zusätzlich qualifizierte und sensibilisierte ärztliche und pflegerische Personal in intensivmedizinischen Einrichtungen für besonders geschwächte oder gefährdete PatientInnen wie "Frühchen" oder kleine Kinder sich konsequent an die fachlich unumstrittenen Regeln zur Händehygiene hält, muss seine Vorstellung mit der Veröffentlichung einer Untersuchung in der pädiatrischen und neonatologischen Intensivstation des Groß- und Universitäts-Klinikums Aachen korrigieren.
In einer im Jahr 2009 durchgeführten Studie wurden dort sämtliche behandelnden Personen und ihre patienten- oder hygienebezogenen Handlungen 192 Stunden lang mit ihrem Wissen lückenlos beobachtet. Zusätzlich zu der Information, dass ihr Hygieneverhalten beobachtet wird, wurden die Beschäftigten in einer sechswöchtigen Pilotphase in mündlicher und schriftlicher Form gründlich über Hygienevorschriften informiert. Dies umfasste auch Verweise auf die kostenlos erhältlichen 270 Seiten umfassenden und weltweit anerkannten " Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care 2009" der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ferner wurde mit den Beschäftigten das sachgerechte Verhalten trainiert und die dafür benötigte Ausrüstung installiert. Mit anderen Worten: Sehr viel besser können Beschäftigte nicht darauf vorbereitet werden, Hygienevorschriften einzuhalten und dabei beobachtet zu werden.
Die Ergebnisse sahen dann so aus:
• Die Anzahl von Situationen und Gegelegenheiten zur Handhygiene ("hand hygiene opportunities") ist höher als erwartet: In der pädiatrischen Intensivstation lag ihre Anzahl bei 321 in 24 Stunden, während es in der neonatologischen Intensivstation in derselben Zeit "nur" 194 solcher Gelegenheiten gab. Der Hauptteil dieser Gelegenheiten lag vor Kontakten zu den PatientInnen und nach dem Kontakt mit ihnen.
• Die Compliancerate, d.h. die Treue mit der sich die Beschäftigten an die durch Vorschriften geregelten Abläufe hielten, betrug in der pädiatrischen Intensivversorgung insgesamt 53% (170 handhygienische Aktivitäten). Die Beschäftigten in der Neonatologie waren statistisch signifikant vorschriftentreuer und hielten sich in 118 oder 61% der Gelegenheiten an die Handhygienevorschriften.
• Die Durchschnittswerte verdecken hier aber in besonderer Weise einen sehr kritisch zu bewertenden Teil der Wirklichkeit. Während sich Pflegekräfte in den beiden Stationen zu 57% (Pädiatrie) und 66% (Neonatologie) an die Hygienevorschriften hielt, taten dies lediglich 29% bzw. 52% der dort beschäftigten Ärzte. Die AutorInnen der Studie empfehlen daher auch, weitere Trainings und Kampagnen auf die Ärzteschaft zu konzentrieren.
• Interessant war auch, dass die Hygiene-Compliance vor dem Kontakt mit einem der PatientInnen höher war als nach dem Kontakt. Dies kann man mit den AutorInnen positiv im Sinne des Patientenwohls bewerten. Aber auch die Compliance vor dem Kontakt mit PatientInnen war bei weitem nicht optimal.
• Wer nun meint, die Hygiene-Compliance sei im "normalen" beispielsweise unbeobachteten Betrieb in solchen Stationen niedriger, hat leider wahrscheinlich recht: Aus den so genannten Hand-KISS-Daten des "National Reference Laboratory for Infection Control" am Robert Koch-Institut in Berlin errechnen sich in den dort erfassten 24 pädiatrischen (in 24 Krankenhäusern) und 57 neonatologischen (in 56 Krankenhäusern) 33 bzw. 29 gründliche Händereinigungen pro Patiententag. Obwohl wie gesehen keineswegs perfekt, reinigten sich die StudienteilnehmerInnen in Aachen ihre Hände im Durchschnitt 43 Mal pro Patiententag.
In Kenntnis der mit Sicherheit erheblich positiv verzerrten Ergebnisse der Studie im Klinikum Aachen kann man sich eigentlich nur noch wundern, warum nicht wesentlich mehr und wesentlich häufiger "Frühchen" oder schwer kranke Kinder (darunter viel am offenen Herzen operierte Kinder) sterben.
Die Studie zeigt aber auch, dass viele für wirksam gehaltenen präventiven Interventionen, darunter das Schließen von Wissenslücken, Verhaltenstrainings und optimale Ausstattungen allein zwar graduelle Verbesserungen bewirken können, aber am Grundproblem mangelnder und folgenreicher Handhygiene nichts ändern.
Die sowohl in Bremen zu hörenden Hinweise, man selber habe sich aber an alle Vorschriften gehalten oder die nach der hier vorgestellten Studie zu erwartenden Zweifel an der Repräsentativität der Aachener Ergebnisse, sind als reine Verteidigungsrhetorik zu bewerten. Die ebenfalls immer wieder bemühten Argumente, dass gerade "Frühchen" wegen ihrem nicht entwickelten Immunsystem bereits ein extrem hohes "natürliches" und eben auch potenziell tödliches Infektionsrisiko haben und viele Keime gegen Antibiotika resistent sind, ist ernster zu nehmen, enthebt aber auch nicht von der Pflicht, die Händehygiene der Beschäftigten bei der Versorgung dieser PatientInnen besonders ernst zu nehmen.
Über die gelungenen Versuche, wirklich etwas gegen den vermeidbaren hygienebedingten Tod von "Frühchen" und erwachsenen PatientInnen (vgl. z.B. zur erfolgreichen MRSA-Prophylaxe à la Niederlande eine ZDF-Reportage vom 24.8.2011 die mit dem Stichwort MRSA und dem Sendungsnamen ZDFzoom aufgerufen werden kann) zu tun und den dafür allerdings notwendigen Aufwand, wird daher noch umfassender berichtet und diskutiert werden müssen.
Der auch mit reichlich weiterführender Literatur versehene Aufsatz "Hand hygiene in pediatric and neonatal intensive care unit patients: Daily opportunities and indication- and profession-specific analyses of compliance" von Simone Scheithauer et al. ist in der November-Ausgabe des "American Journal of Infection Control" (Volume 39, Issue 9: 732-737, November 2011) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich. Die Hauptergebnisse sind auch schon als Poster auf dem 20. "European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)" im April 2010 in Wien vorgestellt worden.
Bernard Braun, 12.11.11
Weniger Entbindungen gleich höhere Komplikationsraten! Mindestmengen oder gezieltes Training für Geburtshelfer mit wenig Praxis?
 Für eine Reihe von Operationen gibt es Belege für einen unerwünschten Zusammenhang der pro Krankenhaus oder Chirurg durchgeführten Operationen mit der Behandlungs- oder Ergebnisqualität: Weniger Operationen gleich schlechterer Outcome und umgekehrt. In einer Reihe von Ländern, darunter auch der Bundesrepublik Deutschland, versucht die Gesundheitspolitik dies in Gestalt von Mindestmengenregelungen und damit des Ausschlusses von Operatueuren oder Behandlern zu berücksichtigen.
Für eine Reihe von Operationen gibt es Belege für einen unerwünschten Zusammenhang der pro Krankenhaus oder Chirurg durchgeführten Operationen mit der Behandlungs- oder Ergebnisqualität: Weniger Operationen gleich schlechterer Outcome und umgekehrt. In einer Reihe von Ländern, darunter auch der Bundesrepublik Deutschland, versucht die Gesundheitspolitik dies in Gestalt von Mindestmengenregelungen und damit des Ausschlusses von Operatueuren oder Behandlern zu berücksichtigen.
Ob es diesen Zusammenhang auch im Bereich der Entbindungen bzw. der Geburtshilfe gibt, wurde nun in einer USA-weiten retrospektiven Kohortenstudie auf der Basis von 380.000 Entbindungen in Krankenhäusern aus dem Jahr 2007 genauer untersucht. Dazu wurden die Krankenhäuser und Geburtshelfer nach der Anzahl ihrer Entbindungen eingeteilt. Der niedrigste Wert lag bei weniger als 7 Entbindungen pro Jahr, der höchste bei 90 und mehr Geburten pro Jahr. Außerdem wurden die Entbindungskomplikationen dokumentiert, darunter Infektionen, Thrombosen, schwere Dammverletzungen und nachgeburtliche Blutungen.
Nach einem Ausgleich der unterschiedlichen medizinischen und schwangerschaftsspezifischen Risikofaktoren zeigte sich als erstes keine konsistente Beziehung zwischen der Gesamtanzahl der Entbindungen in den Krankenhäusern und der Häufigkeit der ausgewählten Komplikationen. Dagegen war aber die Komplikationsrate bei den Entbindungen, die von individuellen Geburtshelfern mit dem geringsten Entbindungsvolumen erbracht wurden, um 50% höher als bei Geburtshelfern mit der höchsten Entbindungsrate. Die Komplikationsraten lagen bei 17,8% und 12,7% und der Unterschied war hochsignifikant. Nur in einem Punkt veränderte sich diese Assoziation: In Krankenhäusern mit einem höheren Volumen an Entbindungen war das Risiko einer Infektion signifikant höher als in Kliniken, die weniger Entbindungen machten. Die Mitberücksichtigung weiterer Charakteristika der Krankenhäuser oder die Häufigkeit von Kaiserschnittentbindungen wirkte sich auf das Komplikationsgeschehen nur wenig aus.
Angesichts dieser auf der Ebene einzelner Geburtshelfer eindeutigen Zusammenhänge, plädieren die WissenschaftlerInnen dafür, solche Ergebnisse nicht nur dazu zu nutzen, die Ergebnisqualität durch öffentliche Ergebnisberichterstattung und verfeinerte Rankinglisten über die Geburtshelfer zu verbessern. Neben einer vorrangigen Überweisung von Schwangeren an Geburtshelfer mit einer hohen Anzahl von Entbindungen sollten aber die Daten dazu genutzt werden, Geburtshelfer zu identifizieren, die zusätzliches Training und Unterstützung brauchen, um bessere Leistungen erbringen zu können.
Ob solche Effekte auch in Deutschland existieren, lässt sich mangels vergleichbarer und veröffentlichter Untersuchungen der hier beschriebenen Art nicht sagen. Sofern dies nachgeholt wird, sollten aber auf jeden Fall weitere Merkmale der Geburtshelfer (z.B. deren weitere Spezialisierung) miterfasst werden, deren Nichtberücksichtigung die US-AutorInnen als einen Mangel ihrer Studie bezeichnen.
Der Aufsatz "Hospital volume, provider volume, and complications after childbirth in U.S. hospitals" von Janakiraman V. et al. ist im September 2011 in der US-Fachzeitschrift "Obstetric Gynecology" (118: 521) erschienen, und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.10.11
"Darf's ein wenig mehr sein"? Blutarmut durch Blutabnahme als jüngstes Beispiel der Fehlversorgung durch Überversorgung
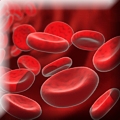 Der Blutverlust bei der Blutabnahme für diagnostische Zwecke ist bei Patienten, die wegen eines akuten Herzinfarkts stationär behandelt werden, mit einem im Krankenhaus erworbenen Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) assoziiert. Die Folge, eine unzureichende Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers, ist gerade bei Menschen mit bereits vorgeschwächtem Organismus ungesund und daher eigentlich systematisch zu vermeiden.
Der Blutverlust bei der Blutabnahme für diagnostische Zwecke ist bei Patienten, die wegen eines akuten Herzinfarkts stationär behandelt werden, mit einem im Krankenhaus erworbenen Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) assoziiert. Die Folge, eine unzureichende Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers, ist gerade bei Menschen mit bereits vorgeschwächtem Organismus ungesund und daher eigentlich systematisch zu vermeiden.
Trotzdem zeigte eine Untersuchung bei 17.676 Herzinfarkt-Patienten, die im Zeitraum von 2000 bis 2008 bei ihrer Einweisung in eines von 57 us-bundesweiten Krankenhäusern nicht an Blutarmut litten, dass rund 20% von ihnen während ihres Krankenhausaufenthaltes eine moderate bis ernste Form einer Anämie entwickelten. Der Hauptgrund war die während des Aufenthalts und insbesondere während der ersten beiden Tage für diagnostische Zwecke entnommene Menge Blut: Bei den anämischen Personen betrug diese Menge 175 mL, bei den nchtanämischen Patienten lediglich 85 mL. Und auch bei den Patienten mit nachstationärer Anämie variierte die entnommene Blutmenge zwischen 119 mL bei moderater Blutarmut bis zu 246 mL Blut bei schwerer Blutarmut. Menschen mit keiner oder einer leichten Form der Blutarmut hatten zwischen 53 und 110 mL abgenommen bekommen. Dies alles zeigt auch, dass es bei vergleichbar erkrankten Personen große Mengen Blut keineswegs gesundheitlich notwendig sind, sondern man auch "mit ein bisschen weniger" diagnostizieren und behandeln kann.
Wer der Meinung ist, es käme bei der Menge Blut im Körper nicht auf ein paar Tropfen an, kann sich durch die Ergebnisse dieser Studie eines Besseren belehren lassen. Mit jeden 50 mL entnommenen Blutes steigt das Risiko für leichte bis schwere Blutarmut und damit auch der Folgen um 18%, multivariat adjustiert immer noch signifikant um 15%.
Die Autoren schlagen auch noch zwei eigentlich triviale Mittel vor, um die Entnahmemenge generell zu reduzieren: Blutröhrchen aus der Pädiatrie zu verwenden oder einfach die Erwachsenenbehälter mit weniger als der höchstmöglichen Menge zu füllen. Nachzudenken wäre aber auch noch über den Sinn und Zweck mancher Blutentnahme. Ob auch bei anderen Behandlungsanlässen für eine stationäre Behandlung so viel zu viel Blut abgenommen wird, dass Blutarmut die Folge ist und ob dies ohne Nachteile für die Diagnostik und Therapie reduziert werden kann, sollte weiter untersucht werden.
Der unter der Rubriküberschrift "Online First. Less is more" stehende Aufsatz "Diagnostic Blood Loss From Phlebotomy and Hospital-Acquired Anemia During Acute Myocardial Infarction von Salisbury et al. ist in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" am 8. August 2011 erschienen (Seiten E1 bis E8) und komplett kostenlos erhältlich.
Ein weiterer "online first" veröffentlichter Kommentar ist unter der Überschrift "Comment on 'Diagnostic Blood Loss From Phlebotomy and Hospital-Acquired Anemia During Acute Myocardial Infarction' von Stephanie Rennke und Margaret C. Fang ist in derselben Ausgabe der Zeitschrift erschienen und ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.8.11
Fehlversorgung: 70% bis 80% der erkälteten Kinder und Jugendlichen in Bremen, Oldenburg und umzu werden mit Antibiotika therapiert
 Die jüngsten alarmierenden Meldungen über das Auftauchen eines gegen sämtliche Antibiotika resistenten Tripper-Keims in Japan zeigen, dass derartige Gefahren nicht nur bei exotischen, sondern auch bei weit verbreiteten übertragbaren Krankheiten wie der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe (z.B. jährlich 700.000 Neuerkrankte allein in den USA) real werden können. Unter der zunächst sinnvollen und wirksamen Dauerbehandlung mit Antibiotika seit den 1940er Jahren habe das "Bakterium eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, sich gegen sämtliche Wirkstoffe zu wehren, die es kontrollieren sollen" - so die Entdecker des resistenten Bakteriums.
Die jüngsten alarmierenden Meldungen über das Auftauchen eines gegen sämtliche Antibiotika resistenten Tripper-Keims in Japan zeigen, dass derartige Gefahren nicht nur bei exotischen, sondern auch bei weit verbreiteten übertragbaren Krankheiten wie der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe (z.B. jährlich 700.000 Neuerkrankte allein in den USA) real werden können. Unter der zunächst sinnvollen und wirksamen Dauerbehandlung mit Antibiotika seit den 1940er Jahren habe das "Bakterium eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, sich gegen sämtliche Wirkstoffe zu wehren, die es kontrollieren sollen" - so die Entdecker des resistenten Bakteriums.
Auch wenn es keine weiteren inhaltlichen Gemeinsamkeiten gibt, sollte mit Antibiotika dort umso zurückhaltender umgegangen werden, wo weder die Schwere der Erkrankheit noch die Art des Erregers einen präventiven noch einen kurative Wirksamkeit versprechenden Einsatz versprechen. Gemeint ist die Verordnung für und die Einnahme von Antibiotika durch Kinder und Jugendliche vor allem gegen die überwiegend durch Viren ausgelösten Erkältungserkrankungen der oberen Atemwege.
Im Auftrag der Handelskrankenkasse (hkk) Bremen untersuchten die Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun und Gerd Marstedt vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen die Diagnosen aus der ambulanten Behandlung und die verordneten Arzneimittel für die jungen hkk-Versicherten aus Bremen, Oldenburg und dem ländlichen Umfeld der beiden Städte aus den Jahren 2007, 2008 und 2009. Insgesamt bestätigt diese Studie die wenigen ebenfalls regionalen Erkenntnisse z.B. aus Hessen. Sie zeigt ferner, dass die Verordnungswirklichkeit über mehrere Jahre hinweg relativ unbeeindruckt von der fachlichen und politischen Debatte geblieben ist.
Nachdem die Wissenschaftler zunächst den Forschungs-Erkenntnisstand über die Notwendigkeit der Verordnung von Antibiotika und die Gefahren einer gesundheitlich überflüssigen Verordnung von Antibiotika für das Entstehen resistenter Bakterien zusammengefasst haben, kommen sie zu folgenden Grundzügen des Verordnungsverhaltens der Ärzte für die hkk-Kinder und -Jugendlichen:
• Der Anteil der Bremer Kinder und Jugendlichen zwischen 0 und 18 Jahren, die zwischen 2007 und 2009 mindestens einmal im Jahr ein Antibiotika verordnet bekamm pendelte zwischen 34 und 35%.
• In der wenige Kilometer entfernten Stadt Oldenburg bewegte sich derselbe Wert zwischen 44 und 46%.
• Betrachtet man nur die Kinder und Jugendlichen, die mit einer Erkältungserkrankung zu ihrem Haus- oder Kinderarzt kamen bzw. von ihren Eltern gebracht wurden, erhielten in Bremen rund 70% diese PatientInnen und in Oldenburg zwischen 75 und 80% von ihnen Antibiotika verordnet. Ihre Altersgenossinnen im ländlichen Bereich lagen in etwa zwischen diesen Werten. Diese Häufigkeit ist dann, wenn man beachtet, dass rund 90% aller Atemwegserkrankungen durch Viren und nicht durch Bakterien verursacht werden und Antibiotika daher hier definitiv keinen gesundheitlichen Nutzen haben, sehr hoch. Experten schätzen, dass mindestens die Hälfte der Verordnungen ohne jeglichen Nachteil für die PatientInnen ersatzlos und ohne negativen gesundheitlichen Effekt wegfallen könnte.
Zusätzlich stellen die Wissenschaftler die recht kurze Reihe von Studien vor, die zu erklären versuchen, warum Ärzte "wieder besseres Wissen" und letztlich nur auf Druck der Eltern (so eine häufig gehörte entschuldigende Floskel, die offen gegen professionelle Basisnormen verstößt) Antibiotika verordnen. Sie versuchen auch das Eltern zu erklären, von denen nur weniger als 10% sachkundig sagen, sie nähmen gerne ein Antibiotika ein und trotzdem mehrheitlich Antibiotika widerspruchslos verordnen lassen und ihre Kinder einnahmen lassen.
Eine Veränderung der Arzt-Patient-Kommunikation, gezieltere Patientenaufklärung, ein besseres Schmerzmanagement durch die Ärzte (Schmerz ist häufig das kritische Symptom einer Infektion der oberen Atemwege oder des Mittelohrs), ein expliziter Behandlungsplan und öffentliche Aufklärungskampagnen könnten alle zusammen - so die noch geringere Anzahl von Studien, die sich darum kümmerten - zu einer Abnahme der Verordnungshäufigkeit führen.
Die Analyse "Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen" von Bernard Braun und Gerd Marstedt ist in der hkk-Berichtsreihe "Aspekte der Versorgungsforschung" als Teil I der 2011er Ausgabe erschienen und kostenlos erhältlich.
Wer sich auch noch für den Auslöser-Text der aktuellen Debatte über das Auftreten eines komplett Antibiotika-resistenten Trippererreger interessiert, kann sich den wissenschaftlichen Aufsatz "Is Neisseria gonorrhoeae Initiating a Future Era of Untreatable Gonorrhea?: Detailed Characterization of the First Strain with High-Level Resistance to Ceftriaxone" von Ohnishi et al., erschienen im Juli 2011 in der Fachzeitschrift "Antimicrobial Agents and Chemotherapy" (Vol. 55, No. 7: 3538-3545) komplett kostenlos downloaden. Angeblich soll es 10 bis 20 Jahre dauern, bis dieser Erreger in Europa angekommen sein dürfte, eine Vermutung, die unter den Bedingungen globaler Mobilität eher unwahrscheinlich klingt.
Bernard Braun, 14.7.11
Unter-/Fehlversorgung: Nur mehrmalige Blutdruckmessungen liefern sichere Grundlage für Diagnose und Therapie von Bluthochdruck
 Das Messen des Blutdrucks ist einer der häufigsten und wichtigsten Gründe, einen Arzt aufzusuchen. Ein dabei gemessener erhöhter Blutdruck ist auch eine der häufigsten Diagnosen und gehört in der ambu-lanten ärztlichen Versorgung zu den wichtigsten Anlässen für eine mehr oder weniger aufwändige und jahre- oder gar lebenslange Behandlung. Und ein wirklich dauerhaft hoher Blutdruck ist wegen der vielen durch ihn mitbedingten schweren Erkrankungen behandlungsbedürftig und kann auch, sofern leitliniengerecht, gut behandelt werden. Wegen der zahlreichen mehr oder weniger schweren und belastenden Nebenwirkungen der Therapien sind aber an die Richtigkeit der Blutdruckmessung auch besondere Qualitätsanforderungen zu stellen.
Das Messen des Blutdrucks ist einer der häufigsten und wichtigsten Gründe, einen Arzt aufzusuchen. Ein dabei gemessener erhöhter Blutdruck ist auch eine der häufigsten Diagnosen und gehört in der ambu-lanten ärztlichen Versorgung zu den wichtigsten Anlässen für eine mehr oder weniger aufwändige und jahre- oder gar lebenslange Behandlung. Und ein wirklich dauerhaft hoher Blutdruck ist wegen der vielen durch ihn mitbedingten schweren Erkrankungen behandlungsbedürftig und kann auch, sofern leitliniengerecht, gut behandelt werden. Wegen der zahlreichen mehr oder weniger schweren und belastenden Nebenwirkungen der Therapien sind aber an die Richtigkeit der Blutdruckmessung auch besondere Qualitätsanforderungen zu stellen.
Schon immer gab es Zweifel an der Validität des Messalltags und der Notwendigkeit der darauf gestützten Behandlung: Ein Zweifel entzündete sich immer wieder an den Blutdruckwerten ab denen die beiden gemessenen Bludruckwerte als "hoch" klassifiziert und als behandlungsbedürftig gewertet werden. Andere Zweifel setzten daran an, dass viele ArztbesucherInnen mit Betreten einer Praxis und in Sichtweite des Arztkittels (daher auch die Bezeichnung "white coat effect") und der Messmanschette mit erhöhtem, also letztlich rein iatrogenen Blutdruck reagieren. Und ein letzter Zweifel machte sich schließlich an der klinisch weit verbreiteten Einmal- oder auch Zweifachmessung der Werte fest.
Ob und wie viel insbesondere am letzten Zweifel berechtigt ist, untersuchten nun us-amerikanische ÄrztInnen im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie mit 444 fast ausschließlich männlichen Angehörigen der US-Streitkräfte und der "Veterans Affairs"-Krankenversicherung. 75% der Personen waren schon mindestens 10 Jahre als Hochdruckkranke diagnostiziert worden bei denen sich aber immer wieder Unklarheiten bei der Blutdruckkontrolle ergeben hatten.
Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen mit unterschiedlichen Messmethoden und -orten aufgeteilt: eine Gruppe, deren Blutdruck in 6-Monatsintervallen nach einem standardisierten Forschungsmessverfahren gemessen wurde, einer Gruppe, deren Blutdruck bei jedem Besuch eines niedergelassenen Arztes gemessen wurde und einer Gruppe, die ihren Blutdruck zu Hause mittels eines elektronischen Systems maß und auf einem Monitor sichtbar machte. Die Messgeschichte des systolischen Blutdruckwertes der Teilnehmer, also des oberen maximalen Wertes mit dem Blut in die Adern gepumpt wird, wurde in der Studie über 18 Monate verfolgt. Die Ergebnisse konnten sich auf insgesamt 111.181 Messungen stützen, 3.218 Forschungs-, 7.121 klinische und 100.842 häusliche Messungen.
Die wichtigsten Ergebnisse sehen so aus:
• Wenn für die klinischen und Forschungsmessungen ein Wert von unter 140 mm Hg und für häusliche Messungen ein Wert von weniger als 135 mm Hg als guter Wert genommen wird, waren 28% der in Arztpraxen diagnostizierten Personen, 47% der Zuhause-Messer und 68% der im Forschungszusammenhang diagnostizierten Personen unterhalb der Grenzwerte. Nur 33% der Patienten waren über alle drei Methoden hinweg dauerhaft als Personen mit zu hohem systolischem Blutdruck eingestuft.
• Die kurzzeitige Veränderung des Wertes ist bei allen drei Messverfahren ähnlich groß. Die mittlere patienteneigene Variablität ("within-patient variability") des systolischen Wertes in der Zeit betrug 10% und schwankte in einem Bereich zwischen 1% und 24%.
• Wer mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit wissen will, ob der systolische Wert einer Person ober- oder unterhalb der Grenzwerte liegt und damit behandelt oder nicht behandelt werden sollte oder muss, kann dies nicht auf der Basis einer einzigen Messung klären. Hier schwanken die Werte zwischen 120 und 157 mm Hg.
• Der Unsicherheits-Effekt der bei ein- und demselben Patienten hin- und herschwankenden Blutdruckwerte verschwindet optimal nach fünf bis sechs Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn eine Diagnose auf weniger Messungen oder gar einer einzigen Messung in einer Arztpraxis beruht, droht einer großen Anzahl der so diagnostizierten Personen eine Fehlbewertung ihrer gesundheitlichen Situation und entweder eine nebenwirkungsreiche Behandlung ohne gesundheitliche Notwendigkeit oder die Nichttherapie trotz tatsächlich zu hohem Blutdruck. Die Autoren berichten dazu auch, dass in vielen Kliniken in den USA wegen der Unsicherheit von Einmalmessungen und ohne dass dann um Kosten zu vermeiden mehrfach gemessen wird bei vielen Personen auf eine blutdrucksenkende Behandlung verzichtet wird.
• Bei der zusätzlichen Untersuchung der Patienten mit häuslichen und Praxismessungen wiesen 51,6% der Patienten einen mittleren in der Arztpraxis gemessenen systolischen Blutdruck auf, der wenigstens 10 mm Hg über dem durchschnittlichen häuslichen Wert lag. Bei 5% der Patienten lag der Praxiswert aber wenigstens 10 mm Hg unterhalb des mittleren häuslich gemessenen Wertes.
Wegen der speziellen Charakteristika der Studienteilnehmer weisen die Autoren selber auf die dadurch möglicherweise vorhandene Begrenzung der Verallgemeinerbarkeit der Studienergebnisse hin. Dies können nur weitere Studien klären, die dann aber auch die Effekte einer höheren Sicherheit als 80% mitklären sollten. Wer aber nach einer einzigen Blutdruckmessung als Hypertoniker klassifiziert wird und von dem untersuchenden Arzt eine Behandlung mit Betablockern und weiteren Arzneimitteln vorgeschlagen bekommt, sollte vorher auf mehr Messungen beharren.
Die 10 Seiten umfassende Studie "Measuring Blood Pressure for Decision Making and Quality Reporting: Where and How Many Measures?" von Benjamin J. Powers et al. ist gerade in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (2011; 154: 781-788) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Dass diese Ergebnisse nicht ungeteilte Zustimmung erfahren, macht ein spontaner Blog-Kommentar eines us-amerikanischen Internisten am 21. Juni 2011 sehr deutlich: "What a great solution to measuring blood pressure! Lets get certified so we can all be sure we are measuring correctly!! This country is broke and this is idiotic! Complicance and cost are much bigger barriers to control. Lets stop paying for these stupid studies!!"
Bernard Braun, 30.6.11
40 Jahre "war on cancer", 20 Jahre "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening trial" und kein "Sieg" in Sicht!
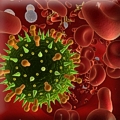 Der größte, langlebigste und solideste wissenschaftliche Beitrag (die "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer (PLCO) Screening"-Studie) zu dem im Jahr 1971 vom damaligen US-Präsidenten Nixon per Gesetz (The National Cancer Act (P.L. 92-218) erklärten Krieg gegen den Krebs ist zwanzig Jahre nach seinem Start bezogen auf die "Wunderwaffe" Screening zu recht "friedlichen" oder erfolglosen Ergebnissen gelangt.
Der größte, langlebigste und solideste wissenschaftliche Beitrag (die "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer (PLCO) Screening"-Studie) zu dem im Jahr 1971 vom damaligen US-Präsidenten Nixon per Gesetz (The National Cancer Act (P.L. 92-218) erklärten Krieg gegen den Krebs ist zwanzig Jahre nach seinem Start bezogen auf die "Wunderwaffe" Screening zu recht "friedlichen" oder erfolglosen Ergebnissen gelangt.
Sowohl über die Ergebnisse zum PSA-Screening: "Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches. als auch über das Eierstockkrebs-Screening: bringt nachweisbar Schaden durch nicht notwendige Operationen aber keinen Nutzen bei der Mortalität. gibt es 2009 und 2010 veröffentlichte Aufsätze über die im "forum-gesundheitspolitik" berichtet wurde.
Der aktuell als "Online first"-Beitrag im renommierten Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichte Aufsatz über die erwünschten und unerwünschten Erfolge und Wirkungen des Eierstockkrebs-Screenings bestätigt die bisher publizierten Ergebnisse grundsätzlich, erhärtet sie aber durch seine kompromisslos klaren Aussagen weiter.
Bezogen auf den primären Endpunkt oder Nutzenindikator "Mortalität" kommen die AutorInnen zu folgenden Schlüssen:
• "In this randomized controlled trial, we found no statistically significant reduction in mortality from ovarian cancer in a cohort of women derived from the general population who were screened for ovarian cancer with 6 annual CA-125 tests and 4 annual transvaginal ultrasound examinations. The numbers of deaths from ovarian cancer were similar in the 2 trial groups over the entire period of follow-up (maximal 13 Jahre - Einfügung d. Verf.), with a modestly (although not statistically significant) greater cause-specific mortality rate in the intervention group (RR, 1.18; 95% CI, 0.82-1.71)."
• Zur Häufigkeit und Art des Schadens, den das Screening den untersuchten Frauen unmittelbar und mittelbar zufügt - im kriegerischen Jargon also die Kollateralschäden -, kommt die Studie ebenfalls zu gewichtigen Zahlen. Von den 34.253 Frauen in der Interventionsgruppe erhielten 3.258 ein falsch-positives Resultat, d.h. bei ihnen wurde ein Eierstockkarzinom "entdeckt", das gar nicht existierte. 1.080 unterzogen sich nach dieser Fehldiagnose einer Operation, 32,9% davon einer Eierstockentfernung. Bei 163 operierten Personen, also 15% aller Operierten traten insgesamt 222 unterschiedliche Hauptkomplikationen (z.B. Blutungen, Herz-/Kreislaufstörungen, Infektionen) auf, was einer Rate von 20,6 Komplikationen pro 100 chirurgischen Eingriffen entsprach. Mangels einer wirklichen Erkrankung handelt es sich bei den Operationen und Komplikationen durchweg um mehr oder weniger gefährliche Körperverletzungen.
• Zusammenfassend heißt es dann: "We conclude that annual screening for ovarian cancer as performed in the PLCO trial with simultaneous CA-125 and transvaginal ultrasound does not reduce disease-specific mortality in women at average risk for ovarian cancer but does increase invasive medical procedures and associated harms."
Ob aus dem 0:2 für Krebs-Screenings durch die noch nicht veröffentlichten Mortalitätsdaten der PLCO nach Lungen- und Darmkrebs-Screening ein 2:2 wird, muss abgewartet werden. Das Ergebnis des "Kriegs" könnte aber auch bald 1:2, 1:3 oder 0:4 heißen. Trotz erster Anzeichen, dass CT-Untersuchungen bei Lungenkrebs sich positiv auf die Mortalität an dieser Krebsart auswirken, bleibt nämlich dann immer noch die Frage, ob z.B. allein die Strahlenbelastung bei einem Screening nicht doch mehr Schaden auslöst als präventiven Nutzen stiftet. 2010 hatte das National Cancer Institute (NCI" der USA als erstes und vorläufiges Ergebnis der "National Lung Screening Trial", einer randomisierten Studie mit mehr als 53.000 früher und auch heute noch schwer rauchenden Personen im Alter von 55 bis 74 berichtet, dass die Sterblichkeit an Lungenkrebs bei den mit einer niedrigen CT-Dosis untersuchten Personen um 20% geringer war als bei den Personen, bei denen ein Bruströntgenbild gemacht wurde. Auch beim Lungenkrebs-Screening gibt es aber wenigstens für ein Drittel der untersuchten Personen ein falsch-positives Ergebnis und bei einer Person unter 14 wird dann nutzlos eine Biopsie durchgeführt.
Von dem Online First-Aufsatz "Effect of Screening on Ovarian Cancer Mortality. The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Randomized Controlled Trial" im JAMA (2011; 305(22): 2295-2303. doi: 10.1001/jama.2011.766) gibt es dauerhaft ein kostenloses Abstract und anders als bei anderen Zeitschriften zumindest vorübergehend ebenfalls kostenlos den kompletten Text.
Bernard Braun, 11.6.11
Hitzewallungen in der Menopause: Wenn eine "kurze Zeit" dauert und dauert und was dies für eine gute Versorgung bedeutet.
 Schon 2009 zog eine Auswertung von Behandlungsdaten (das Abstract des in der Zeitschrift Menopause [Mai/Juni; 16: 453] Aufsatzes Duration of vasomotor symptoms in middle-aged women: A longitudinal study von Col NF et al. ist kostenlos erhältlich) in Zweifel, dass es sich bei den Hitzewallungen und Schweißausbrüchen, einer der unerwünschten Begleiterscheinungen der weiblichen Wechseljahre, um eine "kurzfristige" Erscheinung handle, bis zu deren Verschwinden "waiting out" ausreiche. Die Zeitdauer reichte von 6 Monaten bis zu mehr als 5 Jahre. Damit war klar, dass mehr oder weniger offene Appelle, die Frauen mögen sich für eine kurze Zeit "zusammenreißen", völlig an der Wirklichkeit großer Teile der Frauen in den Wechseljahren vorbeigingen. Für mehrere Jahre war das für diese Situation weltweit verbreitete Therapeutikum der Wahl die Hormonersatztherapie. Der Hinweis in der zitierten Studie, die Beschwerden dauerten bei Frauen mit intensiverer körperlicher Bewegung nicht so lange, blieb eher ohne praktisches Echo.
Schon 2009 zog eine Auswertung von Behandlungsdaten (das Abstract des in der Zeitschrift Menopause [Mai/Juni; 16: 453] Aufsatzes Duration of vasomotor symptoms in middle-aged women: A longitudinal study von Col NF et al. ist kostenlos erhältlich) in Zweifel, dass es sich bei den Hitzewallungen und Schweißausbrüchen, einer der unerwünschten Begleiterscheinungen der weiblichen Wechseljahre, um eine "kurzfristige" Erscheinung handle, bis zu deren Verschwinden "waiting out" ausreiche. Die Zeitdauer reichte von 6 Monaten bis zu mehr als 5 Jahre. Damit war klar, dass mehr oder weniger offene Appelle, die Frauen mögen sich für eine kurze Zeit "zusammenreißen", völlig an der Wirklichkeit großer Teile der Frauen in den Wechseljahren vorbeigingen. Für mehrere Jahre war das für diese Situation weltweit verbreitete Therapeutikum der Wahl die Hormonersatztherapie. Der Hinweis in der zitierten Studie, die Beschwerden dauerten bei Frauen mit intensiverer körperlicher Bewegung nicht so lange, blieb eher ohne praktisches Echo.
Seit dem Erscheinen mehrerer Ergebnisse über die Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Therapie in der "Women's Health Initiative (WHI)"-Studie (vgl. mehr auf der Website der "Women's Health Initiative") standen die Frauen vor einem mehrfachen Dilemma: Einerseits hatte die Hormonersatztherapie nur in einer verhältnismäßig kurzen Phase von 4-5 Jahren eine positive Wirkung auf die Häufigkeit und Intensität der Symptome und damit auf die Lebensqualität. Andererseits stiegen mit der Dauer der Hormonaufnahme verschiedene Erkrankungsrisiken kontinuierlich an. Es wird geschätzt, dass jede hundertste Frau, die länger als 5 Jahre Hormone einnahm, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen, Thrombosen oder gar Brustkrebs hat. Dies ist mit ein Grund warum das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) unter Beachtung strenger Vorsichtsmaßnahmen empfiehlt, die Hormonersatztherapie mit Estrogen nicht länger als ein bis zwei Jahre und in der Kombination Estrogen-Gestagen allerhöchstens ein Jahr anzuwenden.
Insofern sind die neuesten Forschungsergebnisse über die Zeiträume, in dem Hitzewallungen auftreten können, ein echtes Problem.In der so genannten "Penn Ovarian Aging Study" wurde eine Kohorte von 259 bzw. 349 Frauen im Alter von 35 bis 47 Jahre prospektiv über 13 Jahre zu ihren Wechseljahresbeschwerden interviewt. Dabei stand die Frage nach dem Auftreten moderater bis ernsthafter Hitzewallungen im Mittelpunkt der Befragungen. In ihnen wurde allerdings auch der Menopause-Status, das Alter, die Rasse, das Niveau natürlicher Hormone, der Body Mass Index (BMI) und der Raucherstatus erhoben.
Die Dauer der Hitzewallungen sah so aus:
• Die durchschnittliche, mediane Dauer war 10,2 Jahre. Die individuelle Dauer hing aber erheblich davon ab, wann im Verlaufe der Wechseljahre die Symptome auftraten. Wenn sie bereits zu Beginn des Übergangs in die Menopause da waren, dauerten sie im Durchschnitt 11,57 Jahre und länger. Wenn sie erst beim Übergang in die postmenopausale Phase zum ersten Mal auftraten, dauerten sie im Schnitt "nur" noch 3,84 Jahre.
• Die Symptome starteten meistens im Alter von 45-49 Jahren.
• Schwarzafrikanische Frauen hatten nach Adjustierung bei anderen individuellen Merkmalen eine längere Zeit mit Hitzewallungen als sonst vergleichbare weiße Frauen.
• Raucherinnen und Nichtraucherinnen hatten in etwa gleich lange Beschwerden. Nicht übergewichtige Frauen mussten aber länger leiden als ihre übergewichtigen Altersgenossinnen.
Damit wird klar, dass selbst die kürzeste Dauer von Symptomen bei den meisten Frauen länger ist als Experten für die Therapie mit Hormonen als Dauer empfehlen, die keine unerwünschten Wirkungen auslöst.
Die Empfehlungen der AutorInnen der aktuellsten Studie, die Behandlung noch strenger als bisher zu individualisieren, das Risiko-Nutzenverhältnis der Hormonersatztherapie sorgfältig zu bewerten und auch andere Therapien (z.B. der Komplementärmedizin) in Erwägung zu ziehen, machen die Patientinnen und ihre ÄrztInnen eher ratlos. Sie versuchen zwar, eine riskante Fehlversorgung zu vermeiden, ohne aber wirklich etwas anzubieten, was den betroffenen Frauen während der offensichtlich langen Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität helfen könnte.
Die aktuelle Studie Duration of menopausal hot flushes and associated risk factors von Freeman EW et al.. ist in der Fachzeitschrift "Obstetric Gynecology" ( 2011 May; 117: 1095) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.6.11
USA: Tele-Videokonferenzen mit Fachärzten ermöglichen auch die Behandlung schwieriger Erkrankungen durch Hausärzte auf dem Lande!
 Zu einem der viel versprechenden Instrumente des Telemonitoring als einem Standbein der verheißungsvoll auftretenden Telemedizin gehören indikationsspezifische Audio- oder Videokonferenzen zwischen Allgemeinärzten und den in ländlichen Gegenden meist weit entfernten Spezialisten. Gerade für die weltweit überall mindestens mit Fachärzten unterversorgten ländlichen Gegenden versprechen diese Techniken eine bessere, preisgünstige oder überhaupt eine Versorgung. Ob aber PatientInnen davon wirklich einen gesundheitlichen Nutzen haben, muss methodisch verlässlich nachgewiesen und nicht nur den Herstellern der Technik oder Gesundheitspolitikern, die vor dem Problem der ungleichen Versorgungschancen auf dem Lande stehen, geglaubt werden.
Zu einem der viel versprechenden Instrumente des Telemonitoring als einem Standbein der verheißungsvoll auftretenden Telemedizin gehören indikationsspezifische Audio- oder Videokonferenzen zwischen Allgemeinärzten und den in ländlichen Gegenden meist weit entfernten Spezialisten. Gerade für die weltweit überall mindestens mit Fachärzten unterversorgten ländlichen Gegenden versprechen diese Techniken eine bessere, preisgünstige oder überhaupt eine Versorgung. Ob aber PatientInnen davon wirklich einen gesundheitlichen Nutzen haben, muss methodisch verlässlich nachgewiesen und nicht nur den Herstellern der Technik oder Gesundheitspolitikern, die vor dem Problem der ungleichen Versorgungschancen auf dem Lande stehen, geglaubt werden.
Für die Versorgung von PatientInnen, die in den überwiegend ländlichen Regionen des US-Bundesstaates New Mexico an Hepatitis C erkrankt waren und eine sehr komplexe und mit ernsten Nebenwirkungsrisiken verbundene Behandlung brauchen, ist der Nutzennachweis nun in einer kontrollierten Studie gelungen.
In einer prospektiven Kohortenstudie wurde eine Gruppe von 146 PatientInnen, die wegen ihrer Hepatitis-Infektion im Klinikum der Universität von New Mexiko behandelt wurde mit einer Gruppe von 261 in ländlichen Gegenden wohnenden und von einem Allgemeinarzt behandelten PatientInnen verglichen. Die insgesamt 407 PatientInnen waren vor der Studie nicht wegen ihrer Infektion in ärztlicher Behandlung gewesen. Die Allgemeinärzte auf dem Lande waren Nutzer eines so genannten "Extension for Community Healthcare Outcomes (ECHO) model", das im Kern eine Videokonferenztechnologie ist, mit deren Hilfe die Allgemeinärzte sich von weit entfernten Spezialisten u.a. in einer Art regelmäßiger Fallkonferenz oder Qualitätszirkel qualifizieren, trainieren, beraten und unterstützen lassen, schwierige oder komplexe Erkrankungen ohne Facharzt vor Ort zu behandeln.
Der primäre Endpunkt und Indikator für die Ergebnisqualität der Behandlung war der so genannte "sustained virologic response (SVR)". Dieser Indikator bedeutet, dass sechs Monate nach Beendigung der Behandlung kein Hepatitis C-Virus mehr im Blut gefunden wird. Trotz der Möglichkeit, dass einige Viren lediglich unterdrückt sind, d.h. auch wieder akute Probleme auslösen können, gilt ein rascher SVR als das Zeichen für hohe Behandlungsqualität.
Die Ergebnisse in den beiden PatientInnengruppen sahen so aus:
• 57,5% der Erkrankten, die in der Universitätsklinik behandelt wurden hatten einen SVR.
• Dieses gute Behandlungsergebnis fand sich auch bei 58,2% der ECHO-PatientInnen, wobei der kleine Unterschied von 0,7 Prozentpunkten rein zufällig war.
• Auch bei einer Untergruppe der Erkrankten (Genotyp 1-Infektion) betrug die Rate des SVR bei den PatientInnen des Uni-Klinikums 45,8% und das der durch ihren telemedizinisch unterstützten Hausarzt behandelten Personen 49,7%. Der Unterschied zu Gunsten der ECHO-PatientInnen war ebenfalls nicht signifikant.
• Ernste unerwünschte Effekte traten bei 13,7% der Klinik-PatientInnen und 6,9% bei den Hausarzt- und ECHO-PatientInnen auf. Dieser statistisch signifikante Unterschied (p=0,02) führte bei 8,9% der Uni-Klinik-PatientInnen und 4.2% der ECHO-PatientInnen zum vorzeitigen Abbruch der Behandlung.
Die auf Videokonferenzen gestützte Behandlung von Hepatitis C-PatientInnen in spezialärztlich unterversorgten Gebieten hat sich damit eindeutig als wirksame Möglichkeit erwiesen, derartig Erkrankte auf qualitativ hohem Niveau zu behandeln. Daran halten die WissenschaftlerInnen der Studie auch trotz einiger Grenzen ihrer Studie fest. Dazu zählt, dass die Studie etwas zu klein war und weder die TeilnehmerInnen noch die behandelnden Ärzte aus ethischen Gründen randomisiert waren. Ebenfalls aus ethischen Gründen und der Sorge vor den schweren Nebenwirkungen der Therapie entschieden sich die WissenschaftlerInnen gegen eine Kontrollgruppe von Landärzten, welche die Behandlung auch ohne externe Unterstützung anbieten hätten müssen.
Von dem Aufsatz "Outcomes of Treatment for Hepatitis C Virus Infection by Primary Care Providers" von Sanjeev Arora et al., der am 1. Juni 2011 im "New England Journal of Medicine" erschienen ist, gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 2.6.11
"Less is more" oder wie professionelle Verantwortung von Ärzten praktisch aussehen kann. Ein Beispiel aus den USA.
 Weniger Leistungen sparen nicht nur Geld oder verbessern den Gebrauch wertvoller klinischer Ressourcen, sondern führen auch zu mehr, nämlich weniger unerwünschten Wirkungen und zu einer höheren Behandlungsqualität! Klingt utopisch oder arg medizinkritisch? Und trotzdem ist es die Quintessenz eines mehrstufigen Entwicklungs- und Erprobungsprozesses in einer fest etablierten Gruppe us-amerikanischer Primärärzte, dessen Ergebnis drei so genannte "Top 5"-Listen für primärärztlich aktive Familienärzte, Internisten und Pädiater sind.
Weniger Leistungen sparen nicht nur Geld oder verbessern den Gebrauch wertvoller klinischer Ressourcen, sondern führen auch zu mehr, nämlich weniger unerwünschten Wirkungen und zu einer höheren Behandlungsqualität! Klingt utopisch oder arg medizinkritisch? Und trotzdem ist es die Quintessenz eines mehrstufigen Entwicklungs- und Erprobungsprozesses in einer fest etablierten Gruppe us-amerikanischer Primärärzte, dessen Ergebnis drei so genannte "Top 5"-Listen für primärärztlich aktive Familienärzte, Internisten und Pädiater sind.
Die Mitglieder dieser "Good Stewardship Working Group" trugen zuerst die wissenschaftliche Evidenz für eine Reihe von weit verbreiteten Behandlungskonzepten zusammen. Ein erster Entwurf von Empfehlungen, bestimmte Behandlungen zu unterlassen, wurde von 83 Primärärzten in ihren Praxen gründlich auf Machbarkeit, Vermittelbarkeit und auch das Eintreffen der erwünschten Wirkungen getestet. Eine überarbeitete Fassung dieser Empfehlungen wurde danach von einer zusätzlichen Runde von 172 Familien-, internistischen und Kinderärzten erneut getestet.
Zu den dann konsentierten 12 Aktivitäten, welche die klinische Behandlung verbessern konnten, gehörten z.B.:
• Das Unterlassen von bildgebenden Untersuchungen in den ersten 6 Wochen nach Auftreten von Rückenschmerzen - bis auf sehr seltene Ausnahmen.
• Keine Verordnung von Antibiotika bei milder oder moderater Sinusitis
• Keine Verordnung von jährlichen screeningmäßigen EKG- oder anderen Kardio-Untersuchungen bei asymptomatischen und Niedrigrisiko-Patienten
• Ausschließliche Verordnung von Statin-Generika wenn eine fettstoffsenkende Arzneimittel-Therapie begonnen wird.
• Keine "für-alle-Fälle"-Radiologie-Diagnostik bei kleineren Kopfverletzungen nach einem Sturz, wenn der Patient nicht das Bewusstsein verloren hat oder sonstige Risikofaktoren existieren.
• Beratung von Patienten, keine OTC-Präparate gegen Erkältungskrankheiten zu kaufen, da diese kaum erwünschte Wirkungen aber eine Menge unerwünschte Wirkungen haben.
In Kooperation mit Konsumentengruppen und Patientensicherheitsgruppen sollen die "Top 5"-Listen jetzt weiter verbreitet werden und dabei den Geruch von Rationierung verlieren. Dass dies auch vieler Überzeugungsarbeit bei und mit Patienten bedarf, ist den Verfassern dieser Listen bewusst, entmutigt sie aber nach den positiven Erfahrungen in den beiden Testläufen in keiner Weise.
Zu dem in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" am 23. Mai 2011 veröffentlichten Aufsatz "LESS IS MORE. The "Top 5" Lists in Primary Care. Meeting the Responsibility of Professionalism" der The Good Stewardship Working Group gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 24.5.11
Eierstockkrebs-Screening bringt nachweisbar Schaden durch nicht notwendige Operationen aber keinen Nutzen bei der Mortalität.
 Die bereits jetzt lange Reihe der als Screening konzipierten und angebotenen Früherkennungsuntersuchungen, deren Nutzen geringer und deren Nachteil für die untersuchten Personen höher als erwartet ist, wird jetzt gerade verlängert: durch die Ergebnisse einer Studie zur Wirkung von Screeningsuntersuchungen nach der zu den fünf häufigsten und schwersten Krebserkrankungen gehörenden Krebserkrankung der Eierstöcke.
Die bereits jetzt lange Reihe der als Screening konzipierten und angebotenen Früherkennungsuntersuchungen, deren Nutzen geringer und deren Nachteil für die untersuchten Personen höher als erwartet ist, wird jetzt gerade verlängert: durch die Ergebnisse einer Studie zur Wirkung von Screeningsuntersuchungen nach der zu den fünf häufigsten und schwersten Krebserkrankungen gehörenden Krebserkrankung der Eierstöcke.
An der großen randomisierten kontrollierten "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer"-Studie in 10 landesweiten Screening-Zentren in den USA waren zwischen 1993 und 2001 78.216 Frauen im Alter von 55 bis 74 Jahren beteiligt. 39.105 von ihnen wurden nach dem Zufallsprinzip dem so genannten Interventionsarm zugewiesen und nahmen, 39.111 gehörten der Kontrollgruppe mit standardmäßiger Behandlung an. Die Frauen in der Interventionsgruppe wurden sechs und danach noch weitere 4 Jahre mit zwei verschiedenen Methoden auf das Vorliegen von früh zu erkennenden Anzeichen für eine Eierstockkrebserkrankung untersucht. Die Testresultate standen den Teilnehmerinnen und ihren behandelnden ÄrztInnen zur Entscheidungsfindung zur Therapie vollständig zur Verfügung. Für alle Teilnehmerinnen wurden bis zu 13 Jahre lang mögliche Krebsdiagnosen und die Sterblichkeit als primärer Endpunkt der Studie erhoben. Die sekundären Endpunkte waren die Inzidenz von Eierstockkrebs und Komplikationen im Zusammenhang mit den Screeninguntersuchungen und weiteren diagnostischen Prozeduren.
Die Ergebnisse waren eindeutig:
• 212 Frauen in der Interventionsgruppe und 176 in der Kontrollgruppe erkrankten im Untersuchungszeitraum an Eierstockkrebs. In der Interventionsgruppe endete die Erkrankung bei 118 Frauen und in der Kontrollgruppe bei 100 Frauen mit dem Tod. Aus beiden Betrachtungswinkeln gab es also keine nachweisbaren Vorteile für die Teilnehmnerinnen am Screening.
• An anderen Ursachen verstarben zusätzlich 2.924 in der Screening- und 2.914 in der Standardbehandlungsgruppe.
• Dafür gab es nachweisbar massive Nachteile und starke Belastungen durch die Teilnahme am Screening: 3.285 Frauen mit einem falsch positiven Screening-Testergebnis wurden unnötigerweise operiert, 166 litten dabei mindestens eine ernste postoperative Komplikation.
Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der ForscherInnen sind ebenfalls eindeutig: Zumindest so lange wie die zum Screening angewandten Tests (CA-125= Cancer antigen 125 oder Carbohydrate antigen 125 und transvaginale Ultraschalluntersuchung) derart viel falsche und dann folgenreiche Krebsdiagnosen begründen, sollte von ihm und den hohen positiven Erwartungen Abstand genommen werden.
Für die auf dem diesjährigen Fachkongress der "American Society of Clinical Oncology (ASCO)" Anfang Juni vorgestellte Studie " Effect of screening on ovarian cancer mortality in the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) cancer randomized screening trial" von S. S. Buys, E. Partridge et al. (veröffentlicht im "Journal of Clinical Oncology 29: 2011 (suppl; abstr 5001)) gibt es nur das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 20.5.11
Warum Weniger auch Mehr sein kann oder es muss nicht immer CT sein.
 In der notwendigen Debatte wie der im deutschen Gesundheitswesen immer noch hohe Anteil von Über- und Fehlversorgung abgebaut werden kann, braucht man häufig keinerlei neuen Techniken, sondern es reicht auch manchmal die Rückbesinnung und Anwendung traditioneller Methoden. Ein mittlerweile recht bekanntes, aber leider noch nicht überall verbreitete Vorgehen dieser Art, ist der "watch-and-wait"-Ansatz" bei Mittelohrentzündungen von Kindern als Alternative zum vorschnellen und systematisch riskanten (Resistenzbildung) Einsatz von Antibiotika.
In der notwendigen Debatte wie der im deutschen Gesundheitswesen immer noch hohe Anteil von Über- und Fehlversorgung abgebaut werden kann, braucht man häufig keinerlei neuen Techniken, sondern es reicht auch manchmal die Rückbesinnung und Anwendung traditioneller Methoden. Ein mittlerweile recht bekanntes, aber leider noch nicht überall verbreitete Vorgehen dieser Art, ist der "watch-and-wait"-Ansatz" bei Mittelohrentzündungen von Kindern als Alternative zum vorschnellen und systematisch riskanten (Resistenzbildung) Einsatz von Antibiotika.
Eine gerade im amerikanischen Fachjournal "Pediatrics" veröffentliche Studie über die Diagnostik von kleineren stumpfen Schädeltraumata bei Kindern, unterstreicht die Bedeutung und den Nutzen der klinischen Beobachtung, um eine schnelle Computertomographie (CT) zu vermeiden, die oft unnötig und dann nur gesundheitlich nachteilig ist.
Oft äußerten Ärzte Skrupel, sie wüssten nicht, ob der Verzicht nicht doch zu mehr gesundheitlichen Nachteilen für die jungen Patienten führten, sie also z.B. durch den dumpfen Schlag auf den Schädel schwere Hirnverletzungen hätten, die man sofort behandeln müsste.
Einen Teil dieser Ängste dämpft diese Studie jetzt: WissenschaftlerInnen untersuchten dazu die Daten von rund 40.000 Kindern, die Notfallstationen von Krankenhäusern in den USA mit kleinen Schädeltraumata aufsuchten. 14% von ihnen wurden im Rahmen der Studie zuerst für eine bestimmte Zeit klinisch beobachtet - vor einer Entscheidung, ein CT durchzuführen oder nicht. Die anderen 86% wurden nicht beobachtet, d.h. inklusive CT wie gewohnt behandelt.
Das Ergebnis war ein signifikant geringerer Anteil der zuerst klinisch beobachteten Gruppe, der per CT untersucht wurde (31% versus 35%). Wichtig ist aber auch, dass die Häufigkeit einer endgültig diagnostizierten Hirnverletzung sich in den beiden Gruppen nicht unterschied, d.h. das Risiko durch die Option der klinischen Beobachtung, den verletzten Kindern einen zusätzlichen Schaden zuzufügen sehr gering ist.
Die AutorInnen berechnen zusammenfassend, dass durch die primäre Wahl der klinischen Beobachtung 39 unnötige CT-Untersuchungen pro 1.000 Kinder mit kleinen Schädeltraumata vermieden werden könnten.
Eine am 9. Mai 2011 zunächst online veröffentlichte Version des Aufsatzes "The Effect of Observation on Cranial Computed Tomography Utilization for Children After Blunt Head Trauma" von Lise E. Nigrovic, Jeff E. Schunk, Adele Foerster, Arthur Cooper, Michelle Miskin, Shireen M. Atabaki, John Hoyle, Peter S. Dayan, James F. Holmes, Nathan Kuppermann und der Traumatic Brain Injury Group for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network der Zeitschrift "Pediatrics" (10.1542/peds.2010-3373) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.5.11
Wie das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht auf freie Berufsausübung über das Patientenrecht auf fachliche Behandlung erhebt.
 Wenn ein approbierter und einschlägig durch zahlreiche Operationen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich fachlich ausgewiesener Arzt und Zahnarzt in seiner Nebentätigkeit als Geschäftsführer einer Klinik für Schönheitsoperationen noch Brustimplantate einsetzt und operative Bauch- oder Oberarmstraffungen durchführt, darf er dies, wenn derartige Zusatzarbeiten nicht mehr als 5 Prozent seiner Gesamttätigkeit umfassen. So urteilte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 1. Februar 2011 und gab damit der Verfassungsbeschwerde genau dieses Allroundchirurgen statt.
Wenn ein approbierter und einschlägig durch zahlreiche Operationen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich fachlich ausgewiesener Arzt und Zahnarzt in seiner Nebentätigkeit als Geschäftsführer einer Klinik für Schönheitsoperationen noch Brustimplantate einsetzt und operative Bauch- oder Oberarmstraffungen durchführt, darf er dies, wenn derartige Zusatzarbeiten nicht mehr als 5 Prozent seiner Gesamttätigkeit umfassen. So urteilte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 1. Februar 2011 und gab damit der Verfassungsbeschwerde genau dieses Allroundchirurgen statt.
Diese Beschwerde richtete sich gegen eine Reihe standesrechtlicher und gerichtlicher Entscheidungen bis hin zum Bundesgerichtshof, die in dieser omnipotenten Berufsausübung einen Verstoß gegen das ärztliche Berufsrecht sahen. Dieses ist in Heilberufe- und Kammergesetzen kodifiziert und verpflichtet Ärzte auf eine Berufsausübung innerhalb der Grenzen des Fachgebiets für die sie fortgebildet sind und sich auch ständig weiterbilden müssen.
Der betroffene Arzt verwies dagegen u.a. darauf, dass ohne die Durchführung dieser zusätzlichen und nicht seiner Facharztqualifikation entsprechenden Operationen die Existenz seiner Klinik gefährdet wäre.
Die Verfassungsrichter plädieren nun für eine weite Auslegung dieser Vorschrift des ärztlichen Berufsrechts und für die Zulässigkeit von Ausnahmen. Sie beschäftigten sich auch mit dem in den vorherigen Verfahren für entscheidend erachteten Argument, ob nicht ein Teil der fachfremd operierten PatientInnen über die tatsächliche Befähigung des Operateurs für diese Art von Eingriffen getäuscht worden wäre.
Dem widerspricht das BVerfG mit einer eigentümlichen Argumentationskaskade:
• Erstens: "… erscheint auch schon die vom Gericht angenommene, nicht näher begründete Verwechslungsgefahr mehr als fraglich, denn es leuchtet nicht ein, weshalb der durchschnittlich gebildete Patient annehmen sollte, ein Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg - also ein Arzt, dessen fachärztliche Qualifikation sich auf den Bereich des Kopfes bezieht - weise eine besondere Eignung für Operationen im Bereich des Bauch-, Oberkörper- und Armbereichs auf."
• Und auch wenn einige der "durchschnittlich gebildeten Patienten" dann erfolgreich die besondere Eignung vorgegaukelt bekommen haben, ist das letztlich doch akzeptabel: "Insbesondere der Patientenschutz erfordert es nicht, einem bestimmten Fachgebiet zugeordnete Behandlungen nur durch Ärzte dieses Fachgebiets durchführen zu lassen. Die Qualität ärztlicher Tätigkeit wird durch die Approbation nach den Vorschriften der Bundesärzteordnung sichergestellt."
• Was dieser Typ von Arzt an schier Übermenschlichem beachten muss, umreißt das BVerfG so: "Zwar hat ein Arzt in jedem Einzelfall zu prüfen, ob er aufgrund seiner Fähigkeiten und der sonstigen Umstände - wie etwa der Praxisausstattung - in der Lage ist, seinen Patienten nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu behandeln. Vorbehaltlich dieser Prüfung ist er aber, unabhängig vom Vorhandensein von Spezialisierungen, berechtigt, Patienten auf allen Gebieten, die von seiner Approbation umfasst sind, zu behandeln. Eine generelle Verpflichtung, Patienten mit Erkrankungen auf einem bestimmten Gebiet an einen für dieses Gebiet zuständigen Facharzt zu verweisen, wie sie die Ärztekammer H. in ihrer Stellungnahme sieht, ist hiermit nicht vereinbar."
• Wer diese Selbstprüfung und -verantwortung nicht hinbekommt, dem hilft das Verfassungsgericht durch den von ihm kreierten "5-Prozent-Freiraum" als einer Art berufsrechts- und patientenrechtsfreie Zone im sozialen Leben der Bundesrepublik: "Selbst wenn man von einer Zahl von 200 fachgebietsfremden Operationen pro Jahr, wie von der Ärztekammer H. im Rahmen der Verhandlung vor dem Berufsgerichtshof in den Raum gestellt, ausgeht, liegt der Anteil unter 5 % und bewegt sich damit noch im geringfügigen Bereich." Was in einer Prozentrechnung geringfügig sein mag, ist aber für jeden der 200 operierten PatientInnen im Guten wie im Bösen ein 100-Prozent-Ereignis!
Diese Art von "5-Prozent-Freiraum" in dem das Grundrecht auf freie Berufsausübung nicht zwingend an einen konkreten Nachweis der fachlichen Qualifikation gebunden ist, bedeutet bei allem Respekt vor dem notwendigen Schutz von Grundrechten eine erhebliche Relativierung oder Minderbewertung des Rechts von Patienten auf eine ärztliche Leistung, die verlässlich und zertifiziert dem "allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse" (u.a. § 70 SGB V) entspricht.
Wer meint, das träfe doch höchstens jeden zwanzigsten Patienten in Kliniken für Schönheitsoperationen und sei daher zu vernachlässigen, sollte seine Bewertung der Reichweite des Urteils nach Lektüre der Schlussfolgerung eines Medizinrechtskommentators nochmal überprüfen: "Als Konsequenz ist es auch Vertragsärzten möglich, einen Anteil von 5% fachfremder Leistungen zu Lasten der GKV abzurechnen. Diese in früheren Honorarverteilungsmaßstäben enthaltene Regelung ist daher wieder einzuführen." Zusätzlich zu den immer häufiger von niedergelassenen Ärzten angebotenen zum großen Teil fachlich fragwürdigen oder sinnlosen "Individuellen Gesundheitsleistungen" müssen sich Haus- und Facharztpatienten nun also auch noch darauf vorbereiten maximal 5% "fachfremde Leistungen" zu erhalten - ohne dass ihnen dies gesagt werden wird.
Die 33 Absätze des Urteil des BVerfG mit dem Aktenzeichen 1 BvR 2383/10 vom 1.2. 2011 sind kostenlos über die Website des Gerichts erhältlich.
Bernard Braun, 26.3.11
Ist selbst das "Profit vor Sicherheit"-US-System für Medizinprodukte besser als das deutsche "Profit mit Sicherheit"-System?
 Wer sich bisher vor allem mit den Abgründen der Zulassungsbestimmungen bei Arzneimitteln beschäftigt hat, könnte das Gefühl bekommen, vom Regen unter die Traufe zu geraten, wenn er sich eine Studie über die in den USA systematisch zu oberflächlichen Sicherheitsüberprüfungen bei Medizinprodukten anschaut, deren Versagen zu schweren gesundheitlichen Schäden, wenn nicht sogar zum Tode führen könnte.
Wer sich bisher vor allem mit den Abgründen der Zulassungsbestimmungen bei Arzneimitteln beschäftigt hat, könnte das Gefühl bekommen, vom Regen unter die Traufe zu geraten, wenn er sich eine Studie über die in den USA systematisch zu oberflächlichen Sicherheitsüberprüfungen bei Medizinprodukten anschaut, deren Versagen zu schweren gesundheitlichen Schäden, wenn nicht sogar zum Tode führen könnte.
In der Studie wurden 113 Rückrufe von Medizinprodukten einer bestimmten höheren Risikoklasse (darunter z.B. 35 Produkte für den Einsatz bei Herzerkrankungen) durch die dafür zuständige "Food and Drug Administration" (FDA) in den Jahren 2005 bis 2009 genauer untersucht. 81 % dieser Produkte wurden nicht den strengsten wissenschaftlichen PMA (premarket approvals)-Tests unterworfen, sondern nur durch wesentlich oberflächlichere Verfahren (vor allem mittels des so genannten "510(k) process") überprüft. Dies bedeutet u.a., dass nie untersucht wurde, wie diese zum Teil hochkomplexen Produzkte an und im Menschen wirken und möglicherweise eben auch schaden. Für einen Teil der Produkte gibt es schließlich gar keine Regulierung. Aber auch wenn Sicherheitsüberprüfungsvorschriften existieren und angewandt werden müssen, kommt es z.B. zu der sicherheitsrelevant absurden Gleichbehandlung eines Teils der Hüft- und Knieimplantate mit den Reinigungslösungen für Kontaktlinsen.
Wer nun als deutscher potenzieller Nutzer von Medizinprodukten die US-BürgerInnen zu bemitleiden be-ginnt, reagiert vorschnell und sollte sich seine Tränen für die Zeit nach Kenntnis der deutschen Zulassungswirklichkeit für Medizinprodukte aufsparen. Wie diese aussieht wird bereits daran sichtbar, dass US-Hersteller die viel raschere Zulassung ihrer Produkte in den meisten europäischen Ländern argumentativ für ihre Forderung nutzen, das US-System zu liberalisieren. Und in der Tat ist z.B. das deutsche Modell nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) u.a. dadurch herstellerfreundlicher, dass die Zulassung über die Vergabe der so genannten CE-Bezeichnung (vgl. dazu die §§ 6 ff. des MPG) für das Inverkehrbringen im EU-Raum nicht durch eine staatliche Behörde, sondern durch meist privatwirtschaftliche und gewinnorientierte so genannte "benannte Stellen" erfolgt, die diese Produkte gegen entsprechende Gebühren zertifizieren. Das öffentliche, d.h. dem Gemeinwohl verpflichtete "Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte" wird erst dann aktiv, wenn es zu Schäden etc. von Medizinprodukten kommt. Ausländische Hersteller können außerdem ihre Produkte für den EU-Wirtschaftsraum von jedem dazu befugten Institut in einem Mitgliedsland der EU zertifizieren lassen und dabei ein offen genanntes Gefälle der Prüfintensität innerhalb des EU-Wirtschaftsraums nutzen.
Ohne dass in Europa und Deutschland bisher unabhängig untersucht wurde, ob und welche erwünschten oder auch unerwünschte Wirkungen das CE-Zertifizierungssystem für Medizinprodukte auf Patienten aber auch Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen hat, zeigt der Nachweis, dass in Europa US-Produkte zuge-lassen werden, die in ihrem Herstellungsland noch nicht, nur nach einer oberflächlichen Prüfung oder viel-fach umstritten auf dem Markt sind, den nicht besonders vertrauenerweckenden Zustand des CE-Systems. Eine naheliegende Erklärung, dass es sich hierbei um eine Art versteckte Wirtschaftsförderungspolitik handelt, ist insofern möglich, weil die Medizintechnikbranche Deutschlands, mit der Firma Siemens an der Spitze, die weltweite Nummer 3 der Branche ist. Dass es wahrscheinlich noch etwas komplizierter ist, zeigt die Tatsache, dass auf Platz 1 der Medizintechnikbranche die USA und auf Platz 2 Japan stehen und zumindest in den USA etwas herstellerkritischer nach der Produktqualität geschaut wird als in Deutschland.
Von dem im Februar 2011 zuerst online veröffentlichten Aufsatz "Medical Device Recalls and the FDA Approval Process" von Diana M. Zuckerman, Paul Brown und Steven E. Nissen (in "Archives of Internal Medicine" 14, 2011. doi:10.1001/archinternmed.2011.30) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 7.3.11
Legenden zur Verantwortung für Überversorgung: 30 % weniger Betäubungsmittel, wenn Gebärende Schmerztherapie selbst bestimmen!
 Eine beliebte Erklärung von Ärzten und Gesundheitspolitikern für die teure und oft auch gesundheitlich bedenkliche Überversorgung mit Arzneimitteln und nebenbei ein willkommener Beleg für eine Variante von "Moral hazard" ist der von PatientInnen angeblich erzeugte Druck, bestimmte Mittel bei "jedem Wehwechen" in Hülle und Fülle zu erhalten, um Schmerzen oder Befindlichkeitsstörungen so schnell und gründlich wie möglich zum Verschwinden zu bringen. Um diesem Druck zu entgehen, sagen viele Ärzte auf Befragen sie würden oft gegen ihr "fachliches Gewissen" in einer Art vorauseilenden Ärgervermeidens zu viel und zu viel eigentlich nicht Notwendiges oder gar Unsinniges (z.B. Antibiotika gegen Virenerkrankungen) verordnen.
Eine beliebte Erklärung von Ärzten und Gesundheitspolitikern für die teure und oft auch gesundheitlich bedenkliche Überversorgung mit Arzneimitteln und nebenbei ein willkommener Beleg für eine Variante von "Moral hazard" ist der von PatientInnen angeblich erzeugte Druck, bestimmte Mittel bei "jedem Wehwechen" in Hülle und Fülle zu erhalten, um Schmerzen oder Befindlichkeitsstörungen so schnell und gründlich wie möglich zum Verschwinden zu bringen. Um diesem Druck zu entgehen, sagen viele Ärzte auf Befragen sie würden oft gegen ihr "fachliches Gewissen" in einer Art vorauseilenden Ärgervermeidens zu viel und zu viel eigentlich nicht Notwendiges oder gar Unsinniges (z.B. Antibiotika gegen Virenerkrankungen) verordnen.
An der weit verbreiteten Existenz einer solchen Overkill- oder Konsumier-Mentalität bei Patienten wurde aber schon lange gezweifelt. So bereiten viele der so erhaltenen Mittel meist keinenerlei Genuß und die angeblich fordernden Personen haben vor einer Einnahme vieler Mittel sogar erhebliche Ängste und Skrupel.
Dies gilt in besonderem Maße für eine schnell wirksame lokale Schmerztherapie, die sog. Periduralanästhesie, die bei Schwangeren gegen Schmerzen während des Geburtsvorgangs eingesetzt wird. Wer jemals bei einer Geburt dabei war, weiß, dass diese wirklich sehr schmerzhaft und dramatisch sein kann. Viele Schwangere und ihre Partner haben sich aber in der Schwangerenvorbereitung fest vorgenommen, auf diese Betäubung wegen der tatsächlichen oder vermeintlichen Risiken für die Schwangere und ihr ungeborenes Kind (u.a. Verlängerung des Geburtsprozesses und eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine risikoreiche Zangen- oder Saugglockenentbindung) zu verzichten. Die Entscheidung zur Periduralanästhesie hat dann aber häufig nichts mehr mit der "sauberen" Modellwelt von "rational" oder "informed choice" zu tun, sondern muss unter heftigsten Schmerzen, Zeitdruck und oft mit einem schlechten Gewissen erfolgen.
Dass die Schwangeren selbst unter diesen Umständen keine maximale Therapie oder Vollversorgung erwarten und für sich selber notwendig halten, wurde jetzt zum ersten Mal im Rahmen einer randomisierten experimentellen Studie in den USA mit insgesamt 256 durchschnittlich 24 Jahre alten Teilnehmerinnen nachgewiesen.
Anders als in der Geburtshilfe üblich, wurde die Entscheidung über die Dosis der Betäubungsmittel nicht mehr allein dem Narkosearzt überlassen, sondern zwei Drittel der gebärenden Frauen waren in unterschiedlicher Weise beteiligt. In einer Gruppe der dreiarmigen Untersuchung wurde die Periduralanästhesie durch eine kontinuierliche Infusion zweier Wirkstoffe durch den Anästhesisten verabreicht. Eine zweite Gruppe von Frauen konnte sich zusätzlich zu der kontinuierlichen Infusion bei Bedarf noch eine zusätzliche Wirkstoffdosis (sog. Bolusinjektion) einführen. In der dritten Gruppe bestimmten ausschließlich die Frauen wie oft sie wie viel Wirkstoffmengen benötigten und verabreichten sie sich dann auch durch eine entsprechend selbst zu bedienende technische Apparatur. Der Anästhesist kontrollierte bei den beiden letzten Gruppen lediglich, dass die gesundheitlich erträgliche Gesamtmenge nicht überschritten wurde.
Zu den Ergebnissen gehört erstens, dass keine der selbst bestimmenden Frauen die Betäubungsmittel überdosierte. Zweitens verabreichten sich diese Frauen aber sogar eine um 30 % geringere Betäubungsmittelmenge als ihren Mitgebärenden durch Anästhesisten verabreicht bekommen hatten und sogar eine um 46 % niedrigere Dosis als die Gebärenden mit kontinuierlicher plus Bolusinjektion.
Die gebärenden Frauen, welche die Betäubungsmittelinjektion allein bestimmten gaben etwas mehr Schmerzen als an die Frauen der beiden Vergleichsgruppen waren aber nach Meinung der Wissenschaftler zufriedener. Bei ihnen kam es schließlich auch seltener zu einer instrumentell gestützten Entbindung mit Saugglocke oder Zange.
Weitere Einzelheiten der auf der Jahrestagung der Society for Maternal-Fetal Medicine in San Francisco vorgestellten Studie von Michael Haydon et al. finden sich in dem Abstract Nr. 28 auf der Seite 13 des Kongressreaders (das Laden des Dokuments dauert relativ langsam, also nicht verzagen) und einer wesentlich schneller zugänglichen Presseerklärung zu dieser Präsentation.
Bernard Braun, 13.2.11
"Lasst die Toten ruhen!?" - Warum Rate und Ergebnisse von Obduktionen Bestandteil der Qualitätsberichte werden sollten?
 Am 4. Januar 2011 äußerte sich der "Bundesverband Deutscher Pathologen" unter der Überschrift "Neue Obduktionsstudie zeigt: Qualität klinischer Diagnostik ist gestiegen" zu Obduktionsergebnisse aus dem Krankenhaus Görlitz in Sachsen aus den Jahren 1987 und 2005-2007. Der Vorsitzende des Verbandes, Schlake, zog daraus für die aktuelle Gesundheitspolitik den Schluss: "Gehen Sie dorthin, wo viel obduziert wird".
Am 4. Januar 2011 äußerte sich der "Bundesverband Deutscher Pathologen" unter der Überschrift "Neue Obduktionsstudie zeigt: Qualität klinischer Diagnostik ist gestiegen" zu Obduktionsergebnisse aus dem Krankenhaus Görlitz in Sachsen aus den Jahren 1987 und 2005-2007. Der Vorsitzende des Verbandes, Schlake, zog daraus für die aktuelle Gesundheitspolitik den Schluss: "Gehen Sie dorthin, wo viel obduziert wird".
Richtig daran ist, dass Obduktionen oder Sektionen nicht zum Ensemble der Maßnahmen gehören, die Prozess- und Ergebnisqualität im Krankenhaus und Behandlungssystem zu verbessern und weder ihre Häufigkeit noch ihre Ergebnisse zu den Qualitätsindikatoren der obligatorischen strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser gehören. Und angesichts der Blässe oder Lückenhaftigkeit der gesamten Qualitätsberichterstattung sollte ernsthaft über die Aufnahme derartiger Indikatoren nachgedacht werden.
Falsch ist aber, dass es sich um neue Ergebnisse handelt, wenn man bedenkt, dass diese Ergebnisse bereits im "Ärzteblatt Sachsen 1/2009" veröffentlicht wurden. Aber dies ist nicht der erste Fall im deutschen Gesundheitswesen, dass die Einen Ereignisse und Daten schon als veraltet vergessen haben, Andere dieselben als brandneu entdecken und verbreiten.
Problematisch ist bei solchen Neuentdeckungen aber wirklich, wenn sie relativ unvollständig und tendenziös präsentiert werden. So werden zwar für das Jahr 1987 ausführlich die in der so genannten "Görlitzer Studie" extrem hohe Sektionsrate von 97 % aller im Klinikum der damals in der DDR gelegenen sächsischen Stadt Görlitz und die relativ niedrige Rate von 41 % übereinstimmenden klinischen Diagnosen und dem Obduktionsbefund berichtet. Für die Jahre 2005 bis 2007 fehlt in der Pressemitteilung des Verbandes einerseits jede Angabe zu der im Bundesdurchschnitt immer noch überdurchschnittlich hohen Görlitzer Obduktionsrate von 36 % und damit auch zu den möglichen Selektionseffekten. Andererseits berichtet der Verband aber, dass in den aktuelleren Jahren Diagnosen und Befunde in 60-62 % aller untersuchten Fälle voll übereinstimmten.
Trotz der eindeutigen Verbesserungen bei der Häufigkeit in der klinische Diagnosen mit Obduktionsbefunden übereinstimmen sieht dies 2005-2007 bei 38-40 % aller untersuchten Fälle mehr oder weniger anders aus. Deshalb lohnt ein zweiter ausführlicherer und vollständigerer Blick auf die Ergebnisse der "Görlitzer Studie" und die Erklärungen mancher ihrer Ergebnisse:
• Negativ betrachtet wurde 1987 in 37 % aller untersuchten Fälle bzw. obduzierten Toten eine Fehleinschätzung der Todesursache aufgedeckt. Dieser Anteil sank 2005-2007 auf durchschnittlich 18 %. Teilweise Übereinstimmungen traten 2005-2007 bei rund 20 % der Obduzierten auf.
• Trotz des selbstkritischen Hinweises in der Ärzteblatt-Publikation im Jahr 2009, dass die wesentlich niedrigere Obduktionsrate zu Selektionseffekten jedweder Art führen könnte und auch "ein gewisser Selektionsfaktor im Obduktionsgut anzunehmen" wäre "der durch die im häuslichen Milieu Verstorbenen noch verstärkt sein dürfte", relativieren diesselben Autoren die Gefahr selektiver Ergebnisse im selben Atemzug bzw. Absatz. Ihre Ergebnisse wiesen angeblich darauf hin, "dass der Selektionsfaktor von mehr als 30 % (Selektionsrate ab) statistisch gesehen abnimmt."
• Auch wenn das so ist, bedeutet diese Aussage, dass ein Großteil der Krankenhäuser, die entweder gar keine Obduktionen durchführen oder die Häuser mit der aktuell von Experten geschätzten und unwidersprochenen durchschnittlichen Obduktionsrate von 4 bis 6 %, keine verlässliche und für die qualitätsorientierte Krankenhaus-Auswahl relevanten Angaben über ihre Diagnosesicherheit und -qualität liefern können. Diese Situation hat sich auch in den letzten 20 Jahren deutlich verschärft: "So ist die Zahl der Obduktionen an deutschen Krankenhäusern um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen". Die Bundesärztekammer berichtet für 1999 sogar eine Rate von 3,1 %. Als Gründe nannten die Ärzteblatt-Autoren 2009 den Wandel in der Einstellung der Bevölkerung zu Krankheit und Tod "als Störfaktor", die "Einstellung der Ärzte und der ihrer Lehrer zur Obduktion" und für das Verschwinden der Obduktionen aus dem Beantragungs- und Handlungsrepertoire der öffentlichen Gesundheitsämter "Kostenfragen". In 30% der Fälle bei denen eine Obduktion aus ärztlicher Sicht sinnvoll gewesen wäre, sprachen sie sich gegen einen dafür notwendigen Antrag bei den Angehörigen aus. Kommt es zum Antrag würde "nicht selten … das Gespräch dem jüngsten Assistenten überlassen".
Auf die Folgen für die ärztliche Therapiequalität hat die Bundesärztekammer bereits im Jahr 2005 hingewiesen und ihre Einschätzung bis heute auf ihrer Website dokumentiert: "In ca. 15 % aller Todesfälle in Krankenhäusern besteht eine Diskrepanz zwischen klinischer Hauptdiagnose und Sektionsbefund, die mit Folgen für Therapie und Überleben der Patienten einhergeht. Diese Fehlerquote kann nur durch eine systematische klinische Autopsie erkannt und benannt sowie durch einen intensivierten klinisch-pathologischen Diskurs zukünftig verringert werden. In weiteren ca. 20 % der Sektionen ergeben sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen klinischer Hauptdiagnose und Sektionsbefund, allerdings ohne Konsequenzen für die Therapie und das Überleben der Patienten. ... Aus den genannten Fakten und Daten ergibt sich zwingend, dass eine Erhöhung der Sektionsfrequenz notwendig ist, da anderenfalls die ethisch und ökonomisch gebotene Selbstkontrolle der Medizin nur unzureichend erfüllt wird."
Sowohl für die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätssicherung und die Transparenz über die Qualitätssicherungsbemühungen und die Diagnose-Qualität einzelner Krankenhäuser ist daher der Forderung des Pathologenverbandes zuzustimmen, Angaben zur Sektionshäufigkeit und die gewonnenen Ergebnisse in die strukturierten Qualitätsberichte aufzunehmen.
Selbst bei der Unklarheit über Selektionseffekte in der vergleichsweise hohen Obduktionsrate des Görlitzer Krankenhauses zeigen seine Ergebnisse, dass Obduktionen auch Hinweise auf epidemiologische Fehleinschätzungen durch die amtliche Totenscheinstatistik liefern können: "So beträgt der Anteil der zum Tode führenden Herz-Kreislauferkrankungen im Autopsiegut 33-40 % und nicht entgegen offiziellen Mitteilungen über 50 %. Infektionen und Entzündungen stehen seit Jahren in der Obduktionsstatistik als Todesursache mit 14 % an 3. Stelle."
Und selbst wenn sich aber das stationäre Versorgungswesen nicht auf den Fortschritten von "Görlitz 2" ausruht, ändert dies nichts an den unter Qualitätsgesichtspunkten noch wesentlich größeren Mängeln der außerstationären Leichenschau und Todesursachen-Diagnostik. Auch wenn alle Ärzte zur Durchführung der Leichenschau verpflichtet sind, wimmelt(e) für die Bundesärztekammer die "Durchführung der ärztlichen Leichenschau" nach gründlicher Sichtung der bis zum Jahr 2002 dazu veröffentlichten wissenschaftlichen Studien von "Sorgfaltsmängeln", "Fehlleistungen" und liegt zum Teil "weit unter dem Anspruch der 'Evidence-Based-Medicine'."
Zu den "Highlights" der wesentlich längeren Mängelliste gehört, dass nur 25 % aller Ärzte und gerade einmal 1 % der Hausärzte die zu diagnostizierende Leiche gemäß der rechtsmedizinischen Empfehlung völlig entkleiden, sich 47 % der Notärzte und 41 % der niedergelassenen Ärzte durch die Polizei beeinflussen lassen, wenn es um die Entscheidung geht, "polizeiliche Ermittlungen zum Todesfall zu veranlassen", von den Ärzten "in der Regel (unzutreffenderweise) angenommen (wird), dass durch die Leichenschau die sichere Feststellung der Todesursache … möglich wäre", falsch eingeschätzte Todesursachen auf der Todesbescheinigung in 20 bis 50 % aller Todesfälle vorliegen und 1997 "mindestens 11.000 'nicht natürliche Todesfälle' darunter 1.200 Tötungsdelekte pro Jahr der Statistik entgehen, weil sie bei der Leichenschau als 'natürliche Todesfälle' deklariert werden." Von den zuletzt erwähnten 11.000 "nicht natürlich Gestorbenen" starben ca. 4.000 "im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen". Bei dem hier zitierten Verfasser handelt es sich um den Präsidenten der Bundesärztekammer, Hoppe, der dies und noch viel mehr zum Thema in einem Brief an die Teilnehmer der Gesundheitsministerkonferenz vom 22.1. 2003 vortrug und auch gleich ein Mustergesetz angehängt hatte.
Die aktuelle "Presseerklärung des "Bundesverband Deutscher Pathologen" ist kostenlos erhältlich.
Der "alte" Artikel "Obduktionsergebnisse. Unter dem Aspekt der Qualitätsberichte - Jahresanalysen aus dem Klinikum Görlitz" aus dem "Ärzteblatt Sachsen 1/2009" ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Wer an noch mehr Vor- und Nachteilen und Hintergründen zur Autopsie interessiert ist, findet dies in dem 61-seitigen sehr material- und referenzreichen Beschluss des Vorstandes der Bundesärztekammer vom 26. August 2005 "Stellungnahme zur Autopsie - Langfassung".
Und auch der ebenfalls mit zahlreichen weiterführenden Hinweisen versehene Brief von BÄK-Präsident Hoppe an die GMK aus dem Jahr 2003 ist im Internet kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 8.1.11
Über-/Fehlversorgung trotz klarer ärztlicher Behandlungsempfehlungen: Das Beispiel implantierbare Defibrillatoren
 Defibrillatoren sind Geräte, die durch gezielte Stromstöße lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen wie das Kammer- und Vorhofflimmern oder -flattern beenden. Die Geräte haben also bei bestimmten Personen mit bestimmten Erkrankungen oder Risiken einen nachgewiesenen Nutzen. Mit diesem Hinweis wurde ihr Einsatz seit einigen Jahren über den in kardiologischen Intensivstationen hinaus auf immer mehr Orte ausgedehnt. Dazu gehört das Aufhängen an öffentlichen Plätzen oder auch das Aufhängen in Haushalten mit kardiologisch kranken Menschen. Insbesondere der Nutzen von Defibrillatoren in Haushalten meist älterer Menschen war aber in entsprechenden Studien als wesentlich geringer als erwartet bzw. von Herstellern und Therapeuten verbreitet wurde (vgl. dazu den entsprechenden Forums-Beitrag) identifiziert worden.
Defibrillatoren sind Geräte, die durch gezielte Stromstöße lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen wie das Kammer- und Vorhofflimmern oder -flattern beenden. Die Geräte haben also bei bestimmten Personen mit bestimmten Erkrankungen oder Risiken einen nachgewiesenen Nutzen. Mit diesem Hinweis wurde ihr Einsatz seit einigen Jahren über den in kardiologischen Intensivstationen hinaus auf immer mehr Orte ausgedehnt. Dazu gehört das Aufhängen an öffentlichen Plätzen oder auch das Aufhängen in Haushalten mit kardiologisch kranken Menschen. Insbesondere der Nutzen von Defibrillatoren in Haushalten meist älterer Menschen war aber in entsprechenden Studien als wesentlich geringer als erwartet bzw. von Herstellern und Therapeuten verbreitet wurde (vgl. dazu den entsprechenden Forums-Beitrag) identifiziert worden.
Eine aktuelle Studie zur Verbreitung von implantierbaren Defibrillatoren (Defi) in den USA zeigt nun noch weitere Spuren von Überversorgung und auch ein unberechtigtes Verbreiten von Sicherheit bei einer großen Anzahl von herzkranken Patienten. Bei dieser Studie handelt es sich um eine retrospektive Kohortenstudie der im "National Cardiovascular Data Registry" der USA zwischen dem 1.1. 2006 und 30. Juni 2009 registrierten 111.707 Patienten mit einem implantierten Schockgeber.
Trotz eindeutiger Empfehlungen mehrerer ärztlicher Fachgesellschaften bei welchen Krankheitsbildern die Implantation eines solchen Geräts sinnvoll oder nicht sinnvoll (z.B. innerhalb der ersten 3 Monate nach der Erstdiagnose einer Herzerkrankung oder innerhalb von 40 Tagen nach einem akuten Herzinfarkt) ist, erhielten 22,5 % der gesamten Empfänger ihr Gerät ohne medizinische Evidenz. Ohne Evidenz heißt, dass entweder Personen mit einer bestimmten Herz-Erkrankung aus medizinischen/ethischen Gründen in keine der Studien aufgenommen worden sind, die den Nutzen überprüfen sollten oder dass in anderen Studien eindeutig kein Nutzen eines Defibrillators festgestellt werden konnte.
Unter den 22,5 % Patienten, denen die Implantation nicht nutzte, waren z.B. 36,8 % mit einem "frischen" Herzinfarkt und 62,1 % mit einer "frischen" Herzerkrankungs-Diagnose.
Das angedeutete Problem einer falschen Sicherheit verbirgt sich hinter einer weiteren Beobachtung dieser Studie: Die Patienten, bei denen die Implantation ohne Evidenz erfolgte, hatten ein wesentlich höheres Risiko im Krankenhaus zu sterben und deutlich höhere Komplikationen nach der Implantation als die Patienten, bei denen die Implantation evidenzbasiert war. Dies lag natürlich nicht oder nicht direkt am implantierten Defi, sondern am sehr oft schlechteren Gesundheitszustand der Personen mit nicht-evidenten Defi-Einsatz. Dass aber Patienten glaubten, ihnen könne mit Defi nichts mehr passieren und möglicherweise bestimmte Behandlungen unterlassen haben, kann nicht ausgeschlossen werden.
Wer im übrigen glaubt, dass Behandlungsempfehlungen eben ihre Zeit brauchen um beim letzten behandelnden Arzt angekommen zu sein und dann auch befolgt zu werden, findet in dieser Studie leider keine klare Bestätigung: Die Rate der nicht evidenzbasierten Implantationen bewegte sich von 24,5 % im Jahr 2006, 21,8 % in 2007, 22 % in 2008 und 21,7 % im Jahr 2009. Bei der Verbreitung wissenschaftlich gesicherter Behandlungsempfehlungen oder Leitlinien auf den Faktor Zeit zu setzen, ist also wenig hilfreich. Stattdessen muss umfassender als bisher untersucht werden, warum es zu solcher Über- und Fehlversorgung kommt, um dann spezifische aktive Maßnahmen zur Verbreitung zu entwickeln.
Und auch wenn Elektrophysiologen, also u.a. auf den Einsatz von Defis spezialisierte neurologische Fachärzte signifikant weniger Geräte ohne Nutzenevidenz implantierten, betrug auch bei ihnen die Rate der Über- oder Fehlversorgung noch 20,8 %. Kardiologen, die nicht elektrophysiologisch qualifiziert waren, implantierten dagegen 36,1 % ihrer Geräte ohne Evidenz.
Der Aufsatz "Non-Evidence-Based ICD (implantable cardioverter-defibrillator)Implantations in the United States" von Sana M. Al-Khatib et al. ist in JAMA (2011;305(1):43-49) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.1.11
Patientenrecht auf fachgerechte Behandlung à la Bundesgerichtshof: Wundheilbehandlung zwischen Antibiotika und Zitronensaft
 Nach § 2 Abs. 1 SGB V (Fünftes Buch des Sozialgesetzbuchs) haben die "Qualität und Wirksamkeit der Leistungen … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen." Und nach dem § 70 SGB V "(haben) … Krankenkassen und Leistungserbringer … eine … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten". Außerdem "muss" die Versorgung "in der fachlich gebotenen Qualität … erbracht werden" und zu einer "humanen Krankenbehandlung" beitragen.
Nach § 2 Abs. 1 SGB V (Fünftes Buch des Sozialgesetzbuchs) haben die "Qualität und Wirksamkeit der Leistungen … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen." Und nach dem § 70 SGB V "(haben) … Krankenkassen und Leistungserbringer … eine … dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten". Außerdem "muss" die Versorgung "in der fachlich gebotenen Qualität … erbracht werden" und zu einer "humanen Krankenbehandlung" beitragen.
Auch wenn dieser trotz aller Offenheit unbestimmter Rechtsbegriffe eigentlich unmissverständliche gesetzliche Rahmen bei weitem nicht die Versorgungswirklichkeit für GKV-Versicherte bestimmt, hat der Bundesgerichtshof (BGH) kurz vor Weihnachten 2010 ein bemerkenswertes und aus Patientensicht bedenkliches Urteil gefällt.
Seinem Urteil als Revisionsinstanz lag in den Worten der BGH-Pressemitteilung zum Urteil vom 22. Dezember 2010 folgender vom Landgericht (LG) Mönchengladbach (Urteil vom 15. Januar 2010 - 27 Ks 2/10) ermittelte Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte, Chefarzt und Eigentümer einer privaten Klinik in Nordrhein-Westfalen, hatte "eine (80-jährige) Patientin, bei der er eine Darmoperation kunstgerecht durchführte, vor diesem Eingriff nicht darüber aufgeklärt, dass er zur Behandlung einer nach dieser Operation eventuell auftretenden Wundinfektion auch Zitronensaft verwenden würde. Er war von dessen desinfizierenden Wirkung überzeugt und ließ ihn daher unter nicht sterilen Bedingungen mit üblichen Haushaltsgeräten in der Stationsküche gewinnen. Jedoch konnte es durch den unsterilen Zitronensaft zu einer weiteren bakteriellen Belastung damit behandelter Wunden kommen. Nachdem bei der Patientin tatsächlich eine massive Wundheilungsstörung aufgetreten war, nahm der Angeklagte eine zweite Operation (sog. Reoperation) vor und brachte hierbei sowie in der Folgezeit - neben dem Einsatz herkömmlicher Medikamente (insbesondere von Antibiotika) - mehrfach Zitronensaft in die Wunde ein. Auch jetzt informierte er die Patientin hierüber nicht. Diese verstarb rund zwei Wochen nach dem ersten Eingriff an den Folgen der Wundinfektion."
Auch wenn das LG "keinen hinreichenden Anhalt" gefunden hat, dass die Verwendung des Zitronensaftes für den Eintritt des septischen Herz-Kreislaufversagens mitursächlich war, "hätte der Angeklagte die Patientin aber über den möglichen späteren Einsatz von Zitronensaft schon vor der ersten Operation aufklären müssen. Daher hat es bereits die Einwilligung der Patientin in die Vornahme dieses Eingriffes als unwirksam angesehen und diesen daher als rechtswidrige Körperverletzung gewertet. Weil die durch die Erstoperation bedingte Wundinfektion zum Tode der Patientin geführt hat, hat es den Angeklagten der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig erachtet."
Dazu, so der der 3. Strafsenat des BGH, sei der behandelnde Chefarzt nicht verpflichtet gewesen: "Birgt ein ärztlicher Heileingriff das Risiko, dass sich in seiner Folge eine weitere behandlungsbedürftige Erkrankung oder körperliche Schädigung einstellt, so muss der Arzt den Patienten vor dem ersten Eingriff nur dann über die Art und die Gefahren einer bei Verwirklichung des Risikos notwendigen Nachbehandlung aufklären, wenn dieser ein schwerwiegendes, die Lebensführung eines Patienten besonders belastendes Risiko anhaftet, etwa der Verlust eines Organs. Eine derartige Konstellation lag hier nicht vor."
Selbst wenn die Annahme richtig sein mag, das wiederholte Einbringen von nicht sterilen Zitronenstreifen und Zitronensaft in die Wunde, sei nicht die Ursache für den Tod der Patientin, kümmert zumindest die BGH-Richter noch nicht einmal die Tatsache, dass es sich hier weder um ein für diese Zwecke medizinisch "allgemein" anerkanntes Therapeutikum handelt noch das Einbringen insteriler Mittel in eine offene Wunde etwas mit fachlich gebotener Qualität zu tun hat. In seiner Lesart stellt dies alles vielmehr eine "unerprobte Außenseitermethode" dar. Und der tödliche Ausgang der stationären Behandlung könnte dann als ein "schicksalhafter Krankheitsverlauf" bezeichnet werden.
Gerade weil ein Patient von einem behandelnden Arzt eine wissenschaftlich gesichert wirksame Behandlung und nicht eine selbst nach Ansicht des angeklagten Chefarztes nur selten hilfreiche "unerprobte Außenseitermethode" erwartet, gingen die Richter des LG von einer Aufklärungspflicht vor der ersten Operation aus. Diese Information hätte nämlich "bei der Patientin Zweifel an seiner Fachkompetenz … wecken können mit der Folge, dass sie den Eingriff nicht vom Angeklagten hätte vornehmen lassen." Dieser Überlegung schließen sich aber die BGH-Richter ausdrücklich nicht an.
Damit ist es nur konsequent, dass nahezu alle weiteren Besonderheiten ihrer Behandlung strikt und angesichts ihres Todes fast schon zynisch gegen die Patientin ver- und gewendet werden:
• Die Patientin habe immerhin zuerst und als Alternative zur Zitronensaft-Therapie Antibiotika erhalten,
• es wäre "grundsätzlich noch genügend Zeit vorhanden (gewesen), um die Patientin auf den beabsichtigten Einsatz von Zitronensaft hinzuweisen" (ob dies geschah, bleibt im Moment unklar und auch nicht ermittelbar) und
• sie sei "trotz ihrer erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen sogar noch in der Lage (gewesen), eigenverantwortlich ihre Einwilligung in die Reoperation zu erteilen".
Dies gipfelt in der Feststellung, dass das "maßgebliche Risiko" der Zitronensaftbehandlung "ausschließlich eine gewisse zusätzliche bakterielle Belastung" gewesen sei, "was nicht mit der Gefahr für die künftige Lebensführung eines Patienten vergleichbar ist, dem durch die Nachbehandlung etwa ein Organverlust droht."
Der Chefarzt hätte also vom LG nach Ansicht des BGH wegen der fehlenden Aufklärung des Einsatzes von Zitronensaft nach der ersten Operation nicht wegen Körperverletzung noch insgesamt wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt werden dürfen. Da er seine Patientin aber zumindest vor der zweiten Operation über die beabsichtigte Behandlung mit Zitronensaft hätte aufklären müssen (warum, ist der Pressemitteilung nicht zu entnehmen), ordnet der BGH eine erneute Verhandlung des Falles vor dem LG an. Auf "anderer Tatsachengrundlage" wäre nämlich nicht auszuschließen, dass z.B. wegen anderer Fehler bei der Operation doch eine Körperverletzung mit Todesfolge vorläge.
Angesichts dessen, was der BGH hier mit höchstinstanzlicher Autorität und Bedeutung zu Gunsten der "Therapiefreiheit" des Arztes und zu Ungunsten des Anspruchs von Patienten auf eine fachlich wirksame und anerkannte Behandlung geurteilt hat, kann man sich allerdings kaum etwas vorstellen, was die LG-Richter zu einem solchen Urteil bewegen könnte.
Da sich derselbe Chefarzt aber noch wegen zahlreicher weiterer möglicher Fälle von Körperverletzung vor dem LG zu verantworten hat, besteht immer noch die Chance, dass sich die Waage der Rechtsprechung in diesem Fall noch etwas anders einpendelt.
Wer das für Patientenrechte schlechte Signal zum Ende des Jahres 2010 noch etwas genauer erkunden will, ist im Moment ausschließlich auf die offizielle "Pressemitteilung 246/2010 des BGH" angewiesen, die frei zugänglich ist.
Auch wenn sich durch das ausführliche schriftliche Urteil am Ergebnis und der Argumentationsführung des Urteils nichts mehr ändern wird, sollte es in jedem Fall - und das gilt auch ausdrücklich für Nichtjuristen - für die abschließende Bewertung seiner Argumente und Tragweite genau gelesen werden. Der Text lag aber nach Angaben des BGH vom 30.12. 2010 noch nicht in gedruckter Form vor.
Bernard Braun, 1.1.11
Künftige Arzneimittel-Romanschreiber werden es schwer haben, die Wirklichkeit bei GlaxoSmithKline zu übertreffen.
 Noch am Fuße der Presseerklärung, in der die Firma GlaxoSmithKline (GSK), also einer der weltweit führenden Pharmakonzerne, erklären muss, Strafgelder von insgesamt 750 Millionen US-Dollar für die wissentliche jahrelange Duldung schwerster Qualitätssicherheitsmängel und den Weiterverkauf möglicherweise gefährlich kontaminierter Arzneimittel zu zahlen, steht offentlich unbeeindruckbar das Selbstlob: "is committed to improving the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer."
Noch am Fuße der Presseerklärung, in der die Firma GlaxoSmithKline (GSK), also einer der weltweit führenden Pharmakonzerne, erklären muss, Strafgelder von insgesamt 750 Millionen US-Dollar für die wissentliche jahrelange Duldung schwerster Qualitätssicherheitsmängel und den Weiterverkauf möglicherweise gefährlich kontaminierter Arzneimittel zu zahlen, steht offentlich unbeeindruckbar das Selbstlob: "is committed to improving the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer."
Bei dem damit öffentlich bekanntwordenen und ausführlich in der Ausgabe der New York Times vom 26. Oktober 2010 dargestellten Arzneimittelsicherheitsskandal geht es kurz gefasst um Folgendes:
• In einer der weltweit größten Produktionsanlagen der Firma, Cidra bei San Juan in Puerto Rico (USA), mit einem zu Hochzeiten jährlichen Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar wurden bis 2009 u.a. 20 Arzneimittel hergestellt, darunter Blockbuster wie Avandia oder Tagamet.
• In dieser Fabrikanlage gab es eine Kumulation von Verseuchungsrisiken, das von der vollkommen verschmutzten betriebseigenen Wasseranlage bis zu einem Belüftungssystem reichte, das verseuchte Luft, Keime und gefährliche Mikroorganismen im gesamten Betrieb verteilte.
• Der Verdacht über derartige Zustände war der staatlichen US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA bereits Anfang 2002 gekommen und sie teilte ihn der Firma GSK auch mit. Diese schickte dann im August 2002 eine Spezialistin nach Puerto Rico und ließ die dortigen Verhältnisse von insgesamt 100 Qualitätsexperten untersuchen. Diese entdeckte selber, dass die dortige Qualitätskontrolle eine "einzige Schweinerei" war. Neben der verkeimten Wasseranlage und dem maroden Belüftungssystem entdeckte sie z.B. noch, dass Arzneimittel wegen überfüllter spezieller Lagerräume in gemieteten Kraftfahrzeugen gelagert wurden, dass die Fabrik auch nicht die Sterilität von intravenösen Krebsmedikamenten gewährleisten konnte und Pillen unterschiedlicher Stärke manchmal in ein und derselben Dose landeten.
• Obwohl die Expertin führenden Mitgliedern des GSK-Managements die eindeutigen Probleme berichtete und auch empfahl damit zu beginnen die unsicheren und meist gesundheitsgefährdenden Medikamente zurückzurufen, passierte praktisch nichts. Im Mai 2003 wurde ihr Arbeitsverhältnis unter Hinweis auf Arbeitsmangel ("redundancy") beendet.
• Sie beschwerte sich bei Vorstandsmitgliedern von GSK und drohte dabei sogar, ihre Ergebnisse der FDA mitzuteilen, ohne dass GSK mit der Beendigung der bekannten Zustände begann.
• Daraufhin machte die Spezialistin mit ihrer Ankündigung ernst, informierte die FDA und verklagte die Firma auch auf Schadenersatz.
• Die FDA startete darauf eine Kriminaluntersuchung und ließ 2005 durch hunderte von bewaffneten Polizisten in der Fabrik in Puerto Rico Produkte im Wert von nahezu 2 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen.
• Unfähig, an den Sicherheitsproblemen in der Fabrik etwas zu ändern, schloss GSK sie im Jahr 2009. In ihrer Presseerklärung vom 25. Oktober 2010 brachte ein Topmanager des Unternehmens diese Unfähigkeitserklärung auf den Punkt: "We regret that we operated the Cidra facility in a manner that was inconsistent with current Good Manufacturing Practice (cGMP) requirements and with GSK's commitment to manufacturing quality. GSK worked hard to resolve fully the manufacturing issues at the Cidra facility prior to its closure in 2009 and we are committed to continuous improvement in our manufacturing processes."
Die eingangs erwähnte Summe von einer dreiviertel Milliarde US-Dollar umfassende Strafe bezahlt GSK nach eigenem Bekunden u.a. um weitere straf- und zivilrechtliche Verfahren vor mehreren US-Gerichten zu stoppen und auch weitere Aktivitäten von so genannten "whistle-blower" zu verhindern.
Die in der genannten Presserklärung des Unternehmens enthaltene abwiegelnde Bemerkung, es gäbe seit 2001 keinen vergleichbaren Warnhinweis des FDA, ist angesichts der fast ein Jahrzehnt dauernden Unfähigkeit oder des konstant fehlenden Willens nach dem Bekanntwerden des Problems substantiell Abhilfe zu verschaffen, eigentlich nicht beruhigend.
Der ausführliche Artikel in der New York Times vom 26. Oktober 2010 ist kostenlos und evtl. mit geringem Anmeldeaufwand erhältlich.
Und natürlich gilt dies auch für die GSK-Pressemitteilung zur Zahlung der Strafe. Und selbst angesichts dieses Schaustücks über Vertuschung und billigendem Inkaufnehmen von lebensgefährlichen Auswirkungen eigener Qualitätsmängel auf kranke Menschen, offenbart der Pharmakonzern ein seltsames oder fragwürdiges Verständnis von Transparenz. Er startet seine Pressemitteilung nämlich öffentlich mit der Bemerkung: "This press release is intended for business journalists and analysts/investors. Please note that this release may not have been issued in every market in which GSK operates."
Bernard Braun, 29.10.10
Wie verallgemeinerbar sind Ergebnisse von und Empfehlungen aus RCT? Externe Validität am Beispiel Asthma.
 Leitlinien oder therapeutische Empfehlungen auf der Basis evidenter Ergebnisse, die aus den bestmöglichen Studien gewonnen werden, gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine wirksame und wirtschaftliche gesundheitliche Versorgung. Randomisierte kontrollierte Studien (RCT) stellen dabei den "Goldstandard" dar.
Leitlinien oder therapeutische Empfehlungen auf der Basis evidenter Ergebnisse, die aus den bestmöglichen Studien gewonnen werden, gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine wirksame und wirtschaftliche gesundheitliche Versorgung. Randomisierte kontrollierte Studien (RCT) stellen dabei den "Goldstandard" dar.
Trotzdem ist weder die Praxis (z.B. Verbreitung im Behandlungsalltag) noch die Methodik der evidenzbasierten Leitlinien und RCTs problemlos.
Zu einem für die praktische Anwendung von Behandlungsempfehlungen in Arztpraxen und Kliniken wesentlichen Problem gehört die Gültigkeit der Erkenntnisse aus RCT oder deren externe Validität. Mit anderen Worten: Sind die TeilnehmerInnen in RCTs so repräsentativ für die Gesamtheit oder Mehrheit der PatientInnen mit der untersuchten Erkrankung, dass die in diesen Studien gewonnenen Vorgehensweisen auch außerhalb von ihnen sinnvoll und erfolgreich sind?
Eine bereits 2007 erschienene Studie begründet einen berechtigten Zweifel und quantifiziert die Unterschiede zwischen den Innenverhältnissen in RCTs und dem Behandlungsalltag am Beispiel des Asthma, einer Krankheit mit einer bekanntermaßen breiten Palette von klinischen Erscheinungsweisen.
Aus einer insgesamt befragten Gruppe von 3.500 zufällig ausgewählten neuseeländischen BürgerInnen im Alter von 25 bis 75 Jahren wurden mittels eines speziellen Fragebogens und eines Atemfunktionstests zunächst die 179 Personen herausgefiltert, die aktuell an Asthma litten und die 127 Personen, die an Asthma litten und deswegen in Behandlung waren. Für diese Personen wurde geprüft, ob sie den individuellen und krankheitsspezifischen Kriterien ("inclusion criteria") entsprochen hätten, um Teilnehmer einer der 17 großen RCTs gewesen zu sein, deren Ergebnisse wiederum den wesentlichen Input für die "Global Initiative for Asthma (GINA)"-Leitlinien geliefert hatten. Von den Personen, die ohne behandelt zu werden an Asthma litten, wären durchschnittlich 4 % (zwischen 0 % und 36 %) RCT-TeilnehmerIn geworden. Von den behandelten Asthmatikern hätten dies im Schnitt 6 % geschafft, wobei der Anteil je nach RCT zwischen 0 % und 43 % geschwankt hätte.
Die Studie zeigt zum einen, dass die großen Asthma-RCTs mit einer hochselektierten Teilnehmerschaft durchgeführt wurden. Zum anderen besitzen ihre Ergebnisse aber trotz ihrer starken wissenschaftlichen Evidenz nur mehr oder weniger eingeschränkte Aussagekraft und Gültigkeit außerhalb der RCT. Dies bedeutet u.a. konkret, dass sich kein Arzt völlig sicher sein kann, dass z.B. seine PatientInnen auf ein Medikament genauso reagieren wie die RCT-PatientInnen. Zumindest der Grad der Verallgemeinerbarkeit der RCT-Ergebnisse ist unsicher. Die neuseeländischen ForscherInnen fordern daher zu Recht, dass in künftigen RCTs zum Asthma und anderen Erkrankungen eine breitere Palette von Inklusionskriterien zur Anwendung kommen als bisher.
Die Studie "External validity of randomised controlled trials in asthma: to whom do the results of the trials apply?" von Justin Travers, Suzanne Marsh et al. ist in der Fachzeitschrift "Thorax" erschienen (2007;62:219-223). Kostenlos erhältlich ist nur das Abstract.
Bernard Braun, 9.7.10
Wie die Schweinegrippe-Politik der WHO jede Verschwörungstheorie in den Schatten stellt. Glaubwürdigkeit am Ende!
 Vor fast einem Jahr, am 11. Juni 2009 erklärte die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan, die Schweinegrippe zur Pandemie mit der höchsten Stufe 6 und löste damit eine Flut von aufwändigen, teuren und Millionen von Menschen in Angst und Schrecken versetzende Maßnahmen aus: "I have conferred with leading influenza experts, virologists, and public health officials. In line with procedures set out in the International Health Regulations, I have sought guidance and advice from an Emergency Committee established for this purpose. On the basis of available evidence, and these expert assessments of the evidence, the scientific criteria for an influenza pandemic have been met. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic." Und sie fügte hinzu: "WHO has been in close dialogue with influenza vaccine manufacturers."
Vor fast einem Jahr, am 11. Juni 2009 erklärte die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan, die Schweinegrippe zur Pandemie mit der höchsten Stufe 6 und löste damit eine Flut von aufwändigen, teuren und Millionen von Menschen in Angst und Schrecken versetzende Maßnahmen aus: "I have conferred with leading influenza experts, virologists, and public health officials. In line with procedures set out in the International Health Regulations, I have sought guidance and advice from an Emergency Committee established for this purpose. On the basis of available evidence, and these expert assessments of the evidence, the scientific criteria for an influenza pandemic have been met. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic." Und sie fügte hinzu: "WHO has been in close dialogue with influenza vaccine manufacturers."
Wie eng dieser Dialog war und ob es dabei blieb oder es immer mehr war als Miteinanderreden, sollten die öffentliche bekanntwerdenden Details über das Agieren dieser weltweiten Public Health-Institution bis zum heutigen Tag immer drastischer belegen.
Angesichts des nachhaltigen Ausbleibens der Schreckensseiten einer Pandemie bis zum heutigen Tag und der gleichzeitigen milliardenschweren Umsätze und Gewinne der wenigen Hersteller von Impfstoffen und der in ihrer Wirksamkeit bis heute umstrittenen Wirkstoffe Oseltamivir (als Tamiflu der Firma Roche bekannt) and Zanamivir (Markenname Relenza der Firma GlaxoSmithKline) und vieler Ungereimtheiten oder argumentativen Leerstellen der Protagonisten der Pandemie-Politik, gab es bereits früh Vermutungen, ein Teil der Ratgeber, also auch Mitglieder des "Emergency Committee" der WHO, hätten wegen bezahlter Tätigkeiten für die ökonomischen Nutznießer der Pandemiepolitik schwere Interessenskonflikte. Dies wurde u.a. von der WHO stets postwendend als bösartige und grundfalsche Ausgeburt von "Verschwörungstheorien" bestritten und zu diskreditieren versucht.
Was aber seit Ende letzten Jahres über das tatsächliche Geschehen immer deutlicher an die Öffentlichkeit drang, könnte selbst hartgesottene Verschwörungstheoretiker vor Neid erblassen lassen.
Ende 2009 charakterisierte der EX-SPD-MdB Wolfgang Wodarg, heute Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Europarats, des Zusammenschlusses von 47 Staaten, die fast alle auch Mitglied der WHO sind, die WHO-Politik als "campaign of panic" and a "false disaster".
Gestützt auf erste Recherchen einer Arbeitsgruppe des Europarats fügte er dem hinzu:
• "The WHO in collaboration with some big pharmaceutical companies and their scientists, re-defined pandemics and lowered the alarm-threshold. Those new standards forced politicians in most states to react immediately and sign marketing commitments for additional and new vaccines against "swine-flu" and spend billions of dollars to catch up."
• "Never before the search for traces of a virus was carried out so broadly and intensively, besides, many cases of death that happen to coincide with seropositive H1N1 lab-findings were simply attributed to "swine-flu" and used to foster fear."
• Und: "A group of people in the WHO is associated very closely with the pharmaceutical industry."
Die Mitglieder der "Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)" votierten daraufhin dafür, eine gründliche Untersuchung durchzuführen und deren ERgebnisse öffentlich zu diskutieren.
In der Resolution heißt es: "In order to promote their patented drugs and vaccines against flu, pharmaceutical companies have influenced scientists and official agencies, responsible for public health standards, to alarm governments worldwide. They have made them squander tight healthcare resources for inefficient vaccine strategies and needlessly exposed millions of healthy people to the risk of unknown side-effects of insufficiently tested vaccines."
Am 3. Juni 2010 beschäftigen sich Deborah Cohen, eine der Editorinnen des "British Medical Journal (BMJ)" und Philip Carter, Mitarbeiter des "Bureau of Investigative Journalism" in einem Feature in dem renommierten Medizinjournal mit dem Thema "Conflicts of interest. WHO and the pandemic flu 'conspiracies'".
Die Ross und Reiter, also auch Namen von Sponsoren und Geldempfänger beinhaltenden Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen:
• In zahlreichen nationalen und transnationalen Institutionen, die über die Art und Weise der Reaktion auf Grippeerkrankungen entscheiden saßen und sitzen mehrere Wissenschaftler, die gleichzeitig und kontinuierlich Vorträge für Hersteller von Grippemitteln hielten, Forschungsgelder oder Beraterhonorare von ihnen erhielten oder sonstige Verbindungen mit möglichen Interessenskonflikten zu ihnen hatten.
• In dem insgesamt relevantesten Expertengremium der WHO arbeiteten drei der derartig parteilichen Experten an allen WHO-Richtlinien zur Schweinegrippe mit und verfassten darin z.B. das Kapitel "Gebrauch von antiviralen Mitteln während einer Influenza-Pandemie". Dieses Kapitel stammt von dem Infektionsmediziner Fred Hayden von der University of Virginia, der in einer vom Tamufluhersteller Roche bezahlten Studie zum Ergebnis, das Medikament reduziere die Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen wegen Grippe um 60 %. Der Versuch einer Cochrane-Reviewergruppe um den britischen Virologen Jefferson , dieses Ergebnis nachzuvollziehen und es zu bestätigen scheiterte. Wen wundert es dann aber, dass Hayden via WHO-Richtlinie den einzelnen Ländern empfahl, sich ausgerechnet Vorräte von Medikamenten anzulegen und damit vor allem einen Vorrat von Tamiflu!?
• Fred Hayden gab auf die Fragen von Cohen und Carter an, er habe für ein 2002 stattgefundenes WHO-Expertentreff diese Interessenkonflikte gegenüber den WHO-Verantwortlichen auch angegeben: "DOI (declaration of interest) forms were filled out for the 2002 consultation." Ähnlich äußerte sich auch der Epidemiologe Arnold Monto , der die WHO-Richtlinien zum Gebrauch von Impfstoffen in Pandemien verfasste und diverse Zuwendungen vom Impfstoffhersteller GSK bekommen hatte: "Conflict of interest forms are requested before participation in any WHO meeting."
• Obwohl also der WHO bei mehreren Beratern Belege für Interessenkonflikte vorlagen und obwohl 2009 öffentlich über die Existenz der DOI-Formblätter berichtet wurde, taucht bis heute in keiner Richtlinie einer dieser Hinweise auf.
• Fred Hayden räumte auf Vorhalt der beiden BMJ-Autoren ein, er "strongly support transparency in declarations of interest". Selbst für den von ihm verfassten Text konzedierte er, erst mit diesem Wissen könne sich jedermann "make their own judgments about the possible relevance of any potential conflicts."
• Nur die WHO tut buchstäblich alles, um ihre Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit ihrer Richtlinien, zu zerstören und dies auch noch als problemgerechte Politik zu verkaufen: Pressesprecher heben zum einen hervor, die WHO "never publishes individual DOIs, except after consultation with the Office of the Director-General". Und die Generaldirektorin Margaret Chan sei auch "very committed personally to transparency". Als der öffentliche Druck zu groß wird, konkretisiert Direktorin Chan in einer Presseerklärung vom 3. Juni 2010 zum achten Treffen des so fragwürdig gewordenen "Emergency Committees" warum es hier keine Transparenz gab bzw. was Transparenz aus ihrer Sicht ist: "On a separate issue, the Director-General noted that the secretariat is following the practice of the Organization for public disclosure of the names of the Emergency Committee members to take place once the work of the Committee had been completed. The purpose of this practice is to protect the integrity and independence of the Members while doing this critical work - but also to ensure transparency by publicly providing the names of the members as well as information about any interest declared by them at the appropriate time. The Committee Members strongly concurred with this approach." Angesichts der unumstrittenen Sachlage geht es der WHO-Generaldirektorin also aktuell darum, die "Integrität und Unabhängigkeit" der schon immer industrieabhängigen Mitglieder und ihrer industriefreundlichen Arbeit vor Beeinflussung zu sichern.
Dass der angemessene Zeitpunkt, die Namen der Berater und ihre Interessenkonflikte zu veröffentlichen, Sankt-Nimmerleinstag heißt und die schützenswerten Mitglieder diesem Ansatz zustimmen, verwundert dann niemand mehr.
• Unabhängig von dem dreisten, höchst parteilichen und für das künftige Vertrauen in WHO-Empfehlungen desaströse Verständnis der Leiterin der weltweiten Public Health-Institution WHO, wirft der Fall Schweinegrippe-Pandemie noch weitere grundsätzliche Fragen auf, die schnellstens beantwortet werden müssen: Wie geht man mit der Tatsache um, dass es kaum noch Experten für Arzneimittel gibt, die kein Geld von irgendeinem Arzneimittelhersteller für mehr oder weniger seriöse Leistungen erhalten haben oder erhalten? Reicht die Verpflichtung zu DOIs wirklich aus oder muss man nicht auch noch die uneingeschränkte Veröffentlichungspflicht solcher Erklärungen vereinbaren? Sollen und können Experten mit INteressenskonflikten überhaupt in ein Entscheidungsgremium berufen werden dürfen und dort verbindliche Richtlinien beeinflussen dürfen?
• Den langen Reigen der WHO-kritischen Äußerungen und Untersuchungen vervollständigte schließlich der Europarat-/PACE-Ausschuss, der auch noch am 3. Juni 2010 seinen vorläufigen Bericht zum Umgang der WHO mit der H1N1-Pandemie veröffentlichte. Die WHO-Politik habe zu einer einer "Verschwendung großer Summen öffentlicher Gelder, unbegründeter Ängste und Befürchtungen über die Gesundheitsgefahren für die europäische Bevölkerung" geführt. Eine Pandemie, die "eigentlich nie eine solche war" habe eine "Placebobehandlung in großem Umfang" ausgelöst.
In dem verabschiedeten Text stellt der Ausschuss "schwere Mängel" in Bezug auf die Transparenz im Entscheidungsprozess über den Ausbruch [der Pandemie] fest, was zu der Frage über den Einfluss der Pharmazeutischen Industrie auf die getroffenen Entscheidungen führt. Stark rückläufiges Vertrauen in den Rat der für die öffentliche Gesundheit verantwortlichen Institutionen könnte sich im Falle einer ernsten künftigen Pandemie als "katastrophal" erweisen, warnt der Bericht.
Der Ausschuss legt außerdem eine Reihe dringender Empfehlungen für größere Transparenz und bessere Regierungsführung in der öffentlichen Gesundheit dar sowie Garantien für das, was er "unzulässige Einflussnahme durch Interessengruppen" nennt. Auch fordert er einen öffentlichen Fonds für die Unterstützung unabhängiger Forschung, Studien und Expertenratschläge, möglicherweise durch einen Pflichtbeitrag der Pharmazeutischen Industrie finanziert sowie eine engere Zusammenarbeit mit den Medien, um "Sensationsgier und Panikmache im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu vermeiden". Eine Debatte des Berichtes durch die Parlamentarier aller 47 Mitgliedstaaten des Europarates ist für den 24. Juni 2010 auf der Sommersitzung der PACE in Straßburg vorgesehen.
• Ob Mitgliedsländer des Europarats, die zugleich WHO-Mitglieder sind, darüber nachdenken, sowohl den Rücktritt der Generaldirektorin zu fordern und Änderungen an der Transparenzvorstellung der WHO einzufordern, ist bisher öffentlich nicht bekannt.
Die Äußerungen Wolfgang Wodargs und Auszüge aus der Januar-Resolution der PACE finden sich hier.
Das Feature "Conflicts of Interest. WHO and the pandemic flu "conspiracies" von Deborah Cohen und Philip Carter aus der BMJ-Ausgabe vom 3. Juni 2010 (BMJ 2010;340:c2912) ist komplett kostenlos erhältlich und ein Lektüre-Muss für jeden an Public Health interessierten Menschen.
Auch die "provisional version" des Berichtes "The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed" des "Social Health and Family Affairs Committee" des Europarats und des Berichterstatters Mr Paul Flynn ist komplett kostenlos zugänglich.
Schließlich kann man auch einen der wichtigen Texte der ja auch immer noch aktuellen Tamiflu-Debatte komplett und kostenlos erhalten. Es handelt sich dabei um den Aufsatz "Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and metaanalysis" von Tom Jefferson, Mark Jones, Peter Doshi, und Chris Del Mar (alles Mitglieder der "Cochrane Acute Respiratory Infections Group" aus dem BMJ 2009;339:b5106.
Dessen Zusammenfassung lautet: "Neuraminidase inhibitors have modest effectiveness against the symptoms of influenza in otherwise healthy adults. The drugs are effective postexposure against laboratory confirmed influenza, but this is a small component of influenza-like illness, so for this outcome neuraminidase inhibitors are not effective. Neuraminidase inhibitors might be regarded as optional for reducing the symptoms of seasonal influenza. Paucity of good data has undermined previous findings for oseltamivir's prevention of complications from influenza. Independent randomised trials to resolve these uncertainties are needed."
Bernard Braun, 6.6.10
Klinische Behandlungspfade helfen Behandlungsqualität zu verbessern und teilweise Liegezeiten und Behandlungskosten zu verringern!
 Nicht selten als Form von "Kochbuchmedizin" oder auch als rein ökonomisch induzierte Übertragung von Normen industrieller Serienfertigung kritisiert oder in Frage gestellt, erwiesen sich klinische Behandlungspfade bzw. "clinical pathways" im Rahmen eines Reviews der "Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group" als geeignet, die Verweildauer in Krankenhäusern verkürzen, Kosten zu reduzieren aber vor allem auch die Behandlungsqualität zu sichern.
Nicht selten als Form von "Kochbuchmedizin" oder auch als rein ökonomisch induzierte Übertragung von Normen industrieller Serienfertigung kritisiert oder in Frage gestellt, erwiesen sich klinische Behandlungspfade bzw. "clinical pathways" im Rahmen eines Reviews der "Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group" als geeignet, die Verweildauer in Krankenhäusern verkürzen, Kosten zu reduzieren aber vor allem auch die Behandlungsqualität zu sichern.
Die um den Dresdner Gesundheitswissenschaftler Thomas Rotter gescharte internationale Reviewer-Gruppe stützt sich bei diesen Aussagen auf eine Auswahl von 27 randomisierten kontrollierten Studien aus insgesamt international existierenden qualitativ hochwertigen 3.214 Studien, die sich bisher mit den verschiedenen Wirkungen klinischer Behandlungspfade beschäftigten. An den ausgewählten Studien nahmen insgesamt 11.398 PatientInnen teil. Bisher gab es auf der Basis einzelner Studien nicht selten zum Teil sich diametral widersprechende Ergebnisse.
20 Studien verglichen die Ergebnisse von Behandlungen, die ausschließlich auf der Basis von klinischen Behandlungspfaden erfolgten mit den Ergebnissen in Krankenhäusern mit normaler Behandlung.
Die jeweils statistisch signifikanten Hauptergebnisse dieser Studien sahen wie folgt aus:
• Die Häufigkeit von Komplikationen wie etwa Wundinfektionen, Blutungen und Pneumonien während eines stationären Aufenthalts wurde um 42% reduziert.
• Eine umfassende Dokumentation der Behandlung erfolgte in Krankenhäusern mit klinischen Behandlungspfaden fast vierzehnmal häufiger als in Krankenhäusern mit traditionellen, nichtstrukturierten Behandlungsabläufen.
• Es gibt keine Anzeichen für für signifikante Unterschiede bei der Wiedereinweisungshäufigkeit oder der Häufigkeit von tödlichen Ereignissen während des Krankenhausaufenthalts.
• Bei dem am häufigsten dokumentierten Indikator der Aufenthaltsdauer gibt es viele Studien, die unter den Bedingungen klinischer Behandlungspfade kürzere Liegezeiten nachwiesen.
• Auch bei den Kosten der Behandlungen finden sich zahlreiche Studien, die erhebliche Kostenunterschiede zwischen den verglichenen Behandlungsmodi zeigen. Je nach Ausgangssituation des Krankenhauses reichte die durch Behandlungspfade erreichte Einsparung von mehreren hundert bis zu mehreren tausend US-Dollar.
• Die beachtliche methodische Heteroegenität derartiger Studien erlaubte es aber nicht, eine aussagekräftige Meta-Analyse zur Aufenthaltsdauer und den Aufenthaltskosten durchzuführen. Die Autoren schlussfolgern daher auch nur sehr zurückhaltend, Behandlungspfad-Behandlung sei "without negatively impacting on length of stay and hospital costs".
Als inhaltliche Beschränkungen ihres Reviews merken die Reviewer selber an, sie hätten weder untersucht, ob niedrigere Krankenhauskosten möglicherweise in andere Behandlungssektoren verschoben werden, noch reichten die wenigen dazu in den Studien berichteten Fakten aus, einzelne Faktoren des Konzepts der klinischen Behandlungspfade als besonders erfolgversprechende nachzuweisen.
Beim Vergleich der Ergebnisse von sieben Studien, bei denen klinische Behandlungspfade zusammen mit anderen Behandlungsformen wie Case-Management etc. zum Einsatz kamen, mit den Ergebnissen der Behandlung mit üblichen Behandlungsformen, zeigten sich interessanterweise bei keinem der untersuchten Leistungsindikatoren signifikanten Unterschiede. Auch bei der Lektüre des gesamten Reviews fanden sich keine substantiellen Hinweise woran dies liegen könnte.
Zu dem 166 Seiten umfassenden Cochrane Intervention Review "Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs." von Rotter T, Kinsman L, James E, Machotta A, Gothe H, Willis J, Snow P und Kugler J. (CochraneDatabase of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art.No.:CD006632.) gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 30.5.10
Falsch-positive Ergebnisse des Lungenkrebs-Screenings per CT und Bruströntgen samt sinnlosen Eingriffen höher als erwartet
 Zu den möglichen unerwünschten und negativ folgenreichen Ergebnissen praktisch aller Früherkennungsuntersuchungen gehören falsch positive und negative Ergebnisse. Je höher der diagnostizierte Anteil von in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Erkrankungen oder von befundlosen Untersuchungen ist, die eine schwere Erkrankung "übersehen", desto gesundheitsabkömmlicher sind die physischen und psychischen Folgen.
Zu den möglichen unerwünschten und negativ folgenreichen Ergebnissen praktisch aller Früherkennungsuntersuchungen gehören falsch positive und negative Ergebnisse. Je höher der diagnostizierte Anteil von in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Erkrankungen oder von befundlosen Untersuchungen ist, die eine schwere Erkrankung "übersehen", desto gesundheitsabkömmlicher sind die physischen und psychischen Folgen.
Dies gilt zusätzlich noch für Untersuchungen, die als Screening empfohlen und durchgeführt werden. Sofern mit der Diagnostik auch noch mehr oder weniger hohe Strahlenbelastungen verbunden sind, droht eine Kumulation gesundheitlicher Risiken, die es dann sehr genau gegen die möglichen gesundheitlichen Vorteilen des Screenings abzuwägen gilt. Dabei spielen natürlich generell auch die ökonomischen Folgen eine wichtige Rolle.
Für viele Screeningangebote zur möglichst frühen Identifizierung von häufigen wie gefährlichen Erkrankungen gibt es bisher lediglich Vermutungen zu den diversen unerwünschten Effekten und damit auch für die sich daraus ergebenden Belastungen von Individuen und Versicherungsgemeinschaften.
Um diesen Zustand zu beenden, untersuchten nun WissenschaftlerInnen im Rahmen der noch laufenden randomisierten kontrollierten "National Lung Screening Trial" wie häufig bei den Untersuchungen von 3.190 früheren und aktuellen Rauchern (teilweise mit einer über 30 Jahre langen "Rauchgeschichte") im Alter von 55 bis 74 Jahren falsch positive oder negative Ergebnisse auftraten. Der Betrachtungszeitraum ob ein Lungenkrebs auftrat oder nicht, erstreckte sich noch auf den Zeitraum von einem Jahr nach der zweiten Screening-Untersuchung.
Die jetzt vorliegende Untersuchung, welche die Effekte zweier im Jahresabstand folgenden CT-Untersuchungen mit geringer Strahlenbelastung und der traditionellen Röntgenuntersuchung des Brustraums zur Existenz von Lungenkrebs bei zuvor nie wegen Lungenkrebs auffällig gewordenen Personen vergleicht, kommt zu einigen quantitativ wie qualitativ unerwarteten Ergebnissen:
• Eine Person, die einmal an einem CT-Screening teilnimmt, hat eine kumulierte Wahrscheinlichkeit von 21%, ein falsch-positives Ergebnis zu erhalten. Nach der Teilnahme an zwei Screeninguntersuchungen steigt die Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise einen Lungenkrebs diagnostiziert zu bekommen auf 33%.
• Neben der psychischen Belastung durch den mehr oder weniger lang anhaltenden Schrecken der irrtümlich gestellten Diagnose erfolgte bei 7% der CT-untersuchten Personen mit falsch-positivem Befund eine mehr oder weniger gravierende invasive Prozedur.
• Falsch positive Ergebnisse erhielten beim ersten Screening mittels Bruströntgen 7 % und nach der Teilnahme an der zweiten Untersuchung 15 % der Untersuchten.
• Und bei immerhin noch 4 % von ihnen folgte dieser Fehldiagnose eine invasive Zusatzdiagnostik (z.B. Bronchoskopie, Biopsie) oder gar eine große Operation.
• Die Studie konzentrierte sich auf die falsch positiven Ergebnisse und vernachlässigte bereits methodisch die Erkennung der tatsächlichen Anzahl der Nichtentdeckung eines tatsächlich vorhandenen Lungenkarzinoms. So wurden die auftretenden falsch negativen Fälle nur zwischen dem ersten und zweiten Sreening genau gezählt und untersucht. Deshalb beurteilen die Forscher den relativ geringen Anteil falsch-negativer Untersuchungsergebnisse in ihrer Untersuchung als eine Unterschätzung dieses Risikos.
Was aus den falschen Ergebnissen im Einzelnen gesundheitlich, psychosozial, ökonomisch und körperlich folgt, empfehlen die AutorInnen nach ihren Funden noch genauer zu untersuchen.
Wichtige Hinweise für Ärzte und PatientInnen, die eine Bewertung des Verhältnisses von Nutzen, Kosten und Wirkungen/Nebenwirkungen von CT- und Röntgenuntersuchungen im Brustbereich vornehmen und auf dieser Basis Entscheidungen treffen wollen, enthält der 13-Seiten-Aufsatz "Cumulative incidence of false-positive test results in lung cancer screening: a randomized trial" von Croswell JM, Baker SG, Marcus PM, et al. in der anerkannten Fachzeitschrift "Annales of Internal Medicine" vom 20. April 2010 (2010 Apr 20;152(8):505-12, W176-80). Sowohl das Abstract als auch den kompletten Aufsatz gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 9.5.10
Fehlverhalten von Ärzten: Zufall, beeinflussbare individuelle Ursachen und gibt es Frühwarnzeichen?
 Egal ob Chirurgen die falsche, also gesunde Niere entfernen oder ihr OP-Besteck im Bauchraum liegen lassen, oder andere Ärzte bekanntermaßen suchterzeugende Arzneimittel wie Benzodiazepine monatelang verordnen, stellt sich die Frage, ob es sich um "Einzelfälle", "schwarze Schafe", um irgendwie menschliches ("to err is human") Verhalten oder um ursächlich erkennbares und damit evtl. auch verhinderbares Fehlverhalten handelt. Entsprechend der Art von Erklärung fallen dann auch Vorschläge aus, derartiges Fehlverhalten zu vermeiden.
Egal ob Chirurgen die falsche, also gesunde Niere entfernen oder ihr OP-Besteck im Bauchraum liegen lassen, oder andere Ärzte bekanntermaßen suchterzeugende Arzneimittel wie Benzodiazepine monatelang verordnen, stellt sich die Frage, ob es sich um "Einzelfälle", "schwarze Schafe", um irgendwie menschliches ("to err is human") Verhalten oder um ursächlich erkennbares und damit evtl. auch verhinderbares Fehlverhalten handelt. Entsprechend der Art von Erklärung fallen dann auch Vorschläge aus, derartiges Fehlverhalten zu vermeiden.
In diese zum Teil hochemotional besetzte Debatte bringt nun eine kleine Studie etwas mehr Licht und Transparenz zu einer speziellen Art möglicher Ursachen.
Zwei an der "Medical Education Unit" der Universität von Nottingham arbeitende Wissenschaftler versuchten nämlich heraus zu bekommen, ob sich Risikofaktoren für ein nachgewiesenes professionelles Fehlverhalten von Ärzten bereits in deren Ausbildungsprozess an einer von acht Medizin-Hochschulen Großbritanniens oder anderen individuellen Umständen finden lassen.
TeilnehmerInnen an der dazu durchgeführten gematchten Fall-Kontrollstudie waren 59 Ärzte, die zwischen 1999 und 2004 wegen eines Fehlverhaltens oder gravierenden professionellen Fehlern ein Verfahren vor dem "General Medical Council (GMC)" laufen hatten. Als Kontrollgruppe dienten 236 Ärzte, die kein Fehlverhaltensverfahren vor dem GMC laufen hatten und aus verschiedenen Entlassjahrgängen der Medizinhochschulen ausgewählt worden waren. Für alle TeilnehmerInnen gab es Angaben zum Studienverhalten aus den StudentInnen-Akten der ausgewählten meduzinischen Hochschulen.
Mit einer logistische Regression wurde geklärt, welche der individuellen Merkmale eine bestimmende Bedeutung als Früherkennungszeichen für die Entstehung eines "Falls" von Fehlverhalten spielten.
Dannach waren "Fälle"
• mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit Männer (odds ratio=9,8. P=0,001),
• Personen, die aus unteren sozialen Schichten stammten bzw. einen niedrigeren sozialen Hintergrund besitzen (OR=4,3; p=0,006 und
• jene Personen, die speziell in den ersten Semestern ihres Studiums Lernschwierigkeiten bis hin zum Versagen bei ersten Prüfungen oder vorklinischen Prüfungen (OR=5,5; p=<0,001) hatten.
Die Forscher warnen vor vorschnellen und vor allem abschließenden Interpretationen ihrer Ergebnisse und heben hervor, dass diese Ergebnisse lediglich sensibilisieren und eine weitere Debatte auf inhaltlich breiterer Basis eröffnen helfen sollen. Ferner kämen die meisten Ärzte, für die die genannten "Risikofaktoren" zutreffen, niemals vor einen der Untersuchungsausschüsse des GMC - weil bei ihnen auch kein Fehlverhalten auftritt.
Mit Sicherheit sind individuelle Faktoren für ärztliche Behandlungsirrtümer und -pannen mit verantwortlich, müssen aber auch noch gründlicher und repräsentativer bei einer größeren Anzahl von Ärzten unter Berücksichtigung weiterer und anderer Merkmale untersucht werden. Erst dann könnten die Ergebnisse so prädiktiv sein, dass ein sicherlich komplexes Präventionsprogramm angedacht werden kann, dass bereits im Studium ansetzen muss. Trotz des beeindruckenden Ergebnisses ist dabei sicherlich der Ausschluss von MedizinstudentInnen aus Arbeiter- oder Angestelltenfamilien oder die Förderung von Arztdynastien kein sinnvoller Weg.
In der vorliegenden Studie werden aber leider auch nicht noch gleichzeitig und integriert die Strukturbedingungen der Arbeit in Arztpraxen oder Krankenhäuser mit untersucht und berücksichtigt. Sie in Kombination mit individuellen Merkmalen können wahrscheinlich erst eine vollständigere Erklärung für das zum Teil für die betroffenen Patienten folgenreiche Versagen von Ärzten liefern. Dazu gehören z.B. fehlende Sicherheitskontrollen, fehlende oder zu simple obligatorische Fehler-Checklisten, die nachwievor oft eminenzbasierten Behandlungsroutinen mit der Tendenz zur Nicht-Thematisierung und -Kommunikation von Fehlern, eine nicht existierende oder mangelhafte Fehlerkultur oder nicht zuletzt die schlechte Ergonomie im Operationssaal.
Der Aufsatz "Risk factors at medical school for subsequent professional misconduct: multicentre retrospective case-control study" von Janet Yates und David James ist am 27. April 2010 im "British Medical Journal" (BMJ 2010;340:c2040) erschienen und als Abstract wie als kompletter Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.5.10
Leitlinien zur Händehygiene in Krankenhäusern nur wirksam bei aktiver Implementierung
 Als eine der unbestrittenen Ursachen zahlreicher schwerer bis tödlicher Infektionen bei KrankenhauspatientInnen gilt die fehlende oder mangelhafte Händehygiene von Ärzten, Pflegekräften und auch PatientInnen. Lange Zeit glaubte man, das Problem durch Appelle an ethische oder professionelle Grundsätze wie dem des "zuerst einmal nicht schaden (primum non nocere)" oder an den Reinlichkeitssinn bewältigen zu können. Studien im Ausland wie in Deutschland zeigten einerseits, dass Hygienemaßnahmen und darunter Händehygiene wirksame Maßnahmen zur Prävention zahlreicher Krankenhausinfektionen (darunter auch mit multiresistenten Erregern) sind. Andererseits weist aber der aktuellste HTA-Bericht (Korczak/Schöffmann 2010) auf die "irritierend … stark unterschiedlichen Complianceraten" (S. 1) bei der Händehygiene hin, die sich negativ auf die Gesamtwirkung auswirken dürfte. Frühere Studien zeigen, dass diese mangelnde Hygiene aus Sicht der Handelnden auf einer Reihe gewichtiger Faktoren beruht. Einer der genannten Gründe für die mangelnde Compliance war die mangelnde wissenschaftliche Gewissheit über den Nutzen von mehr Händehygiene im Verhältnis zu dem für sie notwendigen Aufwand.
Als eine der unbestrittenen Ursachen zahlreicher schwerer bis tödlicher Infektionen bei KrankenhauspatientInnen gilt die fehlende oder mangelhafte Händehygiene von Ärzten, Pflegekräften und auch PatientInnen. Lange Zeit glaubte man, das Problem durch Appelle an ethische oder professionelle Grundsätze wie dem des "zuerst einmal nicht schaden (primum non nocere)" oder an den Reinlichkeitssinn bewältigen zu können. Studien im Ausland wie in Deutschland zeigten einerseits, dass Hygienemaßnahmen und darunter Händehygiene wirksame Maßnahmen zur Prävention zahlreicher Krankenhausinfektionen (darunter auch mit multiresistenten Erregern) sind. Andererseits weist aber der aktuellste HTA-Bericht (Korczak/Schöffmann 2010) auf die "irritierend … stark unterschiedlichen Complianceraten" (S. 1) bei der Händehygiene hin, die sich negativ auf die Gesamtwirkung auswirken dürfte. Frühere Studien zeigen, dass diese mangelnde Hygiene aus Sicht der Handelnden auf einer Reihe gewichtiger Faktoren beruht. Einer der genannten Gründe für die mangelnde Compliance war die mangelnde wissenschaftliche Gewissheit über den Nutzen von mehr Händehygiene im Verhältnis zu dem für sie notwendigen Aufwand.
Diese Gewissheit vermitteln nun bereits seit Jahren evidenzbasierte Leitlinien zur Händehygiene, die es in den USA nicht nur seit 2002 gibt, sondern die dort auch bereits flächendeckend eingesetzt wurden. Die von den US-"Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" entwickelte Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings gilt als eine der ersten umfassenden (56 Seiten) und wissenschaftlich gründlichen Leitlinien. Darin wird auch bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, ihre Umsetzung am besten im größeren Rahmen einer Sicherheitskultur zu organisieren. Von internationaler Bedeutung sind die 2009 veröffentlichten WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is Safer Care. Auf einem Teil der 270 Seiten dieser Leitlinie beschäftigen sich auch deren Verfasser damit, wie man die Implementierung und die Wirkung solcher wissenschaftlich eindeutig nützlicher und machbarer Handlungsempfehlungen gewährleistet. Danach soll die Händehygiene in die allgemeine Debatte über Indikatoren für Leistung, Ergebnisqualität oder soziales Marketing von Gesundheitseinrichtungen eingebettet werden.
Wie zutreffend und praktisch notwendig solche Hinweise sind, zeigt das Kernergebnis der ersten Studie über die Implementierung der CDC-Leitlinie in US-amerikanischen Krankenhäusern: Von einer schlichten Implementierung als zusätzlichem Informations- oder Wissensangebot darf nicht allzu viel erwartet werden. Die in 40 Krankenhäusern durchgeführte Studie verglich die Raten der versorgungsbedingten Infektionsraten ein Jahr vor und nach der Publikation der Leitlinienempfehlungen. Hierbei war hilfreich, dass die 40 Krankenhäuser Mitglieder des "National Nosocomial Infections Surveillance System" in den USA waren, also sogar deutlich mehr für das Problem der Prävention von Krankenhausinfektionen sensibilisiert waren als der Großteil der Krankenhäuser. Zusätzlich untersuchten die ForscherInnen u.a. durch Befragungen auch sonstige Veränderungen in den Kliniken, die sowohl Folgen als auch Bedingungen für den Erfolg der Leitlinienimplementation sein können. Ergänzt wurde das Bild durch die direkte Beobachtung der Leitlinientreue.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
• Alle Krankenhäuser hatten ihre ausformulierten Hygienegrundsätze der Leitlinie angepasst und auch eine Reihe leitliniengerechter Instrumente und Produkte entwickelt und bereit gestellt.
• Fast 90% der dazu anonym befragten MitarbeiterInnen sagten, sie seien mit den Leitlinien vertraut.
• Auf einer Bewertungsskala für Implementationen erreichte die Händehygiene-Leitlinie 10,5 von 12 maximal möglichen Punkten. Für die Bewertung spielten allerdings Struktur- und Prozessindikatoren wie z.B. die Erhältlichkeit von alkoholischen Mitteln zur Händeinfektion oder die Existenz von Schulungsprogrammen die vorrangige Rolle und lediglich nachrangig Indikatoren für die Ergebnisqualität.
• In 44,2% (19 von 40) der Krankenhäuser existierte aber dennoch kein nachweisbares Programm, das unter Einbeziehung aller Akteure oder Disziplinen die Leitlinientreue verbessern helfen sollte.
• Die Handhygieneraten verharrten bei durchschnittlich 56,6%.
Bei den erhobenen Wirkungen der Handhygiene gab es uneinheitliche Ergebnisse: Die Infektionen durch Arterienkatheter waren in Krankenhäusern mit hohen Handhygieneraten hochsignifikant besser als in Häusern mit niedrigen Raten. Auf alle anderen Möglichkeiten von Behandlungsinfektionen wirkte sich die Implementation der Leitlinie oder der Stand der Händehygiene nicht aus.
Weder die aufwändige und praktikerfreundliche (z.B. Kurzversionen oder so genannte "Kitteltaschen-Versionen") Verbreitung der Leitlinie in den untersuchten Krankenhäusern noch relativ umfangreiche Schulungsmaßnahmen haben allein weder zu multidisziplinären Verbesserungsbemühungen noch zum erhofften Erfolg bei der Senkung von Infektionsraten geführt. Die ForscherInnen sind der Meinung, dass derartige Hygieneleitlinien nur dann ihre unbestrittene Wirksamkeit erreichen können, wenn es multidisziplinär abgestimmte Bemühungen gibt, die Umsetzung so aktiv und vielfältig wie möglich erfolgt und die Umsetzung administrativ und von den leitenden Akteuren aktiv unterstützt wird.
Jüngste Erfahrungen (Schnoor, Maike; Schäfer, Tobias; Welte, Tobias: Leitlinien: Aktive Implementierung zeigt Wirkung (Deutsches Ärzteblatt 2010; 107(12): A-541 / B-472 / C-646;) mit der Implementierung der S3-Leitlinie "Infektionen der unteren Atemwege" innerhalb einer randomisierten kontrollierten Studie an deutschen Krankenhäusern, verweisen für ihr Sachgebiet ebenfalls auf geringere Wirkungen als erwartet wurden. Auch hier werden aber eine bessere Implementierung und höhere Wirkungen erst von einer besonderen, aktiven Form und intensiveren Maßnahmen wie Audits und Qualitätszirkeln erwartet.
Der HTA-Bericht von Korczak und Schöffmann unterstreicht dies für die Prävention der MRSA-Infektionen und schlägt z.B. eine multimodale Kombination von individualisierten Screenings, Schulungen und eines Antibiotika-Managements vor. Ob damit aber die gewünschten und notwendigen Ergebnisse erreicht werden können, kann wegen der bisher fehlenden Evaluation kombinierter Präventions- und Kontrollmaßnahmen nicht verlässlich gesagt werden.
Hier ist ein Abstract: Elaine L. Larson, Dave Quiros und Susan X. Lin (2007): Dissemination of the CDC's Hand Hygiene Guideline and impact on infection rates (American Journal of Infection Control Volume 35, Issue 10: 666-675)
Hier ist die Studie von Korczak/Schöffmann als Volltext: Dieter Korczak, Christine Schöffmann (2010): Medizinische Wirksamkeit und Kosten-Effektivität von Präventions- und Kontrollmaßnahmen gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Infektionen im Krankenhaus (HTA-Schriftenreihe Bd. 100. Köln)
Bernard Braun, 30.4.10
"Gesunde Normalität" oder wie (lebens)-gefährlich sind sekundärpräventive "Idealwerte"? - Das Beispiel Diabetes und HbA1c-Wert
 Mehrere Studien haben in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass das sekundärpräventive Erreichen bisher für erstrebenswert gehaltener Parameter nicht nur nicht den erwarteten Erhalt oder Zugewinn an Gesundheit mit sich brachte, sondern sogar Nachteile bei Morbidität, Mortalität und Lebensqualität. Dies gilt beispielsweise für den Body Mass-Index (BMI). Statt des lange für optimal gehaltenen BMI-Wert von 25 und weniger wird jetzt sogar ein leichtes bis mittleres Übergewicht mit einem BMI-Wert zwischen 25 und 29,9 als gesünderer Zielwert angesehen (vgl. hierzu u.a. einen Studienbericht im Forum Gesundheitspolitik aus dem Jahr 2009).
Mehrere Studien haben in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass das sekundärpräventive Erreichen bisher für erstrebenswert gehaltener Parameter nicht nur nicht den erwarteten Erhalt oder Zugewinn an Gesundheit mit sich brachte, sondern sogar Nachteile bei Morbidität, Mortalität und Lebensqualität. Dies gilt beispielsweise für den Body Mass-Index (BMI). Statt des lange für optimal gehaltenen BMI-Wert von 25 und weniger wird jetzt sogar ein leichtes bis mittleres Übergewicht mit einem BMI-Wert zwischen 25 und 29,9 als gesünderer Zielwert angesehen (vgl. hierzu u.a. einen Studienbericht im Forum Gesundheitspolitik aus dem Jahr 2009).
Eine Studie aus dem Jahr 2008 (ACCORD), über deren Ergebnisse zu den Wirkungen der so genannten intensivierten Insulintherapie von DiabetikerInnen wir ebenfalls schon berichteten, hatte für diese Behandlungsvariante einen signifikant höheren Anteil unerwünschter Folgen gezeigt.
In mehreren aktuellen Studien über den für Diabeteskranke wichtigen sog. Blutzuckergedächtniswert HbA1c wurde nun untersucht, ob die Praxis, den langjährig und für viele Diabetiker wie ihre behandelnden Ärzte auch heute noch für ideal gehaltenen Wert von 6,5% oder sogar niedrigere Werte anzustreben, gesundheitlich unerwünschte Folgen hat.
Dazu wurden aus der "UK General Practice Research Database" für den Zeitraum von Ende 1986 bis Ende 2008 zwei Gruppen von Diabetes Typ 2-Kranken im Alter von 50 und mehr Jahren gebildet: 27.965 Personen stark war eine Gruppe von PatientInnen, deren Diabetesbehandlung mit mehreren oralen Arzneimitteln erfolgte und 20.005 wurden unter Einbezug von Insulin behandelt. Multimorbide Personen wurden aus der Studie ausgeschlossen. Die TeilnehmerInnen an dieser retrospektiven Kohortenstudie wurden nach nach den als Confoundern angesehenen Merkmalen Alter, Geschlecht, Raucherstatus, Cholesterinwert, kardiovaskulärem Risiko und dem allgemeinen Gesundheitszustand adjustiert, was bedeutet, dass diese Einflussfaktoren beim Ergebnis keine Rolle mehr spielen.
Die Berechnung der sogenannten adjustierten Risikorate (hazard ratio) für die Gesamtsterblichkeit führte zu folgenden Ergebnissen:
• Die 10% StudienteilnehmerInnen mit einem HbA1c-Wert unter 6,7% hatten eine höhere Sterblichkeitsrate als die DiabetikerInnen mit einem Wert zwischen 6,8% und 9,9%.
• Ihre Sterblichkeitsrate war in etwa so hoch wie die der Personen mit dem aus diabetologischer Sicht tatsächlich katastrophalen HbA1c -Wert von 10 und mehr Prozent.
• Kardiovaskuläre Erkrankungen wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall waren in der Personengruppe mit dem niedrigsten HbA1c-Wert sogar häufiger als in allen anderen Teilgruppen mit höheren Werten.
• Verglichen mit der Personengruppe mit einem HbA1c-Wert von 7,4 bis 7,7% hatten die mit Insulin behandelten DiabetikerInnen ein höheres Sterberisiko (1,79) als die mit oralen Antidiabetika behandelten Personen (1,30).
• Auch in dieser bisher zahlenmäßig größten Studie zu unerwünschten Effekten von bisher als ideal betrachteten Werten betrachten die Forscher das mit dem Erreichen dieses Wertes verbundene Risiko von Unterzuckerung bis hin zum Unterzuckerungskoma als Hauptgrund für die erhöhte Sterblichkeit.
Auch wenn die Forschergruppe auf viele methodische Einschränkungen ihrer Studie hinweist, ist ihre Schlussfolgerung, man müsse den Zielwert revidieren, von hoher praktischer Relevanz und Dringlichkeit. Auch wenn also aus methodischen Gründen keine kausalen Schlüsse möglich sind, sollten künftig die genannten aber auch andere scheinbar selbstevidenten oder plausiblen Idealwerte und Zielgrößen (noch) kritischer betrachtet und systematisch auf ihre möglicherweise auch unerwünschten Wirkungen hin untersucht werden. Dies gilt nach dieser und den Vorläuferstudien eindeutig für den bisher "idealen" HbA1c-Minimalwert.
Zu dem im britischen Medizin-Journal "Lancet" erschienenen Aufsatz "Survival as a function of HbA1c in people with type 2 diabetes: a retrospective cohort study" von Craig J Currie et al. (The Lancet, Volume 375, Issue 9713, Pages 481 - 489) gibt es nur ein kostenloses Abstract.
Bernard Braun, 1.4.10
Elektronisches Erinnerungssystem für Ärzte: Teure Versuch-und-Irrtum-Übung oder nützliche Vehaltenshilfe?
 Informationstechnik erscheint vielen Akteuren im Gesundheitswesen im Angesicht von Personalnot oder Qualifikationsmängeln von Ärzten und Pflegepersonal eine Art Allzweckwaffe und Erfolgsgarant zu sein. So verbreiten sich weltweit in Krankenhäusern oder Arztpraxen elektronische Systeme, die Daten aus der gesundheitlichen Versorgung dokumentieren und z.B. im Falle der Verordnung von Arzneimitteln auch qualitative Hinweise auf mögliche Kontraindikationen und preiswertere Mittel geben - kurz: das Verhalten von Ärzten und anderen Akteuren im Gesundheitswesen qualitativ beeinflussen oder steuern.
Informationstechnik erscheint vielen Akteuren im Gesundheitswesen im Angesicht von Personalnot oder Qualifikationsmängeln von Ärzten und Pflegepersonal eine Art Allzweckwaffe und Erfolgsgarant zu sein. So verbreiten sich weltweit in Krankenhäusern oder Arztpraxen elektronische Systeme, die Daten aus der gesundheitlichen Versorgung dokumentieren und z.B. im Falle der Verordnung von Arzneimitteln auch qualitative Hinweise auf mögliche Kontraindikationen und preiswertere Mittel geben - kurz: das Verhalten von Ärzten und anderen Akteuren im Gesundheitswesen qualitativ beeinflussen oder steuern.
Anders als Fachliteratur, Handbücher oder schriftliche Leitlinien wird mit elektronischen Informationssystemen die Erwartung verknüpft "just in time", d.h. in der konkreten Behandlungssituation am Krankenbett oder im Behandlungszimmer Zugriff auf eine "Patientenakte" mit sämtlichen relevanten Daten zu haben und sie unmittelbar und nur zum Nutzen der Patienten einzusetzen.
Noch ausgeklügelter und noch nützlicher versprechen dabei ausgeklügelte und intelligente Informationssysteme zu sein, die z.B. den Arzt in jeder denkbaren Versorgungssituation eines konkreten Patienten oder in der Vorbereitung auf einen Kontakt mit dem Patienten an notwendige Aktivitäten oder Abklärungen erinnern bzw. darauf hinweisen, etwas zu unterlassen.
Ob diese so genannten "point-of-care computer reminders" wirklich Einfluss auf das Handeln von Ärzten haben, wurde bisher aber nicht systematisch erforscht.
Um nicht der natürlich rundum positiven Bewertung aus Hersteller-Hochglanzprospekten ausgeliefert zu sein, führten kanadische und britische Wissenschaftler jetzt einen systematischen Review der zwischen 1950 und Mitte 2008 durchgeführten Forschungsarbeiten durch. Im Mittelpunkt des Reviews der am Ende 28 in das Reviewverfahren aufgenommenen randomisierten oder quasi-randomisierten Studien (insgesamt wurden 2.036 Studien gefunden, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt hatten) stand die Frage, wie großdie damit erreichten und nachgewiesenen Verbesserungen im Versorgungsprozess und der Einfluss auf das Verhalten von Ärzten waren. Klinische Ergebnisse standen dagegen nicht im Mittelpunkt der reviewten Studien.
Generell waren die Verbesserungen deutlich kleiner als die Erwartungen mit denen derartige elektroniscxhen Systeme angeschafft werden.
Im Einzelnen gab es folgende Ergebnisse:
• Die elektronischen Erinnerungen verbesserten die Therapietreue der Ärzte um durchschnittlich 4,2%.
• Die Verbesserungen waren interessanterweise nicht größer als bei den Ärzten, die in Papierform, also mehr oder weniger weit weg von konkreten Behandlungssituationen erinnert wurden.
• Wenn man bei jeder Studie nur das beste Ergebnis berücksichtigt, verbesserte sich die durchschnittliche Prozessqualität auch nur relativ wenig auf 5,6%.
• Eine Minderheit der Studien berichtete größere Wirkungen des Remindersystems. Trotzdem gab es mit einer Ausnahme weder in diesen noch den anderen Studien Charakteristika des Remindersystems oder ein bestimmtes methodisches Design, das die Größe des Effekts angezeigt hätte.
• Nur in einer Studie und dem dort untersuchten Krankenhaus-Informationssystem hab es wesentlich größere Verbesserungen als bei den anderen Konmstellationen. Dabei handelt es sich um die Effekte eines gutentwickelten und hauseigenen ("homegrown") Systems, das gegenüber der Normalbehandlung zu einer signifikanten Verbesserung um 16,8% führte.
• Schließlich ist der Effekt dort größer (12,9%) wo ein Erinnerungssystem im Einsatz ist, dessen Meldungen der Nutzer bestätigen muss.
Angesichts dieser Ergebnisse und der trotz des IT-Booms nicht gerade üppigen Forschungslage zur Wirkung dieses technischen Fortschritts, warnen die AutorInnen nachdrücklich davor, dass "these expensive technologies will constitute an expensive exercise in trial and error". Wahrscheinlich gilt dies auch für eine Reihe vergleichbarer medizinisch-technischen Neuerungen.
Untersucht werden sollte in weiteren Studien, warum sich Ärzte trotz verbreiteter Euphorie über die "Möglichkeiten der neuen Technik" diese Ressourcen offensichtlich nicht so stark wie erwartet für ihr Verhalten nutzen. Wenn es gelingt die Euphorie auf ein deutlich niedrigeres Niveau abzusenken, sollte überlegt werden, ob und mit welchen anderen Mitteln zusätzlich das Behandlungsverhalten bedarfsgenau und so zielstrebig wie möglich gesteuert werden kann.
Der Aufsatz "Effect of point-of-care computer reminders on physician behaviour: a systematic review von Kaveh G. Shojania, Alison Jennings, Alain Mayhew, Craig Ramsay, Martin Eccles und Jeremy Grimshaw ist im kanadischen Medizinjournal CMAJ (23. März 2010; 182 (5)) erschienen und kostenlos komplett erhältlich.
Bernard Braun, 24.3.10
Zunahme der bildgebenden Diagnostik: Unerwünschte Strahlenbelastungen und geringer Nutzen gegen Fehldiagnosen. Lösung in den USA?
 Ohne dass es lückenlose und uneingeschränkte Nachweise der Notwendigkeit und des Nutzens gibt, wächst die Anzahl der Verfahren der bildgebenden Diagnostik und darunter besonders auch der mit einer Röntgenstrahlenexposition verbundenen Verfahren in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahren stetig an.
Ohne dass es lückenlose und uneingeschränkte Nachweise der Notwendigkeit und des Nutzens gibt, wächst die Anzahl der Verfahren der bildgebenden Diagnostik und darunter besonders auch der mit einer Röntgenstrahlenexposition verbundenen Verfahren in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahren stetig an.
Der aktuellste Bericht zu dieser Entwicklung, der im Dezember 2008 erschienene "Jahresbericht 2007 Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung" des Bundesamtes für Strahlenschutz stellt in seinem Hauptabschnitt über den medizinischen Beitrag zum Problem trotz einer Reihe methodischer Probleme und Skrupel folgende ZUstände und Tendenzen dar:
• Zur Generaltendenz: "Der größte Beitrag zur zivilisatorischen Strahlenexposition wurde durch die Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in der medizinischen Diagnostik verursacht. Insbesondere der Beitrag der Röntgendiagnostik zur effektiven Dosis ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Wesentliche Ursache für die Zunahme ist die steigende CT-Untersuchungshäufigkeit. Von daher bleibt in diesem Bereich Handlungsbedarf weiterhin angezeigt."
• Tendenz des klassischen Röntgen: "Für das Jahr 2005 wurde für Deutschland eine Gesamtzahl von etwa 132 Millionen Röntgenuntersuchungen abgeschätzt (ohne zahnmedizinischen Bereich: etwa 84,5 Mio. Röntgenuntersuchungen). Die Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen in Deutschland während des betrachteten Zeitraums 1996 bis 2005 nahm leicht ab, wobei der Wert für das Jahr 2005 bei etwa 1,6 Röntgenuntersuchungen pro Einwohner und Jahr liegt." 1996 betrug dieser Wert 1,8.
• Tendenz des "modernen" Röntgen=Computertomographie: "In der Trendanalyse am auffälligsten ist die stetige Zunahme der Computertomographie(CT)-Untersuchungen - insgesamt um nahezu 80% über den beobachteten Zeitraum." Die Häufigkeit stieg von rund 0,06 (1996) auf rund 0,11 (2005) CT-Untersuchungen pro Einwohner und Jahr.
• Bildgebende Verfahren ohne Röntgenexposition: "Ein erheblicher Anstieg ist auch bei den "alternativen" bildgebenden Untersuchungsverfahren, die keine ionisierende Strahlung verwenden, zu verzeichnen, insbesondere bei der Magnetresonanztomographie (MRT)." Der Anstieg von 1996 auf 2005 erfolgte von 0,02 auf 0,08 Untersuchungen pro Einwohner und Jahr.
• Zu den Strahlenbelastungseffekten: Unter verschiedenen Annahmen "beläuft sich die - rein rechnerische - effektive Dosis pro Einwohner in Deutschland für das Jahr 2005 auf ca. 1,8 mSv und stieg damit über den Beobachtungszeitraum nahezu kontinuierlich an. Der festgestellte Dosisanstieg ist im Wesentlichen durch die Zunahme der CT-Untersuchungshäufigkeit bedingt."
• Wo steht Deutschland international?: "Im internationalen Vergleich liegt Deutschland nach den vorliegenden Daten bezüglich der jährlichen Anzahl der Röntgenuntersuchungen pro Einwohner und Jahr im oberen Bereich." In Ländern wie den USA betrug die effektive Dosis pro Kopf in den USA im Jahr 2006 3,2 mSv.
• Was tun?: "Darüber hinaus ist es weiterhin erforderlich, bei der Ärzteschaft ein Problembewusstsein für eine strenge Indikationsstellung unter Berücksichtigung der Strahlenexposition der Patienten zu schaffen."
Dem gesundheitspolitikfernen Bundesamt ist es nicht übel zu nehmen, dass es bei Appellen an das "Problembewusstsein" und bei den technischen Möglichkeiten der Röntgenverordnung verharrt, die Strahlenexposition zu reduzieren.
Außerdem stellt sich auch hier die Frage warum zu diesem quantitativ und qualitativ relevanten gesundheitsbezogenen Geschehen nicht die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) die Daten liefert und sich auf dieser Datenbasis verstärkt um die wahrscheinliche diagnostische Über- oder Fehlversorgung kümmert?
Um über andere, ausdrücklich gesundheitspolitische Methoden und deren Wirksamkeit Genaueres zu erfahren, muss man schon in die USA schauen. Angesichts der gerade genannten sehr hohen Strahlenbelastung und den damit auch noch verbundenen hohen Gesundheitsausgaben ist es nicht verwunderlich, dass dort bereits vor mehreren Jahren versucht wurde, die Zunahme aller bildgebenden und besonders der röntgenbasierten Verfahren zu stoppen und den Trend u.U. umzukehren.
Ob es dort gelungen ist eine wirksame Lösung zu finden und wodurch, arbeitet nun ein im Januar 2010 in der renommierten US-Public Health-Zeitschrift "Health Affairs" erschienener Aufsatz akribisch auf.
Zu den wesentlichen Daten und Einflussfaktoren der Untersuchung gehören:
• Zwischen 2000 und 2005 nahm die Anzahl der bildgebenden Untersuchungen für die ambulante Behandlung mit so genannten entwickelten diagnostischen Bildverfahren (MRT, CT und Nuklearmedizin - hier vor allem die Positronenemissionstomographie PET) für Medicare-Versicherte um 72,7% zu (von 365,7 Untersuchungen pro 1.000 Versicherte auf 631,4 Untersuchungen pro 1.000 Versicherte). Die jährliche durchschnittliche Wachstumsrate war mit 11,3% bei MRT-Untersuchungen am höchsten, dicht gefolgt von der Nuklearmedizin mit 10,7% und der CT mit 9,2%.
• Während die Zunahme der Häufigkeit bildgebender Diagnostik in ambulanten Praxen (inklusive alleinstehende Diagnosezentren bzw. "imaging centers") von 2000 bis 2006 jährlich rund 15,4% betrug, stieg derselbe Indikator in ambulanten Einrichtungen innerhalb von Krankenhäusern lediglich um 6,1% pro Jahr.
• Mit dem "Deficit Reduction Act (DRA)" von 2005, der allerdings voll erst mit dem Beginn des Jahres 2007 wirkte, versuchte die US-Regierung diese Entwicklung in ambulanten Praxen zu bremsen. Das Gesetz enthält aber keine direkten Blockaden des Zugangs der Versicherten zu diesen Leistungen.
• Bereits 2006 und dann vor allem 2007 verringerte sich die Zunahme der bildgebenden Untersuchungen beträchtlich: Das jährliche Wachstum betrug bei allen drei Verfahren zusammen nur noch 1,7% pro Jahr. Dahinter steigt ein Wachstum von 4,3% bei CTs, von 1% bei MRTs aber ein Minuswachstum von 0,8% bei nukleartechnischen Verfahren.
• Sieht man sich insbesondere die Entwicklung im Jahr 2007 nach Art des Leistungserbringern an, steigt die Rate aller Untersuchungen pro 1.000 Medicareversicherten in privaten Praxen um 2,8% und in ambulanten Einrichtungen in Krankenhäusern um gerade einmal 0,4% an. Dies ist insofern ein paradoxes Ergebnis, weil der erwartete Anreiz des DRA vor allem zu einem Rückgang bei den privaten Praxen führen sollte. Gegen eine Stagnation oder gar einen Rückgang der Untersuchungsrate in Krankenhäusern hätte auch gesprochen, dass ein Teil des bisher ambulanten Diagnostikgeschehens wegen der Schließung ambulanter Einrichtungen in die Krankenhäuser hätte wandern müssen.
• Da damit der DRA nicht mehr der einzige oder entscheidende Faktor für die Stagnation der Zunahme zu sein scheint, fragen die Forscher nach anderen Ursachen. Sie halten generell mehrere Erklärungen für möglich. Dazu zählen das Aufkommen von so genannten "radiology business management companies", die besonders hart die Notwendigkeit des Einsatzes bildgebender Verfahren überprüfen und evtl. auch das Bewusstsein für die Angemessenheit derartiger Untersuchungen schärfen. Eine weitere mögliche Erklärung ist der verbesserte Zugang zu fachlichen Kriterien, mit denen sich Ärzte die Angemessenheit einer bildgebenden Diagnostik vergegenwärtigen können.
• Selbst wenn die Abnahme der Zunahme ("slowdown") auch nach 2007 anhält, handelt es sich um eine anhaltende Stagnation auf dem erreichten hohen Niveau. Bei der Nutzung dieser Untersuchungen dürfte es sich daher immer noch um eine Menge Überversorgung oder angesichts der Strahlenrisiken auch um Fehlversorgung handeln.
Im Zusammenhang mit der Einführung innovativer bildgebender Verfahren sind aber nicht nur die Menge, der Preis und die Strahlenbelastung zu hinterfragen, sondern auch der tatsächlich mit den neuen Verfahren zusätzlich zu realisierende Nutzen.
Dass auch hier die Formel "neu-teuer-gut-nützlich" nicht uneingeschränkt gilt, zeigten u.a. zwei Studien einer deutschen Forschergruppe. Dieser untersuchten bereits Mitte der 1990er Jahre für die Jahre 1959, 1969, 1979 und 1989 und dann erneut für die Jahre 1999/2000, also während der alten Röntgenzeit und der Einführungszeit von CT, MRT, Ultraschall und weiteren Verfahren, via Obduktion die Entwicklung der Raten klinischer Fehleinschätzungen an einer Universitätsklinik. Diese Ergebnisse beruhten auf den Autopsiedaten von jeweils 100 zufällig ausgewählten und im Krankenhaus oder kurz danach verstorbenen PatientInnen.
Ernüchterndes Ergebnis: Die Verbesserung der Diagnostik hat die Raten der Fehldiagnosen, des Übersehens der Grundkrankheit, irrtümlich gestellter Diagnosen und übersehener anderer Krankheiten nicht nennenswert beeinflusst.
Im Einzelnen:
• Die Rate von 11% Fehldiagnosen veränderte sich während der gesamten Untersuchungszeit nicht.
• Die Häufigkeit falsch negativer Diagnosen stiegen sogar von 22% im Jahr 1979 auf 34% und 41% in den Jahren 1989 und 1999/2000.
• Die Häufigkeit von falsch positiven Diagnosen stieg ebenfalls vom Jahr 1989 bis zum Jahr 1999/2000 von 7% auf 15%.
• Zu den verbreitetsten und häufigsten Diagnoseirrtümern gehörte im Jahr 1999/2000 wie in den Vorjahren Lungenembolien, Myokardinfarkte, Neubildungen und Infektionen.
Interessante Ergebnis am Rande und auch ein Beitrag zur Debatte über den Nutzen neuer Techniken:
• Die gründliche Erhebung der Erkrankungs- und Behandlungsgeschichte der Patienten und die einfache körperliche Untersuchung hatten durchweg eine wichtige diagnostische Bedeutung. Mit diesen Methoden gelangten die nur so diagnostizierenden Ärzte in 75% der Fälle zu einer korrekten Diagnose.
• Die Autopsierate sank von 88% im Jahr 1959 auf 20% im Jahr 1999/2000. Dies bewerten die Autoren als enorme Beschränkung der Möglichkeiten für Ärzte, aus Fehlern zu lernen. Es könnte aber auch Ausdruck der vermessenen und mit Sicherheit unbegründeten Überzeugung sein, keine Fehler zu machen.
Der erste Aufsatz "Misdiagnosis at a University Hospital in 4 Medical Eras: Report on 400 Cases" von Wilhelm Kirch und Christine Schafii erschien in der Zeitschrift "Medicine" (January 1996; Volume 75, Issue 1: 29-40) und hat weder einen freien Zugang zum Abstract noch zum kompletten Text.
Der zweite Aufsatz bzw. die Fortsetzung der Beobachtungszeitpunkte des Autorenteams "Health care quality: Misdiagnosis at a university hospital in five medical eras. Autopsy-confirmed evaluation of 500 cases between 1959 and 1999/2000: a follow-up study" von Wilhelm Kirch, Fred Shapiro und Ulrich R. Fölsch erschien im "Journal of Public Health" (Volume 12, Number 3 / June, 2004: 154-161) und von ihm ist kostenlos das Abstract zugänglich.
Von der Studie "Physician Orders Contribute To High-Tech Imaging Slowdown" von David C. Levin, Vijay M. Rao und Laurence Parker in der Zeitschrift "Health Affairs" (29, no. 1 (2010): 189-195) gibt es leider nur ein Abstract. Da die Zeitschrift seit Januar 2010 auch ein etwas aufgelockerteres Layout hat, ist Interessenten an der US-Gesundheitspolitik und -wissenschaft aber auch allen Anderen ein Abonnement als "individual" empfohlen, das zumindest normal bezahlte Beschäftigte nicht überfordert.
Der 308-Seiten-Bericht "Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung. Jahresbericht 2007" wird seit Anfang des Jahrhunderts vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) herausgegeben, ist vom Bundesamt für Strahlenschutz erstellt und kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 2.2.10
USA: Beratende Sachverständige für HPV- und Schweinegrippe-Impfung hatten mehr Interessenkonflikte als Unabhängigkeit
 Als die dafür zuständigen staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" im Jahr 2007 u.a. Berater bzw. "special Government employees (SGE)" in die Beratungsgremien ("Federal advisory committees (committees)" beriefen, welche die Gesundheitsbehörden bei der Einführung solch wichtiger, teurer und möglicherweise folgenreicher Interventionen wie der HPV-Impfung gegen Zervikalkrebs sowie der Gestaltung des aktuellen Schweinegrippe-Impfprogramms beraten und bewerten sollten, machten sie in den Worten eines gerade in der "New York Times" vom 17. Dezember 2009 erschienene Analyse "a poor job".
Als die dafür zuständigen staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" im Jahr 2007 u.a. Berater bzw. "special Government employees (SGE)" in die Beratungsgremien ("Federal advisory committees (committees)" beriefen, welche die Gesundheitsbehörden bei der Einführung solch wichtiger, teurer und möglicherweise folgenreicher Interventionen wie der HPV-Impfung gegen Zervikalkrebs sowie der Gestaltung des aktuellen Schweinegrippe-Impfprogramms beraten und bewerten sollten, machten sie in den Worten eines gerade in der "New York Times" vom 17. Dezember 2009 erschienene Analyse "a poor job".
Dieses herbe Urteil stützt sich auf einen 54 Seiten umfassenden Bericht des Inspector General des "Department of Health and Human Services (HHS)" der USA, Daniel Levinson, der am selben Tag erschienen war.
Nach diesem Bericht wies das Auswahlverfahren so ziemlich alle denkbaren und potenziell folgenreichen Fehler und Versäumnisse auf, die man sich ausmalen kann. In diesem Auswahlverfahren geht es vor allem darum, einen vollständigen Überblick über mögliche finanziellen Vorteile zu erhalten, welche die Sachverständigenräte von den Firmen erhalten oder erhalten könnten, die von den Entscheidungen der Sachverständigen profitieren oder eben auch nicht. Um sich diesen Überblick verschaffen zu können, wertete Levinson die so genannten "Confidential Financial Disclosure Reports" des Office of Government Ethics (OGE) bzw. die "Forms 450 and ethics agreements" für 246 beratende Sachverständige in 17 CDC- Komitees im Jahr 2007 aus.
Der staatliche Kontrolleur fand vor allem folgende Probleme:
• In 97% der OGE-Formblätter 450 gab es mindestens eine Lücke oder einen erkennbaren Irrtum. Die meisten Fragebögen für die Mitglieder der Kommissionen hatten mehr als eine Auslassung. Die CDC kümmerte sich offensichtlich nicht darum, diese Lücken zu schließen. Die meisten dieser Panel-Mitglieder arbeiten bis in die Gegenwart hinein in einem der zahlreichen CDC-Komitees beratend und entscheidend mit.
• 64% der SGE hatten potenzielle Interessenkonflikte, welche die CDC nicht identifiziert oder nicht gelöst hatten bevor sie diese Personen zertifizierte und als Ratgeber zuließ. 58% der zertifizierten SGEs hatten mindestens einen potenziellen Konflikt, den die CDC nicht merkten. 32% der zertifizieren und damit zugelassenen SGEs hatten potenzielle Interessenkonflikte, welche die CDC gemerkt hatten aber nicht lösten.
• Die CDC stellten bei 41% der SGE nicht sicher, dass sie die benötigten Ethik-Trainingsprogramme innerhalb des notwendigen Zeitfensters erhielten und besuchten.
• 15% der Berater hielten die ethischen Regeln für ihre Tätigkeit in Sitzungen der Komitees nicht ein. 13% der Ratgeber nahmen an Sitzungen teil und beeinflussten sie auch ohne dass sie auf der Basis der Prozedur des OGE-Fragebogens 450 zertifiziert worden waren. 3% nahmen auch dann an Sitzungen teil, wenn ihnen dies wegen möglicher Interessenkonflikte von den "Ethik-Offizieren" verboten war.
• Die meisten der von Levinson identifizierten Sachverständigen mit Interessenkonflikten hatten die deshalb, weil sie entweder bei einer der von Entscheidungen des Komitees betroffenen Firmen beschäftigt waren oder Zuschüsse von ihnen erhielten oder auch Aktien der betreffenden Unternehmen besaßen.
Mit den Ergebnissen des Berichts konfrontiert, reagierte der aktuelle Direktor der CDC, Thomas Frieden, schnell und ohne dies öffentlich empirisch zu belegen, folgendermaßen: "Since the period covered in this review, CDC has strengthened the financial disclosures and conflict-of-interest process by instituting improved business processes and realigning responsibilities and oversight".
Das einzig Positive an diesem Bericht ist sein Erscheinen. Ob und wie sich die nicht erkannten oder verharmlosten Interessenkonflikte auf Entscheidungen zugunsten der HPV- oder Schweinegrippeimpfung und damit von Pharmakonzernen wie Sanofi-Pasteur, Novartis oder GlaxoSmithKline auswirkten, untersuchte und berichtete Levinson nicht. Weitere Untersuchungen sollten aber von der plausiblen Hypothese ausgehen, dass dies der Fall war.
Wer von den deutschen LeserInnen sich jetzt beruhigt zurücklehnt und das US-Gesundheitssystem bedauert, sollte dies nicht machen bevor eine vergleichbare Transparenz und derartige Analysen für das Robert-Koch-Institut (RKI), die Ständige Impfkommission (StIKo) oder das Paul-Ehrlich-Institut vorliegen. Auf den Rat der dort geballten Experten und sachverständigen Berater werden immerhin seit 2005 zu Gunsten fast derselben Unternehmen plus der Firma Roche Arzneimittelberge und millionenfach Impfseren im Wert von weit über 1 Milliarde Euro gelagert, angeboten und appliziert, die inhaltlich durchaus kontrovers bewertet werden können.
Die potenziell gefährdete Unabhängigkeit us-amerikanischer Gesundheitsinstitutionen kann aber aus deutscher oder europäischer Sicht auch schon deswegen nicht ignoriert werden, weil sich häufig die hiesigen Einrichtungen auf Entscheidungen dieser Institutionen stützen.
Der vom "Department of Health and Human Services" und seinem Inspector General Daniel R. Levinson erstellte Bericht "CDC'S ETHICS PROGRAM FOR SPECIAL GOVERNMENT EMPLOYEES ON FEDERAL ADVISORY COMMITTEES" ist in Gänze kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.12.09
Unerwünschte Ereignisse in schwedischen Krankenhäusern - 70 Prozent wären vermeidbar
 Auch in schwedischen Krankenhäusern sind unerwünschte Ereignisse alltäglich, verursachen erhebliches menschliches Leid und nehmen einen signifikanten Anteil der verfügbaren Ressourcen der Krankenhäuser in Anspruch. Dies ist jedenfalls das Ergebnis der jüngsten Analyse der Inzidenz, Natur und Konsequenzen unerwünschter und vor allem vermeidbarer Vorkommnisse bei einer repräsentativen Stichprobe von 1.967 zwischen dem Oktober 2003 und September 2004 in 28 Krankenhäusern entlassenen PatientInnen - insgesamt wurden in dieser Zeit 1,2 Millionen Personen entlassen.
Auch in schwedischen Krankenhäusern sind unerwünschte Ereignisse alltäglich, verursachen erhebliches menschliches Leid und nehmen einen signifikanten Anteil der verfügbaren Ressourcen der Krankenhäuser in Anspruch. Dies ist jedenfalls das Ergebnis der jüngsten Analyse der Inzidenz, Natur und Konsequenzen unerwünschter und vor allem vermeidbarer Vorkommnisse bei einer repräsentativen Stichprobe von 1.967 zwischen dem Oktober 2003 und September 2004 in 28 Krankenhäusern entlassenen PatientInnen - insgesamt wurden in dieser Zeit 1,2 Millionen Personen entlassen.
Die Untersuchung erfolgte auf der Basis der medizinischen Dokumentationen und mit Hilfe von 18 Screening-Kriterien. Diese reichten vom unerwarteten Tod über eine ungeplante Wiederaufnahme, einer ungeplanten Verlegung von einer normalen Station in die Intensivstation bis zur ungeplanten Verlegung in ein anderes Akutkrankenhaus. Die Bewertungen der medizinischen Dokumente erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren durch Pflegekräfte und Ärzte.
Die Ergebnis sind einerseits nicht völlig unerwartet, zeigen aber andererseits, dass trotz einer Reihe vergleichbarer älterer Untersuchungen mit ähnlichem Ergebnis sich immer noch wenig getan hat, derartige Mängel zu beseitigen. Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• 12% der untersuchten Behandlungsfälle hatten mindestens ein unerwünschtes Ereignis.
• Davon waren nach Meinung der bewertenden Ärzte und Pflegekräfte 70% vermeidbar.
• 55% dieser vermeidbaren Ereignisse führten zu Verletzungen und Behinderungen, die während der Krankenhaus-Behandlungszeit oder innerhalb eines Monats nach Entlassung beseitigt werden konnten. 33% der Ereignisfolgen wurden innerhalb des ersten Jahres behoben, 9% der Ereignisse führten zu dauernder Behinderung und 3% trugen sogar zum Tod der betroffenen PatientInnen bei.
• Vermeidbare unerwünschte Ereignisse verlängerten den Krankenhaus-Aufenthalt um durchschnittlich 6 Tage. Die Hälfte der unerwünschten Ereignisse führte außerdem zu einem oder mehr Besuchen bei ambulanten Ärzten.
• Mit 10 der 18 Indikatoren konnte man 90% des gesamten unerwünschten Geschehens erkennen.
• Rechnet man die Ergebnisse auf die im Untersuchungsjahr behandelten 1,2 Millionen Personen bzw. Fälle hoch, gab es insgesamt 105.000 unerwünschte Ereignisse und 630.000 eigentlich nicht notwendige zusätzliche Krankenhaustage.
Während also im Rahmen der Fallpauschalenbezahlung stationärer Behandlung um jeden Tag gefeilscht wird und aufwändige Qualitätssicherungsprogramme durchgeführt werden, gibt es gleichzeitig offensichtlich selbst in Versorgungssystemen, die sonst immer als vorbildlich gelten, einen Berg von menschlich und ökonomisch folgenreichen Versorgungsmängeln. Und sage niemand, in deutschen Krankenhäusern gäbe es so etwas nicht, außer er könnte dies nach einer vergleichbaren Analyse eindeutig belegen.
Dass eine bessere Transparenz über unerwünschte Ereignisse außerhalb solch etwas aufwändigerer Studien gar nicht so leicht ist und auch nicht automatisch mit eindeutigen Ergebnissen zu rechnen ist, zeigt ein anderer Aufsatz in derselben Ausgabe der Zeitschrift "International Journal for Quality in Health Care".
Eine Gruppe us-amerikanischer ForscherInnen untersuchte den Grad der Übereinstimmung dreier in US-Krankenhäusern aber zum Teil auch in deutschen Kliniken verwendeten Messmethoden für unerwünschte Ereignisse. Konkret ging es um die Bewertungen bei allen im Jahr 2005 in den Mayo-Rochester-Kliniken entlassenen 60.599 PatientInnen.
Bei der Messung unerwünschter Ereignisse kamen folgende Methoden zum Einsatz: Die "Agency for Healthcare Research and Quality-defined patient safety indicators (PSIs)", die im Wesentlichen die Kodierungen nach der Diagnoseklassifikation ICD-9 benutzten; Berichte, die von den Krankenhäusern geliefert wurden und Ergebnisse des "Institute for Healthcare Improvement Global Trigger Tool", dessen Ergebnisse jeweils von Ärzten bestätigt werden mussten. Die wesentlichen Ergebnisse sahen so aus:
• Bei über 4% aller entlassenen PatientInnen (n=2.401) zeigte mindestens eine der Methoden ein unerwünschtes Ergebnis an.
• Rund 38% der bekannten unerwünschten Ereignisse wurden durch die behandelnden Kliniken selber angezeigt. Bei rund 43% der Ereignisse handelt es sich um Verletzungen und vergleichbare Eingriffe, 23% waren Ereignisse im Zusammenhang mit Medikamenten und bei 1,8% spielte die technische Ausstattung des Krankenhauses eine Rolle.
• Wenn eine der Methoden bei einem Patienten ein unerwünschtes Ereignis meldete, wurde dies für gewöhnlich nicht noch zusätzlich durch eine andere Methode bestätigt: Nur für 6% der nach der aus Sicht der Patienten-Methode identifizierten Ereignisse gab es auch einen entsprechenden Krankenhaus-Bericht und nur für 10,5% der von Krankenhaus-Akteuren berichteten Ereignisse lag ein Hinweis auf der Basis eines "Patientensicherheits-Indikators (PSI)" vor.
Angesichts dieser geringen Übereinstimmung mehrerer für sich zuverlässig erscheinenden Berichtsmethoden geben die ForscherInnen zwei praktische Hinweise: Erstens empfehlen sie eine Kombination der Berichtsmethoden für unerwünschte Ereignisse und zweitens werfen die beobachteten Inkonsistenzen der unterschiedlichen Methoden und die geringe Assoziation von dokumentierten Schäden und entsprechenden Berichten Zweifel auf, ob derartige Messungen der Patientensicherheit für die öffentliche Berichterstattung und Vergleiche der Performanz von Krankenhäusern genutzt werden sollen. Sieht man wie sich deutsche Krankenhäuser unabhängig vom durchaus umstrittenen "Wert" einzelner Methoden auf den Einsatz einer einzelnen der vielen Methoden konzentrieren, sollte der zweite praktische Hinweis gerade hierzulande besonders ernst genommen werden.
Von der schwedischen Studie "The incidence of adverse events in Swedish hospitals: a retrospective medical record review study" von Michael Soop, Ulla Fryksmark, Max Köster und Bengt Haglund in der Fachzeitschrift "International Journal for Quality in Health Care" (2009 21(4):285-291; doi:10.1093/intqhc/mzp025) gibt es ein Abstract aber auch die komplette PDF-Fassung von 7 Seiten.
Von der Studie "A comparison of hospital adverse events identified by three widely used detection methods" von James M. Naessens, Claudia R. Campbell, Jeanne M. Huddleston, Bjorn P. Berg, John J. Lefante, Arthur R. Williams und Richard A. Culbertson (International Journal for Quality in Health Care 2009 21(4):301-307; doi:10.1093/intqhc/mzp027) ist nur ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.7.09
1990-2007: "Lack of detection and widespread under-reporting". Qualitätssicherung durch Ärzte-"peer review" in US-Krankenhäusern
 Seit dem 1. September 1990 existiert in den USA auf der gesetzlichen Basis des "Health Care Quality Improvement Act" aus dem Jahre 1986 eine bundesweite Datenbank für Informationen über Krankenhausärzte, denen Behandlungsrechte in Krankenhäusern durch ein so genanntes internes "peer review"-Verfahren für mehr als 30 Tage entzogen oder begrenzt worden sind.
Seit dem 1. September 1990 existiert in den USA auf der gesetzlichen Basis des "Health Care Quality Improvement Act" aus dem Jahre 1986 eine bundesweite Datenbank für Informationen über Krankenhausärzte, denen Behandlungsrechte in Krankenhäusern durch ein so genanntes internes "peer review"-Verfahren für mehr als 30 Tage entzogen oder begrenzt worden sind.
Auch wenn die so genannte "National Practitioner Data Bank" nur in depersonalisierter Form als "public use file" für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist, sollten diese Meldungen der Krankenhäuser vor allem auch zu einer Art selbstreinigenden innerprofessionellen Transparenz beitragen, die Krankenhausverwaltungen z.B. bei Neueinstellungen Informationen über möglicherweise fachlich nicht qualifizierte Ärrzte geben sollte und damit letztlich auch Patienten zu Gute kommen sollte. Das US-Medizinjournal JAMA nannte das "hospital peer review one of the pillars of quality assurance in the United States" und sah die Wirksamkeit dieses Verfahrens der von staatlichen und professionsfremden Kontrollen und Kontrolleure überlegen.
Im Vorfeld des Start dieser Datenbank im Jahre 1990 schätzte die US-Bundesregierung aufgrund der zuvor beobachteten Häufigkeit solcher innerprofessioneller Disziplinierungsmaßnahmen der Ärzteschaft, dass dort mindestens 5.000 derartiger Meldungen jährlich eingingen. Die American Medical Association ging sogar von 10.000 Meldungen aus. Sie stützte sich dabei auf eine Studie der "American Hospital Association (AHA)", also des Verbandes der Krankenhäuser, die festgestellt hatte, dass es pro Jahr in jedem Krankenhaus durchschnittlich 2,5 interner fachlicher Disziplinarmaßnahmen gab, was bei rund 5.000 Kliniken zu der geschätzten Anzahl von Meldungen geführt hätte.
Ein von der gemeinnützigen Public Citizen's Health Research Group am 27. Mai 2009 der Öffentlichkeit vorgestellter Bericht analysierte nun das tatsächliche Meldeverhalten soweit es aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen erkennbar war und kam zu ernüchternden Ergebnissen:
• Die durchschnittliche Anzahl der in den 17 untersuchten Jahren pro Jahr eingehenden Berichte betrug 650, also ein Achtel der von der Regierung und ein Sechzehntel der von der Mediziner-Assoziation geschätzten Anzahl.
• 49% der US-Krankenhäuser sandte in den 17 Jahren keinen einzigen Bericht.
• 34,2% aller Krankenhäuser berichteten während der 17 Jahre wenigstens einen Fall.
• Die Durchführung von "peer reviews" und entsprechende Meldungen variierte zwischen einzelnen Bundesstaaten enorm: Während 70% aller Kliniken in Louisiana niemals Meldungen sandten waren es in Conneticut "nur" 25% Nie-Melder.
• Aber auch in Bundesstaaten mit hohem Berichtsniveau konzentrierten sich die Meldungen nach Feststellung der Berichterstatter oft auf wenige Einrichtungen.
• In zahlreichen Fällen folgte einer oder mehreren Meldungen über Ärzte keine erkennbare aber zwingend notwendige Folgeaktion wie etwa die eines wie auch immer gearteten Lizenzentzugs. Dies gilt z.B. für 952 unter den insgesamt gemeldeten 9.877 Ärzten mit zwei und mehr Reports über unerwünschte Handlungen und 31 mit fünf und mehr dieser Meldungen.
• Da das Problem bereits seit langem bekannt war, gab es seit 1996 verschiedene Anläufe, den Zustand der Transparenz zu verbessern oder Sanktionen einzuführen. Aber schon der Versuch, von den Krankenhäusern mehr über die Gründe ihrer zurückhaltenden Nutzung von "peer review"-Verfahren und der Meldung von Ereignissen zu erfahren, scheiterte 2002. Die Unternehmensberatung PwC versuchte 42 Krankenhäuser und 36 Managed Care Organizations in eine Pilotstudie einzubeziehen, musste aber die Studie einstellen, weil sich nur 3 Krankenhäuser und 5 MCOs zur Teilnahme bereit erklärt hatten.
Die AutorInnen des Public Citizen-Reports schließen trotz der desillusionierenden Geschichte ihren Bericht mit einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen, ohne aber genau angeben zu können, warum diese wirklich etwas am Verhalten der Krankenhäuser ändern sollen.
Trotz der deutlichen Zahlen und der langen Geschichte systematischer und kontinuierlichen Unterberichterstattung beharrt die "American Hospital Association" schließlich auf folgender Sicht der Dinge: "Hospitals are actively involved in a wide variety of efforts to continuously improve care and talk publicly about the care we provide". Derartige Reaktionen verstärken die Zweifel an der Wirksamkeit von Qualitätssicherungen, die ausschließlich auf Selbstverpflichtungen und Freiwilligkeit beruhen und bei denen offenkundige Verstöße nicht sanktioniert werden - so unwohl man sich bei staatlich verpflichtenden Alternativen auch fühlen mag.
Der sehr detaillierte, material- und quellenreiche Bericht "Hospitals Drop the Ball on Physician Oversight. Failure of Hospitals to Discipline and Report Doctors Endangers Patients" von Alan Levine und Sidney Wolfe umfasst 38 Seiten und ist kostenlos erhältlich.
Wer mehr über das im Prinzip interessante Modell der National Practitioner Data Bank. Healthcare Integrity and Protection Data Bank erfahren will, erhält hier einen kostenlosen Zugang.
Bernard Braun, 29.5.09
Was taugen Selbsteinstufungen von Krankenhäusern über die Patientensicherheit in ihren Häusern? Nichts.
 Die Leapfrog Gruppe ist eins von vielen US-Unternehmen, das für Patienten Informationen und Ranglisten über Krankenhäuser anbietet. Die große Vielfalt der US-Klinikführer bewirkt nicht selten, dass die Informationen unübersichtlich sind und teilweise sogar einander widersprechen (vgl. Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus). Auf ein weiteres Problem der Klinikführer hat jetzt eine Studie aufmerksam gemacht, die in der Zeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) veröffentlicht wurde: Die Unzuverlässigkeit von Informationen, die von den Kliniken selbst geliefert werden.
Die Leapfrog Gruppe ist eins von vielen US-Unternehmen, das für Patienten Informationen und Ranglisten über Krankenhäuser anbietet. Die große Vielfalt der US-Klinikführer bewirkt nicht selten, dass die Informationen unübersichtlich sind und teilweise sogar einander widersprechen (vgl. Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus). Auf ein weiteres Problem der Klinikführer hat jetzt eine Studie aufmerksam gemacht, die in der Zeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) veröffentlicht wurde: Die Unzuverlässigkeit von Informationen, die von den Kliniken selbst geliefert werden.
In Klinikführern der Leapfrog-Gruppe werden derzeit Angaben zur Patientensicherheit gemacht, die auf Indikatoren beruhen, die von den Kliniken selbst berichtet werden. Dabei handelt es sich um etwa ein Dutzend Indikatoren zur Struktur- und Prozess-Qualität in den Häusern, die bestimmte Routinen und Maßnahmen betreffen etwa zur Arzneimittelvergabe, zur Vorgehensweise bei Infektionen usw. Aufgrund dieser Angaben erhalten Krankenhäuser in der Kategorie "Patientensicherheit" eine bestimmte Punktzahl und werden danach einer von 4 Gruppen zugeordnet, Kliniken mit sehr hohen, eher hohen, eher niedrigen, sehr niedrigen Punktwerten. Es gibt auch noch andere Verfahren zur Bewertung der Patientensicherheit, aber die Klinik-Selbstangaben werden häufig verwendet, insgesamt etwa 1100 Kliniken sind auf diese Weise bewertet.
Eine kalifornische Forschungsgruppe hat nun untersucht, wie zuverlässig diese Klassifizierungen sind. Dazu wurden alle Kliniken ausgewählt, für die in den verschiedenen US-Bundesstaaten objektive Daten zur Mortalität (während des Klinik-Aufenthalts) vorlagen. Für die Analysen kamen so Daten aus dem Jahr 2005 von insgesamt 155 Kliniken und knapp 1,7 Millionen Patienten zusammen. Dabei wurden etwa 37 Tausend Todesfälle beobachtet.
Die Wissenschaftler stuften die erfassten 155 Kliniken dann hinsichtlich ihrer Patientensicherheit in vier Gruppen ein - entsprechend der Leapfrog-Klassifizierung und überprüften dann, ob sich die Mortalitäts-Raten in den vier Gruppen unterschied. Festgestellt wurden dann folgende risiko-adjustierten Quoten, also unter Berücksichtigung von Art und Schweregrad der Erkrankung, Risiko des Eingriffs etc.:
• Gruppe 1 (sehr hohe Patientensicherheit) Mortalität 1,97%
• Gruppe 2: 2,04%
• Gruppe 3: 1,96%
• Gruppe 4 (sehr niedrige Patientensicherheit): 2,00%
Das heißt: Es gab keinerlei statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Klinik-Gruppen hinsichtlich der Mortalitätsquote. Die von Leapfrog gebotenen Informationen zur Patientensicherheit sind also völlig wertlos. Die Wissenschaftler diskutieren dann, dass die Mortalitätsrate während des Klinik-Aufenthalts nicht der einzige Indikator ist, um "Patientensicherheit" zu messen, auch Infektionsraten oder Komplikationen sind zweifellos Hinweise. Nicht zu Unrecht argumentieren sie allerdings, dass Aussagen darüber, wie oft in einer Klinik der Tod auf dem OP-Tisch zu verzeichnen ist, nach wie vor der für Patienten relevanteste Indikator ist. Die Wissenschaftler diskutieren auch, was ursächlich sein könnte für ihre Ergebnisse. Eine Möglichkeit wäre naheliegend: Kliniken teilen zwar mit, dass bestimmte Sicherheitsvorschriften oder Routinen eingeführt worden sind, nicht aber, ob diese auch in der Alltagspraxis auch immer eingehalten werden.
Studie im Volltext (kostenlos): Leslie P. Kernisan et al: Association Between Hospital-Reported Leapfrog Safe Practices Scores and Inpatient Mortality (JAMA. 2009;301(13):1341-1348)
Gerd Marstedt, 1.4.09
Verhindert Antibiotikaeinsatz bei Mittelohrentzündungen Folgeerkrankung oder fördert er fast nur Antibiotikaresistenz?
 Im Forum wurde bereits die Über- oder Fehlversorgung von Mittelohrentzündungen (Otitis media) mit Antibiotika angesprochen und auf deren Beitrag zur gesundheitlich immer problematischer werdenden Antibiotikaresistenz vieler Erreger hingewiesen. Diejenigen ÄrztInnen, die ihr Handeln zu rechtfertigen versuchen, geben häufig zu bedenken, sie befänden sich in einer klassischen Scylla-und-Charybdis-Situation, und müssten zwischen den möglichen mittel- bis langfristig unerwünschten Folgen der Antibiotika-Therapie und einer kurzfristig drohenden Folgeerkrankung der unbehandelten Mittelohrentzündung abwägen.
Im Forum wurde bereits die Über- oder Fehlversorgung von Mittelohrentzündungen (Otitis media) mit Antibiotika angesprochen und auf deren Beitrag zur gesundheitlich immer problematischer werdenden Antibiotikaresistenz vieler Erreger hingewiesen. Diejenigen ÄrztInnen, die ihr Handeln zu rechtfertigen versuchen, geben häufig zu bedenken, sie befänden sich in einer klassischen Scylla-und-Charybdis-Situation, und müssten zwischen den möglichen mittel- bis langfristig unerwünschten Folgen der Antibiotika-Therapie und einer kurzfristig drohenden Folgeerkrankung der unbehandelten Mittelohrentzündung abwägen.
Bei der Mittelohrentzündung wird vor allem eine so genannte Mastoiditis befürchtet, d.h. eine entzündliche Einschmelzung des knöchernen Warzenfortsatzes im Bereich des Mittelohrs, die ihrerseits wiederum das Risiko von noch schwereren Folgeerkrankungen (z. B. Gesichtsnervenlähmung, Schläfenbeinosteomyelitis, Gehirnhautentzündung, Schläfenlappen- oder Kleinhirnabszess sowie Blutvergiftung) in sich birgt oder eine Entfernung des Warzenfortsatzes erfordert. Die Informationsplattform "Gesundheitspro.de" drückt den Zusammenhang exemplarisch so aus: "Die Mastoiditis ist in der Regel (!!!) eine Komplikation einer unbehandelten oder nicht ausreichend behandelten akuten Mittelohrentzündung. Sie entwickelt sich ungefähr zwei bis vier Wochen nach einer Mittelohrentzündung. … Um einer Mastoiditis vorzubeugen, ist die fachärztliche Behandlung einer Mittelohrentzündung mit Antibiotika … nötig."
Die seit einiger Zeit bei der Mittelohrentzündung von Kindern alternativ gewählte Behandlungsweise ist der so genannte "watch-and-wait"-Ansatz. Weder die beobachtenden und abwartenden Ärzte noch die mit Antibiotika intervenierenden Ärzte konnten aber bisher eindeutig nachweisen, ob ihr Verhalten die Mastoiditis-Inzidenz erhöhte oder verhinderte. Diesen für weite Bereiche der medizinischen Versorgung typischen Wissensmangel beendet jetzt für den Komplex der Mittelohrentzündung eine britische Studie, die für den Zeitraum 1990 bis 2006 für 2.622.348 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 15 Jahren auf der Grundlage der "General Practice Reseaech Database" die Trends der akuten Otitis media und der Mastoiditis und der als regelhaft unterstellten Zusammenhänge untersuchte.
Die Wirklichkeit sieht etwas komplexer aus und irritiert die Rechtfertigung des Antibiotikaeinsatzes erheblich:
• In den 16 untersuchten Jahren blieb die Inzidenz von Mastoiditis mit durchschnittlich rund 1,2 Fällen pro 10.000 Kinderjahren stabil.
• Anders sieht es bei der Mittelohrentzündung aus, deren Inzidenz im selben Zeitraum um 34 % abnahm.
• Von den 854 Kindern, bei denen eine Mastoiditis diagnostiziert wurde, hatten in den jeweils vorangegangenen drei Monaten lediglich 36 % eine diagnostizierte Mittelohrentzündung gehabt.
• Der Anteil der Kinder, die an einer Mittelohrentzündung erkrankt und mit Antibiotika behandelt worden waren, sank von 77 % auf 58 %. Dies liegt in Großbritannien in den hier untersuchten Jahren überwiegend an der Verbreitung des "watch-and-wait"-Ansatz.
• Die je nach Behandlung einer Mittelohrentzündung Inzidenz von Mastoiditis lag in der Gruppe der mit Antibiotika therapierten Kindern bei 1,8 Fällen bei 10.000 Episoden (139 von 792.623). Erhielten Kinder mit Otitis media kein Antibiotikum erhöhte sich ihre Mastoiditisrate auf 3,8 Fälle pro 10.000 Episoden (149 von 389.649). Das Folgerisiko der antibiotisch behandelten Kinder lag also um 53 % unter dem der Kinder, deren Entwicklung zunächst einmal beobachtet und abgewartet wurde.
• Wie in vielen anderen Fällen relativiert sich der Eindruck und der Handlungsdruck des halbierten Risikos, wenn man sich die bisher bekannten Größenordnungen vergegenwärtigt und die Schätzung der Autoren zur NNT- bzw. NNH-Rate ("numbers needed to treat" oder "number needed to harm") mitberücksichtigt, dass 4.831 Kinder bzw. Entzündungsepisoden mit Otitis media mit Antibiotika behandelt werden müssen, um ein Kind vor einer Mastoiditis zu bewahren. 4.830 Kindern hilft also die Antibiotikatherapie zumindest nicht gegen die befürchtete Folgeerkrankung, fördert aber das Resistenzbildungsrisiko und mögliche andere unerwünschten Wirkungen dieses Arzneimittels. Noch anders ausgedrückt: Wenn bei Mittelohrentzündungen gar keine Antibiotika mehr verordnet worden wären, hätte es 255 Fälle von Mastoiditis bei den Kindern gegeben, aber es hätte in Großbritannien auch 738.775 weniger Antibiotikaverordnungen pro Jahr gegeben.
WissenschaftlerInnen nennen als eine Ursache eines möglichen Rückgangs von Mittelohrentzündungen und Mastoiditis die Impfung gegen das Bakterium Streptococcus pneumoniae und verweisen dazu auf Beobachtungen in den USA. Die Inzidenz von Otitis media und Mastoiditis und der unerwünschten Wechselwirkung dürfte also in Ländern mit derartigem Impfangebot noch niedriger sein als in der britischen Studie.
Von dem Aufsatz "Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: A retrospective cohort study using the United Kingdom General Practice Research Database" von Paula Louise Thompson et al. in der Februarausgabe 2009 der Fachzeitschrift "Pediatrics" Jahrgang 123: 424) gibt es kostenfrei nur ein Abstract.
Bernard Braun, 18.3.09
Fehlinformation und Manipulation - tiefe Einblicke in Marketingstrategien für Medikamente am Beispiel Gabapentin
 Behandlungsentscheidungen sollten zutreffende Informationen zugrundliegen. Verzerrte Informationen gefährden die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten. Am Beispiel der Substanz Gabapentin (auch als Neurontin bekannt) lässt sich eine umfassende Marketingstrategie auf Grundlage von Zeugenaussagen und firmeninternen Unterlagen nachvollziehen. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens musste die Firma Parke-Davis (Pfizer) über 8.000 Seiten interner Dokumente öffentlich zugänglich machen. Diese befinden sich in einer durchsuchbaren Datenbank im Drug Industry Document Archive der University of California, San Francisco. Das Gerichtsverfahren war auf Grund der Aussagen des Biologen David P. Franklin zustande gekommen, der im Jahr 1996 für 4 Monate für die Firma arbeitete. Die Zusammenfassung seiner gerichtlichen Zeugenaussage steht als Download zur Verfügung.
Behandlungsentscheidungen sollten zutreffende Informationen zugrundliegen. Verzerrte Informationen gefährden die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten. Am Beispiel der Substanz Gabapentin (auch als Neurontin bekannt) lässt sich eine umfassende Marketingstrategie auf Grundlage von Zeugenaussagen und firmeninternen Unterlagen nachvollziehen. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens musste die Firma Parke-Davis (Pfizer) über 8.000 Seiten interner Dokumente öffentlich zugänglich machen. Diese befinden sich in einer durchsuchbaren Datenbank im Drug Industry Document Archive der University of California, San Francisco. Das Gerichtsverfahren war auf Grund der Aussagen des Biologen David P. Franklin zustande gekommen, der im Jahr 1996 für 4 Monate für die Firma arbeitete. Die Zusammenfassung seiner gerichtlichen Zeugenaussage steht als Download zur Verfügung.
Gabapentin war im Jahr 1993 für die Behandlung einer bestimmten Art epileptischer Anfälle in den USA zugelassen worden. Der Umsatz stieg von 98 Millionen Dollar im Jahr 1995 auf fast 3 Milliarden Dollar im Jahr 2004. Den Anstieg erreichte die Firma durch erfolgreiches Marketing von Gabapentin für nicht zugelassene Indikationen (off-label-Gebrauch) wie Schmerz, Migräne und psychiatrische Diagnosen. Im Jahr 2004 bekannte sich Pfizer illegaler Marketingmethoden schuldig und bezahlte 430 Millionen Dollar Strafe.
Bereits 2006 hatten Steinman und Kollegen das hohe Maß an Systematik beschrieben, das Parke-Davis im Marketing von Gabapentin Mitte bis Ende der 1990er Jahre entwickelt hatte. Forschung, Veröffentlichungen und als unabhängig bezeichnete Fortbildungsprogramme wurden eingesetzt, angereichert mit den Aktivitäten von bezahlten Meinungsführern und Ärzten vor Ort (siehe Abbildung). Bei den meisten Bestandteilen der Kampagne blieb der werbende Charakter verborgen. Die Grenzen zwischen Forschung, Fortbildung und Werbung seien mehr als porös, stellten die Autoren damals fest.
In einem kürzlich erschienen Beitrag im New England Journal of Medicine fassen Landefeld und Steinman die Lehren aus dem Fall der Gabapentin-zusammen:
• Pharmazeutisches Marketing ist umfassend und strategisch, finanziell gut ausgestattet, als Fortbildung oder Forschung verkleidet, einflussreich, effektiv und unauffällig.
• Viele Personen und Institutionen haben die ethischen und gesetzlichen Probleme nicht beachtet - Mitarbeiter der Firma, Ärzte, Krankenhäuser und Fachgesellschaften und Aufsichtsbehörden. Offensichtlich wurde die illegalen Marketingmethoden für normal erachtet.
• Drastische Maßnahmen sind notwendig, um die Integrität der medizinischen Wissenschaft und Praxis zu bewahren und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Öffentliche Förderung pharmazeutischer Forschung.
Die Autoren weisen darauf hin, dass die Marketingmethoden für Gabapentin in den USA in erster deshalb strafbar waren, weil es sich um den off-label-Gebrauch handelte - für zugelassene Indikationen sind sie legal und weit verbreitet.
Landefeld CS, Steinman MA. The Neurontin Legacy - Marketing through Misinformation and Manipulation. N Engl J Med 2009;360:103-106. Auszug
Drug Industry Document Archive der University of California, San Francisco.
Aussage David P. Franklin
Steinman MA, Bero LA, Chren M-M, Landefeld CS. Narrative Review: The Promotion of Gabapentin: An Analysis of Internal Industry Documents. Ann Intern Med 2006;145(4):284-293. Volltext.
David Klemperer, 14.2.09
Selbstverständlichkeit oder medizinisch-technischer Fortschritt? WHO-Sicherheitscheck im OP.
 Um noch mehr diagnostische Einblicke für frühe oder punktgenaue Therapien zu erhalten, werden millionenschwere Investitionen in Großgeräte getätigt und um bestimmte Wirkstoffspiegel noch schneller und direkter zu erreichen ebenfalls Millionen in die Entwicklung neuer Arzneimittel gesteckt. Den medizinisch-technischen Fortschritt lassen "wir uns" also so viel kosten, dass oft schon die bange Frage auftaucht, ob dies künftig wirklich noch alles auf "Kassenrezept" erhältlich sein wird.
Um noch mehr diagnostische Einblicke für frühe oder punktgenaue Therapien zu erhalten, werden millionenschwere Investitionen in Großgeräte getätigt und um bestimmte Wirkstoffspiegel noch schneller und direkter zu erreichen ebenfalls Millionen in die Entwicklung neuer Arzneimittel gesteckt. Den medizinisch-technischen Fortschritt lassen "wir uns" also so viel kosten, dass oft schon die bange Frage auftaucht, ob dies künftig wirklich noch alles auf "Kassenrezept" erhältlich sein wird.
Zur selben Zeit tragen aber die mangelhafte Handhygiene (siehe dazu auch z. B. diesen Forumsbeitrag zur Handhygiene und ihren unerwünschten Folgen), der unüberlegte gießkannenartige Einsatz von Antibiotika in allen Teilen des Krankenbehandlungssystems nicht wenig zum Problem der multiresistenten Erreger bei (siehe dazu auch diesen Forumsbeitrag) und offensichtlich auch das Fehlen einfachster Sicherheitschecks in vielen Operationssälen dazu bei, dass Patienten trotz aller Fortschrittsinvestitionen z.B. wegen "vergessener" Gegenstände im Bauchraum schwer erkranken oder gar sterben.
Dies will nun die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Hilfe einer von ihr entwickelten einfachen Sicherheits-Checkliste im Umfang von einer DIN A 4-Seite dauerhaft verhindern. Nach dieser insgesamt 19 Fragen umfassenden Liste soll u.a. routinemäßig und schematisch vor der Narkose die Identität des Patienten festgestellt werden, die Art des Eingriffs und die Stelle, die operiert werden soll, bestätigt werden, wenn möglich, festgestellt werden, ob der Patient eine Allergie hat, unter Atemschwierigkeiten leidet und ob er bereits Blut verloren hat. Vor dem Schnitt stellt sich jedes Mitglied des OP-Teams mit Namen und Funktion vor. Ärzte und Pflegepersonal sollen vor dem Eingriff über mögliche Komplikationen während der Operation sprechen. Bevor der Patient nach dem Eingriff den Operationssaal verlässt, werden die Instrumente gezählt und mögliche Schwierigkeiten, die bei der Abheilung der Wunde auftreten könnten, vermerkt werden.
Auch wenn vieles selbstverständlich wirkt und banal erscheint, beruht die WHO-Liste schlicht auf den am häufigsten vorkommenden Behandlungsfehlern mit zum Teil schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten im Krankenhaus.
Um aber nicht ständig hören zu müssen, die Liste bewirke praktisch nichts, untersuchten weltweit aktive Mitglieder der "Safe Surgery Saves Lives Study Group" in einer Studie an acht sozial und technisch deutlich unterschiedlichen Krankenhäusern in weltweit acht Städten (Toronto, Neudelhi, Ammann, Auckland, Manila, Ifakara, London und Seattle - natürlich wieder ohne ein deutsches Krankenhaus) die Behandlungsgeschichten von 7.688 nichtkardiologischen Chirurgiepatienten, die älter als 16 Jahre alt waren, drei Monate vor (3.733 Patienten) und 3 Monate lang nach (3.955 Patienten) der Anwendung dieser Liste.
Die im Januar 2009 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Hauptergebnisse lauten:
• Die Rate aller wesentlichen Komplikationen während der Behandlung und 30 Tage nach dem operativen Eingriff fiel statistisch signifikant (p<0,001) von 11 % vor dem Einsatz der Liste auf 7 % danach.
• Die Sterblichkeit während und nach der Operation sank ebenfalls statistisch signifikant (p=0,003) von 1,5 % auf 0,8 %.
• Auch die Raten für postoperative Infektionen und ungeplante Nachoperationen sanken statistisch hochsignifikant.
• Diese Erfolge konnten in allen sozialen Settings verzeichnet werden.
• Die Erfahrungen mit der Einführung an organisatorisch unterschiedlichen Kliniken zeigten auch, dass die Einführung weder viel Geld noch Zeit kostet. Die Testkliniken brauchten zwischen einer Woche und einem Monat, die Checkliste und ihre expliziten Prüfvorgänge in den Alltag einzubauen.
Die erste Ausgabe der WHO Surgical Safety Checklist kann komplett im Internet eingesehen und herunter geladen werden.
Dort gibt es auch einen kurzen Überblick über das Projekt der WHO.
Der 8 Seiten umfassende Aufsatz "A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population" von Alex B. Haynes et al. ist seit 14. Januar 2009 online auf der Website des NEJM komplett kostenlos erhältlich und wird am 29. Januar 2009 im NEJM (N Engl J Med 2009;360: 491-9) gedruckt erscheinen.
Bernard Braun, 22.1.09
Trugbilder der Wirklichkeit für Marketingzwecke - das Beispiel der "Neuroleptika der zweiten Generation"
 Medikamente zur Behandlung der Schizophrenie werden als Neuroleptika oder auch als Antipsychotika bezeichnet. Sie werden nach chemischer Struktur und Wirkstärke (pharmakologische Potenz) unterteilt sowie nach Substanzen der ersten und zweiten Generation, wobei erstere auch als "typische" und letztere als "atypische" Neuroleptika bezeichnet werden. Ihre Wirksamkeit entfalten sie über die Beeinflussung von Botenstoffen im Gehirn, hauptsächlich Dopamin. Psychotische Symptome wie Wahn, Halluzinationen, Verfolgungsängste und Erregungszustände können gebessert werden. Dem stehen eine Reihe unerwünschter Wirkungen gegenüber, wie z.B. Bewegungsstörungen(extrapyramidale Störungen und Dyskinesien) und Gewichtszunahme.
Medikamente zur Behandlung der Schizophrenie werden als Neuroleptika oder auch als Antipsychotika bezeichnet. Sie werden nach chemischer Struktur und Wirkstärke (pharmakologische Potenz) unterteilt sowie nach Substanzen der ersten und zweiten Generation, wobei erstere auch als "typische" und letztere als "atypische" Neuroleptika bezeichnet werden. Ihre Wirksamkeit entfalten sie über die Beeinflussung von Botenstoffen im Gehirn, hauptsächlich Dopamin. Psychotische Symptome wie Wahn, Halluzinationen, Verfolgungsängste und Erregungszustände können gebessert werden. Dem stehen eine Reihe unerwünschter Wirkungen gegenüber, wie z.B. Bewegungsstörungen(extrapyramidale Störungen und Dyskinesien) und Gewichtszunahme.
Die erste Generation der Neuroleptika wurde in den 1950-er-Jahren entwickelt, wie z.B. Chlorpromazin, Perphenazin und Haloperidol. Ab den 1970-er Jahren wurden neu entwickelte Substanzen als zweite Generation von Neuroleptika eingeführt mit dem Versprechen zusätzlicher positiver und weniger unerwünschter Wirkungen, wie z.B. Clozapin, Amisulprid, Olanzapin und Risperidon.
Seit 2005 werden die Medikamente der zweiten Generation in Deutschland häufiger verordnet als die hochpotenten Neuroleptika der ersten Generation (Arzneiverordnungsreport 2008, S. 795).
Eine internationale Arbeitsgruppe ist jetzt in einer Meta-Analyse der Frage der Überlegenheit der Neuroleptika der zweiten Generation nachgegangen mit folgendem Ergebnis:
• Es existiert kein gemeinsames Merkmal, in dem sich die Substanzen der zweiten von der ersten Generation unterscheiden. Der Begriff "atypische Neuroleptika" entbehrt damit einer sachlichen Grundlage.
• Als Gruppe haben die Medikamente der zweiten Generation kein günstigeres Profil von erwünschten und unerwünschten Wirkungen. Insbesondere wirken sie nicht besser auf die negativen Symptome.
• Einzelne Substanzen sind bezüglich einzelner Zielparameter günstiger als andere, so z.B. das Doxepin bezüglich einer bestimmten Form von Bewegungsstörungen.
Für die Meta-Analyse wurden neun Substanzen der zweiten mit Substanzen der ersten Generation verglichen, zumeist mit Haloperidol und Perphenazin. Dafür wurden 150 doppelblinde randomisierte kontrollierte Studien mit 21.533 Teilnehmern ausgewertet. Beurteilt wurde die Gesamtwirksamkeit, positive, negative und depressive Symptome, Lebensqualität, extrapyramidale Störungen, Gewichtszunahme und Sedierung.
Die Begriffe "zweite Generation von Neuroleptika" und "atypische Neuroleptika" erweisen sich somit als eine Erfindung, mit der die Industrie ein erfolgreiches Marketing für die neuen und teureren Medikamente betrieb, merken Peter Tyrer und Tim Kendall in einem Kommentar an.
Durch eine Reihe von Tricks wurde von vornherein sichergestellt, dass die neuen Medikamente im Vergleich besser abschnitten. So wurden die neuen Substanzen in meisten Fällen mit Haloperidol verglichen, einem hochpotenten Neuroleptikum der ersten Generation mit vergleichsweise starken unerwünschten Wirkungen. Weiterhin wurden die Substanzen der ersten Generation hoch dosiert, was zu einer höheren Rate unerwünschter Wirkungen führt. Neuroleptika der ersten Generation mit günstigerem Profil wurden erst gar nicht in die Vergleiche einbezogen und Studien mit unerwünschten Ergebnissen wurden nicht veröffentlicht. Es sei nicht schwer zu erkennen - so die Kommentatoren - dass die Studien dem Marketing dienen und nicht der Klärung des tatsächlichen Nutzens für die Patienten.
Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. The Lancet 2009;373:31-41
Zusammenfassung
Tyrer P, Kendall T. The spurious advance of antipsychotic drug therapy. The Lancet 2009;373:4-5
Kommentar, Download kostenpflichtig
David Klemperer, 4.1.09
US-Arztpraxisstudie: Elektronische Patientenakten vermeiden Medizinschadensfälle nur sehr geringfügig!
 Die Hersteller elektronischer Erfassungs- und Verwaltungsgeräte und -programme für die in Arztpraxen anfallenden Patienten- und Abrechnungsdaten zählen zu den Vorteilen ihrer Angebote, dass sie die Qualität der Behandlung für die Patienten verbessern und durch die Vermeidung von Kunstfehlern aufgrund von Informationsmängel auch die Kosten senken können. Dem stimmen, wie man u.a. der jahrelangen Debatte über die Vorteile der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte entnehmen kann, auch zahlreiche Politiker und Krankenkassenakteure reflexartig zu.
Die Hersteller elektronischer Erfassungs- und Verwaltungsgeräte und -programme für die in Arztpraxen anfallenden Patienten- und Abrechnungsdaten zählen zu den Vorteilen ihrer Angebote, dass sie die Qualität der Behandlung für die Patienten verbessern und durch die Vermeidung von Kunstfehlern aufgrund von Informationsmängel auch die Kosten senken können. Dem stimmen, wie man u.a. der jahrelangen Debatte über die Vorteile der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte entnehmen kann, auch zahlreiche Politiker und Krankenkassenakteure reflexartig zu.
Doch ob dies wirklich so ist, weiß man nicht.
Einige Zweifel werfen jetzt die Ergebnisse einer in den USA durchgeführten Studie mit 1.140 niedergelassenen Ärzten im Bundesstaat Massachusetts auf. Zunächst hatte eine Wissenschaftlergruppe zwischen Juni und Ende November 2005 eine Zufallsstichprobe der Ärzte dieses Bundesstaates mit der Bitte angeschrieben, ihnen ausführlich über ihre Einstellung und Erwartungen zur Nutzung, zur Ausstattung mit und den Einsatz von elektronischen Datensätzen bzw. Gesundheitsakten ("electronic health records" [EHR])in ihren Praxen zu berichten. Zu diesen Arztpraxen spielten die ForscherInnen dann staatliche Daten über den bezahlten Ausgleich von Medizinschadensfällen aus den letzten 10 Jahren hinzu, die auf dem "Massachusetts Board of Registration in Medicine (BRM)" im April 2007 veröffentlicht waren.
Rund ein Drittel der den Survey beantwortenden Ärzten führte elektronische Patientenakten. Von den Ärzten mit einem elektronischen Patientenaktensystem hatten 6,1% einen Medizin- oder Behandlungsschaden, der zu einem finanziellen Schadenausgleich führte. Unter den Ärzten ohne elektronische Patientenakten waren dies 10,8% (nichtadjustierte Odds ratio 0,54, p =0.01). Unterscheidet man die Ärzte, die überhaupt ein System elektronischer Patientenverwaltung einsetzen nach "high usern" und "low usern" dieser Technologie, zeigt sich ein weiterer Unterschied bei den Schadenersatzzahlungen zugunsten der "high user": 5,7 % zu 12,1%, aber nur noch schwach signifikant (p = 0,14).
Wenn man die möglichen anderen Einflüsse auf die Häufigkeit von Medizinschäden berücksichtigt und in einer logistischen Regression den Einfluss des Geschlechts des Arztes, seine Rasse, Berufserfahrung, Spezialisierung und Praxisgröße kontrolliert, verringert sich der Effekt einer elektronischen Patientenakte gegenüber ihrer Nichtexistenz deutlich und ist auch nicht mehr statistisch signifikant (adjustierte Odds ratio 0,69 und p = 0,18).
Obwohl also die Forscherinnen keine überzeugenden oder schlüssigen Belege für die positive qualitätssichernde und kostensparende Wirkung liefern können, kommen sie dann doch zu dem etwas mutigen Schluss: ""Although the results of this study are inconclusive, physicians with EHRs appear less likely to have paid malpractice claims".
Für allzu Voreilige, welche die Ergebnisse doch als Beleg für die Richtigkeit ihrer Hoffnungen in den zwangsläufigen Nutzen elektronischer Patientenakten vereinnahmen wollen, relativieren die US-Forscher aber ihre Aussage schnell wieder: "Confirmatory studies are needed before these results can have policy implications."
Die alleinige Hoffnung, vor allem Ergebnisqualitätsprobleme mit technischen oder IT-Lösungen allein vermeiden zu können, muss aber gerade nach dieser Studie erheblich eingeschränkt werden. Technische Lösungen tragen erst dann ihren sicher wichtigen Teil zur Problemlösung bei, wenn sie durch eine ganze Reihe sozialer, mentaler und kommunikativer Veränderungen von Ärzten und anderen Akteuren in den Praxen sowie weitere organisatorische Interventionen ergänzt werden.
Zu dem Aufsatz "Electronic Health Records and Malpractice Claims in Office Practice" von Anunta Virapongse, David W. Bates, Ping Shi, Chelsea A. Jenter, Lynn A. Volk, Ken Kleinman, Luke Sato und Steven R. Simon in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2008;168(21): 2362-2367) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 25.11.08
Verkürzung der Arbeitszeiten für Mediziner in der Ausbildung: Mehr Patientensicherheit, keine höheren Belastungen für Ärzte
 Mit einem Beschluss des "Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME)" wurde in den USA ab Juli 2003 in einer Vielzahl von Kliniken die Arbeitszeit für Ärzte in der Ausbildung auf 80 Wochenstunden verkürzt und ebenso die maximale Dauer einer Arbeitsschicht auf 30 Stunden. Zielsetzung war eine Erhöhung der Patientensicherheit durch die Verminderung von Müdigkeitserscheinungen und daraus resultierenden Behandlungsfehlern. Unsicher war man sich allerdings, ob dadurch nicht auch kontraproduktive Effekte auftreten könnten: Durch eine höhere Zahl von Patienten pro Arbeitsschicht und durch zusätzliche Koordinations- und Übergabe-Erfordernisse.
Mit einem Beschluss des "Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME)" wurde in den USA ab Juli 2003 in einer Vielzahl von Kliniken die Arbeitszeit für Ärzte in der Ausbildung auf 80 Wochenstunden verkürzt und ebenso die maximale Dauer einer Arbeitsschicht auf 30 Stunden. Zielsetzung war eine Erhöhung der Patientensicherheit durch die Verminderung von Müdigkeitserscheinungen und daraus resultierenden Behandlungsfehlern. Unsicher war man sich allerdings, ob dadurch nicht auch kontraproduktive Effekte auftreten könnten: Durch eine höhere Zahl von Patienten pro Arbeitsschicht und durch zusätzliche Koordinations- und Übergabe-Erfordernisse.
Bereits im Juni 2007 hatte eine Befragung von rund 20.000 Patienten in US-amerikanischen Krankenhäusern deutlich gemacht, dass diese Verkürzung der Arbeitszeiten von Klinikärzten wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität oder Patientensicherheit hat. Allerdings wies diese Studie in methodischer Hinsicht einige Angriffspunkte auf: Die Befragung war retrospektiv erfolgt und die Ergebnisse damit u.U. von Wahrnehmungsverzerrungen oder Erinnerungslücken der Patienten durchsetzt (vgl.: Keine Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen im Krankenhaus auf Behandlungskontinuität - Outcomes sogar etwas besser).
In einer zweiten, als Längsschnittuntersuchung durchgeführten Studie wurde daher versucht, diese potentiellen Schwachstellen zu umgehen. Befragt wurden dabei etwa 1.500 Mediziner in der klinischen Ausbildung, und zwar zu zwei Zeitpunkten: Im Jahre 2003 vor Einführung der Arbeitszeitverkürzung und im Jahre 2004 etwa ein Jahr nach der Maßnahme. Gegenstand der Befragung waren die wöchentlichen Arbeitsstunden der Ärzte zu beiden Zeitpunkten, Beurteilung der Auswirkungen auf die Patientensicherheit, Behandlungsfehler und -irrtümer, Dauer von Arbeitsschichten, Zahl der zu behandelnden Patienten, Schlafdauer nach den Arbeitsschichten.
Da die Arbeitszeitverkürzung nicht überall in gleichem Maße im Klinikalltag durchgesetzt wurde, wurden die Befragungsteilnehmer zwei Gruppen zugeordnet: Ärzte, die im Beobachtungszeitraum entweder eine sehr starke Reduzierung oder aber keine oder eine nur sehr schwache Reduzierung ihrer Arbeitszeit erlebt haben. Im Vergleich der beiden Gruppen zeigte sich dann:
• In der Gruppe mit nachhaltiger Arbeitszeitverkürzung sank die Arbeitszeit im Durchschnitt von 77 auf 68 Stunden. Der Anteil derjenigen, die zumindest gelegentlich noch über 80 Stunden arbeiteten, sank von 44 auf 17 Prozent.
• In dieser Gruppe wurde kein signifikanter Anstieg der Belastungen durch eine höhere Patientenzahl berichtet.
• Andererseits zeigte sich jedoch als Positiveffekt, dass der Anteil derjenigen Ärzte sank, die über "Kunstfehler" oder unerwünschte Ereignisse bei der Behandlung aufgrund von Übermüdung berichteten (von 63% auf 44%).
• In der Vergleichsgruppe ohne Arbeitszeitverkürzung zeigte sich kein solcher Effekt.
• Trotz dieser im Grundsatz positiven Ergebnisse heben die Forscher allerdings hervor, dass die Zahl der Behandlungsfehler auch nach einer Arbeitszeitverkürzung immer noch recht hoch ist. So berichten 33% der Ärzte im Jahr 2003 und 26% im Jahr 2004, dass sie zumindest einmal einen Fehler gemacht hätten.
Unter dem Strich wird nach Ansicht der Wissenschaftler allerdings deutlich, dass die Arbeitszeitverkürzung sich in den Kliniken mit entsprechenden Regelungen positiv auf die Patientensicherheit ausgewirkt hat. Die grundsätzliche Befürchtung, dass sich die psychischen oder physischen Belastungen durch eine Verdichtung der Anforderungen erhöhen würden, konnte nicht bestätigt werden.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Reshma Jagsi u.a.: The Accreditation Council for Graduate Medical Education's Limits on Residents' Work Hours and Patient Safety. A Study of Resident Experiences and Perceptions Before and After Hours Reductions (Arch Intern Med. 2008;168(5):493-500)
Gerd Marstedt, 12.3.2008
"Self management" bei Diabetes und Asthma kein Selbstläufer - Sachkundige Unterstützung und Überprüfung der Umsetzung erforderlich
 So sehr gerade bei chronisch kranken Menschen zu unterstützen ist, dass sie bestimmte Teile ihrer Behandlung in die eigenen Hände nehmen, so sicher sind damit die professionellen Helfer nicht überflüssig oder so problematisch ist es, wenn sie eigenverantwortliche Aktivitäten von Patienten zum Anlass nehmen, sich sofort oder auf Dauer nicht mehr um diese übernommenen diagnostischen und therapeutischen Aufgaben zu kümmern.
So sehr gerade bei chronisch kranken Menschen zu unterstützen ist, dass sie bestimmte Teile ihrer Behandlung in die eigenen Hände nehmen, so sicher sind damit die professionellen Helfer nicht überflüssig oder so problematisch ist es, wenn sie eigenverantwortliche Aktivitäten von Patienten zum Anlass nehmen, sich sofort oder auf Dauer nicht mehr um diese übernommenen diagnostischen und therapeutischen Aufgaben zu kümmern.
Auch wenn es dazu in Deutschland noch keine repräsentativen Untersuchungen gibt, zeigen partiell repräsentative Befragungen von Patienten oder Darstellungen und Tests von Leistungserbringern, dass ein völlig sich selbst überlassenes "self management" von PatientInnen für diese zu keinem Nutzen oder gar zu gesundheitlich gefährlichen Situationen führt.
In den Ergebnissen der so genannten VITA-Studie (Verbesserung der Inhalationstechnik von Menschen mit Asthma und COPD in Apotheken, die am 13. Dezember 2007 von der "Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)" veröffentlicht wurden, offenbaren sich zahlreiche Defizite bei der Inhalation von Asthmasprays. Auch wenn es sich dabei aus Sicht der Apotheken um einen "willkommenen" Bedarf handelt, geht es angesichts von etwa 3,4 Millionen in Deutschland an Asthma erkrankten Erwachsenen und mehr als 6,7 Millionen an chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) Leidenden, bei denen nicht selten Inhalationsarzneimittel zum Einsatz kommen, bei Fehlanwendungen nicht um Kleinigkeiten.
Genau eine weit verbreitete Fehlanwendung der Sprays und damit mögliche unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen (immerhin erfolgt der Einsatz von Asthmasprays in der Regel bei dramatischen Blockaden der normalen Atmung) fanden die ABDA-Forscher bei 750 PatientInnen in 55 Apotheken. Da über deren Auswahl keine Angaben veröffentlicht sind, auch hier nochmals der Hinweis, dass es sich um keine systematisch gebildete zufällige Auswahl von AsthmapatientInnen handelt.
Diese PatientInnen wendeten durchschnittlich seit elf Jahren inhalative Arzneimittel an, d.h. ein hoher Anteil waren keine Krankheits-Anfänger mehr. Die Patienten führten dem Apotheker eine Inhalation vor, nach der sich herausstellte, dass die Inhalation bei 79% nicht korrekt erfolgte. Die drei häufigsten Fehler waren, dass der Kopf nicht nach hinten geneigt, dass nach der Inhalation nicht der Atem angehalten, und dass das Mundstück nicht von Speichelresten gesäubert (um Verkleben zu verhindern) wurde.
Die PatientInnen wurden in einem einmaligen Beratungsgespräch von ApothekerInnen über die individuellen Fehler informiert. Nach vier Wochen führten die Patienten erneut eine Inhalation vor. Das Ergebnis: Noch 28% der Patienten machten Fehler. Trotz des mindest temporären Rückgangs der Fehlanwendungen um 65% machten damit immer noch fast ein Drittel der AsthmatikerInnen massive Anwendungsfehler. Was man in der Veröffentlichung leider nicht erfährt, ist, ob die Studiendurchführer nach den möglichen Folgen der Anwendungsfehler gefragt haben und ob es gravierende Folgen gab.
Auch wenn die Apothekervereinigung natürlich daran interessiert ist, künftig verstärkt auch solche Leistungen anzubieten, ist die Verantwortung der Ärzte zu hinterfragen, die einerseits Asthmasprays verordnen, deren korrekte Anwendung sie aber ihren PatientInnen überhaupt nicht oder jedenfalls nicht nachhaltig und regelmäßig genug vermitteln. Streng genommen gehört diese Beratungsleistung aber zur Honorierung der Leistung für den Arzt dazu, ist also nicht dem Belieben des Arztes überlassen, sondern ist eine Pflichtleistung.
Eine sehr knappe Presse-Information über die ABDA-Studie findet man auf der ABDA-Website.
Es gibt außerdem kostenlos eine umfassendere Folien-Präsentation der wichtigsten Ergebnisse der Studie "Verbesserung der Verbesserung der Inhalationshalationstechnik von Menschen mit Asthma und COPD in Apotheken -VITA" von Andrea Hämmerlein, Uta Müller und Martin Schulz vom Zentrum für Arzneimittelinformation und Pharmazeutische Praxis (ZAPP) der ABDA. Zusätzlich liegt eine Liste zur korrekten inhalativen Therapie vor.
Dass es sich bei den Anwendungsschwierigkeiten von AsthmatikerInnen nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt sich auch, wenn man sich einige Erkenntnisse über verschiedene Bestandteile des "self managements" von DiabetikerInnen aus der letzten Zeit ansieht.
Im Forum-Gesundheitspolitik-Artikel "Diabetes: Versorgung muss sich mehr an den Bedürfnissen der Patienten orientieren" wurde bereits über die Ergebnisse einer Befragung von rund 2.700 bei der Gmünder Ersatzkasse (GEK) versicherten Typ 2 Diabetikern berichtet. Gesundheitswissenschaftler der Universität Bremen fanden in der Studie "Die medizinische Versorgung des Diabetes mellitus Typ 2 - unter-, über- oder fehlversorgt?" u.v.a. heraus, dass die durchaus weit verbreitete und an sich erfreuliche Selbstmessung von Blutzucker- und Blutdruckwerten bei vielen Erkrankten einem riskanten "Blindflug" gleicht.
• So wurde nur bei 31 % der Selbstmesser in der Arztpraxis regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Jahr die technische Funktionsfähigkeit des Messgeräts überprüft und
• lediglich 26 % der aktiven Patienten bekommen jährlich seine richtige Handhabung erläutert. Mehr als zwei Drittel der selbstmessenden Patienten leben somit in der Gefahr, sich mehr oder weniger großen gesundheitlichen Schaden zuzufügen.
In einer weiteren, in dem Forumsartikel zitierten Studie, dem 2006 durchgeführten "Blutzuckerselbstmanagement-Report Deutschland" traten u.a. die folgenden bei den knapp 1.000 befragten Patienten ermittelten Selbstbehandlungsfehler zutage:
• 31 % der Blutzuckerselbstmesser wählen ohne diagnostisch zwingenden Grund mit der Mitte der Fingerkuppe die schmerzhafteste Stelle. 51 % messen an der seitlichen Fingerbeere, der sanftesten Stelle.
• Viele Selbstmesser sind nicht oder nur sehr unzureichend über weitere technischen Möglichkeiten zur möglichst sanften Blutentnahme informiert.
• Fast die Hälfte (44%) der Befragten fühlt sich unsicher bei der Messung. 30% der Befragten sind sich manchmal unsicher, ob die gemessenen Werte präzise sind.
• 69% der Patienten gehen irrtümlich davon aus, dass jedes Blutzuckermesssystem bei der Verwendung eines beschädigten Teststreifens eine Fehlermeldung anzeigt, so dass kein falscher Wert gemessen werden kann. 40% sind fälschlicherweise der Meinung, dass es zur Erreichung eines präzisen Messergebnisses irrelevant ist, an welcher Körperstelle der Blutstropfen zur Messung entnommen wurde.
Ohne hier auch noch ausführlicher (vgl. aber hierzu den Forumsartikel "Self-Monitoring des Blutzuckers ohne gesundheitlichen Zusatznutzen - Von den Grenzen der Patienten-Eigenaktivitäten" auf die ebenfalls im Laufe des Jahres 2007 in mehreren Versorgungsstudien geäußerten Zweifel am Nutzen des Selbstmonitorings des Blutzuckers durch PatientInnen näher einzugehen, zeigt folgende in der Zeitschrift "Diabetes Ratgeber" verbreitete Darstellung der für eine verlässliche Blutzuckermessung gleichzeitig zu beachtenden Aspekte die Grenzen des Selbstmanagements dieser Erkrankten.
In dem in Apotheken ausgelegten November-Heft 2007 des Ratgebers hieß es unter der Überschrift "Blutzucker richtig messen - Wie Diabetiker die Voraussetzung für eine gute Therapie schaffen": "Schon bei den Teststreifen beginnt es: Sie sollen trocken aufbewahrt werden, gehören also nicht ins Bad. Da meistens an den Fingern gemessen wird, müssen die Hände vorher gewaschen werden. Es darf keine Zuckerreste an der Stichstelle geben, die übrigens auch aus Obstsaft stammen könnten, und auch kein Alkohol von einem Desinfektionsmittel. Nicht die Mitte der Fingerkuppe ist der beste Platz zum Stechen, sondern die weniger schmerzempfindlichen Seiten. Zeigefinger und Daumen schont man besser. Kommt der Blutstropfen nicht sofort, nicht drücken, denn dann kann Gewebsflüssigkeit den Wert verfälschen. Der Teststreifen soll den Tropfen aufsaugen, also nicht anpressen, um eine kleine Menge ausnutzen zu wollen. Auch das kann den Wert verfälschen."
Ob das Vergessen der einen oder anderen dieser Bedingungen zu falschen Blutzuckerwerten führt und dies dann zu einer falschen und gesundheitlich problematischen Schlussfolgerung, ist u. W. noch nicht untersucht, aber hochwahrscheinlich.
Solange das Selbstmanagement derartig kompliziert ist und auch durch sorgfältigste Schulung nicht restlos störungsfrei gestaltet werden kann, müssen neueste, im Auftrag des "Verbandes der Diagnostica-Industrie (VDGH)" erhobene Betroffenenwünsche mit Skepsis betrachtet werden. Von den 711 befragten Diabetikern sahen 54% in der Blutzuckerselbstmessung ausschließlich Vorteile für die Kontrolle ihres Behandlungserfolgs. Hinzu kommen 32%, die überwiegend Vorteile sahen. Nur ein Prozent bewertete die Nachteile höher als die Vorteile. Insofern startet die Meldung über die durchgeführte Studie auch mit dem euphorischen Satz: "In der regelmäßigen, eigenverantwortlichen Kontrolle ihrer Blutzuckerwerte sieht die überwältigende Mehrheit aller Diabetiker erhebliche Vorteile."
Das wichtigste Problem, das der VDGH nach der Befragung sieht, ist allerdings nicht das von Anwendungs- und Messfehlern und ob und wie man die verhindern kann, sondern das Faktum, dass gut die Hälfte der Befragten ihren Blutzucker seltener überprüfen würde, wenn sie die Teststreifen für ihre Blutzuckermessgeräte selbst bezahlen müssten.
Hier findet sich die Presseerklärung des Diagnostika-Verbandes.
Bernard Braun, 17.1.2008
Strahlungsbelastung durch Computertomographie (CT) - Zu einem Drittel überflüssige Diagnostik als Erkrankungsrisiko.
 Seit ihrer weltweiten Einführung in den 1970er Jahren wuchs die Nutzung des bildgebenden Verfahrens der Computertomographie (CT) rapide an. In den USA etwa werden gegenwärtig mit hoher Wachstumsdynamik mehr als 62 Millionen CT-Scans durchgeführt, darunter 4 Millionen bei Kindern. 1980 wurden noch insgesamt 3 Millionen CT-Untersuchungen durchgeführt.
Seit ihrer weltweiten Einführung in den 1970er Jahren wuchs die Nutzung des bildgebenden Verfahrens der Computertomographie (CT) rapide an. In den USA etwa werden gegenwärtig mit hoher Wachstumsdynamik mehr als 62 Millionen CT-Scans durchgeführt, darunter 4 Millionen bei Kindern. 1980 wurden noch insgesamt 3 Millionen CT-Untersuchungen durchgeführt.
Die stärksten Zunahmen der CT-Scans verzeichnet man in den USA im Bereich der Diagnostik von Kindern und dem Screening von Erwachsenen: "A large part oft he projected increase in CT scanning adults will probably come from new CT-based screening programs for asymptomatic patients. The four areas attracting the most interest are CT colongraphy, CT lung screening for current and former smokers, CT cardiac screening, and CT whole-body screening" (Brenner und Hall 2007). Bei den Kindern beruht dies vor allem auf dem schnell durchzuführenden Verfahren im Bereich der vorchirurgischen Diagnostik oder der Identifikation von Blinddarmentzündungen.
Und auch hierzulande macht das Wort, jemand "mal schnell durch die Röhre zu schieben" verharmlosend die Runde. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hatte bei der Vorstellung seines "Jahresberichts 2006" auf folgende Entwicklungen der Röntgendiagnostik und darunter der CT in Deutschland hingewiesen: 2004 wurden rund 135 Millionen radiologische Untersuchungen vorgenommen, das entspricht rund 1,6 Untersuchungen pro Einwohner. Mit dieser Häufigkeit liegen Deutsche schon deutlich höher als z. B. die NiederländerInnen mit 0,9 Untersuchungen pro Einwohner. Für den Zeitraum 1996 bis 2004 wurde ein Anstieg der dosisintensiven Computertomographie um 65% festgestellt.
Ohne dass dies Hersteller oder Anwender explizit verbreiten erscheint vielen Beteiligten das CT u.a. eine Alternative zum traditionellen Röntgen und der mit ihm verbundenen Strahlungsbelastung zu sein.
Diese Vorstellung kommt nicht aus dem Nichts, sondern wird z. B. aktiv durch "Patienteninformationen" gefördert, die von den Herstellern verbreitet werden und in denen der tatsächliche oder vermeintliche Komfort der CT für Ärzte und Patienten so in den Vordergrund geschoben wird, dass dahinter gerade noch ein kleines Strahlenrisiko für Schwangere hervorlugt.
Ein aktuelles, nämlich aus 2006 stammendes Paradebeispiel dieser Art von Patientendesorientierung lieferte die Firma Siemens Medical. Hier einige Auszüge aus der 6-seitigen Broschüre "Computertomographie. Informationen für Patienten":
"Aber eines schon vorab: Eine CT-Untersuchung geht schnell vorüber, sie verläuft unkompliziert und tut nicht weh. Sie können Ihrem Termin also ganz gelassen entgegensehen. … Bei der Untersuchung liegen Sie auf einer bequemen Patientenliege (normalerweise auf dem Rücken). Diese fährt Sie dann langsam durch die Öffnung des Tomographen - die so genannte "Gantry". Jetzt müssen Sie nur noch auf die Anweisungen des CT-Personals achten, das Sie zum Beispiel bittet, den Atem kurz anzuhalten oder bestimmte Körperteile besonders ruhig zu halten. … Von der Erstellung der Bilder spüren Sie genauso wenig wie bei herkömmlichen Röntgenuntersuchungen; Sie hören lediglich ein leises Summen. Während der gesamten Untersuchung bewegt sich die Patientenliege ein wenig. … Eine Schwangerschaft sollten Sie Ihrem Arzt unbedingt mitteilen. Genau wie andere Röntgenuntersuchungen darf auch eine Computertomographie während der Schwangerschaft wegen der Strahlenbelastung nicht durchgeführt werden. … Bei einer Computertomographie wird mit Röntgenstrahlung gearbeitet. Dabei wird die Strahlenbelastung für Sie so gering wie möglich gehalten. Das kompetente und erfahrene CT-Personal greift heute auf eine ganze Reihe von Funktionen zur Reduzierung der Strahlendosis zurück. Die Technologie moderner Computertomographen ist auf die konsequente Verringerung der Strahlenbelastung für Patienten und Personal ausgerichtet."
Dass dies ein erheblicher Irrtum ist, ein unterschätztes langfristiges gesundheitliches Risiko existiert und welche Alternativen es dann für einen bedeutenden Anteil der CT-Diagnostik gibt, fassen nun die US-amerikanischen Radiologen David Brenner und Eric Hall vom "Center for Radiological Research am Columbia University Medical Center in New York in ihrem Aufsatz "Computed Tomography - An increasing source of radiation exposure" in der jüngsten Ausgabe des renommierten Medizin-Journals "The New England Journal of Medicine (NEJM)" (2007; 357: 2277-84) zusammen.
Als erstes weisen sie darauf hin, dass die CT-Diagnostik trotz aller technischen Versprechen der Hersteller größere Strahlungsdosen zur Gewinnung eines Bildes einsetzt als die konventionelle Röntgendiagnostik.
Trotz des von den Autoren beklagten Mangels an spezifischen epidemiologischen zum Erkrankungs- und insbesondere Krebsrisiko von CT, weisen sie auf bekannte Zusammenhänge von niedrig dosierter Strahlenbelastung und langfristigen Erkrankungsrisiken bei Arbeitern in der Nuklearindustrie und Atombomben-Überlebenden hin: Die "400.000 radiation workers in the nuclear industry … were exposed to an average dose of approximately 20 mSv (a typical organ dose from a single CT scan for an adult). A significant association was reported between the radiation dose and mortality from cancer in this cohort (with a significant increase in the risk of cancer among workers who received doses between 5 and 150 mSv); the risks were quantitatively consistent with those reported for atomicbomb survivors. The situation is even clearer for children, who are at greater risk than adults from a given dose of radiation, both because they are inherently more radiosensitive and because they have more remaining years of life during which a radiation-induced cancer could develop. In summary, there is direct evidence from epidemiologic studies that the organ doses corresponding to a common CT study (two or three scans, resulting in a dose in the range of 30 to 90 mSv) result in an increased risk of cancer. The evidence is reasonably convincing for adults and very convincing for children." Die Messgröße "mSv"=Microsievert ist eine Maßeinheit für Strahlenbelastung.
Und: "Although the individual risk estimates shown are small, the concern about the risks from CT is related to the rapid increase in its use — small individual risks applied to an increasingly large population may create a public health issue some years in the future. On the basis of such risk estimates and data on CT use from 1991 through 1996, it has been estimated that about 0.4% of all cancers in the United States may be attributable to the radiation from CT studies. By adjusting this estimate for current CT use, this estimate might now be in the range of 1.5 to 2.0%."
Auf die besonderen Risiken und die häufig nicht bestehende medizinische Notwendigkeit, Kinder mit CT zu diagnostizieren, wiesen im Übrigen das US-"National Cancer Institute" und die US-"Society of Pediatric Radiology" in der 2002 erschienenen vierseitigen Broschüre "Radiation risks and pediatric computed tomography (CT): a guide for health care providers. hin.
Bereits 2006 und dann nochmals 2007 verdeutlichten Vertreter des BfS auch für Deutschland kritische Entwicklungen und Missverständnisse der Risikokonstellation: Auch wenn der Anteil der CT an der Gesamthäufigkeit aller Röntgenuntersuchungen im Jahre 2004 mit 7% gering erscheint, so schlägt er sich doch in einer hohen Strahlenbelastung nieder: Die CT trägt mehr als die Hälfte der gesamten Strahlendosis durch röntgendiagnostische Maßnahmen in der Bevölkerung bei. Obwohl die Röntgenverordnung zwingend die ärztliche Rechtfertigung jeder Strahlenanwendung vorschreibt, der Nutzen also nachweisbar deutlich größer sein muss als das Risiko, boomen besonders CTs als Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchungen bzw. als "Manager-Check", der meist als Privatleistung angeboten und abgerechnet wird.
Bereits in einer Auswertung für die Jahre 1996 bis 2003 hatte das BfS gefordert, das Risikogeschehen aus mehreren Blickwinkeln zu bewerten: "Die - rein rechnerische - effektive Dosis pro Einwohner in Deutschland für das Jahr 2003 (beläuft sich) auf ca. 1,7 mSv und stieg damit über den Beobachtungszeitraum nahezu kontinuierlich an. Der festgestellte Dosisanstieg ist im Wesentlichen durch die Zunahme der CT-Untersuchungshäufigkeit bedingt. Demgegenüber zeigt die Kurve für die effektive Dosis pro Einwohner bei den restlichen Untersuchungsverfahren einen über die Jahre 1996 bis 2003 abnehmenden Verlauf. Die CT sowie die ebenfalls dosisintensive Angiographie (einschließlich interventioneller Maßnahmen) tragen nur wenig zu der Gesamthäufigkeit bei, ihr Anteil an der kollektiven effektiven Dosis betrug im Jahr 2003 jedoch mehr als zwei Drittel." Insbesondere die vielgepriesenen hochaufgelösten tomographischen Bilder treiben die verabreichte Röntgenstrahlung nach oben. Im Vergleich mit einer Standard- Röntgenuntersuchung erhöht sich bei einer hochdifferenzierenden CT-Aufnahme des Brustkorbs die Strahlendosis um das mehr als 170-fache.
Brenner und Hall schlagen in ihrem Aufsatz drei Vorgehensweisen vor, die CT-Häufigkeit und damit die dadurch entstehende Strahlenbelastung zu reduzieren:
• Erstens die Senkung der individuellen Dosen durch technische Vorrichtungen an den Computertomographen (automatische Expositionskontrolle),
• zweitens den Ersatz der CT-Diagnostik durch andere bildgebenden Verfahren wie dem Ultraschall oder der Magnetresonanztomographie.
• Der dritte "most effective way to reduce the population dose from CT is simply to decrease the number of CT studies that are prescribed. From an individual standpoint, when a CT scan is justified by medical need, the associated risk is small relative to the diagnostic information obtained. However, if it is true that about one third of all CT scans are not justified by medical need, and it appears to be likely, perhaps 20 million adults and, crucially, more than 1 million children per year in the United States are being irradiated unnecessarily."
Vor einer möglicherweise beim verstärkten Einsatz von röntgenstrahlenfreier Alternativmethoden entstehenden Illusion, deren Anstieg würde ohne weitere zusätzliche Anstrengungen die Häufigkeit der CT-Untersuchungen senken, warnte das BfS bereits 2006 wiederum in seiner empirischen Untersuchung über CT in Deutschland: "Bemerkenswert ist die parallele Zunahme von MRT- (Magnetresonanztomographie), Ultraschall- und CT-Untersuchungen. Die Zunahme alternativer Untersuchungsverfahren ohne Anwendung von Röntgenstrahlen führt somit entgegen den ursprünglichen Erwartungen nicht zu einer Abnahme der Untersuchungsfrequenz von CT-Anwendungen."
Von dem Aufsatz "Computed Tomography - An increasing source of radiation exposure" von Brenner und Hall gibt es ein nicht besonders üppiges Abstract und am 29. November 2007 auch noch die kostenlos als PDF-Datei herunterladbare 8-Seiten-Langfassung.
Sollte diese Möglichkeit verschwunden sein, ist bei dem derzeitigen Eurokurs gegenüber dem US-Dollar aber auch zu überlegen, ob man sich nicht ein Einjahres-Online-Abo des NEJM (samt Nutzung des Archivs bis in die 1990er Jahre zurück) zum Preis von 99 US-$ plus Steuern (also einem Betrag, der häufig viel höher eingeschätzt wird) gönnt oder zu Weihnachten schenken lässt.
Bernard Braun, 30.11.2007
Entdeckungsraten von Missbildungen bei Ultraschalluntersuchungen - Wenig Wissen über die Rolle von Qualifikation und Geräten.
 Praktisch bei jeder schwangeren Frau in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern werden im Verlauf der Schwangerschaft mehrere Ultraschalluntersuchungen des ungeborenen Kindes durchgeführt, in der u.a. nach der Lage, dem Wachstum, Missbildungen und - natürlich völlig zufällig - nach dem Geschlecht des Kindes gesucht wird. Bei erkennbaren Problemen kann die Anzahl der Ultraschalluntersuchungen über die Mindestanzahl von Untersuchungen hinaus erhöht werden. Im Rahmen der "für-alle-Fälle"- oder Wohlfühlmedizin bieten nicht wenige Frauenärzte mittlerweile auch als so genannte "Individuelle Gesundheitsleistung" und auf Privatrezept weitere, nicht medizinisch indizierte Untersuchungen an: das "Baby-Fernsehen".
Praktisch bei jeder schwangeren Frau in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern werden im Verlauf der Schwangerschaft mehrere Ultraschalluntersuchungen des ungeborenen Kindes durchgeführt, in der u.a. nach der Lage, dem Wachstum, Missbildungen und - natürlich völlig zufällig - nach dem Geschlecht des Kindes gesucht wird. Bei erkennbaren Problemen kann die Anzahl der Ultraschalluntersuchungen über die Mindestanzahl von Untersuchungen hinaus erhöht werden. Im Rahmen der "für-alle-Fälle"- oder Wohlfühlmedizin bieten nicht wenige Frauenärzte mittlerweile auch als so genannte "Individuelle Gesundheitsleistung" und auf Privatrezept weitere, nicht medizinisch indizierte Untersuchungen an: das "Baby-Fernsehen".
Den gesetzlich angebotenen Untersuchungen "entkommt" also praktisch kein Kind und kein Elternpaar, Ultraschalluntersuchungen stellen daher praktisch ein Screening einer Bevölkerungsgruppe dar. Insofern ist die Frage berechtigt, ob sie wirklich alle theoretisch auftretenden und mit der Sonografie entdeckbaren gesundheitlichen Anomalien und Probleme des Kindes entdecken bzw. deren Existenz zweifelsfrei ausschließen und die von Natur aus und durch einen Teil der öffentlichen Kommunikation über Missbildungsrisiken eher übervorsichtigen Eltern wirklich beruhigt sein dürfen.
Ob sie dies wirklich sein können oder nur mit Einschränkungen und was getan werden muss, um mögliche Schwachstellen zu beseitigen, war und ist eine der Aufgaben einer umfassenden Analyse der Wirklichkeit der Ultraschalluntersuchung und ihres zunächst einmal "vorläufig" dargestellten Nutzens, die das gerade auch für solche Klärungen 2004 per Gesetz gegründete unabhängige wissenschaftliche "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" in Köln erstellt und jetzt veröffentlicht hat.
Das Institut arbeitet im Auftrag des "Gemeinsamen Bundesausschusses" und hatte in diesem Fall den konkreten Auftrag erhalten, die Testgüte des Ultraschallscreenings in der Schwangerschaft hinsichtlich der Entdeckungsrate fetaler Anomalien zu ermitteln und dabei unterschiedliche Screeningmodalitäten und besonders die so genannte "Nackentransparenz" zu berücksichtigen. Die maximale Dicke der Unterhautschicht ("Nackenfalte") über der zervikalen Wirbelsäule, die sich im Ultraschall als vermehrt schalldurchlässig erweist, erlaubt ein adjustiertes Risiko für das Vorliegen einer Chromosomenanomalie zu berechnen.
Der Versorgungshintergrund ist kurz gefasst der, dass trotz einer seit 1997 in Deutschland abgeschafften flächendeckenden systematischen Erhebung pränatal diagnostizierter Fehlbildungen davon ausgegangen wird, dass ein Viertel aller kindlichen Todesfälle in Zusammenhang mit angeborenen Fehlbildungen gebracht werden kann. Kinder mit Fehlbildungen machen etwa ein Drittel aller stationären pädiatrischen Aufnahmen aus.
Ein 222 Seiten umfassender Vorbericht ist jetzt am 13. November 2007 erschienen und zeigt auf der Basis von 641 Studien in 18 Sprachen, von denen 62 in die IQWiQ-Analysen einbezogen wurden, mehrerlei:
• Entgegen spontaner Erwartungen gibt es bei dieser derartig verbreiteten und relevanten Untersuchungsmethode nirgendwo breit angelegte und qualitativ wie methodisch hochwertige Studien über ihre Ergebnisqualität, die Entdeckungsquoten und vor allem die Determinanten der in den wenigen dazu durchgeführten Studien erkennbaren Unterschiedlichkeit der Untersuchungsqualität.
• Die Gutachter fanden aber in den 62 Studien immer wieder Hinweise auf höhere Erfolgsraten der Ultraschallmessungen und guter Messungen der Nackenfalte bei höherer Qualifikation / größerer Erfahrung der Untersucher bzw. besserer Qualität der Geräte.
• Die Wissenschaftler fanden keine Studien, in denen untersucht wurde, welche Auswirkungen unterschiedliche Qualifikationen der Untersucher oder Qualitäten der Geräte auf die Zuverlässigkeit des deutschen Untersuchungsprogramms haben. Zur Bewertung der Ergebnisqualität bzw. der Entdeckungsrate des in Deutschland etablierten Mehrstufenkonzepts und der Abhängigkeit dieser Detektionsrate von der jeweiligen Erfahrung der Untersucher bzw. den jeweils eingesetzten Geräten fanden die IQWiQ-Forscher keine Diagnosestudie.
• Zweitens zeigt z. B. eine europaweite Untersuchung eine regional massiv variierende Entdeckungsrate von 25% in Zagreb, Kroatien und 88% in Paris, Frankreich. Ob es in Deutschland selber vergleichbar hohe regionale Unterschiede gibt, kann man mangels gezielter Untersuchungen nicht sagen, aber auch nicht ausschließen.
• Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Berichts lauten: "Ein Screeningprogramm sollte von Qualitätssicherungsmaßnahmen begleitet werden, die sich sowohl auf die Fähigkeiten der Untersucher als auch auf die Qualität der Geräte (Alter, Wartung, Software-Update, Schulungen) beziehen. Welche konkreten Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Qualifikation der Untersucher bzw. Qualität der Geräte notwendig sind, lässt sich aus den eingeschlossenen Studien dieses Berichts jedoch nicht eindeutig ableiten. Um dem aktuellen Stand der Technik zu genügen, sollten allerdings alle eingesetzten Geräte über 256 Graustufen verfügen." Und: "Die Detektionsraten, die mit dem in Deutschland etablierten Mehrstufenkonzept erzielt werden, sollten in prospektiven Studien genau untersucht werden. Bei der Planung dieser Studien sollten die Qualifikation der Untersucher und Qualität der Geräte als zentrale Einflussfaktoren berücksichtigt werden." Schließlich plädieren die Berichterstatter auch für die Einführung bzw. verstärkte Nutzung von Pränatalregistern in Deutschland.
Der Zwischenbericht beinhaltet umfangreiche Darstellungen der 62 Studien und einiger daraus abgeleiteter Studienliteratur und gibt auch Informationen über die Relevanz und die Details der Ultraschall- und Nackenfaltenuntersuchungen, die selbst für vorgebildete Laien verständlich sind.
Die komplette PDF-Version des Vorberichts "Ultraschallscreening in der Schwangerschaft: Testgüte hinsichtlich der Entdeckungsrate fetaler Anomalien" (Vorbericht S05-03) ist kostenlos über die Website des IQWiQ erhältlich.
Bernard Braun, 15.11.2007
Report "Krank im Krankenhaus": Übermäßiger Antibiotika-Einsatz und mangelnde Hygiene in Kliniken werden zu einer Gefahr
 In Europa infiziert sich jeder zehnte Krankenhauspatient in der Klinik. Jährlich erkranken mindestens drei Millionen Menschen an so genannten nosokomialen Infektionen, mehr als 50.000 sterben sogar daran. Allein in Deutschland infizieren sich pro Jahr zwischen 500.000 und einer Million Menschen im Rahmen von Klinikenaufenthalten mit Erregern von Krankenhausinfektionen. Bei Patienten auf Intensivstationen liegt das Infektionsrisiko sogar bei über 15 Prozent. Besorgniserregend ist vor allem die Tatsache, dass die für die Infektion ursächlichen Bakterien oft mit herkömmlichen Antibiotika nicht mehr zu bekämpfen sind. So konnten sich "Superbakterien" wie der multiresistente Staphylococcus aureus (MRSA) entwickeln, welche leicht übertragbar, schwer zu bekämpfen und die häufigste Ursache für lebensbedrohliche Infektionen bei Klinikpatienten sind.
In Europa infiziert sich jeder zehnte Krankenhauspatient in der Klinik. Jährlich erkranken mindestens drei Millionen Menschen an so genannten nosokomialen Infektionen, mehr als 50.000 sterben sogar daran. Allein in Deutschland infizieren sich pro Jahr zwischen 500.000 und einer Million Menschen im Rahmen von Klinikenaufenthalten mit Erregern von Krankenhausinfektionen. Bei Patienten auf Intensivstationen liegt das Infektionsrisiko sogar bei über 15 Prozent. Besorgniserregend ist vor allem die Tatsache, dass die für die Infektion ursächlichen Bakterien oft mit herkömmlichen Antibiotika nicht mehr zu bekämpfen sind. So konnten sich "Superbakterien" wie der multiresistente Staphylococcus aureus (MRSA) entwickeln, welche leicht übertragbar, schwer zu bekämpfen und die häufigste Ursache für lebensbedrohliche Infektionen bei Klinikpatienten sind.
Im Report der Allianz Krankenversicherung und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene "Krank im Krankenhaus. Resistente Erreger - eine schleichende Gefahr für Mensch und Gesundheitssysteme" werden die wichtigsten Fakten zusammengetragen und verständlich aufbereitet. Ursache für die Bildung und Ausbreitung von Resistenzen ist der oft wahllose beziehungsweise unnötige Einsatz von Antibiotika. Ein Drittel aller Krankenhauspatienten erhalten Antibiotika, ein großer Teil davon ist jedoch entbehrlich. Begünstigt wird die Resistenzentwicklung durch falschen Einsatz, Unterdosierung sowie zu kurze oder zu lange Anwendungsdauer.
Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene fordert eine gesamtnationale Präventionsstrategie. Denn auf Grund ihrer gesetzlichen Hoheit legen die Bundesländer die Umsetzung der Krankenhaushygiene selbst fest. "Nur vier Bundesländer haben bislang eine Krankenhaushygieneverordnung", sagt Axel Kramer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und Direktor des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Universität Greifswald. Die Politik müsse endlich das Problem der Krankenhaushygiene in Deutschland oben auf ihre Agenda nehmen."In Akutkrankenhäusern mit mehr als 450 Betten brauchen wir hauptamtliche Krankenhaushygieniker und für je 300 Betten muss eine speziell ausgebildete Krankenschwester für Krankenhaushygiene zur Verfügung stehen", so Kramer. Außerdem müssten von staatlicher Seite zusätzliche Kapazitäten für die Ausbildung der Medizinstudenten sowie Weiterbildungskapazitäten für Fachärzte für Hygiene geschaffen werden. "Diese Vorgaben müssen gleichzeitig verbindlich in den Hygieneverordnungen der einzelnen Bundesländer festgeschrieben werden", fordert der Präsident der DGKH. "Um diese Regelungen auf breiter Basis durchzusetzen, sollten Krankenkassen schließlich nur noch Verträge mit Krankenhäusern schließen dürfen, die ein wirksames Qualitätsmanagement für Hygiene etabliert haben."
Der Bericht enthält neben mehreren Interviews, einem Glossar, Literaturverzeichnis und Links folgende Beiträge:
• Von Moses, Robert Koch und der Erfindung des Penicillins, Exkurs: Mit Schimmelpilzen gegen Bakterien
• Im Krankenhaus erkranken: Viren, Bakterien, Pilze oder Protozoen - eine gefährliche Vielfalt, Woher die Erreger kommen, Wie sich Erreger ausbreiten, Drei Millionen Infizierte in Europa
• Resistente Erreger sind auf dem Vormarsch: Wie ein Erreger resistent gegen Antibiotika wird, Wie sich ein Erreger der Wirkung von Antibiotika entzieht, Wie sich Resistenzen bestimmen lassen, Antibiotika haben erst dazu geführt, 3.5 Mediziner warnen vor einer wehweiten Krise
• Die "Superbakterien": Warum Erreger auch multi-resistent sein können, Die Problemkeime, Methicillin-resistente Staphylococcus aureus - MRSA, Vancoraycin-resistente Enterokokken - VRE, Extend spectrum Beta-Lactamase bei Enterobakterien - ESBL
• Die Überwachung der Problemkeime: Exkurs: §23 Infektionsschutzgesetz und das Krankenhaus Infektions Surveillance System KISS, Nebenwirkungen auf Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften, Erhebliche Belastungen für das Gesundheitssystem, Gesellschaftliche Kosten, Exkurs: Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft, Vorbeugen ist billiger, Wer für eine nosokomiale Infektion haftet
• Der Kampf gegen resistente Erreger: Nosokomiale Infektionen sind kaum zu vermeiden, Maßnahmenkatalog, Deutschland kann von Dänemark und den Niederlanden lernen
Download der Studie Studie "Krank im Krankenhaus" - Resistente Erreger - eine schleichende Gefahr für Mensch und Gesundheitssysteme
(PDF, 56 Seiten)
Gerd Marstedt, 4.10.2007
Wo hören ärztliche Beratungs- und Aufklärungspflichten auf und fängt die Eigeninitiative des Versicherten an?
 In der gesundheitspolitischen Debatte spielen Appelle an die Eigenverantwortung und Eigeninitiative von Versicherten und Patienten eine größer werdende Rolle. Ähnliches trifft auf die Beratungs- und Aufklärungspflichten von Ärzten und anderen Leistungserbringern zu. In den Konzepten für "informed consent" und "shared decision making" treffen sich die beiden Stränge - im Idealfall zum Vorteil aller Beteiligter.
In der gesundheitspolitischen Debatte spielen Appelle an die Eigenverantwortung und Eigeninitiative von Versicherten und Patienten eine größer werdende Rolle. Ähnliches trifft auf die Beratungs- und Aufklärungspflichten von Ärzten und anderen Leistungserbringern zu. In den Konzepten für "informed consent" und "shared decision making" treffen sich die beiden Stränge - im Idealfall zum Vorteil aller Beteiligter.
Dass es in der Praxis manchmal gar nicht so einfach ist, zu bestimmen, ob und wo die Beratungs- und Aufklärungspflicht von Ärzten aufhört und definitiv wie ausschließlich die Eigeninitiative des Versicherten beginnt, zeigt ein Streitfall zwischen einer Patientin und ihrem behandelnden Zahnarzt, der vor einigen Monaten nach einem erstinstanzlichen Verfahren vor dem Landgericht (LG) Duisburg vom Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf (Aktenzeichen I-8 U 120/06) zu Lasten der Patientin entschieden wurde.
Im Streitfall ging es darum, dass bei der Patientin wegen eines u.a. durch starke Parodontose geschädigten Gebisses eine umfangreiche Gebisssanierung mit der Extraktion mehrerer Zähne erfolgen musste. Die Patientin machte für diesen Zustand ihres Gebisses ihren Zahnarzt verantwortlich. Dieser habe sie "obwohl sie sich regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen vorgestellt habe, in den Jahren 1990 bis 2004 nicht sachgerecht zahnärztlich betreut; insbesondere habe sie die erforderliche Aufklärung über die von ihr...selbst zu beachtende Mundhygiene unterlassen. Auch habe (der Zahnarzt) nicht auf einen sich verschlechternden Zustand ihres Zahnbestandes hingewiesen." Die Klägerin forderte daher die Übernahme des Eigenanteils an der Behandlung und ein Schmerzensgeld von ihrem Zahnarzt. Dieser wehrte sich dagegen und verwies darauf, dass die "Klägerin die erforderliche Mundhygiene trotz ihr erteilter Hinweise auf den sich verschlechternden Zustand der Zähne und deren erforderliche Pflege vernachlässigt habe" und auch "seit 1995...Kontrolltermine zudem nur unregelmäßig wahrgenommen" habe.
Am Landgericht Duisburg wurde die Klage abgewiesen und musste nach der Berufung der Klägerin daher beim OLG entschieden werden.
Bereits das Landgericht hatte sich substanziell mit der Grenze der Beratungs- und Aufklärungspflicht des Zahnarztes beschäftigt und dazu u.a. folgendes festgestellt: "Ein Zahnarzt sei nicht verpflichtet, seinem Patienten zu erklären, dass und wie er seine Mundhygiene zu betreiben habe. Eine solche Verpflichtung sei einerseits grundsätzlich abzulehnen. Es könne andererseits erwartet werden, dass der Patient Eigeninitiative aufbringe, sich über die anzuwendende Mundhygiene selbst Kenntnis zu verschaffen, was nach Auffassung des Gerichts auch ohne großen Aufwand möglich wäre. Auch aus dem Gesichtspunkt, dass die Maßnahmen des Patienten im Rahmen seiner Mundhygiene nicht ausreichend seien, sah das Gericht keine Hinweispflicht des behandelnden Zahnarztes. Es sei nicht Aufgabe eines Zahnarztes, der feststellt, dass ein Patient sich nicht ordentlich die Zähne putzt, diesen dazu anzuhalten. Etwas anderes könne nach der Auffassung des Landgerichts nur dann gelten, wenn der Patient, für den Zahnarzt erkennbar, zu eigenverantwortlichem Handeln nicht in der Lage sei. Die Eigenverantwortung des Patienten überwiege vorliegend in einem hohen Maße."(so die Zusammenfassung des LG-Urteils durch die Fachanwältin für Medizinrecht, Eva Forster, auf der Website MedizinRecht.de.
Das OLG bestätigte zum einen diese Urteilsbegründung und hob zusätzlich zur Begründung seiner Ablehnung der Klägerin noch einige interessante Argumente hervor:
• Es konzedierte es wegen der bei Patienten "regelmäßig nicht vorhandenen genauen Einsicht in das Behandlungsgeschehen und des Fehlens von erforderlichem Fachwiesen" für die "Substantiierungspflicht eines Klägers im Arzthaftungsprozess" lediglich "maßvolle und verständige Anforderungen".
• Trotzdem müssen aber im Streitfall konkrete Hinweise erfolgen und nicht lediglich pauschale Behauptungen.
• Es könne "im Einzelfall Aufgabe des Zahnarztes sein..., seinen Patienten über eine geeignete Zahnpflege aufzuklären und dabei auch eine Änderung der Reinigungsgewohnheiten anzusprechen."
• Selbst wenn man einen Anspruch auf Aufklärung und Beratung annimmt, hält das OLG es aber insgesamt für die "Sache der Klägerin, das Unterbleiben des von der Beklagten behaupteten Aufklärung über ihre Mundhygiene und die zu treffenden Maßnahmen zu beweisen." Wie dies gehen soll, sagt das Gericht aber nicht.
Der komplette Text des Urteils des OLG Düsseldorf findet sich hier.
Bernard Braun, 16.9.2007
Harvard Medical School: Unerwünschte Wirkungen von langen Arzt-Arbeitszeiten und Schlafmangel auf Patienten und Ärzte.
 Nicht erst seitdem Arbeitszeitvorschriften der EU den Abbau überlanger Arbeits-, Schicht- oder Bereitschaftsdienste für Krankenhausärzte in Deutschland erzwangen, sondern eigentlich schon vorher waren die Risiken der tage-und nächtelangten Bereitschaftsdienste für die Gesundheit der Ärzte und vor allem für die Gesundheit und Sicherheit der von oft übermüdeten Ärzten behandelten Patienten klar gewesen.
Nicht erst seitdem Arbeitszeitvorschriften der EU den Abbau überlanger Arbeits-, Schicht- oder Bereitschaftsdienste für Krankenhausärzte in Deutschland erzwangen, sondern eigentlich schon vorher waren die Risiken der tage-und nächtelangten Bereitschaftsdienste für die Gesundheit der Ärzte und vor allem für die Gesundheit und Sicherheit der von oft übermüdeten Ärzten behandelten Patienten klar gewesen.
Gestützt wurde dies u.a. durch eine Fülle von Forschungsergebnissen aus den USA über die Auswirkungen von Übermüdung, die wir exemplarisch einem Überblicksartikel "Safety of Medical Residents' Long Hours Questioned" des National Public Radio [NPR] aus dem Jahr 2005 entnehmen.
Dabei zeigte sich beispielsweise, dass
• sich 24 Stunden Schlaflosigkeit oder -mangel ungefähr so auswirken wie ein Blutalkoholspiegel von 1 Promille,
• sich die durchschnittliche Reaktionszeit bei Individuen, die 24 Stunden hintereinander wach waren verdreifachte,
• sich Aufmerksamkeitsfehler bei den Ärzten häuften, die 24 aufeinanderfolgende Stunden arbeiteten bzw. in Rufbereitschaft waren,
• solche Fehler bei den Ärzten, die in einer 30-Stundenschicht arbeiteten, doppelt so häufig auftraten als bei ihren Kollegen, die 16 Stunden am Stück arbeiteten und
• dass es bei 30-Stundenschicht-Ärzten zu 36 % mehr ernsten medizinischen Irrtümern kam als bei den 16-Stundenschicht-Ärzten.
Wer noch mehr über das Thema langer Arbeitszeiten, Schlaf und Müdigkeit von Ärzten (differenziert nach Ärzten im Praktikum, Assistenzärzten und Fachärzten) und die vielfältigen Auswirkungen dieser Bedingungen in den USA und damit wenigstens teilweise auch in Deutschland wissen will, findet dies in konzentrierter Form auf einer speziellen Website des Bostoner "Brigham and Women's Hospital" und der "Harvard Medical School", die sie zu ihrem Forschungs- und Dokumentationsvorhaben "Harvard Work hours, health and safety study" gestaltet haben. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Situation bei Assistenzärzten bzw. in postgraduierter Ausbildung befindlicher Ärzte in Krankenhäusern ("medical residents").
Auf der Seite finden sich u.a. komplette Originalveröffentlichungen vor allem aus dem Projekt in den beiden anerkannten us-amerikanischen Medizinjournals "New England Journal of Medicine (NEJM)" und "Journal of American Medical Association (JAMA)" zu Themen wie "Fatigue among Clinicians and the Safety of Patients" oder "Effects of Sleep Inertia on Cognition". Ergänzt werden diese wissenschaftlichen Arbeiten um Links zu Organisationen und ihren Materialien über die Auswirkungen von langen Arbeitszeiten und Schlafmangel. Zum Schluss gibt es die Möglichkeit, einen informellen Survey der beiden Institutionen über KFZ-Unfälle, Beinahe-Unfälle, medizinische Fehler und andere unerwünschte Folgen von Schlafmangel von Ärzten mit Berichten zu bedienen.
Auch die Endergebnisse der seit einiger Zeit in der Datenerfassung beendeten "Harvard Work hours, health and safety study" und weitere Forschungsergebnisse sollen auf der Website künftig zugänglich gemacht werden.
Bernard Braun, 7.8.2007
Medizinische Fehler, Irrtümer oder Beinah-Fehler erhöhen das Stressniveau von Ärzten - Spezielle Unterstützung notwendig
 Über der Einführung anonymer oder innerprofessionell-vertraulicher Foren und Systeme zur Dokumentation von gravierenden und folgenschweren medizinischen Fehlern und zur diskursiven Klärung der Ursachen und Verhinderungsmöglichkeiten wird meist die subjektive Seite der Fehler vergessen oder vernachlässigt.
Über der Einführung anonymer oder innerprofessionell-vertraulicher Foren und Systeme zur Dokumentation von gravierenden und folgenschweren medizinischen Fehlern und zur diskursiven Klärung der Ursachen und Verhinderungsmöglichkeiten wird meist die subjektive Seite der Fehler vergessen oder vernachlässigt.
In einer Studie, deren Ergebnisse im August 2007 in der US-Zeitschrift "Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety" in einem Aufsatz veröffentlicht werden, wurde daher untersucht, ob es mit den genannten rationalen und professionellen Verarbeitungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten getan ist oder ob solche Ereignisse weit tiefer in das Innenleben von Ärzten einwirken als bisher gedacht.
Dazu wurden 3.171 Ärzte in St. Louis, Seattle und Canada (von 4.990 angeschriebenen Internisten, Pädiatern, Familienärzten und Chirurgen, was eine Antwortquote von 64 % bedeutet) ausführlich zu ihren Erfahrungen mit ärztlichen "Kunstfehlern" befragt:
• 2.909 (91,7 %) von ihnen sagten, sie wären in ihrem Ärzteleben bereits in ernsthafte oder auch geringfügigeren medizinischen Fehler oder Beinah-Fehler involviert gewesen.
• 61 % dieser Gruppe sagten, sie hätten dadurch unter verstärktem Stress und Angst über die Möglichkeit künftiger Fehler und Irrtümer gelitten.
• 44 % gaben an, das Vertrauen in ihre professionellen Fähigkeiten verloren zu haben.
• 42 % hatten Schlafprobleme und derselbe Anteil waren nach dem Zwischenfall weniger mit ihrem Job zufrieden.
• 13 % fürchteten für ihre Reputation.
Verstärkter Stress trat sowohl bei Ärzten auf, die einen medizinischen Fehler begangen hatten als auch bei jenen, die beinahe versagt hätten (von ihnen ein Drittel).
Nur 10 % der Ärztegruppe mit dieser Erfahrung bekamen von ihren Gesundheitseinrichtungen Unterstützung bei der Bewältigung ihres fehlerbezogenen Stress. Eine besondere und gesonderte Unterstützung ist aber nach Meinung der Forscher notwendig, um bei den gestressten Ärzten eine Aufgabe der Tätigkeit, die Entwicklung von Depressionen und vor allem weitere Fehler zu vermeiden.
Ein Abstract des Aufsatzes "The Emotional Impact of Medical Errors on Practicing Physicians in the United States and Canada" von Waterman, Amy D.; Garbutt, Jane; Hazel, Erik; Dunagan, William Claiborne; Levinson, Wendy; Fraser, Victoria J. und Gallagher, Thomas H. in der Zeitschrift "Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety" (Volume 33, Number 8, August 2007: 467-476) ist hier kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.7.2007
Professionelle Dolmetscher für Patienten mit fremder Muttersprache helfen Behandlungsqualität zu verbessern.
 Eines der vielen mit der weltweiten Migration verbundenen Probleme ist das der Kommunikation von fremdsprachigen oder nur schlecht mit der nationalen Sprache vertrauten Patienten mit den sie behandelnden Ärzten und Pflegekräfte. Selbst ausländische Patienten, die sich im Alltag gut verständigen können, haben als leidender Patient und auf dem auch sprachlich ungewohnten Feld der Kommunikation über ihre Beschwerden und deren Linderung, Schwierigkeiten sich auszudrücken. Gleichzeitig werden sie von Ängsten beherrscht, dass aus Kommunikationsschwierigkeiten Behandlungsfehler resultieren.
Eines der vielen mit der weltweiten Migration verbundenen Probleme ist das der Kommunikation von fremdsprachigen oder nur schlecht mit der nationalen Sprache vertrauten Patienten mit den sie behandelnden Ärzten und Pflegekräfte. Selbst ausländische Patienten, die sich im Alltag gut verständigen können, haben als leidender Patient und auf dem auch sprachlich ungewohnten Feld der Kommunikation über ihre Beschwerden und deren Linderung, Schwierigkeiten sich auszudrücken. Gleichzeitig werden sie von Ängsten beherrscht, dass aus Kommunikationsschwierigkeiten Behandlungsfehler resultieren.
Daher wird schon lange versucht, diesen Problemen mit dem Einsatz von professionellen Dolmetschern zu begegnen. Ob dies aber wirklich zur Verbesserung der medizinischen Behandlung führt, blieb lange unklar.
Diese Wissenslücke schließt jetzt ein von Forschern der Universität von Kalifornien durchgeführter systematischer Literatur-Review über den Einsatz von Dolmetschern bei der Behandlung von Patienten mit limitierten Englischkenntnissen.
Der Review untersuchte dazu die zwischen 1966 und 2005 veröffentlichte wissenschaftliche Literatur, die in PubMed, PsycINFO und der Cochrane Library dokumentiert war. Dabei wurde jeder peer-reviewte Aufsatz betrachtet, der mindestens zwei Gruppen mit unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten verglich und Daten über den Einsatz von Dolmetschern und z. B. die Ergebnisse und die Patientenzufriedenheit mit der klinischen Behandlung enthielt. Von 3.698 Aufsätzen und sonstigen Publikationen gingen am Ende die Ergebnisse von 49 Arbeiten in den Review ein.
Bei der Untersuchung von vier Behandlungselemente (Kommunikationsirrtümer und -intensität, Nutzung, Ergebnisse und Zufriedenheit), auf die sich wahrscheinlich sprachliche Ungleichheiten auf die Behandlungsqualität auswirken zeigte sich überall eine Verbesserung der Behandlung durch den Einsatz von professionellen Dolmetschern. Der Einsatz von ad hoc-Übersetzern zeigte deutlich geringere positive Wirkungen auf die Behandlungsqualität. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Ergebnisse auch auf andere Länder und deren Sprachbarrieren übertragbar.
Die Studie "Do Professional Interpreters Improve Clinical Care for Patients with limited english Proficiency? A Systematic Review of the Literature" von Karliner, Jacobs, Chen und Mutha wurde im April 2007 in der Fachzeitschrift "Health Services Research" (Volume 42, Issue 2: 727-754) veröffentlicht. Ein kostenloses Abstract ist hier erhältlich.
Bernard Braun, 16.7.2007
BGH pocht auf Selbstbestimmungsrecht des Patienten: Umfassende ärztliche Aufklärungspflicht bei Medikamentenwechsel
 Auch wenn das in der Flut von Gesundheitsreformgesetzen, Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses und den diese umsetzenden Rechtverordnungen etc. und im täglichen Behandlungsgeschehen untergehen mag: Auch die Rechtsprechung beeinflusst in etwas weniger spektakulärer aber manchmal wirksamerer Art und Weise die Bedingungen des gesundheitlichen Versorgung bis in das Arzt-Patientenverhältnis hinein.
Auch wenn das in der Flut von Gesundheitsreformgesetzen, Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses und den diese umsetzenden Rechtverordnungen etc. und im täglichen Behandlungsgeschehen untergehen mag: Auch die Rechtsprechung beeinflusst in etwas weniger spektakulärer aber manchmal wirksamerer Art und Weise die Bedingungen des gesundheitlichen Versorgung bis in das Arzt-Patientenverhältnis hinein.
Dieses Verhältnis ist jetzt durch ein höchstinstanzliches Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 17. April 2007 (Urteil des BGH vom 17.04.2007 - VI ZR 108/06) (im Volltext von 14 Seiten unter Nutzung des Aktenzeichens über die Website des BGH - Entscheidungen - kostenlos erhältlich) zur Arzthaftung für unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei Mittelwechsel im Sinne der Patienten gestärkt worden. Letzteres erfolgt vor allem dadurch, dass das Gericht eindeutig und unmissverständlich eine umfassende Aufklärungspflicht des Arztes festlegt, ohne deren Erfüllung der Arzt entweder kein neues Arzneimittel verordnen darf oder im Falle unerwünschter Wirkungen voll haftbar ist.
Diese Position ist in vier Feststellungen, darunter den beiden Leitsätzen des Urteils, ausformuliert:
• "a) Der Arzt hat den Patienten vor dem ersten Einsatz eines Medikaments, dessen Wirksamkeit in der konkreten Behandlungssituation zunächst erprobt werden soll, über dessen Risiken vollständig aufzuklären, damit der Patient entscheiden kann, ob er in die Erprobung überhaupt einwilligen oder ob er wegen der möglichen Ne-benwirkungen darauf verzichten will.
• b) Kann ein Patient zu der Frage, ob er bei zutreffender ärztlicher Aufklärung in einen Entscheidungskonflikt geraten wäre, nicht persönlich angehört werden (hier: wegen schwerer Hirnschäden), so hat das Gericht aufgrund einer umfassenden Würdigung der Umstände des Einzelfalls festzustellen, ob der Patient aus nachvoll-ziehbaren Gründen in einen ernsthaften Entscheidungskonflikt geraten sein könnte."
• "Der Arzt, der Medikamente, die sich als für die Behandlung der Beschwerden des Patienten ungeeignet erwiesen haben, durch ein anderes Medikament ersetzt, dessen Verabreichung für den Patienten mit dem Risiko erheblicher Nebenwirkungen verbunden ist, hat den Patienten zur Sicherung seines Selbstbestimmungsrechts über den beabsichtigten Einsatz des neuen Medikaments und dessen Risiken aufzuklären (sogenannte Eingriffs- oder Risikoaufklärung). Tut er dies nicht, ist die Behandlung rechtswidrig, auch wenn der Einsatz des Medikaments an sich sachgerecht war."
• Einen eindeutigen Riegel schiebt der BGH auch einer Art wohlgemeintem aber stillschweigenden Experiment vor: "Nicht zu billigen ist auch die Ansicht des Berufungsgerichts (einem Oberlandesgericht), der Einsatz eines neuen Medikaments sei ohne Einwilligung des Patienten vorübergehend zulässig, wenn zunächst ermittelt werden solle, ob das Medikament überhaupt anschlage und sich dessen Risiken in der Erprobungsphase der Medikation noch nicht auswirkten."
Diesen Urteilssätzen liegt der konkrete Fall einer Patientin zugrunde, der Ärzte einer Universitätsklinik zur Behandlung einer Herzstörung ein neues Medikament verabreichten während dessen Einnahme die Patientin eine Woche später einen Kreislaufstillstand mit zurückbleibenden Dauerschäden erlitt. Die Patientin sah ihren Zustand als Folge von Aufklärungs- und Behandlungsfehlern und klagte auf Schmerzensgeld und Schadenersatz. Das zuständige Landgericht und das Oberlandesgericht (OLG) als Berufungsgericht hatten die Klage abgewiesen. Mit den o.g. Argumenten folgt der BGH nicht der Argumentation der beiden niedrigeren Instanzen. Es verweist den konkreten Fall zurück zu einer neuen konkreten Verhandlung an das OLG.
Eine kommentierende juristische Darstellung des Urteils durch den Hamburger Rechtsanwalt Hohmann auf der Website des Fachdienstes "medizinrecht.de" weist noch auf eine sehr weitreichende potenzielle Kollision dieses BGH-Verständnisses von der ärztlichen Aufklärungspflicht mit einigen vom "Wettbewerbsstärkungsgesetz (WSG)" eröffneten ärztlichen Handlungsmöglichkeiten hin:
"Fraglich ist auch, ob unter dieser Rechtssprechung die vom ...WSG ...erhofften Einsparpotentiale durch umfangreiche Rabattverträge ab dem Jahr 2008 noch realisiert werden können. Nach Meldung der Ärzte-Zeitung vom 27.06.2007 erlauben Ärzte zunehmend die Substitution durch den Apotheker. 78% der Niedergelassenen schlossen eine Substitution nach Analyse des Marktforschungsinstituts IMS Health nicht aus, also 14% mehr als im Jahr 2005. Tritt ein Arzt den zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und Herstellern vereinbarten Rabattverträgen bei, so können die rabattierten Arzneimittel dann zum Einsatz gelangen, wenn der Arzt per Rezept aut-idem ("oder das Gleiche") zulässt, die Auswahl der Präparate erfolgt dann durch den Apotheker. Zum Zeitpunkt der Verordnung weiß der Arzt also nicht, welches Präparat der Apotheker herausgibt. Im Prinzip können Wechsel unter Generika folgenreich sein....Sobald nach ärztlichem Wissen bei der Umstellung von Arzneimitteln unerwünschte Arzneiwirkungen auftauchen könnten, haftet der Arzt somit auch für die richtige Auswahl durch den Apotheker. Ist die Auswahl durch den Apotheker nicht beherrschbar und steht ein Therapie- und damit auch ein haftungsrelevantes Risiko im Raum, ist aufgrund der Rechtssprechung aut-idem auszuschließen. Ersparnisse durch Rabattverträge können bei diesen Fällen nicht realisiert werden."
Wenn nicht auch noch der Apotheker eine vergleichbare Aufklärungspflicht dekretiert bekommt und damit eine nicht sinnvoll erscheinende Art Verdoppelung der aufklärungspflichtigen und haftenden Akteure entsteht, muss diese WSG-Regelung und ihre -Praxis auf den Prüfstand des Selbstbestimmungsrechts der Patienten, auch bei nur möglichem Arzneimittelwechsel.
Bernard Braun, 14.7.2007
Warum gefährden Ärzte und Pflegekräfte mit "1000 Gründen" gegen Handhygiene Patienten? Wenig Hoffnung auf Verbesserung!
 Eine möglichst lückenlose und gründliche Handhygiene ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um die Anzahl der in Deutschland zigtausendfachen, manchmal bis zum Tode von Patienten führenden nosokomialen, Krankenhausinfektionen oder "health care-associated infections (HCAI)" erheblich zu reduzieren. Dies bezieht seine Evidenz nicht nur aus dem "gesunden Menschenverstand", sondern schlägt sich auch in weltweit verbreiteten wissenschaftlichen Leitlinien nieder. Trotzdem hält sich eine erhebliche Zahl von Ärzten, Pflegekräften und anderen patientennah tätigen Personen nicht an diese Leitlinien, vernachlässigt die Handhygiene und gefährdet damit eindeutig PatientInnen.
Eine möglichst lückenlose und gründliche Handhygiene ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um die Anzahl der in Deutschland zigtausendfachen, manchmal bis zum Tode von Patienten führenden nosokomialen, Krankenhausinfektionen oder "health care-associated infections (HCAI)" erheblich zu reduzieren. Dies bezieht seine Evidenz nicht nur aus dem "gesunden Menschenverstand", sondern schlägt sich auch in weltweit verbreiteten wissenschaftlichen Leitlinien nieder. Trotzdem hält sich eine erhebliche Zahl von Ärzten, Pflegekräften und anderen patientennah tätigen Personen nicht an diese Leitlinien, vernachlässigt die Handhygiene und gefährdet damit eindeutig PatientInnen.
In einer kleinen, nichtrepräsentativen Befragung aus dem Jahr 1997 (Grol R. Personal Paper: Beliefs and evidence in changing clinical practice. British Medical Journal 1997; 315: 418-21) von 120 Ärzten und Pflegekräften aus 6 Pflegeheimen wurden diese gefragt, warum sie den auch damals bereits existierenden Leitlinien nicht folgen. Allgemein ist wichtig, dass dabei ein Bündel unterschiedlicher Obergründe genannt wurde und es "den" Grund nicht gibt. Diese reichen vom Wissen ("mir fehlt der harte Nachweis der Wirksamkeit"=43 % Zustimmung) über Motivation ("verursacht Nebenwirkungen [Handirritationen]"=81 %), Routine ("vergesse es in der Hektik"=65 %), Sozialem Einfluss und Führung ("niemand kontrolliert mich"=50 %), Organisation ("im Alltag nicht machbar"=61 % oder "keine Arbeitsanweisungen vorhanden"=49 %) bis zu Ressourcen ("Waschgelegenheiten fehlen"=42 %).
Nachdem die Statistiken über Krankenhausinfektionen weiterhin keine sinkenden, sondern eher steigende Erkrankungshäufigkeiten zeigen, untersucht und bewertet ein 2007 erschienener Cochrane-Review auf der Basis von überhaupt verfügbaren und den Einschlusskriterien der Reviewer genügenden Studien, den kurz- und längerfristigen Erfolg von Strategien, die Akzeptanz und Praxis von Handhygiene u.a. gegen die 1997 genannten Multibarrieren zu verbessern. Außerdem soll festgestellt werden, ob ein nachhaltiger Anstieg der Compliance von Handhygiene die Raten der mit dem Aufenthalt in Versorgungseinrichtungen assoziierten Infektionen reduziert.
Die Ergebnisse sehen im Einzelnen so aus:
• Zunächst fällt auf, dass die Reviewer trotz umfassender Recherche in den einschlägigen Datenbanken (z. B. MEDLINE, PubMed, EMBASE) nur zwei Studien anderer Wissenschaftler zu diesen Themen in den letzten beiden Jahren fanden.
• Der Grund für den Ausschluss zahlreicher, auch bereits reviewter Studien und neuerer Studien ist deren ausgesprochen schwache methodische Qualität.
• Entgegen einer 2004 festgestellten Nichtevidenz von Schulungsmaßnahmen, zeigt eine der reviewten Studien, dass "education can have modest success." Die Reviewer zitieren ein paar Studienergebnisse anderer Autoren, die aber keine klaren und einheitlichen Hinweise auf wirksame Interventionen liefern. Entgegen früheren und in anderen Bereichen evidenten Konzepten der Überlegenheit von Konzepten, die verschiedene Maßnahmen kombinieren, zeigte sich für die Handhygiene keine Überlegenheit der "multifaceted interventions" gegenüber "single interventions." Eine andere Studie, die 2006 veröffentlicht wurde, zeigte eine höhere Wirksamkeit reiner Schulungsintervention gegenüber einem Mix aus Audits und Performance-Feedback.
• Die Frage nach der nachhaltigen Wirkung von Handhygiene auf die Infektionsraten konnten die Reviewer wegen des Mangels an längerfristiger Follow-up-Analysen und wegen der Unfähigkeit der Interventionen, die Handhygiene zu fördern, nicht zu klären.
• Fast schon mit dem Mut der Verzweiflung halten die Reviewer die naheliegende Resignation oder Kapitulation vor offensichtlich nachhaltigen Handlungsbarrieren und der kargen Forschungssituation nicht für angemessen und formulieren stattdessen folgende praktische Implikationen ihres Reviews: "Although this review has been not been able to provide evidence of the effect of interventions to promote hand hygiene on compliance even short term (less than six months), the findings should not be taken to suggest that attempts to increase compliance or reduce HCAI are not worth undertaking."
Eine sich in diesem Zusammenhang aufdrängende allgemeinere Frage ist die, wie und mit welcher Erfolgserwartung eigentlich das Fehlverhalten oder Behandlungsfehler von professionellen Akteuren im Versorgungsgeschehen bei weit komplexeren Problemen oder Anforderungen beeinflusst werden soll, wenn es bei dieser vergleichsweise simplen aber doch patientenrelevanten Frage nicht oder nur extrem langsam oder aufwändig klappt?
Die insgesamt 15 Seiten umfassende Vollfassung des Cochrane-Reviews "Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care" von Gould, Chudleigh, Moralejo und Drey (in: The Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art.No: CD005186) ist nicht kostenlos erhältlich, setzt also z. B. einen Bibliothekszugang voraus. Das Abstract des Reviews erhalten sie kostenlos hier.
Bernard Braun, 8.7.2007
Viele Ärzte ordnen zu sorglos Computertomographien an und unterschätzen die Strahlenbelastung
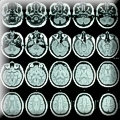 Die schnellen Bilder aus dem Computertomographen sind für viele Ärzte verlockend, um ihre Diagnose abzusichern. Dass dabei jedoch die 100- bis 1000-fache Strahlendosis einer normalen Röntgenaufnahme freigesetzt wird, wissen nur wenige Ärzte. 72 Prozent aller in einer Studie befragten Klinik-Ärzte (Nicht-Radiologen) unterschätzten die Strahlendosis der CT im Vergleich zur konventionellen Röntgenaufnahme. Der unkritische Einsatz des Verfahrens ist die Folge. "Es werden zurzeit zu viele CT-Untersuchungen angemeldet, weil eine gewisse Sorglosigkeit bei den Zuweisern besteht", erklärte Dr. Christoph Heyer, der die Befragung durchführte. Medizinstudium und radiologische Fortbildungsmaßnahmen müssten Ärzte aller Fachrichtungen stärker für die Strahlenbelastung sensibilisieren und die Hemmschwelle anheben, um eine solche Untersuchung zu initiieren.
Die schnellen Bilder aus dem Computertomographen sind für viele Ärzte verlockend, um ihre Diagnose abzusichern. Dass dabei jedoch die 100- bis 1000-fache Strahlendosis einer normalen Röntgenaufnahme freigesetzt wird, wissen nur wenige Ärzte. 72 Prozent aller in einer Studie befragten Klinik-Ärzte (Nicht-Radiologen) unterschätzten die Strahlendosis der CT im Vergleich zur konventionellen Röntgenaufnahme. Der unkritische Einsatz des Verfahrens ist die Folge. "Es werden zurzeit zu viele CT-Untersuchungen angemeldet, weil eine gewisse Sorglosigkeit bei den Zuweisern besteht", erklärte Dr. Christoph Heyer, der die Befragung durchführte. Medizinstudium und radiologische Fortbildungsmaßnahmen müssten Ärzte aller Fachrichtungen stärker für die Strahlenbelastung sensibilisieren und die Hemmschwelle anheben, um eine solche Untersuchung zu initiieren.
119 Ärzte aus Chirurgie, Innerer Medizin, Anästhesie und Neurologie des Universitätsklinikums hatten sich an der Befragung des Instituts für Radiologie der Ruhr-Universität in den BG Kliniken Bergmannsheil beteiligt. 40 Prozent der Befragten schätzten die Strahlendosis einer konventionellen Röntgenaufnahme des Brustraums richtig ein. 34 Prozent der Ärzte wussten, wie hoch die Strahlenbelastung einer Computertomographie des Brustraums beim Erwachsenen ist. Noch weniger Befragte (26 bzw. 27 Prozent) waren sich der Höhe der Strahlendosis einer Herz-CT und einer CT-Untersuchung beim Säugling bewusst - alles Untersuchungen, die zum Alltag in der Universitätsklinik gehören. Rund 12.000 Computertomographien werden dort jedes Jahr angefertigt, Tendenz steigend.
Wie unsicher sich die befragten Ärzte hinsichtlich der Strahlendosis der einzelnen Untersuchungsverfahren waren, zeigte sich auch darin, dass einige ihre Einschätzung offenbar vom Namen des Verfahrens abhängig machten: Ein Drittel der Befragten nahm an, die Strahlendosis einer sog. Low-Dose-CT sei kleiner oder gleich der einer konventionellen Röntgenaufnahme - in Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt. Der Begriff "High-Resolution CT" rief offenbar den Eindruck einer hohen Strahlenbelastung hervor. Hier schätzten 90 Prozent aller Befragten die Strahlenbelastung korrekterweise höher ein als die der konventionellen Röntgenaufnahme. Weder die Berufserfahrung, noch die Position oder Fachrichtung der Befragten machten einen Unterschied bei den Ergebnissen.
Die weit überwiegende Zahl der durchgeführten CT-Untersuchungen wird von Nicht-Radiologen angeordnet. Nach Ansicht der Radiologen gehen die Kollegen in manchen Bereichen zu sorglos und unkritisch damit um. So bestätigt sich zum Beispiel der Verdacht auf eine Lungenembolie durch gezielte Embolie-CT nur bei 10 bis 30 Prozent aller untersuchten Patienten - über 70 Prozent der Patienten werden umsonst der Strahlung ausgesetzt. "Daran, dass so viele CT-Untersuchungen angeordnet werden, sind die Radiologen in gewisser Weise selber schuld, weil sie zum einen schnell und schmerzlos so schöne Bilder erzeugen, und weil sie zum anderen wenig für die Fortbildung der Nicht-Radiologen tun", kritisiert Heyer. Ersetzen lasse sich die CT in vielen Bereichen zwar nicht, es gebe aber Ansätze, vermehrt auf Ultraschall und Kernspintomographie auszuweichen, die den Patienten keiner ionisierenden Strahlung aussetzen. Ziel von Fortbildungen müsse es sein, das Bewusstsein der Zuweisenden für die Strahlenbelastung zu schärfen. "Bei Notfällen braucht man natürlich nicht viel zu diskutieren, aber der Tatsache, dass sich die Zahl der CT-Untersuchungen und damit die durch sie hervorgerufene Strahlenexposition von Jahr zu Jahr erhöht, muss man Rechnung tragen und gegensteuern", fordern die Spezialisten. Es gehe um ein konstruktives, interdisziplinäres Gespräch zwischen Zuweiser und Radiologen zum Wohle des Patienten.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Einschätzung der Strahlenbelastung radiologischer Thorax-Verfahren: Was ist Nichtradiologen bekannt?
(RöFo: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, 2007, 179(3):261-267)
Gerd Marstedt, 29.3.2007
Wissenschaftler-Protest: Die gegenwärtige Praxis der Publikation über klinische Studien gefährdet die Patientensicherheit
 "Die Art und Weise, wie in medizinischen Fachzeitschriften über Ergebnisse aus klinischen Studien berichtet wird, stellt eine massive Bedrohung für die Patientensicherheit dar." Mit diesem Satz beginnt ein Editorial der Open Access Zeitschrift "PLOS Clinical Trials". Die Autoren Richard Smith und Ian Roberts, Professoren an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, zählen in diesem Aufsatz nicht nur einige "Unarten" und Manipulationstendenzen medizinischer Fachveröffentlichungen auf, sondern machen auch deutlich, welche Risiken für die medizinische Versorgung und das Patientenwohl damit verbunden sind.
"Die Art und Weise, wie in medizinischen Fachzeitschriften über Ergebnisse aus klinischen Studien berichtet wird, stellt eine massive Bedrohung für die Patientensicherheit dar." Mit diesem Satz beginnt ein Editorial der Open Access Zeitschrift "PLOS Clinical Trials". Die Autoren Richard Smith und Ian Roberts, Professoren an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, zählen in diesem Aufsatz nicht nur einige "Unarten" und Manipulationstendenzen medizinischer Fachveröffentlichungen auf, sondern machen auch deutlich, welche Risiken für die medizinische Versorgung und das Patientenwohl damit verbunden sind.
Im Einzelnen kritisieren sie folgende Merkmale, die man heute bei einem Großteil der medizinischen Fachveröffentlichungen beobachten kann und die deshalb zwar schlechter, aber durchweg gebräuchlicher Standard sind:
• Veröffentlichungen stellen viel zu stark die Befunde der einzelnen Studie in den Vordergrund und nicht deren Bedeutung im Lichte auch anderer, vorher veröffentlichter Publikationen.
• Studien werden durchgeführt, ohne dass zuvor der Forschungsstand systematisch geprüft wurde. D.h. es werden viele überflüssige Studien durchgeführt oder solche, die nicht die wichtigsten offenen Fragen berühren.
• Studien weichen oftmals nachhaltig vom Protokoll oder Studienplan ab, ohne dass der Leser darüber informiert wird.
• Die veröffentlichten Ergebnisse werden gefiltert und gezielt ausgewählt, dabei wird über positive Ergebnisse besonders intensiv und häufig berichtet, negative Ergebnisse hingegen werden unterdrückt.
• Es wird nicht über die Gesamtheit der Ergebnisse einschl. der beobachteten Nebeneffekte berichtet.
• Die veröffentlichten Befunde fallen in der Regel vorteilhaft für die Sponsoren aus - weil es eine Vielzahl von Möglichkeiten der Datenanalyse und -manipulation gibt.
• Die Autorenschaft der Artikel ist oftmals unklar.
Richard Smith und Ian Roberts belegen ihre Thesen durch Verweis auf viele Veröffentlichungen, in denen die genannten Defizite festgestellt wurden. Auch "Forum Gesundheitspolitik" hat bereits über einige Artikel berichtet, in denen beispielsweise deutlich wurde:
• Bei vielen medizinischen Fachveröffentlichungen waren im Hintergrund von der Pharma-Industrie bezahlte Ghostwriter und Statistiker tätig, ohne dass dies in den Artikeln erwähnt wird.
• Bei Veröffentlichungen über Medikamente, aber auch über alkoholfreie Getränke hat sich gezeigt, dass industrie-gesponserte Untersuchungen sehr viel häufiger zu positiven Resultaten kommen als staatlich oder von öffentlichen Einrichtungen geförderte Studien.
• Es mangelt in vielen Studien an Angaben über absolute Risiken, so dass die mitgeteilten Befunde (z.B. über ein 30% erhöhtes Risiko) überhaupt nicht angemessen bewertet werden können hinsichtlich ihrer Bedeutung für die medizinische Versorgung.
Die Wissenschaftler fassen die Problematik der derzeit gängigen Veröffentlichungspraxis ebenso polemisch wie pointiert so zusammen: "Unglücklicherweise haben sich viele Forscher zu Meistern im selektiven Heranzüchten vorteilhafter Ergebnisse entwickelt. Sie tun dies, um den Herren, die sie bezahlen, zu dienen - oftmals der Pharmaindustrie. Ihre Herren bewerten vorteilhafte Befunde natürlich als für ihr Marketing nützlicher. Die Forscher füllen damit ihre eigenen Taschen und machen Karriere. Die Zeitschriftenredakteure und Herausgeber können über wichtige Neuigkeiten berichten und freuen sich über Einnahmen aus der steigenden Auflage. Verlierer sind die Teilnehmer an den Studien, deren Zeit vergeudet wird, Patienten, die die Arzneien entgegen jeder Evidenz schlucken müssen und die Gesellschaft, die für die Kosten der Medikamente aufkommen muss."
Smith und Robert schlagen in ihrem Artikel abschließend auch einen neuen Kodex und Kriterien vor, nach denen sich Veröffentlichungen über klinische Studien zukünftig richten sollten. Dazu gehören u.a. ein im Internet veröffentlichter systematischer Bericht über den Forschungsstand, volle Transparenz über neue Studien und ihr Design, Möglichkeit der öffentlichen und freien Kommentierung von Studienergebnissen sowie die vorherige Bekanntgabe der geplanten statistischen Analyseschritte.
Der Aufsatz ist hier nachzulesen: Richard Smith, Ian Roberts: Patient Safety Requires a New Way to Publish Clinical Trials
Gerd Marstedt, 13.2.2007
USA: Eindeutig unerwünschte Wirkungen von ärztlichen Schichtdiensten von 24 und mehr Stunden Dauer
 Spätestens seit der vom US-amerikanischen "Institute of Medicine (IOM)" 1999 veröffentlichten Anzahl von jährlich 48.000 bis 98.000 durch Behandlungsfehler ums Leben gekommenen Patienten, wird in den USA systematisch nach den wichtigsten Ursachen dieser "Todeslast" gesucht.
Spätestens seit der vom US-amerikanischen "Institute of Medicine (IOM)" 1999 veröffentlichten Anzahl von jährlich 48.000 bis 98.000 durch Behandlungsfehler ums Leben gekommenen Patienten, wird in den USA systematisch nach den wichtigsten Ursachen dieser "Todeslast" gesucht.
Im Jahr 2004 wurde dazu bereits auf einer allerdings sehr kleinen quantitativen und auch qualitativ schmalen Basis die Rolle von (über)langen Schichtdiensten des medizinischen Personals untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung war eindeutig: Assistenzärzte oder Medizinalassistenten mit "extended-duration shifts (defined as at least 24 h continuously at work) had significantly more ... attentional failures and made significantly more serious medical errors than those scheduled to work shifts 16 h or longer." Näheres findet man z.B. in den folgenden Aufsätzen: (Lockley SW, Cronin JW, Evans EE, Cade BE, Lee CJ, et al. (2004): Effect of reducing interns’ weekly work hours on sleep and attentional failures. N Engl J Med 351: 1829-1837 und hier in einer Zusammenfassung des CMAJ: Landrigan CP, Rothschild JM, Cronin JW, Kaushal R, Burdick E, et al. (2004): Effect of reducing interns’ work hours on serious medical errors in intensive-care units. N Engl J Med 351: 1838-1848).
In einer USA-weiten Studie, deren Ergebnisse im Dezember 2006 in der Open Access-Fachzeitschrift PloS Medicine veröffentlicht wurden, wurden diese Ergebnisse auf einer wesentlichen breiteren und repräsentativeren Basis bestätigt.
Gefördert durch das "Department of Health & Human Services's (HHS)". die "Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)" und die "Centers for Disease Control and Prevention's National Institute for Occupational Safety and Health" der USA, wurden in einem web-basierten Survey 2.737 so genannte "interns" (Medizinalassistenten im ersten Berufsjahr nach ihrem Studium) rund ein Jahr lang gebeten, insgesamt 17.003 Monatsberichte über ihre Arbeitszeitgestaltung und ihre durch Müdigkeit bedingten berufslichen Unaufmerksamkeiten, Irrtümer, Fehler und Katastrophen zu erstellen und anonym über das Internet der Forschergruppe zugänglich zu machen. Untersucht wurde die Häufigkeit von "attentional failures during lectures, rounds, and clinical activities, including surgery" bei Jungärzten, die monatlich gar keine, zwischen ein und vier Arbeitsschichten mit 24 und mehr Stunden oder auch mehr als fünf solcher Schichten arbeiteten.
Das Ergegbnis war eindeutig: "Interns working five or more extended-duration shifts per month reported more attentional failures during lectures, rounds, and clinical activities, including surgery and reported 300% more fatigue-related preventable adverse events resulting in a fatality", also einem Todesfall oder einer medizinischen Katastrophe. Die Häufigkeit weniger dramatischer aber immer noch unerwünschter Übermüdungseffekte stieg bei den Befragten mit monatlich einem bis vier sehr langen Schichtdiensten gegenüber den Befragten mit normaler Arbeitszeit um 450 % und bei Befragten mit 5 und mehr langen Schichtdiensten um 700 % gegenüber den normal Arbeitenden.
Die arztüblichen langen Arbeitsschichten bzw. Bereitschaftsdienste mit 24 Stunden Dauer und mehr sind eindeutig und bei den unterschiedlichsten Gruppen und Typen von Jungärzten in der gesamten USA mit einem steigenden Risiko signifikanter unerwünschter Wirkungen assoziiert.
Hier können Sie die PDF-Datei des achtseitigen Aufsatzes "Impact of Extended-Duration Shifts on Medical Errors, Adverse Events, and Attentional Failures" in PloS Medicine 12.12. 2006 von Laura K. Barger et al. kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 22.1.2007
Untererfassung von Sicherheitsproblemen für Patienten durch Standardreport in NHS-Krankenhäusern - Alternative sichtbar
 Zahlreiche Untersuchungen und Reports der letzten Jahre zeigten praktisch weltweit (für die USA war dies z.B. die aufsehenerregende Studie "To Err is human"), dass während nicht weniger Aufenthalte im Krankenhaus gesundheitlich negative Ereignisse wie Unfälle, spezielle Infektionen und Todesfälle auftreten. Der Großteil dieser Ereignisse gilt als vermeidbar, wenn man ihr Zustandekommen besser kennt. Um dies schaffen zu können, wurden in vielen Krankenhäusern routinemäßige Berichtssysteme für patientenbezogene Sicherheitslücken oder Mängel eingeführt. Während sich sicherlich viele Krankenhäuser in der Sicherheit wiegen, dass diese Standard-Berichtssysteme zuverlässig funktionieren, hat eine Gruppe von Wissenschaftlern an der Universität von York dies systematisch und kontrolliert untersucht.
Zahlreiche Untersuchungen und Reports der letzten Jahre zeigten praktisch weltweit (für die USA war dies z.B. die aufsehenerregende Studie "To Err is human"), dass während nicht weniger Aufenthalte im Krankenhaus gesundheitlich negative Ereignisse wie Unfälle, spezielle Infektionen und Todesfälle auftreten. Der Großteil dieser Ereignisse gilt als vermeidbar, wenn man ihr Zustandekommen besser kennt. Um dies schaffen zu können, wurden in vielen Krankenhäusern routinemäßige Berichtssysteme für patientenbezogene Sicherheitslücken oder Mängel eingeführt. Während sich sicherlich viele Krankenhäuser in der Sicherheit wiegen, dass diese Standard-Berichtssysteme zuverlässig funktionieren, hat eine Gruppe von Wissenschaftlern an der Universität von York dies systematisch und kontrolliert untersucht.
In einem großen Krankenhaus des National Health Service in Großbritannien verglichen sie die Leistungsfähigkeit eines dort seit 2003 über die "National Patient Safety Agency" weit verbreiteten Standard-Berichtssystems mit der eines speziellen kriteriengesteuerten Reviewverfahrens für medizinische Behandlungsunterlagen. Das Standardsystem sammelte einfach alle aus den acht ausgewählten Abteilungen des Krankenhauses von Pflegekräften und Ärzten "on the job" wahrgenommenen Sicherheitsprobleme für Patienten, das "case note review"-Verfahren war deutlich aufwändiger und vor allem kriterienbasiert: Fünf dafür ausgebildete Pflegekräfte sichteten nach 18 Screeningkriterien (z.B. Auftreten einer Verletzung, ungeplante Verlegung in ein anderes Akutkrankenhaus bis unerwarteter Tod) die patientenbezogenen Behandlungsunterlagen. Wenn ein Kriterium erfüllt war oder gar mehrere, kam der Patient in eine zweite Bewertungsstufe. Eine von den anderen Pflegekräften unabhängige Pflegekraft betrachtete sich eine 10-Prozentstichprobe aus den bereits reviewten Patienten nochmals und sicherte damit die so genannte "inter-rater reliability". Zusätzlich untersuchten und bewerteten Ärzte noch 10 % der Fälle für welche die Pflegekräfte kein positives Kriterium für Sicherheitsprobleme gefunden hatten, um so genannte falsch-negative Fälle zu identifizieren.
Die Ergebnisse weisen eine erhebliche Untererfassung der tatsächlichen sicherheitsrelevanten Ereignisse in dem untersuchten Krankenhaus durch das Standard-Berichtssystem nach und rechtfertigen den vergleichsweise hohen Aufwand der Review-Methode.
Im einzelnen macht dies an folgenden erhobenen Daten fest:
• Unter den 1.006 zwischen Januar und Mai 2006 aufgenommenen Patienten traten bei 230 Patienten (22,9 % aller Patienten) insgesamt 324 Sicherheitsereignisse auf. Bei 110 der aufgenommenen Patienten, also bei 10,9 % handelte es sich um Ereignisse, die den Patienten richtig Schaden ("harm") zufügten. Dies bestätigt ein weiteres Mal die Bedeutung dieser Probleme für das Gesamtgeschehen der stationären Versorgung.
• Nur 21, also relativ 7 % all dieser Ereignisse wurden von dem Routine-Berichtssystem des Krankenhauses erfasst, 33 (10 %) wurden von beiden Systemen identifiziert und 270 oder 83 % nur von dem hier vorgestellten Reviewverfahren. Von den Ereignissen, die den Patienten fühlbar schadeten, wurden rund 5 % vom Routinesystem erkannt, während das Reviewverfahren alle entdeckte.
Die Autoren sind nach einer detaillierten Abwägung der möglichen Gründe für eine derartige Unterfassung von Risiken (ein Stichwort: "local reporting arrangements"), der Ansicht, ihre Ergebnisse seien für britische NHS-Krankenhäuser verallgemeinerbar. Noch genauer untersucht werden muss, wie solche Nichtberichte zustande kommen und wie man flächendeckend eine kostengünstige Variante des untersuchten Reviewprogramms zur routinemäßigen Qualitätsverbesserung einsetzt ohne dass aus der neuen Routine und dem neuen Standard erneut mangelnde Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit entsteht.
Hier können Sie die PDF-Datei der im "British Medical Journal" gerade (2007;334; 79-83) veröffentlichten Studie "Sensitivity of routine system for reporting patient safety incidents in an NHS hospital: retrospective patient case note review" von Sari, Sheldon, Cracknell und Turnbull samt einiger Nachweise ähnlicher Untersuchungen herunterladen.
Bernard Braun, 12.1.2007
Vom Mythos der aufwändigen Qualitätssicherung: 5 Regeln zur Vermeidung von Infektionen durch Kathetereinsatz
 Jedes Jahr kommt es in den USA zu 80.000 durch den Einsatz von Kathetern verursachten bakteriellen Entzündungen über die Blutbahn, die pro Patient Kosten von 45.000 US-Dollar (landesweit 2,3 Milliarden US-Dollar) verursachen und jedes Jahr für 28.000 Todesfälle verantwortlich sind.
Jedes Jahr kommt es in den USA zu 80.000 durch den Einsatz von Kathetern verursachten bakteriellen Entzündungen über die Blutbahn, die pro Patient Kosten von 45.000 US-Dollar (landesweit 2,3 Milliarden US-Dollar) verursachen und jedes Jahr für 28.000 Todesfälle verantwortlich sind.
Die "altbekannten Probleme", dass mit zentralvenösen Kathetern nicht nur Messinstrumente, Medikamente oder therapeutische Flüssigkeiten in den Körper gelangen, sondern auch jede Menge gefährliche Erreger, stellen den Ausgangspunkt einer von Peter Pronovost und weiteren Mitarbeitern des "Center for Innovation in Quality Patient Care" an der Johns Hopkins University in Baltimore jetzt im "New England Journal of Medicine" vom 28. Dezember 2006 (NEJM 2006; 355: 2725-2732) vorgestellten Interventionsstudie "An Intervention to Decrease Catheter-Related Bloodstream Infections in the ICU (Intensivstationen)" dar. Diese Infektionen erschienen bisher praktisch nicht vermeidbar oder ihre Vermeidung galt als zu kostenaufwändig: "A common misperception among hospital-based clinicians is that it often costs much too much money and time to significantly improve patient safety" sagte Pronovost.
Als Ergebnis ihrer Studie stellte er aber auch fest: "Our data destroys this myth by showing that profound improvements can be made with minimum cost and effort, as long as clinical teams are committed to improving safety and willing to diligently observe relatively simple safety measures."
Das in 103 Krankenhaus-Intensivstationen im Bundesstaat Michigan durchgeführte Projekt zur Vermeidung von Katheterinfektionen umfasste genau solche einfachen und auch längst durch Leitlinien staatlicher Qualitätseinrichtungen bekannten Regeln oder Ziele und hatte einen enormen Erfolg.
Bei den Regeln ging es um
• strenges und systematisches Händewaschen des Krankenhauspersonals,
• intensive Barrieremaßnahmen beim Legen der Zugänge für die Katheter,
• die Desinfektion der Haut mit Chlorhexidin,
• Vermeidung des Zugangs im Bereich des Oberschenkels und stattdessen Zugang über Gefäße im Bereich des Schlüsselbeins und die
• konsequente Entfernung von unnötigen Kathetern.
Diese Regeln wurden im Projekt im Rahmen einer preiswerten einwöchigen Fortbildung für die im Projekt in jeder Intensivstation eingesetzten Teamleiter vermittelt, die anschließend deren Einhaltung überwachten. Die Autoren betonten, ihr Programm erfordere kein zusätzliches Personal und keine neue Ausrüstung: "There's just no reason any more not to do these relatively simple things" - so Pronovost.
Die Herausgeber des NEJM fügten dem hinzu: "The story is compelling and the costs and efforts so relatively minor that the five components of the intervention should be widely adopted" - und am besten auch nicht nur in Michigan oder den USA.
Weitere Einzelheiten des Projekts finden sich im Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 28.12.2006
Wie sicher sind Operationssäle in deutschen Krankenhäusern? Erschreckendes aus Chirurgen- und Pflegekräftesicht.
 Die Erkenntnis, dass es auch in Gesundheitseinrichtungen erhebliche Erkrankungs- und Sterberisiken für Patienten und Beschäftigte gibt, verbreitet sich weltweit und gesichert durch entsprechende Studien seit einigen Jahren. Pionierarbeit hat dabei die vom US-"Institute of Medicine (IOM)" veröffentlichte kostenlos im Internet lesbare oder kostenpflichtig zu bestellende Studie "To Err is Human. Building a Safer Health System" geleistet, auf die sich mittlerweile in den USA eine Menge von Folgeuntersuchungen und Qualitätssicherungsprogrammen beziehen. Ein aufrüttelndes Ergebnis dieser Studie war die geschätzte Zahl von jährlich durch unbeabsichtigte medizinische Fehler in Gesundheitseinrichtungen getöteten 44.000 bis 98.000 Menschen. Sofern dabei medizinische Geräte eine Rolle spielten, beruhte dies in 60 % der Fälle auf "Missverständnissen zwischen Mensch und Maschine" (DÄB 47/2006:A3187).
Die Erkenntnis, dass es auch in Gesundheitseinrichtungen erhebliche Erkrankungs- und Sterberisiken für Patienten und Beschäftigte gibt, verbreitet sich weltweit und gesichert durch entsprechende Studien seit einigen Jahren. Pionierarbeit hat dabei die vom US-"Institute of Medicine (IOM)" veröffentlichte kostenlos im Internet lesbare oder kostenpflichtig zu bestellende Studie "To Err is Human. Building a Safer Health System" geleistet, auf die sich mittlerweile in den USA eine Menge von Folgeuntersuchungen und Qualitätssicherungsprogrammen beziehen. Ein aufrüttelndes Ergebnis dieser Studie war die geschätzte Zahl von jährlich durch unbeabsichtigte medizinische Fehler in Gesundheitseinrichtungen getöteten 44.000 bis 98.000 Menschen. Sofern dabei medizinische Geräte eine Rolle spielten, beruhte dies in 60 % der Fälle auf "Missverständnissen zwischen Mensch und Maschine" (DÄB 47/2006:A3187).
Auch wenn es in Deutschland noch keinen vergleichbaren Report gibt, zitiert die hier vorgestellte Studie von Matern et al. "Arbeitsbedingungen und Sicherheit am Arbeitsplatz OP" (Deutsches Ärzteblatt - DÄB - Heft 47/2006: A3187-A3192) "allein für die Intensivstationen in Deutschland...Kosten zur Behandlung der Komplikationen, die durch Bedienungsfehler verursacht werden, auf etwa 396 Millionen Euro jährlich".
Was hinter dem derart kostspieligen und leidvollen Geschehen steckt, versuchten die Autoren mit einer Befragung von 425 Chirurgen und 190 OP-Pflegekräfte über deren Arbeitsbedingungen transparenter zu machen. Auch wenn die Studie nicht repräsentativ für alle Chirurgen und OPs ist, vermittelt sie eine Menge mit Sicherheit verallgemeinerbare Einblicke in das Gefährdungspotenzial im OP.
Dessen Einzelheiten sehen beispielsweise so aus:
• Die speziellen Räume für Ein- und Ausleitung der narkotisierten Patienten werden insbesondere im Bereich der Ausleitung relativ selten genutzt oder sind aus Sicht der Anästhesisten auch teilweise ungeeignet.
• Das Klima in den OPs ist trotz Klimaanlagen "für die Tätigkeiten nicht ideal".
• "Lagerungshilfen...sind häufig nicht in ausreichendem Maße vorhanden."
• "Etwa 70 % der Chirurgen und Pflegekräfte haben Schwierigkeiten mit den OP-Leuchten...40,5 % der Chirurgen und 47,2 % der Pflegekräfte sehen potenzielle Gefährdungen für das OP-Team, für ihre eigene Person oder für den Patienten durch OP-Leuchten und haben solche Situationen bereits mehrfach erlebt."
• "In über 80 % der OPs verlaufen die Versorgungsleitungen der Geräte als Stolperfallen."
• "Nur 31,1 % der Chirurgen haben keine Probleme mit Retraktoren (Instrumente zum Offenhalten von Wunden)."
• 97 % der Chirurgen und OP-Pflegekräfte sehen die Notwendigkeit , den OP ergonomisch zu optimieren."
• Obwohl viele Befragten glauben, eine ergonomisch optimale Hand-Augen-Koordination über Monitore zu haben, machen das tatsächlich nur zwei Drittel richtig. Auf Wissens- oder Schulungsmängel deutet auch die Erkenntnis hin, dass es OP-Akteure gibt, die glauben falsch zu handeln, aber in Wirklichkeit völlig korrekt arbeiten.
Alles in allem belegt die Befragung, "dass ergonomische Defizite besonders im Operationssaal wegen fehlender Systemintegration und uneinheitlicher Bedienkonzepte wesentliche Quellen für kostspielige Irrtümer, Fehler und Komplikationsmöglichkeiten darstellen" und dies von vielen Mitarbeitern so gesehen wird.
Das Erschreckende an vielen der genannten Probleme ist, dass sie häufig trivial sind, an anderen Orten schon lange erkannt wurden und dauerhaft beseitigt und verhindert wurden und diese Beseitigung auch oft nicht aufwändig ist.
Hier können Sie die PDF-Datei des Aufsatzes im Deutschen Ärzteblatt herunterladen.
Bernard Braun, 19.12.2006
Händewaschen gegen Krankenhausinfektionen: Auch eine Art medizinischer Fortschritt
 "One of the most powerful approaches to fighting health care-related infection is also the simplest: healthcare providers need to clean their hands every time they see a patient."
"One of the most powerful approaches to fighting health care-related infection is also the simplest: healthcare providers need to clean their hands every time they see a patient."
Dieser Kernüberzeugung der seit 2005 existierenden und von 22 Ländern getragenen WHO Initiative "Clean Care is Safer Care" folgen seit 10. November 2006 13 weitere Länder, darunter Deutschland, die USA und der Sudan.
Zu jedem Zeitpunkt sind weltweit etwa 1,4 Millionen Personen an einer Krankheit erkrankt, die sie sich in Krankenhäusern erworben haben. In entwickelten Ländern leiden an diesen so genannten nosokomialen Infektionen zwischen 5 und 10 % aller Patienten. In einigen Entwicklungsländern sind bis zu einem Viertel der Patienten davon betroffen. Das besondere Problem eines wachsenden Anteils dieser Art von Krankheiten ist der ebenfalls steigende Anteil multiresistenter Erreger, was z. B. in den USA zu jährlich 44.000-98.000 Todesfällen durch nosokomiale Infektionen führt. In den dazu in den USA durchgeführten Studien wurde ermittelt, "dass etwa 1 % dieser Patienten mittelbar oder unmittelbar daran versterben. Bei 2,7 % aller ins Krankenhaus aufgenommenen Patienten tragen Infektionen als Mitursache zu einem tödlichen Verlauf bei, sind jedoch nicht die eigentliche Todesursache." (Zitat Wikipedia)
Für die Situation in Deutschland verweist das "Institut für Hygiene und Umweltmedizin" der Charité auf seiner Website auf folgende Sachverhalte: "1994 wurde eine erste repräsentative bundesweite Studie zur Prävalenz nosokomialer Infektionen in Deutschland durchgeführt (NIDEP 1 - Nosokomiale Infektionen in Deutschland - Erfassung und Prävention). Für diese Studie wurden alle Patienten aus 72 zufällig ausgewählten Krankenhäusern, die zum Zeitpunkt der Studie stationär in den Fachrichtungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Intensivpflege behandelt wurden, auf das Vorhandensein nosokomialer Infektionen hin untersucht. 14 966 Patienten wurden in diese Studie einbezogen. Die ermittelte Prävalenz betrug 3,0 % in der Gruppe der internistischen Patienten, 3,8 % bei den chirurgischen Patienten, 1,5 % bei den gynäkologisch-geburtshilflichen und 15,3 % bei den Intensivpatienten (nosokomial infizierte Patienten pro 100 Patienten). Aufgrund verschiedener methodischer Festlegungen dieser Untersuchung...sind diese Prävalenzraten im Sinne von minimalen Infektionsraten anzusehen....Die häufigsten nosokomialen Infektionen waren in dieser nationalen Untersuchung die Harnweginfektionen (40 %), die Infektionen der unteren Atemwege (20 %) und die postoperativen Wundinfektionen (15 %) gefolgt von der primären Sepsis (8 %).[...] Die zurzeit umfangreichsten Daten zur Inzidenz von nosokomialen Infektionen in Deutschland resultieren aus dem Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS). ... Insgesamt sind durch KISS inzwischen Daten zu mehr als 330.000 Patienten aus 212 Intensivstationen und zu fast 150.000 Operationen in 217 operativen Fachabteilungen erhoben worden. ... Auf der Basis der Daten des Krankenhaus-Infektions-Surveillance-Systems (KISS) und des Statistischen Bundesamtes muss man davon ausgehen, daß in Deutschland allein auf den Intensivstationen jährlich mehr als 60.000 Krankenhausinfektionen auftreten, und es ist mit ca. 128.000 postoperativen Wundinfektionen pro Jahr zu rechnen. Insgesamt kann aufgrund von Hochrechnungen von etwa 500.000 bis 800.000 Fällen nosokomialer Infektionen im Jahr in Deutschland ausgegangen werden."
Im 2002 erschienenen als PDF-Datei erhältlichen Heft 8 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes zum Thema "Nosokomiale Infektionen" wird die Anzahl solcher Fälle auf jährlich 600.000 geschätzt.
Wie einfach und schnell hier gesundheitliche Erfolge erreicht werden können, zeigt die WHO am Beispiel der Schweiz: In zwei kantonalen Krankenhäusern gelang es mittels einer viermonatigen Kampagne für gründliche Handhygiene den Anteil von Ärzten und Pflegekräften, die sich die Hände reinigten um 25 % zu erhöhen. Wenn man dies auf die gesamte Schweiz hochrechnet, könnten jährlich allein durch Händewaschen 17.000 dieser Infektionen vermieden werden.
Hier finden Sie mehr über die WHO-Initiative
Bernard Braun, 13.11.2006
Ärztliche Kunstfehler: Klagen vor Gericht sind fast immer erfolglos
 Patienten, die Ärzte wegen eines Kunstfehlers verklagen, setzen sich vor Gericht nur in seltenen Fällen durch. Von den im Jahr 2005 vor dem Landgericht Leipzig insgesamt 75 neuen Verfahren wegen ärztlicher Kunstfehler hat nur ein Kläger den Rechtsstreit gewonnen, ihm ist ein Schmerzensgeld von 100.000 Euro zugesprochen worden. Dies berichtete jetzt die Nachrichtenagentur ddp. Von insgesamt 75 Fällen endeten nur 27 mit einem Urteil, in allen anderen Fällen wurde ein Vergleich geschlossen oder die Klage wieder zurückgezogen.
Patienten, die Ärzte wegen eines Kunstfehlers verklagen, setzen sich vor Gericht nur in seltenen Fällen durch. Von den im Jahr 2005 vor dem Landgericht Leipzig insgesamt 75 neuen Verfahren wegen ärztlicher Kunstfehler hat nur ein Kläger den Rechtsstreit gewonnen, ihm ist ein Schmerzensgeld von 100.000 Euro zugesprochen worden. Dies berichtete jetzt die Nachrichtenagentur ddp. Von insgesamt 75 Fällen endeten nur 27 mit einem Urteil, in allen anderen Fällen wurde ein Vergleich geschlossen oder die Klage wieder zurückgezogen.
Die Hauptgründe für die Misserfolge der Kläger sieht das Gericht in der schwierigen Beweislast. So muss der Kläger zunächst nachweisen, dass einem Arzt überhaupt ein Fehler unterlaufen ist und darüber hinaus auch noch, dass der Fehler in Zusammenhang mit aktuellen Beschwerden steht. Dies gelingt jedoch in den meisten Fällen nicht, erklärte ein Sprecher des Gerichts.
Das Thema "Patientensicherheit" gelangt meist erst in die Medien nach spektakulären Fällen, etwa wenn ein falsches Bein amputiert wurde. Die Problematik ist jedoch viel alltäglicher: Einen wichtigen Anstoß dazu gab die US-Studie "To Err is Human" aus dem Jahr 2000. Auf jährlich 44-98.000 wird darin die Zahl der Patienten geschätzt, die in US-Krankenhäusern an den Folgen eines unerwünschten Ereignisses sterben. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat die Ergebnisse der Studie auf Deutschland übertragen: Danach sind allein im Jahr 1999 zwischen 31.000 und 81.000 Todesfälle in Kliniken auf unerwünschte Ereignisse zurückzuführen. Somit wären Fehler im Krankenhaus eine häufigere Todesursache als etwa Brustkrebs, Grippe oder Verkehrsunfälle.
Zum Thema "Patientensicherheit" hat die AOK eine Reihe von Broschüren und Pressemitteilungen veröffentlicht: Themenspezial Patientensicherheit: Fehlervermeidung heißt das Ziel und weiterhin auch ein spezielles Themenheft als PDF-Datei herausgegeben: "Presseservice Gesundheit (psg): Thema Patientensicherheit"
Gerd Marstedt, 30.10.2006
Patientensicherheit: Aktionsbündnis will mit medizinischen Fehlern anders umgehen
 Eine neue Sonderausgabe der Zeitschrift Gesundheit und Gesellschaft (G+G) des AOK-Bundesverbandes wendet sich ausschließlich dem Thema "Patientensicherheit" zu. Hintergrund ist ein neu gegründetes Aktionsbündnis aus Vertretern von Gesundheitsberufen, Verbänden und Patientenorganisationen. Man geht davon aus, dass nach jüngsten im Ausland durchgeführten Studien 5-10% der Patienten im Krankenhaus unerwünschte Ereignisse erleiden. Zwischen 30 und 50 Prozent dieser Ereignisse müssen nach Ansicht des Aktionsbündnis Patientensicherheit als vermeidbar eingeschätzt werden. Genaue Zahlen fehlen bisher allerdings für Deutschland.
Eine neue Sonderausgabe der Zeitschrift Gesundheit und Gesellschaft (G+G) des AOK-Bundesverbandes wendet sich ausschließlich dem Thema "Patientensicherheit" zu. Hintergrund ist ein neu gegründetes Aktionsbündnis aus Vertretern von Gesundheitsberufen, Verbänden und Patientenorganisationen. Man geht davon aus, dass nach jüngsten im Ausland durchgeführten Studien 5-10% der Patienten im Krankenhaus unerwünschte Ereignisse erleiden. Zwischen 30 und 50 Prozent dieser Ereignisse müssen nach Ansicht des Aktionsbündnis Patientensicherheit als vermeidbar eingeschätzt werden. Genaue Zahlen fehlen bisher allerdings für Deutschland.
Im G+G Schwerpunktheft wird daher auch auf Erkenntnisse des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) zurückgegriffen. Dieser hat sich in seinem Gutachten 2003 in einem Schwerpunkt mit Fehlern und Schäden im Gesundheitswesen befasst. In Ermangelung deutscher Daten hat der Rat die amerikanischen Zahlen zu Todesfällen durch unerwünschte und häufig vermeidbare Ereignisse in Krankenhäusern auf Deutschland übertragen. In der auf diese Weise geschätzten Größenordnung von 31.000 bis 81.000 Todesfällen jährlich überträfen sie in der Ursachenstatistik für 1999 sogar den Brustkrebs (18.000 Fälle), die Grippe und Lungenentzündung (18.000 Fälle) und um ein Mehrfaches die Zahl der Verkehrstoten (8.000).
Ausführliche Informationen liefert auch die 24seitige AOK-Pressemappe PSG Thema Patientensicherheit. Das 20seitige G+G-Sonderheft berichtet über Ziele des Aktionsbündnisses, neue Konzepte und Modellprojekte.
Das Heft kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden: G+G Sonderheft Patientensicherheit
Gerd Marstedt, 20.10.2005
Saferhealthcare - Patientensicherheit im Internet
 Der Verlag des renommierten "British Medical Journal (BMJ)" eröffnete gerade zusammen mit anderen angelsächsischen Organisationen das Internet-Portal "Saferhealthcare zum Thema Patientensicherheit. Es richtet sich an Ärzte, die danach bestrebt sind, ihre Sicherheitskultur zu verbessern, kann aber natürlich auch von interessierten Nichtärzten und sämtlichen deutschen Interessenten genutzt werden. Die Seite versammelt eine Fülle von Links, enthält aber auch redaktionelle Beiträge. Es gibt Verweise auf zahlreiche Organisationen, die sich mit dem Thema Patientensicherheit beschäftigen. Eine Reihe von Texten thematisiert Sicherheitskultur, Medikationsfehler und Probleme, die beispielsweise durch die fehlerhafte Patienten-Identifizierung und Überweisungen an "weniger strukturierte Versorgungsstrukturen" entstehen können. Es gibt Diskussionsforen, ebenso wie einige elektronische Programme ("Tools"), mit denen sich etwa Medikationsfehler vermeiden lassen sollen.
Der Verlag des renommierten "British Medical Journal (BMJ)" eröffnete gerade zusammen mit anderen angelsächsischen Organisationen das Internet-Portal "Saferhealthcare zum Thema Patientensicherheit. Es richtet sich an Ärzte, die danach bestrebt sind, ihre Sicherheitskultur zu verbessern, kann aber natürlich auch von interessierten Nichtärzten und sämtlichen deutschen Interessenten genutzt werden. Die Seite versammelt eine Fülle von Links, enthält aber auch redaktionelle Beiträge. Es gibt Verweise auf zahlreiche Organisationen, die sich mit dem Thema Patientensicherheit beschäftigen. Eine Reihe von Texten thematisiert Sicherheitskultur, Medikationsfehler und Probleme, die beispielsweise durch die fehlerhafte Patienten-Identifizierung und Überweisungen an "weniger strukturierte Versorgungsstrukturen" entstehen können. Es gibt Diskussionsforen, ebenso wie einige elektronische Programme ("Tools"), mit denen sich etwa Medikationsfehler vermeiden lassen sollen.
Unter der programmatischen Überschrift "The patient safety story. Has been told; now it is time to make practice safer" referieren die beiden Hauptverantwortlichen der Website, der Shared-decision-making-Experte und Arzt Glyn Elwyn von der Universität Cardiff und die us-amerikanische Gesundheitsqualitätsexpertin J. Corrigan aus Washington D.C., die verhältnismäßig lange Entwicklung der aktiven Beschäftigung mit Patientensicherheit vor allem in den USA. Obwohl mehr Menschen durch medizinische Irrtümer zu Tode kämen als durch Verkehrsunfälle, Brustkrebs oder Aids, dauerte es auch in den angelsächsischen Ländern bereits rund 15 Jahre bis der volle Ernst des Problems erkannt wurde.
Unter dieser Adresse findet man Saferhealthcare
Bernard Braun, 7.8.2005