



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Shared Decision Making, Partizipative Entscheidungsfindung |
Alle Artikel aus:
Patienten
Shared Decision Making, Partizipative Entscheidungsfindung
Pro und Contra zum IQWiG-Bericht ĂĽber den fehlenden Nutzen oder Schaden von "gemeinsamer Entscheidungsfindung"
 Unter der Überschrift Führt eine gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient bei der Therapiewahl zu besseren Ergebnissen? stellten wir vor einigen Wochen die wesentlichen Aussagen des vom "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" veröffentlichten, erklärtermaßen "vorläufigen" Themencheck/HTA-Berichts zur gemeinsamen Entscheidungsfindung oder shared decision making vor.
Unter der Überschrift Führt eine gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient bei der Therapiewahl zu besseren Ergebnissen? stellten wir vor einigen Wochen die wesentlichen Aussagen des vom "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" veröffentlichten, erklärtermaßen "vorläufigen" Themencheck/HTA-Berichts zur gemeinsamen Entscheidungsfindung oder shared decision making vor.
Die zentrale Aussage lautete: "Für die patientenrelevanten Endpunkte Mortalität, Morbidität und Lebensqualität wurde kein Nutzen oder Schaden von SDM-Interventionen im Vergleich zur Standardversorgung ohne SDM-Intervention bzw. einer anderen SDM-Intervention abgeleitet."
Wie bereits in unserem Beitrag angekĂĽndigt, gab es die Gelegenheit bis Anfang Oktober Stellungnahmen abzugeben, mit denen sich das IQWiG bis zum 17.11. 2023 auseinandersetzen wollte.
Eine erste bereits jetzt öffentlich zugängliche Stellungnahme ist die des "Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. (EbM-Netzwerk)".
Das Netzwerk kritisiert vor allem folgende Punkte des IQWiG-Berichts:
• "Die Auswahl der primär fokussierten Endpunkte fĂĽr den HTA-Bericht ist nicht zielfĂĽhrend. Medizinische Effektivität und ökonomische Effizienz allein als patientenrelevanten Nutzen zu betrachten, reicht nicht aus."
• Eine informierte Entscheidung als aus Sicht des Patienten ebenfalls, wenn nicht sogar vorrangiger Endpunkt und Nutzen von SDM wĂĽrde im HTA-Bericht nicht berĂĽcksichtigt.
• Zusätzlich oder an anstelle der Endpunkte Morbidität und Mortalität mĂĽsste ein solcher Bericht patientenrelevante Endpunkte wie den Ort des Versterbens oder weniger Rehospitalisierungen, oder kein Haarausfall/positives Körperbild beachten.
• Die Literaturrecherche sei limitiert und konzentriere sich auf systematische Ăśbersichtsarbeiten, die indikations-/populationsĂĽbergreifend den Nutzen von einer oder kombinierten SDM-Interventionen untersucht haben, nicht aber auch auf indikations-/populationsspezifische systematische Ăśbersichten.
• "Grundsätzlich hält das EbM-Netzwerk den Ansatz fĂĽr problematisch, dass im HTA-Bericht auf die Frage "Hat SDM einen klinisch relevanten Nutzen hinsichtlich gesundheits-/krankheitsbezogener Endpunkte?" abgestellt wird. Damit bleibt unberĂĽcksichtigt, dass die evidenzbasierte Versorgung Werte und Präferenzen von Betroffenen als Prämisse voraussetzt und die Informations- und Mitwirkungspflicht bereits im BGB 630c ff. ("Patientenrechtegesetz") festgeschrieben sind. "Wie kann SDM gelingen?" wäre daher die geeignetere Fragestellung fĂĽr den HTA-Bericht gewesen."
Die Stellungnahme des EbM-Netzwerks ist komplett erhältlich.
Eine zweite ebenfalls bereits veröffentlichte Stellungnahme ist die der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der mit ihr kooperierenden "Verbände Verband der Diabetes-Beratungs-und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD)" und "diabetesDE. Deutsche Diabeteshilfe."
Diese Verbände kritisieren u.a. folgende Aspekte des IQWiG-Berichts:
• Es wĂĽrde dort nicht untersucht, "ob eine PE (partizipative Entscheidungsfindung) im Vergleich zu einer Nicht-PE-Kommunikation mehr Vor- oder Nachteile hat, sondern es wird eine 'Nutzenbewertung verschiedener Shared Decision Making-Interventionen' (S. 25) vorgenommen." Korrekt mĂĽsse daher bereits die Ăśberschrift so heiĂźen: "FĂĽhren verschiedene Interventionen zur Verbesserung der gemeinsamen Entscheidungsfindung von Aerztin und Patient zu besseren Behandlungsergebnissen."
• Es sei "wichtig zu vermitteln, dass es in dem Bericht nicht um kontrollierte, randomisierte Studien zur ĂśberprĂĽfung der Effektivität und Effizienz der PE (partizipative Entscheidungsfindung), sondern um MaĂźnahmen zur Steigerung der PE geht."
• Sowohl zahlreiche Studien als auch zentrale Instrumente der Diabetologie (z.B. strukturierte Patientenschulungen und MaĂźnahmen zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit) wĂĽrden "völlig auĂźer Acht" gelassen.
Die dreiseitige Stellungnahme von DDG und anderen Diabetes-Verbänden ist ebenfalls komplett erhältlich.
Ăśber die wahrscheinliche Kommentierung der Kritikpunkte in den beiden Stellungnahmen durch das IQWiG werden wir berichten.
Bernard Braun, 18.11.23
Resistenz gegenüber schlechter Beratung durch evidenzbasierte Informationen
 Die große Mehrzahl der Ärzte und Ärztinnen kennen bzw. verstehen die Prinzipien der (Krebs-)Früherkennung nicht, wie Studien einhellig zeigen, von denen wir eine Reihe im Forum in der Rubrik Früherkennung, Screening dokumentieren. Diese Prinzipien sind in diesen Lehrvideos dargelegt: Krankheitsfrüherkennung Teil 1 und Teil 2. Logischerweise kann die Beratung durch Ärzte, die diese Prinzipien nicht kennen bzw. verstanden haben, nur unzulänglich sein.
Die große Mehrzahl der Ärzte und Ärztinnen kennen bzw. verstehen die Prinzipien der (Krebs-)Früherkennung nicht, wie Studien einhellig zeigen, von denen wir eine Reihe im Forum in der Rubrik Früherkennung, Screening dokumentieren. Diese Prinzipien sind in diesen Lehrvideos dargelegt: Krankheitsfrüherkennung Teil 1 und Teil 2. Logischerweise kann die Beratung durch Ärzte, die diese Prinzipien nicht kennen bzw. verstanden haben, nur unzulänglich sein.
In einer Studie mit 897 Personen wurde getestet, ob korrekte Informationen vor unzureichender Beratung schützen.
In persönlichen Gesprächen erhielten 897 Personen, die aus dem Sozio-oekonomischen Panel rekrutiert wurden, entweder evidenzbasierte (z.B. absolute Risiken von Nutzen und Schäden) oder nicht-evidenzbasierte Informationen (z.B. relative Risiken von Nutzen und Schäden). Die genauen Formulierungen finden sich im Studienprotokoll.
Beide Arten von Information wurden aus tatsächlichen Patienteninformationsmaterialien entnommen.
Im Anschluss gaben die Probanden ihre Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an der Früherkennungsuntersuchung an.
Im nächsten Schritt erhielten alle Teilnehmer einseitige und nicht-evidenzbasierte Empfehlungen für oder gegen die Früherkennungsuntersuchung und sollten sich vorstellen, dass diese von ihrem eigenen Arzt kämen. Dabei handelte es sich um realen Empfehlungen aus dem ärztlichen Alltag. Nach Erhalt dieser unzulänglichen ärztlichen Empfehlung sollten die Probanden ihre Entscheidung neu treffen.
Probanden, die im ersten Schritt unzureichend (nicht-evidenzbasiert) informiert wurden und eine Entscheidung getroffen hatten, die im Widerspruch zur Empfehlung des imaginierten Arztes stand, änderten 33% ihre Entscheidung im Sinne der (unzulänglichen) Arztempfehlung. Bei gut (evidenz-basiert) Informierten betrug dieser Anteil nur 16%.
Initial gut informierte Probanden erwiesen sich also als relativ resistent gegenüber schlechten Empfehlungen, die hier von einem imaginierten Arzt gegeben wurden.
Die Stärke der Studie liegt darin, erstmals die Reaktion von vorab gut bzw. schlecht informierten Probanden auf schlechte Empfehlungen untersucht zu haben. Eine Verallgemeinerung ist dadurch beschränkt, dass das Arztgespräch einem hypothetischen Szenario entsprach, dass einen realen Arzt-Patient-Kontakt nicht realistisch wiedergeben kann. Allerdings dürfte die Durchführung einer entsprechenden Untersuchung im klinischen Setting kaum möglich sein.
Das Fazit lautet also, dass sich die meisten Personen, die gut über Krankheitsfrüherkennung informiert waren, sich durch schlechte Beratung nicht beirren ließen.
Wegwarth O, Wagner GG, Gigerenzer G. Can facts trump unconditional trust? Evidence-based information halves the influence of physicians' non-evidence-based cancer screening recommendations. PLOS ONE. 2017;12(8):e0183024. Link
Evidenzbasierte Entscheidungshilfen (nicht nur) für Krankheitsfrüherkennungs-Untersuchungen bietet das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hier auf seiner Website www.gesundheitsinformation.de
Das Harding-Zentrum für Risikokompetenz bietet Faktenboxen zu einem breiten Themenspektrum, u.a. zur Früherkennung von Brustkrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs.
David Klemperer, 26.5.20
Ausgerechnet kurz vor Ostern: Eier wieder zurück auf der "Lieber-nicht-essen"-Liste! Schwierigkeiten der informierten Entscheidung
 Egal ob es um die Einnahme oder den Konsum von Aspirin, Kaffee, das Glas Rotwein, die Mittelmeer-Diät, Schokolade, Super-/Power-Beeren oder viele andere (Lebens-)Mittel geht: Nicht selten ändern sich die auf wissenschaftliche Studien gestützten Empfehlungen innerhalb weniger Jahre - zum Teil mehrfach. Dabei spielen unterschiedliche Methoden (von der Querschnitts- oder Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe bis zu Kohortenstudien mit Metaanalyse), die Anzahl der Untersuchten, die Wahl der Endpunkte ("nur" Mortalität oder auch patientenbezogene Endpunkte wie Lebensqualität) oder die Dauer der Beobachtung eine Rolle. Wie damit die Mehrheit der Bevölkerung, egal ob sie zu den DauerleserInnen von Fachzeitschriften gehört, sich in Wochenzeitschriften, in Fernsehsendungen, bei "ihrem Arzt" oder "im Internet" informiert bzw.desinformiert, informierte Entscheidungen treffen kann, die ihr gesundheitlich nützen und wirtschaftlich sind, ist nicht einfach zu beantworten.
Egal ob es um die Einnahme oder den Konsum von Aspirin, Kaffee, das Glas Rotwein, die Mittelmeer-Diät, Schokolade, Super-/Power-Beeren oder viele andere (Lebens-)Mittel geht: Nicht selten ändern sich die auf wissenschaftliche Studien gestützten Empfehlungen innerhalb weniger Jahre - zum Teil mehrfach. Dabei spielen unterschiedliche Methoden (von der Querschnitts- oder Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe bis zu Kohortenstudien mit Metaanalyse), die Anzahl der Untersuchten, die Wahl der Endpunkte ("nur" Mortalität oder auch patientenbezogene Endpunkte wie Lebensqualität) oder die Dauer der Beobachtung eine Rolle. Wie damit die Mehrheit der Bevölkerung, egal ob sie zu den DauerleserInnen von Fachzeitschriften gehört, sich in Wochenzeitschriften, in Fernsehsendungen, bei "ihrem Arzt" oder "im Internet" informiert bzw.desinformiert, informierte Entscheidungen treffen kann, die ihr gesundheitlich nützen und wirtschaftlich sind, ist nicht einfach zu beantworten.
Wer 2015 gestützt auf die Ergebnisse eines systematischen Reviews und einer Metaanalyse doch wieder genussvoll ein Frühstücksei aß und sich sicher war, dass das damit aufgenommene Cholesterin nicht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und die damit assoziierte Mortalität erhöhte, könnte/sollte/müsste im Lichte der aktuellsten Studie rechtzeitig vor dem österlichen Eier-Speisegipfel ernsthaft über das Ende oder eine erhebliche Reduktion des Konsums von Eiern nachdenken.
Denn am Ende von sechs prospektiven Kohortenstudien mit nahezu 29.615 beteiligten Erwachsenen ohne anfängliche kardiovaskuläre Erkrankungen hatten nach durchschnittlich 17,5 Jahren Beobachtungszeit 5.400 ein kardiovaskuläres Ereignis und waren 6.100 tot.
Jede zusätzliche Aufnahme von 300 Milligramm des "bösen" Cholesterol über Eier und Fleisch war mit einem um 17% statistisch signifikant höheren Risiko eines neuen kardiovaskulären Ereignis und mit einem 18% höheren Sterberisiko assoziiert. Eier erklären diese Risikoerhöhungen nach Meinung der ForscherInnen deshalb, weil große Eier rund 190 Milligramm Cholesterol enthalten und auch schon ein halbes Ei ein gewichtiges Risiko darstellt. Dass die Assoziation zwischen Eierkonsum und der Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen nach einer Adjustierung nach der Gesamtaufnahme von Cholesterol nicht mehr signifikant ist, stellt einen kleinen Hoffnungsschimmer zumindest für den Konsum des einen oder anderen Ostereis dar.
Ein Herausgeber der Zeitschrift JAMA schlussfolgerte in Kenntnis dieser Studie: "Considering the negative consequences of egg consumption and dietary cholesterol in the setting of heart-healthy dietary patterns, the importance of following evidence-based dietary recommendations, such as limiting intake of cholesterol-rich foods, should not be dismissed."
Von dem am 19. März 2019 in der Fachzeitschrift "JAMA" erschienenen Aufsatz Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality von Victor W. Zhoing et al. (JAMA. 2019; 321(11):1081-1095) ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Die eingangs erwähnte Studie aus dem Jahr 2015 kam dagegen auf der Basis von 40 zwischen 1979 und 2013 Studien, darunter u.a. 17 Kohortenstudien mit 361.923 TeilnehmerInnen zu einem völlig anderen Ergebnis. Obwohl die Aufnahme von Cholesterol über Nahrungsmittel statistisch signifikant die Cholesterinwerte erhöhte, sah das Ergebnis so aus: "Dietary cholesterol was not statistically significantly associated with any coronary artery disease …, ischemic stroke … or hemorrhagic stroke. Mit dem Hinweis, dass noch methodisch bessere Studien durchgeführt warden sollten, um letzte Zweifel auszuräumen, leiten die AutorInnen die nächste Phase dieser Art von Achterbahn ein.
Die Studie Dietary cholesterol and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis von Samantha Berger, Gowri Raman, Rohini Vishwanathan, Paul F Jacques und Elizabeth J Johnson ist am 1. August 2015 in der Zeitschrift "The American Journal of Clinical Nutrition" (Volume 102, Issue 2, 1 August 2015, Pages 276-294) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Auf die möglichen Ursachen für diese wissenschafts- oder studiengeleitete Achterbahnfahrt der Basis für informierte Entscheidungen über Gesundheitsverhalten, weist der durch seine harsche Kritik an der methodischen Dürftigkeit vieler Studien und der Fragwürdigkeit ihrer Ergebnisse bekannt gewordene (laut British Medical Journal die "Geißel der schlampigen Wissenschaft") amerikanische Forscher John Ioannidis in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (SZ vom 4. April 2019 - leider ohne Abo nicht online zugänglich) auf die Frage, was er davon hielte, dass Eier "nun doch ungesund" seien, folgendermaßen hin: "Ja, das ist absolut sinnlos. Es gibt etwa eine Million Ernährungsstudien, Zehntausende Forscher arbeiten auf diesem Gebiet und veröffentlichen wie verrückt. Fast jeden Tag erscheint ein neues Paper, das mit sehr goßer Wahrscheinlichkeit nicht stimmt. Aber es geht immer so weiter, ad infitum. Es wird mit zweifelhaften Messmethoden gearbeitet, mit Beobachtungsstudien, die offen für eine Myriade verzerrender Einflüsse sind, mit Fragestellungen, die eine komplexe Sache übermäßig vereinfachen. Tatsächlich gibt eine fast unbegrenzte Zahl an Nahrungsmitteln, die sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden und mit unserem Lebensstil und anderen Einflüssen verwoben sind."
Und Studien, die methodisch hochwertig sind, mögen nach Meinung Ioannidis's "die meisten Ernährungsforscher ... nicht, weil bei diesen fast nie Nennenswertes herauskommt."
Bernard Braun, 8.4.19
"Das mit der evidenzbasierten Medizin ist einfach im Klinikalltag nicht zu schaffen" oder wie es vielleicht doch klappen könnte!!
 Egal, ob es um die schleppende Implementation von evidenzbasierter Medizin, wissenschaftlichen Leitlinien, shared decision making oder das Entlassmanagement in den Behandlungsalltag geht, wird häufig argumentiert "das klappt vielleicht im akademischen Bereich, aber nicht in meinem hektischen Klinik- oder Praxisalltag mit ständigem Zeitmangel".
Egal, ob es um die schleppende Implementation von evidenzbasierter Medizin, wissenschaftlichen Leitlinien, shared decision making oder das Entlassmanagement in den Behandlungsalltag geht, wird häufig argumentiert "das klappt vielleicht im akademischen Bereich, aber nicht in meinem hektischen Klinik- oder Praxisalltag mit ständigem Zeitmangel".
Umso bedeutender sind Beispiele dafür, dass die genannten oder andere innovative Behandlungsmaßnahmen sehr wohl umgesetzt werden können und wie sowie warum dies in einem ganz normalen Behandlungskontext gelingt.
Ein gerade veröffentlichter "narrative review" einer Gruppe von ÄrztInnen in einem niederländischen 950-Betten-Krankenhaus schildert plastisch, wie in der dortigen pädiatrischen Abteilung mit jährlich rund 8.400 stationär und weiteren tausenden von ambulant versorgten PatientInnen (dies rechtfertigt die Charakterisierung dieser Klinik als "busy") beginnend im Jahr 2005 wesentliche Elemente der evidenzbasierten Medizin (EBM) erfolgreich eingeführt wurden.
Die AutorInnen listen auch auf welche Maßnahmen ihres Erachtens für die erfolgreiche Implementation verantwortlich waren und sind.
Die Maßnahmen reichen von der
• Benennung eines Projektleiters, der oder die als eine Art "buddy" (Kumpel/Kompagnon) die treibende Kraft darstellt, über das
• gesicherte Training oder die Schulung des gesamten Personals zu den Basiselementen von EBM,
• den strukturierten Einbau von spezifischen Zeiträumen ("time slots") in die Terminplanung, in denen wöchentlich über die neuen Handlungsweisen nachgedacht werden kann und neue glaubwürdige Rollen eingeübt werden können bis zur
• Entwicklung der Bereitschaft mit Unsicherheiten umzugehen und Fragen zu stellen, an Stelle omnipotenten und paternalistischen Verhaltens.
Unter diesen Voraussetzungen kommen die in dieser Klinik arbeitenden AutorInnen zu folgendem Resümee: "systematic application of EBM is feasible and worthwhile in a busy clinical service. We have experienced that changing into an EBM practice has made our daily work as healthcare professionals more interesting, more rewarding and more fun."
Der kurze Aufsatz Implementing evidence-based medicine in a busy general hospital department: results and critical success factors von E. Draaisma et al. ist in der Zeitschrift "BMJ Evidence-Based Medicine" (Oktober 2018, Vol 23/Number 5: 173-176) erschienen. Die erste Seite ist kostenlos zu lesen.
Bernard Braun, 15.11.18
G-Trust oder Wie suche ich mir als Arzt die "richtige" Behandlungs-Leitlinie aus?
 Für die Behandlung vieler Krankheiten durch Fachärzte für Allgemeinärzte und zahlreiche andere Fachärzte gibt es eine seit Jahren zunehmende Fülle von Leitlinien oder Behandlungsempfehlungen. Sie werden wiederum weltweit von einer Fülle von wissenschaftlichen Einrichtungen, medizinischen Fachgesellschaften und korporatistischen Einrichtungen mit unterschiedlichster Methodik und Evidenzgraden sowie durch unterschiedlichst zusammengesetzte Arbeitsgruppen erstellt. Zu Recht wird daher von praktisch tätigen ÄrztInnen beklagt, wie schwer und mit zeitlichen Verzögerungen verbunden ein Überblick zu gewinnen ist und dann die Auswahl der "richtigen" Leitlinie sei.
Für die Behandlung vieler Krankheiten durch Fachärzte für Allgemeinärzte und zahlreiche andere Fachärzte gibt es eine seit Jahren zunehmende Fülle von Leitlinien oder Behandlungsempfehlungen. Sie werden wiederum weltweit von einer Fülle von wissenschaftlichen Einrichtungen, medizinischen Fachgesellschaften und korporatistischen Einrichtungen mit unterschiedlichster Methodik und Evidenzgraden sowie durch unterschiedlichst zusammengesetzte Arbeitsgruppen erstellt. Zu Recht wird daher von praktisch tätigen ÄrztInnen beklagt, wie schwer und mit zeitlichen Verzögerungen verbunden ein Überblick zu gewinnen ist und dann die Auswahl der "richtigen" Leitlinie sei.
Um hier zu helfen, hat nun eine Gruppe von us-amerikanischen und kanadischen 22 ExpertInnen für evidenzbasierte Medizin, darunter 17 an der Entwicklung qualitativ hochwertiger Leitlinien beteiligte Experten und ein Vertreter der NutzerInnen medizinischer Leistungen, in einem aufwändigen Verfahren ein Tool bzw. eine Entscheidungscheckliste namens G-Trust (Guideline Trustworthiness, Relevance, and Utility Scoring Tool) entwickelt. Für die Entscheidung für oder gegen Leitlinien schlägt die Gruppe die folgenden acht Entscheidungskriterien vor:
• "The patient populations and conditions are relevant to my clinical setting.
• The recommendations are clear and actionable.
• The recommendations focus on improving patientoriented outcomes, explicitly comparing benefits versus harms to support clinical decision making.
• The guidelines are based on a systematic review of the research data.
• The recommendation statements important to you are based on graded evidence and include a description of the quality (e,g, strong, weak) of the evidence.
• The guideline development includes a research analyst, such as a statistician or epidemiologist.
• The Chair of the guideline development committee and a majority of the rest of the committee are free of declared financial conflicts of interest, and the guideline development group did not receive industry funding for developing the guideline.
• The guideline development includes members from the most relevant specialties and includes other key stakeholders, such as patients, payer organizations, and public health entities, when applicable."
Das stärkste Gewicht bei der Gesamtbeurteilung von Leitlinien haben dabei die Basierung der Leitlinie auf einem systematischen Review der Forschungsdaten mit 22,5%, die Anforderung der Evidenzgrades und der Qualität der Evidenz müsse ausführlich dargestellt worden sein (20,2%) und die differenzierte Orientierung am Outcome für PatientInnen durch die Abwägung des Nutzens und der Schädigungen einer Behandlung (18%).
Bei aller von den VerfasserInnen selbst eingeräumten Grenzen des Instruments (z.B. gibt es für 57% der Leitlinien für die Behandlung einer schweren Depression keine Angaben über mögliche Interessenkonflikte der LeitlinienverfasserInnen) ist es in der Lage zwischen hilfreichen, weniger und nicht hilfreichen Leitlinien zu unterscheiden. Ob mit G-Trust und anderen Evaluationsinstrumenten für Leitlinien eine ausreichende Grundlage für die gemeinsame Entscheidungsfindung von PatientInnen und ÄrztInnen existiert, ist selbst für die G-Trust-Entwickler nicht gesichert.
Unabhängig davon bleibt die Tatsache, dass es im deutschen Gesundheitswesen eine Reihe von Behandlungsbereichen ohne jegliche Leitlinie für die gemeinsame Entscheidungsfindung oder von Behandlungsschwerpunkten gibt, ein untragbarer und durch nichts als die faktische Kraft des eminenzbasierten und einkommensoptimierenden Behandlungsalltags gerechtfertigter Zustand. Ein faktisch leitlinienfreier Bereich ist z.B. die mehrjährige kieferorthopädische Behandlung von bis zu 60% eines Altersjahrgangs von Kindern oder Jugendlichen.
Der Aufsatz Developing a Clinician Friendly Tool to Identify Useful Clinical Practice Guidelines: G-TRUST von Allen F. Shaughnessy et al. ist in der September/Oktober-Ausgabe der Fachzeitschrift "Annals Fam Med" (vol. 15 no. 5 413-418) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.9.17
Falsches Wissen 1 - bei Ärzten weit verbreitet
 Notwendige Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen in der Medizin ist ein zutreffendes Wissen über Nutzen und Schäden (Risiken). Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Ärzte zumeist nicht über dieses Wissen verfügen. Nutzen und Schäden für therapeutische, diagnostische und präventive Maßnahmen geben Ärzte selten zutreffend an aber häufig zu hoch oder zu niedrig. Dabei herrscht ein überoptimistisches Bild vor - der Nutzen wird zumeist überschätzt und die Schäden werden unterschätzt.
Notwendige Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen in der Medizin ist ein zutreffendes Wissen über Nutzen und Schäden (Risiken). Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Ärzte zumeist nicht über dieses Wissen verfügen. Nutzen und Schäden für therapeutische, diagnostische und präventive Maßnahmen geben Ärzte selten zutreffend an aber häufig zu hoch oder zu niedrig. Dabei herrscht ein überoptimistisches Bild vor - der Nutzen wird zumeist überschätzt und die Schäden werden unterschätzt.
Für die Übersichtsarbeit werteten die Autoren die Angaben von 13.011 Ärzten in 48 Studien der Jahre von 1981 bis 2015 aus. Die Studien stammen aus 17 Ländern, 16 der 48 Studien aus den USA. Eingeschlossen sind Studien, in denen die Ärzte quantitative Angaben zu Nutzen und Schäden von Therapie (20 Studien), bildgebenden Untersuchungen (20 Studien) und Screening (8 Studien - 5 zu Krebsscreening, 3 zu vorgeburtlichem Screening) machen sollten.
30 Studien untersuchten die Einschätzung von Schäden, 9 von Nutzen und 6 sowohl Nutzen als auch Schäden.
Zutreffend geben die befragten Ärzte nur 3 von 28 Nutzenergebnisse und 9 von 69 Schadenergebnisse an. Dabei wird der Nutzen sehr viel häufiger über- als unterschätzt, die Schäden hingegen werden sehr viel häufiger unter- als überschätzt.
Die 48 Studien stellen die Autoren in 3 Tabellen dar, unterteilt in Therapien, nicht-bildgebende Untersuchungen / Screening-Untersuchungen und bildgebende Untersuchungen dar.
Beispielhaft seien hier einige Ergebnisse genannt. Dabei ist zu betonen, dass die Ergebnisse für die jeweilige Studie mit den jeweiligen Ärzten zum gegebenen Zeitpunkt gelten und sich nicht ohne weiteres verallgemeinern lassen.
• Fast die Hälfte der Allgemeinmediziner überschätzen den Nutzen der Antibioitikatherapie bei akuter Mittelohrentzündung und bei akuter Mandelentzündung, gleichzeitig überschätzen sie die Risiken der Nicht-Verschreibung (Studie aus 2012).
• In der Bewertung der Mortalitätsrisiken und Komplikationsraten für Eingriffe wie Leistenbruchoperation, Mandelentfernung, Gebärmutterentfernung und Linksherzkatheteruntersuchung liegen nur etwa ein Viertel der Ärzte innerhalb der richtigen Größenordnung, ein ähnlicher Anteil überschätzte bzw. unterschätzte die Risiken (Studie aus 1985).
• Urologen schätzen die Risiken für Inkontinenz und Impotenz bei verschiedenen Behandlungsformen des Prostatakarzinoms richtig ein. Die Spezialisten empfehlen aber die Therapie, die sie erbringen (Studie aus 2000).
• 1998 überschätzten Ärzte den Nutzen der Hormon"ersatz"therapie für die koronare Herzkrankheit, die Knochendichte und die Alzheimer-Krankheit.
• Ärzte sind über und Nutzen Schäden des Mammografie-Screenings nicht zutreffend informiert (Studien aus 1981, 1989, 1993).
• Kinderärzte unterschätzen das Krebsrisiko von CT-Untersuchungen bei Kindern (Studie aus 2012).
• Die meisten Orthopäden unterschätzen die Strahlenbelastung durch eine Knochendichtemessung (Studie aus 2003).
Diese hochrelevante systematische Übersichtsarbeit weist darauf hin, dass Ärzte ihr Handeln häufig überoptimistisch und somit unrealistisch bewerten. Die Studie untersuchte den Zeitraum von 1981 bis 2015. Anhaltspunkte für eine Besserung der Situation liegen eher nicht vor, vielmehr zeigen Studie, die auch für das Forum Gesundheitspolitik aufgearbeitet wurden, gravierende Probleme bei der Therapie mit Antibiotika, dem Mammographie-Screening, dem Stent bei der koronaren Herzkrankheit und der Chemotherapie bei fortgeschrittenem Krebs.
Behandlungsentscheidungen können nicht besser sein als die Informationen, auf denen sie beruhen. Jegliche Bemühung für eine Versorgung, die sich am Bedarf der Nutzer orientiert, sollte von diesem Sachverhalt ausgehen.
Bereits 2015 haben die Autoren eine analoge Studie zu den Einschätzungen der Patienten veröffentlicht Link. Eine Darstellung wird in kürze hier erscheinen.
Hoffmann TC, Del Mar C. Clinicians' expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: A systematic review. JAMA Internal Medicine 2017;177(3):407-19. Link
Hoffmann TC, Del Mar C. Patients' expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: a systematic review. JAMA Intern Med 2015;175(2):274-86. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.6016 [published Online First: 2014/12/23]
im Forum Gesundheitspolitik: Link
David Klemperer, 10.4.17
Neues vom PSA-Screening Teil 2 von 2 - Früh erkannter Prostatakrebs: Komplikationen häufig bei aktiver Behandlung
 In Teil 1 (Früh erkannter Prostatakrebs: Sterblichkeit gering ohne und mit Behandlung) wurden die Ergebnisse der randomisierten kontrollierten ProtecT-Studie zur Therapie des durch Screening erkannten Prostatakrebses dargelegt. Gerade 1 Teilnehmer von 100 war nach 10 Jahren an den Folgen des Prostatakrebses gestorben und zwar unabhängig davon, ob er operiert, bestrahlt oder nicht behandelt wurde.
In Teil 1 (Früh erkannter Prostatakrebs: Sterblichkeit gering ohne und mit Behandlung) wurden die Ergebnisse der randomisierten kontrollierten ProtecT-Studie zur Therapie des durch Screening erkannten Prostatakrebses dargelegt. Gerade 1 Teilnehmer von 100 war nach 10 Jahren an den Folgen des Prostatakrebses gestorben und zwar unabhängig davon, ob er operiert, bestrahlt oder nicht behandelt wurde.
In einer 2. Veröffentlichung wurden weitere aus Sicht der Patienten bedeutsame Ergebnisse (patient-reported outcomes) der ProtecT-Studie berichtet.
Verglichen wurden erneut die Gruppen
• Aktive Beobachtung
• Operative Entfernung der Prostata
• Bestrahlungstherapie in Verbindung mit einer Hormontherapie
Studienteilnehmer beantworteten einen Fragebogen zur Blasen-, Darm- und Sexualfunktion, zu spezifischen Auswirkungen auf die Lebensqualität, zu Angst, Depressivität und zur allgemeinen Gesundheit. Sie erhielten den Fragebogen vor Diagnosestellung, 6 und 12 Monate nach der Randomisation (Zuordnung zur jeweiligen Gruppe) und in der Folge jährlich. Ausgewertet wurde jetzt eine Nachbeobachtungszeit von 6 Jahren. Mit 85% war die Antwortquote hoch.
Im Vergleich der 3 Gruppen trat Inkontinenz nach Prostataentfernung am häufigsten auf: die Benutzung von Inkontinenzeinlagen stieg von 1% vor der Operation auf 46% nach 6 Monaten und sank auf 17% nach 6 Jahren. Bei Bestrahlung lag der Anteil nach 6 Monaten bei 6% und nach 6 Jahren 4%, bei Beobachtung nach 6 Monaten bei 4% und nach 6 Jahren bei 8%.
Auch die sexuelle Funktion war bei der Prostataentfernung am stärksten beeinträchtigt. Schlechter schnitten die operierten Männer bei Maßen ab wie "Erektionsstärke ausreichend für Geschlechtsverkehr", Impotenz und sexuelle Lebensqualität. Vor der Therapie berichteten 67% aller Männer über ausreichende Erektionsstärke, nach 6 Monaten war die Rate auf 12% bei Prostataentfernung gefallen, auf 22% bei Bestrahlung und auf 52% bei Beobachtung. Nach 6 Jahren waren 17% der Patienten nach Prostataentfernung zum Geschlechtsverkehr in der Lage, in der Bestrahlungsgruppe 27% und in der Beobachtungsgruppe 30%.
Die Bestrahlung führte zu etwas höheren Raten an Darmproblemen, wie Blut im Stuhl und bei den Betroffenen zu einer etwas geminderten Lebensqualität.
Der Vergleich der gesundheitsbezogenen körperlichen und psychischen Lebensqualität zeigte keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den 3 Gruppen .
Zusammenfassend führt die Prostataentfernung am häufigsten zu Impotenz und Inkontinenz, die Bestrahlung kann in eher seltenen Fällen zu Darmproblemen führen. Die Patienten der Beobachtungsgruppe hatten im Vergleich die geringste Rate an Problemen. Die Lebensqualität unterschied sich interessanterweise nicht. Dies könnte dadurch zu erklären sein, dass sich die Patienten mit Inkontinenz bzw. Impotenz in ihr Schicksal fügen.
Diese Studie dürfte die bisher verlässlichsten Daten über die unerwünschten Auswirkungen von Prostataentfernung und Bestrahlung im Vergleich zur aktiven Beobachtungergeben erbracht haben.
Aus Sicht des Autors dieses Beitrags unterstreichen die Ergebnisse der ProtecT-Studie die Strategie, darauf zu verzichten, Männern das PSA-Screening aktiv anzubieten. Bei Nachfrage durch den Patienten sollte er mit einer strukturierten Entscheidungshilfe die wesentlichen Informationen erhalten und bei weiter bestehendem Wunsch schriftlich erklären, dass er weiß, worauf er sich einlässt. Für solch eine Entscheidungshilfe liefert die ProtecT-Studie wichtige Informationen.
Donovan JL, Hamdy FC, Lane JA, et al. Patient-reported outcomes after monitoring, surgery, or radiotherapy for prostate cancer. N Engl J Med 2016; 375:1425-37 Abstract
David Klemperer, 27.10.16
Neues vom PSA-Screening Teil 1 von 2 - Früh erkannter Prostatakrebs: Sterblichkeit gering ohne und mit Behandlung
 Den neuesten Daten zufolge erkrankten im Jahr 2012 in Deutschland 63.710 Männer an Prostatakrebs und 12.957 starben daran. Damit ist Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern, mit Abstand gefolgt von Lungenkrebs, an dem 2012 34.490 Männer erkrankten und 29.713 verstarben (Frauen: 18.030 erkrankten, 14.752 verstarben) (Krebs in Deutschland, Ausgabe 2015, S. 94 und S. 58). Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen an Prostatakrebs ist absolut seit 1998 um mehr als die Hälfte gestiegen (von 40.000 auf über 60.000). Der Anteil der Männer, die 2014 am Prostatakrebs starben, betrug laut Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes 3,2% - andersherum: knapp 97% der Männer starben nicht daran.
Den neuesten Daten zufolge erkrankten im Jahr 2012 in Deutschland 63.710 Männer an Prostatakrebs und 12.957 starben daran. Damit ist Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern, mit Abstand gefolgt von Lungenkrebs, an dem 2012 34.490 Männer erkrankten und 29.713 verstarben (Frauen: 18.030 erkrankten, 14.752 verstarben) (Krebs in Deutschland, Ausgabe 2015, S. 94 und S. 58). Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen an Prostatakrebs ist absolut seit 1998 um mehr als die Hälfte gestiegen (von 40.000 auf über 60.000). Der Anteil der Männer, die 2014 am Prostatakrebs starben, betrug laut Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes 3,2% - andersherum: knapp 97% der Männer starben nicht daran.
Das Prostata-spezifische Antigen wird seit Ende der 1980er-Jahre als Test zur Früherkennung eingesetzt. Problematisch sind dabei 3 Sachverhalte:
• Der Test soll die an Prostatakrebs Erkrankten "aussieben", diese sollen sozusagen im Sieb verbleiben während die Nicht-Erkrankten "durchrutschen". Dies leistet der Test aber nur unzureichend, wie eine schwedische Studie gezeigt hat - ein relevanter Anteil der Erkrankten "rutscht durch" und ein relevanter Anteil der Gesunden "bleibt im Sieb hängen" und erhält das Etikett krankheitsverdächtig.
• Die Therapie der früh erkannten Prostatakarzinome hat sich bislang nicht als effektiv erwiesen.
• Viele früh erkannte Tumoren wären im Verlauf wegen ihres langsamen Wachstums nie symptomatisch geworden (dies wird als Überdiagnose bezeichnet).
Die englische ProtecT-Studie untersucht den Nutzen und die Schäden unterschiedlicher Behandlungsstrategien des lokalisiertem Prostatakarzinoms. Ausgangspunkt sind 82,429 Männer, die zwischen 1999 und 2009 in einer Hausarztpraxis einen PSA-Test erhalten haben. 2664 Männer erhielten die Diagnose Prostatakrebs im Frühstadium (auch: lokalisiertes Prostatakarzinom). 1643 stimmten der Teilnahme an der Studie zu. Sie wurden nach Zufallsprinzip in eine von drei Gruppen eingeteilt (randomisiert):
• Aktive Beobachtung
• Operative Entfernung der Prostata
• Bestrahlungstherapie in Verbindung mit einer Hormontherapie
Unter aktiver Beobachtung wird eine Strategie verstanden, in der durch wiederholte PSA-Messungen untersucht wird, ob das Prostatakarzinom wächst oder nicht - operiert oder bestrahlt wird nur im Falle des Fortschreitens. Das Durchschnittsalter betrug zum Zweitpunkt der Randomisation 62 Jahre.
Die wichtigsten Ergebnisse nach 10 Jahren lauten:
• (nur) 17 der 1643 Männer sind am Prostatakrebs gestorben
• In allen 3 Gruppen sind nach 10 Jahren 99% der Teilnehmer nicht am Prostatakarzinom gestorben.
• Auch die Gesamtsterblichkeit der 3 Gruppen ist mit etwa 10% gleich.
Die vorab als Erfolgskriterium definierte Sterblichkeit am Prostatakrebs (primärer Endpunkt) ist also gleich, so auch die als sekundärer Endpunkt definierte Gesamtsterblichkeit.
Etwas häufiger wurde in der Beobachtungsgruppe das Fortschreiten des Prostatakrebses und das Auftreten von Metastasen verzeichnet (sekundäre Endpunkte). In der Beobachtungsgruppe traten in 6 Fällen pro 1000 Personenjahren Metastasten auf, in den Behandlungsgruppen in 2 bis 3 Fällen. Ein Fortschreiten der Erkrankung wurde in der Beobachtungsgruppe in 22 Fällen pro 1000 Personenjahre beobachtet, in den Behandlungsgruppen in je 9 Fällen.
Aus den Zahlen folgt, dass 27 Männer eine operative Prostataentfernung erhalten müssen, um einen Fall von Metastasen zu verhindern bzw. 33 Männer eine Strahlentherapie (number needed to treat). 9 Männer müssen eine Prostataentfernung oder eine Strahlentherapie erhalten, um einen Fall von Krankheitsprogression zu verhindern.
Die Ergebnisse zeigen Folgendes:
Nur wenige der durch PSA-Screening entdeckten Prostatakarzinome führen innerhalb von 10 Jahren zum Tode, unabhängig davon ob operiert oder bestrahlt wird oder nicht. Die Therapie ist insofern wirksam, dass nach 10 Jahren einige Männer mehr Metastasen bzw. ein Fortschreiten der Erkrankung aufweisen, die primär keine Therapie erhalten haben. Ob sich das im weiteren Verlauf in einer niedrigeren Sterblichkeit äußert, lässt sich nicht vorhersagen - die Ergebnisse einer längeren Nachbeobachtung müssen abgewartet werden. Dabei ist zu bedenken, dass das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Auswertung 72 Jahre betrug und die durchschnittliche Lebenserwartung englischer Männer bei 78 Jahren liegt. Viel Zeit für den Lebenszeitgewinn verbleibt somit nicht mehr.
Deutlich dürfte schon jetzt sein, dass der Aufwand für ein niedrigeres Risiko des Fortschreitens der Erkrankung sehr hoch ist und die damit einhergehenden Schäden relevant, wie die Befragung der Probanden gezeigt hat, deren Ergebnisse ebenfalls vor Kurzem veröffentlicht wurden und in Teil 2 dargelegt werden
Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA, et al. 10-year outcomes after monitoring, surgery, or radiotherapy for localized prostate cancer. N Engl J Med 2016; 375:1415-24 Abstract
Lane JA, Donovan JL, Davis M, Walsh E, Dedman D, Down L, Turner EL, Mason MD, Metcalfe C, Peters TJ et al: Active monitoring, radical prostatectomy, or radiotherapy for localised prostate cancer: study design and diagnostic and baseline results of the ProtecT randomised phase 3 trial. The Lancet Oncology 2014, 15(10):1109-1118. Volltext
Holmstrom B, Johansson M, Bergh A, Stenman U-H, Hallmans G, Stattin P: Prostate specific antigen for early detection of prostate cancer: longitudinal study. BMJ 2009, 339(sep24_1):b3537-. BMJ 2009;339:b3537 Abstract
Robert Koch Institut. Krebs in Deutschland 2011/2012. 10. Ausgabe 2015. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Link.
David Klemperer, 27.10.16
"Kind mit 38 oder 43?" Hochriskant für Mutter und Kind oder eher nicht!?
 Ein Teil der immer noch rund 70% aller Schwangeren, die nach den im Mutterpass aufgelisteten Indikatoren eine "Risikoschwangerschaft" durchmachen, sind dies aufgrund ihres Alters von über 35 Jahren. Und dass es sich nicht um ein abstraktes Risiko handelt, bestätigt scheinbar zwingend eine Reihe von gesundheitlichen Störungen (z.B. Downsyndrom, Karzinome), die bei Kindern älterer häufiger als bei denen jüngerer Mütter auftreten. Sollten also Frauen über 35 Jahre zum Wohle ihrer Kinder generell von Schwangerschaften absehen und/oder besser ein paar Jahre früher schwanger werden? Und müssen sie, wenn sie dies nicht tun, ein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben?
Ein Teil der immer noch rund 70% aller Schwangeren, die nach den im Mutterpass aufgelisteten Indikatoren eine "Risikoschwangerschaft" durchmachen, sind dies aufgrund ihres Alters von über 35 Jahren. Und dass es sich nicht um ein abstraktes Risiko handelt, bestätigt scheinbar zwingend eine Reihe von gesundheitlichen Störungen (z.B. Downsyndrom, Karzinome), die bei Kindern älterer häufiger als bei denen jüngerer Mütter auftreten. Sollten also Frauen über 35 Jahre zum Wohle ihrer Kinder generell von Schwangerschaften absehen und/oder besser ein paar Jahre früher schwanger werden? Und müssen sie, wenn sie dies nicht tun, ein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben?
Wenn man die Ergebnisse einer gerade veröffentlichen Längsschnittanalyse der Gesundheit und Lebensqualität von über 1,5 Millionen in Schweden zwischen 1960 und 1991 geborenen männlichen und weiblichen Kinder betrachtet, lässt sich diese Frage nicht mehr eindeutig bejahen und entlastet Frauen, die sich dennoch für ein "Kind mit 38" entscheiden, zumindest von einem Teil des selbstgeschaffenen oder oktroyierten schlechten Gewissens.
Das deutsch-britische Forscherteam untersuchte die Beziehungen zwischen dem Alter der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Kinder, deren späterer Größe und Gewicht, körperlicher Fitness, Leistungsniveau in der weiterführenden Schule und höchstem Bildungsabschluss. Diese Indikatoren gelten als Indikatoren bzw. Proxies (Hilfsvariablen, Stellvertretermerkmale) für die Gesamtgesundheit, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Gesamtheit der Lebenschancen ("lifetime opportunities").
Die Daten erlaubten dann Vergleiche dieser Faktoren zwischen den im frühen Lebensalter der Mutter geborenen Kindern und ihren im höheren Lebensalter der Mutter geborenen Geschwistern.
Das wesentliche Ergebnis mehrerer unterschiedlich nach Makro- und Mikromerkmalen von Eltern und Kindern adjustierten Berechnungen lautet, dass die im höheren Lebensalter geborenen Kinder gemessen an den Indikatoren entweder signifikant gesünder, größer und bildungsbezogen und damit auch bei den Beschäftigungschancen bessergestellt (längere Schulzeiten mit höheren Abschlüssen) sind als ihre älteren, früher im Leben ihrer Mütter geborenen Geschwister oder zumindest nicht signifikant schlechter gestellt sind: "We find that the total effect of increasing maternal age—which includes individual-level factors such as reproductive aging and changing social resources, as well as the positive impact of improving macro-level period conditions—is consistently positive." Die Einflussstärke der sozialen Makrobedingungen ist so stark, dass die festgestellten positiven Effekte für die Spätergeborenen selbst bei durchweg negativem Gewicht der individuellen Bedingungen auftreten.
Und noch deutlicher:
• "In fully adjusted models that remove the influence of the positive time trend, we found no substantively or statistically significant disadvantage for outcomes in adulthood for those born to older mothers, not even for those born to mothers aged 45 or older."
• "Nevertheless, in absolute terms, offspring who are born to an older mother in contemporary Sweden and survive to adulthood do better than their older siblings who were born when their mother was at her peak level of reproductive health."
Trotzdem sie damit erheblich das eingangs erwähnte schlechte Gewissen älter gebärenden Frauen und ihrer Partner reduzieren helfen, weisen die ForscherInnen auf zwei Einschränkungen hin: Erstens könnte es sich bei den Müttern mit mindestens zwei Kindern um "strong mothers" mit "relatively robust babies" handeln, was einen Teil der positiven Ergebnisse der jüngeren Kinder erklären könnte. Zweitens können und wollen sie angesichts einer Reihe von auch zitierten Querschnitts- und Beobachtungsstudien, die immer noch ein höheres Risiko einer schweren Geburt und von negativen gesundheitlichen Zuständen der von älteren Müttern geborenen Kindern belegen, keine "policy recommendation that it is better for women to delay childbearing to an older age" geben.
Sie empfehlen aber, dass Frauen, die über ein Kind nachdenken, die Erkenntnisse ihrer Studie bei ihrer Entscheidung für oder gegen ein Kind und/oder nachdem sie schwanger sind oder ein Kind geboren haben, mitbedenken.
Ergänzend ist festzuhalten, dass diese Erkenntnisse streng genommen nur für Mütter mit einem früh- und einem spätgeborenen Kind gelten und nicht für ein einziges Kind im Mutteralter von 38 oder 43 Jahren.
Diese Studie zeigt dreierlei: Sie motiviert auch bei anderen gewichtigen handlungsleitenden gesundheitsbezogenen Erkenntnissen skeptisch zu sein und sie gründlich zu hinterfragen. Sie zeigt außerdem, dass häufig Verlaufsbetrachtungen negative aber auch positive Ergebnisse aus Querschnittsanalysen widerlegen oder erheblich abmildern können. Und schließlich sollten bei gesundheitsbezogenen Studien mit Aussagen zu biografischen Risiken nicht nur individuelle Mikrofaktoren, sondern auch Bedingungen auf der sozialen Makroebene mitberücksichtigt werden.
Die 26 Seiten umfassende Studie Advanced Maternal Age and Offspring Outcomes: Reproductive Aging and Counterbalancing Period Trends von Kieron Barclay und Mikko Myrskyl ist in der Fachzeitschrift "Population and Development Review" (2016; 42 (1)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.5.16
Mehrheit der Studienergebnisse über Strahlentherapie in den USA trotz Verpflichtung nicht offen zugänglich
 Wichtige Entscheidungen über die Einführung und Nutzung neuer diagnostischen und therapeutischen Mittel werden immer mehr auf der Basis wissenschaftlicher klinischer Studien und der dort identifizierten Evidenz zum erreichbaren Nutzen getroffen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass dieses Entscheidungssystem funktioniert, ist die vollständige und zeitnahe Transparenz über alle Ergebnisse dieser Studien.
Wichtige Entscheidungen über die Einführung und Nutzung neuer diagnostischen und therapeutischen Mittel werden immer mehr auf der Basis wissenschaftlicher klinischer Studien und der dort identifizierten Evidenz zum erreichbaren Nutzen getroffen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass dieses Entscheidungssystem funktioniert, ist die vollständige und zeitnahe Transparenz über alle Ergebnisse dieser Studien.
Einer der möglichen und bereits mehrere Male aufgedeckte Mangel ist, dass Ergebnisse negativer Art, also z.B. fehlender Nutzen oder unerwünschte Wirkungen nicht, d.h. nur positive Ergebnisse veröffentlicht werden.
Um einen weiteren Mangel, nämlich die Nichtveröffentlichung oder zeitlich erheblich verzögerte Veröffentlichung von Ergebnissen, zu verhindern, gibt es in den USA seit 2007 die Verpflichtung, Studienergebnisse innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung der Studienarbeiten öffentlich zugänglich zu machen.
Wie die Realität im Bereich von in den USA durchgeführten Phase III-Studien zur Strahlentherapie, also einer für viele Patienten relevanten Therapieform - aussieht, haben nun Wissenschaftler für die "European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)" und auf deren Konferenz am 30. April 2016 präsentiert.
Als erstes untersuchten sie wie hoch der Anteil dieser Art von Therapiestudien war, die ihre Ergebnisse vor Inkrafttreten der Veröffentlichungspflichten im Jahr 2007 nicht veröffentlichten. Von den 552 berücksichtigten Studien waren dies 422 oder 76,4%.
Entgegen der Erwartung, die Publikationsverpflichtung sorge für mehr Transparenz, stieg der Anteil der Studien, die ihre Ergebnisse nicht wie ab 2007 vorgeschrieben transparent machten, und sei es nur in einer Zusammenfassung der Resultate, im Zeitraum bis 2013 sogar noch auf 81,7% an (655 von insgesamt 802 Strahlentherapiestudien).
Zu den weiteren Funden der beiden Wissenschaftler gehörte, dass sich die Intransparenz je nach Krankheitsart erheblich unterschied. So wurden Studienergebnisse über die strahlentherapeutische Behandlung von Augenkarzinomen "nur" zu 47% nicht veröffentlicht, die über die Behandlung von Brust- und Lungenkrebs zu 78% und 73,7% nicht und die über die Strahlentherapie von Hoden- und Dickdarmkrebs überhaupt nicht - jeweils nicht in dem vorgeschriebenen Einjahreszeitraum.
Ebenfalls unerwartet war, dass sich die für explizit unternehmensfinanzierte Studien Verantwortlichen deutlich häufiger regelkonform verhielten als die von akademischen Studien.
Um im ethischen und gesundheitlichen Interesse der StudienteilnehmerInnen und anderer PatientInnen mehr Transparenz erwirken zu können, schlagen die AutorInnen vor, dass Studienverantwortliche, die eine neue Studie öffentlich finanziert bekommen bzw. registrieren (diese Registration in einer speziellen Datenbank ist eine Voraussetzung für den Studienbeginn) wollen, vorher die Ergebnisse aller ihrer bisherigen Studien veröffentlichen müssen.
Eine Zusammenfassung der Präsentation Failure to publish trial results exposes patients to risks without providing benefits von Jaime Pérez-Aljia und Pedro Gallego ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.5.16
Chemotherapie bei fortgeschrittenem Krebs: Ärzte lassen Patienten keine Wahl, aber Patienten merken es nicht
 Spielt Shared Decision Making eine Rolle bei Entscheidungen über eine Zweit- und Drittlinienchemotherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs, ist die Frage, der eine holländische Studie nachging.
Spielt Shared Decision Making eine Rolle bei Entscheidungen über eine Zweit- und Drittlinienchemotherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs, ist die Frage, der eine holländische Studie nachging.
Teilnehmer waren 14 Patienten mit metastasiertem Darmkrebs (mittlere Überlebenszeit 24 bis 28 Monate) bzw. mit einem nicht heilbaren Hirntumor (Glioblastom, mittlere Überlebenszeit 14 Monate) und ihre insgesamt 18 Ärzte. Eine Forscherin begleitete die Patienten bei ihren Arztbesuchen. Stand wegen Fortschreitens der Erkrankung unter Chemotherapie eine Entscheidung darüber an, ob oder ob nicht eine andersartige Chemotherapie durchgeführt werden sollte, wurden die Gespräche aufgezeichnet. Nach der Entscheidung wurden Patienten und Ärzte interviewt, um ihre Sicht des Entscheidungsprozesses offen zu legen.
Die Gespräche wurden daraufhin analysiert, inwieweit Elemente von SDM erkennbar waren.
Keiner der 14 Patienten erhielt Informationen über alle Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich der Option, keine Anti-Tumor-Behandlung durchzuführen. Eher wurde Zweit- oder Drittlinien-Chemotherapie als einzige Möglichkeit angeboten. Einige Ärzte gaben an, die Chemotherapie bei Fortschreiten des Tumorwachstums für das einzig Richtige zu halten und den Verzicht auf eine Chemotherapie gar nicht erwogen zu haben.
Den Nutzen und Schaden der Chemotherapie besprachen die Ärzte zumeist mit ihren Patienten, wenn auch nicht ausführlich. Da sie die Option der Nicht-Fortführung nicht anboten, entfielen auch die entsprechenden Informationen über Nutzen und Schaden, so dass die Patienten zwischen Durchführung und Nicht-Durchführung nicht abwägen konnten. Einige Patienten stimmen der Therapie schon deshalb zu, weil sie befürchteten, die Entscheidung gegen eine Therapie zu bedauern, wenn die Erkrankung fortschreite.
Bei drei Patienten wurde die Therapie nicht fortgeführt. Diese Patienten gaben an, dass die geringe Wahrscheinlichkeit, das Tumorwachstum zu bremsen, die Beeinträchtigung der Lebensqualität nicht aufwiege. Ihre Entscheidung gründete allein auf Informationen darüber, die Therapie durchzuführen und nicht auch auf Informationen über die Nicht-Durchführung.
Auf die Erwartungen, Sorgen und Erfahrungen der Patienten im Rahmen des Entscheidungsprozesses gingen die Ärzte wenig oder überhaupt nicht ein und wenn, dann eher auf den körperlichen Zustand als auf die emotionale Befindlichkeit. Manche Patienten wünschten sich ein Gespräch, das mehr um ihre Person als allein um den Tumor ging. Der Gewinn an Lebenszeit wurde nicht explizit besprochen, so dass einige Patienten unrealistisch hohe Erwartungen in die Therapie setzten.
Insgesamt neigten die Ärzte stark dazu, die Fortführung der Therapie zu nahezulegen oder explizit empfehlen. Manche versuchten, die Patienten in die Entscheidung einzubeziehen, allerdings erst, nachdem sie ihre Empfehlung ausgesprochen hatten. Wenn Ärzte über Optionen sprachen, ging es stets um zwei gegen den Tumor gerichtete Therapie, wie Chemotherapie bzw. Chirurgie. Manche Ärzte waren gewillt, und hielten es für richtig, den Patienten die Entscheidung zu überlassen, hatten aber das Gefühl, dass diese sich überfordert fühlten.
Die meisten Patienten fühlten sich beteiligt, waren zufrieden mit dem Entscheidungsprozess und gaben an, dass der Rat des Arztes mir ihren Wünschen übereinstimmte und sie das letzte Wort gehabt hätten. Einige Patienten hätten sich jedoch präzisere Information und mehr Abwägung von Nutzen und Schaden gewünscht. Patienten, bei denen die Krankheit trotz Chemotherapie fortschritt, bedauerten die Entscheidung nicht, diejenigen bei denen die Krankheit stabil war, natürlich auch nicht.
Zusammenfassend waren Shared Decision Making-Elemente in Gesprächen über Therapieentscheidungen kaum zu beobachten. Trotzdem waren die Patienten weit überwiegend zufrieden mit dem Prozess und der Entscheidung und ihrer Beteiligung an der Entscheidung. Dies weist darauf hin, dass die Patienten nicht vermissen, was sie nicht kennen, nämlich die nicht-direktive präzise Darlegung der Optionen auf Grundlage der Evidenz zu patientenrelevanten Behandlungsergebnissen. Andere Studien zeigen, dass Patienten, die sich über den zu erwartenden Lebenszeitgewinn durch eine Therapie im Klaren sind, dies sehr wohl mit den Schäden, wie Beeinträchtigung der Lebensqualität abzuwägen wissen. Bei gegebener Aussicht auf Nutzen und Schaden entscheiden Patienten individuell sehr unterschiedlich (wir berichteten). Eine gute Entscheidung ist daher nur durch Shared Decision Making erreichbar.
Brom L, De Snoo-Trimp JC, Onwuteaka-Philipsen BD, et al. Challenges in shared decision making in advanced cancer care: a qualitative longitudinal observational and interview study. Health Expect 2015. (Abstract)
David Klemperer, 16.3.16
Neue Krebsmedikamente 5: Fortgeschrittener Krebs - keine Chemotherapie ist auch eine Option
 Patienten mit nicht heilbarem Krebs und Erfahrung mit Chemotherapie bewerten bei geringer verbleibender Lebenserwartung den Zugewinn an Lebenszeit durch Chemotherapie sehr unterschiedlich, lautet das Fazit einer Befragung von 81 Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Stadium III- IV). Diese Patienten sollten sich vorstellen, sie hätten ohne Chemotherapie noch 4 Monate zu leben und dann angeben, ab welchem Lebenszeitgewinn aus ihrer Sicht der Nutzen die Belastung übersteigt ("minimum survival benefit"), sie also eine Chemotherapie befürworten würden. Diese Entscheidung sollten sie für eine Chemotherapie mit milder und mit schwerer Toxizität treffen. Als Lebenszeitgewinn wurden ihnen 7 Zeiträume zwischen 1 Woche und 24 Monaten angeboten.
Patienten mit nicht heilbarem Krebs und Erfahrung mit Chemotherapie bewerten bei geringer verbleibender Lebenserwartung den Zugewinn an Lebenszeit durch Chemotherapie sehr unterschiedlich, lautet das Fazit einer Befragung von 81 Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Stadium III- IV). Diese Patienten sollten sich vorstellen, sie hätten ohne Chemotherapie noch 4 Monate zu leben und dann angeben, ab welchem Lebenszeitgewinn aus ihrer Sicht der Nutzen die Belastung übersteigt ("minimum survival benefit"), sie also eine Chemotherapie befürworten würden. Diese Entscheidung sollten sie für eine Chemotherapie mit milder und mit schwerer Toxizität treffen. Als Lebenszeitgewinn wurden ihnen 7 Zeiträume zwischen 1 Woche und 24 Monaten angeboten.
Die Antworten zeigten große Unterschiede auf. 5 Patienten würden eine Chemotherapie schon für eine Woche Lebenszeitgewinn akzeptieren, 9 Patienten würden auch bei 24 Monaten noch ablehnen. Weniger als die Hälfte der Befragten würde sich bei einem Lebenszeitgewinn von 3 Monaten für eine Chemotherapie entscheiden. Die mittlere Schwelle lag bei 4,5 Monaten für die gering toxische und bei 9 Monaten für die stark toxische Chemotherapie. Ältere Patienten setzten die Schwelle höher an, ebenso wie Patienten, die bei der bisherigen Chemotherapie ihre Lebensqualität als niedrig einstuften. Bei der Entscheidung zwischen einer unterstützenden, palliativen Behandlung und einer Chemotherapie mit 4 Monaten Lebenszeitgewinn entschieden sich nur 18 der 81 Patienten für die Chemotherapie. Die meisten Patienten gaben an, bis dahin kein Angebot einer unterstützenden Therapie als Option erhalten zu haben.
Die Vorstellungen einiger Patienten zur Chemotherapie waren recht ausgeprägt. Ein Patient, der eine Chemotherapie für 1 Woche Lebenszeitgewinn auf sich nehmen würde, meinte, dass in dieser Woche vielleicht die Heilung von Lungenkrebs entdeckt würde. Eine Patientin würde auch für 24 Monate Lebenszeitgewinn keine Chemotherapie akzeptieren mit der Begründung, sie habe ein volles, produktives Leben geführt hat und wünsche für die verbleibende Zeit keine Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Chemotherapie.
Die Autoren stellen fest, dass die Ergebnisse teils im Gegensatz zur bis dahin erhaltenen Behandlung stehen.
Diese Studie aus dem Jahr 1998 zeigt auf, dass Chemotherapie-erfahrene Patienten mit nicht heilbarem Krebs sehr wohl abzuwägen wissen zwischen Lebenszeit und Lebensqualität. Sie erhalten aber zumeist nicht die Gelegenheit dazu. Die Möglichkeiten der palliativen Behandlung werden nicht ausgeschöpft (Zu viel Medizin, zu wenig Palliativ-Versorgung am Ende des Lebens)und die Vorstellungen über das Therapieziel sind häufig falsch (Lungenkrebs und Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium: Illusionen über Heilung bei der Mehrzahl der Patienten).
Letztlich verdeutlichen diese Studien, dass eine "Personalisierung" der Krebstherapie durch eine klare Kommunikation von Nutzen und Schaden und eine Klärung der Patientenpräferenz gekennzeichnet sein sollte, also durch Shared Decision Making.
Silvestri G, Pritchard R, Welch HG. Preferences for chemotherapy in patients with advanced non-small cell lung cancer: descriptive study based on scripted interviews. BMJ 1998;317:771-75. Volltext
David Klemperer, 24.2.16
Beteiligung von Krebspatienten bei Behandlungsentscheidungen verbessert die Versorgungsqualität

Eine amerikanische Studie befasste sich mit dem Zusammenhang von Shared Decision Making und der Versorgungsqualität aus Patientensicht.
Patienten mit Darmkrebs oder Lungenkrebs, die angeben, dass der Arzt die Behandlungsentscheidungen kontrolliert, bewerten die Qualität der Versorgung und die ärztliche Kommunikation als weniger gut im Vergleich zu den Patienten, die an den Entscheidungen beteiligt sind.
Dies ist das Ergebnis Befragung von über 5000 Patienten, die zwischen 2003 und 2005 eine Darmkrebs- oder Lungenkrebsdiagnose erhalten haben.
3 bis 6 Monate nach der Diagnosestellung waren die Patienten befragt worden nach
• ihrer Bewertung der Behandlungsqualität
• der bevorzugten und der tatsächlichen Rolle bei Entscheidungen
• ihrer Bewertung der ärztlichen Kommunikation.
Die Rolle bei Entscheidungen wurde in die Kategorien "patientenkontrolliert", "Shared Decision Making" und "arztkontrolliert" unterteilt.
Die Mehrheit (58%) der 5315 Patienten gab den Wunsch nach Shared Decision Making an, 36% bevorzugten die patientenkontrollierte Rolle und 6% die arztkontrollierte Rolle. 42% der 10.817 Behandlungsentscheidungen betrafen Operationen, 36% Chemotherapie und 22% Strahlentherapie.
Auch Patienten, die sich nicht beteiligen möchten, bewerten die Qualität der Versorgung der Kommunikation tendenziell höher, wenn der Arzt sie beteiligte.
Kehl KL, Landrum M, Arora NK, et al. Association of actual and preferred decision roles with patient-reported quality of care: Shared decision making in cancer care. JAMA Oncology 2015. Abstract
David Klemperer, 6.8.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 4 - Mit Sicherheit nutzlos, trotzdem verbreitet: Krebsfrüherkennung bei Alten und Kranken
 Krebsfrüherkennung hat dann einen Nutzen, wenn die Vorverlegung der Diagnose eine Therapie ermöglicht, die zu einer niedrigeren Sterblichkeit und längeren Lebenserwartung führt, als wenn die Krebserkrankung erst nach Auftreten von Symptomen behandelt wird. Als nützlich in diesem Sinne gilt derzeit die Früherkennung von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs, wobei der Nutzen der Brustkrebsfrüherkennung durch neuere Studienergebnisse in Frage gestellt ist (siehe Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering).
Krebsfrüherkennung hat dann einen Nutzen, wenn die Vorverlegung der Diagnose eine Therapie ermöglicht, die zu einer niedrigeren Sterblichkeit und längeren Lebenserwartung führt, als wenn die Krebserkrankung erst nach Auftreten von Symptomen behandelt wird. Als nützlich in diesem Sinne gilt derzeit die Früherkennung von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs, wobei der Nutzen der Brustkrebsfrüherkennung durch neuere Studienergebnisse in Frage gestellt ist (siehe Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering).
In jedem Fall ist der Nutzen der Krebsfrüherkennung naturgemäß in einer nicht nahen Zukunft zu erwarten. Daher werden in Leitlinien zur Krebsfrüherkennung zumeist Obergrenzen für das Alter bzw. für die zu erwartende verbleibende Lebenszeit angegeben.
Eine amerikanische Untersuchung ging der Frage nach, ob auch Personen, die aufgrund von Alter und/oder Krankheit eine niedrige verbleibende Lebenserwartung haben, Krebsfrüherkennungsuntersuchungen erhalten.
Datenbasis ist die jährliche bevölkerungsweite Befragung National Health Interview Survey (NHIS) des amerikanischen National Center for Health Statistics.
In den Jahren 2000 bis 2010 wurden mehrfach Fragen nach der Teilnahme an der Früherkennung von Brustkrebs, Prostatakrebs, Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs gestellt. 27.404 Teilnehmer waren 65 Jahre alt oder älter und wurden in 5 Altersklassen (65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 Jahre oder älter) sowie mit Hilfe eines validierten Mortalitätsindex in 4 Mortalitätsklassen eingeteilt - solche mit niedrigem (<25%), mittlerem (25%-49%), hohem (50-74%) und sehr hohem (75% oder höher) Risiko, in den nächsten 9 Jahren zu sterben.
Das Ergebnis lautet: Mit steigendem 9-Jahres-Mortalitätsrisiko nehmen die Screeningraten zwar ab, liegen aber immer noch hoch.
Trotz einem Risiko von 75% und mehr, innerhalb der nächsten 9 Jahre zu sterben,
erhielten eine Früherkennungsuntersuchung
• 54,6% der Männer in letzten 2 Jahren für Prostatakrebs
• 37,5% der Frauen in letzten 2 Jahren für Brustkrebs
• 30.6% der Frauen in den letzten 3 Jahren für Gebärmutterhalskrebs
• 40,8% der Männer und Frauen in den letzten 5 Jahren für Darmkrebs.
Und selbst bei einem Risiko von 75% oder mehr in den kommenden 5 Jahren zu sterben, ist der Anteil derjenigen, die eine Früherkennungsuntersuchung erhalten haben noch hoch: Prostatakrebs 51,6%, Brustkrebs 34,2%, Gebärmutterhalskrebs 25,7%, Darmkrebs 40,8%.
Für die genannten Krebsarten erhält selbst in der höchsten Altersgruppe (84 Jahre und älter) ein nennenswerter Anteil Früherkennungsuntersuchungen.
Höhere Bildung, Krankenversicherungsschutz und Ehe gingen mit einher, Früherkennungsuntersuchungen zu erhalten.
Die Autoren nennen mehrere mögliche Gründe für die Ergebnisse. So gibt es bislang keine einfache Methode, das 10-Jahres-Mortalitätsrisiko für den individuellen Patienten zu berechnen. Aber selbst wenn die verbleibende Lebenserwartung erkennbar niedrig ist, könnte es dem Arzt schwer fallen, dies dem Patienten durch Einstellen der Früherkennungsuntersuchungen mitzuteilen bzw. dem Patienten könnte es schwer fallen dies zu akzeptieren.
Anzumerken bleibt, dass Ärzte und folglich auch Patienten den Nutzen von Krebsfrüherkennung allgemein überschätzen und die möglichen Schäden unterschätzen, wie hier schon vielfach berichtet (siehe Forum Gesundheitspolitik, Kategorie Früherkennung, Screening). Das Screenen auf Krebserkrankungen von sehr alten und sehr kranken Personen unterstreicht diesen Sachverhalt eindrucksvoll und weist auf einen Bereich hin, in dem weniger mehr wäre: weniger medizinische Aktivität würde hier das Wohlbefinden der Patienten fördern und die Verschwendung von Ressourcen mindern.
Royce TJ, Hendrix LH, Stokes WA, et al. Cancer screening rates in individuals with different life expectancies. JAMA Internal Medicine 2014. Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 3 - "Falscher Alarm" bei Brustkrebsfrüherkennung bewirkt psychische Langzeitschäden
 Als positiver Befund wird bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie eine Gewebsverdichtung bezeichnet. "Richtig positiv" ist der Röntgenbefund, wenn die Abklärung ergibt, das die Verdichtung Tumorzellen enthält, "falsch positiv" hingegen, wenn die Veränderungen gutartig sind. Letzteres wird auch als "falscher Alarm" bezeichnet.
Als positiver Befund wird bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie eine Gewebsverdichtung bezeichnet. "Richtig positiv" ist der Röntgenbefund, wenn die Abklärung ergibt, das die Verdichtung Tumorzellen enthält, "falsch positiv" hingegen, wenn die Veränderungen gutartig sind. Letzteres wird auch als "falscher Alarm" bezeichnet.
Falsch positive Befunde sind häufig - in Deutschland geht man davon aus, dass im Screening-Programm für 50- bis 69-jährige Frauen 200 von 1000 Frauen einmal einen falsch positiven Befund erhalten (siehe Kennzahlen Mammographie, Vs. 1.2, 2010, S. 4).
Eine dänische Studie untersuchte die psychischen Folgen eines falsch-positiven Befundes.
In die Studie wurden 454 Frauen mit positivem Befund (Gewebsverdichtung) in der Früherkennungs-Mammographie in den Jahren 2004 bzw. 2005 im Rahmen des dänischen Brustkrebs-Screening-Programms aufgenommen. Bei 174 ergab die Abklärung der Gewebsverdichtung die Diagnose Brustkrebs ("richtig positiv"), bei 272 konnte ein Brustkrebs ausgeschlossen werden ("falsch positiv"). Zum Vergleich wurden 864 Frauen mit Normalbefund hinzugezogen.
Der psychosoziale Status wurde mit dem "Consequences of Screening in Breast Cancer (COS-BC) questionnaire" (Link) gemessen.
Dieses Befragungsinstrument wurde spezifisch für die Brustkrebsfrüherkennung entwickelt und erfasst Outcomes wie Angst, Verhalten, Gefühl der Niedergeschlagenheit, Schlafprobleme, Ausgeglichenheit, soziale Kontakte und Sexualität.
Die Messung erfolgte zu 5 Zeitpunkten (1, 16, 18 und 36 Monate) und erlaubt somit Aussagen über den Verlauf der psychischen Folgen Unklar war bisher, ob die Ängste und Verunsicherungen, die bei der Eröffnung eines positiven Befundes entstehen, bei der Information, dass es sich nicht um Krebs handelt, wieder verschwinden - ob also bei der Entwarnung nach falschen Alarm alles wieder gut ist.
Frauen mit falsch positivem Screening-Ergebnis berichteten in der kritischen Phase vor der endgültigen entlastenden Diagnose aber auch 4 Wochen danach stärker negative psychosoziale Konsequenzen für alle gemessenen Outcomes im Vergleich zu Frauen mit Normalbefund.
Im Vergleich zu Frauen mit richtig positivem Befund (Brustkrebs-Diagnose) waren in den 6 Monaten nach der endgültigen entlastenden Diagnose die negativen Folgen für die Outcomes existentielle Werte und innere Ruhe genauso stark ausgeprägt, in den übrigen Outcomes deutlich weniger negativ. Die Werte der Frauen besserten sich für beide Gruppen bis zum 18. Monat, danach aber nur noch geringfügig.
3 Jahre nach der Information, keinen Brustkrebs zu haben, bestanden weiterhin deutliche negative psychosoziale Folgen, die etwa in der Mitte zwischen den Frauen mit negativem Mammographie-Ergebnis und den Frauen mit Brustkrebs liegen.
Entwarnung nach einem positiven Screening-Befund führte in dieser Studie also nicht zu einem Verschwinden der psychischen Beeinträchtigung, vielmehr scheint auch ein falsch positiver Screning-Befund ein anhaltendes Trauma auszulösen.
Die schädlichen psychischen Effekte wiegen angesichts des in Frage gestellten Nutzens des Brustkrebs-Screenings (wir berichteten) umso schwerer.
Brodersen J, Siersma VD. Long-Term Psychosocial Consequences of False-Positive Screening Mammography. The Annals of Family Medicine 2013;11:106-15 Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 2 - Quantität und Qualität der Studien zu psychischen Folgen von Krebsfrüherkennung unzulänglich
 Ziel der systematischen Übersichtsarbeit war die Untersuchung der methodischen Qualität von Studien, die sich mit psychischen Folgen von Früherkennung befassen.
Ziel der systematischen Übersichtsarbeit war die Untersuchung der methodischen Qualität von Studien, die sich mit psychischen Folgen von Früherkennung befassen.
Ausgewertet wurden 68 Studien, die sich mit psychologischen Schäden bei der Früherkennung von 2 Krebserkrankungen und 4 Nicht-Krebs-Erkrankungen befassten
• PSA-Screening für Prostatakrebs
• Niedrigdosis- Computertomographie für Lungenkrebs
• Knochendichtemessung für Osteoporose
• Ultraschalluntersuchung Bauchaortenaneurysma
• Doppler-Sonographie der Halsgefäße zur Erfassung einer asymptomatischen Stenose (Verengung)
42 der 68 Studien bezogen sich auf das Prostatakrebs-Screening, 11 auf das Lungenkrebs-Screening und die übrigen 15 Studien auf die 3 Nicht-Krebs-Erkrankungen.
Als "psychologische Last" (psychologic burden) von Früherkennungsuntersuchungen bezeichnen die Autoren die Häufigkeit des Auftretens sowie der Schwere der psychologischen Reaktion, die Dauer und die Auswirkungen auf den Alltag der Patientin bzw. des Patienten und seiner bzw. ihrer Familie.
Schäden können während der gesamten "Screening-Kaskade" auftreten:
• vor dem Screening (Antizipation eines positiven Ergebnisses)
• in der Wartezeit unmittelbar nach dem Screening (Angst vor einem positiven Ergebnis)
• in der Abklärungsphase bei einem positiven Screening-Ergebnis
• nach der Bestätigung eines positiven Ergebnisses
• im Zusammenhang mit der Behandlung.
Als methodischen Standard fordern die Autoren Längsschnittstudien mit krankheitsspezifischen Messinstrumenten. Weniger geeignet seien hingegen Querschnittstudien mit allgemeinen Maßen der Lebensqualität (wie z.B. SF-36).
Von den 68 Studien sind 36 als Längsschnitt und 11 als Querschnitt durchgeführt worden, 19 sind qualitativer Natur und 2 nutzen unterschiedliche Methoden. 16 der 49 nicht-qualitativen Studien erfüllten die Kriterien Längsschnitt und krankheitsspezifische Maße für die psychologische Last. Dies traf für 9 der 30 Studien zum Prostatakrebs-Screening und für 7 der 9 Studien zum Lungenkrebs-Screening zu.
Die Autoren kommen zum Schluss, dass die Zahl, das Design und die Maße der Studien zu den psychologischen Schäden der 5 Früherkennungsuntersuchungen insgesamt inadäquat sind. Es bestünden erhebliche Evidenzlücken.
Die Studie stellt einen weiteren Hinweis dafür dar, dass die in Deutschland durch das Patientenrechtegesetz und das Krebsfrüherkennungsgesetz geforderte informierte Entscheidung allein an fehlenden Informationen infolge unzulänglicher Wissenschaft scheitert. Angesichts der vorgesehenen Ausweitung von Gesundheitsuntersuchungen im Rahmen des Präventionsgesetzes sollte die Evidenzlücken dringend und zügig gefüllt werden.
DeFrank J, Barclay C, Sheridan S, et al. The Psychological Harms of Screening: the Evidence We Have Versus the Evidence We Need. Journal of General Internal Medicine 2014:1-7 Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 1 - Schäden werden nicht ausreichend erforscht
 In dieser Studie ging es um die Frage, inwieweit in randomisierten kontrollierten Studien zum Krebsscreening neben dem Nutzen auch die Schäden untersucht wurden.
In dieser Studie ging es um die Frage, inwieweit in randomisierten kontrollierten Studien zum Krebsscreening neben dem Nutzen auch die Schäden untersucht wurden.
Ausgewertet wurden 198 Veröffentlichungen, die sich auf 57 Studien mit insgesamt 3.419.036 Teilnehmern bezogen.
Als Nutzen von Krebsscreening gelten die Senkung
• der Inzidenz (Neuauftreten) der jeweiligen Krebsart
• der krebsspezifischen Mortalität und
• der Gesamtmortalität.
Die Studien befassten sich mit dem Screening von
• Brustkrebs (Selbstuntersuchung der Brust, Mammographie)
• Dickdarmkrebs (Stuhlbluttest, Sigmoidoskopie/"kleine Darmspiegelung
• Leberkrebs (Ultraschall, CA-125)
• Lungenkrebs (Röntgen bzw. Computertomographie des Brustkorbs)
• Mundhöhlenkrebs (visuelle Inspektion)
• Eierstockkrebs (Ultraschall, CA-125) und
• Prostatakrebs (PSA, Tastuntersuchung).
Bezogen auf die 57 Studien wurden in folgender Häufigkeit auch Schäden untersucht:
• in 4 Studien die Überdiagnose (Tumoren, die nie symptomatisch geworden wären)
• in 2 Studien falsch-positive Ergebnisse ("falscher Alarm", z.B. Gewebsverdichtung in der Mammographie, die sich bei weiterer Abklärung als gutartig erweist)
• in 5 Studien negative psychosoziale Folgen
• in 11 Studien körperliche Schäden und
• in 27 Studien die Notwendigkeit invasiver Folgeuntersuchungen mit den jeweils eigenen Risiken.
Der wichtigste Parameter für den Nutzen, die Senkung der Gesamtsterblichkeit, wurde in 34 der 57 Studien berechnet, der Surrogatparameter Senkung der krebsspezifischen Inzidenz in 51 der 57 Studien.
Dieser Studie zufolge werden die Schäden von Krebsscreening selten untersucht.
Krebsfrüherkennung richtet sich an gesunde Menschen. Die Nutzenwahrscheinlichkeit für den Einzelnen ist eher niedrig und geht mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit für gravierende Schäden einher. Eine Entscheidung über die Teilnahme muss sich auf die realistische Abwägung von Informationen über Nutzen und Schaden gründen. Dass Forscher darauf verzichten, Informationen über Schäden zu generieren ist außerordentlich bedenklich und weist auch auf ein Versagen der Ethikkomitees hin, die solche Studien nicht genehmigen dürften.
Heleno B, Thomsen MF, Rodrigues DS, et al. Quantification of harms in cancer screening trials: literature review. BMJ 2013;347 Open Access
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung - 4 neuere Studien
 Für Krebsfrüherkennung gilt, was für alle anderen medizinischen Interventionen ebenfalls zutrifft: der erhoffte Nutzen geht stets mit möglichen Schäden einher. Eine informierte Entscheidung sollte auf der Abwägung von Nutzenwahrscheinlichkeiten und Schadensrisiken durch den Patienten mit Unterstützung des Arztes im Sinne des Shared Decision Making erfolgen.
Für Krebsfrüherkennung gilt, was für alle anderen medizinischen Interventionen ebenfalls zutrifft: der erhoffte Nutzen geht stets mit möglichen Schäden einher. Eine informierte Entscheidung sollte auf der Abwägung von Nutzenwahrscheinlichkeiten und Schadensrisiken durch den Patienten mit Unterstützung des Arztes im Sinne des Shared Decision Making erfolgen.
Von diesem Ideal ist der medizinische Alltag weit entfernt. Diesbezügliche Studien haben wir im Forum fortlaufend aufgegriffen (Rubrik Früherkennung, Screening).
Diese Studien belegen eine ungute Situation, die sich kurzgefasst folgendermaßen darstellt:
• Viele Ärzte sind über die Wahrscheinlichkeiten von Nutzen und Schaden der Früherkennung schlecht informiert. Sie kennen die Zahlen nicht bzw. verstehen sie nicht.
• Daraus folgend kommunizieren Ärzte den Nutzen und den Schaden von Früherkennung unzulänglich.
• Patienten haben daher teils falsche Vorstellungen davon, was Früherkennung überhaupt ist und unrealistische Vorstellungen von Nutzen und Schaden.
• In Studien werden die Schäden unzureichend untersucht, wenn dann noch eher körperliche als psychische Schäden, obwohl auch letztere gravierend sein können.
Fortschritte sind erkennbar. So hat der Gesetzgeber kürzlich für organisierte Früherkennungsprogramme die "mit der Einladung erfolgende umfassende und verständliche Information der Versicherten über Nutzen und Risiken der jeweiligen Untersuchung" im §25a SGB V festgeschrieben.
Zur Schärfung des Problembewusstseins werden im Folgenden werden 4 neuere Studien vorgestellt.
Die Studien belegen folgende Probleme bzw. Verbesserungsbereiche:
1. In randomisierten kontrollierten Studie zur Krebsfrüherkennung werden die Schäden unzulänglich untersucht. Forum-Beitrag: Schäden werden nicht ausreichend erforscht.
Studie: Heleno B, Thomsen MF, Rodrigues DS, et al. Quantification of harms in cancer screening trials: literature review. BMJ 2013;347.
2. Wenn psychische Schäden untersucht werden, dann ist die Methodik häufig unzulänglich.
Forum-Beitrag: Quantität und Qualität der Studien zu psychischen Folgen von Krebsfrüherkennung unzulänglich
Studie: DeFrank J, Barclay C, Sheridan S, et al. The Psychological Harms of Screening: the Evidence We Have Versus the Evidence We Need. Journal of General Internal Medicine 2014:1-7.
3. Ein methodisch hochwertige Studie zu den psychischen Langzeitfolgen von falsch-positiven Screeningbefunden zeigt deutliche negative Folgen noch nach 2 Jahren
Forum-Beitrag: "Falscher Alarm" bei Brustkrebsfrüherkennung bewirkt psychische Langzeitschäden.
Studie: Brodersen J, Siersma VD. Long-Term Psychosocial Consequences of False-Positive Screening Mammography. The Annals of Family Medicine 2013;11(2):106-15.
4. Krebsfrüherkennung wird auch an Personen durchgeführt, die sicher keinen Nutzen davon haben können.
Forum-Beitrag: Mit Sicherheit nutzlos, trotzdem verbreitet: Krebsfrüherkennung bei Alten und Kranken.
Studie: Royce TJ, Hendrix LH, Stokes WA, et al. Cancer screening rates in individuals with different life expectancies. JAMA Internal Medicine 2014.
David Klemperer, 19.2.15
Wenn Risiken und Belastungen den Nutzen überwiegen: Ernährungssonden für demente PatientInnen oft nicht in derem Interesse
 Es ist immer schwer, gesundheitsbezogene oder als gesundheitlich wirksam geltende Leistungen in Frage zu stellen oder sie nicht aktiv anzubieten. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um schwer kranke PatientInnen und den für sie mit einer Leistung erreichbaren Nutzen geht.
Es ist immer schwer, gesundheitsbezogene oder als gesundheitlich wirksam geltende Leistungen in Frage zu stellen oder sie nicht aktiv anzubieten. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um schwer kranke PatientInnen und den für sie mit einer Leistung erreichbaren Nutzen geht.
Eine dieser immer wieder erbrachten aber auch schon immer wieder bezweifelten Leistungen ist der Einsatz so genannter PEG-Sonden (perkutane endoskopische Gastrostomie) oder G-Tubes ("gastrostomy tube"), mit deren Hilfe PatientInnen z.B. durch die Bauchdecke mit Nahrungsmitteln und Flüssigkeit versorgt werden können.
In einer jetzt veröffentlichten Analyse der dazu vorhandenen wissenschaftlichen Literatur kommen die AutorInnen zu dem Schluss, dass PEG-Sonden PatientInnen mit fortgeschrittener Demenz oder anderen "near-end-of-life"-Erkrankungen nur sehr zurückhaltend angeboten und keinesfalls "aufgezwungen" werden sollten. Für diese Empfehlung ist eine offene Abwägung der durch die Sondenernährung erreichbaren Vorteile oder des Nutzens und möglicher Nachteile oder Schäden entscheidend.
Als Quintessenz ihrer Literatursichtung stellen sie also fest: "Current scientific evidence suggests that the potential benefits of tube feeding do not outweigh the associated burdens of treatment in persons with advanced dementia. Studies consistently demonstrate a very high mortality rate in older adults with advanced dementia who have feeding tubes."
Die Entscheidung gegen den Einsatz einer PEG-Sonde sollte aber, so die AutorInnen, nicht von einem behandelnden Arzt alleine getroffen werden, sondern nach einer gründlichen Information und Beratung des Patienten und der ihm nahestehenden Personen über den Nutzen, die Risiken und Belastungen von diesem Personenkreis und allen Mitgliedern des Behandlungsteams.
Die AutorInnen empfehlen darüber hinaus, dass Krankenhäuser und andere Versorgungsanbieter für "end-of-life"-Situationen nicht ausschließlich auf spontanes Vorgehen setzen, sondern Routinen entwickeln, wie patientenbezogene Entscheidungen für Schwerstkranke oder Sterbende unter größtmöglicher Berücksichtigung der Patientenwünsche nach Autonomie, Selbstbestimmung und Würde getroffen werden.
Der Aufsatz Gastrostomy Tube Placement in Patients With Advanced Dementia or Near End of Life. von Denise Baird Schwartz et al. ist in der Zeitschrift "Nutrition in Clinical Practice", dem offiziellen Journal der "American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)" online am 7. Oktober 2014 erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.10.14
Stabile KHK und PCI 4: Dramatische Fehleinschätzung des Nutzens auf Seiten der Patienten
 Dieser Beitrag befasst sich mit der vierten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Dieser Beitrag befasst sich mit der vierten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Zum Verständnis der Studien ist wesentlich, dass die perkutane Intervention (PCI), also die Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei Patienten ohne oder mit leichten Angina pectoris-Beschwerden ("stabile KHK") weder das Herzinfarktrisiko noch das Sterberisiko senkt, wenn sie zusätzlich zur in jedem Fall erforderlichen "optimalen medikamentösen Therapie" (OMT) durchgeführt wird. Die PCI hat lediglich einen eher geringen Effekt auf etwaige Angina pectoris-Beschwerden.
Patienten ist dies zumeist nicht bewusst: Es besteht eine therapeutische Fehleinschätzung ("therapeutic misconception"), in deren Folge der Patient eine Behandlung erhält, die er bei zutreffender Information abgelehnt hätte. Zur ausführlicheren Einführung in die Problematik überflüssiger Stents siehe Forum Beitrag.
In einer Querschnittstudie untersuchten Kureshi et al., wie Patienten die Dringlichkeit und den Nutzen einer gerade durchgeführten perkutanen Intervention einschätzten und wie sich die Einschätzung zwischen Krankenhäusern und Untersuchern unterschied.
Die Studie wurde zwischen 2009 und 2011 in neun Universitätskliniken und großen kommunalen Krankenhäusern in den USA durchgeführt. Dabei wurden 991 Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit befragt, die 4 bis 6 Stunden zuvor eine PCI erhalten hatten. Der Kardiologe war nicht anwesend.
44% der Patienten hatten früher schon einmal eine PCI erhalten; 85% hatten vor der PCI Angina-pectoris-Symptome angegeben.
Die 135 Kardiologen waren im Durchschnitt 50,7 Jahre alt und hatten durchschnittlich 17,6 Jahre Praxiserfahrung; 127 waren männlich, 8 weiblich.
Die Patienten wurden gefragt, ob es sich bei der PCI um einen dringenden oder geplanten (elektiven) Eingriff gehandelt habe. Zur Überprüfung ihres Wissens erhielten sie eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen.
Die Ergebnisse lauten:
20% der Patienten bezeichneten die PCI als dringend, obwohl es sich um einen geplanten Eingriff handelte. Der Anteil in den Krankenhäusern lag zwischen 4 und 38%.
Als Nutzen gaben die Patienten an (in Klammern der niedrigste und höchste Wert in den Krankenhäusern):
• Verlängerung des Lebens 90% (80-97%)
• künftige Herzinfarkte verhüten 88% (79-97%),
• das Leben retten 69% (31-85%)
• Linderung von Symptomen 67% (52-87%)
Nur 1% gab zutreffend die Symptomlinderung als einzigen Nutzen an.
Die unterschiedlichen Vorgehensweisen beim Einholen des Einverständnisses auf Ebene der Krankenhäuser beeinflussten das Antwortverhalten nicht. Unterschiede waren vielmehr auf die einzelnen Ärzte zurückzuführen.
Fazit
Die Studie, durchgeführt an Patienten, die vor kurzem eine PCI erhalten hatten, bestätigt und ergänzt das Wissen darüber, dass die meisten Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit grundlegend falsche Vorstellungen über den Nutzen der PCI haben und fälschlich annehmen, Herzinfarkt vermeiden und die Lebenserwartung verlängern zu können. 1% beantwortete die Frage nach dem Nutzen zutreffend.
Auch hier wird offensichtlich, dass der Prozess der Aufklärung im Sinne des Shared Decision Making zu gestalten ist:
- Nutzen und Risiken der PCI müssen zutreffend, klar und nicht-direktiv kommuniziert werden.
- Der Arzt muss das Verständnis prüfen.
- Der Patient muss die Gelegenheit erhalten, seine Präferenz bezüglich der PCI zu klären.
Kureshi F, Jones PG, Buchanan DM, et al. Variation in patients' perceptions of elective percutaneous coronary intervention in stable coronary artery disease: cross sectional study. BMJ 2014;349 Abstract
David Klemperer, 13.9.14
Stabile KHK und PCI 3: Nutzlose Stents als Folge überflüssiger Herzkatheteruntersuchungen
 Dieser Beitrag befasst sich mit der dritten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Dieser Beitrag befasst sich mit der dritten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Zum Verständnis der Studien ist wesentlich, dass die perkutane Intervention (PCI), also die Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei Patienten ohne oder mit leichten Angina pectoris-Beschwerden ("stabile KHK") weder das Herzinfarktrisiko noch das Sterberisiko senkt wenn, wenn sie zusätzlich zur in jedem Fall erforderlichen "optimalen medikamentösen Therapie" (OMT) durchgeführt wird. Die PCI hat lediglich einen eher geringen Effekt auf etwaige Angina pectoris-Beschwerden. Patienten ist dies zumeist nicht bewusst, es besteht eine therapeutische Fehleinschätzung ("therapeutic misconception"), in deren Folge der Patient eine Behandlung erhält, die er bei zutreffender Information abgelehnt hätte. Zur ausführlicheren Einführung in die Problematik überflüssiger Stents siehe Forum Beitrag.
Bei einem nennenswerten Anteil der Patienten, die eine geplante (elektive) perkutane Intervention (Dehnung einer verengten Herzkranzarterie, zumeist mit Einsetzen eines Stents) erhalten, ist der Eingriff unangemessen (inappropriate).
Als Maß für die Angemessenheit der PCI hat eine Task Force der American College of Cardiology Foundation im Jahr 2012 Kriterien für die klinische Indikation veröffentlicht (Link). Nach diesen Kriterien wird eine PCI als unangemessen bezeichnet, wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie den Gesundheitszustand (Symptome, Funktion, Lebensqualität) oder die Lebenserwartung des Patienten verbessert.
Eine frühere Studie (Chan et al. 2011) hatte gezeigt, dass die PCI in Akutsituationen (z.B. Herzinfarkt) fast immer angemessen war, in nicht-akuten Situationen jedoch in knapp der Hälfte der Fälle die Indikation unangemessen bzw. unklar war. Auf Krankenhauseben lag der Anteil unangemessener PCIs zwischen 0 und 55%.
In einer neuen Studie untersuchten Bradley et al. den Zusammenhang zwischen der Patientenauswahl für die geplante (elektive) diagnostische Koronarangiographie und der Angemessenheit der PCI.
Der Untersuchung lag die Annahme zugrunde, dass Krankenhäuser, die einen hohen Anteil von beschwerdefreien Patienten angiographieren auch in größerem Ausmaß unangemessene PCIs durchführen. Die Auswahlentscheidungen zur Koronarangiographie könnten dann als Hebel zur Vermeidung unangemessener PCIs dienen.
Die Daten für die Studie lieferte das CathPCI Registry, dem größten Register für diagnostische Koronarangiographie und für PCI in den USA mit Beteiligung von mehr als 1400 Zentren.
Ausgewertet wurden die Angaben zu 1.225.562 Patienten elektiven Koronarangiographien sowie 203.158 elekiven PCIs, die zwischen 2009 und 2013 in 544 Krankenhäuser durchgeführt wurden.
Die Beurteilung jeder PCI bezüglich der klinischen Indikation erfolgte anhand der oben genannten Kriterien für die Angemessenheit der klinischen Indikation. Jede PCI wurde einer der Kategorien "angemessen", "unsicher", "nicht angemessen" zugeordnet.
308.083 (25.1%) der Koronarangiographien wurden an beschwerdefreien Patienten durchgeführt. Bezogen auf die Krankenhäuser lag der Anteil beschwerdefreier Patienten an der Gesamtzahl zwischen 1% und 73,6%. Für einen beschwerdefreien Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit unterscheidet sich somit die Wahrscheinlichkeit, eine Koronarangiographie zu erhalten, von Krankenhaus zu Krankenhaus ganz erheblich.
Krankenhäuser mit höheren Raten von beschwerdefreien Patienten bei der Koronarangiographie hatten auch höhere Anteile von PCIs, die wegen der Beschwerdefreiheit der Patienten unangemessen waren.
Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme, dass die Qualität der Indikationsstellung zur elektiven diagnostischen Koronarangiographie mit der Angemessenheit der PCI zusammenhängt.
Das Phänomen, dass mehr Diagnostik fast zwangsläufig zu mehr Therapie führt aber nicht zu mehr Patientennutzen, wurde schon Mitte der 1980er-Jahre nachgewiesen und als diagnostisch-therapeutische Kaskade bezeichnet (Mold und Stein 1986). Eine diagnostisch-therapeutische Kaskade für Koronarangiographie in dem Sinne, dass eine überflüssige Untersuchung zu einer überflüssigen Therapie führt, wurde in einer früheren Studie belegt (Lucas et al. 2008).
Diese diagnostisch-therapeutische Kaskade ist in erster Linie auf die Fehlannahmen über den Nutzen der PCI auf Seiten der Patienten durch die Fehlinformationen der Ärzte zurückzuführen. Hier liegt ein Hebel zur Lösung des Problems.
Die hier besprochene Studie zeigt, dass die diagnostisch-therapeutische Kaskade auch durch die überlegtere Indikationsstellung zur Koronarangiographie verhindert werden kann. Angesprochen sind hier die im Primärbereich tätigen Ärzte, die Patienten mit KHK nur dann zur Koronarangiographie überweisen sollten, wenn das Ergebnis für die Patienten eine vorteilhaftere Behandlung ermöglichen kann. Nutzen und Risiken sollten bei dieser präferenzsensitiven Entscheidung im Rahmen eines Shared Decision Making vermittelt werden. Die Ärzte sollten dabei den Patienten verdeutlichen, dass mit der PCI Herzinfarkte nicht verhindert werden und das Sterberisiko nicht gesenkt wird.
Bradley SM, Spertus JA, Kennedy KF, et al. Patient selection for diagnostic coronary angiography and hospital-level percutaneous coronary intervention appropriateness: Insights from the national cardiovascular data registry. JAMA Internal Medicine 2014 Abstract
David Klemperer, 9.9.14
Stabile KHK und PCI 2: Kardiologen informieren überwiegend falsch
 Dieser Beitrag befasst sich mit der zweiten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Dieser Beitrag befasst sich mit der zweiten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Zum Verständnis der Studien ist wesentlich, dass die perkutane Intervention (PCI), also die Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei Patienten ohne oder mit leichten Angina pectoris-Beschwerden ("stabile KHK") weder das Herzinfarktrisiko noch das Sterberisiko senkt wenn, wenn sie zusätzlich zur in jedem Fall erforderlichen "optimalen medikamentösen Therapie" (OMT) durchgeführt wird. Die PCI hat lediglich einen eher geringen Effekt auf etwaige Angina pectoris-Beschwerden. Patienten ist dies zumeist nicht bewusst, es besteht eine therapeutische Fehleinschätzung ("therapeutic misconception"), in deren Folge der Patient eine Behandlung erhält, die er bei zutreffender Information abgelehnt hätte. Zur ausführlicheren Einführung in die Problematik überflüssiger Stents siehe Forum Beitrag.
Goff und Kolleginnen untersuchten, welchen Einfluss Kardiologen auf die unter Patienten verbreitete falsche Einschätzung des Nutzens der perkutanen Intervention (PCI), also der Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei stabiler koronare Herzkrankheit hat. Dazu analysierten sie die Tonbandaufzeichnungen von 40 Gesprächen über die Entscheidungsfindung zur Koronarangiographie und zur perkutanen Intervention (qualitative Inhaltsanalyse). Diese Gespräche wurden zwischen 2008 und 2012 von 20 Kardiologen geführt, die über 7 bis 31 Jahre Praxiserfahrung verfügten.
Die Patienten waren im Mittel 64 Jahre alt, die Hälfte war wegen Angina pectoris-Beschwerden zugewiesen, die übrigen wegen anderer Fragen, wie z.B. auffälligem Belastungstest.
Die Gesprächsinhalte wurden unter 5 Überschriften wie folgt zusammengefasst.
1. Gründe für die Empfehlung zu Angiographie und PCI
Alle Kardiologen gaben an, warum ihrer Meinung nach eine Angiographie notwendig sei.
20 Patienten waren beschwerdefrei, 11 von ihnen waren - trotzdem - zur Angiographie und PCI zugewiesen. Diesen Patienten gegenüber - die von einer PCI keinen Nutzen zu erwarten hatten - äußerten die Kardiologen zumeist, dass ein Problem vorliege, dass weiter abgeklärt werden müsse.
Die Medikation der meisten Patienten entsprach nicht dem Standard der optimalen medikamentösen Therapie (OMT), einer Behandlungsform, welche die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Patienten verbessert In den wenigen Fällen, in denen Kardiologen dies ansprachen, ließen sie die OMT als geringer wertige Maßnahme im Vergleich zu Angiographie und PCI erscheinen.
Einige Kardiologen äußerten als Grund für die Empfehlung zur Angiographie, ihren Wunsch, die Anatomie der Herzkranzgefäße zu kennen ohne jedoch auf die klinische Bedeutung dieses Wissens einzugehen.
2. Nutzen von Angiographie und PCI
Der Nutzen wurde in allen Gesprächen angesprochen.
Nur 2 der 40 Patienten erhielten die zutreffende Information, dass eine PCI Angina-pectoris-Symptome bessern kann aber die Mortalität und das Herzinfarktrisiko nicht mindert.
In 5 Gesprächen gaben die Kardiologen explizit und fälschlich an, dass die PCI einen künftigen Herzinfarkt und den plötzlichen Herztod verhindern könne.
Häufig übertrieben die Kardiologen den Nutzen implizit, indem sie z.B. von Verengungen der Herzkranzgefäße und deren Beseitigung sprachen ohne den klinischen Nutzen zu erwähnen. Dazu benutzen sie Bilder wie "ein verstopftes Rohr durchgängig machen". Teils formulierten sie auch ganz allgemein, dass ein Problem zu lösen sei. Auch kleideten einige Kardiologen ihre Information in ein Verlust-Framing: die Nicht-Durchführung könne zum Tod führen.
3. Risiken von Angiographie und PCI
Die meisten Kardiologen gingen - wenn überhaupt - nur kurz auf die Risiken ein. Eine Quantifizierung der Risiken z.B. für kontrastmittelbedingtes Nierenversagen, war nicht üblich, vielmehr benutzten die Kardiologen qualitative Beschreibungen wie "selten" bzw. "eine extrem sichere Untersuchung" oder auch dass der Nutzen die Risiken bei weitem überwiegen - überwiegend also verharmlosende Formulierungen.
4. Kommunikationsstil des Arztes
Ein Kommunikationsstil, der Patienten eher entmutigte, sich aktiv an der Entscheidung zu beteiligen, wurde in 30 der 40 Gespräche festgestellt. Dazu zählte der Gebrauch von Fachbegriffen ("anatomic lesion", "distal vessel," "pretest likelihood",), sowie den Patienten zu unterbrechen, seine Fragen zu ignorieren, eine Frage zu stellen und die Antwort nicht abzuwarten, auf Anliegen des Patienten nicht einzugehen. Die Kardiologen schienen ein volles Verständnis der Angiographie und der PCI Vorgehensweisen auf Seiten des Patienten vorauszusetzen.
Die Frage, ob der Patient noch Fragen habe, stellten die Kardiologen regelmäßig. In keinem Fall überprüfte der Kardiologe jedoch, ob der Patient die Informationen verstanden hatte. In 14 Gesprächen fanden sich Elemente, die den Patienten dazu ermutigten, sich an der Entscheidung zu beteiligen, wie z.B. Äußern von Verständnis für die Anliegen und Sorgen des Patienten.
5 Beitrag von Patienten und Familienangehörigen zum Gespräch
Die wenigen Patienten, die von sich aus inhaltliche Fragen stellten, erhielten ausführlichere Informationen. Die meisten Patientenfragen bezogen sich jedoch auf technische und organisatorische Aspekte. Die Anwesenheit eines Familienmitglieds ging mit einer höheren Zahl von Fragen einher.
Das Fazit: Die meisten Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit haben in dieser Studie die für eine Entscheidung relevanten Informationen nicht erhalten. Was die Kardiologen den Patienten mitgeteilt haben, war überwiegend unvollständig, einseitig, verzerrt und falsch. Auch der Kommunikationsstil entsprach zumeist nicht den Erfordernissen für eine informiert Entscheidung. In der Folge stimmen Patienten einer invasiven Behandlung zu, die sie ablehnen würden, wenn sie zutreffend informiert wären.
Goff SL, Mazor KM, Ting HH, et al. How cardiologists present the benefits of percutaneous coronary interventions to patients with stable angina: A qualitative analysis. JAMA Internal Medicine 2014. Abstract
David Klemperer, 9.9.14
Vier neue Studien zur Überversorgung mit Stents
 Im JAMA Internal Medicine sind kürzlich 3 Studien und im British Medical Journal ist eine Studie erschienen, die sich mit der Frage der Einsetzung eines Stents bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit befassen, ein Thema über das wir wiederholt berichtet haben.
Im JAMA Internal Medicine sind kürzlich 3 Studien und im British Medical Journal ist eine Studie erschienen, die sich mit der Frage der Einsetzung eines Stents bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit befassen, ein Thema über das wir wiederholt berichtet haben.
Im Folgenden wird ein Überblick über die Problematik gegeben und dann auf die Forum-Beiträge zu den 4 neuen Studien verwiesen.
Bei einem Teil der Patienten mit nicht akuter, stabiler koronarer Herzkrankheit (KHK), also mit Verengungen an Herzkranzgefäßen, treten Angina pectoris-Beschwerden auf, andere Patienten mit stabiler KHK sind beschwerdefrei.
Durch eine Kombination von Medikamenten, die sog. optimale medikamentöse Therapie (OMT) können KHK-Beschwerden, wie Engegefühl im Brustkorb bei Belastung (Angina pectoris), effektiv gemindert und die Prognose verbessert werden. Die zusätzlich zur OMT durchgeführte Aufdehnung verengter Herzkranzgefäße mit einem Katheter mit Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent), auch als perkutane Intervention (PCI) bezeichnet, bewirkt eine eher geringe zusätzliche Beschwerdebesserung, wie u.a. die amerikanische COURAGE-Studie gezeigt hat (Weintraub et al. 2008) - die Prognose wird jedoch nicht gebessert, d.h. der Eingriff hat keinen Effekt auf die Sterblichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Herzinfarktes oder das Risiko eines Schlaganfalls (Boden et al. 2007, s.a. Beitrag im Forum).
Somit ist die PCI, also das Einsetzen eines Stents, bei der stabilen KHK nur in einer Situation indiziert: der Patient bzw. die Patientin hat trotz OMT Angina pectoris-Beschwerden, welche die Lebensqualität so stark beeinträchtigen, dass sie oder er die Aussicht auf Beschwerdeminderung durch PCI höher bewertet als die Risiken und Unannehmlichkeiten der PCI. Die Entscheidung für oder gegen die PCI kann also sinnhaft nur der Patient nach Klärung seiner Präferenz treffen.
Eine amerikanische Studie (Fowler et al. 2012, s.a. Beitrag im Forum):
• die Mehrheit der Patienten (54%), die eine PCI erhalten, ist beschwerdefrei - der Eingriff ist also eindeutig nicht indiziert
• Ärzte legen zumeist Gründe für die PCI dar (77%) aber eher selten (16%) Gründe, die dagegen sprechen
• andere Vorgehensweisen, wie z.B. die PCI nicht durchzuführen, erwähnen die Ärzte zumeist nicht (nur in 10% der Fälle)
• nur eine Minderheit (16%) wird nach ihrer Präferenz befragt.
Eine weitere Studie zeigte, dass nur bei einer Minderheit der Patienten (43,5%), die eine PCI erhielten, vor der PCI eine OMT durchgeführt worden war. Somit war auch in dieser Studie die Mehrzahl der Eingriffe nicht indiziert, weil eine Indikation erst besteht, wenn die medikamentösen Maßnahmen ausgeschöpft sind (Borden et al. 2011, s.a. Beitrag im Forum).
Eine Arbeitsgruppe um Rothberg hatte 2010 in einer Befragung von 153 KHK-Patienten und 17 Kardiologen festgestellt, dass fast 90% der Patienten sowie einige der Kardiologen fälschlich annahmen, dass eine PCI das Herzinfarktrisiko mindere. Die Mehrheit (70%) der Kardiologen sahen in 2 Fallbeschreibungen keinen Nutzen durch eine PCI, 43% würden sie trotzdem durchführen.
Eine andere Studie zeigte, dass Ärzte bei der Indikationsstellung für eine kardiologische Untersuchung empfindlich auf finanzielle Anreize reagieren und zwar im Sinne einer Dosis-Wirkungsbeziehung - je stärker der finanzielle Anreiz, desto häufiger wird die Untersuchung durchgeführt (Shah et al 2011, siehe auch Beitrag im Forum).
Im Ergebnis erhalten tagtäglich zahlreiche Patienten eine invasive und teure Behandlung, die sie abgelehnt hätten, wenn sie zutreffend informiert wären. Von Seiten der Patienten herrscht ein therapeutische Fehleinschätzung ("therpeutic misconception"). Von Seiten der Ärzte kann von einer "stummen Präferenzfehldiagnose" ("silent misdiagnosis", siehe Beitrag im Forum) gesprochen werden.
Die 4 neuen Studien ergeben deutliche Hinweise für die Lösung des Problems überflüssiger Koronarangiographien und überflüssiger PCIs.
1 Rothberg und Kolleginnen haben in einer randomisierten kontrollierten Studie den Effekt von 3 unterschiedlichen Informationsstrategien zum Nutzen eines Stents bei koronarer Herzkrankheit auf die Patientenentscheidung getestet. Die Entscheidung für einen Stent ist häufiger, wenn der tatsächliche Nutzen vorenthalten und niedriger, wenn er als Fakt oder auch mit Erklärung mitgeteilt wird. Beitrag im Forum
2 Goff und Kolleginnen haben anhand von 40 aufgezeichneten Arzt-Patient-Gesprächen analysiert, wie Kardiologen Patienten mit stabiler KHK informieren. Nur 2 der 40 Patienten erhielten realistische Angaben über Nutzen und Risiken, im Allgemeinen wurde der Nutzen übertrieben dargestellt und die Risiken wurden verharmlost. Beitrag im Forum
3 Bradley und Kollegen befassten sich mit der Frage, wie es sich mit der Angemessenheit der PCI Krankheiten verhält, wenn ein hoher Anteil der Patienten, die eine Koronarangiographie erhalten, beschwerdefrei ist. Tatsächlich ist in diesen Krankenhäuser der Anteil der nicht angemessenen, bzw. überflüssigen PCIs höher. Beitrag im Forum
4 Kureshi et al. befragten Patienten kurz nach einer durchgeführten PCI danach, welchen Nutzen sie sich von der Intervention versprachen. Das Ergebnis ist eine kaum zu übertreffende Fehleinschätzung: nur 1% gab zutreffend die Beschwerdelinderung als Nutzen der PCI an, 90% meinten fälschlich, der Eingriff verhindere Herzinfarkte und verlängere das Leben. Beitrag im Forum
David Klemperer, 9.9.14
Präferenzfehldiagnose bei Stentimplantation und beim Prostatakrebs
 Eine präferenzsensitive Entscheidungssituation liegt vor, wenn es für ein medizinisches Problem mehr als eine Möglichkeit gibt, angemessen damit umzugehen. Dann sollten Patienten umfassend über die unterschiedlichen Vorgehensweisen informiert werden, damit sie jeweils Nutzen und Schaden abwägen können. Einseitige Informationen sind mit dem Recht auf Selbstbestimmung und mit der Autonomie des Patienten nicht vereinbar. Stimmen Patienten einem Eingriff nur zu, weil ihnen relevante Informationen vorenthalten wurden, liegt der Entscheidung eine Präferenzfehldiagnose zugrunde (wir berichteten)..
Eine präferenzsensitive Entscheidungssituation liegt vor, wenn es für ein medizinisches Problem mehr als eine Möglichkeit gibt, angemessen damit umzugehen. Dann sollten Patienten umfassend über die unterschiedlichen Vorgehensweisen informiert werden, damit sie jeweils Nutzen und Schaden abwägen können. Einseitige Informationen sind mit dem Recht auf Selbstbestimmung und mit der Autonomie des Patienten nicht vereinbar. Stimmen Patienten einem Eingriff nur zu, weil ihnen relevante Informationen vorenthalten wurden, liegt der Entscheidung eine Präferenzfehldiagnose zugrunde (wir berichteten)..
Zwei klassische Beispiele für präferenzsensitive Entscheidungen sind die Implantation eines Stents (Gefäßprothese) in eine Herzkranzarterie bei der stabilen, also nicht akuten koronaren Herzkrankheit (Verengung von einem oder von mehreren Herzkranzgefäßen) (wir berichteten) sowie die Behandlung des Prostatakarzinoms (wir berichteten).
Der Stent als zusätzliche Maßnahme zur medikamentösen Behandlung dient bei der stabilen koronaren Herzkrankheit allein zur Linderung der Symptome. Ein Stent hat nach heutigem Wissen keinen Einfluss auf das Risiko eines Herzinfarktes oder auf die Lebenserwartung.
Beim Prostatakarzinom stehen verschiedene Behandlungsmethoden zu Verfügung, neben der Operation die Brachytherapie (interne Bestrahlung), die externe Strahlentherapie und das beobachtende Abwarten. Nach bisherigem Wissen tragen Operation und Bestrahlung, wenn überhaupt, dann nur wenig zur Verbesserung des Überlebens bei - dem bestenfalls geringen Nutzen stehen jedoch gravierend Schäden gegenüber, wie Impotenz und Inkontinenz.
Patienten, die auf einen Stent verzichten bzw. ihr Prostatakarzinom nicht mit Operation oder Bestrahlung behandeln lassen, verschlechtern ihre Prognose also nicht.
Fowler und Kolleginnen befragten 114 Patienten, die einen Stent und 342 Patienten, die eine Prostataoperation erhalten hatten, danach, ob die Ärzte sie in gleichem Maße über den durchgeführten Eingriff wie über andere Vorgehensweisen informiert hatten. Der Eingriff hatte im Durchschnitt 14 Monate vorher stattgefunden.
54% der Stent-Patienten gaben an, im Monat vor dem Eingriff keinen Schmerz im Brustkorb oder im Arm gehabt zu haben, also bezüglich der Verengung eines Herzkranzgefäßverengung beschwerdefrei gewesen zu sein. Bei ihnen gab es somit medizinisch keinen Grund, einen Stent einzusetzen. 10% gaben an, vom Arzt über andere Behandlungsmöglichkeiten - Bypass-Operation oder medikamentöse Behandlung - informiert worden zu sein. Nur 6% sind über die alleinige medikamentöse Behandlung als ernsthaft zu erwägende Option informiert worden.
77% gaben an, vom Arzt ausführlich ("a lot") über den Stent informiert woden zu sein während 19% angaben, der Arzt habe sie ausführlich ("a lot") oder etwas ("some") darüber informiert, was gegen den Eingriff spricht. Nur 16% gaben an, nach ihrer Behandlungspräferenz gefragt worden zu sein.
Beim Prostatakarzinom 64% der Patienten gaben an, dass der Arzt mindestens eine andere Behandlungsform ernsthaft mit ihnen besprochen habe, bei einem Drittel das beobachtende Abwarten. Bei 95% besprach der Arzt die Operation, bei 63% sprach er über Argumente gegen Operation. 76% der Patienten gaben an, dass der Arzt sie nach ihrer Präferenz gefragt habe.
Die ethisch unabdingbare Präferenzklärung bei der Entscheidungsfindung zur Frage der Stent-Implantation bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit war in dieser Studie eher die Ausnahme als die Regel.
Auch beim Prostatakarzinom brachten die Ärzte die Gründe für die Operation häufiger zur Sprache als die Gründe dagegen. Häufiger als beim Stent informierten Ärzte die Patienten über andere Behandlungsformen, trotzdem erhielten nur ein Drittel Informationen über das beobachten und nur drei Viertel wurden nach Präferenz befragt.
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Ärzte in dieser Studie kommunikative und ethische Standards nicht einhalten. Ethisch besonders gravierend erscheint es, dass ein Teil der Patienten dem jeweiligen Eingriff nur zugestimmt hat, weil ihm relevante Informationen vorenthalten wurden.
Es dürfte nahe liegen, das von den Autoren entwickelte Befragungsinstrument (siehe Anhang) zur Qualitätssicherung des Entscheidungsprozesses einzusetzen.
Fowler F, Jr., Gallagher P, Bynum JW, Barry MJ, Lucas FL, Skinner JS. Decision-Making Process Reported by Medicare Patients Who Had Coronary Artery Stenting or Surgery for Prostate Cancer. Journal of General Internal Medicine 2012;27(8):911-16.
Volltext Open Access
Mulley AG, Trimble C, Elwyn G. Stop the silent misdiagnosis: patients' preferences matter. BMJ 2012;345. Link
Forum Gesundheitspolitik. Bessere Behandlungsergebnisse durch Information und Beteiligung Link
Anhang
Four survey questions are the focus of this analysis:
1. Before this (INTERVENTION), did a doctor talk with you about (EACH ALTERNATIVE)?
1a. IF YES, Did the doctor talk about (EACH ALTERNATIVE) as a choice to seriously consider?
Alternatives to prostate surgery were external beam radiation, radioactive seed implants, and not having active treatment right away. The alternatives to stents were CABG and using medicine only.
2. Before the (INTERVENTION) how much did a doctor talk with you about the reasons to have (INTERVENTION) — a lot, some, a little, or not at all?
3. Before the (INTERVENTION), how much did a doctor talk with you about why you might not want to have (INTERVENTION) — a lot, some, a little, not at all?
4. Before this (INTERVENTION) did a doctor ask you if you wanted to have (INTERVENTION) instead of doing something else to manage your (CONDITION)?
David Klemperer, 28.7.14
55% der Bevölkerung wollen gemeinsame Entscheidungsfindung mit Ärzten! Über 50% meinen aber, noch nie etwas entschieden zu haben
 Mit relativ geringen Schwankungen wünschen sich 55% der dazu im Zeitraum 2001 bis 2012 in regelmäßigen bevölkerungsrepräsentativen Befragungen des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung und der Barmer GEK Befragten eine "gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient. Für das paternalistische Modell (Arzt entscheidet allein) stimmt knapp ein Viertel, das autonome Konzept wählt etwa ein Fünftel. Im Zeitraum der letzten elf Jahre haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben, was die relative Häufigkeit dieser Präferenzen betrifft."
Mit relativ geringen Schwankungen wünschen sich 55% der dazu im Zeitraum 2001 bis 2012 in regelmäßigen bevölkerungsrepräsentativen Befragungen des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung und der Barmer GEK Befragten eine "gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient. Für das paternalistische Modell (Arzt entscheidet allein) stimmt knapp ein Viertel, das autonome Konzept wählt etwa ein Fünftel. Im Zeitraum der letzten elf Jahre haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben, was die relative Häufigkeit dieser Präferenzen betrifft."
Für die weitere Bewertung dieser zum ersten Mal in Deutschland über einen derart langen Zeitraum untersuchten bemerkenswert stabilen Wunschhaltung liefert ein Aufsatz der Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun und Gerd Marstedt vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen eine Fülle von differenzierten Daten.
Dazu zählen u.a. die folgenden Ergebnisse:
• Für "überraschend" halten die Autoren die Tatsache, "dass die Zahl der Befürworter eines paternalistischen Modells auf demselben Niveau geblieben ist. Jeder vierte Patient hält es also nach wie vor mit dem Spruch: "Das soll der Arzt entscheiden, schließlich hat er Medizin studiert und nicht ich"".
• "Während eine große Mehrheit von Patienten heute ausführliche Erklärungen zu Krankheitsursachen wie Therapien wünscht, ist andererseits der Wunsch nach Entscheidungsteilhabe deutlich seltener zu finden. Sozioökonomische Variablen (Alter, Geschlecht, Bildungsniveau) und Morbidität (chronische Erkrankung) sind, jenseits von Persönlichkeitsmerkmalen, wesentliche Einflussfaktoren für die jeweils gewählte Präferenz zu Shared Decision Making. Präferenzen für eine alleinige Entscheidung des Arztes äußern überwiegend Ältere und Befragte mit niedriger Schulbildung. Während nur wenige jüngere Befragte mit Abitur die Entscheidung dem Arzt überlassen möchten, sind dies bei älteren Hauptschulabsolventen doppelt so viele. Die Präferenz für eine gemeinsame Entscheidungsfindung zeigt in der Tendenz ein dazu konträres Bild. Festzuhalten bleibt auch, dass Frauen ebenso wie chronisch Kranke die Regie über die Therapie seltener aus der Hand geben möchten und hier zumindest verbal selbstbewusster agieren."
• Unerwartet und für die Häufigkeit von gemeinsamen Entscheidungsfindungen von gravierender Bedeutung ist, dass "einer sehr großen Zahl von Patienten die Entscheidungssituation im Kontext einer Krankheit gar nicht bewusst, also die Verfügbarkeit von Therapiealternativen, die sich im Hinblick auf Risiken und Nutzen unterscheiden und interindividuell in unterschiedlichem Maße geeignet sind. Die Frage, wie oft solche Entscheidungssituationen in der Praxis vorkommen, zeigt einen überraschenden Befund: Wenn man die Antworten der Kategorie "weiß nicht" einmal unberücksichtigt lässt, sind fast zwei Drittel der übrigen Befragungsteilnehmer der Ansicht, eine solche Situation käme eher selten oder sehr selten vor."
• "Auf die Frage, wann es zuletzt zu einer Entscheidungssituation beim Arzt gekommen sei, weil es verschiedene Alternativen der Behandlung gab, antworten weit mehr als die Hälfte der Befragungsteilnehmer (58 %) mit "noch nie". All diese Patienten sind also entweder davon überzeugt, dass es bei Erkrankungen einen Königsweg der Therapie gibt, oder sogar der Ansicht, dass es für die jeweilige Krankheit im Prinzip nur eine effiziente Behandlungsmethode gibt."
• Ein weiterer für die Realität der gemeinsamen Entscheidungsfindung im deutschen Behandlungssystem "besorgniserregender" Befund, ist der, "dass die Betroffenheit von einer chronischen Erkrankung fast keinen Einfluss hat auf die Erfahrung partizipativer Entscheidungsfindung. Auch in dieser Gruppe antwortet ein Großteil der Befragten (50 %), sie hätten noch nie eine Situation des Shared Decision Making erlebt. Will man diesen Patienten nicht Vergesslichkeit oder Begriffsstutzigkeit unterstellen, dann zeigt dies, dass Ärzte auch bei chronischen Erkrankungen in vielen Fällen eine partizipative Entscheidungsfindung eher zu umgehen suchen - beziehungsweise dass ausgerechnet viele evidenzbasierte und daher auch aus Patientensicht im Prinzip wünschenswerte Leitlinien den Ärzten und in der Folge auch ihren Patienten explizit oder implizit keinen Entscheidungsspielraum vorgeben."
Diese und weitere Belege bi- und multivariater Analysen findet sich in dem 12 Seiten umfassenden Aufsatz Partizipative Entscheidungsfindung beim Arzt: Anspruch und Wirklichkeit von Bernard Braun und Gerd Marstedt, der jetzt als Newsletter 2/2014 des Gesundheitsmonitors komplett kostenlos erschienen ist. Eine etwas ausführlichere Version dieses Aufsatzes wird im Jahresband 2014 des Gesundheitsmonitors erscheinen, der in Kürze erscheinen wird.
Bernard Braun, 25.6.14
Unterschiedliche Prioritätensetzung erschwert gemeinsame Entscheidungsfindung: Das Beispiel Empfängnisverhütung.
 Zu den teilweise folgenreichen Fehlschlüssen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung gehört, dass PatientInnen und Leistungsanbieter wie Ärzte oder Apotheker bei gemeinsamen Gesprächen und Entscheidungen an denselben Aspekten der Leistung interessiert sind bzw. identische Interessenhierarchien oder Prioritäten haben. Dies kann dazu führen, völlig aneinander vorbei zu reden und angeblich gemeinsame Entscheidungen zu treffen, deren Inhalte manche PatientInnen bereits beim Verlassen der Praxis oder Apotheke als persönlich irrelevant vergessen haben bzw. die sie nicht befolgen.
Zu den teilweise folgenreichen Fehlschlüssen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung gehört, dass PatientInnen und Leistungsanbieter wie Ärzte oder Apotheker bei gemeinsamen Gesprächen und Entscheidungen an denselben Aspekten der Leistung interessiert sind bzw. identische Interessenhierarchien oder Prioritäten haben. Dies kann dazu führen, völlig aneinander vorbei zu reden und angeblich gemeinsame Entscheidungen zu treffen, deren Inhalte manche PatientInnen bereits beim Verlassen der Praxis oder Apotheke als persönlich irrelevant vergessen haben bzw. die sie nicht befolgen.
Die Tatsache dieses Problems hat eine aktuelle Befragungsstudie mit 417 Frauen zwischen 14 und 45 Jahren und 188 verschiedenen Anbietern von kontrazeptiven Leistungen in den USA erneut gut belegt. Beiden Gruppen sollten insgesamt 34 Fragen zu wichtigen, bei der Verordnung und Einnahme solcher Mittel zu beachtenden Aspekten bewerten.
Die Ergebnisse im Detail:
• Bei 18 Fragen waren sich die beiden Befragtengruppen einig. Bei den restlichen Gruppen traten deutliche Unterschiede auf.
• Die Hauptanliegen für die befragten Nutzerinnen von Empfängnisverhütung waren, wie wirksam und sicher die jeweilige Methode wie empfängnisverhütend wirkt. Die Hauptanliegen der Anbieter waren dagegen die Kosten-Nutzenrelation und wie oft die Patientin leitliniengerecht daran erinnert werden müssen, die Methode zu nutzen.
• Für 41,7% der Nutzerinnen gehörte die Sicherheit der Methode zu den drei Spitzenanliegen, ein Interesse, das aber umgekehrt nur 20,1% der Ärzte für besonders wichtig hielten.
• Zu den drei Hauptfragen der Nutzerinnen gehörte schließlich noch die nach den potenziellen Nebenwirkungen (26,3%), was wiederum nur für 16,3% der Anbieter zu den Hauptfragen gehörte.
Da es ein solches Auseinanderklaffen der Interessen zwischen Patienten und Ärzten etc. auch bei anderen Leistungen gibt oder geben könnte, sollte z.B. bei gravierender Häufung von fehlender Therapietreue oder Unzufriedenheit von Patienten zunächst an solche möglicherweise dafür ursächlichen Unterschiede gedacht werden.
Der Aufsatz What matters most? The content and concordance of patients' and providers' information priorities for contraceptive decision making von Kyla Z. Donnelly et al. ist am 1, Mai 2014 als "article in press" der internationalen Fachzeitschrift für reproduktive Gesundheit "Contraception" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.6.14
Beschneidung von männlichen Kindern mit oder ohne ihre Beteiligung - wenn überhaupt, wann und mit welchem gesundheitlichen Risiko?
 Einer der häufigsten operativen Eingriffe bei männlichen Kindern und Jugendlichen (in medizinischen Einrichtungen der USA jährlich rund 1,4 Millionen Fälle) ist die Entfernung der Vorhaut bzw. die Beschneidung. Sie geschieht überwiegend aus religiösen oder kulturellen Gründen und seltener wegen einer krankhaften, d.h. medizinisch behandlungsbedürftigen Verengung der Vorhaut oder Phimose. In regelmäßigen Abständen, in Deutschland vor zwei Jahren, gibt es Diskussionen darüber, ob es sich bei der religiös oder kulturell motivierten Beschneidung nicht um die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit der oft sehr jungen Kinder handelt, die sich dazu noch komplett über deren Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte hinwegsetzt bzw. mangels Fähigkeit kleiner Kinder hinwegsetzen muss. Da so etwas wie eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit Babys oder sehr jungen Kindern nur sehr schlecht stattfinden kann, gab es immer wieder Forderungen, den Zeitpunkt der Entscheidung pro oder contra Beschneidung ins höhere Kindes- oder Jugendlichenalter zu verschieben.
Einer der häufigsten operativen Eingriffe bei männlichen Kindern und Jugendlichen (in medizinischen Einrichtungen der USA jährlich rund 1,4 Millionen Fälle) ist die Entfernung der Vorhaut bzw. die Beschneidung. Sie geschieht überwiegend aus religiösen oder kulturellen Gründen und seltener wegen einer krankhaften, d.h. medizinisch behandlungsbedürftigen Verengung der Vorhaut oder Phimose. In regelmäßigen Abständen, in Deutschland vor zwei Jahren, gibt es Diskussionen darüber, ob es sich bei der religiös oder kulturell motivierten Beschneidung nicht um die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit der oft sehr jungen Kinder handelt, die sich dazu noch komplett über deren Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte hinwegsetzt bzw. mangels Fähigkeit kleiner Kinder hinwegsetzen muss. Da so etwas wie eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit Babys oder sehr jungen Kindern nur sehr schlecht stattfinden kann, gab es immer wieder Forderungen, den Zeitpunkt der Entscheidung pro oder contra Beschneidung ins höhere Kindes- oder Jugendlichenalter zu verschieben.
Unabhängig von den dagegen wiederum erhobenen religiösen Einwänden, stellt sich die gesundheitliche Frage, ob es einen Zusammenhang von unerwünschten Nebenwirkungen und Lebensalter zum Zeitpunkt der Beschneidung gibt.
Die am 12. Mai 2014 in der Fachzeitschrift "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Ergebnisse einer Analyse der Routinedaten über unerwünschte Ereignisse und Folgen bei der Beschneidung von 1.400.920 us-amerikanischen männlichen Kindern, lauten so:
• Die Inzidenz aller 41 möglichen unerwünschten Effekte betrug 0,5%.
• Sie stieg im Vergleich mit den unter einem Jahr alten männlichen Kindern bei den 1 bis 9-Jährigen auf das Zwanzigfache und bei den 10 Jahre alten und älteren Jungs und jungen Männer auf das Zehnfache dieses Werts.
• Die Rate potenziell ernsthafter Nebenwirkungen reichte von 0,76 Ereignissen pro einer Million Beschneidungen bis zu 703,23 Ereignissen pro eine Million Beschneidungen, wenn eine nicht vollständige Beschneidung nachbehandelt werden musste.
Auch wenn damit eine größere Transparenz existiert, ähnelt die besser informierte Entscheidung einer zwischen Scylla und Charybdis bzw. zwischen dem Gebot, die Operierten an Entscheidungen zu beteiligen und dem mit steigendem Lebensalter ebenfalls steigenden Risiko von unerwünschten Behandlungsfolgen.
Von dem am 12. Mai 2014 "online first" in der Zeitschrift "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Aufsatz Rates of Adverse Events Associated With Male Circumcision in US Medical Settings, 2001 to 2010 von Charbel El Bcheraoui et al. gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 17.5.14
Bessere Behandlungsergebnisse durch Information und Beteiligung
 Information und Beteiligung zählen zu den Grundbedürfnissen der meisten Patienten in der medizinischen Behandlung. Studien zu dieser Fragestellung finden sich in der Rubrik Shared Decision Making/Partizipative Entscheidungsfindung.
Information und Beteiligung zählen zu den Grundbedürfnissen der meisten Patienten in der medizinischen Behandlung. Studien zu dieser Fragestellung finden sich in der Rubrik Shared Decision Making/Partizipative Entscheidungsfindung.
Umfassendste Quelle zum Wissen über die Effekte von SDM dürfte die Cochrane Review "Decision aids for people facing health treatment or screening decisions", die 1999 erstmals erschien und zuletzt 2014 aktualisiert wurde. Für die aktuelle Fassung wurden 115 randomisierte kontrollierte Studien zu 46 Entscheidungssituationen mit 34.444 Patienten ausgewertet.
Die 115 Studien untersuchten, welchen Unterschied Decision aids im Vergleich zu herkömmlicher Arzt-Patient-Kommunikation machen. Decision aids bezeichnet Interventionen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung. Dazu zählt, dass den Patienten vermittelt wird, dass eine Entscheidung zu treffen ist und er oder sie Informationen über den Nutzen und die Risiken von Behandlungsoptionen bzw. Screening-Optionen sowie die zu erwartenden Outcomes erhält, um den Nutzen die Risiken vergleichen zu können. Decision aids unterstützen eine Kommunikation im Sinne des Shared Decision Making.
Bezüglich der Dauer des Arzt-Patient-Gesprächs können Decision aids zu einer Verlängerung oder Verkürzung führen oder aber die Dauer bleibt gleich. Im Median erhöht sich die Dauer um 2,55 Minuten, die Verkürzung betrug je nach Studie bis zu 8 Minuten, die Verlängerung bis zu 23 Minuten.
Die Ergebnisse der 118 Studien sind allein wegen Unterschieden in den Fragestellungen, den Methoden und Messinstrumenten nicht einheitlich.
Übergreifend lässt sich jedoch schlussfolgern:
Decision aids
• verbessern das Wissen
• verbessern die Beteiligung
• fördern die Präferenzklärung
• vermitteln eine realistische Wahrnehmung der Outcomes
• verbessern die Arzt-Patient-Kommunikation
• verbessern die Zufriedenheit mit dem Entscheidungsprozess
• vermindern die Inanspruchnahme einiger chirurgischer Eingriffe
• vermindern die Inanspruchnahme einiger Früherkennungsuntersuchungen
• wirken sich nicht negativ auf die Gesundheitsergebnisse aus.
Die Studienergebnisse für den allgemeinen Gesundheitszustand (general health outcomes), für krankheitsspezifische Behandlungsergebnisse wie auch für Therapietreue (Adhärenz) sind eher uneinheitlich.
Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit des Einsatzes von Decision aids zur Verbesserung der Arzt-Patient-Kommunikation. Dabei geht es um die Überwindung eines unhaltbaren, aber noch wenig skandalisierten Sachverhalts: Patienten erhalten Untersuchungen und Behandlungen, die sie ablehnen würden, wenn sie mehr über den Nutzen und die Risiken erfahren hätten - die "stumme Fehldiagnose" (Forum Gesundheitspolitik: "Stumme Fehldiagnose" - vermeidbar durch Shared Decision Making). Ein jüngeres Beispiel für solche einen unhaltbaren Zustand ist das geringe Wissen und die falschen Vorstellungen zum Mammografie-Screening auf Seiten von Gynäkologen (Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken) und auf Seiten der betroffenen Frauen (Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken).
Stacey D, Légaré F, Col Nananda F, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014. Abstract
David Klemperer, 16.5.14
Amerikanische Studie: Ärzte verschweigen Patienten essentielle Informationen für weitreichende Entscheidungen
 In einer amerikanischen Studie wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die Patient vor eine Operation wegen Prostatakrebs bzw. vor dem Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent) über das Pro und Kontra sowie über die alternativ zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten informiert und sie nach ihren Präferenzen befragt wurden.
In einer amerikanischen Studie wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die Patient vor eine Operation wegen Prostatakrebs bzw. vor dem Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent) über das Pro und Kontra sowie über die alternativ zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten informiert und sie nach ihren Präferenzen befragt wurden.
Bei den Eingriffen handelt es sich um "präferenzsensitive" Maßnahmen. Damit werden medizinische Interventionen bezeichnet, bei denen kein eindeutiges Überwiegen des Nutzens im Vergleich zum Schaden besteht. Die Entscheidung erfordert daher, dass sich der Patienten im Rahmen eines Abwägungsprozesses darüber klar wird, ob die Argumente für oder gegen die Maßnahme schwerer wiegen - welche der Optionen also seiner Präferenz entspricht.
Die operative Entfernung der Prostata verspricht im Vergleich zur Bestrahlung oder zum Abwarten eine leichte Verbesserung der Lebenserwartung bei allerdings hoher Wahrscheinlichkeit schwerer unerwünschter Wirkungen, wie Impotenz und Inkontinenz.
Das Einsetzen eines Stents verringert die Mortalität in den ersten 24 Stunden des Herzinfarkts, danach können durch den Eingriff Beschwerden gelindert aber nicht die Lebenserwartung verbessert oder das Risiko für einen erneuten Infarkt gemindert werden. Dies lässt sich jedoch durch eine medikamentöse Therapie erreichen. Prostataoperation und Stentimplantation haben also Auswirkungen auf die Lebensqualität, dagegen kaum oder gar nicht auf die Lebensdauer.
Teilnehmer der Studie waren 472 Patienten, die im Alter von mindestens 66 Jahren im 2. Halbjahr 2008 eine Prostataoperation oder eine Stentimplantation erhalten haben und über Medicare Part A und B krankenversichert waren.
Die Ergebnisse für Patienten mit Prostatakrebs, die eine Operation erhielten, lauten: 95% berichten, dass der Arzt die Gründe für die Operation besprochen habe, jedoch nur 63%, dass er mit ihnen über die Argumente gegen eine Operation gesprochen habe. Das Gespräch über die anderen Behandlungsmethoden (beobachtendes Abwarten bzw. Bestrahlung) gaben 34% an. Nach ihrer Präferenz wurden 76% gefragt.
Die Ergebnisse für die Patienten, die einen Stent eingesetzt bekamen lauten: 77% berichteten, dass der Arzt mit ihnen über die Gründe für den Eingriff, aber nur 16%, dass er über die Gründe gegen den Eingriff gesprochen habe. Nur 10% erhielten Informationen über andere Vorgehensweisen, wie beobachtendes Abwarten oder Bypass-Operation und nur 16% wurden nach ihrer Präferenz gefragt. 54% hatten im vorangegangenen Monat keine Herzbeschwerden gehabt
Die Studie belegt, dass die Informationen, die Patienten zu einer präferenzsensitiven Maßnahme erhielten, unzureichend waren. Die Ergebnisse für die Patienten mit Prostataoperation sind dabei weniger ungünstig aber immer noch schlecht, weil nicht 34% sondern 100% die Information erhalten sollten, dass sie nicht viel verpassen, wenn sie die Operation nicht erhalten. Die Information der Patienten mit Stent kann hingegen nur als desaströs bezeichnet werden. Am meisten erschüttert, dass bei 54% keine Indikation für den Eingriff vorlag, weil sie frei von Herzbeschwerden waren.
Die Autoren fordern die Verlagerung der Entscheidung zu den Hausärzten, die eher zu einer ausgewogenen Informationen in der Lage seien und den vermehrten Einsatz von Entscheidungshilfen, also evidenzbasierten Informationen zur Unterstützung der Entscheidung.
Fowler, F., Jr.; Gallagher, P.; Bynum, J. W.; Barry, M.; Lucas, F. L.; Skinner, J. (2012): Decision-Making Process Reported by Medicare Patients Who Had Coronary Artery Stenting or Surgery for Prostate Cancer. In: Journal of General Internal Medicine 27/8: 911-916. doi: 10.1007/s11606-012-2009-5 Abstract Open Access
David Klemperer, 5.12.13
Shared Decision Making nur etwas für entwickelte Länder und ihre Ärzte und Patienten? Wie sieht es z.B. in Malaysia aus?
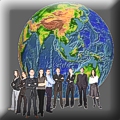 Egal, ob jemand denkt, "shared decision making" (SDM) oder gemeinsame Entscheidungsfindung bei gesundheitsbezogene Entscheidungsfindung sei nur etwas für Patienten und Ärzte in west-, mittel- oder nordeuropäischen und nordamerikanischen Länder und nichts für so genannte Entwicklungsländer oder ob er hofft, dass SDM vielleicht mangels traditionellem Paternalismus dort etwas besser funktioniert: Ein gerade veröffentlichter Review über SDM in Malysia zeigt, dass es sich um zwei Irrtümer handelt.
Egal, ob jemand denkt, "shared decision making" (SDM) oder gemeinsame Entscheidungsfindung bei gesundheitsbezogene Entscheidungsfindung sei nur etwas für Patienten und Ärzte in west-, mittel- oder nordeuropäischen und nordamerikanischen Länder und nichts für so genannte Entwicklungsländer oder ob er hofft, dass SDM vielleicht mangels traditionellem Paternalismus dort etwas besser funktioniert: Ein gerade veröffentlichter Review über SDM in Malysia zeigt, dass es sich um zwei Irrtümer handelt.
Auch in Malaysia, wie in einigen anderen asiatischen Ländern und Gesundheitssystemen gibt es gesetzliche Vorschriften zur Pflicht Patienten aufzuklären (informed consent). Der malayische Ärzteverband hat außerdem bereits 2001 eine Leitlinie zu den Pflichten eines Arztes ausgearbeitet, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient "collaborative" und in "partnership" erfolgen solle. Trotzdem fanden die ForscherInnen unter 1.262 Aufsätzen, die sich überhaupt mit der Beteiligung von PatientInnen in Malaysia beschäftigten, gerade einmal 20 Artikel, die sich umfassend mit SDM bzw. der Patientenbeteiligung an Entscheidungen beschäftigten. Zusätzlich führten sie zwei Online-Surveys mit Hochschulwissenschaftlern aus dem Bereich des klinischen Trainings und der Lehrangebote zu SDM und mit Patientenunterstützungsgruppen durch.
Die bisher ausschließlich deskriptiven Ergebnisse zeigen, dass Ärzte sich zwar über die Bedeutung von Shared Decision Making und informed consent bewusst sind, nur wenige dies aber in ihrer Praxis berücksichtigen. Dies wird durch einen sehr begrenztes Lehrangebot und relativ schlechte Informationsmöglichkeiten für PatientInnen begleitet. Erschwerend wirkt sich in Malaysia aber auch noch die ethnische und sprachluiche Vielfalt aus. Trotz verschiedener Ideen, an diesen Zuständen etwas zu ändern, gibt es bisher auch noch keinen definitiven Implementationsplan.
Daran etwas zu ändern ist dann auch die Absicht eines eigenen Strategievorschlags, der sowohl das Bewusstsein über und die Implementation von SDM verbessern helfen soll.
Erste Reaktionen z.B. aus Brasilien zeigen, dass andere WissenschaftlerInnen in anderen Ländern daran interessiert sind mit eigenen Länderreports nachziehen Daher könnte es demnächst eine Weltkarte über die Verbreitung von SDM geben, in der nicht mehr wesentliche Länder und Erdteile fehlen.
Der Aufsatz An overview of patient involvement in healthcare decision-making: a situational analysis of the Malaysian context von Chirk-Jenn et al. ist 2013 in der Open Access-Zeitschrift "BMC Health Services Research" (13: 408) erschienen und daher komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.10.13
Vom Gesundheitsnutzen des Engagements und der Beteiligung von Patienten, und wie ungleich dies im 11-Ländervergleich aussieht.
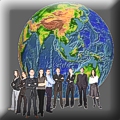 Wenn Patienten an Behandlungsentscheidungen beteiligt sind und auch sonst ausgewählte Elemente und Phasen ihrer Behandlung selbst in die Hand nehmen, berichten sie weniger häufig von Behandlungs- Medikations- oder Labortestfehlern, die sie in den letzten zwei Jahren erfahren mussten, bewerten sie ihre Behandlung und auch ihr Gesundheitssystem insgesamt besser als passive oder paternalistisch behandelte Patienten. So bewerteten z.B. 78% der PatientInnen in den USA, die die Patient-Arzt-Kommunikation und ihr Engegement bei ihrer Behandlung positiv wahrnahmen, die Behandlungsqualität als sehr hoch. Von denen, die weniger beteiligt waren, sagten nur noch 43% die Qualität ihrer Behandlung sei sehr gut.
Wenn Patienten an Behandlungsentscheidungen beteiligt sind und auch sonst ausgewählte Elemente und Phasen ihrer Behandlung selbst in die Hand nehmen, berichten sie weniger häufig von Behandlungs- Medikations- oder Labortestfehlern, die sie in den letzten zwei Jahren erfahren mussten, bewerten sie ihre Behandlung und auch ihr Gesundheitssystem insgesamt besser als passive oder paternalistisch behandelte Patienten. So bewerteten z.B. 78% der PatientInnen in den USA, die die Patient-Arzt-Kommunikation und ihr Engegement bei ihrer Behandlung positiv wahrnahmen, die Behandlungsqualität als sehr hoch. Von denen, die weniger beteiligt waren, sagten nur noch 43% die Qualität ihrer Behandlung sei sehr gut.
Dies ist eines der Ergebnisse einer 2011 vom liberalen, in den USA beheimateten Commonwealth Fund durchgeführten Befragung (Commonwealth Fund International Health Policy Survey) von mehr als 18.000 Erwachsenen in 11 Ländern (Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien und USA), die in der Zeit vor der Befragung stationär behandelt wurden, eine große Operation hinter sich gebracht haben oder im vergangenen Jahr ernsthaft erkrankt oder verletzt waren.
Ein anderes Ergebnis waren die enormen Unterschiede nach Art und Intensität der Beteiligung und des Engagements von Patienten. Hier zeigt sich u.a.:
• Um etwas über das Patientenengagement in Erfahrung zu bringen, fragten die ForscherInnen danach, ob die Ärzte genug Zeit für und mit ihren Patienten aufbringen, sie Sachverhalte verständlich erklären und die Patienten ermuntern, Fragen zu stellen. Bei PatientInnen in Norwegen und Schweden sah das Engagement am geringsten aus, d.h. höchstens ein Drittel der Befragten berichteten zu ihrem Engagement etwas Positives. Ganz anders sah es in Australien, Neuseeland, der Schweiz, Großbritannien und den USA aus, wo rund zwei Drittel der befragten PatientInnen über positive Interaktionen mit ihrem Arzt berichteten.
• In 7 der 11 Länder (Australien, Kanada, Niederlande, Norwegen, Schweden, Großbritannien und den USA) wurden Patienten mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen von ihrem regulären Arzt signifikant weniger zur Beteiligung ermuntert - am ausgeprägtesten in den USA.
• Die Survey-TeilnehmerInnen wurden zusätzlich befragt, ob die von ihnen in Anspruch genommenen Fachärzte sie auch bei der Entscheidungsfindung für eine Behandlung und an der Behandlungsentscheidung beteiligten. Rund 80% der Patienten in der Schweiz und in Großbritannien sagten, dies geschehe durchweg immer oder oft. Zwei Drittel oder mehr der holländischen, neuseeländischen und us-amerikanischen Befragten nahmen dies auch so wahr. Am wenigsten berichteten Befragte in Frankreich, Deutschland, Norwegen und Schweden von "shared decision making"-Erfahrungen bei Fachärzten.
Von der Studie " International Perspectives on Patient Engagement: Results from the 2011 Commonwealth Fund Survey" von R. Osborn und D. Squires, erschienen im "Journal of Ambulatory Care Management" (April/June 2012 35(2):118-28), gibt es kostenlos eine ausführlichere Zusammenfassung.
Bernard Braun, 19.7.12
Autoritäres Verhalten von Ärzten verhindert Shared Decision Making
 Über das Konzept Shared Decision Making haben wir vielfach berichtet (siehe Kategorie SDM). Bekannt ist, dass dieses von allen Seiten zumindest rhetorisch begrüßte Konzept im klinischen Alltag kaum verankert ist. Barrieren wurden bislang zumeist auf Seiten der Patienten und in strukturellen Aspekten wie Zeitmangel auf Seiten der Ärzte gesucht. Eine neue Studie hat jetzt gezeigt, dass Ärzte mit autoritärem Verhalten bei den Patienten Angst erzeugen und schon im Vorfeld die Äußerung von Beteiligungswünschen auf Seiten der Patienten unterdrücken.
Über das Konzept Shared Decision Making haben wir vielfach berichtet (siehe Kategorie SDM). Bekannt ist, dass dieses von allen Seiten zumindest rhetorisch begrüßte Konzept im klinischen Alltag kaum verankert ist. Barrieren wurden bislang zumeist auf Seiten der Patienten und in strukturellen Aspekten wie Zeitmangel auf Seiten der Ärzte gesucht. Eine neue Studie hat jetzt gezeigt, dass Ärzte mit autoritärem Verhalten bei den Patienten Angst erzeugen und schon im Vorfeld die Äußerung von Beteiligungswünschen auf Seiten der Patienten unterdrücken.
Obwohl die aktive Beteiligung der Patienten an Behandlungsentscheidungen im Sinne des Shared Decision Making (SDM) ein weithin propagiertes und als zeitgemäß aufgefasstes Konzept der Arzt-Patient-Kommunikation ist, sind die Versuche, SDM in den medizinischen Versorgungsalltag zu bringen, eher mäßig erfolgreich. Als Barriere wurde u.a. die kommunikative Kompetenz der Ärzte identifiziert. Kaum Aufmerksamkeit hat bislang die kommunikative Kompetenz der Patienten gefunden. Während es im Alltag den meisten Menschen nicht schwerfällt, Fragen zu stellen, Präferenzen zu klären und Empfehlungen abzulehnen, scheint dies in der Kommunikation mit dem Arzt nicht zu funktionieren. Nicht einmal das Coaching von Patienten in Shared Decision Making hat dies deutlich verbessern können.
Der Frage, warum das so ist, ist der amerikanische Gesundheitswissenschaftler Dominick Frosch mit Kollegen jetzt in einer Studie nachgegangen. Dafür führte er 6 Fokusgruppen mit insgesamt 48 Teilnehmern durch. Die Probanden wurden in Allgemeinmedizinpraxen in Palo Alto rekrutiert, einem wohlhabenden Ort in Kalifornien.
Kurzgefasst lautet das Ergebnis: Die Patienten wünschen Beteiligung, sehen aber bei der häufig fehlenden Bereitschaft der Ärzte keine Möglichkeit, ihren Wunsch durchzusetzen. Sie befürchten, den Arzt mit Fragen zu verärgern, dauerhaft als "schwieriger Patient" abgestempelt zu werden und weniger gut behandelt zu werden.
4 übergreifende Themenbereiche ergab die Auswertung der Fokusguppeninterviews.
Patienten befürchten, den Arzt durch Fragen zu verärgern und dadurch Nachteile zu erleiden.
In allen Gruppen äußerten die Patienten den Wunsch nach aktiver Beteiligung an klinischen Entscheidungen. Sie stellten aber auch fest, dass diese Möglichkeit weitgehend vom Arzt abhängt. Sie sahen die Notwendigkeit, die Rolle des "guten Patienten" einzunehmen, weil sie andernfalls Nachteile befürchteten. Sie befürchteten, dass sich der Arzt in seiner Fachlichkeit oder in seiner ärztlichen Autorität durch Nachfragen in Frage gestellt sehe und verärgert würde. Die Teilnehmer befürchten dann wiederum kurzfristige und langfristige Nachteile, Strafe, eine schlechtere Behandlung und eine gestörte Beziehung. Sie empfanden ein hohes Maß an Abhängigkeit, insbesondere vom Wohlwollen des Arztes. Ein selbstbewusstes und fragendes Auftreten würde dazu führen, dauerhaft als "schwieriger Patient" abgestempelt zu werden.
Sie erkennen das Machtgefälle zwischen Ärzten und Patienten und nehmen häufig Rücksicht auf die wahrgenommene Empfindlichkeit des Arztes, um ihn nicht zu verärgern oder zu enttäuschen. Die Teilnehmer sahen sich selbst eher in der Rolle eines Bittstellers unter der Prämisse "doctor knows best" denn als Empfänger einer Dienstleistung. So sehen sie keine andere Möglichkeit, als sich der Rolle des "guten Patienten" anzupassen.
Ärzte können autoritär sein.
Viele Teilnehmer berichten, dass sie sich nicht respektiert und verstanden fühlen, weil der Arzt sich häufig autoritär verhalte. Gegen dieses Verhalten sei man machtlos, weswegen einige Patienten resignativ den Status quo hinnehmen. Die Expertise des Arztes erkennen die Teilnehmer grundsätzlich an, kritisieren aber die daraus abgeleitete dominante Position.
Patienten bemühen sich, Informationslücken zu schließen.
Viele Teilnehmer verschaffen sich außerhalb der Konsultation Informationen über Behandlungsmöglichkeiten. Einige von ihnen verheimlichen dies vor dem Arzt. Motivation für die Informationssuche ist auch die leichte Verfügbarkeit medizinischer Informationen aber auch Misstrauen gegenüber den Empfehlungen des Arztes.
Im Gespräch mit dem Arzt empfinden Teilnehmer häufig Zeitdruck, was sie daran hindere, Fragen zu stellen.
Soziale Unterstützung
Einige Teilnehmer holen sich Unterstützung für den Arztbesuch, z.B. durch Einbezug einer nahestehenden Person. Dies helfe, die Informationen festzuhalten, die sie ansonsten kaum aufnehmen bzw. schnell vergessen würden.
Das Fazit der Autoren: Die Fokusgruppen-Teilnehmer haben durchgehend den Wunsch, Behandlungsoptionen zu kennen und darüber (mit-) zu entscheiden. Sie befürchten aber, den Arzt mit entsprechenden Fragen zu verärgern und die Beziehung zu stören - einige Teilnehmer haben die Erfahrung gemacht, dass der Arzt Fragen als Kritik und Infragestellen seiner Autorität empfindet. Sie sehen das Machtgefälle in der Beziehung zum Arzt und befürchten als Strafe eine schlechtere Behandlung. Da sie dies als zu hohen Preis für die Teilnahme an der Entscheidung bewerten, verzichten sie auf die Durchsetzung ihres Wunsches. Diese Ergebnisse sind umso bemerkenswerter, als es sich um Teilnehmer mit einem hohen sozialen Status handelt, von denen man annehmen kann, dass sie eher als andere selbstbewusst gegenüber den Ärzten auftreten können.
Die Teilnehmer fühlten sich von den Ärzten nicht ausreichend informiert und nicht ausreichend unterstützt, insbesondere wenn es um das Verstehen unterschiedlicher Behandlungsmöglichkeiten geht. Daher behelfen sie sich mit eigener Recherche und Befragung von Mitgliedern ihrer sozialen Netzwerke.
Die Autoren stellen fest, dass zwar eine generell starke Tendenz zur Patientenbeteiligung bestehe. Die Haltung der Ärzte oder zumindest das, was die Patienten als Haltung der Ärzte wahrnehmen sei eine wesentliche Barriere für die Umsetzung im Alltag. Diese Haltung der Ärzte in Frage zu stellen, erscheine den Patienten riskant.
Die Autoren unterbreiten folgende Vorschläge:
• Adäquate Vergütung für Ärzte, die sich in Shared Decision Making engagieren.
• Gute Entscheidungsunterstützungs-Tools (decision aids) und ausreichende Bedenkzeit. Die Entscheidung sollte erst bei einem Folgekontakt getroffen werden.
• Neuausrichtung der Versorgung mit organisatorischen und strukturellen Veränderungen unter Nutzung von Informationstechnologien und besserer Verteilung der Aufgaben im Team. Dadurch könne Zeit für das Arzt-Patient-Gespräch gewonnen werden.
Wesentlicher dürfte aber eine Veränderung der medizinischen Kultur sein. Ärzte sollten ein Interesse entwickeln und auch zeigen für das, was den Patienten wichtig ist. Sie sollten die Ängste ihrer Patienten kennen und ihnen explizit verdeutlichen, dass Fragen und Äußerungen zur Präferenz erwünscht sind. Ausbildung in patientenzentrierter Kommunikation spiele eine Rolle. Letzten Endes gehe es aber um Respekt und die Wertschätzung der Patienten.
Zur Durchsetzung einer patientenzentrierten Versorgung fordern die Autoren rigorose Qualitätsmaße für die Beteiligung der Patienten und die Übereinstimmung ihrer Präferenz mit der durchgeführten Behandlung.
Die Patienten alleine können die kulturellen Barrieren nicht überwinden. Politiker und Meinungsführer im Gesundheitsbereich (health system leaders) müssen proaktive Schritte ergreifen.
Diese Studie verdeutlicht, dass die Entscheidungsfindung in der Medizin auch eine Machtfrage ist. Bislang sitzen die Ärzte am längeren Hebel und setzten ihre Präferenzen durch, indem sie die Beteiligungswünsche der Patienten bewusst oder unbewusst unterdrücken. Wie weit dieses Verhalten auf Seiten der Ärzte verbreitet ist, kann diese qualitative Studie nicht beantworten. Bemerkenswert ist allerdings, dass dieser Mechanismus bei sozial hoch stehenden Patienten gut funktioniert.
Frosch DL, May SG, Rendle KAS, Tietbohl C, Elwyn G. Authoritarian Physicians And Patients' Fear Of Being Labeled 'Difficult' Among Key Obstacles To Shared Decision Making. Health Affairs 2012;31(5):1030-38. Abstract
David Klemperer, 16.6.12
Aktivere PatientInnen haben bessere Outcomes bei Gesundheitsindikatoren und gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen
 Eine Mehrheit der PatientInnen will sich seit Jahren in Befragungen aktiv durch gemeinsame Entscheidungsfindung mit ihren Ärzten an ihrer Behandlung beteiligen und Gesundheitspolitiker appellieren an PatientInnen sich aktiver und wirksamer am Management ihrer Gesundheit und der Behandlung ihrer Krankheiten zu beteiligen. Ob dies außer des damit verbundenen "guten Gefühls" oder jenseits der Befriedigung von Kostendämpfungsinteressen einen gesundheitlichen oder gar gesundheitsökonomischen Nutzen hat, ist, wenn überhaupt, erst für kleine und handverlesene Gruppen von PatientInnen für wenige Indikatoren des gesundheitsbezogenen Nutzens untersucht und dann auch nur zum Teil bestätigt worden.
Eine Mehrheit der PatientInnen will sich seit Jahren in Befragungen aktiv durch gemeinsame Entscheidungsfindung mit ihren Ärzten an ihrer Behandlung beteiligen und Gesundheitspolitiker appellieren an PatientInnen sich aktiver und wirksamer am Management ihrer Gesundheit und der Behandlung ihrer Krankheiten zu beteiligen. Ob dies außer des damit verbundenen "guten Gefühls" oder jenseits der Befriedigung von Kostendämpfungsinteressen einen gesundheitlichen oder gar gesundheitsökonomischen Nutzen hat, ist, wenn überhaupt, erst für kleine und handverlesene Gruppen von PatientInnen für wenige Indikatoren des gesundheitsbezogenen Nutzens untersucht und dann auch nur zum Teil bestätigt worden.
Eine Querschnitts-Untersuchung des Niveaus der Patientenaktivierung und mehrerer patientenbezogener Outcomes von 25.047 erwachsenen PatientInnen einer Gesundheitseinrichtung im US-Bundesstaat Minnesota trat an, einige der Wissenslücken zu schließen. Dazu wurde zunächst während eines Besuchs bei ihrem Primärarzt mit dem mehrdimensionalen, validen und reliablen Standardinstrument "Patient activation measure (PAM)" das Aktivitätsniveau der StudienteilnehmerInnen erhoben. PAM misst sowohl Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Einstellungen und das Vertrauen von Personen ihre Gesundheit und Gesundheitsversorgung managen zu können. Danach identifizierten die WissenschaftlerInnen für dieselben PatientInnen mit Routinedaten der Krankenversicherungsunternehmen 13 gesundheitsrelevante Sachverhalte im Bereich Prävention (z.B. Teilnahme an einem präventiven Screening gegen Brustkrebs), ungesunde Verhaltensweisen (z.B. Rauchen, Übergewicht), klinische Indikatoren (z.B. Blutdruck) und kostspielige Inanspruchnahme von Leistungen (z.B. Besuch einer Notfallambulanz oder Krankenhausaufenthalte).
Die integrierte Analyse beider Datensammlungen zeigte u.a., dass
• 44,2% der Patienten mit dem niedrigsten Aktivitätsniveau (Level 1 mit minimal 0 Punkten) wahrscheinlich einen normalen systolischen Blutdruckwert hatten, wohingegen dies unter den PatientInnen mit dem höchsten Aktivitätsniveau (Level 4 mit maximal 100 Punkten) lediglich 53,4% erreichten,
• 24,1% der Level 1-PatientInnen wahrscheinlich einen oder mehrere Notfallstations-Behandlungen erlitten und dies "nur" bei 16% der Level 4-PatientInnen der Fall war,
• PatientInnen mit dem höchsten Aktivitätsniveau diverse Screeningsangebote mehr in Anspruch nahmen als die PatientInnen mit dem niedrigsten Niveau und
• PatientInnen mit dem niedrigsten Aktivitätsniveau sich häufiger ungesund verhielten als die mit dem höchsten Niveau.
Wurden bei insgesamt 10 der 13 Outcomes die Erwartungen erfüllt, war es bei drei anders. So war die Wahrscheinlichkeit, einen normalen Cholesterinwert, diastolischen Blutdruckwert oder HbA1c-Wert zu haben bei PatientInnen mit hohem Aktivitätsniveau nicht höher als bei jenen mit niedrigem Wert.
Multivariat analysiert sank die Wahrscheinlichkeit zu Rauchen, einer Übergewichtigkeit, einer Notfallbehandlung im Krankenhaus und eines Krankenhausaufenthalts mit jedem zusätzlichen Zehnerschritt nach oben auf der 100 Punkte umfassenden PAM-Skala. Die Wahrscheinlichkeit eines Brustkrebs-Screenings oder normaler Blutzucker-, Cholesterin- und Fettstoffwerte stieg dagegen mit jedem Zehnerschritt nach oben ebenfalls.
Die WissenschaftlerInnen ziehen daraus den Schluss, dass eine quantitativ und qualitativ noch bessere Aktivierung von PatientInnen weitere positive Auswirkungen auf verschiedene Gesundheits-Outcomes haben würde. Mit dem Hinweis, dass ihre StudienteilnehmerInnen nicht repräsentativ für die US-Bevölkerung oder die dortigen Krankenversicherten waren und es außerdem einige Schwierigkeiten gab, die Patientenaktivitätsmessung standardisiert und einheitlich durchzuführen, begründen die ForscherInnen ihren Wunsch, diese Art von Studie repräsentativ und im Längsschnitt mit Möglichkeiten einer Kausalanalyse weiterführen zu können. Dann wäre auch zu klären, ob wirklich ein höheres Aktivitätsniveau zu besseren Outcomes führt oder Personen mit besseren Outcomes bereits ein höheres Aktivitätsniveau haben.
Von dem Aufsatz "Why Does Patient Activation Matter? An Examination of the Relationships Between Patient Activation and Health-Related Outcomes" von Jessica Greene und Judith H. Hibbard, online am 30. November 2011 im "Journal of General Internal Medicine" erschienen, gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 1.4.12
Dramatische Wissenslücken: Ärzte und Früherkennung
 Wenn in einer Gruppe von Patienten eine Krebserkrankung im Alter von 67 Jahren diagnostiziert wird und die Betroffenen mit 70 Jahren sterben, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 0%. Angenommen die Krebserkrankung wird durch eine Früherkennungsuntersuchung bereits im Alter von 60 Jahren diagnostiziert und die Patienten sterben mit 70 Jahren, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 100%. Das Dumme: die dramatische Erhöhung von 0 auf 100% rettet kein einziges Leben. Der Krebs wird zwar früher erkannt, die Lebenserwartung jedoch nicht verbessert.
Wenn in einer Gruppe von Patienten eine Krebserkrankung im Alter von 67 Jahren diagnostiziert wird und die Betroffenen mit 70 Jahren sterben, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 0%. Angenommen die Krebserkrankung wird durch eine Früherkennungsuntersuchung bereits im Alter von 60 Jahren diagnostiziert und die Patienten sterben mit 70 Jahren, beträgt die 5-Jahresüberlebensrate 100%. Das Dumme: die dramatische Erhöhung von 0 auf 100% rettet kein einziges Leben. Der Krebs wird zwar früher erkannt, die Lebenserwartung jedoch nicht verbessert.
Die Minderung der Sterblichkeit an einer Krebserkrankung ist daher das entscheidende Maß für den Erfolg einer Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Die 5-Jahresüberlebensrate ist dagegen bedeutungslos. Ebenfalls untauglich ist die Zahl der früh erkannten Krebserkrankungen, denn durch Früherkennung werden auch solche Tumore entdeckt, die ansonsten nie aufgefallen wären, weil sie entweder nicht weitgewachsen wären oder sich sogar zurückgebildet hätten - ein Phänomen, das als Überdiagnose bezeichnet wird.
Inwieweit amerikanische Allgemeinärzte, die in ihrem Berufsalltag Früherkennungsuntersuchungen veranlassen, diese Sachverhalte kennen und verstehen, haben jetzt Wissenschaftler des Harding Center for Health Literacy untersucht.
Dafür führten sie eine Online-Befragung durch, an der 412 Ärzte teilnahmen.
Grundlage waren 2 Szenarien. In einem Szenario wurde der Nutzen der Krebsfrüherkennungsuntersuchung mit Zahlen zur 5-Jahresüberlebensrate beschrieben, im anderen mit Zahlen zur Senkung der Krebssterblichkeit.
Das Ergebnis lautet: 69% der Ärzte gründeten ihre Empfehlung zur Teilnahme an der Früherkennung auf die 5-Jahresüberlebensrate, also eine für den Nutzen bedeutungslose Information. Nur 23% erkannten die Sterblichkeitssenkung als relevante Information über den Nutzen.
Die meisten Ärzte vermochten nicht zwischen richtigen und falschen Aussagen zur Verbesserung des Überlebens zu unterscheiden.
76% meinten meinten fälschlicherweise, es würden Leben gerettet, wenn durch Krankheitsfrüherkennung die 5-Jahresüberlebensrate gesteigert wird. 22% erkannten, dass diese Aussage falsch ist.
Bei weiterem Nachfragen offenbarten sich weitere Wissenslücken. Die Information, dass die Früherkennungsuntersuchung die Inzidenz von 27 auf 46 pro Tausend Personen steigert (die Zahlen entsprechen den Effekten der Prostatakrebsfrüherkennung), erhöhte bei 62% der Ärzte die Bereitschaft, die Untersuchung zu empfehlen, 50% meinten, dies bedeute eine weitere Erhöhung der Zahl der geretteten Leben - obwohl, wie oben ausgeführt, die Erhöhung der Inzidenz eine diesbezüglich irrelevante Information ist.
Diese und weitere hier nicht dargestellte Antworten belegen einen Mangel an grundlegendem Wissen im Verständnis von Krankheitsfrüherkennung bei der Mehrheit der befragten amerikanischen Ärzte.
Wer nun hofft, dass in Deutschland alles besser sei, wird enttäuscht. In einer Vorläuferstudie mit 65 deutschen Ärzten meinten 76%, dass die 5-Jahresüberlebensrate den Nutzen der Früherkennung beweise. Nur einer der 65 Ärzte konnte den lead-time-bias zutreffend erklären, also die irrtümliche Annahme verbesserten Überlebens durch Vorverlegung des Diagnosezeitpunkts.
Diese Studien sind ein weitere Beleg dafür, dass viele Ärzte aufgrund ihres unzureichend geschulten Zahlenverständnisses nicht dazu in der Lage sind, ihre Patienten angemessen über den Nutzen und Schaden von Früherkennungsuntersuchungen zu informieren. Die Ärztekammern sollten angesichts dieses dramatischen Ergebnisses die Fortbildungspflicht dazu nutzen, die Ärzte auf den Stand des Wissens zu bringen.
Wegwarth O, Schwartz LM, Woloshin S, Gaissmaier W, Gigerenzer G. Do Physicians Understand Cancer Screening Statistics? A National Survey of Primary Care Physicians in the United States. Annals of Internal Medicine 2012;156:340-49. Abstract
Pressemitteilung des Harding-Center Link
Studie mit deutschen Ärzten
Wegwarth O, Gaissmaier W, Gigerenzer G. Deceiving Numbers. Medical Decision Making 2011;31:386-94. Abstract
David Klemperer, 13.3.12
Gemeinsame Entscheidungsfindung ja, aber wie entscheidungsfähig sind Patienten und womit stellt man dies verlässlich fest?
 So wichtig die informierte und gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Patienten und Ärzten für die Akzeptanz, Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit in der Krankheitsversorgung ist, so wichtig ist dabei die Voraussetzung, dass die Patienten überhaupt (mit-)entscheidungsbereit und entscheidungsfähig sind.
So wichtig die informierte und gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Patienten und Ärzten für die Akzeptanz, Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit in der Krankheitsversorgung ist, so wichtig ist dabei die Voraussetzung, dass die Patienten überhaupt (mit-)entscheidungsbereit und entscheidungsfähig sind.
Zu der Frage wie viele Patienten ausreichend Entscheidungsfähigkeit besitzen und wie man diese am besten misst, wurden in einem im "Journal of American Medical Association (JAMA)" im August 2011 veröffentlichten Review die Ergebnisse von bis zum April 2011 vorliegenden 43 qualitativ hochwertigen Studien näher betrachtet.
Als erstes gab es in verschiedenen Bevölkerungs- oder Patientengruppen sehr unterschiedliche Prävalenzen mangelnder Entscheidungsfähigkeit: Dem Anteil von 2,8% in der als Kontrollgruppe untersuchten Gruppe der gesunden älteren Personen stand ein Maximalwert von 68% bei Personen mit Lernbehinderungen, 54% bei Alzheimer-Erkrankten, 44% bei Pflegeheim-BewohnerInnen und 26% bei allen Krankenhauspatienten gegenüber.
Als zweites legen die AutorInnen dar, dass die subjektive Bewertung der Entscheidungsunfähigkeit ihrer PatientInnen durch die behandelnden Ärzte die tatsächliche, durch objektive Diagnostik festgestellte Entscheidungsunfähigkeit deutlich unterschätzt. Nur 42% der nach der objektiven Diagnostik betroffenen PatientInnen wurden von ihren Ärzten auch als entscheidungsunfähig wahrgenommen.
Drittens halten die AutorInnen den faktisch für die Feststellung der Entscheidungsfähigkeit weit verbreiteten "Mini-Mental-Status-Test (MMSE)" außer bei ausgeprägten Verhältnissen nicht für überlegen oder besonders geeignet. Stattdessen schlagen sie drei andere Testmethoden vor, die mit psychisch gesunden Personen/Patienten gegen einen jeweiligen "Goldstandard" (z.B. Bewertung durch einen forensischen Psychiater oder eine multidisziplinäre Kompetenzgruppe) positiv abgeschnitten haben. Da der "Aid to Capacity Evaluation (ACE)-Test" zusätzlich noch kostenlos und online erhältlich ist, Trainingsmaterialien zur Verfügung stehen und der Test höchstens 30 Minuten dauert, schlagen die Reviewer ihn als eine Art Standard vor.
Dem geläufigen Schlusssatz vieler wissenschaftlichen Studien, man müsse noch hier und da weiterforschen, kann hier ohne Vorbehalte zugestimmt werden: Jeder der evaluierten Tests wurde bislang nur ein einziges Mal gegen einen Goldstandard auf seine Validität und Reliabilität hin getest.
Bei schwerwiegenden oder folgenreichen Entscheidungen, die Ärzte zusammen mit ihren PatientInnen treffen oder eventuell auch Patienten mit ihrem Arzt, sollte nach diesen Ergebnissen gründlicher an die Möglichkeit fehlender oder eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit der ja oft schwer kranken PatientInnen gedacht werden und der hier empfohlene Test eingesetzt werden.
Zu dem Aufsatz "Does this patient have medical decision-making capacity?" von Sessums LL., Zembrzuska H. und Jackson JL. - erschienen am 27. Juli 2011 in "JAMA" 27; 306(4): 420-7 - ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.12.11
Welchen Nutzen hat die Behandlung von kranken Menschen statt von Krankheiten?
 Als patientenzentriert gilt eine Behandlung, in der die Ärzte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Behandlungsplan entwickeln und sich dabei bemühen, sämtliche Ressourcen der Krankheitsgeschichte des Patienten zu nutzen aber auch mögliche persönliche Hindernisse für die Behandlung zu berücksichtigen. Ob es sich dabei vor allem um einen Beitrag zum Wohlfühlen beider Seiten handelt oder um mehr, sollte eine von 2008 bis 2010 in Schweden durchgeführte kontrollierte Vorher-Nachher-Studie über die Ergebnisse der stationären Behandlung von 248 PatientInnen mit chronischer Herzschwäche herausbekommen.
Als patientenzentriert gilt eine Behandlung, in der die Ärzte und andere Angehörige von Gesundheitsberufen gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Behandlungsplan entwickeln und sich dabei bemühen, sämtliche Ressourcen der Krankheitsgeschichte des Patienten zu nutzen aber auch mögliche persönliche Hindernisse für die Behandlung zu berücksichtigen. Ob es sich dabei vor allem um einen Beitrag zum Wohlfühlen beider Seiten handelt oder um mehr, sollte eine von 2008 bis 2010 in Schweden durchgeführte kontrollierte Vorher-Nachher-Studie über die Ergebnisse der stationären Behandlung von 248 PatientInnen mit chronischer Herzschwäche herausbekommen.
Die Ergebnisse bei den für die Studie ausgewählten Merkmalen der Behandlung sahen so aus:
• Die Herzpatienten mit der vollständig implementierten personenzentrierten Behandlung lagen 2,5 Tage kürzer im Krankenhaus als die "normal" behandelten Patienten in der Kontrollgruppe. Diese Differenz ist statistisch signifikant.
• Bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) sah es bei den personenzentriert Behandelten ebenfalls signifikant besser aus.
• Bei der gesundheitsbedingten Lebensqualität und der Zeit bis zu einem erneuten Krankenhausaufenthalt unterschieden sich die beiden Patientengruppen nach 3 bzw. 6 Monaten nicht bzw. nicht signifikant. Die raschere Entlassung aus dem Krankenhaus wirkt sich also mit Sicherheit nicht negativ auf die gesundheitsbedingte Lebensqualität und die Notwendigkeit eines erneuten Krankenhausaufenthalts aus.
• Die AutorInnen weisen darauf hin, dass die Effekte der personenzentrierten Behandlung je nach Krankheit unterschiedlich sein können. Diese Art der Behandlung reduzierte beispielsweise die Krankenhausliegedauer von älteren Patienten mit einer Hüftfraktur sogar um 50%.
Trotz einiger Probleme bei der Durchführung der Studie wie zum Beispiel der relativ hohen Abbrecherquote während ihrer Laufzeit, hat eine personenzentrierte Behandlung offensichtlich einen mehrfachen Nutzen für die PatientInnen, der allerdings auch einen gewissen Aufwand auf Arzt- und Patientenseite erfordert. Dies führt immerhin dazu, dass nur 60% der Angehörigen der Interventionsgruppe während ihres gesamten Aufenthalts in der Klinik eine konsistent personenbezogene Behandlung erhielten. Dies zeige, so der Studienleiter Ekman, dass "the difficulty of rearranging the healthcare culture since it is based on a person with an illness and not on the person's illness alone. The biggest challenge will be to break the traditional and rigid structure of healthcare."
Von dem am 15. September 2011 im "European Heart Journal" veröffentlichten Aufsatz "Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure - the PCC-HF study" von Inger Ekman at al. ist neben dem Abstract auch die achtseitige komplette Fassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.11
Wie lang und oft sollen der gesundheitliche Nutzen und die aufwandsenkende Wirkung von Patientenzentrierung noch bewiesen werden?
 Die immer wieder in Studien erkannten Mängel in der Dauer und der Art der Kommunikation und der patientenzentrierten Behandlung insgesamt, stellen auch aus Sicht von vielen Ärzten ein Hemmnis für ihre Wirksamkeit, die Therapietreue und die Zufriedenheit von PatientInnen dar. Dass sich insbesondere in Deutschland nichts an der 6-8-Minutenmedizin und der einseitigen Beendigung des Erzählflusses von PatientInnen durch den Arzt nach kurzer Zeit verändert, begründen ÄrztInnen häufig mit Zweifeln an der tatsächlichen gesundheitlichen Wirksamkeit eines anderen Kommunikations- und Behandlungsstils und auch damit, dass das ja noch mehr zeitlichen Aufwand bei sowieso schon durch die immer wieder berichteten 18 Patient-Arzt-Kontakte pro Jahr überstrapazierten zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Dass eine qualitativ patientenzentriertere und zunächst zeitintensivere Behandlung unter dem Strich zu weniger Aufwand und einer besseren Behandlung könnte, erschien und erscheint vielen ÄrztInnen, Krankenkassenmanagern und Gesundheitspolitikern immer noch zu unsicher, um so zu arbeiten und Anreize zu setzen.
Die immer wieder in Studien erkannten Mängel in der Dauer und der Art der Kommunikation und der patientenzentrierten Behandlung insgesamt, stellen auch aus Sicht von vielen Ärzten ein Hemmnis für ihre Wirksamkeit, die Therapietreue und die Zufriedenheit von PatientInnen dar. Dass sich insbesondere in Deutschland nichts an der 6-8-Minutenmedizin und der einseitigen Beendigung des Erzählflusses von PatientInnen durch den Arzt nach kurzer Zeit verändert, begründen ÄrztInnen häufig mit Zweifeln an der tatsächlichen gesundheitlichen Wirksamkeit eines anderen Kommunikations- und Behandlungsstils und auch damit, dass das ja noch mehr zeitlichen Aufwand bei sowieso schon durch die immer wieder berichteten 18 Patient-Arzt-Kontakte pro Jahr überstrapazierten zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Dass eine qualitativ patientenzentriertere und zunächst zeitintensivere Behandlung unter dem Strich zu weniger Aufwand und einer besseren Behandlung könnte, erschien und erscheint vielen ÄrztInnen, Krankenkassenmanagern und Gesundheitspolitikern immer noch zu unsicher, um so zu arbeiten und Anreize zu setzen.
Dabei gibt es seit mittlerweile über einem Jahrzehnt und bis in die Gegenwart hinein immer wieder genügend Evidenz für den allseitigen Nutzen patientenzentrierterer Behandlung:
• In einem 1995 im "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichten Review von 21 randomisierten kontrollierten Studien über die Wirkungen einer qualitativ anspruchsvollen patientenzentrierten Arzt-Patientkommunikation von der gründlichen und auch narrativen (!) Anamnese bis zur Besprechung (!) eines Behandlungsplans auf die Gesundheit der Patienten, berichteten 16 signifikant positive Resultate, vier negative, die aber nicht signifikant waren und eine Studie ließ den Leser im Unklaren. Die in dem Aufsatz genannten Elemente einer anspruchsvollen Kommunikation empfahlen die AutorInnen als Inputs für die Arztausbildung und Gesundheitsbildungsangebote für PatientInnen. Neben dem Abstract des Aufsatzes "Effective physician-patient communication and health outcomes: a review" von M. A. Stewart im CMAJ (vol. 152 no. 9: 1423-1433) gibt es auch noch eine kostenlose Komplettversion.
• 2000 untersuchte eine andere Gruppe kanadischer VersorgungsforscherInnen in einer Beobachtungsstudie die Kommunikation in 39 Familienärzte-Praxen aus denen insgesamt 315 PatientInnen an der Studie teilnahmen. Das Untersuchungsziel war, heraus zu bekommen, ob sich patientenzentriertes Verhalten von ÄrztInnen auf eine Reihe von Ergebnisindikatoren der Behandlung auswirkte. Sie nahmen zum einen sämtliche Unterhaltungen zwischen diesen PatientInnen und ihren ÄrztInnen auf Tonband auf und klassifizierten die Gespräche anschließend nach dem Grad ihrer Patientenzentrierung. Zusätzlich fragten sie die PatientInnen nach ihren Wahrnehmungen über die Patientenzentrierung des Arztbesuchs. Bei den Ergebnisindikatoren handelte es sich um die Unannehmlichkeit von Symptomen, den selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand nach dem SF-36-Instrument und die Häufigkeit der Nutzung verschiedener diagnostischer Tests, von Überweisungen und von Arztbesuchen. In der Analyse wurden mögliche Confoundervariablen kontrolliert und eine Standardisierung der unterschiedlichen Praxis-PatientInnen vorgenommen.
Zu den Ergebnissen: Die auf der Basis der Tonbandmitschnitte vorgenommene Klassifizierung der Patientenzentrierung korrelierte gut mit der Wahrnehmung von Patientenzentrierung der Kommunikation mit ihrem Arzt. Die Patienten nahmen eine gemeinsame Basis der Arzt-Patientbeziehung wahr. Positive Wahrnehmungen der Patientenzentrierung und eines gemeinsamen Grundes waren deutlich mit einer besseren Erholung von den Unannehmlichkeiten verschiedener Symptome, einer 2 Monate nach der patrienzentrierten Behandlung besseren emotionalen Gesundheit und weniger diagnostischer Tests und Überweisungen assoziiert: Von den Patienten, die in der patientenzentrierten Gruppe behandelt wurden, erhielten 14,6% einen oder mehrere diagnostische Tests, von den PatientInnen, die ihre Behandlung nicht patientenzentriert wahrnahmen, erhielten solche Tests 24,3%. Ähnliche Unterschiede, teils statistisch signifikant, teils nicht, gab es auch noch bei weiteren Aspekten des Behandlungsgeschehens. Die Erfahrung des Patienten, ein anerkannter und gewünschter Teilnehmer an der Problemdiskussion und am Behandlungsprozess zu sein, ist nach Meinung der AutorInnen vielleicht von höchster Bedeutung für sein geringeres Bedürfnis, eine weitere Untersuchung durch Tests und Überweisungen durchzuführen. Dieser Prozess scheint auch beim Arzt abzulaufen. Interessant und nur teilweise erklärt ist, dass es keine statistische Beziehung zwischen der per Tonband klassifizierten Patientenzentrierung ihres Arztkontakts und den positiven Outcomes gab.
Der Aufsatz endet mit einer ausführlichen Reflexion der schwierigen und zum Teil ambivalenten methodischen und inhaltlichen Aspekte der Studie.
Der Aufsatz "The Impact of Patient-Centered Care on Outcomes" von Moira Stewart et al. ist im September 2000 in der Zeitschrift "The Journal of Familiy Practice" (Vol. 49, No. 9) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
• Und schließlich stellte eine us-amerikanische Forschergruppe in der Mai/Juni-Nummer des 2011er-Jahrgangs der Zeitschrift "Journal of the American Board of Family Medicine" die Ergebnisse einer einjährigen randomisierten Studie mit 509 erwachsenen Patienten vor, die von Familienärzten und allgemeinmedizinisch tätigen Internisten behandelt wurden. Die Untersuchung wurde mit Hilfe eines interaktiven Analyseinstruments durchgeführt, das sowohl anzeigt, ob und wie die primärärztliche Behandlung patientenzentriert stattfand und in welchem Verhältnis Patientenzentrierung zu der Nutzung von Gesundheitsversorgung stand.
Nach der Kontrolle des Einflusses einer Vielzahl von sioziodemografischen, Gesundheitsverhaltens- und Gesundheitsindikatoren und dem rechnerischen Ausschluss ihrer möglichen Einwirkung, gab es ein klares Ergebnis zum Zusammenhang von patientenzentreierten Behandlung und zahlreichen der Behandlungsindikatoren. So sank bei den PatientInnen mit wahrgenommener Patientenzentrierung die Anzahl der Inanspruchnahme spezieller Behandlung pro Jahr schwach signifikant, es gab signifikant weniger Krankenhauseinweisungen und weniger Labor- und Diagnosetests. Die Gesamtausgaben für medizinische Dienstleistungen wurden schließlich innerhalb des Untersuchungsjahres ebenfalls signifikant reduziert. Auch hier lohnen sich gründliche Blicke auf die kritische Diskussion der beobachteten Effekte, die zahlreiche Impulse geben, solche Studien für die dennoch ungläubig bleibenden Gesundheitsakteure zu replizieren.
Der Aufsatz "Patient-Centered Care is Associated with Decreased Health Care Utilization" von Klea D. Bertakis und Rahman Azari, erschienen im "The Journal of the American Board of Family Medicine" (24 [3]: 229-239), ist komplett kostenlos erhältlich.
Nach dem hier geschlagenen 16-jährigen Bogen von unterschiedlichsten Studien zum möglichen Zusammenhang von Patientenzentrierung, der Nutzungshäufigkeit gesundheitlicher Leistungen und ihres gesundheitlichen Nutzens, sollten zumindest die Ärzte und andere Erbringer gesundheitlicher Leistungen, die "eigentlich" gern mehr mit ihren PatientInnen kommuniziert und sie in die Behandlung einbezogen hätten, aber nicht so richtig an den Erfolg glauben und vor allem eine aus ihrer Sicht drohende Zunahme von finanzierter und unfinanzierter Arbeit befürchten, auch im deutschen Gesundheitssystem mehr Patientenzentrierung wagen bzw. unterstützen.
Bernard Braun, 24.10.11
Geographische Versorgungsunterschiede und Shared Decision Making - Reports aus den USA und England
 Für Bewohner von St. Cloud, Minnesota, ist die Wahrscheinlichkeit, eine koronare Bypass-Operation zu erhalten halb so groß im Vergleich zu den Bewohnern von Detroit Lakes. Die Wahrscheinlichkeit, an der Wirbelsäule operiert zu werden, ist hingegen zweifach höher als in Rochester. Diese Art von geographischen Versorgungsunterschieden bereitet die Arbeitsgruppe um John Wennberg seit mehreren Jahrzehnten anhand von Medicare-Daten auf. Daten und Analysen werden im Dartmouth-Atlas of Healthcare veröffentlicht (wir berichteten mehrfach).
Für Bewohner von St. Cloud, Minnesota, ist die Wahrscheinlichkeit, eine koronare Bypass-Operation zu erhalten halb so groß im Vergleich zu den Bewohnern von Detroit Lakes. Die Wahrscheinlichkeit, an der Wirbelsäule operiert zu werden, ist hingegen zweifach höher als in Rochester. Diese Art von geographischen Versorgungsunterschieden bereitet die Arbeitsgruppe um John Wennberg seit mehreren Jahrzehnten anhand von Medicare-Daten auf. Daten und Analysen werden im Dartmouth-Atlas of Healthcare veröffentlicht (wir berichteten mehrfach).
Eine neuere Ausgabe des Dartmouth mit dem Titel "Improving Patient Decision-Making in Health Care" richtet sich auch an die Patienten. Auf Grundlage von Versorgungsdaten des US-Bundesstaates Minnesota legen die Autoren die mit den Versorgungsunterschieden verbundenen Probleme und die daraus folgende Notwendigkeit der Beteiligung der Patienten an den Entscheidungen dar.
Der erste Teil fasst einige der Ursachen für die Versorgungsunterschiede dar. So werden Patienten nicht immer darüber informiert, dass überhaupt eine Entscheidung zu treffen ist. In anderen Fällen wird ihnen nicht erklärt, worum es bei der Entscheidung geht. Schlecht informierte Patienten delegieren ihre Entscheidungen an ihre Ärzte, die dann ihre eigenen Präferenzen zugrunde legen. Auch gehen bei Ärzten die Meinungen darüber, was die beste Behandlung ist, oft weit auseinander. Das Ergebnis: Patienten erhalten häufig nicht die Behandlung, für die sie sich entscheiden würden, wenn sie gut informiert wären.
Im zweiten Teil geht es um die Entscheidungsfindung bei 8 Krankheitsbildern. Der Leser findet hier die wesentlichen Informationen über die Krankheitsbilder und die Behandlungsoptionen.
Zusätzlich werden die Operationsraten auf der Ebene der Krankenhauseinzugsbereiche dargestellt.
Die Krankheitsbilder bzw. Entscheidungssituationen:
• Brustkrebs im Frühstadium
• stabile Angina pectoris bzw. Brustschmerz durch koronare Herzkrankheit
• Kreuzschmerz
• Arthrose von Kniegelenk oder Hüftgelenk
• Verengung der Halsschlagadervergrößerung
• Prostatakrebs im Frühstadium
• gutartige Prostata (Behandlung und Screening)
Hier gilt, dass die Entscheidung zwischen zwei Behandlungsmöglichkeiten - von denen eine die Nicht-Behandlung sein kann - sinnvoll nur von einem gut informierten Patienten getroffen werden kann. Geht es allein um Beschwerdelinderung - wie bei der Versorgung mit Bypass oder Stent bei stabiler koronarer Herzkrankheit, sind es die Beschwerden, die dadurch gegebenen Einschränkungen und Auswirkungen auf die Lebensqualität, die der Patient mit den Nutzenwahrscheinlichkeiten und Schadensrisiken der Operation abwägen muss. Wennberg hat dafür den Begriff "Präferenz-sensitive Entscheidung" geprägt. Die Unterschiede für die koronare Bypass-Operation sind beträchtlich - in Pueblo, Colorado erhielten in den Jahren 2002-2007 1,9 von 1.000 Versicherten einen Bypass, in McAllen, Texas 8,9 pro Tausend. Noch größer sind die Unterschiede bei der Implantation eines Stents: in Honolulu wurde der Eingriff an 3,6 von 1.000 Versicherten durchgeführt, in Elyria, Ohio an 37,3 pro Tausend.
Im dritten Teil werden für Patienten und Behandler die Grundlagen von Shared Decision Making in knapper Form dargelegt.
Shared Decision Making ist auch das Thema eines Reports des King`s Fund, einem Londoner Think Tank für versorgungspolitische Themen.
"Shared decision-making is the principal mechanism for ensuring that patients get 'the care they need and no less, the care they want, and no more" lautet ein Kernsatz aus einer Expertise des King's Fund.
"Die Versorgung, die sie benötigen und nicht weniger, die Versorgung die sie wünschen und nicht mehr" - über diese Anforderung an die medizinische Versorgung von Kranken und Gesunden dürfte weitgehend Einigkeit bestehen. Wie wenig sie realisiert ist, zeigt auch der vom Dartmouth-Atlas inspirierte NHS Atlas of Variation in Healthcare (wir berichteten).
Der King's Fund schließt mit seinem Report ausdrücklich an eine Rede des Englischen Gesundheitsministers Andrew Lansley an, der eine Versorgung im NHS forderte, die von den Patienten gesteuert wird, im Sinne von "no decision about me, without me". Der Report hat offensichtlich zum Ziel, Shared Decision Making an die Politik und an die Bevölkerung zu kommunizieren und vermittelt gut aufbereitetes Grundlagenwissen zum Thema.
Ein weiterer kürzlich veröffentlichter Report des King's Fund mit dem Titel "Variations in health care. The good, the bad and the inexplicable" vermittelt Grundlagen über geographische Versorgungsunterschiede. "Gute" Unterschiede infolge unterschiedlicher Krankheitshäufigkeiten und unterschiedlicher Patientenpräferenzen werden kontrastiert mit "schlechten", medizinisch nicht begründbaren Unterschieden.
Improving Patient Decision-Making in Health Care: A 2011 Dartmouth Atlas Report Highlighting Minnesota. Website Download
The Dartmouth Atlas of Healthcare. Website
King's Fund. Making shared decision-making a reality. No decision about me, without me. Website. Download
Variations in health care. The good, the bad and the inexplicable. Website. Download
The NHS Atlas of Variation in Healthcare. Website
David Klemperer, 12.9.11
Bessere Entscheidungen durch evidenzbasierte Informationen zur Darmkrebsfrüherkennung
 Die Früherkennung von Krebs gilt als sinnvoll, wenn sie die Sterbewahrscheinlichkeit am jeweiligen Krebs und - besser noch - die Gesamtsterblichkeit in der Gruppe der Untersuchten senkt.
Die Früherkennung von Krebs gilt als sinnvoll, wenn sie die Sterbewahrscheinlichkeit am jeweiligen Krebs und - besser noch - die Gesamtsterblichkeit in der Gruppe der Untersuchten senkt.
Nur wenige Früherkennungsmethoden erfüllen dieses Kriterium und selbst diese Methoden stiften wegen der stets nur beschränkten Treffsicherheit nicht nur Nutzen sondern auch Schaden. Falsch positive und falsch negative Befunde bei der Früherkennungsuntersuchung, Diagnosestellung und Therapie bei Tumoren, die sich nie bemerkbar gemacht hätten (Überdiagnose und Übertherapie) und eine relativ geringe Aussicht des Einzelnen auf den Benefit des vermiedenen Krebstodes sind unvermeidliche Aspekte von Krebsfrüherkennungsprogrammen.
Daher hat in den letzten Jahren die Forderung an Gewicht gewonnen, dass Betroffenen umfassende und individualisierte Informationen über den Nutzen und Schaden der Früherkennung angeboten werden sollen, damit sie eine informierte Entscheidung für oder gegen die Untersuchung treffen können. Die bislang vorliegenden Informationsmaterialien sparen die weniger erfreulichen Aspekte zumeist aus, informieren somit einseitig und unvollständig und haben häufig eher Werbe- als Informationscharakter - ein allein aus ethischen Gründen nicht haltbarer Zustand.
Eine Hamburger Forschungsgruppe um Ingrid Mühlhauser hat jetzt die Effekte einer evidenzbasierten im Vergleich zu einer konventionellen Patienteninformation zur Darmkrebsfrüherkennung untersucht.
1.577 Angehörige einer Krankenversicherung im Alter von 50 bis 75 Jahren wurden nach Zufallskriterien wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Hälfte der Probanden erhielt eine 38-seitige, von der Arbeitsgruppe entwickelte evidenzbasierte Broschüre, in der z.B. individuelle Wahrscheinlichkeiten zur Erkrankung und zum Tod an Darmkrebs dargestellt werden sowie der mögliche Nutzen und Schaden der Früherkennungsuntersuchung. Die andere Gruppe erhielt eine konventionelle Information, das Informationsblatt des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Darmkrebsfrüherkennung; darin wird in allgemeiner und einseitiger Form für die Teilnahme geworben.
Der Ergebnisparameter war die "informierte Entscheidung", in die das Wissen, die Haltung zu Krebsfrüherkennung und die tatsächliche oder geplante Durchführung der Früherkennungsuntersuchung eingingen. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe eines Fragebogens erfasst, der den Teilnehmern sechs Monate nach der Information per Post zugesandt wurde.
Die wesentlichen Ergebnisse der Intervention:
• 44% trafen eine informierte Entscheidung, in der Vergleichsgruppe lediglich 12,8%.
• Ein "gutes Wissen" hatten 59,6% erworben, in der Vergleichsgruppe16,2%.
• Die "positive Haltung" zur Darmkrebsfrüherkennung war in beiden Gruppen hoch, in der besser informierten Gruppe jedoch etwas niedriger (93,4% vs. 96,5%).
• Auf die tatsächliche oder geplante Durchführung wirkte sich die Intervention nicht aus - 72,4% in der Interventionsgruppe bzw. 72,9% in der Vergleichsgruppe hatten die Untersuchung schon hinter sich bzw. planten sie durchführen zu lassen.
Somit hat diese evidenzbasierte Patienteninformation starke Effekte auf das Wissen und auf die Art der Entscheidung. Aus Sicht derjenigen, die der Früherkennungsuntersuchung eher positiv gegenüber stehen, trifft die befürchtete Minderung der Inanspruchnahme also nicht ein. Die positive Bewertung und folgerichtige Nutzung der Krebsfrüherkennung wird kaum gemindert. Dies heißt aber auch: Die aufwändige evidenzbasierte Risikoinformation hat am Inanspruchnahme-Verhalten nichts geändert.
Aus einer etwas skeptischeren Sicht und Bewertung der Inanspruchnahme dieser Untersuchungen stellt sich die Frage, warum eine inhaltlich deutlich andere Information an der Häufigkeit des letztlich relevanten Endpunkts der Entscheidungsfindung nichts ändert und damit auch nichts an den möglichen Folgewirkungen falsch-positiver oder negativer Ergebnisse des Screenings. Die AutorInnen deuten an, dass die TeilnehmerInnen möglicherweise wegen der weit verbreiteten positiven Bewertung von Früherkennung durch ehrliche Risikoinformationen in eine Situation der kognitiven Dissonanz geraten und dann doch lieber das vorhandene positiv besetzte Untersuchungsangebot nutzen. Ob diese massive Barriere zwischen Wissen und Handeln existiert, sollte jedenfalls im Hinblick auf die Wirksamkeit weiterer wünschenswerter evidenter Risikoinformation noch gründlicher untersucht werden.
Es ist zu hoffen, dass in weiteren Untersuchungen ebenfalls geprüft wird, ob sich diese Ergebnisse verallgemeinern lassen, ob sie also auch für andere Populationen und andere Krebsarten gelten.
Steckelberg A, Hülfenhaus C, Haastert B, Mühlhauser I. Effect of evidence based risk information on "informed choice" in colorectal cancer screening: randomised controlled trial. BMJ 2011;342
Abstract
Volltext
38-seitige Broschüre zur Darmkrebsfrüherkennung Download
Zusatzmaterialien Link
David Klemperer, 7.6.11
Spornen besser informierte Patienten ihre Ärzte dazu an, mehr oder weniger Leistungen anzubieten? In den USA eher weniger!
 Patienten wollen und sollen sich mehr über gesundheitliche Fragen sowie den Nutzen wie die Kosten von Behandlungen informieren, und sind dazu auch zumindest in bestimmten sozialen und Altersgruppen dank des Internets in der Lage. Die Erwartungen an diese sehr normativen neuen Erwartungen an PatientInnen sind hoch und umfassen den Wegfall vieler unnötiger Leistungen und entsprechender Kosten.
Patienten wollen und sollen sich mehr über gesundheitliche Fragen sowie den Nutzen wie die Kosten von Behandlungen informieren, und sind dazu auch zumindest in bestimmten sozialen und Altersgruppen dank des Internets in der Lage. Die Erwartungen an diese sehr normativen neuen Erwartungen an PatientInnen sind hoch und umfassen den Wegfall vieler unnötiger Leistungen und entsprechender Kosten.
Wie so häufig in der deutschen Gesundheitspolitik bleibt es aber meist bei den genannten und ähnlichen Appellen und kümmert sich kaum jemand ernsthaft darum, ob die Ärzte der so informierten und auch entsprechend kommunizierender PatientInnen wirklich weniger oder sogar mehr Leistungen anbieten. So könnten etwa Ärzte, die mit ihren informierten PatientInnen gut über ihre Erkrankungen und deren Behandlungsoptionen reden und sich gut verstehen können, weniger Zeit für Erklärungen und Überzeugungsarbeit bei ihnen benötigen, eher Anreize haben mehr Behandlungsangebote zu machen. Umgekehrt könnte es sein, dass dann, wenn informierte PatientInnen Behandlungen anfragen oder verlangen, die sich deutlich von denen unterscheiden, die der Arzt empfehlen will, eine kontroversenreiche Arzt-Patientbeziehung entsteht, in der es generell schwierig wird, sich überhaupt auf eine Behandlung zu einigen. Ergebnis wären geringer werdende Anreize Leistungen anzubieten und möglicherweise eine qualitativ schlechte Versorgung.
Wie es in den USA wirklich aussieht, untersuchten jetzt Gesundheitswissenschaftler und -ökonomen mit Daten des für die USA repräsentativen "Community Tracking Study (CTS) physician survey".
Mit unterschiedlich komplexen Berechnungsmethoden liegen seit kurzem die folgenden Ergebnisse vor:
• Zunächst bestätigen die Wissenschaftler die zum Teil negative Bewertung von Internet-Informationen durch einen Teil der Ärzte. Die damit verbundene neue interpretative Rolle von Ärzten ist vielen von ihnen oft unwillkommen.
• Generell gaben 8% der befragten Ärzte an, durch informierte PatientInnen bestimmte Anreize zu erhalten, ihre Behandlungsangebote zu reduzieren, 70% empfanden weder leistungsexpansive noch -reduzierende Anreize und 22% sagten, sie hätten Anreize, ihre Dienstleistungen für den Patienten zu erweitern. 16,8% der PatientInnen brachten in die Kontakte mit ihren Ärzten Informationen aus externen Quellen ein.
• Wenn sich Ärzte in einem Umfeld mit überdurchschnittlichem Wettbewerb bewegen, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie Anreize erhalten ihre Leistungen auszudehnen. Umgekehrt sieght es aus, wenn Ärzte stärker unter "managed care"-Bedingungen arbeiten.
• Besser informierte PatientInnen reduzieren die Anreize für Ärzte möglichst viele und auch unnötige oder nutzlose Leistungen anzubieten. Wenn keiner ihrer PatientInnen andere externe medizinische Informationsquellen benutzt, gaben rund 46% der Ärzte an, sie hätten Anreize, die Leistungen für diese Patienten eher auszudehnen. Nur 3% sagen unter diesen Umständen, sie würden Leistungen reduzieren. Wenn aber Ärzte unter ihren PatientInnen die durchschnittliche Anzahl von Personen haben, die sich extern informieren, also 16,8%, geben nur noch 25% von ihnen an, sie empfänden Anreize, die Leistungen auszudehnen. 11,2% sagen dagegen, sie würden in der Praxis mit diesen PatientInnen eher den Anreiz empfinden, die Leistungen zu reduzieren.
Trotz des Mangels an einer generellen Theorie dazu, wie sich PatiententInnen externe medizinische Informationen beschaffen und wie sie diese dann in Arztkontakten nutzen, unterstreicht die Kontrolle einiger anderer vermutlicher Einflussfaktoren und -bedingungen, welche das Arztverhalten beeinflussen könnten, die relativ große Bedeutung des Informationsstandes der PatientInnen für ein Mehr oder Weniger an angebotenen und erbrachten Leistungen. Weitere mehrdimensionale Forscxhung ist aber in jedem Fall notwendig und wahrscheinlich auch ertragreich.
Den kompletten Text des 2011 im "Forum for Health Economics & Policy" (Vol. 14: Iss. 2 Health Economics) erschienenen Aufsatzes "Does Patient Use of Medical Information Affect Physician Practice Incentives to Provide Care?" von Hai Fang and John Rizzo erhält man über die "Berkeley Electronic Press" auch kostenlos. Dazu muss man sich allerdings auf der Website erst persönlich mit wenigen Angaben zur Person anmelden. Nach den Erfahrungen des Autors führt dies zu keinen unerwünschten Angeboten.
Bernard Braun, 1.6.11
Legenden zur Verantwortung für Überversorgung: 30 % weniger Betäubungsmittel, wenn Gebärende Schmerztherapie selbst bestimmen!
 Eine beliebte Erklärung von Ärzten und Gesundheitspolitikern für die teure und oft auch gesundheitlich bedenkliche Überversorgung mit Arzneimitteln und nebenbei ein willkommener Beleg für eine Variante von "Moral hazard" ist der von PatientInnen angeblich erzeugte Druck, bestimmte Mittel bei "jedem Wehwechen" in Hülle und Fülle zu erhalten, um Schmerzen oder Befindlichkeitsstörungen so schnell und gründlich wie möglich zum Verschwinden zu bringen. Um diesem Druck zu entgehen, sagen viele Ärzte auf Befragen sie würden oft gegen ihr "fachliches Gewissen" in einer Art vorauseilenden Ärgervermeidens zu viel und zu viel eigentlich nicht Notwendiges oder gar Unsinniges (z.B. Antibiotika gegen Virenerkrankungen) verordnen.
Eine beliebte Erklärung von Ärzten und Gesundheitspolitikern für die teure und oft auch gesundheitlich bedenkliche Überversorgung mit Arzneimitteln und nebenbei ein willkommener Beleg für eine Variante von "Moral hazard" ist der von PatientInnen angeblich erzeugte Druck, bestimmte Mittel bei "jedem Wehwechen" in Hülle und Fülle zu erhalten, um Schmerzen oder Befindlichkeitsstörungen so schnell und gründlich wie möglich zum Verschwinden zu bringen. Um diesem Druck zu entgehen, sagen viele Ärzte auf Befragen sie würden oft gegen ihr "fachliches Gewissen" in einer Art vorauseilenden Ärgervermeidens zu viel und zu viel eigentlich nicht Notwendiges oder gar Unsinniges (z.B. Antibiotika gegen Virenerkrankungen) verordnen.
An der weit verbreiteten Existenz einer solchen Overkill- oder Konsumier-Mentalität bei Patienten wurde aber schon lange gezweifelt. So bereiten viele der so erhaltenen Mittel meist keinenerlei Genuß und die angeblich fordernden Personen haben vor einer Einnahme vieler Mittel sogar erhebliche Ängste und Skrupel.
Dies gilt in besonderem Maße für eine schnell wirksame lokale Schmerztherapie, die sog. Periduralanästhesie, die bei Schwangeren gegen Schmerzen während des Geburtsvorgangs eingesetzt wird. Wer jemals bei einer Geburt dabei war, weiß, dass diese wirklich sehr schmerzhaft und dramatisch sein kann. Viele Schwangere und ihre Partner haben sich aber in der Schwangerenvorbereitung fest vorgenommen, auf diese Betäubung wegen der tatsächlichen oder vermeintlichen Risiken für die Schwangere und ihr ungeborenes Kind (u.a. Verlängerung des Geburtsprozesses und eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine risikoreiche Zangen- oder Saugglockenentbindung) zu verzichten. Die Entscheidung zur Periduralanästhesie hat dann aber häufig nichts mehr mit der "sauberen" Modellwelt von "rational" oder "informed choice" zu tun, sondern muss unter heftigsten Schmerzen, Zeitdruck und oft mit einem schlechten Gewissen erfolgen.
Dass die Schwangeren selbst unter diesen Umständen keine maximale Therapie oder Vollversorgung erwarten und für sich selber notwendig halten, wurde jetzt zum ersten Mal im Rahmen einer randomisierten experimentellen Studie in den USA mit insgesamt 256 durchschnittlich 24 Jahre alten Teilnehmerinnen nachgewiesen.
Anders als in der Geburtshilfe üblich, wurde die Entscheidung über die Dosis der Betäubungsmittel nicht mehr allein dem Narkosearzt überlassen, sondern zwei Drittel der gebärenden Frauen waren in unterschiedlicher Weise beteiligt. In einer Gruppe der dreiarmigen Untersuchung wurde die Periduralanästhesie durch eine kontinuierliche Infusion zweier Wirkstoffe durch den Anästhesisten verabreicht. Eine zweite Gruppe von Frauen konnte sich zusätzlich zu der kontinuierlichen Infusion bei Bedarf noch eine zusätzliche Wirkstoffdosis (sog. Bolusinjektion) einführen. In der dritten Gruppe bestimmten ausschließlich die Frauen wie oft sie wie viel Wirkstoffmengen benötigten und verabreichten sie sich dann auch durch eine entsprechend selbst zu bedienende technische Apparatur. Der Anästhesist kontrollierte bei den beiden letzten Gruppen lediglich, dass die gesundheitlich erträgliche Gesamtmenge nicht überschritten wurde.
Zu den Ergebnissen gehört erstens, dass keine der selbst bestimmenden Frauen die Betäubungsmittel überdosierte. Zweitens verabreichten sich diese Frauen aber sogar eine um 30 % geringere Betäubungsmittelmenge als ihren Mitgebärenden durch Anästhesisten verabreicht bekommen hatten und sogar eine um 46 % niedrigere Dosis als die Gebärenden mit kontinuierlicher plus Bolusinjektion.
Die gebärenden Frauen, welche die Betäubungsmittelinjektion allein bestimmten gaben etwas mehr Schmerzen als an die Frauen der beiden Vergleichsgruppen waren aber nach Meinung der Wissenschaftler zufriedener. Bei ihnen kam es schließlich auch seltener zu einer instrumentell gestützten Entbindung mit Saugglocke oder Zange.
Weitere Einzelheiten der auf der Jahrestagung der Society for Maternal-Fetal Medicine in San Francisco vorgestellten Studie von Michael Haydon et al. finden sich in dem Abstract Nr. 28 auf der Seite 13 des Kongressreaders (das Laden des Dokuments dauert relativ langsam, also nicht verzagen) und einer wesentlich schneller zugänglichen Presseerklärung zu dieser Präsentation.
Bernard Braun, 13.2.11
Darmkrebs-Screening: Entscheidungshilfen sind auch bei Personen mit geringem Bildungsstand nützlich, senken aber die Teilnahme.
 Die Beteiligung von Patienten an Entscheidungen über ihre Behandlung und die dafür notwendigen Informationen über den Nutzen verschiedener diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen durch den Arzt oder aus anderen Informationsquellen gehören sowohl zu einem modernen und oft mit höherer Wirksamkeit verbundenen Behandlungsverständnis (Stichwort: Patient als "Koproduzent") als auch zu den Erwartungen eines größer werdenden Teils der Patienten.
Die Beteiligung von Patienten an Entscheidungen über ihre Behandlung und die dafür notwendigen Informationen über den Nutzen verschiedener diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen durch den Arzt oder aus anderen Informationsquellen gehören sowohl zu einem modernen und oft mit höherer Wirksamkeit verbundenen Behandlungsverständnis (Stichwort: Patient als "Koproduzent") als auch zu den Erwartungen eines größer werdenden Teils der Patienten.
Zu den immer wieder identifizierten Barrieren des "shared decision making" gehören die Fähigkeit und Bereitschaft der Ärzte, ihre Patienten umfassend und nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu informieren aber auch die Fähigkeit und Bereitschaft vieler Patienten, diese Informationen zu verstehen und auf ihrer Basis eine Behandlungsentscheidung (mit) zu treffen.
Um diese Barrieren auf beiden Seiten abzubauen, wurden in den letzten Jahren für immer mehr Erkrankungssituationen so genannte "decision aids" entwickelt, mit denen im Idealfall alle Informationen vorliegen und stufenweise bis zu einer Entscheidung durchdacht werden können. Auch bei diesen Entscheidungsenthilfen war aber immer die Frage offen, ob formal gering gebildete Personen oder Patienten mit entsprechend geringem Grundwissen über Gesundheits- und Gesundheitssystemfragen wirklich in der Lage sind, alles zu verstehen und eine für sie gute Entscheidung zu treffen.
In einer randomisierten kontrollisierten Studie mit 572 Erwachsenen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren mit niedrigem Bildungsstand wurde nun untersucht, welche Wirkung eine speziell für das kognitive und sprachliche Niveau der Personen zugeschnittene "decision aid" auf das Wahlverhalten und die Inanspruchnahme eines Screeningprogramms für Dick- und Mastdarmkrebs hat. Die sämtlich zur Inanspruchnahme am Screening berechtigten Personen stammen aus mehreren Regionen des australischen Bundesstaates New South Wales, in dem eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht und es einen hohen Anteil ungelernter Tätigkeiten gibt.
Die Interventionsgruppe erhielt eine schriftliche interaktive (Frage-Antwort-Systematik) Broschüre und eine themenbezogene DVD, die beide Angaben zum quantitativen Risiko, an Darmkrebs zu erkranken und zu den Vorteilen aber auch möglichen Schäden durch das Screening enthielten. Hinzu wurde der mögliche Outcome des Tests auf okkultes Blut im Vergleich zu Personen dargestellt, die keinen Test durchgeführt haben. Die Kontrollgruppe erhielt das übliche, d.h. nicht weiter an den vermutlichen geringeren Kenntnissen der Personenm mit niedriger Bildung orientierte Informationsmaterial des nationalen Darmkrebsprogramms. Alle Materialien einschließlich der Teststreifen auf okkultes Blut wurden den TeilnehmerInnen direkt nach Hause geschickt.
Die Ergebnisse zeigten zum einen, dass es möglich ist, mit geeignetem Material und Methodiken auch Personen mit geringem Bildungs- und Wissensstand anzusprechen und ihnen zu einer informierten Wahlmöglichkeit zu verhelfen.
Dies zeigt sich in folgenden Punkten:
• Auf einer Wissenskala mit maximal 12 Punkten, erreichten die EmpfängerInnen der Entscheidungshilfe durchschnittlich 6,5 Punkte, die der Kontrollgruppe lediglich signifikant geringere 4,1 Punkte.
• Untersucht man, wie viele Angehörige der beiden Gruppen eine informierte Wahl getroffen haben, waren es in der "decision aid"-Gruppe 34 % und in der Standardgruppe 12 %.
• Schließlich gaben mehr, nämlich 51 % der Angehörigen der Entscheidungshilfe-Gruppe an, keine Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung Pro oder Contra ihrer Teilnahme am Screening gehabt zu haben als Angehörige der Standardgruppe, von denen dies nur 38 % angaben.
• Die Häufigkeit von genereller Angst vor Darmkrebs war in beiden Gruppen gleich.
Diesen Ergebnissen stehen aber auch ein paar deutlich andersgeartete Effekte der Entscheidungshilfe gegenüber:
• Die Einstellung gegenüber dem Screening auf okkultes Blut war bei 51 % der EmpfängerInnen der Entscheidungshilfe positiv. Bei den Angehörigen der Kontrollgruppe sagten dagegen 65 %, sie stünden diesem Test und seinem Sinn positiv gegenüber.
• Ähnlich sah es dann bei der tatsächlichen Beteiligungsrate aus: Während 59 % der Entscheidungshilfe-Gruppe den Screeningtest durchführte, waren es in der Kontrollgruppe signifikant mehr Personen, nämlich 65 %.
Angesichts der unerwartet niedrigeren Inanspruchnahmehäufigkeit des Darmkrebsscreenings in der Gruppe der Nutzer der Entscheidungshilfe und der offenen Frage, ob es sich dabei um einen "unerwünschten" Effekt handelt oder dies sogar positiv zu bewerten ist, schlagen die australischen ForscherInnen eine gründlichere Debatte über den Sinn und die Umstände von Screenings vor. Sie liefern dafür am Ende ihres Aufsatzes auch eine Reihe von inhaltlichen Hinweisen.
Der 13 Seiten umfassende Aufsatz "A decision aid to support informed choices about bowel cancer screening among adults with low education: randomised controlled trial" von Sian K Smith und anderen ist aktuell online im "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ 2010; 341:c5370) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Über die Anzahl (Ende Oktober 2010=306) und die Art der erhältlichen "decision aids" erfährt man alles in der speziellen "Cochrane decision aid registry".
Bernard Braun, 20.11.10
Blutdruckmessen und Hochdruckbehandeln: Können Patienten Teile dieser wichtigsten Allgemeinarzttätigkeiten erfolgreich übernehmen?
 Die in der Regel mit der ein- oder mehrmaligen Messung des Blutdrucks verbundene und begründete ICD-Diagnose I10 "essentielle (primäre) Hypertonie" bzw. der "Bluthochdruck" steht seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten auf Platz 1 der Hitliste der 50 häufigsten Diagnosen bei Allgemeinärzten und Internisten. Und selbst bei Augenärzten taucht diese Diagnose auf Platz 12 ihrer Diagnose-Hitliste auf.
Die in der Regel mit der ein- oder mehrmaligen Messung des Blutdrucks verbundene und begründete ICD-Diagnose I10 "essentielle (primäre) Hypertonie" bzw. der "Bluthochdruck" steht seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten auf Platz 1 der Hitliste der 50 häufigsten Diagnosen bei Allgemeinärzten und Internisten. Und selbst bei Augenärzten taucht diese Diagnose auf Platz 12 ihrer Diagnose-Hitliste auf.
In einer der immer noch seltenen differenzierten Analysen des inhaltlichen Geschehens in der ambulanten ärztlichen Versorgung wurden im ersten Quartal 2001 24,3 % aller Patienten von Allgemeinmedizinern und praktischen Ärzten wegen dieser Diagnose behandelt, 29,3 % aller Arztkontakte fanden deswegen statt, 29,9 % des angeforderten Leistungsbedarfs beruhte auf dieser Diagnose und je Patient gab es deswegen 4 Kontakte mit Primärärzten. Bis auf die Kontaktanzahl spielten alle anderen Diagnosen und zum Teil schwere symptomreiche Erkrankungen wie etwa Rückenschmerzen oder akute Infektionen der oberen Atemwege eine wesentlich geringere Bedeutung. 2008 verließen 23,5 % aller Patienten allgemeinärztlicher Praxen ihren Arzt nach einer Blutdruckmessung mit der Diagnose Bluthochdruck und 31,1 % aller Behandlungsfälle derselben Arztgruppe lag eine Bluthochdruckdiagnose zugrunde. Diese aus den Daten des ADT-Panels des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung der KBV (ZI) für Brandenburg und Nordrhein entnehmbaren Verhältnisse werfen u.v.a. die Frage auf, ob es sich dabei nicht zum Teil um eine Überversorgung, ja sogar zum Teil eine Fehlversorgung handelt und ein Teil dieses Geschehens vom Arzt und dem Praxisbetrieb wegverlagert werden kann. Ob vor allem einmalige Blutdruckmessungen durch den Arzt in großem Umfang zu iatrogenen Effekten führen, ist eine häufig aufgeworfene Frage zur Validität und Reliabilität (Wiederholbarkeit) der Diagnose eines der bedeutendsten Risikofaktoren.
Insofern sind die Ergebnisse einer großen randomisierten kontrollierten Studie zur Wirksamkeit des Selbstmanagements der Blutdruckmessung und -medikation im Rahmen eines ärztlichen Telemonitorings der gemessenen Blutdruckwerte von äußerst großer Bedeutung. Mit der zusätzlich obligatorischen elektronischen Fern-Überprüfung durch den Primärarzt sollen mögliche Messfehler, Interpretationsfehler der gemessenen Werte und eine falsche Medikation erkannt und verhindert werden.
Um dies zu untersuchen wurden 527 PatientInnen im Alter von 35-85 Jahren aus 24 Allgemeinarztpraxen in Großbritannien ausgesucht, die trotz einer Behandlung erhöhte Blutdruckwerte von 140/90 mm Hg und mehr hatten und gewillt waren, ihren Bluthochdruck selbst zu managen. Von den 480 endgültigen TeilnehmnerInnen wurden 234 der Selbstmanagementgruppe und 246 der Kontrollgruppe mit traditioneller Arzt- und Praxisversorgung zugeordnet. Die Effekte bzw. die Wirksamkeit wurde in allen Gruppen beim Start, nach 6 und nach 12 Monaten anhand des systolischen Druckwertes überprüft. Nach 6 (Differenz: 3,7 mm Hg) und nach 12 Monaten (Differenz: 5,4 mm Hg) lag der systolische Blutdruck in der Selbstmanagementgruppe statistisch signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe. Die Häufigkeit der meisten Nebenwirkungen unterschied sich zwischen den beiden Gruppen nicht, abgesehen von Beinschwellungen, die in der Selbstmanagementgruppe häufiger (32%) auftraten als in der Kontrollgruppe (22 %).
Zumindest ein Teil der Blutdruckmessungen und der Versorgung mit angemessenen Arzneimitteldosen könnten also ohne unerwünschte gesundheitliche Wirkungen bei Bluthochdruckpatienten mit unkomplizierten Erkrankungsverläufen außerhalb der Arztpraxis und von den PatientInnen selber durchgeführt werden. Dadurch könnte sowohl die international sehr hohe Anzahl von Arztkontakten reduziert werden als auch die für jeden Arzt-Patientkontakt zur Verfügung stehende Zeit deutlich über die gegenwärtige 8-Minuten-Marke hinaus verlängert werden.
Diese Erkenntnisse finden sich in dem am 8. Juli 2010 als "Early Online Publication" veröffentlichten Aufsatz "Telemonitoring and self-management in the control of hypertension (TASMINH2): a randomised controlled trial" von Richard McManus et al. im Medizinjournal "The Lancet", von dem leider nur das Abstract kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 8.7.10
Falsche Annahmen führen zu Skepsis gegenüber der Evidenzbasierten Medizin
 Evidenzbasierte Medizin zielt darauf ab, dass Patienten Entscheidungen treffen, nach dem sie die Evidenz bezüglich der für sie relevanten Behandlungsergebnisse mit ihren Präferenzen in Einklang gebracht haben. Eine gerade in der Zeitschrift Health Affairs erschienene Studie liefert Evidenz dafür, dass unter den Nutzern des amerikanischen Gesundheitssystems noch Annahmen und Vorstellungen weit verbreitet sind, die der Umsetzung einer evidenzbasierten Medizin im Wege stehen.
Evidenzbasierte Medizin zielt darauf ab, dass Patienten Entscheidungen treffen, nach dem sie die Evidenz bezüglich der für sie relevanten Behandlungsergebnisse mit ihren Präferenzen in Einklang gebracht haben. Eine gerade in der Zeitschrift Health Affairs erschienene Studie liefert Evidenz dafür, dass unter den Nutzern des amerikanischen Gesundheitssystems noch Annahmen und Vorstellungen weit verbreitet sind, die der Umsetzung einer evidenzbasierten Medizin im Wege stehen.
Die Wissenschaftler um Kristin Carman sammelten Daten mit Hilfe eines Methodenmix aus konventionellen Interviews, Fokusgruppeninterviews und einer webbasierten Befragung von 1.558 Nutzern des Gesundheitssystems.
Die Ergebnisse sind nicht einheitlich, zeigen aber, dass falsche Annahmen wie die folgenden, weit verbreitet sind:
• Mehr Behandlung ist besser als weniger Behandlung.
• Neue Behandlungsmethoden sind besser als alte Behandlungsmethoden.
• Was weniger kostet ist schlechter.
• Die besten Behandlungsmethoden sind auch die teuersten.
• Eine Behandlungen, die wenig Geld kostet, ist einer teuren Behandlung unterlegen.
Mit Begriffen wie medizinische Evidence, Leitlinien und Qualitätsstandards wussten viele Befragte wenig anzufangen.
Falsche Vorstellungen finden sich auch zur Versorgungsqualität. So meinen viele Befragte, dass alle Ärzte bestimmte Qualitätsstandards stets erfüllen und Behandlung unterhalb der Standards nicht möglich sei. Leitlinien werden als rigide Instrumente wahrgenommen, welche die Ärzte daran hinderten, ihre Erfahrung dem individuellen Patienten zukommen zu lassen.
Aus diesen und weiteren Ergebnissen folgern die Autoren: "Unsere Studie zeigt, dass es kritische Lücken im Wissen der Nutzer gibt, die unsere Anstrengungen behindern, die Nutzer zu einer evidenzbasierten Gesundheitsversorgung zu ermutigen." Es gebe aber auch ermutigende Zeichen: "Eine kleine aber signifikante Minderheit der Befragten stimmt den grundlegenden Annahmen der evidenzbasierten Versorgung zu und möchte sich aktiv und informiert an Entscheidungen beteiligen, die sie selbst betreffen."
Auf Grundlage dieser Ergebnisse haben die Wissenschaftler einen Werkzeugkasten mit Lehr- und Informationsmaterialien entwickelt.
Carman KL, Maurer M, Yegian JM, Dardess P, McGee J, Evers M, et al. Evidence That Consumers Are Skeptical About Evidence-Based Health Care. Health Affairs 2010:hlthaff.2009.0296. Download Volltext
American Institutes for Research. The communication toolkit: using information to get high quality care Website
David Klemperer, 3.6.10
HealthNewsReview.org - Vorbildliche Website bewertet Medienberichte zu Medizin und Gesundheit
 5 Sterne für "Asprin könnte das Rezidiv-Risiko für Frauen mit Brustkrebs mindern", 1 Stern für "Das Hormon Oxytocin könnte Patienten mit Asperger-Syndrom helfen". Wie diese Bewertungen von Presseberichten zustande kommen, erfahren Sie auf der Website HealthNewsReview.org.
5 Sterne für "Asprin könnte das Rezidiv-Risiko für Frauen mit Brustkrebs mindern", 1 Stern für "Das Hormon Oxytocin könnte Patienten mit Asperger-Syndrom helfen". Wie diese Bewertungen von Presseberichten zustande kommen, erfahren Sie auf der Website HealthNewsReview.org.
Die Betreiber der Website wollen die Genauigkeit von Medienberichten über medizinische Behandlungen, Untersuchungen und Produkte verbessern. Ziel ist es, den Nutzer unverzerrte, ausgewogene Informationen über Gesundheitsthemen zu vermitteln, damit sie Entscheidungen auf Grundlage der besten Evidenz treffen können. Journalisten sollen dazu angespornt und darin unterstützt werden, ihre Berichte anhand wohldefinierter Qualitätskriterien zu verfassen.
Dafür screent ein multidisziplinäres Team ein breites Spektrum von Tageszeitungen und Nachrichtendiensten und beurteilt die Qualität der Berichte nach einem standardisierten Bewertungssystem, das aus 10 Kriterien besteht. Je nach Bewertung werden zwischen 0 und 5 Sterne vergeben
Herausgeber der preisgekrönten Website ist Gary Schwitzer, Professor an der Abteilung für Journalismus und Massenkommunikation der University of Minnesota.
Finanziert wird die Website von der Foundation for Informed Medical Decision Making, einer non-profit-Organisation, die sich der Verbreitung von Shared Decision-Making widmet.
In der Liste der unabhängigen Experten finden sich prominente Namen, die aufmerksamen Lesern aus Berichten im Forum Gesundheitspolitik bekannt sein dürften, wie Marcia Angell, Lisa Bero, Adriane Fugh-Bergman und Steven Woloshin.
David Klemperer, 21.2.10
Wie entscheiden sich Patienten für oder gegen Therapien und welche Rolle spielen dabei Entscheidungshilfen? Das Beispiel Tamoxifen
 Wie viele Frauen mit einem relativ hohem Risiko, innerhalb der nächsten 5 Jahre an primärem Brustkrebs zu erkranken, versuchen dieses Risiko durch die Einnahme des nachweislich wirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Wirkstoffs Tamoxifen (vgl. genauere pharmakologische und sonstige Angaben mit hervorragenden und hilfreichen Links in der umfassend aufgebauten Datenbank "ChemIDplus lite" der US-National Library of Medicine) zu verringern bzw. eine Erkrankung zu vermeiden?
Wie viele Frauen mit einem relativ hohem Risiko, innerhalb der nächsten 5 Jahre an primärem Brustkrebs zu erkranken, versuchen dieses Risiko durch die Einnahme des nachweislich wirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Wirkstoffs Tamoxifen (vgl. genauere pharmakologische und sonstige Angaben mit hervorragenden und hilfreichen Links in der umfassend aufgebauten Datenbank "ChemIDplus lite" der US-National Library of Medicine) zu verringern bzw. eine Erkrankung zu vermeiden?
Wie entscheiden sie sich, wenn ihnen umfassende, wissenschaftliche ausgewogene und verständliche Informationen über ihr individuelles Erkrankungsrisiko, das Pro und Contra zu den Wirkungen des Wirkstoffs und die positiven wie negativen Wirkungen des Verzichts, ihn einzunehmen, mittels einer maßgeschneiderten Entscheidungshilfe ("tailored decision aid") im Rahmen einer "informed decision making"-Behandlung zur Verfügung gestellt werden?
Der Hintergrund dieser Fragen ist, dass einerseits nach Angaben des "National Cancer Institute" der USA in mehreren seit 1998 durchgeführten Brustkrebs-Präventionsstudien bei Frauen, die ohne Vorerkrankung also präventiv ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tamoxifen eingenommen hatten, eine geringere Inzidenz von Brustkrebs nachgewiesen wurde. Andererseits nehmen aber schätzungsweise von den allein in den USA lebenden 10 Millionen Frauen, die etwas von der Wirkung dieser Präventionsmaßnahme haben könnten, nur wenige Tamoxifen ein.
Ob dies an Informationsmängeln oder dem Fehlen verständlicher und ausgewogener Information liegt, wollte nun erstmals ein Wissenschaftlerteam in den USA genauer wissen.
Dazu wählten sie auf Basis von medizinischen Daten in zwei Krankenversicherungen in Michigan und im Bundesstaat Washington die Frauen im Alter von 40 bis 74 Jahren aus, die zur Zielgruppe der Prophylaxe gehören und für die ein erhöhtes 5-Jahresrisiko für Brustkrebs berechnet werden konnte. Vorgeklärt wurde ferner, ob Tamoxifen nicht evtl. durch sonstige Erkrankungen kontraindiziert wäre.
Von den zunächst als mögliche Teilnehmerinnen mit einem Einladungs- und Informationsschreiben angesprochenen 8.896 Frauen blieben nach weiteren Überprüfungen ihrer Eignung für die Studie noch 632 Teilnehmerinnen übrig. Sie waren durchschnittlich 59 Jahre alt, weiß und gut ausgebildet.
Jede Teilnehmerin erhielt im Rahmen der Studie eine Online-Information zur Quantität ihres Erkrankungsrisikos, der Risiken der Einnahme aber auch der Nichteinnahme von Tamoxifen, die bis in Details auf ihre Person zugeschnitten war. Die VerfasserInnen wollten die Leserinnen ausdrücklich nicht überzeugen, Tamoxifen einzunehmen, sondern ihnen lediglich ausgewogene evidente Informationen zur Entscheidungsfindung liefern. Nachdem die Teilnehmerinnen die Entscheidungshilfe gelesen hatten wurden sie nach ihren Verhaltensabsichten gefragt. Nach 3 Monaten folgten Fragen zum tatsächlichen Verhalten bis zu diesem Zeitpunkt, nach dem Wissensstand und nach Gründen für die Nichteinnahme des Wirkstoffs.
Dabei gab es eine Reihe interessanter Ergebnisse, die in dieser Qualität erstmalig erhoben worden sind:
• Nach der ersten Lektüre der Entscheidungshilfe wollten 28,8% der Teilnehmerinnen sich nach weiteren Informationen umsehen, die sie zum Teil durch Links in dem Hilfetext leicht erreichen konnten. 29,5 % wollten darüber mit ihrem Arzt reden. Nur 5,8% gaben aber an, sie würden innerhalb des folgenden Jahres mit der Einnahme von Tamoxifen beginnen. Dies waren sogar weniger als bei Frauen, die keine derartige Informationsbasis besaßen.
• Es gab einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten Risikoniveau (abgebildet mit dem so genannten Gail score) und dem Wunsch mit einem Arzt über mögliche Behandlungsschritte zu reden. Keine Assoziation gab es aber zwischen dem Risikoniveau und der Absicht, weitere Informationen zum Wirkstoff zu suchen.
• Nach 3 Monaten hatten 0,9% (n=3) der Teilnehmerinnen mit der Einnahme von Tamoxifen begonnen, 5,8 % hatten mit ihrem Arzt geredet und 5,4% hatten nach weiteren Informationen gesucht. Selbst Frauen mit dem höchsten Risikowert suchten zwar etwas häufiger nach Informationen oder redeten mit ihrem Arzt, aber mehr als 10,6% und nochmals 10,6% waren dies nicht. Die große Mehrheit reagierte nicht auf die Informationen der Entscheidungshilfe.
• Als einen Grund für die geringe Anzahl von Teilnehmerinnen mit Reaktionen und Folgeaktivitäten nennen die WissenschaftlerInnen das trotz umfassender Information relativ geringe Wissensniveau vieler Angehörigen der Interventionsgruppe: Alles in Allem beantworteten die Teilnehmerinnen 4,31 der 6 Wissensfragen korrekt. 63% von ihnen beantworteten mindestens 5 Fragen korrekt und 41,4% gaben ausschließlich richtige Antworten. Nur 3% beantworteten aber sämtliche Fragen falsch und stellten interessanterweise einen überproportionalen Anteil an der Gruppe von Frauen, die Tamoxifen einnehmen wollten.
• 81% der Frauen wussten dabei genau, dass der Wirkstoff ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, präventiv beeinflussen kann.
• Gut ein Drittel waren schließlich noch daran interessiert mehr über das Risiko und den Nutzen von Brustkrebs und Tamoxifen zu lernen.
• Da es unmöglich ist, mit den 3 TeilnehmerInnen, die nach der Intervention Tamoxifen einnahmen, differenzierte Analysen über mögliche Ursachen durchzuführen, gaben die ForscherInnen lediglich plausible Hinweise auf die Rolle subjektiver Erwartungen über die Risiken und den Nutzen von Tamoxifen. Hinzu kamen bei 80% der TeilnehmerInnen, die den Wirkstoff nicht einzunehmen beabsichtigten, Sorgen über seine Nebenwirkungen, 58,8% bewerteten den Nutzen nicht so hoch, dass er die Risiken aufwiegen könnte und zwischen 20 und 40% dieser Gruppe hielten viele Umstände einer Arzneimitteltherapie persönlich nicht für ertragbar.
Selbst bei einer so großen Anzahl von Studienteilnehmerinnen und nach dem erstmaligen Einsatz einer maßgeschneiderten Risiko- und Nutzeninformation waren also "many women at elevated risk … unwilling to accept the risks of tamixofen to reduce their breast cancer risk."
Die Studie liefert eine Reihe Einblicke in die wirkliche relative Bedeutung von evidenten und gut aufbereiteten Informationen für Entscheidungen von Gesunden und PatientInnen über medizinische Interventionen. Bemerkenswert ist die insgesamt geringe handlungsauslösende oder -steuernde Rolle der Ressource Wissen bzw. die bereits in anderem Zusammenhang beobachtete deutliche Differenz zwischen dem Interesse an "mehr Informationen", Handlungsabsichten und tatsächlichem Handeln. Weitere empirische Belege hierfür finden sich z.B. in dem Forums-Beitrag "Wissen=Handeln?". Diese Differenz ist für all jene Studien und Interventionsprojekte wichtig, die sich ausschließlich an Informations- oder Handlungsinteressen und -absichten orientieren und dabei riskieren, dass ihre Intervention quantitativ wenig genutzt wird oder wirkungslos verpufft. Lehrreich sind die Ergebnisse dieser Studie auch für jene, die beabsichtigen, optimale Versorgungsziele per informationsorientierten Entscheidungshilfen bzw. "decision aids" zu erreichen.
Da die Studie weder für andere ethnischen Gruppen und auch nicht für Frauen mit anderen Bildungsabschlüssen Gültigkeit besitzen kann, wird erst eine repräsentative Studie, dann aber auch gleich mit Kontrollgruppe, zeigen können, wie sich Entscheidungshilfen in einer Normalbevölkerung auswirken.
Die konkrete 48-seitige Entscheidungshilfe Tamoxifen und Brustkrebs ist für diejenigen, die sich für diese Form der patientenorientierten Entscheidungshilfe interessieren, kostenlos erhältlich.
Zum Aufsatz "Women's decisions regarding tamoxifen for breast cancer prevention: responses to a tailored decision aid" von Angela Fagerlin et al. in der Fachzeitschrift "Breast Cancer Research Treatment" (12. November 2009 - elektronische Vorabveröffentlichung) gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 6.1.10
Patienten wählen bei therapeutischen Entscheidungen meist weniger riskante Optionen, wenn sie allein entscheiden sollen
 Stadtbewohner an vielbefahrenen Straßen, so hat unlängst eine psychologische Studie festgestellt, schätzen die mit dem Autofahren verbundenen Risiken sehr viel höher ein als Landbewohner. Die norwegischen Wissenschaftler haben dieses Ergebnis so interpretiert, dass Landbewohner meist keine andere Alternative haben als mit dem Auto in die Stadt zu kommen und sich dort motorisiert zu bewegen. Stadtbewohner hingegen könnten ihr Auto in der Garage lassen und mit Bus oder Bahn fahren. Dieses größere Maß an Entscheidungsfreiheit führt dann aber auch dazu, dass Risiken höher eingestuft werden. Ähnliche gedankliche Prozesse, so führen die beiden Wissenschaftlerinnen Liana Fraenkel und Ellen Peters aus Connecticut und Oregon jetzt in einer Veröffentlichung aus, vollzieht sich möglicherweise auch bei Entscheidungssituationen in ärztlichen Praxen vom Typus "Shared Decision Making".
Stadtbewohner an vielbefahrenen Straßen, so hat unlängst eine psychologische Studie festgestellt, schätzen die mit dem Autofahren verbundenen Risiken sehr viel höher ein als Landbewohner. Die norwegischen Wissenschaftler haben dieses Ergebnis so interpretiert, dass Landbewohner meist keine andere Alternative haben als mit dem Auto in die Stadt zu kommen und sich dort motorisiert zu bewegen. Stadtbewohner hingegen könnten ihr Auto in der Garage lassen und mit Bus oder Bahn fahren. Dieses größere Maß an Entscheidungsfreiheit führt dann aber auch dazu, dass Risiken höher eingestuft werden. Ähnliche gedankliche Prozesse, so führen die beiden Wissenschaftlerinnen Liana Fraenkel und Ellen Peters aus Connecticut und Oregon jetzt in einer Veröffentlichung aus, vollzieht sich möglicherweise auch bei Entscheidungssituationen in ärztlichen Praxen vom Typus "Shared Decision Making".
Wenn in solchen Situationen, in denen eine Therapieentscheidung ansteht, dies völlig dem Patienten überlassen wird, entscheidet er sich meist konservativ und wählt weniger riskante (unter Umständen aber auch weniger effektive) Behandlungsmethoden. Gibt der Arzt hingegen direkt oder indirekt den Hinweis, man könne durchaus auch die riskantere Therapie wählen, so entscheiden sich sehr viel mehr Patienten dementsprechend.
Diese Befunde stammen aus einem Experiment, das die Wissenschaftler mit 216 Besuchern einer Klinik mit ambulanter Behandlungs-Station durchführten. Das Durchschnittsalter betrug knapp 60 Jahre, etwa 60% waren Frauen, es handelte sich überwiegend (70%) um Weiße.
Den Studienteilnehmern wurde eins von zwei unterschiedlichen Videos gezeigt, in denen ein Arzt erläutert, es gäbe jetzt für Patienten mit rheumatischen Erkrankungen ein neues Medikament. Im ersten Video war dies ein Arzneimittel zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im zweiten Video eins zur Behandlung chronischer Schmerzen. In beiden Fällen wurde das Medikament sehr positiv charakterisiert: Überaus effektiv in der Wirkung, nur eine Tablette pro Tag ist einzunehmen, Krankenkasse kommt voll für die Kosten auf. Nur ein negativer Aspekt sei zu berücksichtigen: In extrem seltenen Fällen käme es zu unangenehmen, problematischen Nebenwirkungen. Dabei wurde entweder eine Nekrose (fortlaufende Zellzerstörung) im Zahnkiefer genannt oder eine Leukenzephalopathie (Erkrankung des Zentralen Nervensystems mit motorischen und kognitiven Störungen). Das Auftreten solcher Nebenwirkungen sei jedoch überaus selten, das Risiko also sehr gering. Diese niedrige Wahrscheinlichkeit wurde in der Studie unterschiedlich beschrieben, teilweise quantitativ ("1 von 100.000 ist betroffen"), teilweise qualitativ ("extrem selten"), teilweise mit alltagspraktischen Beispielen ("eine Person von all jenen, die in den größten Uni-Hörsaal passen").
Dann wurden die Studienteilnehmer wieder per Zufall in zwei Gruppen unterteilt, die verschiedene Instruktionen erhielten. Entweder wurde gesagt
• (A) "Ihr Arzt hat sich dafür entschieden, dass Sie dieses Medikament einnehmen sollten und ein Rezept ausgestellt." Oder es wurde mitgeteilt:
• (B) "Ihr Arzt hat Ihnen gesagt, dass es vollständig Ihnen überlassen bleibt, ob Sie das Medikament einnehmen und bittet Sie um eine Entscheidung."
Alle Teilnehmer wurden dann gebeten, wie wahrscheinlich es sei, dass sie das Medikament einnehmen würden. Dies war auf einer 11stufigen Skala von 0 (extrem unwahrscheinlich) bis 10 (extrem wahrscheinlich) anzugeben. Ebenso sollten sie auf einer solchen Skala angeben, wie groß ihre Sorgen oder Befürchtungen wegen der potentiellen Nebenwirkungen seien.
Es zeigte sich dann:
• Die Bereitschaft zur Einnahme des Medikaments war niedriger, wenn der Betroffene dies allein entscheiden sollte (A) und höher, wenn man dem Rat des Arztes folgte (B). Die Mittelwerte lagen hierbei um etwa einen Skalenpunkt auseinander.
• Ähnlich waren die Sorgen oder Befürchtungen wegen der Nebenwirkungen höher in der Situation (A)
• Diese Unterschiede in der Risikobewertung bestätigten sich in einer multivariaten Analyse, in der verschiedene potentielle Einflussfaktoren (Alter, Geschlecht, Bildung, Art der Risiko- bzw. Nebenwirkungs-Angabe) kontrolliert wurden.
Die Studie ist insofern für die Diskussion des Konzepts "Shared Decision Making" von Bedeutung, als sie aufzeigt, dass Patienten oftmals weniger riskanten Behandlungsmethoden den Vorzug geben, dabei unter Umständen aber auch weniger effektive Therapien bevorzugen - und zwar dann, wenn der Arzt ihnen die Entscheidung allein überlässt. Die Autorinnen betonen daher, dass es überaus wichtig sei, Patienten umfassend über Vor- und Nachteile von Therapien zu informieren.
Hier ist ein Abstract der Studie: Liana Fraenkel, Ellen Peters: Medical Decision Making - Patient responsibility for medical decision making and risky treatment options (Arthritis Care & Research, Volume 61, Issue 12, Pages 1674-1676)
Gerd Marstedt, 1.12.09
Shared Decision Making: Partizipative ärztliche Kommunikation stärkt bei Krebspatienten die psychische Gesundheit
 Ärztliche Kommunikation, die auf die Bedürfnisse von Patienten eingeht, zu Fragen ermuntert, ausführlich und ohne Zeitdruck über unterschiedliche Behandlungs-Optionen, ihre Vor- und Nachteile informiert, zeigt bei Krebspatienten nachhaltige Verbesserungen in Bezug auf verschiedene Aspekte psychischer Gesundheit wie Selbstwirksamkeits-Erwartungen, Kontrolle über die Krankheit oder psychisches Wohlbefinden.
Ärztliche Kommunikation, die auf die Bedürfnisse von Patienten eingeht, zu Fragen ermuntert, ausführlich und ohne Zeitdruck über unterschiedliche Behandlungs-Optionen, ihre Vor- und Nachteile informiert, zeigt bei Krebspatienten nachhaltige Verbesserungen in Bezug auf verschiedene Aspekte psychischer Gesundheit wie Selbstwirksamkeits-Erwartungen, Kontrolle über die Krankheit oder psychisches Wohlbefinden.
Diese Ergebnisse einer empirischen Studie von Patienten, bei denen man vor 2-5 Jahren Krebs diagnostiziert hatte (Leukämie, Darm- oder Blasenkrebs), wurden jetzt von US-amerikanischen Wissenschaftlern in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht. Die Befunde basieren auf Befragungen von 623 Krebspatienten aus nordkalifornischen Kliniken, die einige Jahre nach der Erstdiagnose noch lebten. Etwa die Hälfte der angeschriebenen Patienten beteiligte sich auch an der Befragung.
Zunächst wurde überprüft, ob bei ihnen innerhalb der letzten 12 Monate bestimmte medizinische Entscheidungen gefällt worden waren, sei es über diagnostische Tests, über Änderungen bei Medikamenten oder grundsätzliche Änderungen in der Therapie. Dies war bei fast zwei Dritteln von ihnen (63%) der Fall. Diese Gruppe wurde dann ausführlich über den Kommunikationsstil des Arztes im Rahmen dieser Entscheidung befragt und seine Bereitschaft, den Patienten an der Entscheidung zu beteiligen. Fragen hierzu waren etwa: Hat der Arzt alle Optionen so erklärt, dass man sie verstehen konnte? Hat er dazu ermuntert, Fragen zu stellen? Ermuntert, Ängste oder Unsicherheiten hinsichtlich der Informationen dazulegen? Den Patienten so an der Entscheidungsfindung beteiligt, wie dieser es gewünscht hat?
Die Auswertung dieser Antworten ergab dann ein erstes überraschendes und für die an der Studie beteiligten Ärzte (Allgemeinärzte, Onkologen, andere Fachärzte) problematisches Ergebnis: Nur etwa die Hälfte der Ärzte (54%) hatte ein solches Maß an (stärker oder schwächer ausgeprägter) Entscheidungsbeteiligung gezeigt, wie die Patienten es sich gewünscht hatten.
In weiteren Fragen der Erhebung wurden bei den Patienten dann potentielle Auswirkungen auf die psychische Gesundheit überprüft. Insgesamt wurden in Fragenbatterien sechs verschiedene Aspekte erfasst: Selbstwirksamkeitserwartung, Vertrauen in den Arzt, emotionale Kontrolle über die Krankheit, Ängste und Ungewissheit über den Krankheitsverlauf, Selbsteinschätzung des körperlichen Gesundheitszustands, Einschätzung des psychischen Wohlbefindens.
In verschiedenen statistischen Analysen zeigte sich dann, dass mit Ausnahme des körperlichen Gesundheitszustands alle übrigen abhängigen Variablen sehr deutlich vom Kommunikationsverhalten des Arztes beeinflusst waren, genauer gesagt davon, ob er den Patienten in dem Maße in die zurückliegende medizinische Entscheidung einbezogen hatte, wie dieser es sich gewünscht hatte. Zwei Mechanismen erscheinen den Wissenschaftlern im Rahmen von Shared Decision Making besonders bedeutsam: Die Verstärkung der Selbstwirksamkeits- und Kontrollerwartungen der Patienten zum einen sowie die Stärkung des Vertrauens und Reduzierung von Ungewissheit zum anderen.
Zwar findet sich kein direkter Effekt der Partizipation auch auf den körperlichen Gesundheitszustand der Krebspatienten, dies wäre nach Ansicht der Forscher aufgrund der Vielzahl von potentiellen Einflussfaktoren (Alter und Morbidität der Patienten, gewählte Therapie, Krebsstadium bei der Diagnose etc.) auch eher überraschend. Dass aber zumindest die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Patienten deutlich verbessert wird, erscheint durchaus relevant. Dies umso mehr, als nur etwa die Hälfte der Ärzte das gewünschte Kommunikations- und Informationsverhalten an den Tag legte.
Hier ist ein Abstract der Studie: Neeraj K. Arora et al: Physicians' decision-making style and psychosocial outcomes among cancer survivors (Patient Education and Counseling, doi: 10.1016/j.pec.2009.10.004, Article in Press)
Gerd Marstedt, 11.11.09
Was halten Ärzte von "shared decision making" und "decision aids" und warum nutzen sie sie nicht intensiver?
 Trotz einer mittlerweile weltweit immer intensiver geführten Debatte über das Konzept des "informed" und "shared decision making" (SDM) in medizinischen Behandlungen und der damit verbundenen Veränderung einer dominant paternalistischen zu einer partizipativen Patient-Arzt-Beziehung, gibt es relativ wenig Informationen über die Implementation dieser neuen Kultur bzw. darüber welche Faktoren SDM fördern oder hemmen.
Trotz einer mittlerweile weltweit immer intensiver geführten Debatte über das Konzept des "informed" und "shared decision making" (SDM) in medizinischen Behandlungen und der damit verbundenen Veränderung einer dominant paternalistischen zu einer partizipativen Patient-Arzt-Beziehung, gibt es relativ wenig Informationen über die Implementation dieser neuen Kultur bzw. darüber welche Faktoren SDM fördern oder hemmen.
Zwei Studien aus den USA und Kanada verringern den Mangel an Wissen zumindest über die Verhältnisse bei Ärzten zu einem gewissen Teil.
Eine von der "Foundation for Informed Medical Decision Making (FIMDM)" in Auftrag gegebene, inhaltlich gut vorbereitete (u.a. durch 11 Intensivinterviews mit Primärärzten) und von "Lake Research Partners" 2008 durchgeführte USA-weite Interview-Befragung von 402 Primärärzten liefert eine Vielzahl von bisher so nicht bekannten Daten.
Die Hauptergebnisse des Surveys lauten:
• Zunächst die guten Nachrichten: Für 93% der befragten Ärzte hört sich SDM (definiert als Prozess in dem "the doctor provides the patient with balanced information about treatments options, and incorporates patient preferences and values into the medical plan") nach einem positiven Prozess an. Nur 2% sehen darin einen negativen Prozess.
• 81% schätzen SDM als potenziell hilfreich zur Veränderung von Lebensstilen und 80% sehen dies in Bezug auf das Management chronischer Erkrankungen. 90% glauben außerdem, dass SDM potenziell (!) helfen kann die Einnahme von verordneten Arzneimitteln zu sichern und für 76% wird dadurch auch die Verordnung von Medikamenten mit unbewiesener Wirkung vermieden.
• Und nun die schlechten News: Den hohen Werten beim potenziellen Nutzen steht aber eine wesentlich geringere Bewertung der tatsächlichen Wirkung gegenüber: Nur noch 40% der befragten Ärzten sagen nämlich, dass SDM tatsächlich den Patienten beim Umgang mit ihrer Erkrankung hilft; 35% nennen noch eine tatsächliche Verbesserung der Befolgung von Einnahmehinweisen und nur noch 26% glauben, dass mit SDM die Verordnung unnützer Medikamente vermieden werden könne.
• Kleiner werden die Zahlen auch, als die Ärzte nach ihrem tatsächlichen Einsatz von SDM gefragt wurden: 58% sagen, sie würden dies machen, wenn es um Veränderung von Verhalten der Patienten ginge, 51% machen dies bei Operationen, 47% bei chronisch Erkrankten oder 42% bei der Verordnung neuer Arzneimittel.
• Die Frage nach den Gründen oder Barrieren, die Ärzte von einem häufigeren Einsatz von SDM abhalten, fördert eine breite Palette zu Tage: 67% halten die Bezahlung für den höheren Aufwand von SDM für unzulänglich, 94% sagen, sie hätten zu wenig Zeit für SDM, 45% haben Angst vor möglichen gerichtlichen Klagen und 33% geben an, dass es ihnen schwer fällt, immer auf dem aktuellen Stand der klinischen Forschung zu sein. Nur 26% der Ärzte verneinen, dass eine Vorliebe für Patienten, die sich auf die ärztlichen Empfehlungen verlassen eine Barriere für die Realisierung von SDM ist. Für 4% ist diese Einstellung eine große und für 70% zumindest eine kleine Barriere. 96% sagen in unterschiedlicher Intensität, dass die Schwierigkeiten von Patienten, alles zu verstehen was sie wissen müssten, eine Realisierungsbarriere wäre. Rund 50% der Ärzte sahen auch die Gefahr, dass SDM die Häufigkeit unnötiger Tests und Behandlung erhöhe. 84% (darunter 13% besonders stark) halten einen Mangel an verlässlichen Informationen für Patienten als eine Barriere für SDM an. In dieselbe Richtung zielt die Angst vor dem möglichen Zugang der Patienten zu "bad information" oder die vor dem möglichen Einfluss von Familienangehörigen und Freunden (dies sagen 13% der Ärzte).
• Am Rande auffällig ist, dass zwischen 80 und 90% der Ärzte gut informierte Patienten am meisten schätzen, sich aber zugleich darüber "ärgern", dass selbst bei Krebstests höchstens 20% der Patienten gut vor-informiert sind.
Für die sicherlich nicht einfache Vorbereitung und Durchführung der gemeinsamen Entscheidungsfindung gibt es seit längerem schriftliche und in der Regel evidenzbasierte Instrumente, die so genannten "decision aids"(DA) (Fragenerläuterung: "Patient decision aids do note advise people to choose one treatment option over another, nor are they meant to replace practitioner consultation. Instead, they prepare patients to make informed, values-based decisions with their practitioner").
Wie deren Einsatz im Versorgungsalltag der us-amerikanischen "primary care"-Ärzte aussieht, wurde im zweiten Teil des FIMDM-Survey erhoben:
• 43% der Ärzte sagen, sie hätten gegenwärtig Zugang zu den verschiedenen Typen von DA. Dieser Anteil betrug in multidisziplinären Gruppenpraxen 55% und in Einzelpraxen 41%.
• Bei DAs halten 60% den möglichen Nutzen für einen zunehmenden Patientenkomfort für wichtig, 53% sehen damit die Möglichkeit geschaffen mehr Zeit für Diskussionen über die Ziele und Anliegen der Patienten zu haben und 53% sehen dies bezogen auf unnötige Tests und Behandlungen.
• 96% der Ärzte zeigen den Willen, DAs in ihrer Praxis zu nutzen "if the aids met their standards". Dazu gehört offensichtlich auch die Billigung und Unterstützung durch fachliche Autoritäten. So sagen 48% der Befragten, sie würden DA verstärkt einsetzen, wenn sie von den nationalen Medizingesellschaften genehmigt wären. Wenn diese Genehmigung durch unabhängige nicht gewinnorientierte Akteure erfolgte, würden noch 32% der Ärzte DA einsetzen. Sofern hier Regierungseinrichtungen oder Pharmafirmen aktiv würden, sinkt die Bereitschaft der Ärzte zum Einsatz auf 18% bzw. 2%.
• Natürlich fehlt auch hier fehlende Bezahlung nicht als Hinderungsgrund: 63% würden mehr am Einsatz von DAs interessiert sein, wenn ihnen die zusätzlich für Patientengespräche notwendige Zeit vergütet würde. 24% der rzte zeigten sich ferner am Zugang zu einem externen Beratungsservice für Entscheidungen mit dafür qualifizierten "health coachs" interessiert.
Natürlich können die bei us-amerikanischen Ärzten erhobenen Verhaltensweisen und Nutzungsbarrieren nicht vollständig auf Ärzte in anderen Gesundheitssystemen übertragen werden, also auch nicht auf die deutschen niedergelassenen oder Krankenhausärzte. Trotzdem erscheint es plausibel, dass deren Bewertung und Nutzung von SDM nicht fundamental anders aussieht.
Die umfängliche zusammenfassende Veröffentlichung (Grundauszählung der Daten als Anhang) der Befragung "Informing and Involving Patients in Medical Decisions: The Primary Care Physicians' Perspective. Findings from a National Survey of Physicians" aus dem Februar 2009 gibt es kostenlos auf der Website der Stiftung.
Dass es sich bei den Ergebnissen des FIMDM-Surveys zumindest im Bereich der Nutzung von decision aids mit Sicherheit nicht um ein singuläres, nur für die USA gültiges Ergebnis handeln dürfte, zeigen die Ergebnissen einer bereits 2007 veröffentlichten Befragungsstudie kanadischer Familienärzte, Geriater und Lungenfachärzte.
Dieser Studie lag explizit die Gewissheit zugrunde, dass es genügend Evidenz (darunter auch den zuletzt 2006 aktualisierten Cochrane Review "Decision aids for people facing health treatment or screening decisions" von O'Connor et al. aus dem Jahr 2003) gibt, dass "decision aids" Schlüsselindikatoren für die Qualität der Entscheidungen von Patienten verbessern.
Recht wenig wusste man aber trotzdem auch in Kanada über die Akzeptanz der DA's bei den Ärzten oder die Faktoren, die die Entscheidungen beeinflussen, sie zu nutzen oder nicht.
Um darüber mehr zu erfahren befragte ein ForscherInnenteam 580 Ärzte aus den drei genannten Facharztgruppen zu ihren Auffassungen zu drei DA's zur Hormonersatztherapie für Frauen in der Menopause, zu einer Form künstlicher Ernährung bei kognitiv eingeschränkten älteren Menschen und zu mechanischer Beatmung bei an COPD erkrankten Patienten am Ende ihres Lebens, erhielten von270 oder 47% auch eine Antwort und befragten diese drei Monate nach der Erstbefragung über ihren aktuellen Gebrauch von DA's.
Die Empfindungen und Bewertung der DA's und die Absichten sie zu nutzen sahen folgendermaßen aus:
• Mehr als 85% der antwortenden Ärzte nahmen die DA's als gut entwickelt wahr und meinten, sie präsentierten wesentliche Informationen für den Entscheidungsprozess in einer verständlichen, ausgewogenen und unverzerrten Weise.
• Eine Mehrheit von ihnen, über 80%, waren auch fest davon überzeugt, dass die DA's die Patienten in einer logischen Weise führten und sie gut präparierten, am Entscheidungsprozess teilzunehmen und eine Entscheidung zu erreichen.
• Weniger als 60% waren aber noch davon überzeugt, dass die DA's die Qualität der Patientenbesuche beim Arzt verbessern würden oder einfach in den Praxisalltag zu implementieren wären.
• Und nur noch sehr wenige, nämlich 27% gaben an, sie sähen es als möglich an, mit DA's Zeit zu sparen.
Die Absicht der Ärzte die derartig positiv aufgefassten DA's auch tatsächlich zu verwenden hingen vom Komfort ab mit dem sie sie den Patienten anbieten können, vom speziellen Inhalt des DA und der angenommenen Einfachheit, sie in die Behandlungspraxis einzubauen.
54% der Befragten kündigten dennoch bei der ersten Befragung an sie würden DA's in den folgenden drei Monaten zu nutzen versuchen. Bei der zweiten Befragung, also nach 3 Monaten, machten dies aber tatsächlich nur 32% der Ärzte (n=99), die sie verbal so positiv wahrgenommen hatten. Bei den kanadischen Ärzten besteht also ein großer Unterschied zwischen Absicht und tatsächlichem Verhalten.
Weitere Forschungsarbeiten werden aber notwendig sein die Determinanten dieses "intention-behaviour gap" zu erkunden und Interventionen oder Maßnahmen zu entwickeln, die auf die Barrieren zielen, welche den Einsatz von DA's bei der Mehrheit der Ärzte verhindern.
In der Diskussion ihrer Ergebnisse geben die AutorInnen einen knappen Überblick zu vergleichbaren aber auch gegenläufigen Forschungsergebnissen. In vergleichbaren Studien gibt es demnach Hinweise auf einen grundsätzlichen Widerstand gegen Veränderungen auf Seite der Ärzte, welchen sie mit Mangel an Vertrauen in die Evidenz von DA's, ihrem Streben nach individueller Behandlung von Patienten und der Befürchtung begründeten, dass eine standardisierte Behandlung von Patienten die Arzt-Patientenbeziehung oder den Konsultationsprozess behindere. Unter Hinweis auf mehrere frühere Studien, die zeigen, dass Ärzte beim Thema Leitlinien zu einer Überschätzung ihres tatsächlichen Gebrauchs tendieren, deuten die AutorInnen schließlich noch an, dass die Lücke zwischen Absicht und Wirklichkeit noch größer sein könnte.
Der Aufsatz "Physicians' intentions and use of three patient decision aids" von Ian D Graham, Jo Logan, Carol L Bennett, Justin Presseau, Annette M O'Connor, Susan L Mitchell, Jacqueline M Tetroe, Ann Cranney, Paul Hebert und Shawn D Aaron ist am 6. Juli 2007 (BMC Medical Informatics and Decision Making 2007, 7:20) veröffentlicht worden und als 10-seitiger Text komplett und kostenlos erhältlich.
Der Cochrane Review "Decision aids for people facing health treatment or screening decisions" von Annette M. O'Connor, Carol L Bennett, Dawn Stacey, Michael Barry, Nananda F Col, Karen B Eden, Vikki A Entwistle, Valerie Fiset, Margaret Holmes-Rovner, Sara Khangura, Hilary Llewellyn-Thomas und David Rovner ist am 20. Januar 2003 zum ersten Mal erschienen, 2006 geupdatet worden. Kostenlos ist lediglich ein längeres Abstract erhältlich.
Die Ergebniszusammenfassung aus dem Jahr 2006 lautet: "Decision aids to help people who are facing health treatment or screening decisions Making a decision about the best option to manage health can be difficult. Getting information on the options and the possible benefits and harms in the form of decision aids may help. Decision aids, such as pamphlets and videos that describe options, are designed to help people understand the options, consider the personal importance of possible benefits and harms, and participate in decision making. They are used when there is more than one medically reasonable option - no option has a clear advantage in terms of health outcomes, each has benefits and harms that people value differently. The updated review of trials found that decision aids improve people's knowledge of the options, create accurate risk perceptions of their benefits and harms, reduce difficulty with decision making, and increase participation in the process. They may have a role in preventing use of options that informed patients don't value without adversely affecting health outcomes. They did not seem to have an effect on satisfaction with decision making or anxiety."
Wie weit sich die Ergebnisse auf die deutschen Behandlungsverhältnisse übertragen lassen ist - wie leider so oft - nicht abschließend oder befriedigend zu klären. Sofern aber deutsche Ärzte angeben, sie würden SDM und DA wesentlich häufiger und intensiver nutzen und einsetzen als ihre KollegInnen in den USA ist dies bis zur Vorlage vergleichbar gewonnenen empirischer Erkenntnisse aus dem hiesigen Behandlungsgeschehen mit äußerster Skepsis zu bewerten. Und wer meint, in Nordamerika erhobene Sachverhalte seien "in keinster Weise" auf Deutschland übertragbar, müsste eigentlich an der Spitze derjenigen stehen, die sich die wirklichen Verhältnisse hierzulande endlich genauer ansehen wollen. Für die Anlage dieser Untersuchung liefern die nordamerikanischen Untersuchungen wertvolle Hinweise.
Bernard Braun, 27.5.09
Informiert über und für "shared decision making" - Annotierte Bibliographie der "Foundation for Informed Medical Decision Making"
 "Shared decision making" (SDM) oder partizipative Entscheidungsfindung ist einer der avanciertesten Versuche, die gesundheitlichen und sozialen Nachteile der lange Zeit in der ärztlichen Berufsausübung dominanten paternalistischen Arzt-Patientbeziehung zu vermeiden und Arztpraxen vom Odium einer "beteiligungsfreien Zone" zu befreien.
"Shared decision making" (SDM) oder partizipative Entscheidungsfindung ist einer der avanciertesten Versuche, die gesundheitlichen und sozialen Nachteile der lange Zeit in der ärztlichen Berufsausübung dominanten paternalistischen Arzt-Patientbeziehung zu vermeiden und Arztpraxen vom Odium einer "beteiligungsfreien Zone" zu befreien.
Über wichtige Forschungsergebnisse zu den erwünschten und unerwünschten Wirkungen von SDM, den Stand ihrer Implementation in verschiedenen Gesundheitssystemen und die dafür notwendigen fördernden Bedingungen beschäftigt sich das forum-gesundheitspolitik in einer eigenen Rubrik "Shared decision making, partizipative Entscheidungsfindung" schon lange.
Auf der Website der FIMDM finden sich zu den wichtigsten Aspekten, Instrumenten und Verfahren von SDM weitere Darstellungen und Materialien. Neben der Frage "What is an informed medical decision?", einer Darstellung der "problems with medical decision making" und einer Darstellungen zur Evidenzbasis von SDM finden sich praktische Darstellung der Implementation von SDM im "primary" und "speciality care"-Bereich oder im Rahmen der "Breast Cancer Initiative". Zusätzlich gibt es eine Übersicht über die wichtigen Entscheidungshilfen, also den so genannten "patient decision aids" und dabei einzuhaltenden Qualitätsstandards. Außerdem vermittelt die Seite noch einen Eindruck zu den Beiträgen der US-Gesundheitspolitik zur Verbreitung von SDM.
Einen zusätzlichen enormen Nutzen stiftet eine 109 Seiten umfassende Zusammenstellung wissenschaftlicher Literatur (mit Schwerpunkt auf Aufsätzen) über die Hauptaspekte von SDM, die nicht nur Titel, sondern praktisch zu jedem Aufsatz auch ein aussagekräftiges Abstract enthält. Die Literatur stammt fast ausschließlich aus dem angelsächsischen Bereich und deckt den Erkenntnissstand bis Ende 2007 ab.
Die 13 inhaltlichen Schwerpunkte liegen bei den Themen Decision Making, Decision Quality, Variation, Evidence Based Medicine, Patient Preferences, Patient Satisfaction, Patient Involvement, Physician Practice, Patient-Physician Relationship, Implementation, Decision Aids, Decision Specific Trials (u.a. zu Abtreibung, Kaiserschnitt, PSA-Test oder Bluthochdruck) und anderen Themen.
Schließt kommt man über die FIMDM auch auf die Startseite für das "Ottawa Decision Support Tutorial (ODST)", einem Online-Tutorial, das Praktikern im Gesundheitswesen helfen soll, Fähigkeiten zu entwickeln, um Unterstützung bei Entscheidungen liefern zu können. Wer sich nicht den passwortgeschützten Zugang beschaffen kann oder will, kann aber auch eine 41 Seiten umfassende PDF-Version mit dem Titel "Decisional conflict: Supporting people experiencing uncertainty about options affecting their health" von O'Connor und Jacobsen aus dem Jahr 2007 kostenlos herunterladen.
Ergänzend führt ein weiterer Link auf ein A-Z-Verzeichnis von überwiegend angelsächsischen "decision aids" und das von der Cochrane Systematic Review Group getragene Cochrane Inventory von Decision Aids.
Bernard Braun, 13.5.09
"Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches.
 Der Kommentar des Bostoner Arztes Michael J. Barry zu den zusammen gerade im angesehenen "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Zwischenergebnissen zweier randomisierter kontrollierter Studien über den Nutzen der systematischen Bestimmung des PSA-Wertes (gemessen wird dabei ein prostataspezifisches Antigen) zur frühzeitigen Entdeckung von Prostatakrebs und der damit erhofften Senkung der spezifischen Sterberate, bringt das Dilemma und einen Teil der Lösung für die Leser beider Studien auf den Punkt: Die lange erwarteten Ergebnisse widersprechen sich diametral.
Der Kommentar des Bostoner Arztes Michael J. Barry zu den zusammen gerade im angesehenen "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Zwischenergebnissen zweier randomisierter kontrollierter Studien über den Nutzen der systematischen Bestimmung des PSA-Wertes (gemessen wird dabei ein prostataspezifisches Antigen) zur frühzeitigen Entdeckung von Prostatakrebs und der damit erhofften Senkung der spezifischen Sterberate, bringt das Dilemma und einen Teil der Lösung für die Leser beider Studien auf den Punkt: Die lange erwarteten Ergebnisse widersprechen sich diametral.
In der Interventionsgruppe der zwischen 1993 und 2001 laufenden "U.S. Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO)" mit 73.693 teilnehmenden Männern war die Prostatakrebs-Sterberate mit rund 2 Toten pro 10.000 Personenjahren insgesamt sehr niedrig. Vor allem aber unterschied sich die Sterberate der Screeningteilnehmer (n=38.343) nicht signifikant von der der Teilnehmer in der Kontrollgruppe (n=38.350). Unerwartet lag dann schließlich die Sterberate in der Interventionsgruppe mit 2 Toten über (!!) der von 1,7 Toten pro 10.00 Personenjahre (Rate 1,13) in der Kontrollgruppe, der Unterschied war aber nicht signifikant. Die Inzidenz von Prostatakrebs betrug in der Screeninggruppe 116 Erkrankte pro 10.000 Personenjahre und 95/10.0000 Personenjahre in der Kontrollgruppe (Rate=1,22). Der PSA-Test erhöht zwar die Anzahl der entdeckten Prostatakarzinome erhöht, erfüllt aber seinen insbesondere in Deutschland (interessanterweise beurteilen die us-amerikanischen Urologen das PSA-Screening viel zurückhaltender) propagierten Zweck, die Sterblichkeit zu senken, nicht.
Was die Ergebnisse etwas verwässert ist der Fakt, dass anders als in anderen klinischen Studien sich auch etwa die Hälfte der Kontrollgruppe ihren PSA-Wert bestimmen (Anstieg von 40 % auf 52 % im sechsten Studienjahr) und sich auch digital-rektal untersuchen (Anstieg von 41% auf 46 %) ließ. Trotzdem lag dieser Anteil in der Interventionsgruppe deutlich höher; nämlich bei 85 % für den PSA-Test und 86 % für die rektale Untersuchung. Dies Teilnehmer der Interventionsgruppe nahmen innerhalb der vergleichsweise langen Untersuchungsdauer von 7 bis 10 Jahren regelmäßig an einem PSA-Screening (jährlich über 6 Jahre) teil oder ließen eine digital-rektale Untersuchung (jährlich für vier Jahre) durchführen.
Die Ergebnisse der "European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC)" unterscheiden sich inhaltlich beträchtlich von denen der US-Studie. Ihre 162.243 Teilnehmer zwischen 50 und 74 Jahren aus sieben europäischen Ländern (ohne deutsche Teilnehmer) wurden in der Interventionsgruppe alle vier Jahre PSA-gescreent. Letztendlich akzeptierten 82 % der Männer dieses Angebot. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe nahmen keine Screeningleistung in Anspruch.
Die auch hier untersuchte Prostatakrebs-Sterberate sah deutlich anders aus als in den USA: Bei den Interventionsteilnehmern lag sie 20 % niedriger als bei den Kontrollgruppenteilnehmern (p = 0,04). Das Screening führt nach Meinung der Studienautoren dazu, dass nach 9 Jahren Laufdauer sieben Männer pro 10.000 Männer weniger starben als ohne PSA-Bestimmung mit anschließender Intervention. Um einen Todesfall zu verhindern, müssen mehr als 1.400 Männern ein PSA-Screening durchlaufen ("number to treat" oder "number to test"), und es müssen zusätzlich 48 Männer zum Teil aufwändig behandelt werden. Um den Nutzen erreichen zu können, muss man nach Meinung des bereits zitierten ärztlichen Kommentators also viel oder auch zu viel an Diagnostik und Therapie in Kauf nehmen. Dies bedeutet nicht nur einen finanziellen Mehraufwand, sondern birgt auch unterschiedliche Risiken in sich. Dies gilt etwa für die 17.000 Biopsien, die bei 73.000 Männern in der ERSPC-Studie gemacht wurden. Die WissenschaftlerInnen der europäischen Studie nennen selber im Abstract ihres Aufsatzes das Problem des "high risk of overdiagnosis" durch das PSA-Screening und mögliche Folgeaktivitäten.
Zumindest aktuell können keine offensichtlichen methodischen Schwächen einer der beiden Studien als Erklärung für ihren Kardinalunterschied und als Entscheidungsfaktor herangezogen werden.
Daraus folgt praktisch zweierlei:
• Der potenzielle Schaden durch zu umfassende und nicht notwendige Diagnostik oder Therapie muss gründlich gegen den Nutzen abgewogen werden.
• Zum anderen muss künftig aber noch mehr das berücksichtigt werden, was Barry für den Behandlungsalltag erneut nachdrücklich empfiehlt: "As a result, a shared decision-making approach to PSA screening, as recommended by most guidelines, seems more appropriate than ever." Dass dabei möglicherweise territoriale Präferenzen die entscheidende Rolle spielt ist unbefriedigend, aber immer noch besser als wenn behandelnde Urologen allein die europäischen Ergebnissen an ihre Patienten vermitteln würden.
Alle Beteiligten und Betroffenen bekommen aber evtl. durch zwei weitere, nicht abgeschlossene Studien, der "Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT)" in den USA und dem Projekt "Prostate Testing for Cancer and Treatment (PROTECT)" in Großbritannien einhelligere Entscheidungsdaten oder aber noch mehr Widersprüchliches. Die Diskussion um Sinn und Unsinn des PSA-Screenings bezogen auf die Sterblichkeit an Prostatakrebs dürfte deshalb noch einige Jahre anhalten.
Der Aufsatz "Mortality Results from a Randomized Prostate-Cancer Screening Trial" von Gerald L. Andriole und zahlreichen weiteren Mitgliedern des PLCO Projektteams ist im NEJM vom 18. März 2009 erschienen und als zehnseitige PDF-Datei kostenlos erhältlich.
Den Aufsatz "Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study" von Fritz H. Schröder et al. erhältlich man ebenfalls komplett kostenlos.
Der Kommentar von Michael J. Barry "Screening for Prostate Cancer — The Controversy That Refuses to Die" in der Ausgabe des NEJM vom 18. März 2009 ist als vierseitige PDF-Datei komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.09
Shared Decision Making: Erfolge zeigen sich vor allem, wenn Patienten kontinuierlich beteiligt sind
 Der Wunsch nach partizipativer Entscheidungsfindung beim Arzt ("Shared Decision Making") findet sich heute bei einer Mehrheit von Patienten, auch wenn dies nicht für alle Erkrankungen in gleichem Maße gilt und Ältere oft noch zur traditionellen Rollenverteilung zwischen Arzt und Patient neigen. Ein systematischer Einbezug von Patienten bei anstehenden Therapie-Entscheidungen ist jedoch deutlich zeitaufwändiger, so dass sich die Frage stellt, ob dieses Vorgehen auch lohnt. Eine Literaturstudie englischer und niederländischer Wissenschaftler hat nun eine Reihe schon veröffentlichter Untersuchungen über die Effekte von Shared Decision Making ausgewertet und zusammengefasst.
Der Wunsch nach partizipativer Entscheidungsfindung beim Arzt ("Shared Decision Making") findet sich heute bei einer Mehrheit von Patienten, auch wenn dies nicht für alle Erkrankungen in gleichem Maße gilt und Ältere oft noch zur traditionellen Rollenverteilung zwischen Arzt und Patient neigen. Ein systematischer Einbezug von Patienten bei anstehenden Therapie-Entscheidungen ist jedoch deutlich zeitaufwändiger, so dass sich die Frage stellt, ob dieses Vorgehen auch lohnt. Eine Literaturstudie englischer und niederländischer Wissenschaftler hat nun eine Reihe schon veröffentlichter Untersuchungen über die Effekte von Shared Decision Making ausgewertet und zusammengefasst.
Berücksichtigt wurden nur Studien mit hohem methodischem Niveau, durchweg randomisierte Kontrollstudien ("RCTs"), also Verlaufsstudien mit einer Kontrollgruppe (mit gleicher Erkrankung, aber ohne partizipative Entscheidungsfindung) und zufälliger Einteilung der Teilnehmer. Einbezogen wurden nach einer systematischen Literatursuche insgesamt 11 Studien, die sich - wie in solchen Metastudien nicht anders zu erwarten - in einer Vielzahl von Aspekten deutlich unterscheiden. Die Zahl einbezogener Patienten variierte zwischen knapp 50 und 750, bei den Krankheiten fanden sich Herzerkrankungen ebenso wie Krebs oder Depressionen. Auch die Information der Patienten war sehr unterschiedlich, teils gab man ihnen sog. "Entscheidungshilfen" in Broschürenform oder als Video, teils auch nur ärztliche Informationen.
Als Ergebnis-Variablen waren ebenfalls abweichende Indikatoren verwendet worden: Patientenzufriedenheit, Therapie-Compliance, Krankheits-Kenntnisse, subjektives Befinden, Krankheits-Symptome. Unter dem Strich zeigte sich dann:
• 5 der 11 randomisierten Kontrollstudien Studien zeigten keine Unterschiede zwischen der Shared Decision Making-Gruppe und der Kontrollgruppe.
• 5 Studien zeigten positive Effekte bei der Intervention mit partizipativer Entscheidungsfindung.
• Eine Studie zeigte zwar keine kurzfristigen, dafür aber langfristige Vorteile der Interventionsgruppe.
• Beide Studien, die sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigten (Depression, Schizophrenie) zeigten Vorteile für Shared Decision Making.
Die Wissenschaftler hoben in der Diskussion ihrer Ergebnisse hervor: Studien mit positivem Ausgang, also besseren Ergebnissen für die SDM-Gruppe hinsichtlich Patientenzufriedenheit, Compliance und gesundheitlichem Befinden, zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass die therapeutische Vorbereitung, Information und Therapie zeitlich längerfristig verläuft. Bei Studien, die keine Unterschiede gefunden haben, ist die Patientenbeteiligung und -information meist reduziert auf nur eine Sitzung. Von daher sollte Shared Decision Making als längerfristiger Kooperationszusammenhang zwischen Arzt und Patient betrachtet werden und nicht als kurzfristige, einmalige Intervention.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Joosten, E.A.G. u.a.: Systematic Review of the Effects of Shared Decision-Making on Patient Satisfaction, Treatment Adherence and Health Status (Psychother Psychosom 2008;77:219-226)
Gerd Marstedt, 12.6.2008
"Irren ist ärztlich" oder wo man lieber nicht seinem Arzt glauben sollte: Medizinische Mythen an die sogar Ärzte glauben.
 Mythen gehören zum Grundrepertoire der argumentativen Auseinandersetzungen in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen und beherrschen auch die Sicht- und Handlungsweise der unterschiedlichsten professionellen Akteure im Gesundheitswesen.
Mythen gehören zum Grundrepertoire der argumentativen Auseinandersetzungen in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen und beherrschen auch die Sicht- und Handlungsweise der unterschiedlichsten professionellen Akteure im Gesundheitswesen.
Erinnert sei nur an die "Kostenexplosion", die "Lohnnebenkosten-Bedrohung", den "Leistungsmissbrauch" oder die "demografische Bedrohung". Der Beschäftigung mit der Existenz von Mythen und ihre Dekonstruktion geht es dabei nicht oder zumindest nicht vorrangig darum, ihre Propagandisten als intellektuell dumm oder unredlich zu entlarven oder zu blamieren, sondern über das Verständnis ihres Zustandekommens, ihrer enormen Plausibilität und Glaubwürdigkeit und ihrer argumentativen Absicherung mehr über die wirklichen Entwicklungen und Strukturen im Gesundheitswesen zu erfahren. Wenn man die Bedingungen der Möglichkeit solcher Mythen verstanden hat, versteht man außerdem sein eigenes Denken sowie das Innenleben des Gesundheitswesens wesentlich besser.
Dies alles gilt auch für Ärzte, die man zwar trotzdem weiter zu allen gesundheitsbezogenen Problemen fragen kann oder sollte, nur nicht mit der uneingeschränkten und naiven Erwartung nur Richtiges und Evidentes geantwortet zu bekommen.
Der Blick in die Weihnachtsausgabe der medizinischen Fachzeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" (2007, 22. Dezember; 335: 1288-1289) und den dortigen Aufsatz "Medical Myths. Sometimes even doctors are duped" von Rachel Vreeman und Aaron Carroll gibt "a light hearted reminder that we (Ärzte) can be wrong and need to question what other falsehoods we unwittingly propagate as we practice medicine."
Dafür stellten die an der Indiana University School of Medicine forschenden Verfasser eine Liste zusammen, die sieben, oft von Ärzten und der allgemeinen Öffentlichkeit verkündeten und auch zur Handlungsorientierung genutzten Statements über scheinbar sichere medizinische oder gesundheitliche Erkenntnisse enthält. Mit Hilfe von Medline bzw. PubMed und Google suchten die Forscher nach empirischer oder systematischer Evidenz für oder gegen die Gültigkeit und Stimmigkeit der ausgewählten Behauptungen und Annahmen.
Fehlende Evidenz oder sogar Gegenevidenz finden sich dabei für
• den Ratschlag mindestens acht Gläser Wasser mit einem Volumen von rund 2,5 Liter täglich zu trinken,
• den Glauben, dass Menschen nur 10% ihres Gehirns nutzen,
• die Annahme, dass Haare und Fingernägel auch nach dem Tod weiterwachsen (wer sich über Weihnachten Fred Vargas neuen Kriminalroman "Die dritte Jungfrau" gönnen will, sollten dies ganz schnell vergessen und sich die spannende Lektüre trotzdem gönnen), die - apropos Lesen -
• ängstigende Idee, Lesen bei gedimmten Licht würde die Lesekraft ruinieren,
• die ebenfalls für manche schreckliche Annahme, das Rasieren von Haaren führte zwangsläufig dazu, dass sie schneller und derber nachwachsen,
• die Annahme, dass Mobiltelefone in Krankenhäusern gefährlich seien und nicht nur für US-BürgerInnen
• die Angst, dass der bevorzugt weihnachtliche Verzehr von Truthähnen eine spezielle einschläfernde Wirkung hat.
Worauf sich die Bewertung dieser 7 medizinischen Überzeugungen als unbewiesen oder unwahr stützt, wird jeweils knapp dargestellt. In einigen Fällen wird auch gezeigt, welches die Quelle für die verblüffende Gewissheit der Überzeugung ist.
Die "conclusions" des Aufsatzes lassen sich daher auch schon als vorgezogene Wünsche für den rationalen öffentlichen medizinischen Diskurses in 2008 lesen: "Despite their popularity, all of these medical beliefs range from unproved to untrue. Although this was not a systematic review of either the breadth of medical myths or of all available evidence related to each myth, the search methods produced a large number of references. While some of these myths simply do not have evidence to confirm them, others have been studied and proved wrong. Physicians would do well to understand the evidence supporting their medical decision making. They should at least recognise when their practice is based on tradition, anecdote, or art. While belief in the described myths is unlikely to cause harm, recommending medical treatment for which there is little evidence certainly can. Speaking from a position of authority, as physicians do, requires constant evaluation of the validity of our knowledge."
Wer über der Anzahl von "nur" sieben falschen Überzeugungen oder gewissen Annahmen doch wieder schnell zum heilen und bequemen "…fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker"-Idyll zurückkehren will, machen bereits Vreeman und Carroll einen Strich durch die Rechnung. Sie arbeiten an einem Buch, das über 100 weitere vergleichbare Mythen enthält und 2008 erscheinen soll.
Wer aber schon jetzt etwa wissen will, welche Evidenz es für den ärztlichen und populären Ratschlag an Schwangere gibt, Katzen wegen möglicher Geburtsdefekte zu meiden, ob das menschliche Herz wirklich bei kräftigem Nießen aufhört zu schlagen, ob zuckerreiche Süßigkeiten bei Kindern zu hyperaktivem Verhalten führen, die Einnahme großer Mengen Vitamin C eine Erkältung vermeiden hilft oder man mit einer großen Menge heißem und schwarzen Kaffee die Folgen erhöhten Alkoholkonsums kompensieren kann - also vielfach jahreszeitgerechte Merksätze -, kann seine Neugier auf der Website "Find the Truth Behind Medical Myths" der University of Arkansas for Medical Sciences befriedigen.
Bernard Braun, 23.12.2007
Einstellungen von Ärzten zur Partizipativen Entscheidungsfindung: Im Grundsatz dafür, aber …
 Während in einer Vielzahl internationaler Studien die Einstellungen von Patienten zur Partizipativen Entscheidungsfindung (Shared Decision Making) untersucht wurde, ist über die Haltung von Ärzten weitaus weniger bekannt. Eine australische Studie, veröffentlicht in der Zeitschrift "Cancer", hat jetzt einige Erkenntnisse hierzu erbracht. Deutlich wurde in der Befragung, dass viele Chirurgen, Radiologen und Onkologen zwar im Grundsatz eine Einbeziehung von Brustkrebs-Patientinnen in die Therapie-Entscheidung befürworten. Die Frage, ob Patientinnen auch bei jenen Sitzungen der Ärzte und Pflegekräfte teilnehmen sollten, bei denen der Behandlungsplan diskutiert und festgelegt wird, beantworteten die meisten Mediziner allerdings mit "nein".
Während in einer Vielzahl internationaler Studien die Einstellungen von Patienten zur Partizipativen Entscheidungsfindung (Shared Decision Making) untersucht wurde, ist über die Haltung von Ärzten weitaus weniger bekannt. Eine australische Studie, veröffentlicht in der Zeitschrift "Cancer", hat jetzt einige Erkenntnisse hierzu erbracht. Deutlich wurde in der Befragung, dass viele Chirurgen, Radiologen und Onkologen zwar im Grundsatz eine Einbeziehung von Brustkrebs-Patientinnen in die Therapie-Entscheidung befürworten. Die Frage, ob Patientinnen auch bei jenen Sitzungen der Ärzte und Pflegekräfte teilnehmen sollten, bei denen der Behandlungsplan diskutiert und festgelegt wird, beantworteten die meisten Mediziner allerdings mit "nein".
Dass Patienten auch an Entscheidungen über die für sie sinnvollste Therapie teilhaben sollten, ist im Grundsatz auch unter Ärzten unstrittig. Doch die Problematik steckt wohl im Detail: Wie weit sollte diese Teilhabe gehen? Australische Wissenschaftler hatten in einer Klinik-Abteilung für Brustkrebs-Patientinnen ein kleines Pilotprojekt durchgeführt. Während Patientinnen normalerweise zwar von den Ärzten auch ausführlich über die Diagnose und die Therapie-Optionen informiert werden, ist es bislang unüblich, dass Patientinnen auch an jenen Sitzungen teilnehmen, in denen die Mediziner (Chirurgen, Radiologen, Onkologen) und Pflegekräfte im Detail über die Therapie diskutieren und auch den exakten Behandlungsplan festlegen. Exakt dies wurde nun jedoch einmal erprobt - mit sehr unterschiedlicher Bewertung durch die Ärzte. Einige Ärzte äußerten sich sehr positiv und stellten fest, dass sie durch das Beisein der Patientin und ihre Fragen die Fallproblematik sehr viel aufmerksamer durchdacht und die individuellen Besonderheiten berücksichtigt hatten. Andere jedoch erlebten diese ungewohnte Situation eher als zeitraubend und kontraproduktiv: Medizinische Aspekte würden zu kurz kommen, man müsse ständig seine Wortwahl kontrollieren.
Das kleine Pilotprojekt wurde in eine größere schriftliche Befragung überführt, an der dann 142 Chirurgen, 31 Radiologen, 65 Onkologen, 135 Patientensprecherinnen an Kliniken und 56 Krankenschwestern aus der Onkologie teilnahmen. Erhoben wurden unterschiedliche sozialstatistische und berufliche Daten wie Zahl der Patienten, Berufsjahre, Art der Klinik usw. Darüber hinaus wurden Fragen gestellt zur Einstellung der Teilnehmer gegenüber dem Konzept der Partizipativen Entscheidungsfindung. Als Ergebnis zeigte sich, dass - ähnlich wie in Umfragen bei Patienten - in allen Gruppen etwa zwei Drittel (58-66%) grundsätzlich für eine gemeinsame Entscheidung von Arzt und Patient votierten.
Hier schloss sich dann die Frage an: "Hilft es Patientinnen, bei denen Brustkrebs neu diagnostiziert wurde, auch an den Sitzungen des multi-disziplinären Teams teilzunehmen, bei denen ihr Fall besprochen und der Behandlungsplan festgelegt wird?" Dabei zeigten sich massive Unterschiede in den Antworten der einzelnen Gruppen. 93% der Patientensprecherinnen und 73% der Krankenpfleger/innen antworteten mit "ja". Die Ärzte waren überwiegend jedoch anderer Meinung. Für eine Patienten-Teilnahme stimmten nur 32% der Chirurgen und 24-25% der Radiologen bzw. Onkologen.
Als Begründung für die Ablehnung des Vorschlags wurden dabei von ärztlicher Seite sehr unterschiedliche Argumente angeführt: Bei Patientinnen würden zu viele Ängste geweckt, die medizinische Diskussion würde beeinträchtigt, man müsse ständig seine Wortwahl kontrollieren, das Vorhaben sei viel zu zeitaufwändig, Patientinnen würden mit Informationen überlastet und verwirrt. Ein für die Wissenschaftler überraschendes Nebenergebnis der Analyse war dann, dass Patientensprecherinnen, die selbst einmal ein Brustkrebs erkrankt waren oder sogar aktuell eine Therapie deshalb durchmachen, etwa 7-10mal so häufig für eine Teilnahme von Patientinnen stimmen. Diese Gruppe, so die Wissenschaftler in ihrer Bilanz der Ergebnisse, ist zwar überhaupt nicht repräsentativ für Brustkrebs-Patientinnen. Es zeigt sich jedoch, dass Patienten mit einem sehr hohen Informationsbedarf sehr viel weitergehende Interessen an Partizipativer Entscheidungsfindung haben als ihnen praktisch meist zugestanden wird. Bei den Ärzten, so die Forscher, ist überdies deutlich geworden, dass sie den Zeitdruck bei ihrer Arbeit und die Details einer medizinischen Fachdiskussion höher bewerten als die Chance, Ängste und Wünsche einer Patientin detailliert kennen zu lernen - wie auch immer man dies bewerten mag.
Hier ist ein kostenloses Abstract der Studie zu finden: Phyllis Butow u.a.: Health professional and consumer views on involving breast cancer patients in the multidisciplinary discussion of their disease and treatment plan (Cancer, Volume 110, Issue 9, Pages 1937-1944)
Gerd Marstedt, 23.10.2007
Starke Patienten-Orientierung von Ärzten kann auch Widerstände bei Patienten bewirken
 Neuere Studien haben gezeigt, dass eine "Partizipative Entscheidungsfindung" heute keineswegs immer und von allen Patienten gewünscht wird. Alter und Bildungsniveau spielen hier ebenso eine Rolle wie die Art der Erkrankung. Es scheint, dass mit dem Grad der Beunruhigung aufgrund einer bestimmten Krankheitsdiagnose und mit der Unkenntnis von Risiken und Therapiechancen auch die Tendenz wächst, Entscheidungen eher dem Arzt zu überlassen. Eine jetzt in der Zeitschrift "Annals of Behavioral Medicine" veröffentlichte Studie hat eine im Prinzip schlichte und vorhersehbare Schlussfolgerung nun auch empirisch bestätigt: Wichtig ist die Übereinstimmung von ärztlichem Verhalten und Patientenerwartungen. Je stärker dies auseinander klafft, umso eher können sich Patienten im Rahmen der Therapie auch als widerspenstig erweisen: Sie befolgen Diätvorschriften nicht oder lassen verordnete Medikamente unbeachtet in der Schublade liegen.
Neuere Studien haben gezeigt, dass eine "Partizipative Entscheidungsfindung" heute keineswegs immer und von allen Patienten gewünscht wird. Alter und Bildungsniveau spielen hier ebenso eine Rolle wie die Art der Erkrankung. Es scheint, dass mit dem Grad der Beunruhigung aufgrund einer bestimmten Krankheitsdiagnose und mit der Unkenntnis von Risiken und Therapiechancen auch die Tendenz wächst, Entscheidungen eher dem Arzt zu überlassen. Eine jetzt in der Zeitschrift "Annals of Behavioral Medicine" veröffentlichte Studie hat eine im Prinzip schlichte und vorhersehbare Schlussfolgerung nun auch empirisch bestätigt: Wichtig ist die Übereinstimmung von ärztlichem Verhalten und Patientenerwartungen. Je stärker dies auseinander klafft, umso eher können sich Patienten im Rahmen der Therapie auch als widerspenstig erweisen: Sie befolgen Diätvorschriften nicht oder lassen verordnete Medikamente unbeachtet in der Schublade liegen.
An der Studie beteiligt waren 16 Allgemeinärzte und 146 Patienten aus Iowa, USA. Alle Patienten wurden zweimal befragt, zunächst über ihre Erwartungen und Vorlieben im Hinblick auf die Arzt-Patient-Kommunikation und über ihre Beteiligung an der Entscheidungsfindung. Etwa zwei Wochen nach dem letzten Arztkontakt gaben Patienten dann zusätzlich noch über ihre Zufriedenheit mit der Behandlung Auskunft und darüber, ob sie die ärztlichen Anweisungen (etwa zur Umstellung der Ernährung oder zu körperlicher Bewegung) und gegebenenfalls die Vorschriften zur Medikamenteneinnahme auch befolgt hätten. Die Ärzte gaben ebenfalls in zwei Befragungen Auskunft über ihre persönlichen Vorlieben zur Kommunikation und Patienteninformation.
Als Ergebnis zeigte sich dann, dass die Befolgung der ärztlichen Regeln, die sogenannte "Therapietreue" oder "Compliance" am höchsten war, wenn Ärzte, die Patienten gerne in einer aktiven Rolle sahen auch solche Patienten behandelten, die diese Teilhabe an Therapieentscheidungen für sich bevorzugten. Umgekehrt waren dann besonders viele Widerstände gegen die Befolgung der ärztlichen Vorschlage und Medikamentenverordnungen anzutreffen, wenn Ärzte ihre Patienten in eine partizipative Rolle drängten, diese aber im Grunde eher das traditionelle, paternalistische Muster der Arzt-Patient-Beziehung bevorzugten. In der Mitte fand sich jene Konstellation, dass Patienten mit starken Partizipationswünschen auf eher paternalistisch orientierte Ärzte trafen.
Für die Wissenschaftler war nach eigener Aussage überraschend, dass Patienten, die gegen ihre Vorlieben in eine Mitbestimmungs-Position hineingedrängt werden, die stärksten Widerstände zeigten. Sie erklären diese Verweigerung der Befolgung ärztlicher Vorschläge oder Anordnungen als Versuch, wieder eine Situationskontrolle herzustellen, sei es durch Verweigerung der Medikamentenverschreibung oder Missachtung von Empfehlungen zur Umstellung der Ernährung oder zu mehr körperlicher Bewegung.
"Es gibt eine wirklich nennenswert große Zahl von Patienten", so erklärte Prof. Alan Christensen, einer der Autoren, "bei denen das partizipative Vorgehen absolut fehlschlägt. Diese Patienten sind der festen Überzeugung, dass es der Job des Arztes sei, Entscheidungen zu treffen. Wenn diese auf einen Arzt treffen, der sie zu stark in Mitbestimmungs-Positionen hineindrängt, verlassen sie die Sprechstunde ziemlich verwirrt und ratlos und sind überfordert. Viele von ihnen verweigern dann die Mitarbeit an der Therapie."
Christensen legt ärztlichen Kollegen daher nahe, sich zu Beginn eines Patientengesprächs ausführlicher darüber zu informieren, welche Erwartungen und Wünsche der Patient hat, im Hinblick auf die Genauigkeit und Ausführlichkeit der Informationen, aber auch im Hinblick auf das Ausmaß der Entscheidungsteilhabe.
• Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Cvengros, J.A. u.a.: Patient and Physician Attitudes in the Health Care Context: Attitudinal Symmetry Predicts Patient Satisfaction and Adherence
(Annals of Behavioral Medicine, 2007, Vol. 33, No. 3, Pages 262-268)
• Hier ist eine ausführlichere Pressemitteilung der University of Iowa: University of Iowa News Release: UI Research: Patient-Centered Approach Can Backfire
Gerd Marstedt, 16.8.2007
Der Wunsch nach partizipativer Entscheidungsfindung beim Arzt: Eine große Rolle spielt das Krankheitsbild
 Die Mehrheit der Patienten möchte heute bei Therapieentscheidungen einbezogen werden, dies ist keine neue Erkenntnis. In welchem Ausmaß dies der Fall ist, hängt jedoch sehr stark ab vom Krankheitsbild und davon, wie vertraut man mit Symptomen, Ursachen und Risiken einer Krankheit ist. Dies hat jetzt eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Toronto (Kanada) bei einer Befragung von über 2.700 Patienten ergeben, die wegen unterschiedlicher Erkrankungen im kanadischen Distrikt Ontario in Behandlung waren.
Die Mehrheit der Patienten möchte heute bei Therapieentscheidungen einbezogen werden, dies ist keine neue Erkenntnis. In welchem Ausmaß dies der Fall ist, hängt jedoch sehr stark ab vom Krankheitsbild und davon, wie vertraut man mit Symptomen, Ursachen und Risiken einer Krankheit ist. Dies hat jetzt eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Toronto (Kanada) bei einer Befragung von über 2.700 Patienten ergeben, die wegen unterschiedlicher Erkrankungen im kanadischen Distrikt Ontario in Behandlung waren.
Die Erkrankungen der Untersuchungsteilnehmer waren unterschiedlich schwer wiegend: Brustkrebs, Prostata-Erkrankungen, Knochenbruch, Inkontinenz, HIV, Gutartige Prostatavergrößerung, Orthopädische Erkrankungen, Herz- oder rheumatische Erkrankungen, Unfruchtbarkeit (nur Frauen) und Multiple Sklerose. Zur Kontrolle wurden außerdem Krankenschwestern, die noch in der Ausbildung waren, einbezogen. In der Befragung wurde neben sozialstatistischen Daten und dem Krankheitsbild vor allem untersucht, in welchem Ausmaß sich die Patienten eine Beteilung an Therapie-Entscheidungen wünschen.
Dafür entwickelten die Forscher ein theoretisches Konzept, das über die gängige Erfassung von Patientenwünschen zum "Shared Decision Making" hinausgeht. Üblicherweise wird hier gefragt, ob man in Situationen, in denen beim Arzt eine Entscheidung ansteht, diese Entscheidung dem Arzt überlassen möchte, alleine entscheiden möchte oder gemeinsam mit dem Arzt. Die Forschungsgruppe geht jedoch davon aus, dass die angesprochene Situation zumindest zwei unterschiedliche Dimensionen beinhaltet: Die Problemlösung und die Entscheidung. Für beide können ihrer Ansicht nach unterschiedliche Patienten-Optionen gewählt werden.
Unter "Problemlösung" verstehen sie Fragen wie unter anderem: Wer sollte entscheiden, welche Krankheitsursachen maßgeblich sind, welche Behandlungsmöglichkeiten offen stehen, welche Risiken und Nutzen gegeben sind? Unter "Entscheidung" ordnen sie zwei Fragen ein: Wer sollte entscheiden, wie groß Nutzen und Risiken für den Patienten in besonderem Fall sind? Wer sollte entscheiden, welche Therapie dann gewählt wird?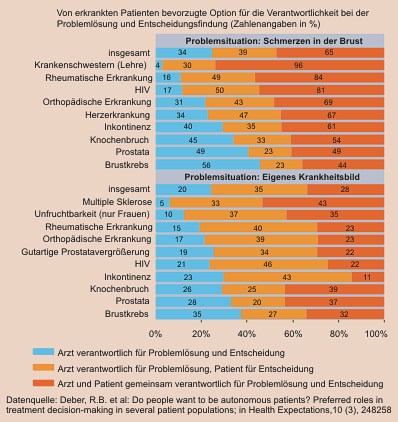
Die für beide Dimensionen jeweils bevorzugten Patientenwünsche zum Shared Decision Making (Arzt entscheidet, Patient entscheidet, beide entscheiden) erfragten sie dann für zwei unterschiedliche Problemsituationen. Einmal wurde das bei einem Patienten tatsächlich gegebene Krankheitsbild in die Frage einbezogen, einmal wurde eine fiktive Situation gewählt, nämlich seit drei Tagen bestehende Schmerzen in der Brust. Überraschend war zunächst, dass so gut wie kein Befragungsteilnehmer (0-2%) für beide Dimensionen (Problemlösung und Entscheidung) an einer alleinigen Patientenentscheidung interessiert war. Das "passive Antwortmuster" (Arzt entscheidet durchweg) war (mit 20-34%) auch nicht quantitativ vorherrschend. Am häufigsten gewählt wurde die Variante: Die Problemlösung ist primär Sache des Arztes, die Entscheidung Sache des Patienten. Am zweithäufigsten tauchte die Variante auf: Für beide Aspekte wird eine gemeinsame Entscheidung von Arzt und Patient getroffen.
Bei der Betrachtung einzelner Patientengruppe nach Art der Krankheit (siehe Grafik) zeigten sich dann massive Unterschiede: Fasst man die beiden zuletzt genannten Antwortmuster zu einer Kategorie "partizipative Lösung" zusammen, dann wählen (für die Problemsituation: eigene Erkrankung) Brustkrebs-Patientinnen nur zu 64% dieses Antwortmuster, während zugleich 36% dieser Gruppe eine passive Lösung wählen. Ähnliche Antwortverteilungen findet man auch für Prostataerkrankungen, während umgekehrt bei rheumatischen oder orthopädischen Erkrankungen oder MS passive Tendenzen eher selten auftreten und irgendeine Form der Beteiligung von über 80% gewünscht wird.
Die Forscher geben zwar keine Interpretationen ab, ob die unterschiedlichen Antwortmuster direkt mit der Art der Erkrankung zusammenhängen. Es könnte jedoch sein, dass mit dem Grad der Beunruhigung und Verängstigung durch eine bestimmte Krankheitsdiagnose und der geringeren Kenntnis von Risiken auch die Tendenz wächst, Entscheidungen dem Arzt zu überlassen. Dafür spricht auch das Ergebnis, dass in der fiktiven und unbekannten Problemsituation (seit 3 Tagen Schmerzen in der Brust, Grafik obere Hälfte) der Anteil derjenigen Studienteilnehmer sehr viel höher ausfällt, der sich in eine passive Rolle begibt und dem Arzt alleine Entscheidungen überlässt.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Do people want to be autonomous patients? Preferred roles in treatment decision-making in several patient populations (Health Expectations 10 (3), 248-258.)
Gerd Marstedt, 30.7.2007
Welche Patienten wünschen sich eine "Partizipative Entscheidungsfindung" und welche nicht?
 Eine "Partizipative Entscheidungsfindung" oder "Shared Decision Making", so haben viele Studien gezeigt, wird heute von der Mehrzahl der Patienten in der ärztlichen Praxis gewünscht, wenn Entscheidungen anstehen über diagnostische oder therapeutische Vorgehensweisen. Je nach Studie und Fragenformulierung sind es etwa 50-70%, die "gemeinsam mit dem Arzt" entscheiden möchten. Zwar wurde in früheren Studien auch der Frage nachgegangen, welche Bevölkerungsgruppen in dieser Hinsicht als mündige Patienten behandelt werden möchten. Die gefundenen Zusammenhänge waren jedoch durchweg sehr niedrig, es zeigten sich nur geringe Effekte, etwa für das Alter oder Bildungsniveau.
Eine "Partizipative Entscheidungsfindung" oder "Shared Decision Making", so haben viele Studien gezeigt, wird heute von der Mehrzahl der Patienten in der ärztlichen Praxis gewünscht, wenn Entscheidungen anstehen über diagnostische oder therapeutische Vorgehensweisen. Je nach Studie und Fragenformulierung sind es etwa 50-70%, die "gemeinsam mit dem Arzt" entscheiden möchten. Zwar wurde in früheren Studien auch der Frage nachgegangen, welche Bevölkerungsgruppen in dieser Hinsicht als mündige Patienten behandelt werden möchten. Die gefundenen Zusammenhänge waren jedoch durchweg sehr niedrig, es zeigten sich nur geringe Effekte, etwa für das Alter oder Bildungsniveau.
Eine Studie an der University of London und der London School of Economics ist jetzt dieser Frage noch einmal systematischer nachgegangen. Über 500 Patienten, die wegen Arthritis oder Diabetes in allgemeinärztlicher Behandlung waren, nahmen an der Untersuchung teil. Ihnen wurde ein umfangreicher Fragebogen vorgelegt, in dem sie Auskunft gaben zu unterschiedlichen Aspekten: Alter, Geschlecht und Bildungsniveau waren darunter, ebenso wie Angaben zum Gesundheitszustand, Einstellungen gegenüber Medikamenten und subjektiv empfundene Lebensqualität. Darüber hinaus wurden sie auch befragt, wer in bestimmten Situationen der Therapie über das weitere Vorgehen ihrer Meinung nach entscheiden sollte. Als Vorgaben dazu gab es fünf Möglichkeiten: Der Arzt allein, der Arzt mehr als der Patient, Arzt und Patient gemeinsam, der Patient mehr als der Arzt, der Patient alleine.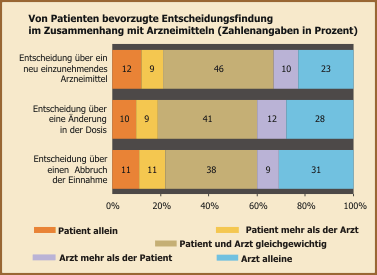
Die gewählten Entscheidungssituationen betrafen eine neue Medikamentenverordnung, einen Wechsel der Arzneimittel-Dosierung und ein Absetzen des Medikaments. Hier zeigte sich zunächst (vgl. Abbildung), dass zumindest eine Mitbeteiligung des Patienten bei allen Situationen Mehrheitswunsch war. Das traditionelle Entscheidungsverhalten (Arzt entscheidet allein) wurde nur von 23-31% gewünscht, das "modernistische" jeweils nur von 10-12%.
Die Wissenschaftler überprüften dann mit aufwändigen statistischen Verfahren, ob man aufgrund der erfassten sozialstatistischen und gesundheitlichen Angaben oder der Einstellungen vorhersagen könnte, welche Art der Entscheidungsbeteiligung sich ein Patient wünscht. Das Ergebnis war jedoch negativ. Zwar ergaben sich geringfügige statistische Zusammenhänge: Jüngere und Angehörige höherer Sozialschichten wünschten sich etwas öfter eine Partnerschaftliche Entscheidungsfindung. Selbst bei kombinierter Verwendung aller verfügbaren Variablen (im Rahmen multivariater Analysen) blieb die Prognose jedoch überaus unsicher (multiples R: 0.37).
Das Ergebnis ist insofern relevant, als es einerseits verdeutlicht: Verhaltensweisen und Erwartungen im Gesundheitssystem sind teilweise völlig unabhängig von traditionellen Gruppen- und Schichtzugehörigkeiten. Es ist keineswegs so, dass Arbeiter und Volksschüler nun durchweg dem paternalistischen Entscheidungsmuster anhängen und Akademiker oder Großverdiener sich durchweg als mündige und autonom entscheidende Patienten verstehen. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse auch Probleme auf, die sich für Ärzte ergeben, wenn sie in der Sprechstunde auf Patientenwünsche eingehen möchte. Diese Patientenerwartungen sind nicht mit einem Blick erfahrbar, sondern müssen im Gespräch ausgelotet werden.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Can patients’ preferences for involvement in decision-making regarding the use of medicines be predicted? (Patient Education and Counseling, Volume 66, Issue 3, June 2007, Pages 361-367)
Gerd Marstedt, 25.7.2007
Shared Decision Making in 8 Ländern: Ein Überblick über den Forschungsstand und die Bedeutung im Versorgungssystem
 In einem Schwerpunktheft widmet sich die Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (Vol 101, 2007) jetzt dem Thema "Shared Decision Making" (Partizipative Entscheidungsfindung) in einer länderübergreifenden Perspektive. Vorgestellt werden in acht Einzelbeiträgen Forschungsaktivitäten, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen und Bemühungen zur Implementierung von Shared Decision Making in das Versorgungssystem. Vorgestellt werden dabei die Länder Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, United Kingdom und USA
In einem Schwerpunktheft widmet sich die Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (Vol 101, 2007) jetzt dem Thema "Shared Decision Making" (Partizipative Entscheidungsfindung) in einer länderübergreifenden Perspektive. Vorgestellt werden in acht Einzelbeiträgen Forschungsaktivitäten, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen und Bemühungen zur Implementierung von Shared Decision Making in das Versorgungssystem. Vorgestellt werden dabei die Länder Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, United Kingdom und USA
Wenn man überhaupt ein Fazit über alle Länder und Gesundheitssysteme hinweg ziehen kann, so dieses: Der Stand der Forschung (z.B. Umfragen zu Patienteninteressen an Shared Decision Making) und auch die Entwicklung praktischer Materialien (z.B. Decision Aids, Entscheidungshilfen für Patienten) ist sehr viel weiter fortgeschritten als die tatsächliche Anwendung in der medizinischen Versorgung oder auch die Berücksichtigung der Erkenntnisse in der Berufsausbildung von Ärzten.
So heißt es beispielsweise in einem Fazit für das United Kingdom: "Zwei der wichtigsten Ansatzpunkte für die Implementierung von Partizipativer Entscheidungsfindung in Großbritannien sind die medizinische Ausbildung und die Entwicklung von Entscheidungshilfen. Im Falle der medizinischen Ausbildung, obwohl es die entsprechende Erkenntnis auf gesundheitspolitischer Ebene gegeben hat, ist die Implementierung bisher begrenzt, sowohl in der studentischen Ausbildung als auch in postgraduierten Curricula. Ähnlich ungeplant und fragmentiert zeigt sich die Entwicklung von Entscheidungshilfen, obwohl deren Einsatz in einigen klinischen Bereichen allmählich in Gang kommt." (vgl. "Prominent strategy but rare in practice: shared decision-making and patient decision support technologies in the UK")
Ähnlich zeigt sich auch für Kanada noch eine große Kluft zwischen Zukunftsperspektiven und medizinischem Alltag: "Die gesetzliche Pflicht für Ärzte, den Patienten vollständige Informationen zu geben und damit eine Entscheidung der Patienten zu ermöglichen, brachte professionelle Richtlinien hervor und die Vision, Patienten durch Entscheidungshilfen und PEF im Sinne eines "Patienten-Empowerment" zunehmend zu befähigen. Demgegenüber hat eine Studie bei Hausärzten im Jahre 2002 gezeigt, dass die hausärztliche Aufgabe eher darin gesehen wird, den Patienten Angst zu nehmen, als sie zu einer informierten Entscheidungsfindung zu ermutigen." (vgl. "Shared decision-making in Canada: update, challenges and where next!")
Im Beitrag von Andreas Loh, Daniela Simon, Christiane Bieber, Wolfgang Eich und Martin Härter über die Situation in Deutschland wird neben einer Beschreibung neuerer Ansätze zur institutionellen Stärkung der Patientenbeteiligung (etwa durch das IQWiG, die Einrichtung von Patientenberatungsstellen oder das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin und deren Internetseite www.patienten-information.de) ausführlicher eingegangen auf die Projekte des vom BMG mit 3,3 Millionen Euro geförderten Forschungsverbundes "Der Patient als Partner".
Dabei werden die zentralen Forschungsbefunde der einzelnen Studien vorgestellt:
• Eine Kontrollstudie bei schizophrenen Patienten in München ergab eine stärkere Patientenbeteiligung und bessere Kenntnisse über die Krankheit. Allerdings zeigte die Rate der stationären Wiederaufnahme von Patienten keinen Unterschied zur Quote einer Kontrollgruppe.
• Ein Freiburger Projekt über SDM bei depressiven Patienten ergab nicht nur eine höhere Patientenzufriedenheit, sondern auch eine stärkere Therapietreue, also vorschriftsmäßige Einnahme der verordneten Medikamente in der Interventionsgruppe.
• Bei Patienten mit Multipler Sklerose wurden in Hamburg unter anderem auch Entscheidungshilfen für die zu wählende Therapie-Option entwickelt. Als Ergebnis zeigte sich, dass Patientenbeteiligung zu einer geringeren Zahl von Arztkontakten führt und dass weniger invasive und riskante Behandlungsmethoden gewählt werden.
• Ein Berliner Forschungsteam konnte zeigen, dass bei Patienten mit Alkoholproblemen eine persönlich zugeschnittene Information und Beratung zu einer deutlichen Senkung des Alkoholkonsums führt und auch zu geringerem exzessivem Trinken (Binge-Drinking, Rauschtrinken)
• Ein Forschungsprojekt mit Fibromyalgie-Patienten (chronischer Schmerz) verbesserte in Heidelberg nachhaltig die Arzt-Patient-Kommunikation und konnte auch die Patientenzufriedenheit verbessern sowie Entscheidungskonflikte reduzieren. Der medizinische Behandlungserfolg war allerdings nicht besser als in einer Kontrollgruppe.
• In einer weiteren Münchener Studie wurden Informationsmaterialien und Entscheidungshilfen für Patienten mit neu diagnostiziertem Brustkrebs entwickelt. Hier zeigte sich, dass die informierteren Krebspatienten weniger Entscheidungskonflikte hatten und ein besseres Gefühl der Krankheitskontrolle.
• Palliative (schmerzlindernde) Hilfen standen im Mittelpunkt eines Jenaer Projekts bei unheilbar kranken Patienten im Endstadium der Krankheit. Das Beratungsteam konnte allerdings keinen Einfluss auf die Entscheidung der Patienten nehmen, ob sie zu Hause oder in der Klinik sterben wollten.
• Schließlich untersuchte eine Studie in Erlangen-Nürnberg bei Bluthochdruck-Patienten, welchen Effekt Trainingsprogramme zum Shared Decision Making bei Ärzten und Patienten haben. Es wurden bessere Patientenkenntnisse über die Krankheit festgestellt, aber kein genereller Effekt für den Therapieerfolg. Nur bei einer Patientengruppe, die in sehr starkem Maße an einer Partizipativen Entscheidungsfindung interessiert war, zeigte sich neben einer höheren Therapietreue auch eine sehr viel bessere Kontrolle des Blutdrucks.
Unter dem Strich lässt sich damit erneut bilanzieren, dass die Implementierung von Shared Decision Making vielfältige Positiveffekte bei Patienten bewirkt: Bessere Kenntnisse über Krankheitsursachen und -verlauf, höhere Patientenzufriedenheit, weniger Entscheidungskonflikte. Ein nachhaltiger Effekt auf den Behandlungserfolg konnte jedoch nur in Untergruppen festgestellt werden. Damit wird vor allem deutlich, dass eine pauschale und undifferenzierte Anwendung von Partizipationsmodellen in der medizinischen Versorgung wenig erfolgversprechend ist. Wahrscheinlich müssten, so wie dies in neueren Studien theoretisch entwickelt wurde, sehr viel stärker die jeweiligen individuelle Bedürfnisse von Patienten berücksichtigt werden.
• Ein Abstract des Aufsatzes ist hier nachzulesen: Patient and citizen participation in German health care - current state and future perspectives
• Die übrigen genannten Aufsätze zu Shared Decision Making in acht Ländern finden sich in der Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen - German Journal for Quality in Health Care
(Volume 101, Issue 4, 10 May 2007)
Gerd Marstedt, 4.7.2007
Partizipative Entscheidungsfindung bei depressiven Patienten zeigt positive Effekte
 Für das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung (oder "Shared Decision Making" SDM) und seine Anwendung in der medizinischen Versorgung wurden in Studien vielfältige Positiveffekte gefunden: Eine höhere Therapietreue von Patienten, ein besser Umgang mit Beschwerden und Handicaps, mehr Kenntnisse über Krankheitsursachen und -verlauf, stärkere Zufriedenheit mit der Therapie und dem Therapeuten. Nicht ganz so überzeugend sind bislang allerdings Forschungsergebnisse, die unmittelbar den Behandlungserfolg und gesundheitliche Effekte betreffen. In den hierzu vorliegenden Übersichtsarbeiten finden sich nur sehr wenige Studien, die auch eine deutliche Überlegenheit der Patientenbeteiligung hinsichtlich des medizinischen Behandlungserfolgs und Gesundheitszustands dokumentieren. (vgl. als Übersichtsarbeit etwa: "Was bringen Maßnahmen zur Stärkung der Patienten-Beteiligung an medizinischen Entscheidungen? Ergebnisse einer Literaturrecherche", Forum Gesundheitspolitik Shared Decision Making, in dieser Rubrik, oder: Improving patients’ communication with doctors: a systematic review of intervention studies)
Für das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung (oder "Shared Decision Making" SDM) und seine Anwendung in der medizinischen Versorgung wurden in Studien vielfältige Positiveffekte gefunden: Eine höhere Therapietreue von Patienten, ein besser Umgang mit Beschwerden und Handicaps, mehr Kenntnisse über Krankheitsursachen und -verlauf, stärkere Zufriedenheit mit der Therapie und dem Therapeuten. Nicht ganz so überzeugend sind bislang allerdings Forschungsergebnisse, die unmittelbar den Behandlungserfolg und gesundheitliche Effekte betreffen. In den hierzu vorliegenden Übersichtsarbeiten finden sich nur sehr wenige Studien, die auch eine deutliche Überlegenheit der Patientenbeteiligung hinsichtlich des medizinischen Behandlungserfolgs und Gesundheitszustands dokumentieren. (vgl. als Übersichtsarbeit etwa: "Was bringen Maßnahmen zur Stärkung der Patienten-Beteiligung an medizinischen Entscheidungen? Ergebnisse einer Literaturrecherche", Forum Gesundheitspolitik Shared Decision Making, in dieser Rubrik, oder: Improving patients’ communication with doctors: a systematic review of intervention studies)
Eine der bislang wenigen Ausnahmen hiervon ist eine deutsche Studie, die im Rahmen des vom BMG initiierten Forschungsverbunds "Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess" Vorraussetzungen und Effekte einer stärkeren Patientenbeteiligung bei Depressionen untersucht hat. Das Projekt wurde in mehreren Etappen durchgeführt. Zunächst entwickelte die Freiburger Gruppe patientengerechte und an Leitlinien orientierte Informationsmaterialien sowie eine Entscheidungshilfe, die über verschiedene Therapiemöglichkeiten informierte. Die Broschüre ist auch im Internet verfügbar: Patienten-Information für Patienten mit depressiven Erkrankungen.
Darüber hinaus wurden jedoch auch Ärzte in die Studie systematisch einbezogen. Für 20 niedergelassene Hausärzte, die Patienten mit depressiven Störungen in ihrer Praxis behandelt hatten, wurde sechs Monate lang in Abendveranstaltungen eine Fortbildung durchgeführt. Die Methodik der Fortbildung bestand aus Vorträgen und Diskussionsrunden, Gesprächsübungen, Rollenspielen und Videobeispielen als Modell der Partizipativen Entscheidungsfindung. Dabei wurden standardisierte oder auch reale Fallbeispiele aus der hausärztlichen Praxis genutzt.
Einbezogen in die Studie waren dann über 400 Patienten mit depressiven Erkrankungen. Diese wurden entweder der Interventionsgruppe zugeordnet (mit Informationsbroschüre, Entscheidungshilfe und Therapie bei einem der 20 Ärzte mit Fortbildung im Shared Decision Making) oder einer Kontrollgruppe (mit üblicher Therapie durch 10 Ärzte, die an keiner Fortbildung teilgenommen hatten). Schließlich wurden im Vergleich der beiden Gruppen die Auswirkungen der partizipativen Entscheidungsfindung für Ärzte und Patienten detailliert überprüft. Berücksichtigt wurde aber auch, dass das tatsächlich Ausmaß der Patientenbeteiligung unabhängig von der Zuordnung "Untersuchungsgruppe - Kontrollgruppe" erheblich variierte.
Als Ergebnis zeigte sich, dass Patienten, die in höherem Ausmaß an der medizinischen Entscheidungsfindung beteiligt waren,
• sowohl die Diagnose Depression als auch deren Behandlung erheblich besser akzeptierten,
• die verordneten Medikamente zuverlässiger einnahmen
• sowie auch einen höheren Behandlungserfolg aufwiesen. In der Gruppe mit höherer Beteiligung waren nach 6 bis 8 Wochen 64% der Patienten erfolgreich behandelt, bei den geringer Beteiligten nur 50%. Gemessen wurde dieser Behandlungserfolg mit einem Gesundheitsfragebogen für Patienten, durch den eingeschätzt werden kann, ob eine Depression vorliegt oder nicht.
• Als Ergebnis besonders herauszustellen ist schließlich auch, dass die positiven Effekte des Trainingsprogramms für Ärzte nicht mit einer verlängerten Konsultationszeit in der Praxis einhergehen. Die Befürchtungen niedergelassener Ärzte, dass eine Anwendung von Shared Decision Making schon aus zeitlichen Gründen bzw. damit zusammenhängenden Honorierungs-Problemen unrealistisch ist, ließ sich somit nicht bestätigen.
Die Wissenschaftler hatten für ihre Studie ein sehr komplexes Studiendesign gewählt, das nicht nur real vorfindliche Unterschiede in der medizinischen Versorgung und deren Effekte analysierte, sondern auf zwei Ebenen Interventionen durchführte, bei Patienten wie Ärzten. Aus diesem Grunde musste auch eine Forschungsfrage unbeantwortet bleiben, nämlich in welchem Ausmaß die erwünschten Effekte auf die Patienteninformation, die Entscheidungshilfe oder die ärztliche Fortbildung zurückzuführen ist.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Effekte der Patientenbeteiligung in der Grundversorgung depressiver Patienten - Höhere Therapietreue und bessere Behandlungsergebnisse (Klinikarzt 2007; 36: 38-41, DOI: 10.1055/s-2007-970174)
Die Ergebnisse sind auch hier (auf englisch) veröffentlicht: The effects of a shared decision-making intervention in primary care of depression: A cluster-randomized controlled trial (Patient Education and Counseling, Article in Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.pec.2007.03.023)
Gerd Marstedt, 17.6.2007
Ärzte sind auch nur Menschen: Sympathie und unterschwellige Urteile sind ein zentraler Faktor für die Patientenzentrierung des Arztes
 Eine große Zahl von Studien hat gezeigt, dass die Qualität der medizinischen Versorgung für einen Patienten auch sehr stark abhängt von den sozialen und kommunikativen Kompetenzen des Arztes. Bei Ärzten, die ausführlich informieren, dem Patienten Respekt und Verständnis entgegen bringen und ihn zu einer Beteiligung an anstehenden Entscheidungen ermuntern, wurde zumeist eine höhere Patientenzufriedenheit, Therapietreue und auch eine stärkere Verbesserung des Gesundheitszustands gefunden. Dass das Kommunikationsverhalten von Ärzten gegenüber ihren Patienten von vielen Faktoren abhängt, ist bekannt: Eine Rolle spielt hier nicht nur, ob solche Themen auch in der medizinischen Ausbildung behandelt wurden, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale des Arztes sind maßgeblich oder der Zeitdruck in der Praxis.
Eine große Zahl von Studien hat gezeigt, dass die Qualität der medizinischen Versorgung für einen Patienten auch sehr stark abhängt von den sozialen und kommunikativen Kompetenzen des Arztes. Bei Ärzten, die ausführlich informieren, dem Patienten Respekt und Verständnis entgegen bringen und ihn zu einer Beteiligung an anstehenden Entscheidungen ermuntern, wurde zumeist eine höhere Patientenzufriedenheit, Therapietreue und auch eine stärkere Verbesserung des Gesundheitszustands gefunden. Dass das Kommunikationsverhalten von Ärzten gegenüber ihren Patienten von vielen Faktoren abhängt, ist bekannt: Eine Rolle spielt hier nicht nur, ob solche Themen auch in der medizinischen Ausbildung behandelt wurden, sondern auch Persönlichkeitsmerkmale des Arztes sind maßgeblich oder der Zeitdruck in der Praxis.
Eine neue Studie hat jetzt jedoch auch gezeigt, dass auch überaus "weiche" Faktoren wie Sympathie oder Antipathie, Emotionen oder Einschätzungen des Patienten eine große Rolle für die Kommunikation des Arztes spielen und seinen Respekt gegenüber dem Patienten und seinem Anliegen. Basis der vorab in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" online veröffentlichten Studie waren einerseits Audio-Aufzeichnungen von Arzt-Patienten-Gesprächen, an denen insgesamt 29 niedergelassene Ärzte in Praxen oder Versorgungszentren der Allgemeinversorgung in Texas, USA, und über 200 Patienten teilnahmen.
Diese Audio-Mitschnitte wurden von den Wissenschaftlern nachträglich bewertet hinsichtlich des vom Arzt, aber auch vom Patienten gezeigten Kommunikationsstils. Unterschieden wurden hier drei Formen, die ein unterschiedliches Ausmaß an Patientenzentrierung bedeuten: informierend, unterstützend, partnerschaftlich. Ferner wurde die im Gespräch deutlich werdende emotionale Atmosphäre klassifiziert, ob sie eher von positiven oder negativen Gefühlsäußerungen beherrscht war.
Darüber hinaus füllten die teilnehmenden Ärzte aber auch nach den Gesprächen jeweils einen Fragebogen aus, in dem sie die Patienten nach verschiedenen Merkmalen beurteilten: Ihr Kommunikationsstil, ihre Emotionalität im Gespräch, die bei ihnen vermutete Therapietreue und Zufriedenheit mit dem Behandlungsgespräch. In ähnlicher Weise bewerteten auch die Patienten in einem Fragebogen den Arzt und das Behandlungsgespräch. Erfasst wurden außerdem verschiedene Patientenmerkmale wie Rasse/Hautfarbe, Alter, Geschlecht und Bildungsniveau.
In der Auswertung dieser vielfältigen Daten zeigte sich dann unter anderem:
• Ärzte waren dann stärker patienten-orientiert und partnerschaftlich eingestellt, wenn sie den Patienten als "guten Erzähler" einstuften. Ebenso galt dies, wenn sie annahmen, dass der Patient zufrieden mit der Behandlung war und die Therapieanweisungen vermutlich befolgen würde.
• Sie zeigten einen stärker partnerschaftlichen Kommunikationsstil, wenn Patienten positive Gefühle geäußert, sich intensiv in das Gespräch eingebracht und weniger Widerspruch oder Gegenmeinungen artikuliert hatten.
• Gegenüber dunkelhäutigen Patienten waren Ärzte eher direktiv und tonangebend in ihren Äußerungen. Sie stuften Patienten dieser Hautfarbe durchweg auch als schlechtere Erzähler ihres Anliegens ein und als eher unzufrieden mit dem Gespräch.
• Ärzte, die sich selbst einstuften als tendenziell partnerschaftlich orientiert, setzten dies auch zumeist tatsächlich im Gespräch mit dem Patienten so um.
• Das Alter, Geschlecht oder Bildungsniveau eines Patienten spielte keine Rolle für den vom Arzt umgesetzten Kommunikationsstil.
Unter dem Strich wurde damit deutlich, dass unterschwellige Emotionen des Arztes eine überaus große Rolle spielen für den jeweils realisierten Kommunikationsstil: Die empfundene Sympathie oder auch die Einschätzung, ob ein Patient ein "guter Patient" ist, also sein Anliegen gut darstellt, Ängste und Hoffnungen artikuliert und nicht zuletzt auch ärztliche Therapieanweisungen befolgt. In diesen Fällen waren Ärzte überaus partnerschaftlich eingestellt. Gegenüber "unliebsamen Patienten" jedoch, die Widerspruch erhoben, ihr Anliegen verbal nur schlecht darstellten oder keinerlei Gefühle zeigten, zeigten Ärzte sich sehr viel weniger patienten-zentriert. Diese Haltung zeigte sich etwa daran, ob der Patient aufgefordert wurde, auch seine Ängste und Befürchtungen zu äußern, ob er als gleichrangig und mit Respekt behandelt wurde usw.
Auch für die Forscher war der überaus starke Einfluss psychologischer Faktoren auf die Qualität und Patientenzentrierung des ärztlichen Behandlungsgesprächs überraschend. Mit der tendenziellen Diskriminierung dunkelhäutiger Patienten hatten sie ebenfalls nicht gerechnet. Allerdings zeigte sich in einer zusätzlichen Auswertung, dass Ärzte nicht-weißer Hautfarbe diese Tendenz nicht ganz so stark zeigten. Vermutet wird von den Forschern, dass dunkelhäutige Patienten teilweise aufgrund früherer Negativerfahrungen dazu neigen, in der ärztlichen Praxis selbstbewusster und energischer aufzutreten. Sie hoffen, damit eine möglichst optimale Therapie zu bekommen - ohne zu wissen, dass dies bei vielen Ärzten eher das Gegenteil bewirkt, zumindest im Hinblick auf Aspekte wie Zuhören oder Respekt.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Richard L. Street, Jr, Howard Gordon, and Paul Haidet: Physicians' communication and perceptions of patients: Is it how they look, how they talk, or is it just the doctor? (Social Science & Medicine (2007), doi:10.1016/j.socscimed.2007.03.036)
Jetzt auch als kostenloser Volltext Download
Gerd Marstedt, 4.6.2007
Was bringen Maßnahmen zur Stärkung der Patienten-Beteiligung an medizinischen Entscheidungen? Ergebnisse einer Literaturrecherche
 Eine Vielzahl von Patienten wünscht sich in der medizinischen Versorgung eine stärkere persönliche Beteiligung an Entscheidungen, die zu treffen sind: Ob man einen bestimmten Früherkennungstest durchführen soll oder nicht, ob man sich bei einer Erkrankung lieber für Therapie A oder B mit jeweils unterschiedlichen Vor- und Nachteilen entscheiden soll. Die sog. "Partizipative Entscheidungsfindung" (oder "Shared-Decision-Making"), dies hat eine Reihe von Studien gezeigt, erhöht nicht nur die Patientenzufriedenheit mit dem behandelnden Arzt und dem Therapieverlauf, sondern erhöht auch die "Compliance" (oder neuerdings: "Adherence", also die Einhaltung der Therapievorgaben) und erhöht damit mittelbar auch die Chancen für den Therapieerfolg.
Eine Vielzahl von Patienten wünscht sich in der medizinischen Versorgung eine stärkere persönliche Beteiligung an Entscheidungen, die zu treffen sind: Ob man einen bestimmten Früherkennungstest durchführen soll oder nicht, ob man sich bei einer Erkrankung lieber für Therapie A oder B mit jeweils unterschiedlichen Vor- und Nachteilen entscheiden soll. Die sog. "Partizipative Entscheidungsfindung" (oder "Shared-Decision-Making"), dies hat eine Reihe von Studien gezeigt, erhöht nicht nur die Patientenzufriedenheit mit dem behandelnden Arzt und dem Therapieverlauf, sondern erhöht auch die "Compliance" (oder neuerdings: "Adherence", also die Einhaltung der Therapievorgaben) und erhöht damit mittelbar auch die Chancen für den Therapieerfolg.
Vor allem im anglo-amerikanischen Bereich bemüht man sich seit Jahren auch darum, die Patientenbeteiligung in der ärztlichen Sprechstunde zu intensivieren. In einer jetzt im "Deutschen Ärzteblatt" veröffentlichten Literaturrecherche, die ihrerseits nur Übersichtsarbeiten berücksichtigt hat, wurde nun eine Bilanz versucht, ob und in welcher Hinsicht solche Maßnahmen zur Stärkung der Partizipativen Entscheidungsfindung erfolgreich sind. Unterschieden werden von den Autoren dabei drei Vorgehensweisen:
• Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Medizinstudenten und Ärzte, bei denen in Kursen oder Seminaren Kommunikationsfertigkeiten erläutert und auch trainiert werden, damit Ärzte ihre Patienten dazu ermuntern, sich bei medizinischen Entscheidungen stärker zu beteiligen
• Medizinische Entscheidungshilfen (sog. "Decision Aids"), gedruckte Materialien oder auch audio-visuelle Medien für Patienten, die über die Erkrankung und die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Therapieformen informieren, so dass der Patient im Gespräch mit dem Arzt über bessere Kenntnisse verfügt.
• Patienten- und Multiplikatorenschulungen: Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen, die Gesprächs- und Handlungskompetenzen bei Patienten aufbauen sollen.
Für die Auswertung der Forschungsbefunde wurden 10 systematische Übersichtsarbeiten berücksichtigt, die sich auf insgesamt 256 randomisierte kontrollierte Studien beziehen. Die Literaturübersicht geht leider nicht auf Details der Forschungsbefunde ein bzw. stellt Vorgehensweisen und Ergebnisse nur in einer tabellarischen Übersicht dar. Als Fazit wird jedoch hervorgehoben, dass die untersuchten Maßnahmen in vielerlei Hinsicht dabei erfolgreich sind, eine stärkere Involvierung von Patienten in Prozesse des Shared Decision Making zu bewirken. Die Autoren fassen dies so zusammen: "Die Interventionen bewirkten
• eine Zunahme des Wissens,
• eine realistischere Erwartung über Behandlungsverläufe,
• eine aktivere Beteiligung am medizinischen Behandlungsprozess,
• eine Verringerung von Entscheidungskonflikten und eine Abnahme der Unentschlossenheit der Patienten gegenüber Behandlungen,
• eine Verbesserung der Arzt-Patienten-Kommunikation
• und der Risikowahrnehmung der Patienten."
Als gesundheitspolitische Konsequenz aus den Forschungsergebnissen wird die Forderung erhoben: "Zusammenfassend ergibt sich die Notwendigkeit, die Partizipative Entscheidungsfindung stärker in der Regelversorgung zu verankern. Eine höhere Akzeptanz wird sich einstellen, wenn mehr Ärzte und Patienten die Erfahrung machen, dass die PEF sich in der Praxis vorteilhaft auswirkt."
Die Literatur-Recherche ist hier nachzulesen Loh/Simon/Kriston/Härter Patientenbeteiligung bei medizinischen Entscheidungen: Effekte der Partizipativen Entscheidungsfindung aus systematischen Reviews (Dtsch Arztebl 2007; 104(21): A 1483-8)
Die Studie als PDF-Datei
Gerd Marstedt, 30.5.2007
Deutsche Frauen wollen über die Therapie mitentscheiden, Frauen aus Skandinavien sind noch selbstbewusster
 Das traditionelle Verhältnis von Arzt und Patient hat sich verändert. Die früher weitgehend passive Rolle des Patienten, in der er Entscheidungen über die weitere Therapie allein dem Arzt überlassen hat, findet man aktuell fast nur noch bei Älteren. Die Mehrheit der Bevölkerung, dies hat eine Vielzahl internationaler Studien gezeigt, bevorzugt heute in der Arztpraxis einen Konsultationsstil, der als "Shared Decision Making" (SDM) oder "Partizipative Entscheidungsfindung" (PEF) bezeichnet wird: Man möchte mit dem Arzt über gesundheitliche Befunde diskutieren und mit ihm zusammen eine gemeinsame Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf treffen.
Das traditionelle Verhältnis von Arzt und Patient hat sich verändert. Die früher weitgehend passive Rolle des Patienten, in der er Entscheidungen über die weitere Therapie allein dem Arzt überlassen hat, findet man aktuell fast nur noch bei Älteren. Die Mehrheit der Bevölkerung, dies hat eine Vielzahl internationaler Studien gezeigt, bevorzugt heute in der Arztpraxis einen Konsultationsstil, der als "Shared Decision Making" (SDM) oder "Partizipative Entscheidungsfindung" (PEF) bezeichnet wird: Man möchte mit dem Arzt über gesundheitliche Befunde diskutieren und mit ihm zusammen eine gemeinsame Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf treffen.
Eine norwegische Studie hat nun untersucht, inwieweit dieses neue Patienteninteresse an gemeinsamen Entscheidungen in verschiedenen europäischen Ländern gleich stark ausgeprägt ist. Basis der Studie war eine Befragung von über 9.000 Frauen in 15 europäischen Ländern, die alle an Harn-Inkontinenz leiden und deshalb die Praxis eines Fach- oder Hausarztes aufgesucht haben. Insgesamt 1.055 Ärzte verteilten einen Fragebogen an diese Patientinnen, in dem sie unter anderem um Auskunft gebeten wurden, welchen Stil der Arzt-Patient-Konsultation sie am meisten bevorzugen. Zur Auswahl standen fünf Alternativen:
• (1) Ich selbst möchte die letzte Entscheidung über die weitere Behandlung treffen. (Typ: Aktiv)
• (2) Ich selbst möchte die letzte Entscheidung über die weitere Behandlung treffen, nachdem ich die Meinung des Arztes sorgfältig geprüft habe. (Aktiv)
• (3) Ich möchte gemeinsam mit dem Arzt entscheiden, welche Behandlung für mich am besten ist. (Partizipativ)
• (4) Ich möchte, dass der Arzt die letzte Entscheidung trifft, nachdem er sorgfältig meine Meinung dazu geprüft hat. (Passiv)
• (5) Ich möchte alle Entscheidungen über meine Behandlung dem Arzt überlassen. (Passiv)
Das zentrale Ergebnis der Analyse zeigt dann einen überraschenden Nord-Süd-Verlauf hinsichtlich der bevorzugten Arzt-Patient-Kommunikation. Frauen in Dänemark, Norwegen und Finnland bevorzugen am häufigsten eine aktive Rolle (Antwortmuster 1 und 2) wollen also nicht nur mit dem Arzt mitentscheiden, sondern trauen sich selbst die letzte Entscheidung über die weitere Therapie zu. Umgekehrt findet man eine Vorliebe für die passive Rolle der Patienten am weitesten verbreitet in südeuropäischen Ländern wie Griechenland, Portugal und Spanien. In den mitteleuropäischen Ländern (wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux-Staaten, Frankreich) findet das partizipative Muster am meisten Zustimmung.
Quantitativ zeigt sich dies beispielsweise daran, dass über ein Drittel (33-36%) der skandinavischen Frauen die Typen A und B wählten, während dies in Südeuropa nur bei 5-7% der Frauen der Fall war. Umgekehrt wählten in Griechenland, Portugal und Spanien über die Hälfte der Frauen (49-70%) eine passive Rolle, in Skandinavien hingegen weniger als 20%. Die Ergebnisse zeigten sich auch dann, wenn man die unterschiedliche Sozialstruktur der Stichproben in den einzelnen Ländern nach Merkmalen wie Alter, Bildungsniveau oder Erwerbstätigkeit kontrollierte oder auch den Schweregrad der Gesundheitsbeschwerden in der Analyse mitberücksichtigte.
Die Wissenschaftler interpretieren ihre Ergebnisse als Einfluss kultureller Normen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft und verweisen auch darauf, dass die berufliche Integration der Frauen einen Einfluss hat für ihr Rollenverständnis, das sich sogar im Verhältnis zu Ärzten niederschlägt. Denn während Frauen in den skandinavischen recht häufig ins Erwerbsleben integriert sind, ist dies in Südeuropa weniger der Fall. Die Ergebnisse zeigen damit, dass kulturelle Normen und Werte auch überaus bedeutsam sind für Patientenerwartungen im Gesundheitswesen.
Ein Abstract des Aufsatzes ist hier nachzulesen: General preferences for involvement in treatment decision making among European women with urinary incontinence ( Social Science & Medicine, Volume 64, Issue 9 , May 2007, Pages 1914-1924)
Gerd Marstedt, 8.4.2007
Maßnahmen zur Stärkung der Patientenbeteiligung greifen bei älteren Patienten bislang kaum
 Viele Studien haben gezeigt: Jüngere Patienten möchten heute in der ärztlichen Sprechstunde an Entscheidungen über das weitere therapeutische Vorgehen aktiv beteiligt werden. Demgegenüber sind Ältere häufig noch fixiert auf die traditionelle, paternalistische Rollenverteilung zwischen Arzt und Patient, neigen meist dazu, allein dem Mediziner solche Entscheidungen zu überlassen. Da die Patientenbeteiligung ("Shared Decision Making") sich jedoch in vielen Studien als vorteilhaft für die Genesung erwiesen hat, etwa aufgrund einer stärkeren Befolgung ärztlicher Verordnungen, werden seit einiger Zeit in den USA, in Großbritannien und auch in Deutschland Anstrengungen unternommen, diese Beteiligung auch bei älteren Patienten durch unterschiedliche Interventionen zu verstärken.
Viele Studien haben gezeigt: Jüngere Patienten möchten heute in der ärztlichen Sprechstunde an Entscheidungen über das weitere therapeutische Vorgehen aktiv beteiligt werden. Demgegenüber sind Ältere häufig noch fixiert auf die traditionelle, paternalistische Rollenverteilung zwischen Arzt und Patient, neigen meist dazu, allein dem Mediziner solche Entscheidungen zu überlassen. Da die Patientenbeteiligung ("Shared Decision Making") sich jedoch in vielen Studien als vorteilhaft für die Genesung erwiesen hat, etwa aufgrund einer stärkeren Befolgung ärztlicher Verordnungen, werden seit einiger Zeit in den USA, in Großbritannien und auch in Deutschland Anstrengungen unternommen, diese Beteiligung auch bei älteren Patienten durch unterschiedliche Interventionen zu verstärken.
In einer Metaanalyse schon veröffentlichter wissenschaftlicher Studien hat jetzt die "Cochrane Collaboration" überprüft, inwieweit diese Interventionen auch zum gewünschten Erfolg geführt haben. In diese Bilanzierung des Forschungsstandes "Interventions for improving older patients' involvement in primary care episodes" wurden Studien mit verschiedenen Maßnahmen einbezogen: schriftliche Informationen zur Vorbereitung auf den Arztbesuch und zur stärkeren Beteiligung am Entscheidungsprozess, audio-visuelle Vorführungen und Trainingsprogramme für Patienten, Listen mit potentiellen Fragen an den Arzt. So erhielten in einer Studie die Patienten drei Tage vor dem Arztbesuch per Email eine Trainingsbroschüre mit Hinweisen zugeschickt, wie sie bei dem bevorstehenden Arztgespräch ihre Wünsche und Fragen einbringen könnten. Überdies wurden sie kurz vor dem Arztbesuch noch einmal von einem Wissenschaftler interviewt und auf das Arztgespräch vorbereitet. In einer anderen Studie versuchte man die aktive Beteiligung der Patienten durch mehrere Interventionen zu intensivieren: Durch Teilnahme an Gruppensitzungen, in denen ein Rollentausch von Arzt und Patient durchgespielt wurde, durch Merkzettel, die praktische Hinweise auf ein aktives Patientenverhalten beschrieben und durch ein Heft, in das Patienten ihre Wünsche und Fragen hinsichtlich des Arztgesprächs eintragen konnten.
Ein erstes allgemeines Ergebnis der Bilanzierung war, dass in keiner einzigen derzeit vorliegenden Studie die eigentlich wichtigen Indikatoren für eine solche Fragestellung berücksichtigt worden sind. Die Frage "Hat eine aktivere Beteiligung älterer Patienten beim Arztgespräch auch Auswirkungen für den Gesundheitszustand, das Wohlbefinden oder Veränderungen im Gesundheitsverhalten" ist daher bislang nicht zu beantworten. In der Regel ist in vorliegenden Studien lediglich überprüft worden, ob die Interventionen zu einem aktiveren Patientenverhalten (durch mehr Fragen an den Arzt) oder zu einer besseren Patientenzufriedenheit führen. Festgestellt wurde darüber hinaus, dass die meisten der vorliegenden Studien in methodischer Hinsicht starke Defizite aufweisen, so dass von den zunächst einbezogenen 88 Veröffentlichungen lediglich drei für die eigentliche Bilanzierung berücksichtigt wurden.
Aber auch für diese drei methodisch fundierteren Studien mit insgesamt 433 Patienten wurde ein eher ernüchterndes Fazit gezogen: In einer Studie zeigte die Intervention keinerlei Effekte im Vergleich mit einer Kontrollgruppe, wenn man die Zeitdauer des Arzt-Patient-Gesprächs oder die Intensität des Frage-Antwort-Verhaltens verglich. In einer zweiten Studie zeigte sich kein Unterschied in der generellen Patientenzufriedenheit zwischen "trainierten" und "untrainierten" Patienten. Allerdings fand man Hinweise, dass bestimmte Trainingsformen zu einem intensiveren Frageverhalten führen.
Das Fazit der Wissenschaftler fiel daher eher kritisch aus: "Unter dem Strich zeigt unsere Auswertung einige Effekte bei den unterschiedlichen Interventionen zur Stärkung der Patientenbeteiligung bei Älteren. Da dieser Effekt jedoch eher schwach ausfällt, können wir keine Empfehlung für den Alltagsgebrauch solcher Maßnahmen aussprechen. In der ärztlichen Praxis sollte ein gewisses Gleichgewicht bestehen in der Respektierung der Patientenautonomie einerseits und Bemühungen zur Intensivierung ihrer Beteiligung an therapeutischen Entscheidungen andererseits. Trainingssitzungen für Patienten mit oder ohne schriftliche Informationsmaterialien könnten ein gangbarer Weg sein. Da dies jedoch für die gesamte Bevölkerung nicht umsetzbar ist, wäre es sinnvoll, eine Patientengruppe zu identifizieren, die davon am meisten profitiert, die sich also solche Unterstützung wünscht, aber nicht über die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Diese Patienten könnten in Gruppensitzungen trainiert werden."
Bemühungen zu einem aktiveren Patientenverhalten waren auch Gegenstand eines von der Europäischen Union geförderten Projekts zur "Entwicklung und Implementierung von Instrumenten zur Förderung der Einbeziehung älterer Patienten in der hausärztlichen Versorgung.". Ziel dieses Projekts "IMPROVE" war es, Hilfsmittel auszuwählen und zu erproben, die ältere Patienten dazu ermutigen und befähigen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der hausärztlichen Konsultation eine aktivere Rolle einzunehmen. Dazu wurden unter anderem auch schriftliche Informationsmaterialien erarbeitet und in Wartezimmern von Arztpraxen ausgelegt. Das Projekt überprüfte auch die Akzeptanz solcher Materialien bei älteren Patienten und kam zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Cochrane-Übersichtsarbeit. Zusammenfassend heißt es, dass "die Instrumente in manchen Situationen sehr hilfreich waren, indem sie Patienten dazu ermutigten Fragen zu stellen, ihre Erfahrungen einzubringen und aus ihrer Sicht wichtige Themen anzusprechen. Für manche Patienten stellten sie jedoch auch eine Behinderung bei der Formulierung ihrer Anliegen dar. Es sollte deshalb jeweils zusammen mit den Patienten ausprobiert werden, ob ein Instrument sich eignet oder nicht, und wie man es am sinnvollsten anwendet."
Die erarbeiteten Materialien und die Ergebnisse der Studie stehen hier zum Download zur Verfügung: "Stärkung der Rolle älterer Menschen in der hausärztlichen Versorgung - Instrumente und Anleitungen"
Gerd Marstedt, 19.3.2007
Shared Decision Making: In der Theorie hoch entwickelt, in der (ärztlichen) Praxis noch ein Mauerblümchen
 Viele Studien haben gezeigt: "Shared Decision Making" (oder: "Partizipative Entscheidungsfindung"), also eine intensive Beteiligung von Patienten an der Entscheidung über das weitere therapeutische Vorgehen durch Informationen und eine intensive Arzt-Patient-Kommunikation, ist heute ein Anspruch der meisten Patienten. In der Theorie ist das Konzept weit entwickelt, in der ärztlichen Praxis indes hapert es noch an allen Ecken und Enden. Ärzte sind zumeist noch weit davon entfernt, die individuellen Ansprüche ihrer Patienten genauer wahrzunehmen und auch darauf einzugehen. Dies ist das Ergebnis einer systematischen Auswertung von Literaturstudien, die jetzt das Picker-Institut vorgelegt hat: "Patient-focused interventions - A review of the evidence".
Viele Studien haben gezeigt: "Shared Decision Making" (oder: "Partizipative Entscheidungsfindung"), also eine intensive Beteiligung von Patienten an der Entscheidung über das weitere therapeutische Vorgehen durch Informationen und eine intensive Arzt-Patient-Kommunikation, ist heute ein Anspruch der meisten Patienten. In der Theorie ist das Konzept weit entwickelt, in der ärztlichen Praxis indes hapert es noch an allen Ecken und Enden. Ärzte sind zumeist noch weit davon entfernt, die individuellen Ansprüche ihrer Patienten genauer wahrzunehmen und auch darauf einzugehen. Dies ist das Ergebnis einer systematischen Auswertung von Literaturstudien, die jetzt das Picker-Institut vorgelegt hat: "Patient-focused interventions - A review of the evidence".
Eine der Fragestellungen der Autoren ist: Wie kann man Patienten dazu befähigen, an therapeutischen Entscheidungen kompetent mitzuwirken? Und was ist effektiver: Ein Kommunikations-Training für Mediziner und Ärzte oder verbesserte Informationen und Entscheidungshilfen für Patienten? Bevor sie den wissenschaftlichen Forschungsstand zu dieser Frage sinnvoller und effektiver Interventionen zur Verbesserung von Shared Decision Making nachgehen, gehen die Wissenschaftler jedoch auf den Status quo ein. Sie müssen dabei aufgrund einer Vielzahl von Untersuchungen feststellen, dass Ärzte noch erhebliche Probleme bei der Umsetzung von Shared Decision Making haben:
• Eine Studie bei 62 Allgemeinärzten fand, dass Ärzte die spezifischen Bedürfnisse ihrer Patienten oft unberücksichtigt lassen und dazu neigen, die Krankheit, und nicht die kranke Person in den Vordergrund zu stellen.
• Eine andere Studie wertete über 1.000 Audio-Mitschnitte von Arzt-Patient-Gesprächen bei Ärzten verschiedener Fachrichtung aus und fand: Nur bei 21% wurden Patientenwünsche diskutiert, nur bei 11% Therapie-Alternativen erörtert, nur bei 6% über Vorteile und Risiken der Alternativen informiert
• Eine weitere Studie wertete 134 Veröffentlichungen über Beobachtungen von Arzt-Patient-Gesprächen aus. Als Fazit ergab sich, dass Ärzte überwiegend dazu neigen, die Kommunikation zu dominieren und Patienten sich schnell in eine passive Rolle drängen lassen.
• In einer repräsentativen Befragung in England bei knapp 100.000 Patienten im Jahre 2004 zeigte sich, dass knapp die Hälfte bei der letzten Arztkonsultation gerne mehr an der Entscheidung teilgehabt hätten, etwa 40% hätten auch gerne mitentschieden bei der Medikamentenauswahl und ebenso viele hätten sich mehr Informationen über die Arzneimittel-Nebenwirkungen gewünscht. (Coulter/Ellins, Kap 2, S. 64, dort auch Literaturhinweise zu den Studien)
Die Wissenschaftler überprüften in ihrer Studie jedoch auch, welche Konzepte und Interventionen bislang erprobt wurden, um zu mehr Entscheidungsteilhabe von Patienten in der Arztpraxis zu gelangen und wie erfolgreich diese waren. Unterschieden werden dabei drei Strategien: Unterschiedliche Formen des Kommunikationstrainings und der Gesprächsführung für Ärzte, Beratung von Patienten und Hilfsmittel (wie Fragekärtchen), um im Gespräch mit dem Arzt eigene Positionen besser einzubringen, Informationen und Entscheidungshilfen für Patienten durch unterschiedliche Medien (Broschüren, PC-Programme, Videos usw.)
Unter dem Strich zeigt sich, dass ein Königsweg für die Zielsetzung bislang nicht gefunden wurde. Viele Strategien zeigen in einigen Bereichen und für einige Kriterien Erfolge (z.B. Patientenzufriedenheit und Informationsstand), für andere jedoch nicht (Gesundheitszustand, Zeitaufwand und Kosten). Im Einzelnen wird bilanziert:
• Gesprächsführung für Ärzte: Verbesserung des Informationsstands der Patienten, höhere Zufriedenheit, weniger Ängste, bessere Compliance, aber widersprüchliche Befunde hinsichtlich des medizinischen Effekts.
• Patientenberatung zur Gesprächsführung: besserer Informationsstand, insgesamt keine eindeutigen Befunde.
• Entscheidungshilfen für Patienten: Besserer Informationsstand, bessere Übereinstimmung zwischen eigenen Wünschen und ärztlichem Verhalten, hinsichtlich der Patientenzufriedenheit und der gesundheitlichen Effekte keine übereinstimmenden Befunde.
Insgesamt wird damit für die Autoren noch ein sehr umfassender Forschungsbedarf offenbar, da keine der bislang praktizierten Strategien eindeutige und durchschlagende Erfolge aufweisen konnte.
Die Literaturstudie steht hier zum Download zu Verfügung: Improving clinical decision-making
Die Studie ist Teil einer noch umfassenderen Veröffentlichung des Picker Instituts, in der noch zu einer Reiher weiterer Fragen der medizinischen Versorgung und praktischen Ansätzen der Verbesserung im Rahmen von Literaturauswertungen berichtet wird, u.a. zum Thema Patientensicherheit, Kompetenz in Gesundheitsfragen ("Health Literacy"), Selbstmanagement von Patienten, Zugang zur Versorgung usw.: Angela Coulter, Jo Ellins: Patient-focused interventions - A review of the evidence, Hg.: Picker Institute Europe (PDF-Datei, 10,9 MB, 277 Seiten)
Gerd Marstedt, 13.2.2007
Shared Decision Making: Neuere Forschungsergebnisse zu Patientenerwartungen
 Eine große Zahl von Studien und Bevölkerungsumfragen hat zuletzt in Veröffentlichungen überraschende Ergebnisse vorgetragen, wonach gut zwei Drittel aller Patienten im Rahmen der ärztlichen Therapie eine Mitbeteiligung wünschen. "Arzt und Patient sollen gemeinsam über die Behandlung entscheiden" - dies ist heute nach den vorliegenden Studien eine normale Erwartung bei der großen Mehrheit aller Patienten. (vgl. die Artikel auf dieser Seite "Patienten wollen in der Sprechstunde mitentscheiden - Ärzte äußern sich zwiespältig" und "Shared Decision Making (SDM) - Was Patienten heute in der ärztlichen Sprechstunde erwarten" auf dieser Seite)
Eine große Zahl von Studien und Bevölkerungsumfragen hat zuletzt in Veröffentlichungen überraschende Ergebnisse vorgetragen, wonach gut zwei Drittel aller Patienten im Rahmen der ärztlichen Therapie eine Mitbeteiligung wünschen. "Arzt und Patient sollen gemeinsam über die Behandlung entscheiden" - dies ist heute nach den vorliegenden Studien eine normale Erwartung bei der großen Mehrheit aller Patienten. (vgl. die Artikel auf dieser Seite "Patienten wollen in der Sprechstunde mitentscheiden - Ärzte äußern sich zwiespältig" und "Shared Decision Making (SDM) - Was Patienten heute in der ärztlichen Sprechstunde erwarten" auf dieser Seite)
Eine neuere Studie hat nun in Wisconsin bei rund 5.200 Erwachsenen jeweils 75minütige Telefoninterviews durchgeführt und sie ein wenig genauer nach ihren Erwartungen und Wünschen im Rahmen ärztlicher Therapie befragt. Unter dem Strich zeigt sich, dass zwar die überwältigende Mehrheit der Patienten tatsächlich Information, Kommunikation und Beratung in der ärztlichen Sprechstunde erwartet. Eine Beratung durch den Arzt und erfahren zugleich eine eigenständige und allein getragene Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf treffen, sofern verschiedene Therapie-Alternativen zur Verfügung stehen, möchte jedoch weniger als die Hälfte (46%) der Patienten .
Die Autoren unterscheiden aufgrund der Interviewergebnisse vier verschiedene Patiententypen. In diese vier Kategorien konnten sie nahezu alle (96%) Befragten einordnen. Danach gibt es:
• beratungs-desinteressierte und zugleich Entscheidungen an den Arzt delegierende Patienten ("non-deliberative delegators"), diese machen insgesamt 23% aus,
• beratungs-interessierte, Entscheidungen jedoch an den Arzt delegierende Patienten ("deliberative delegators"), dies sind 16%,
• beratungs-interessierte und individuell entscheiden wollende Patienten ("deliberative autonomists"), diese sind mit 46% die größte Gruppe, und schließlich
• an Beratung nicht interessierte, gleichwohl aber persönlich und autonom entscheiden wollende Patientem ("non-deliberative autonomists"), die insgesamt nur 11% ausmachen.
Der komplette Aufsatz von Kathryn E. Flynn, Maureen A. Smith und David Vanness kann hier eingesehen werden: A typology of preferences for participation in healthcare decision making
Gerd Marstedt, 11.12.2006
Patienten wollen in der Sprechstunde mitentscheiden - Ärzte äußern sich zwiespältig
 Die Mehrzahl der Patienten will heute in der ärztlichen Sprechstunde mehr als nur ein Rezept oder eine körperliche Untersuchung, sie will vom Arzt ausführlich informiert werden und dann mitentscheiden über die Behandlungsmethode. Ärzte sind über den besseren Informationsstand von Patienten teilweise erfreut, sie sehen in den neu auf sie zukommenden Anforderungen aber auch zusätzliche Belastungen und kritisieren das Halbwissen der Patienten. Dies ist das Ergebnis repräsentativer Umfragen, die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung von NFO Infratest durchgeführt und von der Universität Bremen wissenschaftlich ausgewertet wurden. Eine umfassende Expertise zu geänderten Patientenwünschen wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Mehrzahl der Patienten will heute in der ärztlichen Sprechstunde mehr als nur ein Rezept oder eine körperliche Untersuchung, sie will vom Arzt ausführlich informiert werden und dann mitentscheiden über die Behandlungsmethode. Ärzte sind über den besseren Informationsstand von Patienten teilweise erfreut, sie sehen in den neu auf sie zukommenden Anforderungen aber auch zusätzliche Belastungen und kritisieren das Halbwissen der Patienten. Dies ist das Ergebnis repräsentativer Umfragen, die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung von NFO Infratest durchgeführt und von der Universität Bremen wissenschaftlich ausgewertet wurden. Eine umfassende Expertise zu geänderten Patientenwünschen wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt.
Bis in die 90er Jahre bevorzugte die Mehrheit der Patienten noch eine passive Rolle im medizinischen Behandlungsprozess. Die aktive und dominante Rolle des Arztes entsprach anscheinend den Bedürfnissen der meisten Patienten. Sie wollten eine Diagnose und ein Medikament oder eine Behandlungsmethode verschrieben bekommen, um ihre Krankheit zu kurieren. Diese Auffassung hat sich grundlegend geändert. Die Mehrzahl der Patienten in Deutschland und Europa ist heute, unterem durch das Internet, nicht nur sehr viel besser informiert über Krankheitsursachen und unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, sondern möchte auch an medizinischen Entscheidungen beteiligt werden.
58 Prozent der befragten Deutschen wünschen sich heute, dass sie vom Arzt an der Therapieentscheidung beteiligt werden, nur 28% möchte dies allein dem Arzt überlassen. Weitere 14 Prozent wollen die Entscheidung sogar alleine treffen, nachdem sie vom Arzt über Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt wurden. Diese Ergebnisse stimmen sehr genau mit dem überein, was in anderen Umfragen im Jahr 2003 in anderen europäischen Ländern gefunden wurde.
Die Autoren der Expertise, David Klemperer und Melanie Rosenwirth, ziehen aus den Befragungsergebnissen weit reichende Schlussfolgerungen. Ein nicht unerheblicher Teil der Ärzte sieht sich nur unzureichend vorbereitet, um auf die veränderten Patientenwünsche einzugehen. Sie fordern daher: "Die Medizinischen Fakultäten müssen vom Gesetzgeber zur Sicherstellung des Erwerbs kommunikativer Kompetenzen verpflichtet werden. Die Ärztekammern müssen die Ärzte dazu verpflichten, einen Teil (z. B. 20 Prozent) der Pflichtfortbildung in Kommunikationstrainings zu absolvieren. Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen müssen die Patientenbeteiligung zu einem obligaten Bestandteil der Verträge über neue Versorgungsformen machen."
Die Expertise kann als PDF-Datei heruntergeladen werden: Shared Decision Making
Gerd Marstedt, 26.9.2005
Shared Decision Making (SDM) - Was Patienten heute in der ärztlichen Sprechstunde erwarten
 Das "paternalistische Modell" der Arzt-Patient-Beziehung scheint heute ein Relikt zu sein, Patienten, die sich bei Erkrankungen oder Gesundheitsbeschwerden blind vertrauend und uninformiert der Obhut des Arztes übergeben. In einer Repräsentativbefragung des Gesundheitsmonitors wollen sich 58% der 9.146 Befragten am Entscheidungsprozess mit beteiligen. Allerdings möchten nur 14 Prozent der Versicherten allein die Entscheidung über ihre Behandlung fällen und 28 Prozent würden lieber den Arzt allein entscheiden lassen. Ältere Befragte äußern dabei häufiger als Jüngere die Option, dass der Arzt allein entscheidet. Patienten wünschen sich heute Ärzte, die ihnen umfassende Informationen über ihre Krankheit geben, sich für ihr Verständnis und ihre Deutung der Krankheit interessieren, sich um ihre Ängste kümmern, sie an den Entscheidungen beteiligen und dabei über einen warmen, zugewandten Kommunikationsstil verfügen.
Das "paternalistische Modell" der Arzt-Patient-Beziehung scheint heute ein Relikt zu sein, Patienten, die sich bei Erkrankungen oder Gesundheitsbeschwerden blind vertrauend und uninformiert der Obhut des Arztes übergeben. In einer Repräsentativbefragung des Gesundheitsmonitors wollen sich 58% der 9.146 Befragten am Entscheidungsprozess mit beteiligen. Allerdings möchten nur 14 Prozent der Versicherten allein die Entscheidung über ihre Behandlung fällen und 28 Prozent würden lieber den Arzt allein entscheiden lassen. Ältere Befragte äußern dabei häufiger als Jüngere die Option, dass der Arzt allein entscheidet. Patienten wünschen sich heute Ärzte, die ihnen umfassende Informationen über ihre Krankheit geben, sich für ihr Verständnis und ihre Deutung der Krankheit interessieren, sich um ihre Ängste kümmern, sie an den Entscheidungen beteiligen und dabei über einen warmen, zugewandten Kommunikationsstil verfügen.
Viele Ärzte haben jedoch nach einer anderen Umfrage das Gefühl, nicht über die erforderlichen Fertigkeiten zu verfügen, um Patienten in die Entscheidung einzubeziehen, sie fühlen sich nicht ausreichend ausgebildet in Kommunikationsfertigkeiten. Einige Ärzte trauen den Patienten keine Entscheidung zu, andere sahen es als Entlastung und Chance. Als Konsequenz hieraus scheint die Forderung nahe zu liegen, dass die Medizinischen Fakultäten Ärzte auch im Bereich kommunikativer Kompetenzen unterrichten und Ärztekammern praktizierende Ärzte dazu verpflichten, einen Teil ihrer Fortbildung dem Kommunikationstraining zu widmen.
David Klemperer ist Professor für medizinische Grundlagen der Sozialen Arbeit, Sozialmedizin und Public Health an der Fachhochschule Regensburg. Er forscht seit langer Zeit über die Themen "Patienteninformation" und "Shared Decision Making (SDM)". Auf seiner Homepage hat er jetzt eine große Zahl neuester Veröffentlichungen von ihm zu diesen Themen als PDF-Dateien zur Verfügung gestellt. Wer sich über das Thema Shared Decision Making informieren will, findet auf der Seite von Klemperer umfassende und neueste Forschungsergebnisse.
David Klemperer: Veröffentlichungen zu Shared Decision Making und Patientenbeteiligung
Gerd Marstedt, 30.7.2005