



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Kranken- und Altenpflege, ältere Patienten |
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Alle Artikel aus:
Patienten
Kranken- und Altenpflege, ältere Patienten
USA: Wie viele BewohnerInnen müssen Pflegekräfte im besten oder schlimmsten Fall in jedem Altenpflegeheim betreuen?
 In den USA leben fast 1,4 Millionen Personen in einem der über 14.000 (Alten)Pflegeheime mit professioneller Versorgung rund um die Uhr.
In den USA leben fast 1,4 Millionen Personen in einem der über 14.000 (Alten)Pflegeheime mit professioneller Versorgung rund um die Uhr.
Eine der vielen eher unbekannten Leistungen des "Affordable Care Act (ACA)" oder Obamacare ist die systematische, kontinuierliche und differenzierte Erhebung der Anzahl von ausgebildeten Pflegekräften (registered nurses) und Pflegehelfern im Verhältnis zu den bei Medicare versicherten Pflegebedürftigen. Dazu dienen anders als bisher die täglichen Gehaltsabrechnungen für das Pflegepersonal. Die bisherige Datenbasis waren Angaben über die Pflegepersonen und BewohnerInnen innerhalb der letzten zwei Wochen vor einer Inspektion. Da dieser Termin den Pflegeeinrichtungen oft bekannt war, war die Personalausstattung oft "geschönt". Mit den nun von den "Centers for Medicare & Medicaid Services" erhobenen Daten ist es möglich für jedes Pflegeheim zu erfahren, ob die Gesamtausstattung mit Personal und die Ausstattung mit ausgebildeten Pflegekräften weit überdurchschnittlich, überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich oder weit unterdurchschnittlich ist. Gleichzeitig kann berechnet werden wie viele Pflegebedürftige eine ausgebildete Pflegekraft und ein Pflegehelfer an den Tagen mit bester oder schlechtester Personalausstattung zu versorgen hat.
Diese Daten sind seit dem 12. Juli 2018 für sämtliche Bundesstaaten der USA und für jedes Pflegeheim das Medicare-Versicherte betreut mittels eines von der "Kaiser Family Foundation" erstellten interaktiven Tool grafisch und tabellarisch gut aufbereitet verfügbar.
Das Tool Look-Up: How Nursing Home Staffing Fluctuates Nationwide ist kostenlos nutzbar.
In dem am 7. Juli 2018 zuerst in der "New York Times" veröffentlichten Artikel 'Like A Ghost Town': Erratic Nursing Home Staffing Revealed Through New Records finden sich weitere Angaben zu den beiden Verfahren zur Erhebung der Personalausstattung in Pflegeheimen und Beispiele für die enormen Unterschiede bei der personellen Ausstattung zwischen Heimen aber auch die zwischen Werk- und Feiertagen je Heim.
Bernard Braun, 16.7.18
Das Elend von Transparenz im Wettbewerb: Qualität hinter der Vielzahl von Siegeln zur Langzeitpflege trotz Checkliste unzureichend
 Wenn etwas im Gesundheitswesen, und zwar von den gesetzlichen Krankenkassen über Krankenhäuser, Arztpraxen bis zu Pflegeheimen laufend boomt ist es eine Flut von Siegeln, Zertifikaten und Kunden-/Versicherten-/Patienten-Voten über die "beste" Qualität oder die "vollste" Zufriedenheit der Befragten mit nahezu allen Regungen dieser Institutionen.
Wenn etwas im Gesundheitswesen, und zwar von den gesetzlichen Krankenkassen über Krankenhäuser, Arztpraxen bis zu Pflegeheimen laufend boomt ist es eine Flut von Siegeln, Zertifikaten und Kunden-/Versicherten-/Patienten-Voten über die "beste" Qualität oder die "vollste" Zufriedenheit der Befragten mit nahezu allen Regungen dieser Institutionen.
Vor lauter "Besten", "Nummer 1" oder "Freundlichsten" ist es für diejenigen, die eine Krankenkasse, ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung suchen, auch mit viel Zeit- und Recherchieraufwand - im Ernstfall hat man aber meist nicht viel Zeit sich für oder gegen eine Einrichtung zu entscheiden - aber eher erschwert, mit gutem Gewissen eine Entscheidung zu treffen mit der man auch noch "übermorgen" zufrieden ist. Vor lauter Siegel-Bäumen ist oft der Wald nicht mehr sichtbar.
Und natürlich gibt es auch schon "Fluthelfer", so aktuell das "Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP)" mit einer "Checkliste zu Siegeln und Zertifikaten" in der Langzeitpflege. An diesem Beispiel lässt sich dann aber auch das Wohl und Wehe der Transparenz von Siegeln etc. erkennen.
Positiv ist an dieser "Checkliste" zunächst, dass ein Sohn oder eine Tochter, der/die für pflegebedürftige Eltern eine Einrichtung zur Langzeitpflege sucht, einen Überblick über die derzeit existierenden und von den Einrichtungen mehr oder weniger aktiv bis aufdringlich-suggestiv präsentierten Qualitäts-Etiketten bekommt. In der ZQP-Liste sind dies Stand Januar 2018 auf 6 Seiten 20 Siegel von "AWO-Qualitätsmanagement Zertifikat" bis "Schmerzmanagement-Zertifikat". Jedes Siegel wird steckbriefmäßig vorgestellt und außerdem gibt es den Link auf Webseiten, die zu dem was für das Siegel geprüft wird und wie die Überprüfung stattfindet sicherlich noch weitere Informationen liefern - natürlich von den Anbietern dieser Siegel.
Und damit ist man auch schon bei den Schwachstellen und Unzuverlässigkeiten dieser Art, den Eindruck von gesicherter Qualität zu erzeugen.
Richtig stellen nämlich die ZQP-AutorInnen folgendes fest: "Wichtig, zu wissen ist: Die Siegel und Zertifikate sind meist nicht vergleichbar, da Prüfverfahren und konkrete Prüfinhalte unterschiedlich und nicht immer transparent sind. Wissenschaftlich gesicherte und verlässliche Aussagen über die Qualität der Pflegeleistungen und -angebote können nicht getroffen werden. Auch ist nicht bekannt, wie sich die regelmäßige Prüfung auf die Qualität der Leistungsangebote auswirkt."
Und: "Als Basis für die Entscheidung, welches Heim oder welcher Dienst gut pflegt, taugen die Prüfbescheinigungen jedoch kaum. Denn über die tatsächliche Pflegequalität sagen diese eher nichts aus. Allerdings können sie Hinweise zu bestimmten Strukturen und Prozessen der Pflegeangebote geben."
Die Lösung des ZQP in einer Pressemitteilung hat dann nichts mehr mit Siegeln, sondern mit dem guten, alten Augenschein durch die Suchenden zu tun: "Da also Siegel und Zertifikate - sowie auch die offiziellen Pflegenoten - für Pflegebedürftige und Angehörige keine hinreichenden Aufschlüsse über die Pflegequalität bieten und schon gar nicht Auskunft darüber geben können, ob ein Angebot zu den persönlichen Bedürfnissen passt, ist es wichtig, sich selbst ein Bild zu machen."
Dies ist sicherlich nicht falsch, wirft aber die Frage auf, warum dann mit viel Aufwand und Kosten, die natürlich in den Preis der Einrichtungen eingepreist sind, Siegel bestellt und verbreitet werden. Das einzige Siegel, das problemlos vergeben werden kann, ist dann wohl das "Siegel für Geschäftstüchtigkeit" der Siegel-Anbieter und -Produzenten.
Und ob die vom ZQP vorgeschlagenen teilnehmenden Beobachtungen und Gespräche in jeder Einrichtung geführt werden können und auch von den dort Beschäftigten und Betreuten offen geführt werden, ist nicht sicher.
Die ZQP-Pressemitteilung zur Veröffentlichung der Checkliste vom 27. März 2018ist kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für die 6-seitige Checkliste zu Siegeln und Zertifikate in der Langzeitpflege.
Bernard Braun, 27.3.18
Alter=schwere Sehbehinderung oder Blindheit? Inzidenz von Sehbehinderung und Erblindung durch Makuladegeneration nimmt stetig ab!
 Zum Inventar der Debatten über die altersbedingte "kränker werdende Gesellschaft" gehören eine Reihe von chronischen oder degenerativen Erkrankungen mit mehr oder weniger gravierenden Einschränkungen körperlicher, geistiger und sozialer Funktionen.
Zum Inventar der Debatten über die altersbedingte "kränker werdende Gesellschaft" gehören eine Reihe von chronischen oder degenerativen Erkrankungen mit mehr oder weniger gravierenden Einschränkungen körperlicher, geistiger und sozialer Funktionen.
Dazu gehört auch die so genannte Makuladegeneration, eine Erkrankung der Netzhaut des Auges, die im besseren Fall zu Sehunschärfen, im schlimmsten und nicht seltenen Fall zu hochgradiger Sehbehinderung und Blindheit führen kann.
Dass es sich dabei nicht um eine stetig wachsende und unvermeidliche Entwicklung oder gar eine alternsassoziierte Epidemie handelt, zeigt eine gerade veröffentlichte Studie in den USA.
Dort wurde das Risiko einer Makuladegeneration in mehreren Altersgruppen mit insgesamt 4.819 Personen untersucht, die entweder 1987/88 zwischen 43 und 84 Jahren oder in den Jahren 2005/2008 zwischen 21 und 84 Jahre alt waren. Mit der letzten Gruppe, der so genannten Baby-Boomer-Gruppe, verbinden sich generell die größten Befürchtungen für die Krankheitsentwicklung älter werdenden Menschen.
Die jeweilige mehrfach adjustierte (z.B. nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und Lebensgewohnheiten) 5-Jahres-Inzidenz für alternsassoziierter Makuladegeneration sank von 8,8% in der zwischen 1901-1924 geborenen ersten Gruppe, über 3% in der 1925-1945 geborenen Gruppe auf 1% in der zwischen 1946 und 1964 geborenen Baby-Boomergruppe und sogar auf 0,3% in der so genannten Generation X (zwischen 1965 und 1984 geboren). Da die StudienteilnehmerInnen überwiegend Weiße waren, können die Ergebnisse allerdings - so die AutorInnen - nicht ohne weiteres für Angehörige anderer Ethnien verallgemeinert werden.
Zur gesundheitspolitischen Relevanz halten die AutorInnen folgendes fest: "Factors that explain this decline in risk are not known. However, this pattern is consistent with reported declines in risks for cardiovascular disease and dementia, suggesting that aging Baby Boomers may experience better retinal health at older ages than did previous generations."
Die Studie Generational Differences in the 5-Year Incidence of Age-Related Macular Degeneration. von
K.J. Cruickshank et al. ist "online first" am 16. November 2017 in der Fachzeitschrift "JAMA Ophthalmology" erschienen.
Bernard Braun, 27.11.17
Es ist selten zu spät und selten zu wenig. Körperliche Aktivität, Mobilität, Behinderung und Unabhängigkeit von 70-89-Jährigen
 Körperliche Leistungsfähigkeit und funktionale Mobilität sowie die Freiheit von Behinderung sind wichtige Voraussetzungen für ein weitgehend selbständiges Leben älterer Personen in ihren "eigenen vier Wänden". Regelmäßige körperliche Aktivitäten sind geeignet, diese Ziele zu erreichen. Dass viele Angehörige dieser Altersgruppe noch nicht einmal beginnen, das Ziel erreichen zu wollen, liegt nur u.a. an Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern an zwei gesichert erscheinenden Erwartungen oder Vorbehalten: Man sei zu alt für "mehr Sport" und er "bringe" in diesem Alter auch nichts mehr und die Leistungsziele mancher Bewegungsprogramme erreiche man nicht und habe daher auch nicht den versprochenen oder erwarteten Nutzen.
Körperliche Leistungsfähigkeit und funktionale Mobilität sowie die Freiheit von Behinderung sind wichtige Voraussetzungen für ein weitgehend selbständiges Leben älterer Personen in ihren "eigenen vier Wänden". Regelmäßige körperliche Aktivitäten sind geeignet, diese Ziele zu erreichen. Dass viele Angehörige dieser Altersgruppe noch nicht einmal beginnen, das Ziel erreichen zu wollen, liegt nur u.a. an Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern an zwei gesichert erscheinenden Erwartungen oder Vorbehalten: Man sei zu alt für "mehr Sport" und er "bringe" in diesem Alter auch nichts mehr und die Leistungsziele mancher Bewegungsprogramme erreiche man nicht und habe daher auch nicht den versprochenen oder erwarteten Nutzen.
Eine jetzt veröffentlichte randomisierte, 2,6 Jahre laufende Studie (die so genannte "Lifestyle Interventions and Independence for Elders (LIFE)"-Studie) mit 1.635 Männer und Frauen im Alter zwischen 70 und 89 Jahren mit zu Beginn niedrigem Level körperlicher Aktivitäten relativiert beide Vorbehalte als weitgehend unbegründet.
In einem ersten Studienteil belegten die ForscherInnen zunächst, dass regelmäßige körperliche Aktivitäten auch in diesem Alter helfen können die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und einen Mobilitätsverlust oder Muskelschwund zu verhindern.
In dem jetzt veröffentlichten zweiten Teil, sollten die TeilnehmerInnen sich zum Erreichen der beiden Ziele 150 Minuten pro Woche spürbar bewegen. Die Folgeuntersuchungen nach 6, 12 und 24 Monaten haben aber gezeigt, dass der erhoffte Nutzen bereits eintrat, wenn sich die StudienteilnehmerInnen mindestens 48 Minuten pro Woche bewegten.
Die Studie Dose of physical activity, physical functioning and disability risk in mobility-limited older adults: Results from the LIFE study randomized trial. von Roger A. Fielding et al. ist am 18. August 2017 in der Fachzeitschrift "PLOS ONE" (12 (8): e0182155) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.9.17
Polypharmazie - Wie werden welche Krankenversicherten von wem und warum mit zu vielen Medikamenten versorgt?
 Seit mehreren wird international wie national über die gesundheitliche Bedeutung der so genannten Polypharmazie und die Notwendigkeit wie Möglichkeiten diskutiert sie einzuschränken oder abzubauen. Dabei stehen zweierlei Risiken der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - dies ist die am meisten verwendete Definition von Polypharmazie - im Vordergrund: Erstens nimmt die Wahrscheinlichkeit von oftmals unbekannten unerwünschten Wechselwirkungen mit der Anzahl von Arzneimitteln rasch zu und zweitens steigt das sowieso schon bei rund der Hälfte der verordneten Medikamente vorhandene Problem einer nicht korrekten Einnahme mit der Anzahl der einzunehmenden Medikamente kräftig an - mit ebenfalls möglichen zusätzlichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen.
Seit mehreren wird international wie national über die gesundheitliche Bedeutung der so genannten Polypharmazie und die Notwendigkeit wie Möglichkeiten diskutiert sie einzuschränken oder abzubauen. Dabei stehen zweierlei Risiken der gleichzeitigen Verordnung und Einnahme von fünf und mehr unterschiedlichen Arzneimitteln - dies ist die am meisten verwendete Definition von Polypharmazie - im Vordergrund: Erstens nimmt die Wahrscheinlichkeit von oftmals unbekannten unerwünschten Wechselwirkungen mit der Anzahl von Arzneimitteln rasch zu und zweitens steigt das sowieso schon bei rund der Hälfte der verordneten Medikamente vorhandene Problem einer nicht korrekten Einnahme mit der Anzahl der einzunehmenden Medikamente kräftig an - mit ebenfalls möglichen zusätzlichen unerwünschten gesundheitlichen Folgen.
Wer hoffte, dass die Diskussion die Sensibilität für Polypharmazie mit praktischen Folgen erhöht und ihre Häufigkeit sich verringert, wird durch die Ergebnisse aktueller Studie enttäuscht.
Was dies konkret heißt zeigt zuletzt eine im April 2017 veröffentlichte Studie über das Verordnungsgeschehen bei den Versicherten der Handelskrankenkasse Bremen (hkk), die im Jahr 2015 ganzjährig versichert waren und mindestens ein Medikament verordnet bekamen. Analysiert wurde, wie viele hkk-Versicherte fünf oder mehr pharmazeutisch unterschiedliche Medikamente gleichzeitig verordnet bekamen. Auch in dieser Studie konnte nicht ermittelt werden, wie viel weitere oft stark wirksame Arzneimittel sich die untersuchten Personen zusätzlich ohne Rezept in einer Apotheke gekauft haben, der Umfang und die Risiken von Polypharmazie also zum Teil noch beträchtlich ausgeprägter sein dürfte.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Von allen im Jahr 2015 durchgängig bei der hkk Versicherten waren 26,7 % von Polypharmazie betroffen. Von den Angehörigen der Verordnungspopulation, d.h. aller ganzjährig in der hkk versicherten Personen, die mindestens ein Arzneimittel verordnet bekamen, waren 2015 bei ganzjähriger Betrachtung 35 % von Polypharmazie betroffen. Bei den älteren Versicherten dieser Population ab 65 Jahren waren es 61,5 %.
• Bei quartalsweiser Betrachtung waren in jedem Quartal zwischen 15,6 % und 16,6 % aller Angehörigen der hkk-Verordnungspopulation von Polypharmazie betroffen. Dieser Wert schwankte bei den über 64-jährigen zwischen 33,1 % im zweiten und 34,4 % im vierten Quartal.
• Es gibt einen starken Zusammenhang von Polypharmazie und Polymorbidität. Klassifiziert man Versicherte mit jährlich mehr als 20 unterschiedlichen ambulant gestellten Diagnosen als multimorbide, waren dies 17,6 % aller medikamentös behandelten hkk-Versicherte.
• Ein alternder Organismus reagiert generell anders auf Medikamente als ein junger, was womöglich deren Wirksamkeit beeinflusst oder die Gefahr für Neben- und Wechselwirkungen erhöht. Verschärft werden diese Risiken, weil besonders ältere Menschen oft an mehreren Erkrankungen gleichzeitig leiden und entsprechend viele Medikamente benötigen. Als Anhaltspunkt für eine möglichst sichere Arzneimitteltherapie im Alter haben Experten in verschiedenen Ländern Listen mit "potenziell inadäquaten Medikamenten (PIM)" zusammengestellt. Das Ergebnis der deutschen Untersuchung, die finale so genannte Priscus-Liste, umfasst 83 Wirkstoffe, die als potenziell ungeeignet für älter Menschen gelten und 18 verschiedenen Arzneistoffklassen aus einem breiten Spektrum an Behandlungsgebieten entstammen (durchweg hoch wirksame und oft Abhängigkeit erzeugende Schlaf- und Beruhigungsmittel bzw. Neuroleptika). Im Jahr 2015 erhielten 18,6 % der über 64-jährigen hkk-Versicherten, die in diesem Jahr wenigstens ein Medikament verordnet bekamen, mindestens ein nach der PRISCUS-Liste potenziell inadäquates, d.h. ein möglicherweise gesundheitlich riskantes Arzneimittel oder einen derartigen Wirkstoff.
• Ein grober Vergleich mit einer ähnlichen Analyse von Polypharmazie bei den Versicherten der hkk im Jahr 2010, bestätigt den Eindruck, dass sich an der Häufigkeit von Polypharmazie prinzipiell nichts geändert hat.
Die bisher erprobten Strategien und Instrumente zur Beeinflussung von Polypharmazie haben oft gar keine oder nicht die erhoffte Wirkung. Das Hoffen auf die eine Patentlösung sollte daher aufgegeben werden und durch einen mehrdimensionalen Ansatz ersetzt werden.
Dieser sollte mindestens drei Handlungsebenen oder Ansatzpunkte umfassen:
• An die Stelle der weit verbreiteten Behandlungsform von Multimorbidität jede einzelne Erkrankung auf der Basis krankheitsspezifischer evidenzbasierter Leitlinien optimal oder maximal zu behandeln führt in bester Absicht gerade bei älteren Patienten zu Polypharmazie. Um dieses Dilemma zu vermeiden braucht es ebenfalls evidenzbasierte Leitlinien für die Behandlung von Multimorbidität für Ärzte und PatientInnen.
• Die Absicht, Art und Umfang von Polypharmazie zu beeinflussen erfordert eine kontinuierliche, systematische und verständliche Information von Ärzten und polypharmazeutisch behandelte PatientInnen. Dies kann in gesonderten Beratungsgesprächen für PatientInnen durch die verordnenden Ärzte erfolgen. Als aktueller Anlass bietet sich die gesetzlich seit Oktober 2016 vorgeschriebene Aushändigung eines schriftlichen Medikationsplans für alle PatientInnen mit mindestens drei verordneten Arzneimitteln an. Hier bietet sich auch die Möglichkeit an, mehr über den Erwerb und die Einnahme von OTC-Medikamenten zu erfahren und damit noch ein Stück näher an die Realität von Polypharmazie heranzukommen.
• Im Rahmen des ebenfalls für gesetzliche Krankenkassen gesetzlich verpflichtenden Versorgungsmanagement sollte eine regelmäßige Berichterstattung über den Umfang und die Art der Arzneimittelverordnungen mit dem Schwerpunkt Polypharmazie auf dem Hintergrund der Informationen der Krankenkassen über ambulante und stationäre Diagnosen, Ärzte und Krankenhausaufenthalte stattfinden.
Der 47-seitige hkk-Gesundheitsreport 2017 Polypharmazie. Eine Analyse mit hkk-Routinedaten des Bremer Gesundheitswissenschaftlers Bernard Braun ist kostenlos erhältlich. Zusätzlich zu den Auswertungen des Verordnbungsgeschehens enthält der Report kurze Überblicke über andere Studien zur Polypharmazie und zur Literatur über die Art und Wirksamkeit von Strategien und Maßnahmen zur Reduktion von Polypharmazie.
Bernard Braun, 16.5.17
Über- und Fehlbehandlung von älteren Personen: Blutdrucksenkung trotz normalem oder niedrigem Blutdruck
 Nicht genug, dass Überversorgung ein national wie international trotz aller Transparenz über die Art und den Umfang und entsprechenden versorgungspolitischen Debatten weit verbreitetes Behandlungsmuster ist und immer wieder Krankheiten für Therapeutika gesucht und kreiert werden, die eigentlich keine bzw. nichts Behandlungsbedürftiges sind (um was es geht findet man unter dem Stichwort "disease mongering" u.a. in diesem Forum). Es gibt aber offensichtlich auch kontinuierliche Behandlungen mit hochwirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Therapeutika ohne Behandlungsgrund oder Erkrankung, also tendenziell schädigende Fehlbehandlung.
Nicht genug, dass Überversorgung ein national wie international trotz aller Transparenz über die Art und den Umfang und entsprechenden versorgungspolitischen Debatten weit verbreitetes Behandlungsmuster ist und immer wieder Krankheiten für Therapeutika gesucht und kreiert werden, die eigentlich keine bzw. nichts Behandlungsbedürftiges sind (um was es geht findet man unter dem Stichwort "disease mongering" u.a. in diesem Forum). Es gibt aber offensichtlich auch kontinuierliche Behandlungen mit hochwirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Therapeutika ohne Behandlungsgrund oder Erkrankung, also tendenziell schädigende Fehlbehandlung.
Ein aktuelles und auch quantitativ relevantes Beispiel sind die Ergebnisse einer retrospektiven Analyse der Blutdruckwerte und Behandlung mit bluthochdrucksenkenden Arzneimitteln von 11.167 über 70-jährigen Versicherten des National Health Service (NHS) in Großbritannien in den Jahren 2005 und 2015. 9.870 von duiesen Personen hatten einen systolischen Blutdruckwert von 120 mmHg und größer, waren also, sofern dies ein Dauerwert war, potenziell behandlungsbedürftig. 1.297 von diesen Personen hatten einen systolischen Blutdruck von unter 120 mmHg, also einen völlig "gesunden" und nicht behandlungsbedürftigen Wert.
Trotzdem erhielten rund 65% der Personen mit einem bereits niedrigen systolischen Blutdruckwert zwischen 100 und 119 mmHg und 70% der Personen mit einem noch niedrigeren systolischen Wert mindestens ein blutdrucksenkendes Medikament verordnet. Von den Personen mit einem systolischen Blutdruckwert von weniger als 100 mmHg nahmen jeweils 17,2% zwei oder drei Blutdrucksenker ein. Daran änderte sich während des gesamten Untersuchungszeitraums für 41% dieser Personen nichts, bei 34% von ihnen wurde die Medikation aber etwas verringert.
Dass es sich dabei nicht nur um eine gesundheitlich nicht notwendige aber kostenträchtige Behandlung handelt, sondern die Absenkung eines bereits niedrigen Blutdruckwertes auch gesundheitlich nachteilig sein könnte, legen die für diese Personengruppe erhöhten Werte für Krankenhauseinweisungen, Sterblichkeit und Herzschwäche nahe. In multivariaten Analysen war der Blutdruckwert außerdem ein unabhjängiger Prädiktor für diese Behandlungsereignisse. Dies alles
schließt allerdings nicht aus, dass die Ereignisse Folgen einer nicht erfassten Erkrankung waren.
Zusammenfassend kommen die AutorInnen zu dem Schluss: "The results demonstrate that low SBP (systolic blood pressure) is associated with adverse events, it is possible that the pursuit of BP (blood pressure) control at a population level may lead to over-treatment in certain groups of patients. This may result in an increased incidence of adverse events particularly in older people."
Die Studie Older people remain on blood pressure agents despite being hypotensive resulting in increased mortality and hospital admission von Yvonne Morrissey, Michael Bedford, Jean Irving und Chris K. T. Farmer ist am 30. Juni 2016 in der Zeitschrift "Age and Ageing" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.7.16
"Well, palliative is, oh God, where people go to hospital to die." Die Rolle von Begriffen und Einbettungen im Gesundheitswesen
 Die Kommunikation über Krankheiten oder die für gesundheitsbezogene Versorgung benutzten Begriffe können die Nutzung von Angeboten beeinflussen und den damit verbundenen Nutzen mindern oder verhindern. Dies zeigt eine am 18. April 2016 in der kanadischen Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichte Studie über die Inanspruchnahme von Palliativversorgung.
Die Kommunikation über Krankheiten oder die für gesundheitsbezogene Versorgung benutzten Begriffe können die Nutzung von Angeboten beeinflussen und den damit verbundenen Nutzen mindern oder verhindern. Dies zeigt eine am 18. April 2016 in der kanadischen Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichte Studie über die Inanspruchnahme von Palliativversorgung.
Palliativbehandlung ist eine speziell für PatientInnen mit ernsten und leidensvollen Erkrankungen und ihre Familien entwickelte stationäre und ambulante Versorgungsform, die möglichst früh genutzt werden sollte, dabei helfen soll, die Lebensqualität sowie die körperliche und mentale Gesundheit zu verbessern und sogar lebensverlängernde Effekte haben kann.
Eine randomisierte kontrollierte Studie mit 71 an fünf Krebsarten erkrankten TeilnehmerInnen (48 Patienten und 23 helfende Angehörige) wies 40 von ihnen einer Gruppe zu, die zusätzlich zu der Standard-Krebsbehandlung eine frühe Überweisung in eine Palliativbehandlung erhielten. Die anderen 31 TeilnehmerInnen erhielten ausschließlich die Standardbehandlung. Die von den behandelnden Onkologen geschätzte weitere Lebenserwartung aller PatientInnen betrug 6 bis 24 Monate.
48 PatientInnen und 23 pflegende Angehörige nahmen zum Abschluss der Studie an halbstrukturierten mündlichen Interviews über ihre Einstellungen zur und Wahrnehmungen von palliativmedizinischen Versorgung teil.
Das wesentliche Ergebnis war, dass Angehörige der Interventions- wie Kontrollgruppe diese Art von Behandlung als mit einem negativen Stigma von Tod, finaler Behandlung und "end of life care" behaftet beschrieben. Der Gedanke an bzw. das Angebot von Palliativversorgung provoziere Furcht und löse Vermeidungsverhalten aus. Diese Wahrnehmungen entsprangen oft der Interaktion mit Ärzten oder Angehörigen anderer Gesundheitsberufe.
Auch wenn viele Angehörigen der Interventionsgruppe während der Behandlung ein breiteres Verständnis von Palliativversorgung entwickelten, also z.B. erkannten, dass es sich um eine Art "ongoing care" handelt, die ihre Lebensqualität verbesserte, assoziierten auch viele von ihnen mit der Behandlungsform weiterhin das beschriebene Stigma.
Um eine möglichst frühzeitige Inanspruchnahme von palliativmedizinischer Versorgung zu fördern schlugen Angehörige beider Gruppen vor, eine andere Bezeichnung (z.B. "supportive care") zu benutzen, das Angebot in einen anderen Gesamtrahmen einzufügen und die Erklärung durch professionelle Helfer deutlich zu verbessern.
Was bei einer anderen Rahmung der palliativen Behandlung zu beachten wäre, benennt ein Kommentator der Studie so: "Although changing the name to supportive care may help promote a more positive view of palliative care, the stigma will persist if this type of care is recommended only as default treatment when curative or life-prolonging treatments are deemed ineffective or undesired."
Die schlüssige Darstellung der negativen Assoziationen mit dem Begriff Palliativversorgung und der Notwendigkeit sie durch eine andere Begrifflichkeit und Einbettung zu vermeiden, sollte Anlass sein, bei der Nicht- oder zu geringen Inanspruchnahme anderer Gesundheitsangebote (z.B. Impfen, Früherkennungsuntersuchungen oder Nutzung von "watchful waiting"-Angeboten) auch an ein falsches oder stigmatisierendes "wording" zu denken und über mögliche Alternativen nachzudenken.
Der Aufsatz Perceptions of palliative care among patients with advanced cancer and their caregivers von Camilla Zimmermann et al. ist komplett kostenlos erhältlich und enthält eine Fülle von interessanten Originalzitaten aus den geführten Interviews.
Bernard Braun, 25.4.16
Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und deren Arbeitsbedingungen relevant für ungeplante Wiedereinweisung von Patienten
 Erneut (vgl. dazu auch schon eine Studie von L. Aiken et al.) bestätigt eine Analyse der Behandlungsdaten von 112.017 älteren erwachsenen Medicare-PatientInnen, die im Jahr 2006 in 495 Kliniken in Kalifornien, Florida, New Jersey und Pennsylvania künstliche Knie- oder Hüftgelenke implantiert bekamen, überwiegend signifikante Zusammenhänge des Risikos einer Wiedereinweisung wegen unerwünschter Folgewirkungen der Operation innerhalb von 10 oder 30 Tagen mit der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und der Qualität deren Arbeitsbedingungen.
Erneut (vgl. dazu auch schon eine Studie von L. Aiken et al.) bestätigt eine Analyse der Behandlungsdaten von 112.017 älteren erwachsenen Medicare-PatientInnen, die im Jahr 2006 in 495 Kliniken in Kalifornien, Florida, New Jersey und Pennsylvania künstliche Knie- oder Hüftgelenke implantiert bekamen, überwiegend signifikante Zusammenhänge des Risikos einer Wiedereinweisung wegen unerwünschter Folgewirkungen der Operation innerhalb von 10 oder 30 Tagen mit der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und der Qualität deren Arbeitsbedingungen.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• 5,64% aller PatientInnen mussten innerhalb von 30 Tagen ungeplant wegen Folgeproblemen erneut in einem Krankenhaus behandelt werden, mehr als die Häfte davon innerhalb von 10 Tagen. Die häufigsten Gründe waren postoperative Infektionen oder Osteoarthritis.
• Nach der Adjustierung nach Patienten- und Klinikmerkmalen erhöhte sich die Chance für eine Wiedereinweisung innerhalb von 30 Tagen statistisch signifikant um 8% (odds ratio 1,08) für jeden zusätzlichen Patienten pro Pflegekraft. Diese Chance betrug bei Patienten, die innerhalb von 10 Tagen wiedereingewiesen wurden, 12% (odds ratio 1,12).
• Wie bereits aus anderen Untersuchungen bekannt, wirkt sich aber nicht nur das quantitative Verhältnis von Patienten pro Pflegekraft auf unerwünschte Folgewirkungen einer Krankenhausbehandlung aus, sondern auch die Qualität der Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte. Wenn die mit dem Standardinstrumnent "Practice Environment Scale of the Nursing Work Index" gemessene Arbeitsqualität gut war, war die patienten- und klinikadjustierte Chance für eine Wiedereinweisung innerhalb von 30 Tagen um 12% (odds ratio 0,88) geringer als wenn sie von geringer Qualität war. Bei den Patienten, die innerhalb 10 Tagen ungeplant in stationärer Behandlung waren, war zwar die Chance bei guten Arbeitsbedingungen ebenfalls geringer, aber der Unterschied statistisch nicht signifikant. Die für die Qualität der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften wichtigsten Merkmale waren kollegiale Beziehungen zu Ärzten, Möglichkeiten autonomen Handelns und kompetente und wirksame Führungskräfte.
Der Aufsatz Nurse staffing and the work environment linked to readmissions among older adults following elective total hip and knee replacement von Karen B. Lasater und Matthew D. Mchugh ist zuerst online im "International Journal for Quality in Health Care" (2016, 28(2), 253-258) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.4.16
Todkranke und zu Hause palliativ versorgte Menschen haben keine Nachteile, eher Vorteile. Rücksicht auf Präferenzen möglich!
 Fragt man gesunde wie schwer kranke Menschen an welchem Ort oder unter welchen Umständen sie sterben möchten, bevorzugen fast alle Befragten ihr häusliches Umfeld und eine dort erhältliche Pflege und Betreuung. Ein oft in diesem Zusammenhang vorgebrachter Einwand ist, dass in diesem Umfeld keine optimale Versorgung möglich wäre und die so versorgten Menschen früher und möglicherweise unter im Krankenhaus oder anderen nichthäuslichen Versorgungsorten vermeidbaren Schmerzen etc. sterben würden.
Fragt man gesunde wie schwer kranke Menschen an welchem Ort oder unter welchen Umständen sie sterben möchten, bevorzugen fast alle Befragten ihr häusliches Umfeld und eine dort erhältliche Pflege und Betreuung. Ein oft in diesem Zusammenhang vorgebrachter Einwand ist, dass in diesem Umfeld keine optimale Versorgung möglich wäre und die so versorgten Menschen früher und möglicherweise unter im Krankenhaus oder anderen nichthäuslichen Versorgungsorten vermeidbaren Schmerzen etc. sterben würden.
Dass nicht so sein muss und die geäußerten Präferenzen ernster genommen werden sollten, zeigen die Ergebnisse einer gerade veröffentlichten prospektiven multizentrischen Kohortenstudie über die Überlebenszeit von an unterschiedlichen Orten vor ihrem Tod versorgten Menschen.
Zwischen September 2012 und April 2014 wurde für 2.069 von 58 spezialisierten Anbietern von palliativer Leistungen versorgten Patienten die Überlebenszeit untersucht. 1.582 Personen erhielten die palliativen Leistungen in Kliniken oder anderen stationären Einrichtungen, 487 erhielten sie im häuslichen Umfeld. Im Untersuchungszeitraum starben insgesamt 1.607 der stationär und 462 der ambulant versorgten PatientInnen tatsächlich.
Das Ergebnis war eindeutig: Die Überlebenszeit der zu Hause palliativ versorgten todkranken PatientInnen war signifikant länger - wenige Tage, aber die sind eventuell extrem wichtig - als die der PatientInnen, die im Krankenhaus versorgt wurden und dort starben. Dabei blieb es auch nach der Adjustierung der Ergebnisse beider Gruppen nach einer Reihe von möglichen Einflussfaktoren oder Confounder, darunter soziodemografische Merkmale und klinische Charakteristika der PatientInnen.
Trotz aller selbst eingeräumten Begrenzungen ihrer Studie, kommt einer der Autoren zu dem für die eingangs zitierten Befürchtungen zu folgendem praktisch bedeutsamen Schluss: "Patients, families, and clinicians should be reassured that good home hospice care does not shorten patient life, and even may achieve longer survival."
Warum dies bei einer guten palliativen Versorgung in Deutschland völlig anders aussehen soll, ist nicht nachvollziehbar. Auf die genannten Befürchtungen sollte daher auch hierzulande zumindest bis zum Ergebnis einer vergleichbaren Studie in Deutschland verzichtet werden, und damit mehr die Präferenzen der PatientInnen beachtet werden.
Die Studie A multicenter cohort study on the survival time of cancer patients dying at home or in hospital: Does place matter? von Jun Hamano et al. ist in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Cancer" im März 2016 erschienen, von der das Abstract kostenlos verfügbar ist.
Bernard Braun, 30.3.16
Zugehörigkeit zu örtlichen sozialen Gruppen oder Was außer regelmäßiger Bewegung lässt Rentner länger und besser leben?
 Spätestens dann, wenn nicht ein biologistischer Determinismus oder Fatalismus die Vorstellung vom Rentner- und Älterwerden bestimmt oder das Heil allein in Anti-Aging-Pillen und -Cremes gesucht wird, stellt sich die Frage, was wirklich Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenserwartung der Angehörigen dieser Altersgruppe fördert bzw. vor den gesundheitlichen Folgen des Verlustes von arbeitsbezogenen Gruppenbindungen und der mit Beschäftigung assoziierten Identität bewahrt.
Spätestens dann, wenn nicht ein biologistischer Determinismus oder Fatalismus die Vorstellung vom Rentner- und Älterwerden bestimmt oder das Heil allein in Anti-Aging-Pillen und -Cremes gesucht wird, stellt sich die Frage, was wirklich Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenserwartung der Angehörigen dieser Altersgruppe fördert bzw. vor den gesundheitlichen Folgen des Verlustes von arbeitsbezogenen Gruppenbindungen und der mit Beschäftigung assoziierten Identität bewahrt.
In einer Langzeit-Kohortenstudie in der 424 TeilnehmerInnen von kurz vor ihrem Rentenbeginn bis 6 Jahre nach diesem Zeitpunkt teilnahmen haben dies nun australische Wissenschaftler etwas genauer untersucht.
Ihre Ergebnisse lauten:
• RentnerInnen, die vor dem Beginn ihrer Rentenzeit aktives Mitglied in zwei örtlichen sozialen Gruppen (z.B. Buchklub oder kirchliche Gruppe) waren und dies auch die ersten 6 Jahre ihrer Rentenzeit blieben, hatten in diesen 6 Jahren ein Sterblichkeitsrisiko von 2%. Schieden sie aus einer der Gruppen aus, stieg dieses Risiko auf 5%, und wenn sie beide Mitgliedschaften aufgaben auf 12%.
• Außerdem verringerte sich die mit einem Standardinstrument gemessene erfahrene Lebensqualität bei jeder verlorenen Mitgliedschaft um 10%.
• Die Ergebnisse waren auch nach der Berücksichtigung von Alter, Geschlecht oder sozialem Status robust.
• Der Effekt der Mitgliedschaft in sozialen Gruppen war schließlich mit dem von körperlichen Aktivitäten/Bewegung vergleichbar. Dies zeigte sich besonders deutlich bei der Untersuchung des Sterblichkeitsrisikos in einer soziodemografisch vergleichbaren so genannten "match control"-Gruppe von ebenfalls 424 Personen, die weiterarbeiteten aber ebenfalls 6 Jahre genau betrachtet wurden. Diejenigen von ihnen, die sich 6 Jahre wöchentlich kräftige körperlich betätigten, hatten in diesem Zeitraum ein Risiko von 3%, bei denen, die dies nicht mehr wöchentlich machten, stieg das Risiko auf 5% und auf 8%, wenn sie damit komplett aufhörten. Der Effekt von Bewegung etc. auf das Sterblichkeitsrisiko bei den berenteten Personen war ähnlich: 3%, 6% und 11%.
Auch wenn diese Studie als Beobachtungsstudie keine kausalen Belege liefern kann, gehört die Kombination des Erhalts alter und die Motivation zu neuen sozialer Beziehungen mit geeigneten körperlichen Aktivitäten sicherlich zu den praktikablen und wirksamen präventiven Mitteln für FrischrentnerInnen. In einem dänischen Modellversuch erwies sich das stundenlange, gemeinsame und enorm "bewegte" Billiardspielen in Altenzentren Kopenhagens als ein akzeptiertes, äußerst wirksames und regelmäßig genutztes Angebot dieser Art.
Der Aufsatz Social group memberships in retirement are associated with reduced risk of premature death: evidence from a longitudinal cohort study von Niklas K Steffens, Tegan Cruwys, Catherine Haslam, Jolanda Jetten und S Alexander Haslam ist im Februar 2016 in der Zeitschrift "BMJ Open" erschienen und daher auch komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.2.16
Was bedeutet die Forderung nach besseren Einkommen für Pflegekräfte und wie hoch ist es eigentlich?
 Immer wenn es um die Frage geht, wie man mehr Nachwuchs für pflegerische Berufe im Gesundheitswesen gewinnen kann, spielt neben einer Verbesserung verschiedener materieller (z.B. Hebehilfen, Arbeitszeitpläne) und immaterieller (z.B. Autonomie, Wertschätzung) Arbeitsbedingungen auch die Erhöhung der Einkommen eine gewichtige Rolle. Wie hoch die derzeitigen Einkommen sind und wie sie sich in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der Diskussion über mehr Nachwuchs für diese Berufe entwickelt haben, ist dabei häufig unbekannt oder unklar. Von welchem realen Niveau muss eine Einkommenserhöhung also starten und wie realistisch ist die Forderung nach ihr?
Immer wenn es um die Frage geht, wie man mehr Nachwuchs für pflegerische Berufe im Gesundheitswesen gewinnen kann, spielt neben einer Verbesserung verschiedener materieller (z.B. Hebehilfen, Arbeitszeitpläne) und immaterieller (z.B. Autonomie, Wertschätzung) Arbeitsbedingungen auch die Erhöhung der Einkommen eine gewichtige Rolle. Wie hoch die derzeitigen Einkommen sind und wie sie sich in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der Diskussion über mehr Nachwuchs für diese Berufe entwickelt haben, ist dabei häufig unbekannt oder unklar. Von welchem realen Niveau muss eine Einkommenserhöhung also starten und wie realistisch ist die Forderung nach ihr?
Darauf gibt eine kleine Analyse im Jahresbericht 2014 der Arbeitnehmerkammer Bremen ernüchternde Antworten:
• Während die tariflichen Einstiegsvergütungen der MetallfacharbeiterInnen zwischen 1995 und 2010 von nominell 23.006 Euro auf 38.544 Euro und damit um 67,5% gestiegen sind, stieg die Einstiegsvergütung der Krankenschwestern/-pfleger absolut von 21.912 Euro auf 26.612 Euro und damit lediglich um 21,4%. Bei AltenpflegerInnen betrug der Anstieg 20% und bei ErzieherInnen 37,7%.
• Im Vergleich mit MetallfacharbeiterInnen, Versicherungskaufmännern/-frauen, ErzieheriNnnen oder Bankkaufmännern/-frauen verdienten Krankenschwestern/-pfleger 2010 um bis zu einem Drittel weniger.
• Krankenschwestern/-pfleger und Altenpfleger stehen aber auch bei der Aufstiegsentlohnung schlechter da als die Angehörigen anderer Berufsgruppen. Während MetallfacharbeiterInnen und Versicherungskaufleute 2010 tarifliche Endlöhne von 53.000 oder 55.000 Euro erreichen konnten, lag die Spitzenentlohnung bei AltenpflegerInnen mit der Verantwortung für mindestens 10 Pflegepersonen bei 39.677 Euro und die von Krankenschwestern/-pfleger bei 50.912 Euro. Dieser Betrag ist aber erst auf der relativ seltenen Position einer Pflegedienstleiterin erreichbar.
Sieht man also vom möglichen Konkurrenzberuf AltenpflegerIn ab, müsste das Einkommen für Pflegefachkräfte enorm und gegen einen langjährigen Trend steigen, um bei Berufswahlentscheidungen konkurrenzfähig gegenüber zahlreichen anderen Berufen zu werden.
Die Autorin der Analyse ist sich dessen bewusst, wenn sie zwei Bedingungen nennt, die für eine Trendumkehr dieses Gewichts ihres Erachtens nötig sind: Eine "zunehmende Organisationsbereitschaft der Beschäftigten und eine Anpassung der Interessenpoilitik der Arbeitnehmervertreter an die spezifischen Beschäftigungsstrukturen im Gesundheitswesen."
Dass und welche soziale Bedingungen der Arbeit von Pflegekräften für diese Veränderungen gerade nicht förderlich sind, zeigt ein weiterer Beitrag in diesem Bericht. So waren bundesweit zum Stichtag 30. Juni 2013 58,7% der im Berufsbereich Gesundheit, Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe beschäftigten HelferInnen in Teilzeit beschäftigt. Bei den Fachkräften oder Spezialisten in diesem Berufsbereich waren es 40,7% - ob 30, 20 oder 15 Stunden.
Der im März 2014 veröffentlichte Bericht zur Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Bremen 2014 ist komplett kostenlos erhältlich. Zitiert wurden im auch sonst interessanten Bericht die Beiträge von Irene Dingeldey und Carola Bury.
Bernard Braun, 16.12.14
Gehirnjogging-Produkte "nein danke" oder geistig fit durch "gutes Leben"
 Egal ob papiergebunden oder computerbasiert: Trainingsprogramme für den Erhalt und die Stärkung der geistigen Leistungsfähigkeit sowie gegen Alzheimer und Demenz "bis ins hohe Alter" gehören zu den "cash cows" der Gesundheitswirtschaft. Wie bei vielen Produkten und Dienstleistungen auf dem besonders im Zeichen der alternden Babyboomer anwachsenden zweiten Gesundheitsmarkts wird der Eindruck erweckt bei den für die Gesundheit und die Lebensqualität positiven Wirkungen handle es sich um wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse.
Egal ob papiergebunden oder computerbasiert: Trainingsprogramme für den Erhalt und die Stärkung der geistigen Leistungsfähigkeit sowie gegen Alzheimer und Demenz "bis ins hohe Alter" gehören zu den "cash cows" der Gesundheitswirtschaft. Wie bei vielen Produkten und Dienstleistungen auf dem besonders im Zeichen der alternden Babyboomer anwachsenden zweiten Gesundheitsmarkts wird der Eindruck erweckt bei den für die Gesundheit und die Lebensqualität positiven Wirkungen handle es sich um wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse.
Doch daran, dass diese Programme das leisten was drauf steht, gibt es mittlerweile erhebliche Zweifel.
Aktuell am deutlichsten äußert dies eine am 21. Oktober 2014 veröffentlichte gemeinsame Erklärung von internationalen Kognitions- und Neurowissenschaftlern, die sich mit den Gehirnjogging-Produkten auf Einladung des Stanford Center on Longevity an der Stanford University und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin ausführlich beschäftigten.
Die Kernaussagen dieser Erklärung lauten folgendermaßen:
• Es ist nicht belegt, dass Gehirnjogging die allgemeine geistige Leistungsfähigkeit steigert.
• Werbung für Gehirnjogging-Spiele, die behauptet, Alzheimer- oder andere Demenzformen verhindern oder heilen zu können, ist wissenschaftlich unbegründet.
• Körperliches Training (aerobes Fitnesstraining) steigert die körperliche Gesundheit und wirkt nachweisbar positiv auf die Durchblutung des Gehirns und auf kognitive Leistungen.
• Weder in Einzelstudien noch summiert über viele Studien (d.h. in sogenannten Metaanalysen) gibt es klare Hinweise auf länger andauernde Leistungsverbesserungen in allgemeinen kognitiven Fähigkeiten mit Alltagsrelevanz.
Zum Schluss Ihrer Stellungnahme empfehlen die Wissenschaftler anstatt Gesundheit vorrangig zum Nutzen der Hersteller durch Gehirnjogging- und andere Produkte einkaufen und konsumieren zu wollen, "ein körperlich aktives, geistig herausforderndes und sozial anregendes Leben zu führen, und zwar in der Art, die zu einem passt." Und wie dies konkret aussehen könnte, fasst der anschließende Ratschlag so zusammen: "Bevor man Zeit und Geld in ein Gehirnjoggingprodukt steckt, sollte man an das denken, was in der Ökonomie als Opportunitätskosten bezeichnet wird: Wenn man eine Stunde damit verbringt, alleine am Computer Aufgaben zu trainieren, anstatt in der Zeit spazieren zu gehen, Italienisch zu lernen, ein neues Rezept auszuprobieren oder mit seinen Enkeln zu spielen, so könnte dies eine ungünstige Wahl sein. Aber wenn diese Stunde am Computer eine Stunde auf der Couch vor dem Fernseher ersetzt, so könnte es sich um eine gute Wahl handeln."
Die neunseitige Langfassung der Erklärung Gehirnjogging am Computer hält nicht, was es verspricht.Gemeinsame Erklärung von internationalen Kognitions- und Neurowissenschaftlern ist kostenlos erhältlich und enthält auch noch einige Verweise auf weiterführende wissenschaftliche Studien.
Bernard Braun, 9.11.14
Warum ein "guter" niedriger Blutdruck nicht immer anstrebenswert ist. Am Beispiel der geistigen Fitness von hochaltrigen Personen.
 Dies soll kein Plädoyer dafür sein, sich nicht um einen "zu hohen" Blutdruck zu kümmern. Ähnlich wie bereits beim Übergewicht oder Blutzucker, soll lediglich dem Eindruck entgegengewirkt werden, das Überschreiten bestimmter absoluter Werte bedeuteten zwangsläufig den eindeutigen Übergang von gesund zu krank und müsse immer und bei jedem Menschen mit allen geeigneten Mitteln verhindert bzw. rückgängig gemacht werden.
Dies soll kein Plädoyer dafür sein, sich nicht um einen "zu hohen" Blutdruck zu kümmern. Ähnlich wie bereits beim Übergewicht oder Blutzucker, soll lediglich dem Eindruck entgegengewirkt werden, das Überschreiten bestimmter absoluter Werte bedeuteten zwangsläufig den eindeutigen Übergang von gesund zu krank und müsse immer und bei jedem Menschen mit allen geeigneten Mitteln verhindert bzw. rückgängig gemacht werden.
Entgegen dieser Ansicht zeigen immer mehr Studien, dass dies nicht immer und zwangsläufig der Fall ist, und bestimmte als "krank" definierte Körperwerte sogar "gesunde" Effekte haben können. Beim eingangs erwähnten Übergewicht, war dies die mehrfach bestätigte Erkenntnis, dass ein so genannter Body-mass-Index-(BMI)-Wert zwischen 25 und 30 durchaus auch protektive bzw. "gesunderhaltende" Wirkungen bei der kardiologischen Morbidität haben kann.
"Zu hoher" Blutdruck (ein Wert, dessen absolutes Niveau sich dazu auch noch in regelmäßigen Abständen verändert), galt und gilt wegen der mit ihm assoziierten Arterienverkalkung als Risikofaktor für Herzinfarkt, Nierenversagen und Schlaganfall.
Eine Studie in den Niederlanden, die so genannte "Leiden 85-plus Study", kommt nun zu dem Ergebnis, dass ein hoher Blutdruck nicht immer und offensichtlich auch nicht für alle Seiten der gesundheitlichen Lebensqualität eines Menschen schlecht ist. Und dies gilt besonders für hochaltrige Menschen und deren geistige Fitness.
TeilnehmerInnen dieser Studie waren 560 Personen im Alter von 85 Jahren, bei denen fünf Jahre lang der Blutdruck, die geistige Fitness (mittels des Mini-Mental-Status-Tests) und die Leistungsfähigkeit ihres Herzens (über einen Eiweißmarker) gemessen wurden. Die Personen wurden in drei Gruppen mit einem niedrigen (unter 147 mmHg), normalen (147 bis 162 mmHG) und hohen (über 162 mmHg) systolischen Blutdruck aufgeteilt.
Die Ergebnisse lauteten im Detail so:
• Die TeilnehmerInnen mit dem niedrigsten Blutdruck schnitten bereits zu Beginn der Studie am schlechtesten bei der geistigen Fitness ab.
• Daran änderte sich im Studienzeitraum nichts, d.h. "Probanden mit einem niedrigeren Blutdruck bauten geistig schneller ab, als die mit einem höheren Blutdruck".
• Direkt unabhängig davon, wirkte sich auch eine Herzinsuffizienz negativ auf die kognitiven Leistungen aus.
• Personen mit einer schwachen Herzleistung und niedrigem Blutdruck hatten die schlechteste kognitive Leistung. Dies deutet darauf hin ("possibly"), dass das zentrale Problem die Herzinsuffizienz mit der Folge eines niedrigen Blutdrucks und einer schlechten Sauerstoffversorgung u.a. des Gehirns ist.
Auch wenn die AutorInnen sich nicht ausführlich mit den praktischen Konsequenzen befassen, folgt aus ihren Ergebnissen, dass niedrige Blutdruckwerte je nach Personenkreis und dessen Gesamt-Gesundheitszustand unterschiedlich beurteilt werden müssen und u.U. auch für die spezifische Lebensqualität bestimmter Personen gesund sein können.
Das Abstract der Studie NT-proBNP, blood pressure, and cognitive decline in the oldest old. The Leiden 85-plus Study. von P. van Vliet et al., am 20. August 2014 online in der Zeitschrift "Neurology" erschienen, ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.14
"Nichts ist unmöglich" oder SchülerInnenzahl in Pflegefachberufen nimmt zwischen 2007/08 und 2011/12 kräftig zu
 Zu den häufig als unvermeidbar oder unumkehrbar dargestellten und linear problematischer werdenden Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen gehört der Mangel an Fachkräften in den wichtigsten 17 gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufen. Die Brisanz solcher Prognosen ergibt sich hauptsächlich aus der ebenfalls als naturgegeben prognostizierten Zunahme kranker und pflegebedürftiger älteren Personen und die für den beruflichen Nachwuchs besonders unattraktiv charakterisierten und kommunizierten Arbeitsbedingungen in pflegerischen Berufen.
Zu den häufig als unvermeidbar oder unumkehrbar dargestellten und linear problematischer werdenden Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen gehört der Mangel an Fachkräften in den wichtigsten 17 gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufen. Die Brisanz solcher Prognosen ergibt sich hauptsächlich aus der ebenfalls als naturgegeben prognostizierten Zunahme kranker und pflegebedürftiger älteren Personen und die für den beruflichen Nachwuchs besonders unattraktiv charakterisierten und kommunizierten Arbeitsbedingungen in pflegerischen Berufen.
Eine Reihe von nationalen und international vergleichenden Studien zeigen allerdings, dass beide Trends nicht zwangsläufig oder zumindest nicht in dem dramatisierten Umfang eintreten müssen.
Eine am 17. Juli 2014 veröffentlichte Auswertung der Entwicklung der SchülerInnenzahl in Gesundheitsfachberufen zwischen 2007/08 und 2011/12 durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) liefert eine bemerkenswerte und zum Teil unerwartete Momentaufnahme für die Personalentwicklung.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten so:
• mit rund 187.000 Schülerinnen und Schülern im Jahr 2011/2012 im Vergleich zum Schuljahr 2007/2008 ist ein Anstieg um 5,9 % in allen nicht-akademischen Erstausbildungen der Gesundheitsfachberufe zu verzeichnen.
• Der Anteil der SchülerInnen in den drei Pflegeberufen "Altenpflege", "Gesundheits- und Krankenpflege" sowie "Gesundheits- und Kinderkrankenpflege" an allen SchülerInnen beträgt beinahe 66%.
• Zunahme der SchülerInnen für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege um 4,7 %, für Gesundheits- und Krankenpflege um 7,6 %, für RettungsassistentInnen um 21,6 %), für Podologen/zur Podologin um 29,7 % und für AltenpflegerInnen um 36,2%.
• Insbesondere bei den SchülerInnen für Altenpflege verstärkt sich die Zunahme sogar gegen Ende des Untersuchungszeitraums mit jährlich +5,3% sogar kräftig.
• Eine Abnahme der SchülerInnenzahlen gibt es dagegen bei den PhysiotherapeutInnen (-10,1 %), ErgotherapeutInnen (-23,7 %), MasseurInnen und medizinischen BademeisterInnen (-28,1 %) DiätassistentInnen (-42,2 %).
Die Entwicklung kommentiert der BIBB-Präsident so: "Wenn der momentane Trend sich verstetigt, besteht die Chance, dass wir den gerade in dieser Branche erwarteten Fachkräftemangel abmildern können". Ob dieser Kommentar nicht zu weit geht, werden die nächsten Jahre und vergleichbare Untersuchungen belegen müssen. Wenigstens an der Unvermeidbarkeit des Umfangs des Personalnotstands im Pflegebereich lässt sich aber mit diesen aktuellen Trends schon zweifeln.
Die als Heft 153 der "Wissenschaftlichen Diskussionspapiere" des BIBB erschienene Studie Gesundheitsfachberufe im Überblick von Maria Zöller et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
"Das wissenschaftliche Diskussionspapier fasst die Ergebnisse der statistischen Analysen der bundesrechtlich geregelten nicht-akademischen Ausbildungen in Gesundheitsfachberufen zusammen. Darüber hinaus werden Ansatzpunkte zur Modernisierung der Ausbildungen aufgezeigt. Ergänzend werden Forschungsprojekte und Publikationen des Bundesinstituts für Berufsbildung sowie Hinweise zu Portalen mit weiterführenden Informationen übersichtlich dargestellt. Abgerundet wird der Bericht durch eine aktuelle BIBB-Auswahlbibliografie zu Gesundheitsfachberufen."
Bernard Braun, 20.7.14
"Bloß keine richtig Alten oder Sprechbehinderten": Altersdiskriminierung und Selektion Schwerstkranker in Stroke-Reha-Studien
 Ein Teil der Schreckensszenarien über die gesundheitliche Last der demografischen Entwicklung kreist daher um die oftmals dauerhaften körperlichen und mentalen Einschränkungen bei den meist älteren PatientInnen. Im Mittelpunkt von Versorgungsforschungsstudien zur akuten und rehabilitativen Behandlung dieser Patienten müssten daher gerade auch ältere Personen stehen - eigentlich!!
Ein Teil der Schreckensszenarien über die gesundheitliche Last der demografischen Entwicklung kreist daher um die oftmals dauerhaften körperlichen und mentalen Einschränkungen bei den meist älteren PatientInnen. Im Mittelpunkt von Versorgungsforschungsstudien zur akuten und rehabilitativen Behandlung dieser Patienten müssten daher gerade auch ältere Personen stehen - eigentlich!!
Ein am 18. März 2014 veröffentlichter Review von 182 randomisierten kontrollierten Studien über die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten zeigt aber, dass dies nicht der Fall ist.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Während das Durchschnittsalter der in akut-ärztlicher Behandlung befindlicher Schlaganfallpatienten bei 75 Jahren liegt, sind die Teilnehmer der untersuchten RCTs durchschnittlich 64,3 Jahre alt. In einigen Ländern beträgt diese Alterslücke sogar 11-12 Jahre.
• In 46% der RCTs wurden Patienten mit kognitiven Einschränkungen ausgeschlossen.
• Das Gleiche gilt in 23% der Studien für Schlaganfallpatienten mit Sprachausdrucks- oder Sprachkoordinationsstörung - also einer nicht kleinen und irrelevanten, ja sogar typischen Betroffenengruppe.
• In 13% der RCTs wurden schließlich auch noch Patienten ausgeschlossen, die bereits mehrere Schlaganfälle hatten.
Dies bedeutet alles in allem, dass die am schwersten Erkrankten und Rehabilitationsbedürftigen nicht in Studien vertreten waren, die eigentlich repräsentativ für alle Schlaganfallpatienten die Wirkung unterschiedlicher rehabilitativer Interventionen untersuchen und ecidenzbasierte Behandlungshinweise liefern sollten. Zu den wesentlichen Gründen zählen die AutorInnen des Reviews den notwendig höheren und phantasievolleren Aufwand, der betrieben werden muss, wenn diese Patientengruppe in RCTs aufgenommen werden. Wenn aber noch nicht einmal unter den besonderen Bedingungen von Studien alle Typen oder nur eine hochselektierte Gruppe von Patienten vertreten sind, wäre es nicht verwunderlich, wenn unter den Alltagsbedingungen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten mit denselben Argumenten ältere und aufwändigere Patienten auch diskriminiert würden.
Dazu äußern sich die irischen AutorInnen des Reviews zwar nicht, fassen aber die weitreichenden Auswirkungen ihrer Untersuchungsergebnisse folgendermaßen zusammen: "However, it is important that this more vulnerable cohort of patients is represented adequately in trials, not only because they reflect an appreciable proportion of patients suffering from stroke internationally but also to ensure that the development of evidence-based rehabilitation methods is both appropriate and applicable to this age group."
Der dreiseitige Report Ageism in stroke rehabilitation studies von Eva Joan Gaynor, Sheena Elizabeth Geoghegan und Desmond O'Neill ist in der Fachzeitschrift "Age and Ageing" erschienen und online vorab am 18. März veröffentlicht worden. Der Bericht ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.3.14
Zur Kumulation von 13 Qualitätsmängeln bei der Arzneimittelbehandlung von 65+-BürgerInnen am Beispiel Italien
 Es gibt auch in Deutschland immer mehr Untersuchungen, die speziell für die älteren und oft kränkeren BürgerInnen auf einzelne, unerwünschte oder nachteilige Einzelheiten der Behandlung mit Arzneimitteln hinweisen. Dazu gehören z.B. die Polypharmazie, d.h. die gleichzeitige Behandlung mit 5 und mehr verschiedenen Medikamenten oder die Verschreibung von gesundheitlich nachteiligen Medikamenten.
Es gibt auch in Deutschland immer mehr Untersuchungen, die speziell für die älteren und oft kränkeren BürgerInnen auf einzelne, unerwünschte oder nachteilige Einzelheiten der Behandlung mit Arzneimitteln hinweisen. Dazu gehören z.B. die Polypharmazie, d.h. die gleichzeitige Behandlung mit 5 und mehr verschiedenen Medikamenten oder die Verschreibung von gesundheitlich nachteiligen Medikamenten.
Dass die potenziellen Qualitätsmängel der Arzneimittelbehandlung damit bei weitem nicht vollständig erfasst sind und bewertet werden können, zeigt jetzt eine Untersuchung aller Verordnungsdaten aus dem Jahr 2011 für sämtliche in Italien krankenversicherte Personen im Alter von 65 und mehr Jahren (12,3 Millionen Personen).
Dafür definierten Wissenschaftler der "Italian Medicines Agency (AIFA)" 13 Qualitätsindikatoren, die aus Routinedaten gebildet werden können. Dazu gehörten Indikatoren für Polypharmazie, Therapietreue bei Medikamenten zur Behandlung einiger chronischer Erkrankungen, Verschreibungs-Kaskaden, Unterbehandlung, Arzneimittelwechselwirkungen und die Verordnung von Arzneimitteln, die besser nicht verordnet würden.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• 60,3% aller älterer Krankenversicherten erhielten 5 und mehr Arzneimittel verordnet,
• bei 63,9% der neu behandelten Patienten war die Therapietreue z.B. bei der Behandlung mit Antidepressiva gering (definiert als Versorgung an weniger als 40% der Behandlungstage),
• ein Anteil von 7,5% aller älterer Versicherter waren diabetische Patienten mit einer Unterversorgung mit Statinen,
• 0,8% aller älterer Versicherten wurden gleichzeitig mit Arzneimitteln (hier Warfarin und Aspirin) behandelt, welche Blutungsrisiken erhöhten,
• das für Verordnungs-Kaskaden ausgewählte Beispiel der Verordnung und Einnahme von Anti-Parkinson- und antipsychotischen Medikamenten prägte die Behandlung von 0,2% oder immerhin noch 25.949 älterer Versicherter,
• 1,6% aller älterer Versicherten wurden mit blutdrucksenkenden Medikamenten mit ungünstigem Risiko-Nutzen-Profil behandelt und
• 0,7% aller Älteren wurden mit blutzuckersenkenden Mitteln mit einem damit verbundenen hohen Risiko einer Unterzuckerung behandelt. Nimmt man nur die Gruppe der mit Blutzuckersenkern behandelten Älteren, haben 5,1% von ihnen dieses Risiko.
Zu Recht heben die AutorInnen hervor, dass ihr bevölkerungsbezogener Ansatz "highlighted the huge dimension of suboptimal drug prescribing in older adults, a finding demanding the urgent implementation of national educational programs".
Wer sich näher mit den 13 Indikatoren auseinandersetzen will, sie eventuell unverändert oder verändert im deutschen Gesundheitssystem überprüfen und ihre Bildung nachvollziehen will, findet eine ausführliche Beschreibung in einem Anhang zum Aufsatz, der leider nur für Abonnenten der Zeitschrift zugänglich ist.
Der Aufsatz High Prevalence of Poor Quality Drug Prescribing in Older Individuals: A Nationwide Report From the Italian Medicines Agency (AIFA) von Graziano Onder et al. ist im April 2014 im "Journal of Gerontology A Biol Sci Med Sci" 69 (4): 430-437 erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.3.14
Schlusslicht der stationären pflegerischen Versorgung in Europa für das deutsche Gesundheitssystem - und Griechenland.
 Das deutsche Gesundheitssystem nimmt in internationalen Vergleichen bei vielen Leistungsindikatoren meist einen Mittelplatz ein, bei einigen problematischen landet es aber auch am Ende solcher Rangskalen.
Das deutsche Gesundheitssystem nimmt in internationalen Vergleichen bei vielen Leistungsindikatoren meist einen Mittelplatz ein, bei einigen problematischen landet es aber auch am Ende solcher Rangskalen.
Eine in der international durchgeführten Studie "Registered nurses forecasting (RN4CAST)" gestellte Frage nach der Anzahl von pflegerisch notwendigen Leistungen, die z.B. aus Zeitmangel nicht durchgeführt werden konnten, also eines Maßes für implizite Rationierung, zeigt, dass dies auch bei gesundheitlich gewichtigen Leistungen der Fall sein kann.
Diese und eine Reihe anderer für die Arbeitsbedingungen und die patientenbezogene Versorgungsqualität relevanten Fragen wurde 2009/10 33.659 Pflegekräften in 488 den chirurgischen und medizinischen Abteilungen in Akut-Krankenhäusern in zwölf europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Finnland, Griechenland, Schweiz und Deutschland, gestellt. In Deutschland betraf dies 1.508 examinierte Pflegekräfte in bundesweit 49 Kliniken.
Die Ergebnisse aus deutscher Sicht sahen u.a. so aus:
• Während in Europa durchschnittlich 54% aller Pflegekräfte über einen Bachelorabschluss verfügten, traf dies zu dem Befragungszeitpunkt für keine(n) Befragten an deutschen Krankenhäusern zu. Dies bedeutete beim Ausbildungsstand den letzten Platz.
• Beim Belastungsindikator Patient pro Pflegekraft landete Deutschland mit 13 Patienten erneut auf dem letzten Platz. Den Spitzenplatz nahm Norwegen mit 5 Patienten pro Pflegekraft ein.
• Abgerundet werden diese Negativrekorde mit dem erneut europaweit schlechtesten Indikator des Anteils der Pflegekräfte, die in ihrer letzten Arbeitsschicht mit nichtpflegerischen Tätigkeiten beschäftigt waren. Im europäischen Durchschnitt waren es 34%, in Spanien 17% und in Deutschland 61%.
• Bei den 13 pflegerischen Aktivitäten (z.B. physische Pflege, Patientenüberwachung und -mobilisierung sowie den psychosoziale äußerst notwendigen Patientengesprächen), für welche die Pflegekräfte befragt wurden, ob sie sie z.B. wegen Zeitmangel nicht durchführen konnten, lagen die Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern erneut deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 3,6. Mit durchschnittlich 4,7 nicht erbrachten notwendigen pflegerischen Maßnahmen landete Deutschland auf dem vorletzten Platz - vor Griechenland mit 5,8 solcher Aktivitäten. Dass es besser gehen kann zeigten die Pflegekräfte in der Schweiz, den Niederlanden und in Schweden mit 2,8 rationierten Pflegemaßnahmen.
• Angesichts des immer häufiger beklagten Pflegekräftemangels ist auch ein weiteres Ergebnis relevant: In Kliniken mit vorteilhafteren Arbeitsbedingungen, einer geringeren Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und eines unterdurchschnittlichen Anteils von nichtpflegerischen Tätigkeiten am gesamten Arbeitsvolumen ist der Anteil von AussteigerInnen aus dem Pflegeberuf signifikant am geringsten.
Diese Ergebnisse werden auch in einer neueren (2012) inhaltlich vergleichbaren Befragung von Pflegekräften an 27 hessischen Krankenhäusern bestätigt, deren Ergebnisse in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.
Der Forderung der Autorinnen des Europavergleichs, solche Befragung als eine Art Frühwarnsystem für dauerhaft die Arbeits- und Versorgungsqualität verschlechternde Arbeitsbedingungen regelmäßig durchzuführen und dadurch Druck auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und darunter auch eine Erhöhung der Personalanzahl auszuüben, ist zuzustimmen.
Der Aufsatz Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study von Dietmar Ausserhofer et al. ist in der Fachzeitschrift "BMJ Quality & Safety" online am 10. November 2013 erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.12.13
Arzt/Pflegekräfte-Teams sind für die meisten geriatrischen Patienten besser als Ärzte allein: Wann werden wir es jemals lernen?
 Die seit einiger Zeit durch den Gesetzgeber und den Gemeinsamen Bundesausschuss auch in Deutschland geschaffenen normativen Grundlagen für eine teamorientierte, Delegation und Substitution umfassende Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe zwischen Ärzten und Pflegekräften kommt nur langsam gegen die traditionellen standespolitischen Widerstände und Vorurteile voran. In anderen Ländern gibt es dafür immer mehr Belege für den gesundheitlichen Nutzen einer solchen systematischen multiprofessionellen Teamorientierung und damit auch den Nutzen für das Selbstbewusstsein oder die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Ärzte und Pflegekräfte.
Die seit einiger Zeit durch den Gesetzgeber und den Gemeinsamen Bundesausschuss auch in Deutschland geschaffenen normativen Grundlagen für eine teamorientierte, Delegation und Substitution umfassende Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe zwischen Ärzten und Pflegekräften kommt nur langsam gegen die traditionellen standespolitischen Widerstände und Vorurteile voran. In anderen Ländern gibt es dafür immer mehr Belege für den gesundheitlichen Nutzen einer solchen systematischen multiprofessionellen Teamorientierung und damit auch den Nutzen für das Selbstbewusstsein oder die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Ärzte und Pflegekräfte.
Jüngstes Beispiel ist eine vergleichende Untersuchung aus den USA, ob und wie 658 bzw. 485 (von insgesamt 1.084 TeilnehmerInnen) an mehreren chronischen Krankheiten leidende Personen im Alter von 75 Jahren und älter durch ambulante Allgemeinärzte allein oder durch ein Team aus solchen Ärzten und aus so genannten "primary care physician-nurse practitioner", also speziell ausgebildeten Pflegekräften, die für sie in Leitlinien empfohlene Behandlung erhielten. Nach der zufälligen Verteilung der geriatrischen Patienten auf die beiden Gruppen waren 49% in der Komanagement-Gruppe. Die Qualität wurde mittels sieben standardisierter Qualitätsindikatoren gemessen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Insgesamt erhielten 57% die empfohlene Behandlung,
• Von den Patienten, die an Sturzfolgen litten, erhielten in der Komanagement-Gruppe (KG) 80% die empfohlene Behandlung, in der Arzt-Gruppe (AG) 34%,
• Von den Patienten mit einer Urin-Inkontinenz erhielten in der KM 66% und in der AG 19% die für sie beste Behandlung,
• Bei Patienten mit Demenz erhielten 59% in der KG und 38% in der AG die empfohlene Behandlung und
• Patienten mit einer Depression erhielten in der KG zu 63% und in der AG zu 60% die empfohlene Behandlung.
Diese Behandlungsvorteile für die geriatrischen Patienten in der KG blieben auch nach einer Adjustierung nach Alter, Geschlecht, Anzahl der Krankheiten etc. signifikant erhalten.
Der Aufsatz Effect of nurse practitioner comanagement on the care of geriatric conditions von Reuben DB et al. ist im Juni 2013 in der Fachzeitschrift "Journal of the American Geriatrics Society" (61(6): 857-67) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Dass aber auch in den USA trotz solcher Ergebnisse keineswegs die große Umorientierung in Richtung gemischtprofessionelle Teams und Komanagement stattfindet, zeigt ein Kommentar zu dem Aufsatz mit dem an einen Song von Pete Seeger anknüpfenden Titel When Will We Ever Learn the Benefits of Teams? von Barbara Resnick in derselben Ausgabe der Fachzeitschrift (1019-1021). Zu ihm gibt es leider weder ein kostenloses Abstract noch einen freien Zugang.
Bernard Braun, 15.12.13
Viel Krach um die "stille Epidemie" der Demenz versus wissenschaftlicher Evidenz zu ihrer sinkenden Inzidenz und Prävalenz
 Ein aktueller Bericht der "Alzheimer Disease International (AID)" progostiziert für das Jahr 2050 eine Verdreifachung der weltweiten Alzheimerfälle auf 135 Millionen. Die "Deutsche Alzheimer Gesellschaft - Selbsthilfe Demenz" verkündete ein vergleichbares Epidemie-Szenario bereits Ende 2012. Laut einem Informationsblatt zur Epidemiologie der Demenz, wird die Zahl der Erkrankten allein in Deutschland von aktuell 1,4 Millionen auf etwa 3 Millionen im Jahr 2050 steigen: plus 40.000 im Jahr und mehr als 100 am Tag!
Ein aktueller Bericht der "Alzheimer Disease International (AID)" progostiziert für das Jahr 2050 eine Verdreifachung der weltweiten Alzheimerfälle auf 135 Millionen. Die "Deutsche Alzheimer Gesellschaft - Selbsthilfe Demenz" verkündete ein vergleichbares Epidemie-Szenario bereits Ende 2012. Laut einem Informationsblatt zur Epidemiologie der Demenz, wird die Zahl der Erkrankten allein in Deutschland von aktuell 1,4 Millionen auf etwa 3 Millionen im Jahr 2050 steigen: plus 40.000 im Jahr und mehr als 100 am Tag!
Dass es sich bei derartig spektakulären Prognosen eher um interessengeleitete Spekulationen handeln könnte, zeigt ein Blick auf eine ebenfalls aktuelle Übersicht zum Stand der Forschung zur Entwicklung von Inzidenz und Prävalenz der Demenz in den letzten Jahrzehnten im seriösen "New England Journal of Medicine (NEJM)" - also von tatsächlichen Fällen in methodisch hochwertigen empirischen Studien in mehreren mit Deutschland vergleichbaren Ländern.
Vorgestellt werden die Ergebnisse von fünf großen Studien aus den Niederlanden, England, Schweden und zweimal aus den USA, die jeweils die Inzidenz und Prävalenz von Demenz oder schweren kognitiven Leistungseinschränkungen bei über 51-, 55-, 65 und 75-jährigen Personen zu zwei Zeitpunkten bzw. in Zeiträumen untersuchten.
Die zentralen Ergebnisse der Kohortenvergleiche se´hen folgendermaßen aus:
• Ein Vergleich der Prävalenz schwerer kognitiver Leistungseinschränkungen der Jahre 1982 und 1999 in den USA zeigte eine Abnahme der Prävalenz bei über 65-Jährigen von 5,7% auf 2,9%.
• Ein ähnlicher Vergleich der Prävalenz bei über 70-Jährigen in den USA in den Jahren 1993 und 2002 zeigte ebenfalls eine Abnahme von 12,2% auf 8,7%.
• In der so genannten Rotterdamstudie sank die Inzidenz von Demenz bei 55+-Personen in der 1990er- und in der 2000er-Gruppe von 6,56 Fällen pro 1.000 Personen und Jahr auf 4,92 pro 1.000 Personen und Jahr.
• In Schweden zeigten zwei Querschnittsanalysen bei 75+-Personen in den Jahren 1987-1989 und 2001-2004 ebenfalls eine sinkende Inzidenz aber auch eine alters- und geschlechtsstandardisiert sehr leicht steigende Prävalenz der Demenz: Von 17,5% in den Jahren 1987-89 auf 17,9% in den Jahren 2001-04.
• Und der jüngste Vergleich zweier Jahrgangs-Kohorten in drei Regionen Englands in der so genannten "Cognitive Function and Ageing Study (CAFS I und II)" fand bei über 65-Jährigen sogar eine Abnahme der Demenz-Prävalenz von 8,3% in den Jahren 1989-94 auf 6,5% in den Jahren 2008-11.
Einige der Autoren, die sich auf die Analyse der Neuerkrankungen konzentrierten, räumen ein, eine Zunahme der absoluten Anzahl älterer BürgerInnen könne selbst bei sinkender Inzidenz insgesamt oder für längere Phasen durchaus zu einer Zunahme der Prävalenz führen. Dies müsse aber nicht zwangsläufig so sein. Anders als die Alzheimer-Propheten oder -Lobbyisten in der Pharmaindustrie und in Teilen der Patientenorganisationen weisen sie aber auch auf Faktoren hin, die ihre bei weitem nicht so apokalyptischen und naturgewaltigen Funde erklären helfen und präventive Bedeutung haben.
"But for now, the evidence supports the theory that better education and greater economic well-being enhance life expectancy and reduce the risk of late-life dementias in people who survive to old age. The results also suggest that controlling vascular and other risk factors during midlife and early old age has unexpected benefits."
Und zu dem möglichen Effekt, der entsteht, wenn man diese Faktoren präventiv beeinflussen würde, stellen die AutorInnen fest: "That is, individual risk-factor control may provide substantial public health benefits if it leads to lower rates of late-life dementias. Just as control of vascular risk factors has had measurable effects on public health through reduced rates of stroke and myocardial infarction, the recent English study concluded that estimates of national dementia prevalence based on CFAS I needed to be revised downward by 24% on the basis of the age- and sex-specific prevalence rates in 2011 found in CFAS II."
Die Ergebnisse der AID-"Studie" G8 Policy Briefing reveals 135 million people will live with dementia by 2050 sind kostenlos erhältlich.
Das Wichtigste zur Epidemiologie der Demenz findet sich auf 5 Seiten, welche die Deutsche Alzheimer Gesellschaft kostenlos zur Verfügung stellt.
Die Übersichtsarbeit New Insights into the Dementia Epidemic von Eric B. Larson, Kristine Yaffe, und Kenneth M. Langa ist am 27. November 2013 im NEJM erschienen und komplett kostenlos erhältlich. Diejenigen Interessierten, die sich seriös intensiver und weiter über die Entwicklung des Demenzrisikos informieren wollen und am unbedingt notwendigen und keineswegs abgeschlossenen Diskurs über dessen Bedeutung für die heutige und künftige Gesundheitspolitik teilnehmen wollen, finden hier auch bibliografische Angaben zu den Originalaufsätzen über die zitierten Studien.
Bernard Braun, 5.12.13
WHO-Krebsforschungszentrum: Luftverschmutzung ist mit ausreichender Evidenz "a leading environmental cause of cancer deaths"
 Über den Erhalt, die mögliche Verringerung, Ausnahmeregelungen oder gar die Ausdehnung der immer noch relativ wenigen Umweltzonen in deutschen Städte finden immer noch zähe Auseinandersetzungen praktisch um jede Straße und jeden Block statt. Dieses Ringen sollte mit dem Erscheinen der "Monographie 161: Air pollution and cancer" der "International Agency for Research on Cancer (IARC)", einer wissenschaftlichen Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, beendet und sogar qualitativ derart erweitert werden, dass mehrere bisher weitgehend unbeachtete Schadstoffe berücksichtigt und vermieden werden sollten.
Über den Erhalt, die mögliche Verringerung, Ausnahmeregelungen oder gar die Ausdehnung der immer noch relativ wenigen Umweltzonen in deutschen Städte finden immer noch zähe Auseinandersetzungen praktisch um jede Straße und jeden Block statt. Dieses Ringen sollte mit dem Erscheinen der "Monographie 161: Air pollution and cancer" der "International Agency for Research on Cancer (IARC)", einer wissenschaftlichen Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, beendet und sogar qualitativ derart erweitert werden, dass mehrere bisher weitgehend unbeachtete Schadstoffe berücksichtigt und vermieden werden sollten.
Für die WHO-Onkologen besteht für die durch mehrere Stoffe bestimmte Luftverschmutzung nach der Sichtung von mehr als 1.000 weltweit erschienenen Studien eine ausreichende Evidenz, dass mehrere dieser Stoffe und ihre Mischung Lungen- und auch andere Krebsarten auslösen können. Luftverschmutzung wird deshalb innerhalb der Risikobewertungsklassifikation der IARC ein so genanntes Group 1-Karzinogen ("agent is carcinogenic to humans" und hat "sufficient evidence of carcinogenicity").
Zu der riskanten Schadstoffmischung in der Außenluft gehören z.B. gehören polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, Ruß, Titandioxid und Talk, offene Feuer und das Anbraten unter hohen Temperaturen im Haushalt, Bitumen und Bitumen-Emissionen und verwandte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) sowie Diesel und andere Fahrzeugabgase sowie Nitroarene, deren Gefährlichkeit einzeln auch bereits in anderen IARC-Monographien nachgewiesen wurde. Der in den "Innenstadt-Umweltzonen"-Debatten eine bedeutende Rolle spielende Feinstaub wurde in einer weiteren Studie ebenfalls zum Group 1-Karzinogen erklärt.
Die Autoren der Monographie 161 heben zwar hervor, dass ihre Forschungsergebnisse sicher das Krebsrisiko der Luftverschmutzung als Ursache für weltweit, also ausdrücklich auch in europäischen Großstädten rund 223.000 Tote pro Jahr nachweisen, lassen aber nicht unerwähnt, dass Luftverschmutzung auch signifikant mit anderen Krankheiten assoziiert ist wie z.B. Herz-Kreislauf- oder Atmungsorganerkrankungen. Trotz eines zunächst geringen individuellen Risikos, wegen der Luftverschmutzung z.B. an Lungenkrebs zu erkranken und zu versterben, stellt die Verringerung der Verschmutzung ein weltweit enormes Public-Health-Thema dar.
Dass die Auswirkung von Luftverschmutzung auf die Morbidität und Frühsterblichkeit von Bevölkerungen keineswegs ein Problem der Dritten Welt oder Chinas ist, zeigten auch bereits zwei im Sommer 2013 erschienene methodisch hochwertige Studien.
Die in der Zeitschrift "Lancet Oncology" vorgestellte Meta-Analyse der Ergebnisse von 17 in Europa durchgeführten Kohortenstudien, die in Regionen mit erhöhten Schadstoffanteilen in der Außenluft leben, bestand bei einem maximalen Follow-up von 13 Jahren bei mehreren Schadstoffen ein signifikant erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.
Eine Meta-Analyse von 35 internationalen Studien in der Fachzeitschrift "Lancet" belegt, dass höhere Expositionen gegenüber bestimmten Schadstoffen (z.B. Carbon-Monoxid) das Risiko erhöhte, während Krankenhausbehandlung wegen Herzschwäche zu sterben. In den USA könnten durch eine Absenkung der Schadstoffkonzentration in der Luft um 3,9 Mikrogramm pro Kubikmeter rund 8.000 Todesfälle während der stationären Behandlung von Herzschwäche pro Jahr vermieden werden.
Einen Überblick über das IARC-Programm für eine "encyklopaedia of carcinogens" gibt die knappe IARC-Pressemitteilung Nr. 221 vom 17.10.2013.
Die von Kurt Straif, Aaron Cohen und Jonathan Samet herausgegebene Monographie 161. IARC Scientific Publication No. 161 "Air Pollution and Cancer" kann man als E-Book im epub-Format kostenlos herunterladen und bei Bedarf z.B. mit dem Programm Calibre in ein anderes Readerformat umwandeln.
Zu dem im August 2013 erschienenen Aufsatz Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) von Ole Raaschou-Nielsen rt al. - erschienen in "The Lancet Oncology" (Volume 14, Issue 9, Pages 813 - 822) gibt es das Abstract kostenlos.
Ebenfalls das kostenlose Abstract gibt es für den im September 2013 online erschienenen Aufsatz Global association of air pollution and heart failure: a systematic review and meta-analysis von Anoop SV Shah et al. aus der Zeitschrift "The Lancet" (Volume 382, Issue 9897, Pages 1039 - 1048). 21 September 2013
Bernard Braun, 18.10.13
Welche zentralen Faktoren spielen bei Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit Hauptrollen und was haben beide miteinander zu tun?
 Was sind die häufigsten Probleme von Pflegekräften, Ärzten und Patienten im Zusammenhang mit der stationären Behandlung? Gibt es Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit von Patienten und Krankenhausmitarbeitern? Diesen Fragen ging das Picker-Institut, einer der international tätigen Pioniere der seriösen Patienten- und Mitarbeiterbefragung, umfassend nach. Erstens mit einer Analyse der Antworten von 111.835 Patienten-Befragungsbögen aus den Jahren 2009 bis 2012, zweitens mit einer Auswertung der Antworten auf einen Mitarbeiter-Fragebogen von 10.441 Pflegekräften und 4.211 Ärzten im selben Zeitraum und drittens mit den Antworten von 27.300 Patienten, ca. 4.000 Ärzten und 11.000 Pflegekräfte aus Krankenhäusern, in denen im Abstand von höchstens einem Jahr alle drei Gruppen befragt wurden.
Was sind die häufigsten Probleme von Pflegekräften, Ärzten und Patienten im Zusammenhang mit der stationären Behandlung? Gibt es Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit von Patienten und Krankenhausmitarbeitern? Diesen Fragen ging das Picker-Institut, einer der international tätigen Pioniere der seriösen Patienten- und Mitarbeiterbefragung, umfassend nach. Erstens mit einer Analyse der Antworten von 111.835 Patienten-Befragungsbögen aus den Jahren 2009 bis 2012, zweitens mit einer Auswertung der Antworten auf einen Mitarbeiter-Fragebogen von 10.441 Pflegekräften und 4.211 Ärzten im selben Zeitraum und drittens mit den Antworten von 27.300 Patienten, ca. 4.000 Ärzten und 11.000 Pflegekräfte aus Krankenhäusern, in denen im Abstand von höchstens einem Jahr alle drei Gruppen befragt wurden.
Zu den wichtigsten bekannten und neuen Erkenntnissen gehören:
• 47% der befragten Patienten berichten über eine suboptimale Versorgungssituation bei der Vorbereitung auf ihre Entlassung, 30% sahen ihre Familie nicht gut einbezogen, 22% hatten Probleme mit der Arzt-Patient-Interaktion, 18% hatten Probleme mit dem Essen und der geringste Anteil von 10% Probleme mit der Sauberkeit.
• Die zentralen Faktoren für die Gesamtzufriedenheit der Patienten waren mit 60,8% Anteil die Pflegepersonal- und Arzt-Patient-Interaktion. Und nicht die häufig kolportierte Qualität der Küche oder der TV-Empfangsmöglichkeiten.
• 57%, 54% und 50% der Ärzte haben große Probleme mit der Arbeitsbelastung, ihrer Qualifizierung und der Führungs- und Unternehmenskultur. Diese Wahrnehmung und Erfahrungen teilten sie sich mit 49%, 47% und 48% der Pflegekräfte. Die wenigsten Ärzte und Pflegekräfte, nämlich zwischen 13% und 20% hatten dagegen Probleme mit dem zwischenmenschlichen Umgang oder der Dienstplanung.
• 49% der Arbeitszufriedenheit von Ärzten wird durch die Faktoren Führungs- und Unternehmenskultur, das Verhältnis zu den direkten Vorgesetzten sowie zu ihren direkten Kollegen bestimmt. Etwas anders sieht es bei Pflegekräften aus: 58% ihrer Arbeitszufriedenheit werden auch durch den Faktor Führungs- und Unternehmenskultur, die Arbeitsbelastung und die Bedingungen der Patientenversorgung bestimmt.
• 50% bis 65% der Ärzte und Pflegekräfte haben aus ihrer subjektiven Sicht zu wenig Zeit für die Interaktion mit Patienten und deren Angehörigen.
• Je besser die Pflegekräfte die Interaktion von Patienten, Pflegekräften und Ärzten und die Bedingungen der Patientenversorgung bewerten, umso besser beurteilen die Patienten die Interaktion mit den Pflegekräften. Ähnliche ebenfalls hochsignifikante Zusammenhänge gibt es auch zwischen Patienten und Ärzten.
Für die Autoren des Picker-Reports bedeutet dies, dass Patienten- und Mitarbeiterorientierung "nicht zu Lippenbekenntnissen in Leitbildern und Marketingaktionen" "verkommen" dürfen. Ähnliches gilt wohl auch für einen Teil der Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsrituale. Die offensichtlich essentiell miteinander verbundenen Erfahrungen von Patienten und Ärzten sollten daher wesentlich mehr als bisher bei der Definition von Qualitätszielen oder als Steuerungselemente in Krankenhäusern genutzt werden.
Eine Kurzversion von vier Seiten des Reports Picker-Report 2013. Zentrale Faktoren der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit von K. Stahl und M. Nadj-Kittler ist kostenlos erhältlich. Wer an der 23-seitigen Langversion interessiert ist, sollte es beim Picker-Institut in Hamburg versuchen.
Bernard Braun, 2.10.13
Mehr Schaden als Nutzen oder Fehlversorgung? Antidepressiva und Hüftfrakturen im höheren Lebensalter
 Die Heilung von Knochenfrakturen aller Art und die Wiederherstellung der vorherigen Beweglichkeit und Sicherheit zahlreicher körperlicher Prozesse dauert insbesondere bei älteren Menschen sehr lange, belastet die Lebensqualität (z.B. Schmerzen und Schmerzbehandlung) oder kommt teilweise auch gar nicht mehr zustande.
Die Heilung von Knochenfrakturen aller Art und die Wiederherstellung der vorherigen Beweglichkeit und Sicherheit zahlreicher körperlicher Prozesse dauert insbesondere bei älteren Menschen sehr lange, belastet die Lebensqualität (z.B. Schmerzen und Schmerzbehandlung) oder kommt teilweise auch gar nicht mehr zustande.
Die Hüftfraktur gehört zu den Erkrankungen mit den gravierendsten Folgen und sollte daher möglichst verhindert werden. Eine verminderte Knochendichte und -stabilität sowie Stürze gehören zu den wichtigsten Ursachen und damit auch präventiven Ansatzpunkten.
Eine landesweite prospektive Kohortenstudie mit allen 906.422 in Norwegen vor 1945 geborenen Personen untersuchte jetzt, ob nicht auch Arzneimittel und dabei insbesondere die für ältere Personen relativ häufig verordneten Antidepressiva eine wichtige Rolle als Risikofaktor spielen.
Die ForscherInnengruppe erhielt für ihre Untersuchung sämtliche Informationen über alle zwischen 2004 und 2010 erfolgten Verordnungen von Antidepressiva und Angaben über alle Hüftfrakturen im Zeitraum 2005-10. Der für den Vergleich des Neueintretens einer Hüftfraktur bei PatientInnen mit oder ohne Antidepressiva-Verordnungen genutzte Indikator war die standardisierte Inzidenzrate (SIR).
Die Ergebnisse:
• 4,4% dieser Kohorte oder 39.938 Personen hatten im Untersuchungszeitraum eine Hüftfraktur.
• Dieses Risiko war bei Menschen mit der Verordnung irgendeines Antidepressivums signifikant höher als bei Personen ohne die Einnahme eines solchen Medikaments. Die SIR lag bei 1,7.
• Bei trizyklischen Antidepressiva lag SIR etwas niedriger, und zwar bei 1,4. Unter der Einnahme von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (selective serotonin reuptake inhibitors [SSRIs]) war die Rate mit 1,8 am höchsten. Alle anderen Antidepressiva hatten eine SIR von 1,6.
• Daraus ergibt sich für Hüftfrakturen insgesamt ein zusätzliches oder attributives Risiko der Exposition gegen Antidepressiva von 4,7%.
Wer nicht der Meinung ist, Hüftfrakturen gehörten zum normalen stofflichen Altersrisiko und seien daher nicht vermeidbar, sollte sich nach dieser und weiteren Studien mit ähnlichen Ergebnissen intensiver mit der Art und dann auch noch der Menge der verordneten Arzneimittel (Stichwort Polypharmazie) kümmern. Auch wenn mit dieser Studie kein abschließender Beleg für einen ursächlichen Zusammenhang vorliegt, sollten die Ergebnisse trotzdem zu einer defensiveren Verordnung dieser Art von Arzneimittel Anlass sein und weitere Studien die jetzige signifikante Assoziation zu einem Ursache-Wirkungszusammenhang verdichten.
Der Aufsatz Increased risk of hip fracture among older people using antidepressant drugs: data from the Norwegian Prescription Database and the Norwegian Hip Fracture Registry von Marit Stordal Bakken et al. ist am 24. Februar 2013 in der Online-Ausgabe der Zeitschrift "Age Ageing" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.3.13
Leben die alternden "baby boomer" in den USA länger und gesünder als ihre Väter? Ja und nein!
 Von 1946 bis 1964 wurden in den USA 78 Millionen Kinder geboren, die unter der Bezeichnung "baby boomer" 2010 26,1 der US-Bevölkerung stellten. Da auch in den USA die nachfolgenden Geburtsjahrgänge geringer besetzt sind und die "baby boomers" auch eine längere Lebenserwartung als ihre Eltern haben werden, wird dieser Anteil zukünftig noch zunehmen. Und zunehmen wird außerdem der Einfluss ihrer Gesundheit auf den künftigen Versorgungsbedarf und die Finanzierbarkeit des US-Gesundheitssystems. Je nachdem, wie gesund die "baby boomer" in das Rentenalter und damit in den meist gesundheitlich aufwändigeren Lebensabschnitt kommen, desto positiver oder negativer wird dieser Einfluss werden.
Von 1946 bis 1964 wurden in den USA 78 Millionen Kinder geboren, die unter der Bezeichnung "baby boomer" 2010 26,1 der US-Bevölkerung stellten. Da auch in den USA die nachfolgenden Geburtsjahrgänge geringer besetzt sind und die "baby boomers" auch eine längere Lebenserwartung als ihre Eltern haben werden, wird dieser Anteil zukünftig noch zunehmen. Und zunehmen wird außerdem der Einfluss ihrer Gesundheit auf den künftigen Versorgungsbedarf und die Finanzierbarkeit des US-Gesundheitssystems. Je nachdem, wie gesund die "baby boomer" in das Rentenalter und damit in den meist gesundheitlich aufwändigeren Lebensabschnitt kommen, desto positiver oder negativer wird dieser Einfluss werden.
Eine WissenschaftlerInnengruppe hat nun durch einen Vergleich der Daten für die Jahre 1988 bis 1994 und 2007 bis 2010 (Baby-Boomer-Generation) für die in diesen Zeiträumen jeweils 46- bis 64-jährigen Befragten aus dem "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)" folgendes herausgefunden:
• Die Lebenserwartung stieg zwischen den beiden Untersuchungszeiträumen deutlich an, d.h. die Baby-Boomer-Kohorte lebt länger.
• Bei sehr ähnlicher soziodemografischer Zusammensetzung sagten statistisch signifikant weniger, nämlich 13,2% der Baby-Boomer, ihr Gesundheitszustand sei exzellent, als es die Generation davor im selben Lebensalter gesagt hatten, nämlich 32%.
• Ein jeweils signifikant höherer Anteil der Baby-Boomer benötigte eine Gehhilfe (6,9% versus 3,3%), war eingeschränkt arbeitsfähig (13,8% versus 10,1%) oder hatte eine funktionale Beeinträchtigung (13,5% versus 8,8%).
• Ebenfalls signifikant höher war der Anteil der übergewichtigen Baby-Boomer (38,7% versus 29,4%).
• Auch bei einer Reihe von Lebensstil- und Gesundheitsverhaltensfaktoren (z.B. regelmäßige Bewegung, mäßiger Alkoholkonsum, Rauchen) waren die Baby-Boomer weniger aktiv oder verhielten sich ungesünder.
• Auch wenn die Veränderungen in der soziodemografischen Charakteristik der beiden Kohorten in einer multivariaten Analyse berücksichtigt wurden, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Baby-Boomer diabeteskrank waren, einen zu hohen Blutdruck oder Cholesterinspiegel hatten signifikant höher als in der vorherigen Generation.
• Besser war die gesundheitliche Situation der Baby-Boomer aber bei Emphysemen und Herzinfarkten. Außerdem rauchten sie weniger als ihre Mütter und Väter.
Die Hoffnung, dass die längere Lebenserwartung der Baby-Boomer-Generation ohne weitere Anstrengung eine höhere Anzahl gesunder Jahre mit sich bringe, muss nach den Ergebnissen dieses Kohortenvergleichs erheblich reduziert werden. Stattdessen sehen die WissenschaftlerInnen die Notwendigkeit so früh wie noch möglich Präventionsprogramme und Gesundheitsförderungsangebote für die Baby-Boomer-Generation zu entwickeln und anzubieten.
Die Ergebnisse sollten einerseits Anlass sein, die gesundheitliche Entwicklung und das Gesundheitsverhalten dieser Generation systematisch weiter zu untersuchen. Andererseits müssen sie in der weltweit geführten und gesundheitspolitisch enorm wichtigen Debatte über die gesundheitlichen Bedingungen oder Folgen der demografischen Alterung mitberücksichtigt werden.
Ob es solche unerwarteten intergenerationellen Veränderungen auch in Deutschland gibt, ist aktuell mangels entsprechender Untersuchungen weder zu bestätigen noch zu verwerfen.
Die als "research letter" am 1. Februar 2013 "online first" veröffentlichte Studie "The Status of Baby Boomers' Health in the United States: The Healthiest Generation?" von Dana E. King et al. ist in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.2.13
"IAB-Regional"-Bericht Altenpflege 2030 in Deutsch-Südwest: Wie rechnet man sich einen bedrohlichen Pflegebedarf zurecht!?
 Die Anzahl, der Qualifikationsmix und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte in Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten und stationären Einrichtungen der Altenpflege reichen mit Sicherheit weder heute noch in der weiteren Zukunft aus, um alle PatientInnen und Pflegebedürftigen bedarfsgerecht, wirksam, human und wirtschaftlich zu pflegen. Dies genau zu quantifizieren ist sozialpolitisch wichtig und berechtigt.
Die Anzahl, der Qualifikationsmix und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte in Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten und stationären Einrichtungen der Altenpflege reichen mit Sicherheit weder heute noch in der weiteren Zukunft aus, um alle PatientInnen und Pflegebedürftigen bedarfsgerecht, wirksam, human und wirtschaftlich zu pflegen. Dies genau zu quantifizieren ist sozialpolitisch wichtig und berechtigt.
Dazu trägt auch der gerade in der Reihe "IAB-Regional" erschienene Bericht 3/2012 zum zukünftigen Bedarf an Arbeitskräften im Bereich der Altenpflege in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis zum Jahr 2030 bei.
Auf der Basis des so genannten Status quo-Szenarios der weiteren demografischen und Pflegeentwicklung prognostizieren die Autoren zunächst folgende Veränderungen im Pflegebereich:
• Einen "Anstieg der Pflegebedürftigen von derzeit 105.800 auf bis zu 149.000 im Jahr 2030 in Rheinland-Pfalz und von gegenwärtig 30.400 auf bis zu 40.000 im Saarland."
• "Voraussichtlich (wird) die professionelle Pflege weiter an Bedeutung gewinnen, d. h. sowohl die Versorgung durch ambulante Pflegedienste als auch die Unterbringung in stationären Einrichtungen. Die Modellrechnungen zeigen für Rheinland-Pfalz, dass sich der Bedarf an Pflegearbeitskräften von heute rund 26.500 Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenten) auf 35.400 (starkes Engagement der Angehörigen und technischer Fortschritt in der Pflege) bis zu 48.300 (schwaches Engagement der Angehörigen und kein technischer Fortschritt in der Pflege) bis 2030 erhöhen könnte. Im Saarland ergibt sich ausgehend vom heutigen Bestand von 7.900 Arbeitskräften (in Vollzeitäquivalenten) im günstigsten Fall im Bereich der Altenpflege nur ein zukünftiger Bedarf von 9.900, sofern Produktivitätsfortschritte mit Effizienzgewinnen und eine hohe Versorgungsbereitschaft durch Angehörige gegeben sind. Oder, sofern Produktivitätsfortschritte ausbleiben und die Beteiligung von Angehörigen in der Pflege zurückgeht, werden im Bereich der Altenpflege an der Saar in 2030 13.000 Personen (in Vollzeitäquivalenten) erforderlich, um die Versorgung der Pflegebedürftigen zu ermöglichen.
• Dass die gesamte Weiterentwicklung "nicht nur vom Engagement der pflegenden Angehörigen sowie von Produktivitätsfortschritten in der Pflege" abhängt, "sondern auch von den Kosten für professionelle Pflegedienstleistungen" und der Höhe der "Verdienstmöglichkeiten im Pflegebereich" als Anreiz für Berufssuchende, sich für den Pflegebereich zu entscheiden, ist ein wichtiger Hinweis der Mitarbeiter des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit in den beiden Ländern und NRW.
Doch auch trotz der beabsichtigten differenzierten Prognose legen die Autoren wichtige Argumente und Faktoren entweder gar nicht auf den Tisch oder "begraben" sie nach kurzer Betrachtung unter ihm. So werden Mythen gemacht!
Als erstes erwecken auch sie den Eindruck, man könne gerade die Entwicklung der Nachfrage nach Pflege und des Angebots von Pflegekräften wirklich exakt für die nächsten 20 Jahre prognostizieren. Die zahllosen Fehlprognosen über die Entwicklung des Sozial- und Gesundheitsbereich in den letzten 30-40 Jahre und das oft für unmöglich oder undenkbar gehaltene Auftreten von Innovations- und Produktivitätsschüben, sollten solche Gewissheiten eigentlich verbieten.
Die Autoren weisen dann zwar selber auf die mögliche Einseitigkeit ihrer Annahmen über die zukünftige Nachfrage nach Pflegeleistungen und Pflegekräften hin, berücksichtigen die erwähnten Alternativannahmen bei ihren Berechnungen aber komplett nicht: "Diesem Szenario liegt die Annahme zugrunde, dass es zukünftig keine Verbesserungen im Gesundheitszustand der älteren Menschen gibt, z. B. durch präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen, Verhaltensänderungen und/oder durch bessere Behandlungsmöglichkeiten. … Diese Status-Quo-Hypothese basiert auf der Annahme, dass die Prävalenz der Pflegebedürftigkeit im Zeitablauf unverändert bleibt, obwohl sich die Lebenserwartung verlängert. Der Umfang, in welchem zukünftig Pflegeleistungen in Anspruch genommen werden, würde sich entsprechend der gegenwärtigen Struktur der Prävalenz verändern. Die Nachfrage nach Pflegeleistungen wächst nach dieser These daher nur, weil zukünftig ein höherer Bevölkerungsanteil auf die obersten Altersklassen entfällt. Diese Status-Quo-Hypothese ist nicht unumstritten, da bis dato nicht endgültig geklärt wurde, ob die altersspezifische Prävalenz in Zukunft tatsächlich unverändert bleibt … ." Wer danach Worte oder Zahlen sucht, die belegen was eine längere Lebenserwartung bei sich verbessernder Gesundheit und Pflegebedürftigkeit, d.h. die so genannte Kompressionshypothese oder eine Verbesserung der bei vielen Pflegeanlässen (z.B. Demenz) hilfreichen Rehabilitationsangebote ("Rehabilitation vor Pflege") für die künftige Nachfrage nach Pflegekräften in den beiden Bundesländern praktisch bedeutet, sucht vergeblich.
Der 42-seitige Bericht "Der zukünftige Bedarf an Arbeitskräften im Bereich der Altenpflege in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Modellrechnungen für die Länder bis zum Jahr 2030. von Anne Otto und Carsten Pohl ist 2012 in der Reihe "IAB-Regional. Berichte und Analysen aus dem Regionalen Forschungsnetz. IAB Rheinland-Pfalz-Saarland", erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.11.12
Cochrane-Review: Umfassende geriatrische Bewertung in Spezialabteilungen nützlicher als normale Behandlung und geriatrische Teams
 Mit für Cochrane-Reviews relativ seltener Entschiedenheit bzw. Uneingeschränktheit bewerteten die Reviewer in ihrem im Juli 2011 veröffentlichten Review "Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital" diese Form der Diagnose und Bewertung der Verfassung von geschwächten älteren KrankenhauspatientInnen als durchweg nützlicher als ihre normale Behandlung.
Mit für Cochrane-Reviews relativ seltener Entschiedenheit bzw. Uneingeschränktheit bewerteten die Reviewer in ihrem im Juli 2011 veröffentlichten Review "Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital" diese Form der Diagnose und Bewertung der Verfassung von geschwächten älteren KrankenhauspatientInnen als durchweg nützlicher als ihre normale Behandlung.
Diese Bewertung des "comprehensive geriatric assessment (CGA)" basierte auf den Ergebnissen von 22 randomisierten, kontrollierten Studien aus sechs Ländern mit 10.315 TeilnehmerInnen. CGA ist ein multidimensionaler, interdisziplinärer Diagnoseprozess, der die medizinischen, psychologischen und funktionalen Fähigkeiten von geschwächten älteren KrankenhauspatientInnen ermittelt, selbständig und selbstbestimmt leben zu können und dafür einen koordinierten und integrierten Behandlungs- und Unterstützungsplan entwickelt, der eine möglichst lange Dauer hat. Die professionellen Akteure bei CGA können spezielle Abteilungen in den Krankenhäusern oder mobile Teams sein.
Die wesentlichen Ergebnisse der berücksichtigten Studien lauteten:
• Die PatientInnen, die das CGA erhielten, lebten im Vergleich zu den PatientInnen mit der üblichen Behandlung sowohl nach sechs (Odds ratio: 1,25; p=0,0002)) als auch nach zwölf Monaten (odds ratio: 1,16; p=0,003) nach der Krankenhausentlassung signifikant häufiger in ihren eigenen vier Wänden ("living at home" als primärer Outcome).
• Die "Chance" nach der Krankenhausbehandlung in einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Institution zu landen war unter den CGA-PatientInnen signifikant geringer (OR: 0,79; p<0,0001). Dies galt ebenso für die "Chance" zu sterben oder eines schlechteren Gesundheitszustands (OR: 0,76; p=0,001).
• Es war schließlich signifikant wahrscheinlicher, dass die CGA-PatientInnen im Vergleich mit normalbehandelten PatientInnen ihre kognitiven Fähigkeiten verbesserten (OR: 1,11; p=0,02)
• Detaillierte Analysen zeigten außerdem, dass die wesentlichen Effekte des CGA vor allem dann auftraten, wenn die älteren PatientInnen in speziellen Abteilungen ("wards") anstatt in ihrer jeweiligen Behandlungsabteilung durch spezielle mobile Teams behandelt wurden.
Vom Cochrane-Review "Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital" von Ellis G., Whitehead MA et al. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD006211) ist kostenlos nur das umfassende Abstract zu erhalten.
Die Ergebnisse des Cochrane-Reviews werden auch in dem Aufsatz "Comprehensive geriatric assessment for older adults adnitted to hospital: meta-analysis of randomised controlled trials" von Graham Ellis et al. im "British Medical Journal" (2011; 343) dargestellt, der komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 22.10.12
Selbständiges häusliches Leben für Ältere nach kürzerem Krankenhausaufenthalt möglich: Das "Acute Care for Elders (ACE)"-Programm
 Der schon immer hohe Anteil von älteren, oft multimorbiden PatientInnen im Krankenhaus, die nach ihrer Entlassung auch noch oft behandlungs- und versorgungsbedürftig sind, wird als Folge der demografischen Alterung weiter zunehmen. Und damit nimmt auch das Problem zu, sie so zu entlassen, dass sie mit möglichst geringem Stress wieder in ein möglichst selbständiges oder selbstbestimmtes Leben in ihrer häuslichen Umgebung zurückkehren können. Funktioniert diese Reintegration nicht, drohen die Wiedereinweisung in das Krankenhaus, unerwünschte gesundheitliche Stress-Folgen oder gar der Beginn von ambulanter und stationärer Pflegebedürftigkeit.
Der schon immer hohe Anteil von älteren, oft multimorbiden PatientInnen im Krankenhaus, die nach ihrer Entlassung auch noch oft behandlungs- und versorgungsbedürftig sind, wird als Folge der demografischen Alterung weiter zunehmen. Und damit nimmt auch das Problem zu, sie so zu entlassen, dass sie mit möglichst geringem Stress wieder in ein möglichst selbständiges oder selbstbestimmtes Leben in ihrer häuslichen Umgebung zurückkehren können. Funktioniert diese Reintegration nicht, drohen die Wiedereinweisung in das Krankenhaus, unerwünschte gesundheitliche Stress-Folgen oder gar der Beginn von ambulanter und stationärer Pflegebedürftigkeit.
Ob und was Krankenhäuser machen können, um diese unerwünschten Folgen vermeiden oder minimieren zu können, zeigen die in der Juniausgabe 2012 der renommierten Gesundheitspolitikzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Ergebnisse einer in 200 bundesweiten Kliniken der USA in den Jahren 1993 bis 1997 durchgeführten kontrollierten Studie mit insgesamt 1.632 70-jährigen und älteren TeilnehmerInnen über die Wirkungen des "Acute Care for Elders (ACE)"-Programms. Zuvor war das Programm bereits in zwei randomisierten kontrollierten Studien in unterschiedlichen Krankenhaustypen untersucht worden und zum Teil gab es ebenfalls positive Wirkungen auf die Lebensqualität und die Kosten der stationären Behandlung.
Dieses Programm wurde u.a. deshalb entwickelt, weil in den USA über ein Drittel der älteren KrankenhauspatientInnen das Krankenhaus mit einer geringeren Funktionsfähigkeit für das tägliche selbstbestimmte Leben verlassen als zu Beginn der stationären Behandlung. Dafür verantwortlich sind Mobilitätsverluste, gestörtes Schlafen, die ungewohnte Krankenhausumgebung, andere gesundheitliche Störungen, Verwirrungen und Schwierigkeiten alleine Stärke und Mobilität zurückzugewinnen.
Das Programm beruht auf einem multidisziplinären Ansatz, der Prinzipien der Qualitätsverbesserung und ein umfassendes geriatrisches Assessment mit dem Ziel verbindet, stationär behandelten älteren Personen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, sich im Bereich der funktionalen Basisaktivitäten des täglichen Lebens unabhängig verhalten zu können. Das dafür gebildete Versorgungsteam besteht in der Regel aus einem Geriater, einer speziell weitergebildeten Pflegekraft ("practice nurse"), einem Sozialarbeiter, einem Apotheker, Ernährungsberater und einem Physiotherapeuten.
Zu den Hauptinstrumenten und -bedingungen des Programms gehören z.B.
• eine speziell "häuslich" gestaltete Krankenhausumgebung mit Teppichböden, erhöhten Toilettensitzen und einem salonartigen Raum für gemeinsames Essen und Familienbesuche,
• die patientenzentrierte Behandlung, in deren Mittelpunkt die Förderung von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung steht und
• die regelmäßige Überprüfung der medizinischen Behandlung mit dem besonderen Schwerpunkt behandlungsbedingte und den Krankenhausaufenthalt verlängernde Komplikationen zu reduzieren.
Zu den untersuchten Wirkungen des Programms gehörten primär die Länge des Krankenhausaufenthalts und seine Kosten und sekundär einige Indikatoren des Behandlungsverlaufs (z.B. Entlassplanung, Krankenhaussterblichkeit, Drei-Monats-Wiedereinweisungsrate) und der Fähigkeiten im täglichen häuslichen Leben (z.B. Einkaufen, diverse Mobilitätsmerkmale).
Die Ergebnisse für diese Outcome-Indikatoren lauteten:
• Die stationäre Liegezeit betrug in der ACE-Gruppe 6,7 Tage. In der Kontrollgruppe mit der üblichen Behandlung betrug sie 7,3 Tage. Der Unterschied ist statistisch signifikant. Pro hundert PatientInnen, die in der Untersuchungszeit nach dem ACE-Programm versorgt wurden, verringerte sich im Vergleich die Anzahl der Krankenhaustage um 58 Tage.
• Die Wiedereinweisungsrate nahm bei den ACE-PatientInnen nicht zu.
• Bei den funktionalen Fähigkeiten zum Zeitpunkt der Entlassung gab es in dieser Studie keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. In zwei anderen, im hier vorgestellten Aufsatz zitierten Studien gab es aber signifikant bessere Fähigkeiten für das tägliche Leben bei den ACE-Personen. Eine Erklärung wäre, dass nach den ersten Erfolgen des ACE-Konzepts auch die übliche Behandlung verbessert wurde und ähnlich positive Wirkungen hat.
• Den 9.477 US-Dollar, welche die Behandlung eines ACE-Patienten im Durchschnitt kostete, standen 10.451 US-Dollar für normal behandelte PatientInnen gegenüber - ein ebenfalls statistisch signifikanter Unterschied. Auf sämtliche stationär behandelte Medicare-Versicherte hochgerechnet beträgt die jährliche Ausgabenersparnis 6 Milliarden US-Dollar.
• Schließlich gab es auch Ergebnisse, die den intuitiven Erwartungen widersprachen: So hatten die TeilnehmnerInnen der ACE-Gruppe z.B. weniger Konsultationen mit Physiotherapeuten und auch seltener eine Entlassungsplanungsdokumentation. Eine Erklärung wäre, dass vieles, was in den genannten formalen Formen erwartet wird bereits informell in den multidisziplinären Teams bearbeitet und vermittelt wurde. Immerhin ist ja das Ziel, die PatientInnen darauf vorzubereiten, nach Hause entlassen werden zu können, eine integrale Komponente von ACE. Diese spezielle Vorbereitung ersetzt dann evtl. die normale Entlassungsplanung.
• Trotz der wiederholten Belege für den Nutzen des ACE-Konzepts weisen die AutorInnen auf mehrere potenziellen Implementationsbarrieren hin, die es wahrscheinlich nicht nur in den USA gibt: der Mangel an angemessenen Vergütungsformen, der Mangel an geeignetem geriatrisch qualifizierten Personal, das Risiko für eine Unterauslastung der ACE-Betten, die nicht für andere Patienten genutzt werden können.
Zu dem möglichen Hinweis, es handle sich doch um eine relativ alte Studie mit möglicherweise völlig veralteten Ergebnissen, merken die AutorInnen an: "We believe that in all likelihood, the findings are even more relevant today for several reasons."
Von dem im Juni 2012 in der Zeitschrift "Health Affairs" (31, no.6 :1227-1236) veröffentlichten Aufsatz "Acute Care For Elders Units Produced Shorter Hospital Stays At Lower Cost While Maintaining Patients' Functional Status" von Deborah E. Barnes, Robert M. Palmer, Denise M. Kresevic et al. gibt es kostenlos ein knappes Abstract.
Bernard Braun, 21.10.12
65+-PatientInnen in Krankenhäusern haben ein höheres Risiko für unerwünschte Ereignisse als Jüngere. Gegenmaßnahmen möglich!
 Auch wenn das öffentliche Bewusstsein, dass es in Krankenhäuser auch zu unerwünschten gesundheitlichen Ereignissen kommen kann, vor allem durch diverse Hygieneskandale oder fragwürdige Umstände von Organverpflanzungen stimuliert wird, zeigen systematische Untersuchungen, dass ihr Auftreten keine Seltenheit ist oder es nur um "schwarze Schafe" geht.
Auch wenn das öffentliche Bewusstsein, dass es in Krankenhäuser auch zu unerwünschten gesundheitlichen Ereignissen kommen kann, vor allem durch diverse Hygieneskandale oder fragwürdige Umstände von Organverpflanzungen stimuliert wird, zeigen systematische Untersuchungen, dass ihr Auftreten keine Seltenheit ist oder es nur um "schwarze Schafe" geht.
In den Niederlanden hat eine retrospektive Analyse von medizinischen Behandlungsdaten als nationale Inzidenzrate für unerwünschte Ereignisse bei KrankenhauspatientInnen einen Anteil von 5,7% aller Krankenhausfälle ermittelt. 40% dieser Ereignisse wurden als vermeidbar bewertet und 12,8% der Ereignisse endeten bei permanenter Behinderung oder Tod.
Da der Anteil älterer PatientInnen unter den KrankenhauspatientInnen bereits jetzt relativ hoch ist und weiter wachsen wird, stellten sich holländische Wissenschaftler die Frage, ob diese PatientInnengruppe besonders häufig von unerwünschten gesundheitlichen Ereignissen betroffen ist.
Eine für die niederländischen Krankenhäuser repräsentative Studie und fachliche Bewertung von 7.917 Patienten-Behandlungsakten bzw. -dateien aus 21 Kliniken im Jahr 2004, bestätigten ein signifikant höheres Risiko älterer KrankenhauspatientInnen.
Im Einzelnen sahen die Ergebnisse so aus:
• Unerwünschte Ereignisse und vermeidbare unerwünschte Ergebnissen traten bei 6,9% bzw. 2,9% aller 65-jährigen und älteren PatientInnen auf. Bei jüngeren PatientInnen (jünger als 65 Jahre) betrugen die Anteile 4,8% bzw. 1,8%.
• Bei älteren PatientInnen traten bei 20,1% unerwünschte Ereignisse bei der Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln auf. Der Anteil dieser Art von Ereignissen lag bei den Jüngeren erneut signifikant niedriger, nämlich bei 9,6%.
• Als Hauptursache für die unerwünschten Ereignisse identifizierten die WissenschaftlerInnen die Unfähigkeit von Ärzten und/oder Pflegekräften vorhandenes Wissen in neuen und komplexen Situationen anzuwenden. Dies war bei 36,4% der Ereignisse der Älteren und bei 24,3%, und damit wieder signifikant selteneren Ereignissen der Jüngeren der Fall.
Um das für Ältere im Krankenhaus deutlich höhere Risiko gesundheitlich geschädigt zu werden zu reduzieren, schlagen die AutorInnen u.a. ein spezifisches Training vor mit dem die Wissens- und Handlungslücken für die Behandlung älterer PatientInnen geschlossen werden können. Zusätzlich könnte der Aufbau und standardmäßige Einsatz von multidisziplinären Teams von Geriatern und spezialisierten Pflegekräften für die Behandlung älterer KlinikpatientInnen zu einer deutlichen Verbesserung der Behandlung und auch zu weniger unerwünschten Ereignisse führen.
Von dem am 19. Oktober 2012 veröffentlichten Aufsatz "Scale, nature, preventability and causes of adverse events in hospitalised older patients" von H. Merten et al. - erschienen in der Fachzeitschrift "Age and Ageing 2012; 0: 1-6" - ist kostenlos ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 20.10.12
"Move slowly" oder Vorsicht vor vorschnellen und übersteigerten Erwartungen beim Einsatz von Telemonitoring bei älteren Kranken
 Auch wenn dies die umsatzwitternden Hersteller von Mess-Sensoren und Übertragungstechnologien für Körperwerte und ihre Partner in Kassenärztlichen Vereinigungen, Landesgesundheitsministerien und Krankenkassen anders sehen: Der gesundheitliche und finanzielle Nutzen von Telemonitoring ist noch lange nicht und vor allem nicht für alle PatientInnengruppen zweifelsfrei bewiesen.
Auch wenn dies die umsatzwitternden Hersteller von Mess-Sensoren und Übertragungstechnologien für Körperwerte und ihre Partner in Kassenärztlichen Vereinigungen, Landesgesundheitsministerien und Krankenkassen anders sehen: Der gesundheitliche und finanzielle Nutzen von Telemonitoring ist noch lange nicht und vor allem nicht für alle PatientInnengruppen zweifelsfrei bewiesen.
Zwar ist die Vorstellung "nett", ältere Kranke nicht den möglicherweise beschwerlichen und gelegentlich nicht zu bewältigenden Weg zum kilometerweit entfernten Arzt machen zu lassen und stattdessen kontinuierlich eine Fülle von Körperdaten elektronisch an eine Art Überwachungszentrum zu übertragen, wo dann von Ärzten oder speziell ausgebildeten Pflegekräften entschieden wird, ob direkte Unterstützung notwendig ist. Unklar ist aber, ob einige Erwartungen zum Nutzen des Telemonitoring berechtigt sind.
Für eine Gruppe von insgesamt 205 älteren PatientInnen (Durchschnittsalter 80 Jahre, 54% Frauen, 102 in der Telemonitoring-Gruppe, 103 in der Standardbehandlungsgruppe) mit mittels Standardinstrumenten gemessenen hohen gesundheitlichen Risiken, die aber trotzdem nicht in einem Pflegeheim wohnten, dement oder unfähig waren die Telemonitoring-Apparaturen zu nutzen, wurden in einer randomisierten kontrollierten Studie über ein Jahr hinweg die Anzahl der Krankenhauseinweisungen, der Besuche von Notfallstationen und die Sterblichkeit untersucht.
Die Ergebnisse waren eindeutig:
• Die Ereignisraten in der Telemonitoring-Gruppe unterschieden sich nicht signifikant von denen in der Patientengruppe mit der üblichen Behandlung. Bemerkenswert ist dennoch, dass die Raten in der Telemonitoring-Gruppe durchweg über denen in der Kontrollgruppe lagen.
• Unerwartet und statistisch signifikant höher war aber die Sterblichkeitsrate in der Telemonitoring-Gruppe mit 15% höher als in der "usual care"-Gruppe mit 3,9%. Der Kommentar der ForscherInnengruppe zu diesem Ergebnis lautet: "The cause of greater mortality in the telemonitoring group is unknown."
Ein Kommentator, der die Ergebnisse dieser Studie kritisch hinterfragt und dabei auch wichtige Hinweise für mögliche Erklärungen beider Ergebnisse liefert, kommt am Schluss seiner Ausführungen aber zu zwei prinzipiell relevanten Schlussfolgerungen für den weiteren Umgang mit Telemonitoring: "We believe there are 2 principal lessons to be drawn from this well-performed study. First, we need a better understanding of the critical patient, physician, health system, and telehealth program factors that predict success and that would allow us to target these interventions to patients who are most likely to see benefit. Second, there should be careful thought given to the appropriate outcomes that telehealth programs aim to effect. While awaiting the answers to these questions, we would advise payers and physicians to move slowly in implementing telehealth programs on a wide scale."
Von der Studie "A randomized controlled trial of telemonitoring in older adults with multiple health issues to prevent hospitalizations and emergency department visits." von Takahashi PY, Pecina JL, Upatising B, Chaudhry R, Shah ND, Van Houten H, Cha S, Croghan I, Naessens JM, Hanson GJ., erschienen am 28. Mai 2012 in der renommierten Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (172(10): 773-9) gibt es kostenlos ein Abstract.
Von dem in derselben Ausgabe dieser Zeitschrift erschienenen "Invited Commentary: Another Sobering Result for Home Telehealth—and Where We Might Go Next. Comment on "A Randomized Controlled Trial of Telemonitoring in Older Adults With Multiple Health Issues to Prevent Hospitalizations and Emergency Department Visits" von Scott R. Wilson und Peter Cram gibt es leider nur rein sehr karges Abstract.
Bernard Braun, 14.10.12
Sturzrisiko von älteren Menschen: häufig, aber nicht einfach zu verhindern
 Ältere Menschen haben ein relativ hohes Risiko zu stürzen und eine Reihe von zum Teil schwerwiegenden Sturzverletzungen und Einschränkungen ihrer funktionellen Kompetenzen davon zu tragen. Stürze und ihre Folgen sind auch häufig Auslöser für eine stationäre Langzeitversorgung. Um Stürze und kurz- wie langfristige Folgen zu verhindern gibt es eine Fülle von personen- und sachbezogenen Maßnahmen und Interventionen.
Ältere Menschen haben ein relativ hohes Risiko zu stürzen und eine Reihe von zum Teil schwerwiegenden Sturzverletzungen und Einschränkungen ihrer funktionellen Kompetenzen davon zu tragen. Stürze und ihre Folgen sind auch häufig Auslöser für eine stationäre Langzeitversorgung. Um Stürze und kurz- wie langfristige Folgen zu verhindern gibt es eine Fülle von personen- und sachbezogenen Maßnahmen und Interventionen.
Am Ende einer Analyse der Veröffentlichungen von 184 aus 12.000 durchgeführten Studien über die Wirksamkeit und den Nutzen dieser Maßnahmen sehen sich die VerfasserInnen eines 2012 veröffentlichten HTA-Berichts aber mangels konsistenter positiver Wirkungen auf die Sturzhäufigkeit wie die Sturzfolgen nicht in der Lage, eine oder mehrere dieser Maßnahmen uneingeschränkt zu empfehlen.
Nach einer Reihe internationaler Studien stürzen ca. 30% aller Menschen über 65 Jahre mindestens ein Mal jährlich und ihr Risiko für weitere Stürze ist deutlich erhöht. In Subgruppen wie z.B. den Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen erreicht die jährliche Sturzinzidenz die 50%-Marke. Diese Angaben werden zwar für Deutschland nicht durch große bevölkerungsbezogene Studien belegt, kleinere Untersuchungen bestätigen aber zumindest das Niveau des Auftretens von Stürzen unter älteren Menschen. In der jährlichen bundesweiten Dokumentation der Sturzhäufigkeit in stationären Einrichtungen, stürzten 3,7% der Angehörigen einer Stichprobe von KrankenhauspatientInnen und 3,9% einer Stichprobe aller BewohnerInnen von Pflegeheimen vor dem Erhebungszeitpunkt mindestens einmal.
Bei diesen Stürzen verletzten sich zwischen 30% und 70% der Gestürzten, wobei der Großteil (einige Studien nennen hier 90%) von ihnen keine medizinische Versorgung benötigt. Ob Stürze das Risiko frühzeitig zu sterben erhöhen, ist unklar. Wenn es zu behandlungsbedürftigen Verletzungen kommt, sind diese meist ernsthafter und langwieriger Natur. Dazu gehören insbesondere hüftgelenksnahe Frakturen.
Zu den gravierenden Folgen von Stürzen alter Menschen gehört aber auch deren Erlebnis als traumatischem, schwerwiegenden Ereignis, welches das Selbstbewusstsein und das Eigenständigkeitsgefühl beeinträchtigt und eine ausgesprochene Sturzangst fördert. Mit diesen eher psychischen Folgen ist der vorübergehende oder dauerhafte Verlust funktioneller Kompetenzen verbunden, die besonders bei den gestürzten Personen auftreten, die wegen der Sturzverletzungen stationär behandelt werden müssen. Sturzbedingte Verletzungen sind u.a. wegen dieser Einschränkungen der Fertigkeiten für das tägliche Leben in schätzungsweise 40% der Fälle der Auslöser für eine notwendige stationäre pflegerische Langzeitversorgung.
Angesichts dieses wahrscheinlich wegen der demografischen Entwicklung noch zunehmenden Problemdrucks, gehören die Fragen wie man eine Sturzgefahr bei älteren Personen so früh wie möglich identifiziert und durch geeignete Maßnahmen verhindert, zu den wichtigsten Themen der Prävention für ältere Menschen.
Ein über 600 Seiten dicker Health Technology Assessment (HTA)-Bericht Lübecker Mediziner hat nun versucht, diese Fragen auf der Basis von rund 12.000 Veröffentlichungen und einer Auswahl von 184 methodisch hochwertigen Studien zu beantworten.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Studien lauten:
• Instrumente und Tests zur Beurteilung des Sturzrisikos allein tragen weder zu einer Senkung der Sturzhäufigkeit noch zu einer häufigeren Anwendung prophylaktischer Maßnahmen bei.
• Trainingsangebote zur Förderung motorischer Funktionen können insbesondere dann, wenn sie multidimensional sind und über einen längeren Zeitraum genutzt werden, das Sturzrisiko mindern. Ob dadurch sturzbedingte Verletzungen verhindert werden können, ist unklar. Bei besonders gebrechlichen RentnerInnen zeigen sich aber auch unerwünschte Effekte motorischer Übungen.
• Chirurgische Eingriffe an den Augen oder das Einsetzen von Herzschrittmachern haben nicht durchgängig positive Effekte. So wird zum Teil die Sturzrate gesenkt, nicht aber das Frakturrisiko.
• Schulungsmaßnahmen und Interventionen, die allein oder vorrangig die Kompetenzen von Fachkräften erhöhen, haben wenig sturzmindernde Wirksamkeit.
• Die Anpassung der Wohnumgebung hat für ältere Personen ohne bisherige Stürze zu keiner signifikanten Reduktion der Sturzhäufigkeit geführt. Anders sieht es mit sturzprophylaktischen Maßnahmen in den Wohnungen von Personen aus, die bereits Stürze hinter sich haben.
• Für Hüftprotektoren gibt es weder bei den im eigenen Haushalt wohnenden Personen noch bei BewohnerInnen von Einrichtungen der Langzeitversorgung einen eindeutig positiven Effekt. Diesen gibt es dagegen für gangstabilisierendes Schuhwerk.
• Das vorliegende Studienmaterial zur zusätzlichen Einnahme von Vitamin D, der Aufnahme kalorienreicher Nahrungsergänzungsmittel oder Multivitaminpräparate als sturzprophylaktischen Mitteln liefert keine konsistenten Wirksamkeitsnachweise.
• Für Maßnahmen zur Reduktion des Sturzrisikos durch Anpassung der Einnahme von Medikamenten, die z.B. den Gleichgewichtssinn oder die Wachheit der Personen beeinträchtigen, lässt sich meist kein Wirksamkeitsnachweis erbringen. Dies gilt besonders für den Nachweis einer positiven Wirkung auf sturzbedingte Verletzungen.
• Die 8 Studien zum präventiven Nutzen von multiplen Interventionen und die fast 30 Studien über die Wirkungen multifaktorieller Interventionen, liefern ein sehr durchwachsenes Bild. In jedem Fall sind aber Einfach-Programme mit geringer inhaltlicher und zeitlicher Intensität wesentlich unwirksamer als multifaktorielle Interventionen. Aber auch dort mangelt es an konsistenten Belegen für die Reduktion der Sturzrate und gibt es praktisch keine Belege für die Reduktion der sturzbedingten Verletzungen.
• Neben den Studien mit medizinisch-pflegerischen Fragestellungen enthält der HTA-Bericht noch einen Überblick über die wenigen Studien mit gesundheitsökonomischer, juristischer, ethischer oder sozialer Fragestellung. Auch dort mangelt es an guten Studien oder zeigen z.B. Untersuchungen der Wirksamkeit freiheitsentziehender Maßnahmen in Pflegeheimen keinen positiven Effekt.
• Durch praktisch alle aufgearbeiteten Studien zieht sich ein grundsätzlicher Mangel: Mangels eines einheitlichen Forschungsprogramms sind die vorliegenden Studien in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht so heterogen, dass sich fast zwangsläufig keine eindeutigen Ergebnisse gewinnen lassen. Viele der bereits ausgewählten Studien enthalten z.B. keinen Wirksamkeitsnachweis oder beschäftigen sich nur mit der Sturzrate, nicht aber mit dem Risiko sturzbedingter Verletzungen.
Wegen der bereits in dieser Zusammenfassung erkennbaren Unklarheit der Wirksamkeit praktisch aller Maßnahmen auf die Sturzrate und die damit assoziierten negativen Wirkungen sprechen die AutorInnen des Berichts keine klare Empfehlung zugunsten bestimmter Maßnahmen aus. Die wenigen gesichert positiven Wirkungen auf den einen oder anderen Aspekt des Sturzgeschehens zeigen allerdings, dass es sich lohnt weiter nach wirksameren präventiven Interventionen zu suchen.
Der Bericht "Sturzprophylaxe bei älteren Menschen in ihrer persönlichen Wohnumgebung" von Katrin Balzer, Martina Bremer, Susanne Schramm, Dagmar Lühmann und Heiner Raspe ist 2012 als HTA-Bericht 116 des "Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" erschienen und kostenlos erhältlich. (http://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf)
Bernard Braun, 27.6.12
Ehrenamtliche Tätigkeit im höheren Alter fördert soziale Kontakte und subjektives Wohlbefinden
 Mäßige und intensivere ehrenamtliche Tätigkeiten und vor allem die soziale Unterstützung durch Freunde steigern sowohl bei den jüngeren als auch den älteren Angehörigen einer Gruppe von 55- bis 94-jährigen BürgerInnen das subjektive Wohlbefinden. Zusammen mit der körperlichen Leistungsfähigkeit ist das subjektive Wohlbefinden eine wichtige Bedingung für die Möglichkeit gesund und in Würde alt zu werden.
Mäßige und intensivere ehrenamtliche Tätigkeiten und vor allem die soziale Unterstützung durch Freunde steigern sowohl bei den jüngeren als auch den älteren Angehörigen einer Gruppe von 55- bis 94-jährigen BürgerInnen das subjektive Wohlbefinden. Zusammen mit der körperlichen Leistungsfähigkeit ist das subjektive Wohlbefinden eine wichtige Bedingung für die Möglichkeit gesund und in Würde alt zu werden.
In der australischen "Transitions In Later Life"-Studie mit 561 Personen zwischen 55 und 94 Jahren wurden u.a. der Umfang der ehrenamtlichen Tätigkeiten, die sozialen Interaktionen und Austauschprozesse sowie der Erhalt und die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung durch Freunde, Verwandte und Nachbarn erhoben. Damit konnte die Lebenszufriedenheit und das subjektive Wohlbefinden von ehrenamtlich tätigen Personen mit der/dem von nicht ehrenamtlich Tätigen verglichen werden.
Als erstes zeigten sich enge innere Zusammenhänge der Existenz von Freundeskreisen und ehrenamtlicher Tätigkeit. So initiieren Freundes-Netzwerke mehr als Verwandtschaften und Nachbarschaften ehrenamtliche Tätigkeiten und umgekehrt führen ehrenamtliche Tätigkeiten oft zu neuen Freundschaften.
Die positive Assoziation, die zwischen einer bereits moderaten ehrenamtlichen Tätigkeit von bis zu 7 Stunden pro Woche und dem subjektiven Wohlbefinden besteht, wird vom Erhalt der sozialen Unterstützung durch Freunde, Verwandte und Nachbarn und den mit ihnen stattfindenden sozialen Interaktionen vermittelt. Unerwartet wirkte sich die soziale Unterstützung durch Freunde am stärksten auf den positiven Effekt von ehrenamtlicher Tätigkeit auf das subjektive Wohlbefinden aus. 36% dieses Effekts wurde durch die Beziehungen zu Freunden, 16% durch die soziale Unterstützung durch Verwandte bedingt und ein weiterer Anteil von 13% verdankt sich generellen positiven sozialen Beziehungen. Die Hypothese, dass negative soziale Beziehungen und Erfahrungen eine ebenfalls negative Wirkung auf die Assoziation zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit und subjektivem Wohlbefinden haben können, konnte nicht verifiziert werden. Die Ergebnisse der Studie belegen eher, dass ehrenamtliche Arbeit eher mit positiven als mit negativen sozialen Beziehungen assoziiert ist.
Zu dem von Pilkington, P.D., Windsor, T.D. und Crisp, D.A. verfassten Aufsatz "Volunteering and subjective well-being in midlife and older adults: the role of supportive social networks.", veröffentlicht im "The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2012; 67(2), 249-260, ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.6.12
"Mehr Personal im Pflegebereich und alles wird gut"!? Auch die Evidenz von "guten" Patentrezepten muss nachgewiesen werden
 Gut gemeinte einzelne Veränderungen im Bereich der Krankenbehandlung greifen manchmal zu kurz und das dafür aufgebrachte Engagement verpufft für PatientInnen möglicherweise folgenlos. Dies trifft nach Lektüre mehrerer aktueller Forschungsergebnisse auch für die stand-alone-Forderung zu, die Anzahl von Pflegekräften im Krankenhaus pro Patient zu erhöhen bzw. die Anzahl von PatientInnen pro Pflegekraft zu verringern und damit das Auftreten unerwünschter Behandlungswirkungen wie Druckgeschwüre oder Sterblichkeit zu vermeiden.
Gut gemeinte einzelne Veränderungen im Bereich der Krankenbehandlung greifen manchmal zu kurz und das dafür aufgebrachte Engagement verpufft für PatientInnen möglicherweise folgenlos. Dies trifft nach Lektüre mehrerer aktueller Forschungsergebnisse auch für die stand-alone-Forderung zu, die Anzahl von Pflegekräften im Krankenhaus pro Patient zu erhöhen bzw. die Anzahl von PatientInnen pro Pflegekraft zu verringern und damit das Auftreten unerwünschter Behandlungswirkungen wie Druckgeschwüre oder Sterblichkeit zu vermeiden.
Bereits 2011 haben Aiken et al. auf die teilweise unerwarteten Wechselwirkungen zwischen der quantitativen Ausstattung mit Pflegekräften, deren Ausbildungsniveau und verschiedener Arbeitsbedingungen mit dem 30-Tage-Sterberisiko sowie dem Tod durch unvorhergesehene aber vermeidbare Vorfälle ("failure-to-rescue") bei Krankenhauspatienten hingewiesen. Sie untersuchten dazu die Behandlungsergebnisse von 1.262.120 allgemeinmedizinisch, orthopädisch und chirurgisch behandelten PatientInnen aus 665 Krankenhäusern in 4 großen Bundesstaaten der USA und eine Zufallsstichprobe von 39.038 Pflegekräften.
Zu den wesentlichen Ergebnissen ihrer Untersuchung gehören:
• Die Verringerung der Arbeitslast (workload) durch die Abnahme von einem Patienten pro Pflegekraft senkt in Krankenhäusern mit besten Arbeitsbedingungen die Wahrscheinlichkeit der beiden Risiken um 9% bzw. 10%.
• In Krankenhäusern mit durchschnittlichen Arbeitsbedingungen sinkt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens beider Risiken um 4%.
• In Krankenhäusern mit schlechten Arbeitsbedingungen führt dagegen die Personalaufstockung zu keiner Verbesserung bei den beiden Risiken.
• Egal ob die Arbeitsbedingungen gut oder schlecht waren, senkte eine Zunahme hochqualifizierter Pflegekräfte ("Bachelors of Science in Nursing Degree nurses") um 10% beide Risiken um rund 4%.
Der Aufsatz Effects of Nurse Staffing and Nurse Education on Patient Deaths in Hospitals With Different Nurse Work Environments von Linda Aiken et al. ist 2011 in der Zeitschrift "Medical Care" (49:12: 1047-1053) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bereits im Juni 2010 ist in der Arbeitspapier-Reihe des "National Bureau of Economic Research (NBER)" der USA eine 31 Seiten umfassende Untersuchung erschienen, welche die Wirkungen der Ausstattung von Kliniken mit Pflegekräften auf die gesundheitlichen Behandlungsergebnisse untersuchte. Anlass dieser Untersuchung war die Frage, ob und wie sich das "California Minimum Staffing Regulation"-Gesetz ausgewirkt hat. Dieses Gesetz, auch bekannt als "Assembly Bill 394 (AB394)" legte Mindestwerte von Pflegekräften pro Patient fest, die mit Krankenhäusern und Pflegekräfteverbänden mehrfach abgestimmt wurden.
Die hier vorgestellte Untersuchung basiert auf einer Reihe administrativer Daten zur Krankenhausbehandlung in rund der Hälfte der kalifornischen Kliniken. Als Indikatoren für das Behandlungsergebnis nutzten die ForscherInnen das Auftreten unvorhergesehener aber vermeidbarer tödlicher Ereignisse oder Komplikationen und das Auftreten von Druckgeschwüren.
Die Ergebnisse mehrerer bivariater und multivariater Vorher-Nachher-Analysen der Wirkungen der gesetzgeberischen Intervention in den Jahren 2000 (pre regulation-Phase 2000-2002) bis 2006 (post regulation-Phase 2005-2006) lauten:
• Das Gesetz erhöhte bei den Krankenhäusern, die den gesetzlichen Standard zu Beginn der Laufzeit des Gesetzes nicht erfüllten, deutlich die Anzahl von Pflegekräften pro Patient.
• Der Indikator Dekubitus erwies sich für die Analyse der Wirkung dieses Gesetzes als prinzipiell ungeeignet. Der Indikator Tod durch unvorgesehene Ereignisse war dagegen prinzipiell als Wirkungsindikator geeignet.
• Trotzdem zeigte die Längsschnittanalyse, also eine Methodik, die ursächliche Zusammenhänge zu erkennen erlaubt, dass sich das Auftreten solcher tödlicher Ereignisse nicht proportional zur Absenkung der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft verringerte. Egal ob Kliniken vor der Einwirkung des Gesetzes viel oder wenig Patienten pro Pflegekraft hatten, zeigten sich ähnliche Effekte. Daraus schlussfolgerten die ForscherInnen, es gäbe "no evidence of a causal impact of patient/nurse ratio on failure to rescue."
• Auch sie fanden aber wie die meisten anderen Studien bei einer Querschnittsbetrachtung ihrer Daten eine statistisch signifikante Assoziation von Personalausstattung und Behandlungsergebnissen.
• Zum Schluss ihrer Analysen weisen die Autoren darauf hin, dass für weitere Analysen dieser Assoziationen eventuell noch mehr Faktoren als bisher und wenn möglich ebenfalls im zeitlichen Verlauf berücksichtigt werden müssen: "Our empirical results suggest that a mandate reducing patient/nurse ratios, on its own, need not lead to improved patient safety. This is not to say, though, that nurse staffing decisions are unimportant as a component in a hospital's overall strategy for ensuring high patient safety. ... We have noted the difficulties associated with drawing causal inferences on the basis of such results. Nonetheless, apparently those hospitals that are most effective in ensuring patient safety generally find it optimal to employ more nurses per patient. Perhaps there are complementarities between nursing inputs and other (possibly unobserved) inputs and policies that lead to better patient safety. Thus, improved nurse staffing might be crucial in improving patient safety, but only in combination with other elements."
Um welche Elemente es sich dabei handelt, sollten Kenner der Krankenhausbehandlung mit Vorrang beantworten. Der Hinweis von Aiken et al. auf die Bedeutung von Arbeitsbedingungen stellt einen ersten Schritt dar.
Das NBER-Arbeitspapier 16077 "THE EFFECT OF HOSPITAL NURSE STAFFING ON PATIENT HEALTH OUTCOMES: EVIDENCE FROM CALIFORNIA'S MINIMUM STAFFING REGULATION" von Andrew Cook et al. ist vollständig kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.6.12
Die Lebenserwartung selbst fitter älterer Erwachsenen hängt maßgeblich von der sozialen Verletzlichkeit oder sozialen Defiziten ab
 Dass nicht die stark mit dem biologischen Altern assoziierte körperliche Gebrechlichkeit alleine Einfluss auf die künftige Lebenserwartung hat, sondern darauf auch nicht-altersbedingte soziale Verhältnisse und Beziehungen Einfluss nehmen, ist weitgehend bekannt. Wie stark der Einfluss welcher sozialen Faktoren ist, aber weniger.
Dass nicht die stark mit dem biologischen Altern assoziierte körperliche Gebrechlichkeit alleine Einfluss auf die künftige Lebenserwartung hat, sondern darauf auch nicht-altersbedingte soziale Verhältnisse und Beziehungen Einfluss nehmen, ist weitgehend bekannt. Wie stark der Einfluss welcher sozialen Faktoren ist, aber weniger.
Eine Sekundäranalyse der Daten von 5.703 zum Start der "Canadian Study of Health and Aging" 70-jährigen und älteren TeilnehmerInnen zeigt nun für eine Untergruppe von 584 zu Hause lebenden Personen mit einem durchweg guten gesundheitlichen und funktionellen Zustand Folgendes:
Das Drittel dieser Personen mit großen Defiziten bei 40 sozialen Merkmalen hatte nach 5 Jahren eine gegenüber dem Drittel der am wenigsten sozial verletzlichen oder beeinträchtigten AltersgenossInnen eine um das 2,5-Fache erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit. Bei den Personen mit einer insgesamt stabilen sozialen Situation belief sich die Fünfjahresmortalität auf 10,8% und erhöhte sich bei den Personen mit der höchsten sozialen Verletzlichkeit auf 32,5%. Die absolute Mortalitäts-Differenz betrug damit hochsignifikante 22%.
Dazu wurde mit 31 selbst berichteten Indikatoren für Gesundheitsdefizite wie etwa Krankheiten und funktionelle Defizite ein individueller Gebrechlichkeitsindex erstellt. Der Wert für die soziale Verletzlichkeit beruht auf Angaben zu 40 Items zu denen z.B. der Familienstand, soziales Engagement, soziale Unterstützung, das Gefühl sein eigener Herr zu sein oder der soziale Status gehören.
Für die 5-Jahresanalyse wurde nur die weitere Entwicklung der älteren Personen untersucht, die kein oder nur ein gesundheitliches Defizit von maximal 31 möglichen Defiziten hatten.
Von der Studie "The impact of social vulnerability on the survival of the fittest older adults" von Melissa K. Andrew et al. - erschienen in der Zeitschrift "Age and Ageing" vom 26. Januar 2012 gibt es kostelos nur das Abstract.
Bernard Braun, 23.4.12
Ist die Entwicklung von Demenz wirklich nicht oder nicht ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu verlangsamen?
 Das regelmäßige Angebot einer nichtmedikamentösen komplexen Behandlung kann die Entwicklung milder bis mäßiger und schwerer Demenz bei einer Personengruppe verlangsamen, die für die BewohnerInnen von Pflegeheimen repräsentativ ist. Dabei werden ihre kognitiven Funktionen und ihre Fähigkeiten für Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) positiv beeinflusst. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer einjährigen randomisierten, kontrollierten und für die 98 TeilnehmerInnen verblindeten Verlaufsstudie in 5 bayrischen Pflegeheimen.
Das regelmäßige Angebot einer nichtmedikamentösen komplexen Behandlung kann die Entwicklung milder bis mäßiger und schwerer Demenz bei einer Personengruppe verlangsamen, die für die BewohnerInnen von Pflegeheimen repräsentativ ist. Dabei werden ihre kognitiven Funktionen und ihre Fähigkeiten für Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) positiv beeinflusst. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer einjährigen randomisierten, kontrollierten und für die 98 TeilnehmerInnen verblindeten Verlaufsstudie in 5 bayrischen Pflegeheimen.
Solange es keine wirksame ursächliche Behandlung oder Prävention der degenerativen Demenz gibt, gilt das Hauptaugenmerk pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Interventionen, die den Erkrankungsprozess verlangsamen. Eine Reihe von so genannten Acetylcholinesterase-Präparaten ist zur symptomatischen Behandlung der Alzheimererkrankung als der häufigsten Form von Demenz zugelassen und sie erweisen sich zum Teil auch als wirksam. Wegen der letztlich doch geringen oder nur bei milden Erkrankungsformen spürbaren Wirksamkeit und der Fülle von dosisabhängigen unerwünschten Wirkungen, werden seit einiger Zeit nichtmedikamentöse Behandlungsformen gesucht und erprobt. Positive Effekte zeigten sich bei ihnen aber auch nur bei milden Formen der kognitiven Beeinträchtigung durch Demenz und meist auch nur für kurze Zeiträume.
Die Intervention mit dem mehrere qualitativ unterschiedliche Komponenten umfassenden so genannten MAKS-Programm unterscheidet sich konzeptionell von den bisherigen nichtmedikamentösen Behandlungsformen erheblich und ist in mehrerlei Hinsicht erfolgreicher. Die Intervention von MAKS besteht aus den durch kurze Pausen unterbrochenen Komponenten Motorische Stimulation (z.B. 30 Minuten Bowling oder das Balancieren eines Tennisballs auf einer Frisbeescheibe samt Weitergabe an andere TeilnehmerInnen), einer 30 Minuteneinheit mit Kognitiven Aufgaben, einer 40-Minuteneinheit mit Übungen zu den Aktivitäten des täglichen Lebens (z.B. Zubereitung eines Snacks) und einer 10-minütigen Spirituellen Einstimmung in die rund zweistündige Gesamtübung (z.B. ein Gespräch über Glück oder das Singen einer Hymne). Die rund zweistündige standardisierte Behandlung erfolgte geleitet durch zwei Therapeuten in Zehnergruppen mit einem vergleichbaren Erkrankungsniveau an sechs Tagen pro Woche über 12 Monate. Die Therapiekosten lagen unter 10 Euro pro Tag und PatientIn und waren damit nach Angaben der Studienverantwortlichen nicht wesentlich höher als die der medikamentösen Behandlung - allerdings ohne deren Nebenwirkungen.
Die Angehörigen der Kontrollgruppe konnten die gewöhnlicherweise in den Pflegeheimen angebotenen Nicht-MAKS-Leistungen (z.B. Gedächtnistraining, Anti-Sturztraining oder Beschäftigungstherapie) in Anspruch nehmen und nutzten durchschnittlich auch zwei von ihnen pro Woche. Die Angehörigen der MAKS-Gruppe konnten diese Angebote ebenfalls zusätzlich besuchen und taten dies auch durchschnittlich einmal die Woche.
Die Wirksamkeit der MAKS-Behandlung wurde mit zwei Standardinstrumente erhoben: Der "Alzheimer Disease Assessment Scale—Cognitive Subscale (ADAS-Cog)" für die Messung der kognitiven Fähigkeiten und dem "Erlangen Test of Activities of Daily Living (E-ADL)" für die Messung der Alltagsaktivitäten. Die Skalen der beiden Tests reichen von 0 bis 70, wobei der höhere Wert eine größere kognitive Behinderung anzeigt, und von 0 bis 30 Punkten, wobei hier der höhere Wert eine geringere Behinderung anzeigt.
Während 12 Monate nach Beginn der Studie die beiden Werte bei allen Angehörigen der Interventionsgruppe unverändert geblieben waren, hatten sich bei den Angehörigen der Kontrollgruppe der adjustierte Wert für die kognitiven Fähigkeiten um signifikante 7,7 Punkte und der Wert für die Alltagsfähigkeiten um 3,6 Punkte verschlechtert. Die Wirkung war zwar bei den TeilnehmerInnen mit milder oder mäßiger Demenz stärker, aber auch bei den Angehörigen der Untergruppe mit schwerer Demenz deutlich zu erkennen.
Obwohl die Studienverantwortlichen auf einige Grenzen der Studie wie z.B. die geringe Anzahl von TeilnehmerInnen, das Fehlen einer Placebo-Kontrollgruppe und den möglichen unspezifischen Einfluss der allgemeinen Aufmerksamkeit für die Angehörigen der Interventionsgruppen hinwiesen, halten sie die positiven Wirkungen ihrer nichtmedikamentösen Intervention für gesichert. In zukünftigen Studien sollte dies mit mehr TeilnehmerInnen bestätigt werden und auch die Wirkung einer Kombination medikamentöser und nichtmedikamentöser Behandlung untersucht werden.
Sowohl die englischsprachige Originalarbeitals auch eine deutschsprachige Fassung der Studienveröffentlichung sind frei zugänglich: Graessel E, Stemmer R, Eichenseer B, Pickel S, Donath C, Kornhuber J, Luttenberger K: "Non-pharmacological, multicomponent group therapy in patients with degenerative dementia: a 12-months randomized, controlled trial" - erschienen in "BMC Medicine" 9 (2011).
Bernard Braun, 17.4.12
Deutsches Pflegesystem im EU-Vergleich qualitativ überdurchschnittlich aber unterdurchschnittlich finanziert
 Das deutsche Pflegesystem befindet sich was z.B. die Einkommensunabhängigkeit der und den rechtlichen Anspruch auf Leistungsgewährung, die freie Wahl des Leistungsanbieters, die Existenz eines verpflichtenden Qualitätssicherungssystems und die Unterstützung informeller Pflege durch Angehörige angeht, zusammen mit Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Schweden in der Spitzengruppe einer Typologie europäischer Pflegesysteme. Bei der öffentlichen Finanzierung rutscht das deutsche Pflegesystem dann aber wegen der Eigenart der Pflegeversicherung als Teilkaskoversicherung auf einen mittleren bis unteren Platz. Diese "aus der Sicht der Pflegebedürftigen nicht vorteilhafte" Konstruktion - so etwas verharmlosend die Verfasserin des Aufsatzes - bedeutet, dass hierzulande für Pflegeleistungen pro Einwohner jährlich 109 Euro privat finanziert werden müssen, in Frankreich 2 Euro oder in Spanien 59 Euro.
Das deutsche Pflegesystem befindet sich was z.B. die Einkommensunabhängigkeit der und den rechtlichen Anspruch auf Leistungsgewährung, die freie Wahl des Leistungsanbieters, die Existenz eines verpflichtenden Qualitätssicherungssystems und die Unterstützung informeller Pflege durch Angehörige angeht, zusammen mit Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Schweden in der Spitzengruppe einer Typologie europäischer Pflegesysteme. Bei der öffentlichen Finanzierung rutscht das deutsche Pflegesystem dann aber wegen der Eigenart der Pflegeversicherung als Teilkaskoversicherung auf einen mittleren bis unteren Platz. Diese "aus der Sicht der Pflegebedürftigen nicht vorteilhafte" Konstruktion - so etwas verharmlosend die Verfasserin des Aufsatzes - bedeutet, dass hierzulande für Pflegeleistungen pro Einwohner jährlich 109 Euro privat finanziert werden müssen, in Frankreich 2 Euro oder in Spanien 59 Euro.
Diese und weitere Daten zu den Pflegesystemen in Polen, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Finnland, Spanien, Slowenien, Österreich, Italien, Schweden, Frankreich Großbritannien, Estland, Schweden und Ungarn finden sich in einer ersten Veröffentlichung des internationalen Forschungsprojekts "Assessing Needs of Care in European Nations (ANCIEN)". Dessen zentrale Fragen lauten: Wie wird das Risiko Pflege in den einzelnen Mitgliedstaaten abgedeckt? Wie ist die Pflege organisiert und finanziert? Wie ist das Verhältnis von informeller Pflege durch Familienangehörige und formeller Pflege durch ambulante Pflegedienste oder Pflegeheime? Wie wird die Qualität der Pflege sichergestellt? Die Antworten beruhen auf einer umfassenden Aufbereitung und Analyse von vorliegenden Daten durch Experten aus den insgesamt 17 am Projekt beteiligten Forschungsinstituten (für Deutschland ist dies das "Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)").
Ganz nebenbei erfährt man bei der Lektüre, dass scheinbar unumstößlich wirkende Charakteristika der Pflege und der Pflegebedürftigen durchaus anders aussehen können. Dies gilt z.B. für die in vielen Ländern bestätigte Annahme, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden möchten. Dies ist z.B. in Schweden völlig umgekehrt, woran sicherlich die hochentwickelte Qualität der Pflegeheime und deren hohe Integration in die örtlichen Strukturen beteiligt sein dürfte.
Ob die bisher zugänglichen Daten wirklich ausreichen oder nicht durch eine Reihe zusätzlicher Erhebungen angereichert und u.U. auch anders bewertet werden müssen, sollte bei der Lektüre der Ergebnisse bedacht werden.
Weitere Projektergebnisse findet man im komplett kostenlos erhältlichen Aufsatz "Das deutsche Pflegesystem ist im EU-Vergleich unterdurchschnittlich finanziert" von Erika Schulz im DIW-Wochenbericht Nr. 13/2012: 10-16
Bernard Braun, 8.4.12
Wirksamkeit der Maßnahmen zur Sturzprophylaxe älterer Personen "an sich" und tatsächliche Beteiligung im Alltag
 Zwölf Monate nach dem Beginn von Studien, in denen Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen angeboten und auf ihre Wirksamkeit untersucht werden, hält sich wahrscheinlich nur die Hälfte der im häuslichen Umfeld und ein Drittel der in Pflegeheimen oder Krankenhäusern lebenden älteren TeilnehmerInnen an diese Maßnahmen. Das ist das ernüchternde Ergebnis einer ergänzenden Analyse der Ergebnisse und Umstände der in zwei Cochrane-Reviews untersuchten randomisierten kontrollierten Studien über Maßnahmen zur Sturzprophylaxe.
Zwölf Monate nach dem Beginn von Studien, in denen Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen angeboten und auf ihre Wirksamkeit untersucht werden, hält sich wahrscheinlich nur die Hälfte der im häuslichen Umfeld und ein Drittel der in Pflegeheimen oder Krankenhäusern lebenden älteren TeilnehmerInnen an diese Maßnahmen. Das ist das ernüchternde Ergebnis einer ergänzenden Analyse der Ergebnisse und Umstände der in zwei Cochrane-Reviews untersuchten randomisierten kontrollierten Studien über Maßnahmen zur Sturzprophylaxe.
Stürze sind eine der häufigsten und bis hin zum vorzeitigen Tode folgenreichsten Ereignisse im Leben älterer Personen. Entsprechend wichtig sind sämtliche wirksamen Angebote oder Interventionen für die Sturzprophylaxe im häuslichen Umfeld aber auch im Bereich der Pflegeheime. Dem entspricht, dass sich zwei Cochrane-Reviews der vorliegenden randomisierten kontrollierten Interventionsstudien getrennt damit beschäftigen, für den Nutzen welcher Maßnahmen es eine robuste Evidenz gibt.
• Die systematische Betrachtung der 111 Studien von Maßnahmen für die noch zu Hause lebenden älteren Personen hebt besonders körperliches Bewegungstraining und Tai Chi als hochwirksame Interventionen zur Prävention von Stürzen hervor. Die häusliche Sicherheit oder der Entzug bestimmter psychotroper Medikamente haben dagegen nur beschränkte präventive Evidenz. So kann beispielsweise die Nichtverschreibung bestimmter Medikamente zwar die Rate der Stürze reduzieren aber nicht das Sturzrisiko.
• Die systematische Betrachtung von 41 Studien über Maßnahmen für ältere Menschen, die in Pflegeheimen oder Krankenhäusern leben, führte insgesamt eher zu negativen Ergebnissen. In einzelnen Studien zeigten sich aber die Wirksamkeit eines vielseitigen und angeleiteten körperlichen Trainings bei Personen im Krankenhausumfeld und die Wirksamkeit der Einnahme von Vitamin D bei BewohnerInnen von Pflegeheimen.
• Keine Rolle spielten in beiden Cochrane-Reviews - und im Übrigen auch in manch anderen dieser methodisch hochwertigen Analysen -drei für den Präventionsalltag relevante inhaltliche Umstände, nämlich die grundsätzliche Beteiligung älterer Personen an solchen Interventionen, ihr Engagement in den angebotenen Maßnahmen und der Grad mit dem sie sich an die vorgeschriebenen Maßnahmen halten bzw. die Adhärenz oder Compliance. Diese Umstände können zu dem sehr praktischen Phänomen führen, dass unabhängig davon, wie wirksam einzelne Maßnahmen nachweisbar sein mögen, die populationsbezogene Wirksamkeit bedeutend karger ausfällt, wenn die Beteiligung älterer Menschen an solchen Maßnahmen gering ist oder sie sich nicht an die vorgeschriebenen Prozeduren halten.
Zwei ergänzende Untersuchungen der reviewten RCTs zeigen nun, wie viele der ursprünglich zur Teilnahme an diesen Studien ausgewählten und eingeladenen Personen der Einladung überhaupt gefolgt sind (Rekrutierungsrate), wie viele der TeilnehmerInnen ihre Teilnahme innerhalb der ersten 12 Monate abgebrochen haben, wie verlässlich sich die TeilnehmerInnen an die vorgeschriebenen Maßnahmen gehalten haben und wie sich das auf die Anzahl der TeilnehmerInnen auswirkt, die sich an die wirksamen Maßnahmen zur Sturzprävention halten und damit Nutznießer deren Wirksamkeit sind.
Betrachtet man für die noch im häuslichen Umfeld lebenden älteren Personen ihre Rekrutierungsrate von 70%, ihre Abbruchquote von 10% und ihre Adhärenzrate von 80%, halten es die Reviewer für möglich, dass sich nach 12 Monaten Präventionsalltag nur die Hälfte der ursprünglichen TeilnehmerInnen treu an die Interventionen und Maßnahmen der Sturzprävention halten.
Betrachtet man ferner dieselben Indikatoren für die älteren Personen in institutionellen Settings, liegt deren Rekrutierungsrate bei 49%, steigt ihre Abbruchquote auf 16% und halten sich ebenfalls durchschnittlich 80% (bei Schwankungen zwischen 11% und 93%) an die vorgeschriebenen Maßnahmen in den Studienprotokollen. Dies bedeutet, dass sich nach 12 Monaten wahrscheinlich nur noch ein Drittel der Pflegeheimbewohner an die wirksamen Maßnahmen hält oder diese in ihrem realen Leben umsetzen.
Beide Ergebnisse sind sowohl für die künftige Konzeption von RCTs bedeutsam, die sich um eine höhere Beteiligung ihrer ursprünglich vorgesehenen Teilnehmerschaft, ein höheres Engagement und eine größere Therapietreue der dann teilnehmenden Personen kümmern müssen. Wichtig sind diese Erkenntnisse aber auch für die Anbieter von Sturzpräventionsprogrammen und ihr Ziel, die Inzidenz von Stürzen möglichst kräftig zu senken. Ohne Berücksichtigung der jetzt identifizierten und quantifizierten Prozesse könnten sich manche Versprechungen oder Erwartungen als so unrealistisch erweisen, dass diese Maßnahmen rasch an Akzeptanz verlieren.
Bei den beiden Cochrane-Reviews handelt es sich um:
• Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S, Cumming RG, Rowe BH. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2.
• Cameron ID, Murray GR, Gillespie LD, Robertson MC, Hill KD, Cumming RG, Kerse N. Interventions for preventing falls in older people in nursing care facilities and hospitals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1..
Die beiden zusätzlichen Analysen der Gesamtwirksamkeit der untersuchten Interventionen sind:
• Nyman Samuel R., Christina R. Victor (2011): Older people's participation in and engagement with falls prevention interventions in community settings: an augment to the cochrane systematic review. in "Age Ageing" (2012; 41(1):16-23). Der Aufsatz ist in der im August 2011 vorveröffentlichten Online-Version komplett kostenlos erhältlich.
• Nyman SR, Victor CR. (2011): Older people's recruitment, sustained participation, and adherence to falls prevention interventions in institutional settings: a supplement to the Cochrane systematic review. In: Age Ageing; 40(4): 430-6. Zu dem Aufsatz ist kostenlos sowohl das Abstract und auch der komplette Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.3.12
Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen 2011 - Licht- und Schattenseiten der offiziellen Arbeitsmarktstatistik
 2010 arbeiteten nach der neuesten Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 2,8 Millionen Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen.
2010 arbeiteten nach der neuesten Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 2,8 Millionen Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen.
Die wichtigsten Charakteristika der Beschäftigungssituation in diesen Berufen fasst die BA so zusammen:
• Die Beschäftigung in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den letzten zehn Jahren um ein Fünftel gewachsen.
• Jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeitet mittlerweile in einem Gesundheits- oder Pflegeberuf.
• Der Frauenanteil unter den Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegesektor ist deutlich größer als bei der Gesamtbeschäftigung.
• Sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitbeschäftigung sind gestiegen.
• 2010 waren ein Drittel der im Gesundheits- und Pflegeberufen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Teilzeit tätig.
• Minijobber sind in Gesundheits- und Pflegeberufen unterdurchschnittlich vertreten.
• Die Arbeitslosigkeit in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.
• 2010 waren in Gesundheits- und Pflegeberufen durchschnittlich 40.700 offene Stellen gemeldet.
• Die Besetzung offener Stellen im Gesundheitssektor, insbesondere bei Ärzten, Kranken- und Gesundheitspflegekräften sowie Altenpflegefachkräften fällt zunehmend schwerer. Fachkräfteengpässe zeigen sich nahezu in allen Bundesländern.
Dass die alleinige Lektüre des "Wichtigsten in Kürze" zu falschen Eindrücken und Schlussfolgerungen führen kann, d.h. die Lektüre des gesamten 24-seitigen Textes notwendig, hilfreich also in jedem Fall empfehlenswert ist, zeigt die gut ausgewogen wirkende Feststellung, sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitbeschäftigung seien gestiegen. Schaut man in den Text, ergibt sich ein wesentlich differenzierteres und nachdenklich stimmendes Bild. Von allen 2,8 Millionen Beschäftigten arbeiteten 2010 910.000 in Teilzeit und 1,8 Millionen waren vollzeitbeschäftigt. Das Wachstum fiel allerdings extrem unterschiedlich aus: Die Vollzeitbeschäftigung wuchs in den letzten Jahren um 6% und die Teilzeitbeschäftigung um 70%. In einigen Sub-Berufsgruppen, wie etwa bei den KrankenpflegerInnen im Krankenhaus ist sowohl der Anteil der Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten deutlich höher (ca. 45%) und die Zunahme der Beschäftigten erfolgt fast ausschließlich durch die Zunahme von Teilzeitbeschäftigten.
Auch die eher beruhigend gemeinte Behauptung, Minijobber seien in den Gesundheits- und Pflegeberufen unterdurchschnittlich vertreten, stimmt zwar. Dennoch beruhigt ein Blick in das entsprechende Kapitel nicht wirklich. So arbeiteten 2010 rund 401.000 Personen in diesem Berufsfeld geringfügig - 59% ausschließlich geringfügig und 41% zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten um 33% bestiegen. Dieser Anstieg war deutlich stärker als in allen Berufen und den Dienstleistungsberufen mit einem Anstieg von 21%.
Über eine Reihe weiterer Schwachstellen der offiziellen Beschäftigtenstatistik im Bereich der Pflegeberufe erfährt man noch mehr bei der Lektüre des aktuellen Gutachtens zum Stand der Beschäftigungsverhältnisse in Pflegeberufen von Michael Simon.
Die im Dezember 2011 erschienene Broschüre Der Arbeitsmarkt in Deutschland 2011 - Gesundheits- und Pflegeberufe der Bundesagentur für Arbeit erhält man kostenlos.
Bernard Braun, 4.3.12
Nicht vergessen: "Das Thema Demenz ist im Krankenhaus leider noch nicht richtig angekommen, die dementen Patienten aber sehr wohl"
 Nicht erst seitdem die Boulevardpresse nach dem Selbstmord von Gunter Sachs und dem Demenz-Outing Rudi Assauers die Existenz der Alzheimer-Krankheit als einer der Hauptursachen von Demenz schlagzeilenträchtig thematisierte, wurden die dementiellen Erkrankungen als große Herausforderungen für die Lebensqualität der zahlreicher werdenden SeniorInnen und für die soziale Kranken- wie Pflegeversicherung prognostiziert und diskutiert.
Nicht erst seitdem die Boulevardpresse nach dem Selbstmord von Gunter Sachs und dem Demenz-Outing Rudi Assauers die Existenz der Alzheimer-Krankheit als einer der Hauptursachen von Demenz schlagzeilenträchtig thematisierte, wurden die dementiellen Erkrankungen als große Herausforderungen für die Lebensqualität der zahlreicher werdenden SeniorInnen und für die soziale Kranken- wie Pflegeversicherung prognostiziert und diskutiert.
So berechneten Pflegeforscher am Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen in ihrem Pflegereport 2010, dass "bis zum Jahr 2060 … mit 2,5 Millionen Demenzkranken in Deutschland zu rechnen (ist) … Das wären etwa 3,8 % der dann lebenden Bevölkerung. Der Anteil der Dementen an der Bevölkerung verzweieinhalbfacht sich somit." Noch plakativer und problemsensibilisierender lauten ihre Erkenntnisse: "Ein Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen werden im Laufe ihres Lebens dement."
Zu erwarten wäre daher, dass sich die diversen Akteure im Gesundheitswesen und die Leistungserbringer in Pflegeheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern seit längerem organisatorisch und vor allem qualifikatorisch auf diese künftigen Herausforderungen vorbereiten.
Wie eine jetzt veröffentlichte Studie des ebenfalls an der Universität Bremen angesiedelten Instituts für Public Health und Pflegeforschung (IPP) aber zeigt, verfehlen solche Erwartungen zumindest für den Erhebungszeitraum im Jahr 2011 noch erheblich die Wirklichkeit, wenn es um die Vermittlung demenzspezifischer Kompetenzen im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung geht. Wer weiß, dass Qualifikationsprozesse um wirksam zu werden einen langen zeitlichen Vorlauf brauchen, hat es hier mit einem besonders ausgeprägten Fall der Diskrepanz von Wissen, Wollen, Beschwören und Handeln zu tun.
Die Bremer ForscherInnen erhoben ihre Erkenntnisse mittels einer bundesweiten Onlinebefragung aller Kranken- und Altenpflegeschulen (derzeit 1293) sowie deren Pflegeauszubildenden (insgesamt wurden 2.467 Auszubildende angeschrieben). Nach dem Erhebungszeitraum Februar bis Mai 2011 konnten die Daten von 678 Pflegeschulen sowie 564 Pflegeauszubildende ausgewertet werden.
Das Resumé der IPP-Studie lautet: "Die IPP-Daten (zeigen) sehr eindrucksvoll, dass die Vermittlung demenzspezifischer Kompetenzen vor allem im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung zukünftig deutlich stärker zu berücksichtigen ist. Insgesamt gilt es eine intensivere Auseinandersetzung mit und Integration von demenzsensiblen Konzepten im Krankenhaus gezielt zu forcieren. Denn obwohl das Thema Demenz von der Mehrheit der Befragten eine große Relevanz zugeschrieben wird und eine curriculare Verankerung stattgefunden hat, wirkt sich das nur sehr begrenzt auf den Kompetenzerwerb der Auszubildenden, insbesondere im Versorgungssetting Krankenhaus aus. Um aktuell und zukünftig eine adäquate Versorgung von Menschen mit Demenz in Akutkliniken zu gewährleisten, bedarf es entsprechender Maßnahmen, die bereits in der Pflegeausbildung beginnen."
Konkreter sieht schon die derzeitige Lage so aus: "Ein Großteil (75,6 Prozent) der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege wird regelmäßig beauftragt, demenzerkrankte Menschen im Krankenhaus zu betreuen. Doch nur knapp ein Viertel (23,4 Prozent) von ihnen glaubt, dass ihre Kompetenzen zum Zeitpunkt der Befragung ausreichen, um Menschen mit Demenz bedürfnisorientiert zu pflegen. Bei knapp dreiviertel (74 Prozent) der Gesundheits- und Krankenpflegeauszubildenden treten Kompetenzunsicherheiten auf, wenn Demenzpatienten zum Beispiel aggressiv sind. 64,9 Prozent haben Probleme, die Bedürfnisse des an Demenz erkrankten Menschen zu erkennen. Gut die Hälfte der Auszubildenden (56,3 Prozent) fühlen sich im Umgang mit den Angehörigen schlecht vorbereitet." Die in der Überschrift zitierte Äußerung einer im Rahmen der Studie interviewten Leiterin einer Pflegeeinrichtung beschreibt das praktische Dilemma vieler Beschäftigter vor allem in der stationären Pflege.
Positiv stellen die IPP-ForscherInnen aber fest, dass die Vermittlung pflegerischer Kompetenzen für den Umgang mit Demenzkranken in Altenpflegeschulen besser aussieht.
Der 41-seitige Abschlussbericht des Projektes "Demenzsensible nicht medikamentöse Konzepte in Pflegeschulen. Vermittlung pflegerischer Kompetenzen in der Ausbildung, die zur nachhaltigen Verbesserung von Menschen mit Demenz in Akutkliniken beitragen - Eine bundesweite Vollerhebung" von S. Görres, M. Stöver, J. Bomball und A. Schwanke steht kostenlos als Band 8 der IPP-Schriften zur Verfügung.
Der 256 Seiten umfassende materialreiche BARMER GEK Pflegereport 2010. Schwerpunktthema: Demenz und Pflege von Heinz Rothgang, Stephanie Iwansky, Rolf Müller, Sebastian Sauer und Rainer Unger ist ebenfalls in ganzer Längfe kostenlos erhältlich. Dort findet man auch eine Fülle von interessanten Daten zu den vermutlichen Auswirkungen der künftigen demografischen Entwicklung auf die Pflegebedürftigkeit.
Bernard Braun, 8.2.12
Anzahl und Qualifikationsstruktur des Pflegepersonals durch Gesundheitspersonalstatistik um 20% und 50% überschätzt.
 Während sich u.a. der GKV-Spitzenverband regelmäßig über die mehr oder weniger umfangreichen oder gesicherten quantitativen Erfolge des Pflegesonderprogramms freut und die unterschiedlichsten Pflegeexperten in Deutschland sich kräftig über die Absichten der EU-Kommission streiten, als Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung zur Pflegefachkraft eine mindestens 12-jährige Schulbildung zu verlangen, sieht die quantitative und qualitative Wirklichkeit der Pflegepersonen in Krankenhäusern noch wesentlich schlimmer aus als es schon die amtliche Statistik zeigt.
Während sich u.a. der GKV-Spitzenverband regelmäßig über die mehr oder weniger umfangreichen oder gesicherten quantitativen Erfolge des Pflegesonderprogramms freut und die unterschiedlichsten Pflegeexperten in Deutschland sich kräftig über die Absichten der EU-Kommission streiten, als Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung zur Pflegefachkraft eine mindestens 12-jährige Schulbildung zu verlangen, sieht die quantitative und qualitative Wirklichkeit der Pflegepersonen in Krankenhäusern noch wesentlich schlimmer aus als es schon die amtliche Statistik zeigt.
Das zeigen jedenfalls die wesentlichen Erkenntnisse eines für den "Deutschen Pflegerat" erstellten Gutachtens des in diesem Sachbereich seit Jahren ausgewiesenen Hannoveraner Wissenschaftlers, Michael Simon. Simon war es, der vor einiger Zeit nachgewiesen hatte, dass trotz der seit einigen Jahren stetig steigenden Anzahl und Schwere von Krankenhaus-Fällen seit Ende der 1990er Jahren rund 50.000 Pflegekräftestellen abgebaut worden sind. Wenn überhaupt, nimmt das Pflegesonderprogramm davon nur einen Bruchteil zurück.
Auf der Basis einer kritischen Würdigung der methodischen Grenzen der Gesundheitspersonalstatistik des Statistischen Bundesamtes (z.B. Hochrechnungen von der 1%-Haushaltsstichprobe des Mikrozensus) kommt Simon auf der Basis diverser 100%-Meldedatensätze über die Anzahl und Qualität des Pflegepersonals u.a. zu folgenden, deutlich von der Gesundheitspersonalstatistik abweichenden Ergebnissen:
• Die Zahl des Pflegepersonals ist niedriger als bislang angenommen: Statt der von der Gesundheitspersonalrechnung des Bundes für das Jahr 2009 ausgewiesenen 1,458 Mio. Pflegekräfte gibt es lediglich ca. 1,21 Mio. Beschäftigte in Pflegeberufen.
• Deutlich niedriger als bisher angenommen ist auch die Zahl der Pflegefachkräfte, d.h. der Pflegekräfte mit dreijähriger Pflegeausbildung. Das Statistische Bundesamt überschätzt die Zahl der Pflegefachkräfte um fast 50 %.
• Der Beschäftigungszuwachs in der Pflege, oftmals als Indiz für den "Jobmotor" Pflege bemüht, besteht überwiegend aus einer enormen Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung. Der Gutachter bezweifelt in diesem Zusammenhang ferner, dass diese Zunahme der Teilzeitbeschäftigung komplett oder zum größten Teil durch die persönlichen Lebensumstände oder die Präferenzen der dort meist weiblichen Beschäftigten bestimmt wurde und wird - sie also uneingeschränkt eine soziale Wohltat darstellt. Vielmehr spiele die Teilzeitbeschäftigung auch als Instrument der Flexibilisierung des Personaleinsatzes eine Rolle.
Das Gutachten "Beschäftigte und Beschäftigungsstrukturen in Pflegeberufen. Analyse der Jahre 1999 bis 2009" gibt es komplett (72 Seiten) kostenlos auf der Website des Auftraggebers, des Deutschen Pflegerates.
Wer zusätzlich noch daran interessiert ist, mehr über die im Vergleich zu den gerade genannten Trends kleinen Verbesserungen durch das Pflegesonderprogramm zu erfahren, kann dies z.B. im "Zweiten Bericht des GKV-Spitzenverbandes zum Pflegesonderprogramm gemäß § 4 Abs. 10 Satz 12 KHEntgG (Förderjahre 2009 und 2010)" vom 30.6.2011 tun, der ebenfalls kostenlos erhältlich ist.
Die beiden Kernsätze des Berichtes lauten:
• "Der kumulierte Finanzierungsbetrag 2009/2010 auf Basis der Vereinbarungswerte beläuft sich auf insgesamt ca. 537 Mio. Euro für bislang fast 10.700 zusätzlich vereinbarte Pflegestellen."
• "Trotz einer gesetzlichen Änderung zur Nachweisführung in § 4 Abs. 10 Satz 11 KHEntgG kann die Zahl der in den Jahren 2009 und 2010 neu geschaffenen Stellen noch nicht zuverlässig ermittelt werden. Dies ist erst möglich, wenn den Krankenkassen von allen am Programm teilnehmenden Krankenhäusern die erforderliche Bestätigung durch einen Jahresabschlussprüfer vorgelegt wurde. Zum Zeitpunkt der diesjährigen Berichterstattung war das nur bei etwa der Hälfte der Krankenhäuser der Fall. Der GKV liegen Bestätigungen der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2009 von 475 der 1.017 am Förderprogramm teilnehmenden Krankenhäuser vor. Damit sind für etwa 63 % der vereinbarten zusätzlichen Stellen des ersten Förderjahres die Nachweise durch die Krankenhäuser geführt worden. Für weitere 7 % der zusätzlich vereinbarten Vollkräfte haben die Krankenhäuser unbestätigte Informationen mitgeteilt. Von Wirtschaftsprüfern bestätigte Angaben zu zusätzlich beschäftigtem Pflegepersonal oder zusätzlichen Finanzierungsbeträgen liegen für das Jahr 2010 nur in Ausnahmefällen vor."
Bernard Braun, 23.1.12
Unerwartetes zur Beschäftigungs- und Berufstreue sowie Einkommensentwicklung von Krankenschwestern und Co. 1993-2008 in SLH
 Das "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt sich kurzem intensiver mit dem Status quo sowie der bisherigen und künftigen Entwicklung regionaler Arbeitsmärkte und dabei auch der der Gesundheitswirtschaft.
Das "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt sich kurzem intensiver mit dem Status quo sowie der bisherigen und künftigen Entwicklung regionaler Arbeitsmärkte und dabei auch der der Gesundheitswirtschaft.
Welche interessanten und teilweise unerwarteten Ergebnisse hier zu erwarten sind, zeigt der vom IAB-Nord erstellte Bericht "Gesundheitswirtschaft in Schleswig-Holstein. Leit- und Zukunftsbranche für den Arbeitsmarkt". Der Bericht über das "Gesundheitsland" Nummer 1 der BRD enthält die folgenden Rubriken: aktuelle Situation der Beschäftigung, Entwicklung der letzten 10 Jahre, Strukturen der Beschäftigung, Beschäftigung in ausgewählten Berufen der Gesundheitswirtschaft, Verdienst in Berufen der Gesundheitswirtschaft und einem beschäftigungs- und gesundheitspolitisch besonders interessanten Kapitel über die Berufsverläufe in Berufen der Gesundheitswirtschaft - der Geburtsjahrgang 1968.
Die Erkenntnisse der Berufsverlaufsanalyse basieren auf den maximal bis 1975 zurückreichenden Individualdaten der Beschäftigten-Historik (BeH) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die BeH enthält die Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung und umfasst in der aktuellen Version rund 36 Millionen Individuen in Deutschland (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Minijobber). Für die Analyse zu Schleswig Holstein wurde aus der BeH eine spezifische Untersuchungskohorte gebildet. Ausgewählt wurden alle im Jahr 1968 Geborenen (ruznd 10 % der Geburtskohorte), die am 30.06.1993 in einem Gesundheitsberuf beschäftigt waren (Voll- oder Teilzeit). Anschließend wird bis zum Jahr 2008 jeweils am 30.06. der ausgeübte Beruf, die Arbeitszeit und das Einkommen erfasst. Abgebildet wird so der Berufsverlauf zwischen dem 25. und dem 40. Lebensjahr.
Auf dieser Basis können u.a. die Beschäftigungstreue (Verbleib in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung), die Berufsteue (Verbleib im Ausgangsberuf des Jahres 1993 oder einem anderen Gesundheitsberuf) und die Einkommensentwicklung berechnet werden.
Die Ergebnisse lauten im Einzelnen:
• Beschäftigungstreue: Der überwiegende Teil der Ausgangsgruppe geht im "Beobachtungszeitraum einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht (unabhängig vom jeweiligen Beruf). Differenziert nach Berufen haben die Krankenschwestern/-pfleger, Hebammen mit fast 80 % eine sehr hohe Beschäftigungsquote (78,4 Prozent, Stichtag im Folgenden jeweils der 30.06.2008). Im Durchschnitt aller Berufe liegt diese Rate deutlich niedriger (71,9 Prozent, Westdeutschland: 74,8 Prozent). Ebenfalls recht hohe Beschäftigungswerte erreichen die Krankenpflegehelfer (Schleswig-Holstein: 75,0 Prozent, West: 75,6 Prozent) und die Sprechstundenhelfer (Schleswig-Holstein: 74,5 Prozent, Westdeutschland: 75,5 Prozent). Bei den Altenpflegern/-helfern ist die Beschäftigungsquote niedriger (Schleswig-Holstein: 71,2 Prozent, Westdeutschland: 72,8 Prozent). Ein ganz anderes Bild bei den Masseuren und Krankengymnasten. Hier beträgt der Verbleib im Beschäftigungssystem nur 54,5 Prozent in Schleswig-Holstein (55,1 Prozent in Westdeutschland)." Abgesehen von den zuletzt Genannten, bei denen aber ihre hohe Selbständigkeit eine Rolle spielen könnte, weisen Gesundheitsberufe weitgehend konstante Beschäftigungsverläufe auf.
• Berufstreue: Hier kommen zum Stichtag 30. Juni 2008 "die Krankenschwestern/-pfleger und Hebammen auf eine Berufstreue von fast 90 Prozent (Schleswig-Holstein: 89,0 Prozent, Westdeutschland: 89,3 Prozent). Auch die Altenpfleger/-helfer haben eine hohe Berufstreue (Schleswig-Holstein: 84,8 Prozent, Westdeutschland: 79,7 Prozent). Die Krankenpflegehelfer sind nach 15 Jahren zu etwas weniger als 80 Prozent in einem Gesundheitsberuf tätig (Schleswig-Holstein: 79,7 Prozent, Westdeutschland: 78,0 Prozent). Auffallend ist die Situation der Sprechstundenhelfer. Diese Gruppe verbleibt zwar überdurchschnittlich häufig im Beschäftigungssystem, aber zu weniger als 70 Prozent in einem Gesundheitsberuf (Schleswig-Holstein: 69,9 Prozent, Westdeutschland: 70,9 Prozent). Hier hat eine starke Abwanderung in andere Berufsfelder stattgefunden. Umgekehrt die Gruppe der Masseure und Krankengymnasten. Hier war der Verbleib im Beschäftigungssystem am niedrigsten. Von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind aber über 80 Prozent in einem Gesundheitsberuf tätig (Schleswig-Holstein: 81,8 Prozent, Westdeutschland: 81,3 Prozent). Ebenfalls zu einem hohen Grad berufstreu sind die Diätassistenten und Pharmazeutisch-technischen Assistenten (Schleswig-Holstein: 83,6 Prozent, Westdeutschland: 74,6 Prozent). Das auffallendste Verlaufsmuster haben die Apothekenhelfer. Sie erreichen zwar den konstantesten Beschäftigungsverlauf aller Gesundheitsberufe, sind allerdings nur noch gut zur Hälfte in einem Gesundheitsberuf tätig (Schleswig-Holstein: 57,7 Prozent, Westdeutschland: 53,7 Prozent). Hier erfolgt eine starke Abwanderung in andere Berufe und Branchen, jeder zweite Apothekenhelfer verlässt die Gesundheitswirtschaft."
• In der dritten Längsschnittsanalyse geht es um das Niveau und die Entwicklung der Bruttoeinkommen: Die Analyse der Gehälter ist auf Vollzeiteinkommen beschränkt, weil auch "in der BeH die genauen Angaben zu wöchentlichen Arbeitsstunden bei Teilzeitbeschäftigung fehlen. Differenziert man nach Geschlecht ist eine ausgeprägte "Gender-Wage-Gap", zu finden, d. h. Frauen verdienen im selben Beruf bei gleicher Arbeitszeit weniger als Männer. … Das höchste Einkommen erreichen die Krankenschwestern/-pfleger, Hebammen. Mit 3.352 € bei den Männern und 2.950 € liegt das Einkommen deutlich über dem Durchschnittswert aller Berufe in Schleswig-Holstein. Gegenüber dem Berufskollegen in Westdeutschland fällt der Rückstand mit jeweils rund 100 € relativ gering aus. Im Zeitverlauf (1993 bis 2008) hat sich der Verdienst günstig entwickelt. Zwischen 1993 bis 2008 beträgt der Einkommenszuwachs bei den Männern rund 68 Prozent, bei den Frauen sind es rund 45 Prozent (Westdeutschland: Männer 63 Prozent, Frauen 47 Prozent). Der Lohnzuwachs ist höher als in Schleswig-Holstein insgesamt (Männer: 49 Prozent, Frauen: 41 Prozent) und auf ähnlichem Niveau wie der der Berufskollegen in Westdeutschland. … Krankenpflegehelfer erzielen mit 2.890 € bei den Männern und 2.698 € bei den Frauen einen überdurchschnittlichen Lohn für Schleswig-Holstein. Die weiblichen Krankenpflegehelfer verdienen sogar mehr als die Berufskollegen in Westdeutschland. Im Zeitverlauf konnten die Krankenpflegehelfer einen deutlichen Lohnzuwachs erzielen. Zwischen 1993 und 2008 ist das Einkommen bei den Männern um rund 66 Prozent gestiegen, bei den Frauen rund 50 Prozent (Westdeutschland: Männer 66 Prozent, Frauen 46 Prozent). Auf der anderen Seite des Lohnspektrums findet man die Sprechstundenhelfer. Hier können mangels ausreichender Fallzahlen nur die weiblichen Einkommen untersucht werden. Mit 1.843 € liegt das Einkommen um fast 1.000 € unter dem Durchschnitt aller Berufe in Schleswig-Holstein. Verglichen mit dem Verbraucherpreisindex haben die Sprechstundenhelfer sogar Einkommensverluste hinnehmen müssen."
Unter allen untersuchten Gesundheitsberufen "ist die Situation bei den Apothekenhelfern (am ungünstigsten). Auch hier können mangels Fallzahlen nur die weiblichen Beschäftigten ausgewertet werden. Mit 1.722 € liegt das Einkommen rund 650 € unter dem Durchschnitt Schleswig-Holsteins und ist das niedrigste aller untersuchten Gesundheitsberufe. Die Apothekenhelfer in Schleswig-Holstein verdienen fast 300 € weniger als ihre Kollegen in Westdeutschland. Auch in der zeitlichen Perspektive zwischen 1993 und 2008 ist die Einkommensentwicklung ungünstig."
Die Resultate der IAB-Nord-Analysen beinhalten einige gewichtige Anregungen aber auch Irritationen für die weitere Diskussion über die die Situation und zukünftige Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials oder -angebots im Gesundheitswesen (Schlagwort: "Fachkräftemangel/-notstand"). Nachdem auch diese Analyse belegt, dass rund 80% des Beschäftigungszuwachses im Gesundheitswesen zwischen 2000 und 2010 auf dem Zuwachs von Teilzeitstellen beruht, fällt der Mangel an Transparenz über weitere Merkmale dieser Beschäftigtengruppe (Stichwort: Arbeitszeit) besonders ins Gewicht.
Auf weitere derart differenzierte und längsschnittlich fokussierte Berichte über die Verhältnisse in anderen Bundesländern darf man jedenfalls gespannt sein.
Der Bericht "Gesundheitswirtschaft in Schleswig-Holstein. Leit- und Zukunftsbranche für den Arbeitsmarkt" von Volker Kotte (IAB-Regional. IAB Nord Nr. 01/2011) umfasst 49 Seiten und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.1.12
Dekubitusprophylaxe für ältere Patienten muss bei den wenigen Stunden auf Tragbahren in Notfallambulanzen anfangen, und lohnt sich
 Druckgeschwüre oder Dekubiti gehören zu den am schnellsten entstehenden und schwersten unerwünschten Nebenwirkungen bei zum Liegen gezwungenen Patienten im Krankenhaus oder auch von bettlägrigen häuslichen Patienten oder Heimbewohnern. Wenn erst einmal ein Druckgeschwür entstanden ist, ist es sehr aufwändig, es wieder weg zu bekommen und weitere Folgen zu vermeiden.
Druckgeschwüre oder Dekubiti gehören zu den am schnellsten entstehenden und schwersten unerwünschten Nebenwirkungen bei zum Liegen gezwungenen Patienten im Krankenhaus oder auch von bettlägrigen häuslichen Patienten oder Heimbewohnern. Wenn erst einmal ein Druckgeschwür entstanden ist, ist es sehr aufwändig, es wieder weg zu bekommen und weitere Folgen zu vermeiden.
Deshalb gelten gezielte präventive Maßnahmen wie das personalintensive ständige Umlagern gefährdeter PatientInnen oder druckentlastende Unterlagen bzw. Matratzen zu den anerkannten Gegenmitteln. Da weder zusätzliches Personal kostenlos zu erhalten ist, noch geeignete Matratzen billig sind, scheuen viele Behandlungs- und Pflegeeinrichtungen vor solchen Personal- und/oder Sachinvestitionen aus Kostengründen zurück und riskieren damit eine lang andauernde gesundheitliche Beeinträchtigung sowie auch Folgekosten für das Krankenhaus.
Dass dieses Verhalten weder human noch kosteneffizient ist, weist jetzt eine kanadische Studie über die Kosten und den finanziellen Nutzen früher Prävention von Druckgeschwüren durch spezielle druckentlastende Matratzen in Notfallambulanzen bis auf den Dollar-Cent genau nach. Da dort viele dieser Patienten lange auf Tragbahren und einfachen Betten liegen müssen und sich bereits dadurch ein Druckgeschwür bilden oder verschlimmern kann, untersuchten die ForscherInnen mittels einer aufwändigen Analysemethodik (Markov-Modelle) für die rund 240.000 älteren Patienten in Ontario, die über eine Notfallambulanz ins Krankenhaus kamen, die Inzidenz von Druckgeschwüren nach durchschnittlich 15,4 Stunden Aufenthalt auf normalen Liegegelegenheiten und bei der Nutzung von speziellen druckentlastenden Betten.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Die Inzidenz eines während eines Notfallambulanzaufenthalts erworbenen Druckgeschwürs betrug bei PatientInnen, die auf einfachen Tragbahren etc. lagen, 1,90%. Bei den Patienten mit einem speziellen präventiv wirkenden Schaumstoffbett belief sich die Inzidenz auf 1,48%. Für die erfolgreiche Verhinderung eines Druckgeschwürs mussten 238 PatientInnen behandelt werden ("number needed to treat").
• Die Ausgaben für die Umrüstung auf druckentlastende Betten bzw. entsprechend wirkende Matratzen für Tragbahren beliefen sich auf 0,30 Canada-Dollar pro Patient.
• Das Liegen in den Spezialbetten stellte ein wirksames Mittel der Frühprävention gegen Druckgeschwüre dar, führte zu einer Verlängerung der "quality-adjusted life-days" von 0,0015 und führte zu einer durchschnittlichen Gesamtkostenersparnis von 32,36 Kanada-Dollar pro älterem Patient. Der Anteil des durch die Verlängerung der gesunden Lebenszeit bedingten Gesundheitsnutzens am finanziellen Netto-Nutzen betrug 0,21 Kanada-Dollar. Die Kostenersparnis pro Patient schlug mit 32,15 Kanada-Dollar zu Buche. Selbst wenn ein Patient nur eine Stunde in einer Notfallambulanz lag, betrug der finanzielle Nutzen der Dekubitus-Prävention mittels einer speziellen Matratze noch 4 Kanada-Dollar pro Patient selbst dann, wenn diese nur eine Stunde liegend in einer Krankenhaus-Ambulanz auf ihre Behandlung warten mussten.
• Die positive gesundheitliche und ökonomische Wirkung druckentlastender Schaumstoffmatratzen bestätigte sich auf unterschiedlichen Niveaus auch noch in weiteren Analysen, die z.B. Effekte über längere Zeiträume untersuchten.
• Trotz der Absicht, nach weiteren Effekte in differenzierteren Untersuchungen zu suchen, kommen die AutorInnen zu dem eindeutigen Schluss, dass "the economic evidence supports early prevention with pressure-redistribution foam mattresses in the emergency department. Early prevention is likely to improve health for elderly patients and save hospital costs."
Zu dem in der Novemberausgabe 2011 in der Fachzeitschrift "Annals of Emergency Medicine" (Volumen 58 [5]: 468-78) erschienenen Aufsatz "Early Prevention of Pressure Ulcers Among Elderly Patients Admitted Through Emergency Departments: A Cost-effectiveness Analysis" von Ba' Pham et al. ist kostenlos lediglich das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 14.12.11
"Bewertet wird das, was beim Bewohner tatsächlich ankommt": Qualitäts-Indikatoren für Altenpflege liegen vor - und was nun?
 Mitten in die unsägliche Situation, dass eine nette Weihnachtsfeier im Altenpflegeheim die fehlerhafte Ausgabe von Arzneimitteln an HeimbewohnerInnen aufwiegen oder ausgleichen kann und Prüfberichte über Altenheime nicht veröffentlicht werden dürfen, legt jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlich gesicherter, machbarer und sogar innerhalb des Projekts praktisch erprobter Indikatoren zur Erhebung und Bewertung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe vor. Sie wurde zwischen 2008 und 2011 im Auftrag von Gesundheits- und Familienministerium von MitarbeiterInnen des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) sowie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) erarbeitet.
Mitten in die unsägliche Situation, dass eine nette Weihnachtsfeier im Altenpflegeheim die fehlerhafte Ausgabe von Arzneimitteln an HeimbewohnerInnen aufwiegen oder ausgleichen kann und Prüfberichte über Altenheime nicht veröffentlicht werden dürfen, legt jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlich gesicherter, machbarer und sogar innerhalb des Projekts praktisch erprobter Indikatoren zur Erhebung und Bewertung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe vor. Sie wurde zwischen 2008 und 2011 im Auftrag von Gesundheits- und Familienministerium von MitarbeiterInnen des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) sowie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) erarbeitet.
Wegen der bescheidenen Wirklichkeit der (Ergebnis)-Qualitätsaktivitäten in Deutschland heben die AutorInnen vor ihren detaillierteren Vorschlägen ein "gemeinsames Grundverständnis von Versorgungsergebnissen" hervor: "Ergebnisse der vollstationären pflegerischen Versorgung umfassen danach messbare Veränderungen des Gesundheitszustands, der Wahrnehmung und des Erlebens der Bewohner, die durch die Unterstützung der Einrichtung bzw. durch das Handeln ihrer Mitarbeiter bewirkt werden. Ergebnisqualität ist dementsprechend eine Eigenschaft von Versorgungsergebnissen, die mit einer bewertenden Aussage beschrieben wird." Für besonders wichtig halten sie, "dass sich die Indikatoren auf Ergebnisse beziehen, die von einer Einrichtung und ihren Mitarbeitern maßgeblich beeinflusst werden können. Darüber hinaus sollten sie sich für einen seriösen Vergleich der Qualität zwischen Einrichtungen eignen."
Im Detail schlagen sie 15 Indikatoren als geeignet vor: Erhalt oder Verbesserung der Mobilität (zwei Indikatoren, die abhängig vom Grad der kognitiven Einbußen sind), Selbständigkeitserhalt oder -verbesserung bei Alltagsverrichtungen (zwei Indikatoren), Selbständigkeitserhalt oder -verbesserung bei der Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte, Dekubitusentstehung (zwei Indikatoren je nach Dekubitusrisiko), Stürze mit gravierenden Folgen (zwei Indikatoren), Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (zwei Indikatoren), Integrationsgespräch für Bewohner nach dem Heimeinzug, Einsatz von Gurtfixierungen, Einschätzung von Verhaltensauffälligkeiten bei Bewohnern mit kognitiven Einbußen, Schmerzmanagement (Schmerzeinschätzung/Information über Schmerz).
Zusätzlich geben sie auch an, welche Indikatoren für die Beurteilung der Ergebnisqualität begrenzt einsetzbar und nicht empfohlen sind bzw. werden können - durchaus aber im Rahmen des internen Qualitätsmanagements nutzbar sind: Häufigkeit von Sondenernährung, Sturzhäufigkeit, Entstehung von Kontrakturen bei Bewohnern mit erheblichen Mobilitätseinbußen, Intensiver Medikamenteneinsatz ohne Überprüfung von Wechsel-/Nebenwirkungen, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Management von Harninkontinenz und Häufigkeit von Medikationsfehlern.
Bei einer dritten Gruppe von Indikatoren "wirft auch der begrenzte Einsatz im internen Qualitätsmanagement Probleme auf. Vielfach steht in Frage, ob hier tatsächlich von einem relevanten Einfluss der Einrichtungen ausgegangen werden kann." Dazu gehören u.a. die Entwöhnung von der Sondenernährung, Ungeplante Krankenhaus-Einweisungen, Häufigkeit von Harnwegsinfekten, Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten, Depression, Angst, Inadäquater Psychopharmakaeinsatz, Im Krankenhaus verstorbene Bewohner, Vorliegen einer Stuhlinkontinenz, Nosokomiale Infektionen, Grippeimpfungen, Chronische Wunden und Frakturen/Verletzungen.
Zu den so genannten "objektiven Indikatoren" zählen die Pflegeexperten schließlich noch sechs Indikatoren für den Regelbetrieb: Grad der Möglichkeit zur Möblierung, Qualität der Wäscheversorgung, Teilnahme an Aktivitäten und Kommunikation, Aktionsradius von Bewohnern mit deutlichen Mobilitätseinschränkungen, Risiko sozialer Isolation (mit Bedarf an Weiterentwicklung) und Mitarbeiterzeit pro Bewohner (mit Bedarf an Weiterentwicklung).
Auf der Basis einer zehnmonatigen Versuchsphase an Bewohnern von 46 Heimen halten die AutorInnen ihre Vorschläge auch mit einem geringen zusatzaufwand für praktikabel , an die "heutigen Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen anschlussfähig und in bestehende Abläufe integrierbar." Den zusätzlichen Aufwand halten sie für gering bzw. müsste er im Rahmen einer fachgerechten Pflege sowieso erbracht werden.
Ihr Fazit lautet: "Mit dem vorgestellten Set gesundheitsbezogener Indikatoren stehen die Voraussetzungen für ein innovatives Qualitätsberichtssystem zur Verfügung. Mit einem solchen System würde der Anspruch, Ergebnisqualität in den Mittelpunkt von Qualitätssicherung und Qualitätsbeurteilung zu stellen, nach vielen Jahren Diskussion umgesetzt. In Deutschland würde damit auch frühzeitig Anschluss gefunden an den aktuellen internationalen Entwicklungstrend. … Die Eigenverantwortung der Einrichtungen würde gestärkt und ein erheblicher Anreiz für "gute Pflege" im Interesse des Bewohners geschaffen."
Was die tatsächliche Chancen für den Einsatz der Indikatoren zur Qualitätssicherung in stationären Altenpflegeeinrichtungen angeht, ist aber nach Meinung des Staatssekretärs im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Ilka, auch trotz der ausdrücklich in Auftrag gegebenen und positiv verlaufenen praktischen ERprobung offen: "Die Ergebnisse lassen sich jedoch auf das heutige System nur schrittweise übertragen und benötigen weitere sorgfältige Vorbereitungen."
Der im März 2011 veröffentlichte Abschlussbericht "Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe von Klaus Wingenfeld, Dietrich Engels et al. umfasst 394 Seiten und ist kostenlos erhältlich. Er sollte in keiner künftigen Debatte über Pflegequalität unerwähnt bleiben.
Bernard Braun, 20.6.11
Erkrankungsrisiken von pflegenden Familienangehörigen oft höher als die von nichtpflegenden Vergleichspersonen
 Von den 2010 rund 2,4 Millionen pflegebedürftigen Personen werden rund 70 % zu Hause versorgt. Daran sind Pflegekräfte aus den rund 11.500 ambulanten Pflegediensten beteiligt aber auch in erheblichem Maße pflegende Familienangehörige. Zwei Drittel von ihnen sind im erwerbsfähigen Alter, drei Viertel sind weiblich und über die Hälfte lebt im gleichen Haushalt wie die pflegebedürftige Person. Die pflegenden Familienangehörigen geben den Zeitaufwand für die Pflege mit 42 Stunden pro Woche an, was mehr als 20 % nicht davon abhält neben der Pflege noch zu arbeiten, knapp die Hälfte von ihnen sogar in einem Vollzeitjob.
Von den 2010 rund 2,4 Millionen pflegebedürftigen Personen werden rund 70 % zu Hause versorgt. Daran sind Pflegekräfte aus den rund 11.500 ambulanten Pflegediensten beteiligt aber auch in erheblichem Maße pflegende Familienangehörige. Zwei Drittel von ihnen sind im erwerbsfähigen Alter, drei Viertel sind weiblich und über die Hälfte lebt im gleichen Haushalt wie die pflegebedürftige Person. Die pflegenden Familienangehörigen geben den Zeitaufwand für die Pflege mit 42 Stunden pro Woche an, was mehr als 20 % nicht davon abhält neben der Pflege noch zu arbeiten, knapp die Hälfte von ihnen sogar in einem Vollzeitjob.
In allen Analysen zur gesundheitlichen Situation von pflegenden Angehörigen hat man es also oft mit Personen zu tun, die einer Dreifachbelastung aus Berufstätigkeit, eigener Familie oder eigenem Haushalt und Pflegetätigkeit ausgesetzt sind.
Auch wenn 85 % der pflegenden Angehörigen angeben, die Pflege vermittle ihnen "ein gutes Gefühl", zeigten bisherige allgemeine Untersuchen, dass ein Drittel von ihnen während und evtl. auch wegen der Pflege selbst erkrankt.
Wie groß und welcher Art das Erkrankungsrisiko von pflegenden Angehörigen im Einzelnen ist, untersuchte jetzt die Siemens BKK für 700 ihrer Versicherten im Alter zwischen 31 und 60 Jahren, die pflegende Angehörige sind. Deren Erkrankungssituation verglichen sie mit einer ansonsten ähnlichen Gruppe von Versicherten, die keinen Angehörigen pflegten.
Dabei zeigte sich, dass pflegende Angehörige in vielfacher Hinsicht kränker sind. Dies zeigt sich u.a. in folgenden Indikatoren:
• Die Zahl der Diagnosen mit chronischen und schwerwiegenden Krankheiten pro Person liegt bei pflegenden Angehörigen um bis zu 51 % höher als bei Durchschnitts-Deutschen. Die gesamten Leistungsausgaben für pflegende Angehörige liegen 18 % über dem Durchschnitt.
• Die Ausgaben für ambulante Behandlung liegen für pflegende Angehörige um 29 %, für Arzneimittel um 28 % und für Heil- und Hilfsmittel um 70 % über denen in der nicht pflegenden Vergleichsgruppe.
• Keine Unterschiede gab es bei den Ausgaben für stationäre Behandlungen.
• Die jüngeren, d.h. die 31- bis 40jährigen pflegenden Angehörigen sind nach der Zahl der Diagnosen um 19 % kränker als der Durchschnitt. Die Gesamtausgaben für stationäre und ambulante Behandlung liegen jedoch um 20 % unter dem Durchschnitt. Diese Diskrepanz könnte eine latente Unterversorgung mit potenziellen gesundheitlichen Folgeproblemen anzeigen.
Diese Querschnittsanalyse zeigt nicht, wie sich die Erkrankungslasten weiter entwickeln, kumulieren, ernster oder auch wieder geringer werden. Nicht berücksichtigt wird in ihr, dass auch professionelle Pflegekräfte in Altenheimen oder im ambulanten Bereich kränker sind als gleichaltrige Nicht-Pflegekräfte. Beide Einwände bedeuten aber nicht, dass der Gesundheit der Personen, welche aktuell und wohl auch auf Dauer die Hauptlast der Pflege pflegebedürftiger Personen tragen werden mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als bisher.
Eine Materialsammlung zur Pflegesituation und Daten über die pflegenden Angehörigendiverser Strukturdaten zur Pflegebedürftigkeit und der Ergebnisse von Analysen des Krankenstandes und der Behandlungsversorgung von pflegenden Angehörigen ist bei der Siemens BKK kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.2.11
Pflegekräftemangel 2025: Unentrinnbare Lücke oder doch etwas anders und beeinflussbarer!?
 Die Prognosen über einen künftigen Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus und in der ambulanten Pflege boomen. Nach der zuletzt veröffentlichten Prognose des Unternehmensberatungskonzerns PricewaterhouseCoopers (PwC) legen nun auch das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BiBB) auf der Basis von Mikrozensus-Daten aus dem Jahr 2005 "Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen bis 2025" vor.
Die Prognosen über einen künftigen Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus und in der ambulanten Pflege boomen. Nach der zuletzt veröffentlichten Prognose des Unternehmensberatungskonzerns PricewaterhouseCoopers (PwC) legen nun auch das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BiBB) auf der Basis von Mikrozensus-Daten aus dem Jahr 2005 "Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen bis 2025" vor.
Das "Deutsche Ärzteblatt" startet seinen Kurzbericht zu dieser Prognose am Nikolaustag mit der Überschrift "In 15 Jahren fehlen rund 150.000 Pflegekräfte". Am Dienstag lässt dann etwa die "Süddeutsche Zeitung" unter der Überschrift "Die Pflege-Lücke" die "Statistiker … einen massiven Personalmangel bei der Betreuung alter und kranker Menschen (erwarten)" und berichtet dann aber relativ differenziert über die ihr wichtig erscheinenden Ergebnisse der Projektionen. Angesichts des Ernstes der künftigen Entwicklung der Nachfrage und des Angebots von Pflege lohnt sich eigentlich bei jeder Informationsquelle die Lektüre des Originals. Diese verschafft einen Menge inhaltlicher und methodischer Einblicke in das Innere derartiger Prognosen.
Die bisher bekannt gewordene Berichterstattung erwähnt nämlich einige der wesentlich differenzierter als normal vorgelegten Ergebnisse nicht bzw. behandelt sie randständig.
Zu den wichtigen Determinanten der Nachfrage nach Pflege und des Angebots an Pflegekräfte zählen die Autoren Anja Afentakis und Tobias Maier
• auf der Nachfrageseite die stetige Zunahme des Anteils der 65+-Bevölkerung und ihrer spezifischen Morbidität. Wie bereits in früheren Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes legen die AutorInnen ihren Berechnungen aber zwei theoretisch solide Szenarien der künftigen Morbiditäts- und Leistungsnachfrageentwicklung zugrunde. Dies sind das so genannte "status quo-Szenario", das die bisherige expandierende Entwicklung fortschreibt und das "Szenario der sinkenden Behandlungsquoten". Im "status quo-Modell" steigt die als Bedarf genutzte Anzahl der Krankenhaus-Fälle bis zum Jahr 2025 um 12,5 %. Im Modell der "sinkenden Behandlungsquoten" steigt die Nachfrage im selben Zeitraum schwächer, nämlich um 8,5 %. Dies ist bezogen auf aktuell 17,5 Millionen Krankenhaus-Fälle pro Jahr ein Unterschied von rund 800.000 Fällen und ein spürbarer Unterschied bei der benötigten Anzahl von Pflegekräften, die man braucht, um diesen Bedarf bei ansonsten konstanten Bedingungen abzudecken. In beiden Szenarien steigt der Vollständigkeit halber die Nachfrage nach Pflegekräften in der ambulanten und (teil-)stationären Pflege aber um einen höheren Betrag (Status quo: +48,1 %; Sinkende Behandlungsquoten: +35,4 %) als in der Krankenhauspflege.
• Aber auch die Angebotsseite, also die Quantität unterschiedlich qualifizierter Pflegekräfte und die Beschäftigungsstruktur, d.h. vor allem das Verhältnis von Vollarbeits- zu Teilzeitarbeitskräften und das von voll ausgebildetem und angelernten Pflegepersonal, ist gegenwärtig das Gegenteil von unabänderlich determiniert. Es gibt vielmehr z.B. bei der Beschäftigungsstruktur trotz ähnlich hoher Frauenanteile erhebliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Bereits für die Situation im Ausgangsjahr 2005 der Prognose wirkten sich die Unterschiede in der Beschäftigungsstruktur allein des ausgebildeten Pflegepersonals in Ost- und Westdeutschland so aus: Die westdeutsche Beschäftigungsstruktur würde, wenn sie für Gesamtdeutschland gelten würde, bereits 2005 zu einem Mangel an 59.000 Pflegevollkräften führen. Wenn alternativ die ostdeutsche Beschäftigtenstruktur gesamtdeutsch würde, hätte 2005 ein Überangebot von 28.000 Pflegevollkräften bestanden.
• Bezieht man sämtliche bisherigen Differenzierungen in die Prognosen ein, also die unterschiedlichen Morbiditäts- und Versorgungsszenarien und Beschäftigtenstrukturen ergeben sich erhebliche quantitative Unterschiede für das im Zieljahr 2025 notwendige oder fehlende Pflegepersonal: Die Beschäftigtenstruktur in Gesamtdeutschland bzw. im früheren Bundesgebiet unterstellt, würde der Mangel an ausgebildeten Pflegekräften im "status quo-Szenario" 193.000 bzw. 214.000 Personen umfassen. Die fehlende Anzahl von ausgebildeten Pflegekräfte sinkt im Szenario "sinkender Behandlungsquoten" auf 135.000 bzw. 157.000.
• Nimmt man aber für Gesamtdeutschland die ostdeutsche Beschäftigtenstruktur an oder sorgte dafür sie zu verallgemeinern, sieht die Anzahl der fehlenden ausgebildeten Pflegekräfte im Jahr 2025 noch einmal völlig anders aus: Unter den Bedingungen des "status quo-Szenarios" für die Nachfrage nach Pflegeleistungen würde bis 2023 kein quantitativer Mangel existieren, aber 2025 fehlten dann doch 34.000 Pflegevollkräfte. Unter den Bedingungen des Szenarios "sinkender Behandlungsquoten" träte aber schließlich der Fall ein, dass es sogar nochim Jahr 2025 ein ausreichendes Angebot an Pflegevollkräften gäbe. Warum also nicht die Schlagzeile "Pflege-Lücke bis 2025 geschlossen!"?
• Die Autoren der weisen außerdem eindringlich darauf hin, dass ihre Prognosen auf einer Fülle konstant gesetzter Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren basieren, die in den meisten Fällen geändert werden könnten. Dies betrifft etwa die durchschnittliche Verweildauer von Krankenhaus-Patienten, die Aufgabenteilung von Pflegekräften und Ärzten, die Berufsflexibilität oder das Verhältnis von ausgebildeten zu an- und ungelernten Pflegekräften.
Auch wenn man nicht davon ausgehen kann, dass die derzeitigen ostdeutschen Rahmenbedingungen für das Pflegekräfte-Angebot irgendwann einmal ohne Abstriche zur Normalität in Gesamtdeutschland werden, zeigt diese Projektionsvariante, dass die künftige Pflegekräftesituation auch von einer Menge politisch beeinflussbaren Faktoren abhängig ist.
Dabei geht es beispielsweise um eine Politik zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Kindererziehung und Beruf, die Prävention hoch belastender und für viele Pflegekräfte nicht mehr in Vollzeit ertragbaren Arbeitsbedingungen oder kreativere Arbeitszeitmodelle.
Sich dieser Gestaltungsmöglichkeiten vor der Kapitulation vor dem scheinbar unentrinnbaren "massiven Personalmangel" von "rund 150.000" Pflegekräften zu erinnern, ist ein wichtiger Beitrag zu einer rationaleren Pflegekräfte-Politik.
Der Aufsatz "Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen bis 2025" von Anja Afentakis (Statistisches Bundesamt) und Tobias Maier (BiBB) ist in der Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik" (Heft 11/2010) erschienen und komplett wie kostenlos zum weiteren Kennenlernen anspruchsvollerer Prognosen erhältlich.
Bernard Braun, 7.12.10
Zu Hause betreute Demenzkranke leben über 2 Jahre länger als wenn sie in Heimen gepflegt würden. Was folgt daraus?
 Bei manchen Forschungsergebnissen stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, sie existierten nicht oder man müsste sich nicht mit den praktischen Konsequenzen auseinandersetzen.
Bei manchen Forschungsergebnissen stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, sie existierten nicht oder man müsste sich nicht mit den praktischen Konsequenzen auseinandersetzen.
Dies gilt beispielsweise für die Antwort auf die Frage "Leben Demenzkranke zu Hause länger als im Heim?", die am 5.April 2010 in einem Online-First-Beitrag in der Fachzeitschrift "Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie" erschienen ist. Sie beruht auf einer bemerkenswerten und in ihrer Art sehr seltenen Follow up-Studie, die mit 173 in einer Ambulanz der Uniklinik Bochum diagnostizierten Demenzkranken zwischen 1995 und 2001 bzw. 2006 durchgeführt wurde. Beim Erstkontakt lebten 48 der Patienten mit vollständiger Datenlage in einem Seniorenheim, die restlichen 97 Demenzkranken mit kompletten Daten wurden zuhause gepflegt.
Wie die ForscherInnen aus verschiedenen Kliniken betonen, sind Frage wie Antwort deshalb von großer Bedeutung, weil bei wahrscheinlich zunehmender Inzidenz von Demenz bei älteren Menschen die "Deckung der Kosten, die durch Demenzkranke verursacht werden, und die Sicherstellung ihrer adäquaten Betreuung" wichtige gesellschaftliche Fragen sind. Dabei gibt es bereits ohne diese Studie einige ethisch schwierigen Konstellationen. Dazu zählt u.a. das Neben- und Gegeneinander des auch bei dementen Personen bekannten Wunsches, solange wie möglich zuhause gepflegt zu werden und der enormen psychischen, psychosozialen und -mentalen Belastungen, denen pflegende Angehörige bis hin zur eigenen Psychiatrisierung ausgesetzt sind.
Die Studie der fünf Ärzte und Gerontologen kommt nun zu folgenden Ergebnissen:
• Die Sterblichkeit von Alzheimer-Patientenhängt hauptsächlich vom Alter und vom Schweregrad der Demenz ab. Demenzkranke Frauen leben länger als demenzkranke Männer.
• Im Seniorenheim gepflegte Patienten haben nach Ausschluss des Einflusses von Alters-, Geschlechts- und vor allem Schweregradunterschieden ein signifikant um 53,1% höheres relatives Sterberisiko (p=0,047) als zu Hause gepflegte Betreute. Dies entspricht absolut und maximal einem um 2,2 Jahre längeren Leben, was je nach Bewertung methodischer Besonderheiten leicht kürzer ist, aber bei einem anderen prospektiven Design auch "deutlich höher" liegen könnte.
Unter dem Ziel der Verlängerung von Lebenszeit bedeutet also eine Heimunterbringung eine bisher so nicht bekannte gravierende Verkürzung der "medianen Überlebenszeit".
Was es noch bedeutet, deuten die Autoren dann an, wenn sie nach der praktischen Bedeutung der Abschätzung von Überlebenszeiten fragen: "Angehörige bezüglich der Prognose fundierter beraten zu können, damit diese besser ihre eigenen Grenzen erkennen und sich entsprechend für eine häusliche oder in-stitutionelle pflegerische Versorgung entscheiden können. Dies hätte im Sinne einer psychiatrischen Primärpräventi¬on eine Verbesserung des Gesundheitzustandes der pflegenden Angehörigen zur Folge, da diese eine Hochrisikopopulation für psychiatrische Morbidität darstellen."
Die anschließende konkrete Schilderung der enormen Belastungsfolgen bei pflegenden Angehörigen von Demenzkranken und die Darstellung einiger struktureller Vorteile der Heimunterbringung (z.B. besserer Umgang mit Mangelernährung, Dehydrierung und dem oft gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus von Demenzkranken, befreit nicht von dem Druck des jetzt sogar quantifizierten Lebensverkürzungseffekt einer "vernünftig" erscheinenden Entscheidung zu Gunsten einer Heimunterbringung.
Offen bleibt in der Studie aber leider u.a. auch, warum unter den für die genannten Aspekte der Lebensqualität von Alzheimerpatienten und die Lebensqualität pflegender Angehöriger vorteilhaften Heimbedingungen die Pflegebedürftigen um Jahre früher sterben. Immerhin weisen die ForscherInnen auf die Unterbeachtung der Lebensqualität von Demenzkranken hin und die vermutlich in Heimen weniger berücksichtigten und befriedigten sozialen Bedürfnisse nach zwischenmenschlichen Kontakten und sinnvoller Beschäftigung.
Wer als Wissenschaftler Angehörige nicht unter einen extremen Rechtfertigungs- und möglicherweise Missbilligungsdruck setzen oder geraten lassen will, wenn sie eine Heimunterbringung für notwendig halten, und wem über zwei Lebensjahre für Demenzkranke nicht gleichgültig sind, muss also so schnell und klar wie möglich sagen, wie entweder die mortalitätsfördernden Bedingungen in Seniorenheimen geändert werden können oder wie Demenzkranke zu Hause betreut werden können ohne dass die Betreuenden selber schwer körperlich und psychisch erkranken.
Der 5 Seiten umfassende Aufsatz ""Leben Demenzkranke zu Hause länger als im Heim?" von D. Lankers, S. Kissler, S.D. Hötte, H.J. Freyberger und S.G. Schröder ist Online-First am 5.4.2010 in der Fachzeitschrift "Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie" (DOI: 10.1007/s00391-010-0096-7) erschienen und kostenlos lediglich als Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 22.4.10
Sturzprävention: Benzodiazepinkonsum älterer Menschen durch einmalige Beratungsveranstaltung signifikant und dauerhaft senkbar.
 Die Einnahme psychotropischer bzw. wesensverändernder Arzneimittel ist bei älteren Menschen weit verbreitet. In einer finnischen Studie mit 75 Jahre alten und älteren Personen, die in ihren eigenen vier Wänden wohnten, nahmen 37% mindestens eine derartiges Medikament ein, 12% sogar zwei und mehr. Jeder Dritte nutzte Schlafmittel oder angstlösende Arzneimittel, deren Hauptwirkstoff Benzodiazepin oder ein ähnlicher Stoff war. Benzodiazepine werden in der Regel über längere Zeit und regelmäßig eingenommen.
Die Einnahme psychotropischer bzw. wesensverändernder Arzneimittel ist bei älteren Menschen weit verbreitet. In einer finnischen Studie mit 75 Jahre alten und älteren Personen, die in ihren eigenen vier Wänden wohnten, nahmen 37% mindestens eine derartiges Medikament ein, 12% sogar zwei und mehr. Jeder Dritte nutzte Schlafmittel oder angstlösende Arzneimittel, deren Hauptwirkstoff Benzodiazepin oder ein ähnlicher Stoff war. Benzodiazepine werden in der Regel über längere Zeit und regelmäßig eingenommen.
Alle psychotropische Arzneimittel erhöhen bei älteren Menschen das Risiko von Stürzen und Knochenbrüchen. Dem steht speziell bei Schlafstörungen ein marginaler Nutzen gegenüber und das Risiko unerwünschter Effekte wie beispielsweise der von Abhängigkeit oder behandlungsabhängiger Depressionen ist hoch.
Daher verwundert es nicht, dass in einer prospektiven randomisierten kontrollierten Studie mit 528 freiwilligen und rüstigen TeilnehmerInnen im 65+-Alter untersucht wurde, ob und wodurch die langfristige Einnahme von Benzodiazepinen und vergleichbarer Arzneimittel dauerhaft verringert werden kann.
Die präventive Intervention bestand zu Beginn der Studie in einer mündlichen Bestandsaufnahme der gesamten Medikation der TeilnehmerInnen durch einen Geriater, was auch die Beratung über die Zweckmäßigkeit der Einnahme von Benzodiazepinen und ggfls. auch die Verordnung anderer, für notwendig gehaltenen Arzneimittel umschloss. Im weiteren Verlauf der Studie erhielten die Angehörigen der Interventionsgruppe eine einstündige Informationsveranstaltung über die Benzodiazepine und ihre unerwünschten Wirkungen sowie über weitere Möglichkeiten der Sturzprävention angeboten. Deren erklärtes Ziel war die Beendigung, die Reduktion oder der Wechsel der Einnahme von Benzodiazepine. In der Kontrollgruppe wurde die vorherige Verordnung und Einnahme derartiger Medikamente fortgesetzt.
Die Wirkung der Intervention in der Zeit wurde auch noch durch ein 12-Monate-Follow up gemessen. Frühere Studien hatten im Übrigen schon gezeigt, dass auch ein einfacher Brief des Hausarztes zur Benzodiazepineinnahme bereits Wirkungen erzielen kann.
Die Ergebnisse lauten:
• Die Anzahl der regelmäßigen NutzerInnen von Benzodiazepinen und verwandter Wirkstoffe sank in der Interventionsgruppe signifikant (p=0,012) um 35%. In der Kontrollgruppe stieg sie dagegen um 4%.
• Die größten präventiven Wirkungen wurden bei "jüngeren" Alten und Frauen erzielt.
• Die Intervention reduzierte auch die Anzahl der Personen, die Benzodiazepine nur unregelmäßig einnahmen. In dieser Gruppe trat zusätzlich der auch in anderen kleinräumigen Interventionsstudien beobachtete Effekt auf, dass auch die Anzahl der Angehörigen der Kontrollgruppe, die Benzodiazepine einnahmen, signifikant abnahm. Erklärbar ist dies durch die engen sozialen Kontakte der StudienteilnehmerInnen in der Kommune oder auch durch die Medienberichterstattung über die Hintergründe der Studie.
So eindrucksvoll die immerhin über 12 Monate anhaltende Wirkung der relativ unaufwändigen Intervention auch ist, so bedauerlich ist, dass die Studie an keiner Stelle untersucht, ob die Reduktion der Einnahme psychotroper Arzneimttel auch noch etwas an der Häufigkeit von Stürzen ändert. Selbst wenn es dort keine signifikanten Veränderungen gäbe, rechtfertigte der mit der Nichteinnahme verbundene Gewinn an Lebensqualität und Nebenwirkungsfreiheit die Intervention.
Von dem in der renommierten Fachzeitschrift "Age and Ageing" (2010 39(3):313-319; doi:10.1093/ageing/afp255) erschienenen siebenseitigen Aufsatz "One-time counselling decreases the use of benzodiazepines and related drugs among community-dwelling older persons" von Maritta Salonoja, Marika Salminen, Pertti Aarnio, Tero Vahlberg und Sirkka-Liisa Kivelä gibt es kostenlos sowohl ein Abstract als auch die komplette Fassung.
Bernard Braun, 14.4.10
Erste Zeugnisse für Gemeindeschwester AGnES: Modellprojekt bekommt gute Noten von Ärzten und Patienten
 AGnES (Arzt-entlastende, Gemeinde-nahe, E-Health-gestützte, Systemische Intervention) ist ein Modellprojekt, das in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchgeführt wurde, um Engpässen in der hausärztlichen Versorgung zu begegnen. Im AGnES-Modellprojekt wird der Hausarzt von einer speziell ausgebildeten Krankenschwester (Telegesundheitsschwester, Gemeindeschwester) unterstützt, die durch neue Kommunikationstechniken mit dem Hausarzt in Verbindung steht und ihn so von der zeitraubenden Tätigkeit der Hausbesuche teilweise entlasten kann. Die Projekte wurden jetzt in einer ersten Bilanz durch Befragung von Ärzten und Patienten überprüft, wobei sich ein sehr hohes Maß an positiven Bewertungen ergab.
AGnES (Arzt-entlastende, Gemeinde-nahe, E-Health-gestützte, Systemische Intervention) ist ein Modellprojekt, das in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchgeführt wurde, um Engpässen in der hausärztlichen Versorgung zu begegnen. Im AGnES-Modellprojekt wird der Hausarzt von einer speziell ausgebildeten Krankenschwester (Telegesundheitsschwester, Gemeindeschwester) unterstützt, die durch neue Kommunikationstechniken mit dem Hausarzt in Verbindung steht und ihn so von der zeitraubenden Tätigkeit der Hausbesuche teilweise entlasten kann. Die Projekte wurden jetzt in einer ersten Bilanz durch Befragung von Ärzten und Patienten überprüft, wobei sich ein sehr hohes Maß an positiven Bewertungen ergab.
Demografischer Wandel und steigende Lebenserwartung von Patienten einerseits sowie Schwierigkeiten bei der Wiederbesetzung von Arztpraxen in ländlichen Regionen waren zentrale Gründe für die Einführung der Modellprojekte, bei denen speziell ausgebildete Krankenschwestern einen Teil der ärztlichen Tätigkeiten übernahmen und den Arzt so von Routine-Arbeiten entlasteten. Insgesamt wurden etwa 300 unterschiedliche Tätigkeiten delegiert. Dazu gehörten (1) die Erhebung diagnostischer Parameter (z. B. Blutdruck- und Blutzuckerwerte, Puls, Gewicht, Peakflow, Temperatur, EKG) (Anteil etwa 50%), (2) die standardisierte Beurteilung des Gesundheitszustandes, Dokumentation von Symptomen und medizinisch relevanten Ereignissen, eine Beratung etwa zur Flüssigkeitsaufnahme, Ernährung, zum Umgang mit Heil- und Hilfsmitteln (Anteil etwa 35%) und (3) auch einfache medizinische Tätigkeiten (z. B. Blutentnahmen, Injektionen und Wund- und Dekubitusbehandlungen, Verbandswechsel) (Anteil etwa 15%).
Die Modellprojekte unterscheiden sich insofern, als die AGnES-Mitarbeiterinnen je nach Projekt in Voll- oder Teilzeit arbeiten und unterschiedlich angebunden sind, an einer Einzel- oder Gemeinschaftspraxis, einem medizinischen Versorgungszentrum oder einem lokalen Hausärzteverbund. Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass Krankenschwestern statt des Arztes Hausbesuche durchführen können, weil technische Verbindungen zwischen dem Arzt, dem Auto der Pflegeschwester sowie bei langzeitüberwachten Patienten durch WLAN eingerichtet sind. Die Schwester kann dadurch unabhängig von ihrem Standort mit dem Arzt kommunizieren oder ihm Daten wie Blutdruck, EKG übermitteln. Ferner können bei Patienten, Telecare-Geräte installiert werden, die eine dauerhafte ärztliche Überwachung ermöglichen.
Bis Oktober 2008 hatten in den vier neuen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt mehr als 1.500 Patientinnen und Patienten an einem der Modellprojekte nach dem AGnES-Konzept teilgenommen. Die zeitlich befristeten Projekte wurden durch das Institut für Community Medicine der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald konzipiert, durchgeführt und wissenschaftlich ausgewertet. Die teilnehmenden Patientinnen und Patienten waren zum größten Teil multimorbide (durchschnittlich 6 Diagnosen pro Patient), waren gar nicht oder nur eingeschränkt mobil und hatten ein Durchschnittsalter von 79 Jahren. Insgesamt wurden 10.112 Hausbesuche durchgeführt.
In einer Befragung zeigten sich dann eindeutig positive Bewertungen des Projekts;
• 92% der Hausärzte/innen bewerteten die Qualität der neuen medizinischen Betreuung als vergleichbar mit einer üblichen hausärztlichen Vorgehensweise
• 90% der Hausärzte/innen gaben an, dass sich das AGnES-Konzept entlastend auf ihre Tätigkeiten auswirkt
• 88% der Hausärzte/innen meinten, dass sich der Einsatz der AGnES-Fachkräfte positiv auf die Mitwirkungsbereitschaft der Patienten/innen (Compliance, Adherence) auswirkt
• 99% der Patienten/innen sagten, dass die AGnES-Fachkräfte kompetente Ansprechpartnerinnen für Gesundheitsfragen sind und
• 94% der Patienten/innen können sich vorstellen, dass die Hausärztin/der Hausarzt Hausbesuche nur noch bei dringendem medizinischem Bedarf durchführt und eine AGnES-Fachkraft die restlichen Hausbesuche übernimmt.
Diese überaus positive erste Bilanz scheint die sehr ablehnende Haltung von Ärzteverbänden nachhaltig zu widerlegen. So hieß es in einer Presseinformation der Landesärztekammer Brandenburg vom 20. November 2007:
"Projekt "Gemeindeschwester" muss überarbeitet werden
Die Landesärztekammer Brandenburg (LÄKB) fordert eine inhaltliche Neuausrichtung des Modellprojektes 'Gemeindeschwester'. In einer Resolution betont die Kammerversammlung, dass das Projekt nur eine Chance auf Realisierung hat, wenn es mit der Ärzteschaft und nicht gegen sie entwickelt wird. (...) In der öffentlichen Diskussion stellen die Delegierten zunehmend eine unrealistische, idealisierte und antiquierte Vorstellung von dem neu einzuführenden Berufsbild einer 'Gemeindeschwester' fest. Der verklärte Blick auf alte DDR-Bilder riskiert eine Fehlentwicklung, so der Standpunkt der Kammerversammlung. (...) Die Schaffung einer
'Dritten Säule' durch akademisierte Heilhilfsberufe ist unnötig.
Verantwortlichkeiten werden zersplittert, Kosten in
die Höhe getrieben und die Bürokratie erhöht, erklärte
Dr. Udo Wolter, Präsident der LÄKB, stellvertretend für die
Kammerversammlung."
• Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg: Vorstellung der Modellprojekte nach dem AGnES-Konzept in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt
• Mehrere Dateien zum Symposium "Hausarztunterstützende Konzepte und Strukturen - Die Modellprojekte nach dem AGnES-Konzept" (17. Oktober 2008 in Berlin)
• Wissenschaftliche Bilanz des Teilprojekts auf Rügen, Abstract und PDF-Download: Neeltje van den Berg et al: GP-support by means of AGnES-practice assistants and the use of telecare devices in a sparsely populated region in Northern Germany - proof of concept (BMC Family Practice 2009, 10:44doi:10.1186/1471-2296-10-44)
Gerd Marstedt, 23.6.09
Licht am Ende des langen dunklen Tunnels der Debatte über Gesundheit und Alter in Deutschland? Ein Bericht von RKI, StaBu und DZA
 Immer wenn die Zukunft der Gesundheit und der Finanzierung von Gesundheitssystemen so richtig dunkel erscheinen soll, wird seit geraumer Zeit je nach Temperament die demographische "Entwicklung" oder "Katastrophe" bemüht: Alt, älter, kränker, teurer und kollektiv unfinanzierbar aber immer öfter das Eldorado der Gesundheitswirtschaft.
Immer wenn die Zukunft der Gesundheit und der Finanzierung von Gesundheitssystemen so richtig dunkel erscheinen soll, wird seit geraumer Zeit je nach Temperament die demographische "Entwicklung" oder "Katastrophe" bemüht: Alt, älter, kränker, teurer und kollektiv unfinanzierbar aber immer öfter das Eldorado der Gesundheitswirtschaft.
Dass an einigen der Grundannahmen wenig oder nichts stimmt, wird seit einiger Zeit und vorwiegend im internationalen Rahmen intensiver diskutiert als im GKV-System. Dies gilt vor allem für die Stimmigkeit der Annahmen mit der Zunahme der Lebenserwartung sei eine Morbiditätsexpansion verbunden versus der Annahme, dass die Anzahl der gesunden Lebensjahre zunimmt und der Großteil der Morbidität ans Lebensende verschoben oder völlig bewältigt wird. Der internationale Forschungsstand gab einem der letzten "Alter-und-Gesundheit"-Beiträge im Forum-Gesundheitspolitik Anlass von einem "Spielstand" von 4:1 für die "compression of morbidity" zu sprechen.
Mit dem in der Reihe "Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes" 2009 erschienenen, 323 Seiten umfassenden Band zum Thema "Gesundheit und Krankheit im Alter" haben die drei HerausgeberInnen Böhm (Statistisches Bundesamt), Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Altersfragen) und Ziese (Robert Koch-Institut), deren Institute in diesem Bereich enger zu kooperieren beabsichtigen, eine bemerkenswert gründliche, verständliche und für die Bundesrepublik Deutschland aktuell empirisch gestützte Analyse vorgelegt. Ihre Analyse bricht mit einigen der reflexartigen Verständnisse über Alter und Gesundheit und unterstützt damit einen längst überfälligen Paradigmawechsel in diesem Bereich der gesundheitspolitischen Debatte.
Die Darstellung gliedert sich in die Abschnitte: theoretische Positionen zum Alter und Altern, Gesundheitszustand und Gesundheitsentwicklung mit der Frage, ob der demografische Wandel zu einer Kompression oder Expansion der Morbidität führen wird, gesundheitsrelevante Lebenslagen und Lebensstilen mit einer Erörterung der Frage »Wie wichtig ist Prävention?, Angebote gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung
für alte Menschen, Beiträge zu den ökonomischen Chancen und Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und der Frage, ob Gesundheit unter den Bedingungen von Demografie und Fortschritt bezahlbar bleibt.
Die wesentlichen Forschungsergebnisse zum Verhältnis von Gesundheit/Krankheit und Alter sowie der Morbiditätslast älterer Menschen sehen nach der Ansicht und im Originalton der AutorInnen aus dem RKI und seinen Kooperationspartnern so aus:
• "Es ist noch nicht endgültig zu beantworten, ob die Verlängerung der Lebenszeit im Alter auch mit einer Zunahme der Lebensjahre ohne substanzielle funktionale Einschränkungen einhergeht. Es überwiegen allerdings die Studien, die Verbesserungen in der funktionalen Gesundheit Älterer in den letzten Jahren nachweisen."
• "Entscheidend für weitere Erfolge bei der Verbesserung der funktionalen Gesundheit wird daher sein, inwieweit es gelingt, ältere Menschen über gesundheitsförderliches Verhalten zu informieren und sie zu Veränderungen im Gesundheitsverhalten zu motivieren."
• "Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Verschlechterung der subjektiven Gesundheit keiner altersinhärenten Gesetzmäßigkeit folgt. Vielmehr tragen vielfältige individuelle und gesellschaftliche Bedingungen dazu bei, ob und in welchem Ausmaß sich die subjektive Gesundheit mit steigendem Alter verschlechtert."
• Zwar argumentieren die AutorInnen zunächst relativ zögerlich: "Eine empirisch noch ungeklärte Forschungsfrage ist, inwiefern der Zugewinn an Lebensjahren ein längeres Leben bei guter Gesundheit impliziert. In der Tendenz verzeichnen die Länder mit einer sehr hohen Lebenserwartung auch die größeren Anteile an gesunden Lebensjahren." An anderer Stelle lautet die "Kernaussage" dann aber recht deutlich: "Auch wenn in Deutschland nur wenige Datenquellen zur Entwicklung der gesunden Lebenserwartung zur Verfügung stehen, deuten die vorliegenden Ergebnisse auf eine Zunahme der Lebenserwartung in Gesundheit hin."
• Außerdem: "Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorliegenden Ergebnisse auf einen Anstieg der gesunden Lebenserwartung seit Ende der 1980er-Jahre hindeuten. Es kam im Zuge der ansteigenden Lebenserwartung zu einer relativen Kompression chronischer Morbidität. Die Befundlage zur Entwicklung der gesunden Lebenserwartung in Deutschland stimmt mit den internationalen Ergebnissen überein. Ein Anstieg zeigt sich anhand unterschiedlicher Datenquellen und auf Basis verschiedener Gesundheitsindikatoren. Im Kohortenvergleich haben sich der Anteil und das Ausmaß der gesundheitlich beeinträchtigten Lebenszeit bei Männern und Frauen insbesondere für starke gesundheitliche Beeinträchtigungen verringert. Damit deutet sich insgesamt eine Entwicklung in Richtung der Kompressionsthese an."
Liegen damit genügend Hinweise auf die Evidenz der Kompressionshypothese vor, bleibt immer noch der Hinweis auf die Kostenträchtigkeit und auf Dauer Unfinanzierbarkeit der Krankheitskosten älterer Menschen.
Hierzu stellt der Bericht fest:
• "Obwohl ein beträchtlicher Teil der Krankheitskosten bei älteren Menschen entsteht, kann das Alter per se nicht dafür verantwortlich gemacht werden: Weitere, teils altersabhängige, teils altersunabhängige Faktoren müssen bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden."
• "Zusammenfassend gibt es eine Reihe zuverlässiger Belege dafür, dass weniger die Altersstruktur per se, als vielmehr ein Bündel verschiedener Faktoren Einfluss auf die Krankheitskosten ausübt, die teils selbst mit dem Alter in Zusammenhang stehen (z.B. die in der Sterbekostenforschung erkannte Ballung von Krankheitskosten im letzten Zeitabschnitt vor dem Tod - Anmerkung Bernard Braun), teilweise aber auch altersunabhängig sind. Welchem Faktor dabei im Einzelnen welcher Stellenwert zukommt, ist auf der gegenwärtigen Datenbasis und in Anbetracht der Komplexität des Themas nur schwer zu quantifizieren. ...Von einer (statistischen) Altersabhängigkeit der Krankheitskosten prospektiv auf eine "Kostenexplosion" im Gesundheitswesen zu schließen, würde die hier komplex wirkenden Mechanismen und Zusammenhänge deutlich verkennen."
• "Abschließend sei daher nochmals betont: Das Alter an sich muss keine größere gesundheitliche Belastung und Pflegebedürftigkeit bedeuten".
Wohltuend zurückhaltend, realistisch und differenziert geht die Expertise schließlich auch beim Versuch einer Prognose der künftigen Entwicklung der Gesundheitswirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Zunahme der 60/65+-Bevölkerung vor: "Zusammenfassend zeigt sich, dass einzelne Zweige der Gesundheitswirtschaft vom Älterwerden der Gesellschaft profitieren, ohne dass sie zwangsläufig einen Ausgabenfaktor für die GKV darstellen (individuelle Gesundheitsleistungen, Selbstmedikation). ...Ob und inwiefern sich eine florierende Gesundheitswirtschaft auf die künftige Beschäftigungsentwicklung auswirken wird, bleibt offen. ...Umgerechnet in Vollzeitäquivalente ist im Gesundheitswesen eine stagnierende bis leicht abnehmende Beschäftigungsentwicklung zu beobachten. Ausgenommen hiervon sind wenige Berufsgruppen, primär die Beschäftigten in der Altenpflege."
Der 323-seitige Untersuchungsband "Gesundheit und Krankheit im Alter" ist komplett und kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 26.5.09
Früher aber nicht notwendiger Einsatz von Antibiotika bei Kindern - Kein Nutzen der Antibiotikaprophylaxe bei Harnwegsinfekten
 Die Über- oder Fehlversorgung von BürgerInnen aller Altersgruppen mit Antibiotika und das damit sogar verbundene Risiko, systematisch multiresistente Erreger heranzuzüchten, wird allenthalben als großes ökonomisches und gesundheitliches Problem kommuniziert.
Die Über- oder Fehlversorgung von BürgerInnen aller Altersgruppen mit Antibiotika und das damit sogar verbundene Risiko, systematisch multiresistente Erreger heranzuzüchten, wird allenthalben als großes ökonomisches und gesundheitliches Problem kommuniziert.
Der Einstieg in Antibiotikatherapien erfolgt häufig bereits bei kleinen Kindern und gewinnt zum Teil hier ihr positives Image als Waffe gegen wiederkehrende Erkrankungen und einige ihrer fürs Leben erworbenen physiologischen Folgen. Dies gilt - neben der Mittelohrentzündung - auch für die häufig wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, die nicht nur schmerzhaft sind, sondern auch durch die mögliche Vernarbung des Nierengewebes bleibende Spuren mit wiederum möglichen unerwünschten Folgewirkungen hinterlassen.
Die Intervention gegen eine erstmalige Erkrankung an Harnwegsinfektionen galt auch bereits bei sehr jungen Kindern als geeignetes Mittel, Rezidive und Vernarbungen zu verhindern.
Ob dies wirklich zutrifft und ob daher möglicherweise das Resistenzbildungsrisiko geringer wiegt, wurde aber erst jetzt in einer randomisierten kontrollierten Studie mit 338 Kindern im Alter von 7 Monaten bis zu 7 Jahren untersucht, die erstmalig an einem fiebrigen Harnwegsinfekt erkrankt waren, der mit einer nicht-schweren Form der Umkehr der Fließrichtung des Harns (vesikoureteralem Reflux [VUR; Grad I-III]) verbunden war oder nichts davon aufwies.
In einer multizentrischen, randomisierten, kontrollierten, einseitigen Äquivalenzstudie erhielt ein Teil dieser Kinder ein Jahr lang eine Antibiotikaprophylaxe (n=127) , der andere (n=211) nicht. Bei 309 dieser Kinder wurde eine Nierenbeckenentzündung nachgewiesen und 27 Kinder litten neben einer Nierenbeckenentündung auch an Problemen des Harnabflusses (Reflux).
Die beiden Studienziele waren die Rezidivrate des fiebrigem Harnwegsinfekt und die durch diese wiederkehrenden Entzündungen verursachten Vernarbungen des Nierengewebes zu untersuchen.
Die so genannte "Intention-to treat"-Analyse ergab weder für den primären Endpunkt der Rezidivrate noch die Vernarbung des Nierengewebes einen signifikanten Unterschied zwischen der Antibiotika- und Nicht-Antibiotika-Gruppe:
• Mit Prophlaxe erkrankten 9,45 % der Kinder mit Antibiotikaeinnahme erneut und 7,11 % waren es in der Gruppe ohne Antibiotikabehandlung. In der Untergruppe mit vesikoureteralem Reflux erkrankten 12,1 % der behandelten und 19,6 % der nicht behandelten Kinder erneut an einem Harnwegsinfekt.
• 1,9 % der Kinder ohne Prophylaxe zeigten eine Vernarbung des Nierengewebes und 1,1 % der Kinder mit Prophylaxe.
- Zu keinem Lebenszeitpunkt erwies sich die fehlende Prophylaxe als ein Risikofaktor.
• In einer multivariaten Analyse erwies sich ein schwererer Grad der Fließumkehr des Harns als der entscheidende Risikofaktor für wiederkehrende fiebrige Harnwegsinfekte. Protektiv wirkte ein höheres Alter
Zumindest für die Fälle in denen es zu keiner oder einer leichten bis mittelschweren Form des Refluxes kommt, sehen daher die Wissenschaftler keinen Nutzen für die Antibiotikaprophlaxe. Damit sollten deren potenziellen mittel- bis langfristigen Nachteile und auch ihre Kosten Anlass sein, auf eine solche Therapie zu verzichten.
Von dem Aufsatz "Prophylaxis after first febrile urinary tract infection in children? A multicenter, randomized, controlled, noninferiority trial" von Montini G. et al. in der Zeitschrift Pediatrics (Vol. 122 No. 5 November 2008, pp. 1064-1071) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 1.3.09
Medikalisierung vs. Kompression: Künftiger Anstieg der Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben im Alter deutlich überschätzt.
 Nach mehreren klaren Relativierungen der auch in den USA dramatisierend geführten Debatte - "die demographische Katastrophe" - über unerwünschte gesundheitliche und ökonomische Auswirkungen des Altwerdens und der relativen Zunahme älterer Menschen, liegt mit einem achtseitigen Aufsatz des Essener Gesundheitsökonomen Stefan Felder nun auch aus deutschen Landen ein empirisch gut begründeter Einspruch gegen den Mainstream der Medikalisierungspropheten vor.
Nach mehreren klaren Relativierungen der auch in den USA dramatisierend geführten Debatte - "die demographische Katastrophe" - über unerwünschte gesundheitliche und ökonomische Auswirkungen des Altwerdens und der relativen Zunahme älterer Menschen, liegt mit einem achtseitigen Aufsatz des Essener Gesundheitsökonomen Stefan Felder nun auch aus deutschen Landen ein empirisch gut begründeter Einspruch gegen den Mainstream der Medikalisierungspropheten vor.
Die beiden Hypothesen stammen aus einer seit einiger Zeit geführten Debatte über den Zusammenhang von Altwerden und Älterwerden mit Morbidität und Gesundheitsversorgungs- wie Pflegekosten. Die "Medikalisierungshypothese" sieht durch die höhere Lebenserwartung auch die Anzahl der kranken Jahre oder multimorbid überlebenden Personen und damit die Pro-Kopf-Ausgaben wachsen, die "Kompressionshypothese" dagegen sieht die Anzahl der beschwerdefreien Jahre wachsen und die Gesundheitsausgaben erst am Lebensende oder im letzten Lebensjahr besonders wachsen. Je nachdem welcher Hypothese man folgt, wird die an sich erfreuliche Verlängerung der Lebenszeit als Katastrophe oder Gewinn gesellschaftlicher Lebensqualität dargestellt.
Während also insbesondere in den USA die Debatte zunehmend (in Fußballbegriffen steht es dort 4:1 für die Kompressionshypothese) von empirischen Erkenntnissen zugunsten der "compression of morbidity" bestimmt wird, hing die allemal zu Überdramatisierungen neigende deutsche Szene eher noch allen Varianten der Medikalisierung und erdrückenden Morbiditätslast des Alters nach.
Der bereits im Oktober 2008 erschiene Aufsatz von Stefan Felder liefert aber die folgenden Gegenargumente:
• Auch er hebt den von ihm bereits vor Jahren mit Krankenversicherungsdaten aus der Schweiz gewonnenen Trend der Konzentration der Gesundheitsausgaben (mit Pflegekosten) zu Beginn und am Ende des Lebens hervor.
• Der Versuch das Leben zu verlängern steigert die Ausgaben für medizinische Versorgung in der Regel im letzten Lebensjahr stark. Sie betragen mehr als das Zehnfache der Ausgaben für die in diesem Jahr überlebenden Personen.
• Trotzdem sinken die Gesundheitsausgaben für über 65-Jährige am Lebensende mit zunehmendem Alter. In einer deutschen Untersuchung fand sich folgender Beleg für diese Dynamik: Die Zahl der im letzten Lebensjahr verbrachten Tage im Krankenhaus lag zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr am höchsten und sank danach mit zunehmendem Alter. Dahinter vermutet man, dass Ärzte und Patienten in jüngerem Alter eher bereit sind, alle medizinischen Maßnahmen auszuschöpfen als in höheren Lebensjahren bzw. der Nähe zu einem "natürlichen" Sterbealter.
Die Folgen dieser Trends sehen nach Felder völlig anders aus als die Debatte über die Bedeutung der Alterung für die Finanzierungszukunft des Gesundheitssystems erwarten lässt:
• "Die demografische Alterung hat nur einen schwachen Einfluss auf die Gesundheitsausgaben einer Bevölkerung." Entscheidender ist die Nähe zum Tod.
• "Es gibt kaum empirische Evidenz, die für die Gültigkeit der Medikalisierungsthese spricht". Felder verweist dabei auch auf Berechnungen mit Daten des Mikrozensus für Deutschland, nachdem jüngere Alterskohorten nicht nur länger lebten, sondern auch einen "Zugewinn an Lebensjahren in guter Gesundheit erfuhren." Bereits im "Dritten Altenbericht der Bundesregierung" aus dem Jahr 2000 hieß es dazu auf der Basis der damals und derzeit bestmöglichen empirischen Daten u.a.: "Für Deutschland hat Dinkel auf der Grundlage der Mikrozensusdaten 1978-1995 die Entwicklung des - subjektiven - Gesundheitszustands im Alter und die Verlängerung der ferneren Lebenserwartung in Gesundheit in der Abfolge der Geburtsjahrgänge 1907, 1913 und 1919 untersucht (Dinkel 1999). Je nach Kohorte wurde dabei die Zeit zwischen dem 60. und 89. Lebensjahr betrachtet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung offenbaren eine merkliche Verbesserung des Gesundheitszustands auch im höheren Alter und einen absoluten und relativen Rückgang der in Krankheit verbrachten Lebensjahre der Seniorinnen und Senioren. Dinkels Ergebnisse ... legen nahe, dass zumindest in den letzten Dekaden die "gewonnenen" Altersjahre auch einen - sogar überproportionalen - Gewinn an gesunden Lebensjahren mit sich brachten."
• Auch für eine von Felder überprüfte so genannte Status-quo-Hypthese findet sich "keine empirische Bestätigung". Diese Hypothese meint, "dass altersspezifische Ausgaben nur von den Fortschritten der medizinischen Technik abhängen."
• Die Kompressionshypothese habe dagegen eine "feste empirische Basis".
Der Aufsatz "Im Alter krank und teuer? Gesundheitsausgaben am Lebensende" ist in Heft 4 des Jahrgangs 2008 der Beilage "Gesundheit und Gesellschaft-Wissenschaft (GGW)" einer Verlagsbeilage der Zeitschrift "Gesundheit+Gesellschaft" des Wissenschaftlichen Institus der Ortskrankenkassen (WIdO) erschienen und kostenlos komplett erhältlich.
Bernard Braun, 15.2.09
Wutausbrüche und Gewalt gegen Demenzkranke durch pflegende Angehörige sind kein Einzelfall
 Dass die Pflege altersschwacher oder kranker Angehöriger erhebliche Belastungen mit sich bringt und es teilweise zu Behandlungsverläufen kommt, die für Pflegende wie Gepflegte gesundheitlich überaus problematisch sind, ist durchaus bekannt. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) hat aus diesem Grunde sogar eine Leitlinie "Pflegende Angehörige" verfasst, in der auf solche Risiken hingewiesen wird: Gewalttätige Übergriffe von pflegenden Angehörigen auf die Pflegebedürftigen als Ausdruck von Überlastung und angestauten Aggressionen, Medikamenten- und Alkoholmissbrauch, Erschöpfungsdepression, Suizidgefahr.
Dass die Pflege altersschwacher oder kranker Angehöriger erhebliche Belastungen mit sich bringt und es teilweise zu Behandlungsverläufen kommt, die für Pflegende wie Gepflegte gesundheitlich überaus problematisch sind, ist durchaus bekannt. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) hat aus diesem Grunde sogar eine Leitlinie "Pflegende Angehörige" verfasst, in der auf solche Risiken hingewiesen wird: Gewalttätige Übergriffe von pflegenden Angehörigen auf die Pflegebedürftigen als Ausdruck von Überlastung und angestauten Aggressionen, Medikamenten- und Alkoholmissbrauch, Erschöpfungsdepression, Suizidgefahr.
Eine englische Studie hat jetzt gezeigt, dass solche Übergriffe gegen demenzkranke Angehörige, die von Familienmitgliedern gepflegt werden, durchaus kein Einzelfall sind. Basis der Studie sind Interviews mit insgesamt 220 pflegenden Familienangehörigen. 56% von ihnen pflegten Elternteile, 33% einen Ehepartner, 13% andere Verwandte oder Freunde. Es handelte sich bei diesen Teilnehmern an der Befragung um zufällig ausgewählte Personen, die einen psychologischen Dienst in Essex und London in Anspruch genommen hatten und anlässlich dieses Besuches auch um ihre Mitarbeit gebeten wurden.
Gefragt wurde dabei, ob es bei ihnen in den letzten drei Monaten zu bestimmten psychischen oder physischen Übergriffen gegen ihre zu pflegenden Angehörigen gekommen sei. Vorgegeben wurden sehr unterschiedliche Formen, angefangen von verbalen Drohungen, lautem Brüllen und Anschreien, bis hin zu körperlichen Attacken in Form von Durchschütteln oder Schlägen. Gefragt wurde auch, wie oft es zu solchen Verhaltensweisen gekommen sei. Es zeigte sich dann:
• Über verbale Angriffe wurde recht häufig berichtet: Ein lautes Brüllen und Anschreien kam bei jedem Vierten im letzten Vierteljahr manchmal oder öfter vor, Beleidigungen oder ein herabsetzender, entwürdigender Tonfall bei nicht ganz jedem Fünften.
• Körperliche Gewaltausbrüche unterschiedlicher Form waren demgegenüber eher selten und wurden von weniger als 5% der Teilnehmer berichtet.
• Insgesamt sind es 52% der Befragungsteilnehmer, die in irgendeiner Form zumindest ab und zu (im letzten Vierteljahr) körperliche oder seelische Attacken gegen ihre demenzkranken Angehörigen ausgeübt haben.
Berücksichtigt man, dass es sich erstens um Angehörige handelt, die bereits einen Problemdruck verspüren und deshalb psychologische Hilfe suchen und dass es sich zweitens um Eingeständnisse der Befragten handelt, die sozial wenig erwünscht sind und daher auch in Interviews eher Leugnungstendenzen unterliegen, dann dürften die angegebenen Häufigkeiten nur die Spitze eines Eisbergs darstellen. Die Studie zeigt damit noch einmal nachdrücklich auf, wie wichtig Hilfen für die betroffenen Angehörigen wären.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Claudia Cooper u.a.: Abuse of people with dementia by family carers: representative cross sectional survey (BMJ 2009;338:b155; Published 22 January 2009, doi:10.1136/bmj.b155)
In einer bereits 2008 veröffentlichten Metaanalyse über Misshandlungen und Vernachlässigungen Älterer war aus der Auswertung von insgesamt 49 Studien deutlich geworden, dass die Prävalenz solcher Übergriffe gegen Ältere zwischen 12 und 55 Prozent beträgt, je nachdem, welchen Zeitraum man zugrunde legt und welche Verhaltensweisen man als gewalttätig bewertet. Vgl.: Claudia Cooper, Amber Selwood, Gill Livingston: The prevalence of elder abuse and neglect: a systematic review (Age and Ageing 2008 37(2):151-160; doi:10.1093/ageing/afm194)
Gerd Marstedt, 26.1.09
Gesundheitswissenschaftliche Modellrechnung: In Krankenhäusern fehlen aktuell 70.000 Pflegekräfte
 Wollte man die gleiche Versorgungsqualität in deutschen Krankenhäusern wie Mitte der 90er Jahre erreichen, dann wäre es aktuell erforderlich, 70.000 zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Modellrechnung des Gesundheitswissenschaftlers Prof. Michael Simon der Fachhochschule Hannover (Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales). Obwohl die Zahl der Krankenhauspatienten seit Jahrzehnten kontinuierlich steigt, so argumentiert der Wissenschaftler, wurden seit Mitte der 1990er Jahre Stellen im Pflegedienst der Krankenhäuser in ganz erheblichem Umfang abgebaut. Folge davon ist, dass immer weniger Pflegekräfte immer mehr Patienten versorgen müssen. In einer Modellrechnung errechnete der Gesundheitswissenschaftler, dass angesichts der gestiegenen Leistungszahlen gegenwärtig ca. 70.000 mehr Pflegekräfte in Krankenhäusern erforderlich wären, um den gleichen Versorgungsstandard wie Mitte der 1990er wieder zu erreichen.
Wollte man die gleiche Versorgungsqualität in deutschen Krankenhäusern wie Mitte der 90er Jahre erreichen, dann wäre es aktuell erforderlich, 70.000 zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Modellrechnung des Gesundheitswissenschaftlers Prof. Michael Simon der Fachhochschule Hannover (Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales). Obwohl die Zahl der Krankenhauspatienten seit Jahrzehnten kontinuierlich steigt, so argumentiert der Wissenschaftler, wurden seit Mitte der 1990er Jahre Stellen im Pflegedienst der Krankenhäuser in ganz erheblichem Umfang abgebaut. Folge davon ist, dass immer weniger Pflegekräfte immer mehr Patienten versorgen müssen. In einer Modellrechnung errechnete der Gesundheitswissenschaftler, dass angesichts der gestiegenen Leistungszahlen gegenwärtig ca. 70.000 mehr Pflegekräfte in Krankenhäusern erforderlich wären, um den gleichen Versorgungsstandard wie Mitte der 1990er wieder zu erreichen.
Das gegenwärtig von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Sonderprogramm zur Finanzierung von 21.000 zusätzlichen Stellen im Pflegedienst der Krankenhäuser ist darum nach Auffassung von Professor Simon nicht ausreichend. Durch Überlastung der Pflegekräfte bleibt nach seiner Argumentation nicht nur weniger Zeit für menschliche Zuwendung. Überdies belegen zahlreiche internationale Studien, dass eine Unterbesetzung im Pflegedienst das Risiko für Krankenhauspatienten erhöht, schwere Komplikationen zu erleiden oder daran unter Umständen sogar zu sterben.
Im internationalen Vergleich zeigt sich eine deutliche Unterbesetzung der deutschen Kliniken. So liegt laut OECD die Zahl des Krankenhauspersonals je 1.000 Einwohner in Finnland, Frankreich, Irland, Österreich, der Schweiz und den USA um 50 bis 60% über der in Deutschland. Würde man diese Relationen auf den Pflegedienst übertragen, müssten in deutschen Krankenhäusern ca. 150.000 zusätzliche Stellen in der Pflege eingerichtet werden.
Die Studie zeigt auch auf, dass nur etwa ein Drittel des Stellenabbaus im Pflegedienst zwischen 1996 und 2006 durch die Budgetentwicklung zu erklären ist. Der überwiegende Teil erfolgte zugunsten einer internen Umverteilung von Finanzmitteln. Die im Pflegedienst eingesparten Mittel wurden vor allem für die Finanzierung zusätzlicher Arztstellen verwendet, wenn man den Kostendaten der amtlichen Krankenhausstatistik Glauben schenkt. Denn während im Pflegedienst ab 1996 Stellen abgebaut wurden, verzeichnete der ärztliche Dienst parallel dazu einen Stellenzuwachs. Die Stellenvermehrung setzte auch keineswegs erst mit der neuen Arbeitszeitgesetzgebung für Klinikärzte ein und ist auch nicht mit der gesetzlich vorgesehenen Refinanzierung der Mehrkosten durch die Abschaffung des Arztes im Praktikum (AiP) im Jahr 2004 und Umwandlung von AiP-Stellen in Arztstellen zu erklären.
Die Studie (PDF, 16 Seiten) mit Angaben zu weiterer Literatur ist hier herunterzuladen: Modellrechnung zur Schätzung der gegenwärtigen Unterbesetzung im Pflegedienst der Krankenhäuser
Gerd Marstedt, 21.11.08
Pflegereport der Gmünder Ersatzkasse GEK 2008: Erhebliche Mängel der medizinischen Versorgung in Pflegeheimen
 Der Pflegereport 2008 der Gmünder Ersatzkasse, für den sowohl die kasseninternen Pflegedaten als auch die amtliche Statistik ausgewertet wurden, kritisiert eine Reihe von Mängeln der medizinischen Versorgung in Pflegeheimen. Hier fiel den Wissenschaftlern unter anderem die Diskrepanz zwischen hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung auf: Zwar wird jeder Heimbewohner einmal im Quartal von einem Hausarzt untersucht. Pflegebedürftige mit psychischen Störungen oder Parkinson-Syndrom kommen allerdings nur 2,5 mal pro Jahr mit einem Neurologen oder Psychiater in Kontakt, was aus medizinischer Sicht zu selten ist. Auch bei der Versorgung durch Augenärzte und Orthopäden sind Verbesserungen erforderlich, denn die jährliche Behandlungsquote von Pflegebedürftigen in häuslicher und stationärer Pflege durch Augenärzte liegt um 50 Prozent niedriger als bei nicht pflegebedürftigen Personen. Bei Orthopäden fällt die Behandlungsquote um 25 bis 33 Prozent ab.
Der Pflegereport 2008 der Gmünder Ersatzkasse, für den sowohl die kasseninternen Pflegedaten als auch die amtliche Statistik ausgewertet wurden, kritisiert eine Reihe von Mängeln der medizinischen Versorgung in Pflegeheimen. Hier fiel den Wissenschaftlern unter anderem die Diskrepanz zwischen hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung auf: Zwar wird jeder Heimbewohner einmal im Quartal von einem Hausarzt untersucht. Pflegebedürftige mit psychischen Störungen oder Parkinson-Syndrom kommen allerdings nur 2,5 mal pro Jahr mit einem Neurologen oder Psychiater in Kontakt, was aus medizinischer Sicht zu selten ist. Auch bei der Versorgung durch Augenärzte und Orthopäden sind Verbesserungen erforderlich, denn die jährliche Behandlungsquote von Pflegebedürftigen in häuslicher und stationärer Pflege durch Augenärzte liegt um 50 Prozent niedriger als bei nicht pflegebedürftigen Personen. Bei Orthopäden fällt die Behandlungsquote um 25 bis 33 Prozent ab.
Weiterhin kritisierten die Wissenschaftler die festgestellte Diskrepanz zwischen hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung. Abgesehen davon, dass es Hinweise dafür gibt, dass die fachärztliche Versorgung ausbaufähig erscheint, wäre auch hier der verstärkte Einsatz koordinierender Hausärzte denkbar. Heute sind für Pflegeheime mit ca. 150 Betten häufig rund 40 verschiedene Hausärzte zuständig, inklusive aller Kommunikations- und Schnittstellenprobleme. Besser wären nach Meinung der Forscher kleine Netzwerke von drei bis vier Hausärzten, die exklusiv an eine stationäre Pflegeeinrichtung angebunden sind und ihre einheitliche Behandlung kontinuierlich mit der Pflegedienstleitung absprechen. Das würde auch die aufwendige Installation eigener Heimärzte überflüssig machen, denn "kleine Krankenhäuser" sollten die stationären Pflegeheime nicht werden.
Pflegegeldempfängern, die also einen Angehörigen persönlich zuhausen pflegen, gelingt es offensichtlich besser, die Einweisung in eine stationäre Einrichtung zu vermeiden oder zeitlich zu verzögern. Für Professor Rothgang, der Mitglied im Beirat des Bundesministeriums für Gesundheit zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist, zeigt sich hier eine alarmierende Tendenz: "Diejenigen, die professionelle Pflegesachleistungen und Kombinationsleistungen in Anspruch nehmen, kommen früher in Pflegeheime als Pflegegeldempfänger. Deshalb sollte die Pflege im häuslichen Umfeld weiter gestärkt werden." Soll der Heimeintritt gemäß des Grundsatzes "ambulant vor stationär" vermieden oder zumindest verzögert werden, dann sollten familiäre Pflegearrangements stabilisiert werden, bevor eine Überforderung der Familien einsetzt. Die in den letzten Jahren forcierten niedrigschwelligen Angebote für Demenz-Erkrankte bieten hierfür ebenso Ansatzpunkte wie die im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz neu geschaffenen Pflegeberater und Beratungsstellen.
Wie groß ist das Risiko, selbst pflegebedürftig zu werden? Auch hierzu macht der GEK Pflegereport erstmals verlässliche Angaben. Er untersuchte, wie hoch der Anteil der 2007 verstorbenen GEK Versicherten war, die im Todesjahr Leistungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch genommen haben. Bei den Männern lag der Anteil bei 41 Prozent, bei den Frauen bei 51 Prozent, im Durchschnitt bei 44 Prozent.
• Die wichtigsten Ergebnisse der Studie (Referate von Dr. Kai Behrens und Prof. Dr. Heinz Rothgang) GEK Digitale Pressemappe zum Pflegereport
• Die Buchveröffentlichung (PDF, 318 Seiten): Heinz Rothgang, Lars Borchert, Rolf Müller, Rainer Unger: GEK-Pflegereport 2008. Schwerpunktthema: Medizinische Versorgung in Pflegeheimen
Gerd Marstedt, 18.11.08
Häusliche Pflege zwischen Traum und Alptraum: Weit unterschätzt, weiblich aber wie lange noch!?
 Im Alter will speziell in Deutschland eigentlich niemand in ein Altersheim. Trotz des gegenläufigen kräftigen Anstiegs der Zahl von Pflegeheimbewohnern um 17,4 % zwischen 2000 und 2006, wurden 2005 immer noch fast 70 % der offiziell pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt - und dies unter starker Beteiligung von engen meist weiblichen Angehörigen.
Im Alter will speziell in Deutschland eigentlich niemand in ein Altersheim. Trotz des gegenläufigen kräftigen Anstiegs der Zahl von Pflegeheimbewohnern um 17,4 % zwischen 2000 und 2006, wurden 2005 immer noch fast 70 % der offiziell pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt - und dies unter starker Beteiligung von engen meist weiblichen Angehörigen.
So sicher also die "dominierende Form der heutigen Versorgung von Pflegebedürftigen ... die häusliche familiäre Betreuung durch Frauen" ist, so wenig finden sich im Rahmen offizieller Statistiken oder in der politischen Debatte fundierte Daten über die Bedingungen und vor allem die Zukunftsfähigkeit dieser häuslichen Pflegeform für 2005 1,45 Millionen Menschen.
Im Rahmen ihres Zukunftsprojekts 2020 ließ daher die Friedrich-Ebertstiftung (FES) durch die Studie "Gender in der Pflege. Herausforderungen für die Politik" von Gertrud M. Backes, Ludwig Amrhein und Martina Wolfinger (WiSo-Diskurs der Friedrich-Ebertstiftung August 2008) auf 72 Seiten etwas mehr Licht in dieses Dunkel bringen.
Die wichtigsten Erkenntnisse lauten:
• "Der Umfang der häuslichen Pflegearbeit wird im extremen Maße unterschätzt: Die Daten über die Lebenssituation pflegender Angehöriger sind völlig unzureichend, das spiegelt die gesellschaftliche Zuordnung zum privaten Raum wider, die privat pflegende Person wird amtlich unsichtbar gemacht. Dennoch weiß man, dass sie im Durchschnitt 36,7 Wochenstunden oder 5,2 Stunden am Tag pflegt. Der Umfang dieser Pflegearbeit ist so groß, dass die Schaffung von 3,2 Millionen Erwerbsarbeitsplätzen in Vollzeit möglich wäre. Der Wert dieser Arbeit kann mit 44 Milliarden Euro angesetzt werden, wenn man ein mittleres Lohnniveau unterstellt. Die Absicherung für diese Arbeit ist völlig unzureichend, denn über die Pflegeversicherung werden pro Tag nur 0,5 bis 1,8 Stunden Pflegearbeit fi nanziert. Das Verhältnis der privat Pflegenden zu den professionell Pflegenden beträgt drei zu eins.
• Die geschlechtliche Ungleichheit zeigt sich bei Pflegenden und bei Gepflegten: Die Pflegenden sind überwiegend weiblich: Zwei Drittel der unbezahlten Pflegearbeiten werden von Frauen, ein Drittel von Männern geleistet. 90 % der Pflegepersonen, die über die Pflegeversicherung sozialversichert sind, sind Frauen. Der Anteil der Männer an den Hauptpflegepersonen ist in den letzten Jahren allerdings gestiegen, wenn auch die Männer eher Pflegemanagementaufgaben als direkte Pflegearbeiten übernehmen. Die gesellschaftliche Tabuisierung der weiblichen Sorgearbeit für Pflegebedürftige führt dazu, dass auch die "atypische" Pflegeleistung der Männer gering geschätzt wird, sie sind aber in der Pflege bereits eine quantitativ bedeutsame Minderheit. Aber auch im Blick auf die zu Pflegenden fallen Geschlechterdifferenzen und Ungleichheiten auf: Alte und hochaltrige Männer verfügen in der Regel über Partnerinnen, die sie pflegen, alten und hochaltrigen Frauen fehlt in der Regel dieser Partner, weil er oft bereits verstorben ist.
• Die Pflegeversicherung stabilisiert die Geschlechterhierarchien: Die sozialpolitischen Regelungen zur Pflegearbeit verstärken die Polarisierung und Hierarchisierung im Geschlechterverhältnis. Das hier angewandte Subsidiaritätsprinzip in der Pflege führt zu einer Verstärkung der geschlechtsbezogenen Macht- und Ungleichheitsstrukturen im Feld der Altenpflege. Die heutige Gestaltung der Pflegeversicherung ist einem familiaristischen Bild verpflichtet, das dem männlichen Haupternährer und der Hausfrau und Mutter, später der weiblichen Hauptpflegeperson entspricht. Das durch die Pflegeversicherung gezahlte Pflegegeld hat nicht den Status von Entlohnung, gilt aber als Anreiz zur privaten Pflegearbeit und ist damit dem von konservativer Seite stark verteidigten Betreuungsgeld für die private Kleinkinderziehung vergleichbar. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Pflege von Angehörigen als Frauenarbeit wahrgenommen wird, nimmt real jedoch ab. ...
• Professionelle Pflege ist durch Geschlechterhierarchie gekennzeichnet: Die Pflegearbeit selbst ist geschlechtsbezogen zugeordnet: Die direkte Pflege des Körpers ist weiblich, die Managementaufgaben in der Pflege sind männlich konnotiert und besetzt. Das Pflegesystem gilt als weiblich und steht in der Anerkennung und der Bezahlung unter dem medizinischen System. Typische Merkmale für die Diskriminierung von Frauenarbeit kennzeichnen das Feld: Unterbezahlter Qualifikationseinsatz bei extremer Belastung, Teilzeitarbeit, prekäre Beschäftigung und die Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Migrantinnen. ... Schon heute lässt sich ein eklatanter Mangel an Fachkräften in diesem typischen Frauenberuf feststellen, und die gegenwärtige Anzahl der Auszubildenden liegt weit unter dem absehbaren Bedarf. Und diese Bedarfsberechnungen beziehen die notwendigen Verschiebungen von privater zu professioneller Arbeit noch nicht mit ein."
Die vorgelegte Expertise will ein erster Schritt sein, die Bedeutung des Geschlechts für die Zuordnung und Bewertung von Arbeit bewusst zu machen und dafür zu sensibilisieren. Der schon jetzt wahrnehmbare Wandel in den Geschlechterverhältnissen muss jedoch einen Wandel in der Gestaltung dieser Arbeit nach sich ziehen. Gelingt dies nicht, wird ein wachsender Teil der Pflegebedürftigen wahrscheinlich zukünftig nicht mehr auf eine ausreichende Anzahl von pflegewilligen und -fähigen Personen treffen und nicht mehr um das Pflegeheim herumkommen.
Die 72-seitige Studie "Gender in der Pflege. Herausforderungen für die Politik" ist kostenlos über die Homepage der Ebertstiftung erhältlich.
Bernard Braun, 9.10.2008
"End-of-life"-Gespräche von Todkranken mit Ärzten und Angehörigen nutzen allen.
 Wie bei vielen anderen Behandlungsanlässen auch, scheinen Gespräche, die zwischen Schwerkranken, ihren Ärzten und nächsten Angehörigen in der wahrscheinlich letzten Lebensphase stattfinden, allen Beteiligten körperlich und seelisch zu helfen.
Wie bei vielen anderen Behandlungsanlässen auch, scheinen Gespräche, die zwischen Schwerkranken, ihren Ärzten und nächsten Angehörigen in der wahrscheinlich letzten Lebensphase stattfinden, allen Beteiligten körperlich und seelisch zu helfen.
Dies zeigen jedenfalls die gerade im US-Medizinjournal JAMA (JAMA. 2008;300(14):1665-1673) veröffentlichten Ergebnisse einer Studie mit 330 todkranken Menschen und ihren um sie Sorge tragenden Personen im Zeitraum von 2002 bis 2008. Über ein Drittel dieser Patienten berichtete davon, so genannte Lebensabschiedsgespräche ("end-of-life discussions") mit ihren Ärzten gehabt zu haben.
Die wesentlichen Ergebnisse im Vergleich mit den Patienten, die keine derartigen Gespräche geführt haben, sahen so aus:
• Die Patienten mit derartigen Gesprächen waren nicht depressiver als die Angehörigen der Kontrollgruppe und auch ihre Behandlung war nicht schwieriger.
• Nach einer Adjustierung beider Gruppen mit wesentlichen soziodemografischen Merkmalen war eine aggressivere medizinische Versorgung hochsignifikant mit einer schlechteren Lebensqualität der Patienten assoziiert.
• Die Gesprächsgruppen-Patienten erhielten in der letzten Woche ihres Lebens weniger aggressive Therapien wie beispielsweise künstliche Beatmung, Wiederbelebungen oder Verlegungen in Intensivstationen.
• Sie wurden auch früher in Hospize aufgenommen, was mit einer besseren Lebensqualität verbunden war.
• Die informellen, nichtprofessionellen Pflegepersonen wie etwa der Ehepartner oder erwachsene Kinder berichteten 6 Monate nach dem Tod ihres Angehörigen weniger Depressionen oder andere Trauerprobleme, wenn die Verstorbenen keine aggressive "end-of-life"-Behandlung bekommen hatten. Umgekehrt hatten trauernde Pflegepersonen ohne solche Gespräche ein wesentlich höheres Risiko an schweren Depressionen zu erkranken.
Die Forscher stellten zusammenfassend fest: "There appears to be a need to increase the frequency of these conversations."
Ein Abstract des Aufsatzes "Associations Between End-of-Life Discussions, Patient Mental Health, Medical Care Near Death, and Caregiver Bereavement Adjustment" von Alexi A. Wright, Baohui Zhang, MS; Alaka Ray, Jennifer W. Mack, Elizabeth Trice, Tracy Balboni, Susan L. Mitchell, Vicki A. Jackson, Susan D. Block, Paul K. Maciejewski und Holly G. Prigerson gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 8.10.2008
Deutsche zweifeln an der Qualität stationärer Pflege, noch mehr Probleme bereitet jedoch deren Finanzierbarkeit
 Drei von vier Deutschen befürchten, dass stationäre Pflegedienste für sie persönlich finanziell nicht erschwinglich sind. Überdies beurteilen 35% der Ostdeutschen und 42% der Westdeutschen die Qualität der stationären Pflege als schlecht. Schlechter als in Westdeutschland wird die Qualität der stationären Pflege nur in den osteuropäischen Ländern sowie in Griechenland und Italien bewertet. Zu diesen Ergebnissen kommt das Zentrum für Sozialindikatorenforschung von GESIS-ZUMA in Mannheim in einer Studie über Einstellungen zur Pflege in Deutschland und Europa. Grundlage der Studie sind Daten der Eurobarometer-Umfrage von 2007 in der über 26.000 Bürger in der EU zur Pflegesituation in ihrem Land befragt wurden.
Drei von vier Deutschen befürchten, dass stationäre Pflegedienste für sie persönlich finanziell nicht erschwinglich sind. Überdies beurteilen 35% der Ostdeutschen und 42% der Westdeutschen die Qualität der stationären Pflege als schlecht. Schlechter als in Westdeutschland wird die Qualität der stationären Pflege nur in den osteuropäischen Ländern sowie in Griechenland und Italien bewertet. Zu diesen Ergebnissen kommt das Zentrum für Sozialindikatorenforschung von GESIS-ZUMA in Mannheim in einer Studie über Einstellungen zur Pflege in Deutschland und Europa. Grundlage der Studie sind Daten der Eurobarometer-Umfrage von 2007 in der über 26.000 Bürger in der EU zur Pflegesituation in ihrem Land befragt wurden.
In den osteuropäischen Mitgliedsstaaten ist der Zugang zu Pflegediensten nach Aussagen der Befragten wesentlich schwieriger als in den übrigen EU-Ländern. Rund drei Viertel der Bulgaren, Tschechen, Slowaken und Ungarn klagen über ziemlich oder sehr schwierige Zugangsmöglichkeiten zu ambulanter Pflege. In den skandinavischen Ländern und den Benelux-Staaten hingegen, wo ambulante Pflegedienste besonders stark bevorzugt werden, wird der Zugang zu ambulanter Pflege wesentlich besser beurteilt. Deutschland ist hier gespalten: Während nur 32% der Westdeutschen - und damit deutlich weniger als der EU-Durchschnitt von 43% - den Zugang zu ambulanter Pflege als schwierig bezeichnen, wird mit 47 % die Versorgung in Ostdeutschland besonders schlecht bewertet.
Unabhängig von den Zugangsmöglichkeiten werden in Deutschland stationäre und ambulante Pflegedienste zudem häufiger für unerschwinglich gehalten als im EU-Durchschnitt: 55% der Deutschen betrachten ambulante Dienste als zu teuer. Noch dramatischer fällt hierzulande das Urteil über Pflegeheime aus: Rund 75% der Deutschen halten die stationären Dienste für nicht erschwinglich.
Obwohl die ambulanten Pflegedienste in Deutschland häufig als nicht erschwinglich angesehen werden, wird jedoch weitaus seltener an deren Qualität gezweifelt: 71% der West- und 76% der Ostdeutschen halten die Qualität der ambulanten Pflege für "ziemlich gut" bis "sehr gut", während der EU-Durchschnitt bei 65% liegt. Ganz anders fällt der Befund für stationäre Pflegedienste aus. 35% der Ostdeutschen und sogar 42% der Westdeutschen beurteilen die Qualität der stationären Pflege als "ziemlich schlecht" oder "sehr schlecht". Schlechter als in Westdeutschland wird die Qualität der stationären Pflege damit nur in den osteuropäischen Ländern sowie in Griechenland und Italien bewertet. Die Vermutung liegt nahe, dass die Skepsis der Deutschen mit tatsächlichen Mängeln in der stationären Pflege in Zusammenhang steht. In der politischen Diskussion steht die Qualitätssicherung ambulanter Pflegedienste gegenwärtig im Mittelpunkt, während aus Sicht der Bevölkerung aber vor allem in der stationären Pflege Handlungsbedarf besteht.
Der Aufsatz zur Studie steht hier im Volltext zur Verfügung: Jörg Dittmann : Deutsche zweifeln an der Qualität und Erschwinglichkeit stationärer Pflege (gesis Informationsdienst Soziale Indikatoren, ISI 40, Ausgabe 40, Juli 2008)
Gerd Marstedt, 8.8.2008
"Helle Köpfe" im Altersheim: Licht besser als Hormone zur Behandlung von dementiellen Erscheinungen und Depressionen geeignet.
 Zu den Absonderlichkeiten eines medikalisierenden bzw. medikalisierten Umgangs mit gesundheitlichen Problemen gehört das häufig durch kommerzielle Anbieterinteressen geförderte Verdrängen von Methoden, die im Alltagsleben evident und praktisch erfolgreich sind, durch pharmakologische oder vergleichbare Interventionen und Stoffe.
Zu den Absonderlichkeiten eines medikalisierenden bzw. medikalisierten Umgangs mit gesundheitlichen Problemen gehört das häufig durch kommerzielle Anbieterinteressen geförderte Verdrängen von Methoden, die im Alltagsleben evident und praktisch erfolgreich sind, durch pharmakologische oder vergleichbare Interventionen und Stoffe.
Einen kleinen aber guten Beleg für diese Art einer letztendlich als Fehlversorgung charakterisierbaren Handlungsweise liefert eine gerade abgeschlossene und in der US-Fachzeitschrift "Journal of American Medical Association (JAMA)" (JAMA 2008; 299: 2642-2655) veröffentlichte Studie über unterschiedliche Methoden, dementielle Erscheinungen und Depressionen bei BewohnerInnen von Pflegeheimen zu therapieren.
In den USA und zunehmend auch in Europa wird hierzu die Einnahme des körpereigenen Hormons Melatonin erwogen oder auch umgesetzt, das nachweisbar an der Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus beteiligt ist. Störungen dieses Rhythmus mit den dabei u.a. auftretenden Schlafstörungen gelten als mögliche Mitverursacher für Depressionen und für das bei dementen Personen häufig zu beobachtende aggressive Verhalten.
Eine Gruppe niederländischer Wissenschaftler hat nun in einer randomisierten Studie mit 189 Bewohnern, die durchschnittlich 86 Jahre alt waren, zu 90% weiblich und zu 87% dement waren, die Wirkung von Melatonin mit der anderer Therapie- oder Präventionsmöglichkeiten verglichen. Bei der alternativen Intervention handelt es sich um die Übernahme einer alltagserprobten Form zur Bewältigung von so genannten "Winterdepressionen" in nordischen Ländern durch den intensiven therapeutischen Einsatz hellen Lichts.
Dazu installierten die Wissenschaftler in den Gemeinschaftsräumen von 12 Pflegeheimen Leuchtkörper. In 6 der Heimen strahlten die Leuchtmittel von neun Uhr morgens bis sechs Uhr abends mit der sehr hohen Lichtstärke von 1.000 Lux. In den anderen Heimen war die Lichtleistung auf 300 Lux gedimmt. Zusätzlich erhielten zufällig ausgewählte BewohnerInnen in beiden Heimtypen noch Melatonin und ein Placebo zur Einnahme.
Nach 3 Jahren Versuchszeit zwischen 1999 und 2004 zeigen sich klare und eindeutige Ergebnisse:
• Die Lichttherapie verringerte die Abnahme der kognitiven Leistungen im so genannten "Mini-Mental-Status-Test" um 5%. Noch günstiger waren die Auswirkungen auf die depressiven Symptome. Sie verschlechterten sich zwar in beiden Gruppen, aber bei Lichtexposition doch um 19 % weniger. Bei den Verrichtungen des täglichen Lebens ergab sich sogar ein Unterschied von 53 % zugunsten der Lichttherapie-Gruppe.
• Die Melatonintherapie erfüllte dagegen nicht die Erwartungen. Die Senioren waren insgesamt nicht ausgeschlafener, d.h. die tägliche Melatonintherapie erleichterte ihre Pflege nicht.
• Nur wenn Melatonin und Lichttherapie kombiniert wurden, war ein positiver Effekt der Hormontherapie erkennbar. Das aggressive Verhalten der Heimbewohner war um 9 % reduziert. Ob dies den Einsatz von Melatonin bei Heimbewohnern rechtfertigt, dürfte aber offen bleiben.
Da an den Vorteilen der Lichttherapie kein Zweifel besteht und sie außerdem nebenwirkungsfrei und in allen Wohneinrichtungen leicht umzusetzen ist, fällt nämlich ein kritischer Umstand der Melatonintherapie umso stärker ins Gewicht: Melatonin ist zwar ein körpereigenes Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen beeinflusst. Es ist aber in Deutschland und anderen europäischen Ländern wegen seiner möglicherweise unerwünschten Nebenwirkungen nicht als Arzneimittel zugelassen und auch in den USA nur als Nahrungsergänzungsmittel auf dem legalen Markt.
Das Abstract des Aufsatzes " Effect of Bright Light and Melatonin on Cognitive and Noncognitive Function in Elderly Residents of Group Care Facilities. A Randomized Controlled Trial" von Rixt F. Riemersma-van der Lek, Dick F. Swaab, Jos Twisk, Elly M. Hol, Witte J. G. Hoogendijk und Eus J. W. Van Someren ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.6.2008
Altenheimpflege: Steigende Probleme, lückenhafte medizinische Versorgung und hoher Anteil von Freiheitseinschränkungen.
 Ende 2005 lebten in Deutschland rund 750.000 Menschen in vollstationären Altenheimen. Dies bedeutet seit 1994 (in diesem Jahr wurde die MuG II-Studie durchgeführt) einen Anstieg um 52%. Die Zahl der häuslich betreuten Pflegebedürftigen hat sich im gleichen Zeitraum um 18% von etwa 1,2 Mio. auf etwas über 1,4 Mio. Personen in einem im Vergleich etwas geringerem Ausmaß erhöht.
Ende 2005 lebten in Deutschland rund 750.000 Menschen in vollstationären Altenheimen. Dies bedeutet seit 1994 (in diesem Jahr wurde die MuG II-Studie durchgeführt) einen Anstieg um 52%. Die Zahl der häuslich betreuten Pflegebedürftigen hat sich im gleichen Zeitraum um 18% von etwa 1,2 Mio. auf etwas über 1,4 Mio. Personen in einem im Vergleich etwas geringerem Ausmaß erhöht.
Angesichts der demografischen Entwicklung und unter der Annahme, dass es auch künftig keine alternativen Versorgungsmöglichkeiten geben wird, dürfte sich die Anzahl dieser Personen mit erheblichem Pflegebedarf noch deutlich erhöhen.
Damit wird auch eine differenziertere Kenntnis der konkreten individuellen Versorgungsbedarfe und der weiteren Umstände der Altenheimversorgung wichtiger als bisher.
Die im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend u.a. von TNS Infratest durchgeführte und im November 2007 der Öffentlichkeit vorgestellte Studie "Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung in stationären Einrichtungen (MuG IV)" legt für die weitere Diskussion und Versorgungsplanung einen wichtigen Grundstein.
Sie basiert u.a. auf Ergebnissen einer Befragung von insgesamt 4.229 Bewohnern aus 609 Alteneinrichtungen in Deutschland, einer fallstudiengestützten Vertiefungsstudie und einer Analyse von Pflegedokumentationen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• 85% der BewohnerInnen sind pflegebedürftig und beziehen Leistungen der Pflegeversicherung. Dieser Anteil betrug 1994 erst 63%.
• Etwa 69 % der Bewohner leiden an einem Demenzsyndrom. Ihre sehr unterschiedlichen Bedarfslagen werden allerdings in der Breite nach wie vor nicht hinreichend identifiziert und entsprechend berücksichtigt. Rund ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner wird von den Pflegekräften als zeitlich und/oder räumlich unzureichend orientiert charakterisiert für die die Notwendigkeit für eine dauernde Überwachung besteht. Im Jahr 1994 wurde dies erst für 14% der Bewohnerinnen und Möglichkeiten und Bewohner berichtet. Eine gesetzliche Betreuung wird für 54% angegeben. Im Jahr 1994 traf dies auf 30% zu.
• Etwas mehr als ein Fünftel (22 %) der Heimbewohner verstirbt innerhalb der ersten sechs Monate und insgesamt etwa ein Drittel (31 %) innerhalb des ersten Jahres nach dem Einzug in das Heim. Ebenfalls ein Fünftel (22 %) lebt allerdings auch fünf Jahre oder sogar noch länger im Heim. Im Vergleich zu 1994 ist die Verweildauer rückläufig (im Durchschnitt 41 Monate zu früher 56 Monaten).
• Gestiegen ist der Anteil der Einzelzimmer. Im Vergleich zu 54 % im Jahr 1994 bewohnen inzwischen mit 64 % immerhin zwei von drei Bewohnern ein Einbettzimmer.
• Angesichts der fachlich unbestrittenen hohen Bedeutung einer möglichst selbständigen Lebensführung dieses Personenkreises ist die Sorge der Autoren der Studie über den nach wie vor hohen Anteil von pflegebedürftigen Bewohnern, die - zumindest zeitweise - unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln fixiert werden nachvollziehbar und berechtigt. Dieser hohe Anteil spricht dafür, dass die pflegerische Versorgung die neuen, auf Prävention und Rehabilitation oder Selbstbestimmung und Selbständigkeit ausgerichteten Standards bisher noch unvollkommen umgesetzt hat.
In der Zusammenfassung der Studie heißt es dazu wörtlich: "Der nach wie vor hohe Anteil von pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, die zumindest zeitweise unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln fixiert werden (33% durch Bettgitter, 5% körpernah durch Vorsatztische und ähnliches bzw. 34% insgesamt bezogen auf die letzten 4 Wochen), spricht allerdings dafür, dass die pflegerische Versorgung eher konventionell und weniger im Sinne neuer, auf Prävention und Rehabilitation oder Selbstbestimmung und Selbständigkeit ausgerichteter Standards vollzogen wird. Hierbei lässt sich für den Bereich der Betreuung von Demenzkranken zeigen, das die Wahrscheinlichkeit der Anwendung bewegungs- und freiheitseinschränkender Maßnahmen (Bettseitenteil, Stecktisch, Fixiergurt) durch den Einsatz von gerontopsychiatrischen Fachkräften spürbar gesenkt werden kann (Ergebnisse der Vertiefungsstudie)."
• Damit verknüpft, wenn nicht sogar maßgeblich verantwortlich ist die Personalsituation bzw. die Qualifikationsstruktur des vorhandenen Personals: Der Personalbestand hat sich zwischen 1994 und 2005 nur auf den ersten Blick erhöht. Berücksichtigt man z. B. den gestiegenen Pflegebedarf, kommt man zu dem Schluss der Studie, "dass der Personalbestand im letzten Jahrzehnt relativ betrachtet eher konstant auf dem damaligen Niveau verharrt haben dürfte." Zwar hat sich die Qualifikationsstruktur in den letzten Jahren ein wenig verbessert, was aber nicht weiterhin Mängel in zahlreichen Einrichtungen ausschließt. Im Vergleich zu 47 % im Jahr 1994 gehören inzwischen 54 % der Pflegekräfte zur Gruppe der examinierten Fachkräfte. Die im Heimgesetz festgelegte Fachkraftquote wird aber von nicht mehr als 73 % der Einrichtungen erreicht.
• Für verbesserungsbedürftig halten die AutorInnen außerdem noch die Organisation der medizinischen Versorgung. Dazu die Zusammenfassung der Ergebnisse: "Die medizinische Versorgung wird im Bedarfsfall durch niedergelassene Ärzte erbracht. Nicht mehr als 18% der Einrichtungen haben hierzu allerdings feste Vereinbarungen getroffen (1994: 38%). Gewährleistet ist die Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln. Heilmittel und Funktionstherapien werden ebenfalls verordnet. An der Spitze steht die Krankengymnastik oder Bewegungstherapie, die 41% der Bewohnerinnen und Bewohner (1994: 35%) in den letzten 12 Monaten erhalten haben. Rückläufig ist hingegen, trotz eines unverminderten Bedarfs, der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner mit Ergotherapie (21% in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu 38% in 1994) sowie die Versorgung mit Massagen, medizinischen Bädern oder Elektrotherapie (9% in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu 15% im Jahr 1994)."
• Zunächst uneingeschränkt positiv erscheint der Anteil der von informellen HelferInnen aus Angehörigen und Bekannten getragenen alltäglichen sozialen Betreuung in den Altenheimen: "So gut wie jede/r zweite Bewohner/in (47%) wird im Wochenverlauf von Verwandten besucht. Darüber hinaus erhalten 12% im Wochenverlauf und weitere 13% monatlich Besuche von Freunden oder Bekannten. Es überrascht von daher nicht, dass vor allem die alltägliche soziale Betreuung in Altenheimen von Verwandten und Bekannten sowie von freiwilligen Helfern als externen Akteuren maßgeblich mitgetragen wird. Die persönliche Einbindung wirkt dabei nicht nur als soziale Betreuung sondern ist auch mit der Erbringung von konkreten Versorgungsleistungen verbunden. 9% erhalten täglich und weitere 27% ab und an in der Woche Hilfe- oder Pflegeleistungen von eigenen Verwandten. 2% erhalten täglich Hilfen von eigenen Freunden und Bekannten und 9% ab und an in der Woche. Hinzu kommen selber engagierte Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, von denen 10% täglich und weitere 8% ab und an in der Woche Hilfeleistungen erhalten. Von freiwilligen Helfern erhalten 2% täglich und weitere 14% ab und an in der Woche Versorgungsleistungen."
Auch wenn die Zahlen gegen das Vorurteil spricht, ältere pflegebedürftige Menschen würden ins Altenheim abgeschoben, könnte ein Teil des Engagement natürlich auf von den Angehörigen massiv wahrgenommenen eklatanten Versorgungslücken beruhen, die sie zu stopfen versuchen. Dafür spricht etwas, dass es nur in 46% der untersuchten Einrichtungen ein explizites Konzept zur Angehörigenarbeit gibt.
Kostenfrei erhältlich sind
• eine 16-seitige Zusammenfassung und
• der 350 Seiten umfassende Integrierte Abschlussbericht "Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung in stationären Einrichtungen (MuG IV) - Demenz, Angehörige und Freiwillige, Versorgungssituation sowie Beispielen für "Good Practice".
Bernard Braun, 7.5.2008
Pflegekräfte - leichte Beute für die Pharmazeutische Industrie?
 In ihrer Studie "Soft Targets: Nurses and the Pharamceutical Industry" gehen die australischen Autoren Annemarie Jutel und David B. Menekes der Frage nach, wie die Pharmazeutische Industrie auf die Pflege Einfluss nimmt und wie die Pflege darauf reagiert. Ihre Literaturrecherche erbrachte lediglich sieben empirische Untersuchungen, weitere 25 Arbeiten befassten sich mit theoretischen Fragen oder stellten Kommentare oder Meinungsäußerungen dar. Somit kann die Studie weder ein umfassendes noch ein repräsentatives Bild zeichnen. Deutlich wird, dass sich eine Reihe von Aspekten aus dem gut erforschten Verhältnis von Ärzten und Industrie auf die Pflege übertragen lassen. Sowohl die Strategien der Einflussnahme als auch die Reaktion der Pflegekräfte ähneln sich stark. Die Pflege ist von der Industrie als Gruppe mit zunehmendem Einfluss auf die Auswahl von Produkten und Dienstleistungen erkannt, was Fachzeitschriften wie Nursing Standard zur Akquise von Inseraten nutzen.
In ihrer Studie "Soft Targets: Nurses and the Pharamceutical Industry" gehen die australischen Autoren Annemarie Jutel und David B. Menekes der Frage nach, wie die Pharmazeutische Industrie auf die Pflege Einfluss nimmt und wie die Pflege darauf reagiert. Ihre Literaturrecherche erbrachte lediglich sieben empirische Untersuchungen, weitere 25 Arbeiten befassten sich mit theoretischen Fragen oder stellten Kommentare oder Meinungsäußerungen dar. Somit kann die Studie weder ein umfassendes noch ein repräsentatives Bild zeichnen. Deutlich wird, dass sich eine Reihe von Aspekten aus dem gut erforschten Verhältnis von Ärzten und Industrie auf die Pflege übertragen lassen. Sowohl die Strategien der Einflussnahme als auch die Reaktion der Pflegekräfte ähneln sich stark. Die Pflege ist von der Industrie als Gruppe mit zunehmendem Einfluss auf die Auswahl von Produkten und Dienstleistungen erkannt, was Fachzeitschriften wie Nursing Standard zur Akquise von Inseraten nutzen.
Die empirischen Arbeiten zeigen, dass die befragten Pflegekräfte sich ziemlich offen gegenüber der Industrie verhalten. Eine große Mehrzahl bejaht und pflegt Kontakte zu Pharmavertretern. In der jeweiligen Befragung hatten z.B. 88 Prozent keine Bedenken gegen die Annahme von Geschenken, 82 Prozent betrachten Direktwerbung der Industrie (direct to consumer advertising) als Patienteninformation. Pflegekräfte, die Medikamente verschreiben dürfen (wie z.B. in England) betrachten Pharmavertreter als wichtige Informationsquelle und geben an, sich davon beeinflussen zu lassen. Nur eine kleine Minderheit äußert grundsätzliche Bedenken.
Ein buntes Bild ergeben die Kommentare und Meinungsäußerungen. Das Spektrum reicht von vollständiger Gleichsetzung der Interessen von Industrie und Pflege bis zur grundsätzlichen Ablehnung jeglicher Einflussnahmeversuche. Manche Pflegekräfte betrachten die Zuwendung der Industrie mit der Erschließung neuer Informationskanäle als Emanzipation von ärztlicher Dominanz, andere scheinen es als Kränkung zu empfinden, wenn sie keinen Besuch von Pharmavertretern erhalten.
Jutel und Menekes vermissen einen Aufschrei der Pflege gegen die Einflussnahme der Industrie. Sie erklären die positive Haltung ihrer KollegInnen mit Ausbildungsmängeln und daraus folgendem unzureichendem Wissen über Bereiche wie Marketingstrategien der Industrie, Psychologie der Beeinflussung, evidenzbasierte Medizin und kritische Bewertung von Studien und Gesundheitsinformationen.
Als Lösung schlagen die Autoren u.a. eine verbesserte Ausbildung in den genannten Bereichen vor sowie klare Strategien und Richtlinien innerhalb der Einrichtungen.
Studie im Volltext.
Soft Targets: Nurses and the Pharmaceutical Industry, PLoS Medicine Februar 2008
David Klemperer, 28.2.2008
Radikale Reform zur Pflege Behinderter in England: Betroffene erhalten persönliches Geldbudget zur Finanzierung ihrer Pflege
 Die britische Regierung hat ein Programm für chronisch Erkrankte und Behinderte beschlossen, das ab April 2008 eine neue Ära in der Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe einleitet. Alle Anspruchsberechtigten werden dann über ein persönliches Finanzbudget verfügen und können selbst bestimmen, welche Art von Dienstleistungen, Pflege oder medizinischer Versorgung sie bei welcher Einrichtung erhalten wollen. Das Programm mit der Bezeichnung "Putting People First" (etwa: "Auf die Menschen kommt es an") hat bereits eine Erprobungsphase in einigen Kreisen und Gemeinden hinter sich. Ab 2008 sollen dafür dann drei Jahre lang 520 Millionen Pfund (etwa 720 Millionen Euro) zur Verfügung stehen.
Die britische Regierung hat ein Programm für chronisch Erkrankte und Behinderte beschlossen, das ab April 2008 eine neue Ära in der Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe einleitet. Alle Anspruchsberechtigten werden dann über ein persönliches Finanzbudget verfügen und können selbst bestimmen, welche Art von Dienstleistungen, Pflege oder medizinischer Versorgung sie bei welcher Einrichtung erhalten wollen. Das Programm mit der Bezeichnung "Putting People First" (etwa: "Auf die Menschen kommt es an") hat bereits eine Erprobungsphase in einigen Kreisen und Gemeinden hinter sich. Ab 2008 sollen dafür dann drei Jahre lang 520 Millionen Pfund (etwa 720 Millionen Euro) zur Verfügung stehen.
Der Gedanke der Selbstbestimmung Behinderter über die für sie nötigen und unnötigen Leistungen im Bereich von Pflege, Haushaltshilfe oder medizinischer Versorgung spielt für die Initiative eine große Rolle. Womöglich noch bedeutsamer ist aber das Motiv, hier über die Entscheidungen der Betroffenen mehr Wettbewerb bei Pflegeeinrichtungen in Gang zu setzen und damit auch Kosten einzusparen. Eine Studie hatte unlängst gezeigt, dass über 60 Prozent der Sozialleistungen für Behinderte an stationäre Pflegeeinrichtungen gehen, obwohl eine solche Unterbringung für viele Ältere und chronisch Erkrankte weder medizinisch notwendig ist noch persönlich gewünscht wird.
Kernstück des Vorhabens ist ein persönliches Finanzbudget für alle Betroffenen, aus dem sie ihre persönlichen Bedürfnisse im Bereich der Pflege und sozialen Betreuung bezahlen. In bestimmten Fällen kann dieses Budget auch in bar ausgezahlt werden, in der Regel dürfte zukünftig aber in Absprache mit Sozialarbeiten oder Ärzten der jeweiligen Gemeinde festgelegt werden, welche Leistungen medizinisch notwendig und persönlich erwünscht sind, ferner, von welcher Einrichtung oder welchen Personen dies geleistet werden soll.
Aufgrund dieser Festlegung werden dann von der Gemeinde aus dem Konto des Behinderten entsprechende Zahlungen geleistet. Den Betroffenen soll es dann auch möglich sein, sich für ein betreutes Wohnen, eine ambulante Pflege oder Haushaltshilfe anstelle der stationären Unterbringung in einem Pflegeheim zu entscheiden und auch die Dienstleistungs- oder Versorgungseinrichtung selbst auszuwählen. In diesem Rahmen sind dann auch Details aushandelbar, wie der zeitliche Umfang der Pflege, der Einkauf von Notrufdiensten und -apparaten oder der Zeitpunkt bestimmter Hilfen in der Wohnung.
Hier sind Berichte der Tageszeitung "The Guardian":
• Revolution in home care for old people
• Disabled to get cash to choose care options
• Hier ist die Publikation der britischen Regierung zum Vorhaben: HM Government: Putting People First. A shared vision and commitment to the transformation of Adult Social Care
Gerd Marstedt, 10.12.2007
Die Zahl der Pflegekräfte in Kliniken hat direkten Einfluss auf die Patientensicherheit
 Nach Befunden der Studie "Pflege-Thermometer 2007" wurden seit 1995 rund 50.000 Pflegestellen in bundesdeutschen Kliniken abgebaut, während gleichzeitig die Zahl der hauptamtlich tätigen Klinikärzte um 20 Prozent gestiegen ist. Heute müssen in den Kliniken pro Jahr etwa eine Million Patienten mehr als 1995 medizinisch versorgt und pflegerisch betreut werden, die Patienten-Pflegekraft-Quote hat sich um 23 Prozent erhöht (vgl. "Massiver Abbau von Pflegepersonal in Kliniken: Eine Gefahr für die Patientensicherheit?"). Ob dieser Trend des Abbaus von Pflegepersonal in Anbetracht des zunehmenden Wettbewerbsdrucks zwischen Krankenhäusern so anhält, ist nicht mit Sicherheit vorhersagbar. Dass eine Verschlechterung des Personalbestands in der Krankenpflege allerdings massive Negativauswirkungen auf die Versorgungsqualität und die Patientensicherheit hat, wurde jetzt erneut durch zwei Studien aufgezeigt.
Nach Befunden der Studie "Pflege-Thermometer 2007" wurden seit 1995 rund 50.000 Pflegestellen in bundesdeutschen Kliniken abgebaut, während gleichzeitig die Zahl der hauptamtlich tätigen Klinikärzte um 20 Prozent gestiegen ist. Heute müssen in den Kliniken pro Jahr etwa eine Million Patienten mehr als 1995 medizinisch versorgt und pflegerisch betreut werden, die Patienten-Pflegekraft-Quote hat sich um 23 Prozent erhöht (vgl. "Massiver Abbau von Pflegepersonal in Kliniken: Eine Gefahr für die Patientensicherheit?"). Ob dieser Trend des Abbaus von Pflegepersonal in Anbetracht des zunehmenden Wettbewerbsdrucks zwischen Krankenhäusern so anhält, ist nicht mit Sicherheit vorhersagbar. Dass eine Verschlechterung des Personalbestands in der Krankenpflege allerdings massive Negativauswirkungen auf die Versorgungsqualität und die Patientensicherheit hat, wurde jetzt erneut durch zwei Studien aufgezeigt.
In einer Meta-Analyse wurden insgesamt 28 schon veröffentlichten Studien neu ausgewertet, die den Zusammenhang zwischen der Personalausstattung im Pflegebereich und verschiedenen Indikatoren zur Patientensicherheit untersucht hatten. Als Ergebnis der Meta-Analyse, die von Wissenschaftler der Minnesota School of Public Health durchgeführt und jetzt in der Zeitschrift "Medical Care" veröffentlicht wurde, zeigte sich:
• Eine höhere Personalausstattung geht einher mit reduzierten Mortalitätsraten der Patienten. Das Mortalitätsrisiko beträgt bei Kliniken mit guter Personalausstattung nur 91% in Intensivstationen, bei Chirurgie-Patienten nur 84%, bei sonstigen Klinik-Patienten 94%.
• Ähnliche Werte wurden auch gefunden für weniger dramatische Indikatoren zur Patientensicherheit. So reduziert sich die Quote der durch Klinik-Infektionen entstandenen Lungenentzündungen auf 70%, der Atemwegserkrankungen auf 40%, der Herzstillstände auf 72%. In der Studie werden auch noch weitere Indikatoren genannt, die ähnliche Unterschiede aufzeigen.
• Ebenso zeigt sich bei besserer Personalausstattung, jeweils bezogen auf die Zahl der Patienten und die in der Klinik verbrachten Tage, eine reduzierte Verweildauer. Sie beträgt 76% in Intensivstationen und 69% bei Chirurgiepatienten.
In einer Pressemitteilung äußert sich einer der Forscher auch zu der Frage, was diese Ergebnisse in einer Situation des verschärften Wettbewerbs und Kostendrucks für Kliniken bedeuten. Robert Kane: "Es geht nicht darum, Kliniken nur auf die Möglichkeiten für mehr Patientensicherheit hinzuweisen. Es geht darum, sie zu überzeugen, dass es in ihrem ureigenen Interesse ist, solche Veränderungen einzuleiten. Aus einer rein ökonomischen Perspektive betrachtet, würden die Kosten für mehr Pflege-Personal nicht wett gemacht durch eine kürzere Verweildauer von Patienten. Man muss in diese Kalkulation jedoch auch Aspekte einbeziehen wie das Klinik-Image und die medizinische Zuverlässigkeit."
Hier ist ein Abstract der Studie: Kane, Robert L. u.a.: The Association of Registered Nurse Staffing Levels and Patient Outcomes: Systematic Review and Meta-Analysis (Medical Care. 45(12):1195-1204, December 2007)
In einer zweiten Studie einer Forschungsgruppe aus Chicago und Philadelphia wurde neben der rein quantitativen Personalausstattung (in Relation zur Patientenzahl und der Verweildauer) auch das Qualifikationsniveau des Pflegepersonals als Einflussfaktor untersucht. Als Indikatoren der Patientensicherheit wurde überprüft, wie häufig Druckgeschwüre und Infektionen im Uro-Genital-Bereich auftraten. Als Datenbasis dienten insgesamt etwa 400.000 Beobachtungen von stationären Krankenbehandlungen, die in den Jahren 1996-2000 in fünf Bundesstaaten der USA protokolliert worden waren. Es zeigte sich: Je besser die Personalausstattung ist, desto seltener traten auch die berücksichtigten Komplikationen auf. Das Qualifikationsniveau hatte allerdings nur Einfluss auf die Häufigkeit von Druckgeschwüren.
Abstract der Studie: R. Tamara Konetzka u.a.: The Staffing-Outcomes Relationship in Nursing Homes (Health Services Research, OnlineEarly Articles, doi:10.1111/j.1475-6773.2007.00803.x)
Gerd Marstedt, 29.11.2007
Ein schlechtes Arbeitsklima im Team ist bei Pflegekräften eine zentrale Ursache für die Neigung zum Berufsausstieg
 Schlechte Arbeitsbedingungen sind auch in Pflegeberufen ein zentraler Faktor von Unzufriedenheit und erhöhen die Neigung, den Betrieb zu wechseln oder ganz aus dem Pflegeberuf auszusteigen. Bei den Arbeitsbedingungen nimmt dabei die Qualität der Teamarbeit eine herausragende Rolle ein. Pflegekräfte, die über schlechte Zusammenarbeit oder Konflikte in der Arbeitsgruppe berichten, fassen etwa fünf mal so oft den Entschluss, ihren Arbeitgeber oder Beruf zu wechseln. Quantitativ nicht ganz so bedeutsam als Stressoren sind Aspekte wie berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Ausmaß der Entscheidungsspielräume, Unsicherheiten bei der Behandlung von Patienten und wechselnde Einsatzbereiche. Aber auch diese Bedingungen verursachen bei ungünstiger und belastender Ausprägung noch eine doppelt so hohe Neigung zum Ausstieg aus der aktuellen Pflegetätigkeit.
Schlechte Arbeitsbedingungen sind auch in Pflegeberufen ein zentraler Faktor von Unzufriedenheit und erhöhen die Neigung, den Betrieb zu wechseln oder ganz aus dem Pflegeberuf auszusteigen. Bei den Arbeitsbedingungen nimmt dabei die Qualität der Teamarbeit eine herausragende Rolle ein. Pflegekräfte, die über schlechte Zusammenarbeit oder Konflikte in der Arbeitsgruppe berichten, fassen etwa fünf mal so oft den Entschluss, ihren Arbeitgeber oder Beruf zu wechseln. Quantitativ nicht ganz so bedeutsam als Stressoren sind Aspekte wie berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Ausmaß der Entscheidungsspielräume, Unsicherheiten bei der Behandlung von Patienten und wechselnde Einsatzbereiche. Aber auch diese Bedingungen verursachen bei ungünstiger und belastender Ausprägung noch eine doppelt so hohe Neigung zum Ausstieg aus der aktuellen Pflegetätigkeit.
Die Ergebnisse zum Berufsausstieg stammen aus einer Befragung von über 28.000 Pflegekräften in 185 Kliniken aus zehn Ländern der EU. Dabei wurde auch deutlich, dass die Motivation zum Verbleib im Beruf bei Pflegern und Pflegerinnen in Deutschland, Italien und Großbritannien am niedrigsten ist. Hier ist ein kostenloses Abstract der Studie zu finden: Estryn-Behar, Madeleine u.a.: The Impact of Social Work Environment, Teamwork Characteristics, Burnout, and Personal Factors Upon Intent to Leave Among European Nurses (Medical Care. 45(10):939-950, October 2007)
Die Auswertung der Daten ist Teil der sogenannenten "NEXT"-Studie, die in 10 europäischen Ländern Längsschnittdaten von über 50.000 Pflegekräften erhoben hat. In einem früheren Bericht der Projektgruppe findet man Ergebnisse zur Frühverrentung und zu Problemen älterer Mitarbeiter in Pflegeberufen, Pflegekräftemangel und Migration in Nachbarländer, Gesundheit und Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitregelungen. Die meisten Ergebnisse beziehen auch einen Vergleich zwischen den 10 beteiligten Ländern ein (Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Niederlande, Polen, Slowakei, Schweden). Sustaining Working Ability in the Nursing Profession - Investigation of Premature Departure from Work. Nurses Early Exit Study - NEXT. NEXT Scientific Report July 2005
Auch in einer zweiten, von der NEXT-Studie unabhängigen Untersuchung, die in Finnland durchgeführt wurde, wurde in ähnlicher Weise die herausragende Bedeutung eines guten Arbeitsklimas im Team deutlich. Basis hierfür war eine über 2-4 Jahre hinweg durchgeführte Längsschnittstudie bei über 6.400 Pflegekräften in finnischen Kliniken. Dort wurden zu zu Beginn und zum Ende der Untersuchung Befragungen zum Arbeitsklima im Team, zur Berufsmotivation und zu eventuellen Ausstiegswünschen durchgeführt. Auch wurden verschiedene sozialstatistische und berufliche Faktoren wie etwa Art des Arbeitsvertrages erhoben. Das erlebte Arbeitsklima wurde sehr detailliert anhand von 14 Fragen erfasst, wobei Aspekte angesprochen wurden wie das Gemeinschaftsgefühl, der Informationsfluss im Team, die Sinnhaftigkeit der Arbeit, das Ausmaß gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Als Ergebnis zeigte sich auch hier: Befragte, die die Qualität der Teamarbeit negativ bewerteten, waren zum Ende der Studie fast doppelt so oft entschlossen, aus dem Beruf ganz auszusteigen oder zumindest Klinik und Arbeitgeber zu wechseln.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Mika Kivimaki u.a.: Team climate, intention to leave and turnover among hospital employees: Prospective cohort study (BMC Health Services Research 2007, 7:170doi:10.1186/1472-6963-7-170)
Gerd Marstedt, 31.10.2007
Über- und Fehlversorgung bei Grippeschutzimpfungen für alle über 65-Jährigen
 Wenn die ersten Herbsttage und die ersten harmlosen Erkältungen vorbei sind, beginnt spätestens die Werbung dafür, sich gegen die Virusgrippe impfen zu lassen. Ob stillschweigend suggeriert oder explizit wird von der präventiven Wirksamkeit dieser Impfung für einige soziodemografischen "Problemgruppen" ausgegangen. Dazu wurden und werden alle älteren Menschen gerechnet. Dies wird auch durch eine Reihe von Beobachtungsstudien aus allen möglichen Ländern auch scheinbar belegt. So wurde in den USA davon berichtet, dass eine Influenza-Impfung die Hälfte des Winter-Sterblichkeitsrisikos reduziere. Entsprechend stieg in den USA auch dieser spezieller Impfschutz in der Gruppe der über 65-Jährigen von 15 bis 20 % in der Zeit vor 1980 auf rund 65 % im Jahr 2001. Unerwartet stieg allerdings in diesem Zeitraum auch die grippebedingte Sterblichkeit der 65+-Bevölkerung an.
Wenn die ersten Herbsttage und die ersten harmlosen Erkältungen vorbei sind, beginnt spätestens die Werbung dafür, sich gegen die Virusgrippe impfen zu lassen. Ob stillschweigend suggeriert oder explizit wird von der präventiven Wirksamkeit dieser Impfung für einige soziodemografischen "Problemgruppen" ausgegangen. Dazu wurden und werden alle älteren Menschen gerechnet. Dies wird auch durch eine Reihe von Beobachtungsstudien aus allen möglichen Ländern auch scheinbar belegt. So wurde in den USA davon berichtet, dass eine Influenza-Impfung die Hälfte des Winter-Sterblichkeitsrisikos reduziere. Entsprechend stieg in den USA auch dieser spezieller Impfschutz in der Gruppe der über 65-Jährigen von 15 bis 20 % in der Zeit vor 1980 auf rund 65 % im Jahr 2001. Unerwartet stieg allerdings in diesem Zeitraum auch die grippebedingte Sterblichkeit der 65+-Bevölkerung an.
Bereits im Jahr 2005 veröffentlichte die amerikanische Wissenschaftlerin Lone Simonsen die Ergebnisse einer mit sechs weiteren ForscherInnen durchgeführten Studie zum "Impact of Influenza Vaccination on Seasonal Mortality in the US Elderly Population" in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2005;165:265-272).
Mit aufwändigen statistischen Methoden untersuchte die Forschungsgruppe das Impf-, Erkrankungs- und Sterbegeschehen während den 33 Grippe-Saisons zwischen 1968 und 2001.
Ihre Ergebnisse waren sehr differenziert, relativierten aber den scheinbar offensichtlichen Nutzen der Impfung für "die" ältteren Menschen erheblich:
• Bei den 65- bis 74-Jährigen sank das Sterblichkeitsrisiko von 1968 bis in die frühen 1980er Jahre zunächst ab, blieb aber danach praktisch konstant auf dem erreichten Niveau. Die ForscherInnen vermuten, dass dies Folge der Immunisierung gegen den so genannten A(H3N2)-Virus war.
• Für die 85 Jahre alten und älteren Personen veränderte sich die Sterblichkeitsrate in der gesamten Zeit kaum.
• In den Jahren, in denen vorrangig die A(H1N1)- and B-Grippeviren aktiv waren, gab es ebenfalls wenig Veränderungen der übermäßigen Sterblichkeit.
• In keiner Altersgruppe gab es nach 1980 einen statistischen Zusammenhang von zunehmendem Impfschutz und abnehmender Sterblichkeit.
• Ihre Ergebnisse fassen die ForscherInnen im Abstract ihres Aufsatzes daher so zusammen: "Because fewer than 10% of all winter deaths were attributable to influenza in any season, we conclude that observational studies substantially overestimate vaccination benefit."
Eine Vermutung von Lone Simonsen lautete, es würden vermutlich die falschen Leute bzw. Personen ohne jegliches Risiko geimpft. So würde ein Impfangebot, das sich vorrangig und besonders an vorerkrankte oder besonders alte Alten wendet, mehr allgemeine Wirksamkeit zeigen.
In einem aktuellen Aufsatz in "Lancet Infectious Diseases" (2007: 7: 658-666) ("Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people: an ongoing controversy") greifen jetzt Simonsen et al. ihre "alten" Ergebnisse nochmals aufgegriffen und unterstreichen ihre Zweifel an den hohen Erfolgsquoten.
Ein weiterer Grund für diese unterschiedlichen Wirkungsschätzungen ist danach der, dass die Grippeimpfung bevorzugt von gesunden Senioren in Anspruch genommen wird. Bereits im letzten Jahr fanden andere Forscher ("Evidence of bias in estimates of influenza vaccine effectiveness in seniors" von Lisa A Jackson et al.) heraus, dass das Sterberisiko von geimpften Senioren bereits vor der Impfung um 61 Prozent niedriger ist als das Sterberisiko von Senioren, die nicht mehr um einen Impftermin nachsuchen - möglicherweise weil sie zu krank oder zu gebrechlich sind.
Wichtig ist: In beiden Aufsätzen wird nicht generell die Wirksamkeit einer Grippeschutzimpfung bestritten oder eingeschränkt gesehen, sondern nur die Wirksamkeit einer "Durchimpfung" der gesamten 65+-Bevölkerung. Empfohlen wird auch zusätzlich, jüngere Angehörige und Betreuungspersonen von älteren Personen zu impfen.
Ein Abstract des Aufsatzes "zum "Impact of Influenza Vaccination on Seasonal Mortality in the US Elderly Population" aus dem Jahre 2005 gibt es hier. Der komplette 8-Seiten-Aufsatz steht als PDF-Datei ebenfalls zur Verfügung.
Bernard Braun, 26.9.2007
Pflegeheime private Anlagespäre: "More profit and less nursing at many homes" - Nicht nur ein Problem der USA!?
 In der durch den aktuellen Prüfbericht des "Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK)" über die Qualität der ambulanten und stationären Altenpflege zum wiederholten Maße provozierten Debatte über immer noch beachtliche Defizite in Pflegeheimen, wird gar nicht oder nur am Rande über das mögliche Konfliktverhältnis zwischen den Gewinninteressen privater Träger von Pflegeeinrichtungen und den Interessen der Pflegebedürftigen und ihrer Pflegekassen gesprochen. Die Hinweise darauf, dass es offensichtlich Träger gibt, die eine weit bessere Qualität mit mehr qualifizierten MitarbeiterInnen anbieten als andere und dabei auch noch Gewinn machen, sollten aber Anlass sein darüber gründlicher zu recherchieren und zu diskutieren.
In der durch den aktuellen Prüfbericht des "Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK)" über die Qualität der ambulanten und stationären Altenpflege zum wiederholten Maße provozierten Debatte über immer noch beachtliche Defizite in Pflegeheimen, wird gar nicht oder nur am Rande über das mögliche Konfliktverhältnis zwischen den Gewinninteressen privater Träger von Pflegeeinrichtungen und den Interessen der Pflegebedürftigen und ihrer Pflegekassen gesprochen. Die Hinweise darauf, dass es offensichtlich Träger gibt, die eine weit bessere Qualität mit mehr qualifizierten MitarbeiterInnen anbieten als andere und dabei auch noch Gewinn machen, sollten aber Anlass sein darüber gründlicher zu recherchieren und zu diskutieren.
Zu welchen interessanten Ergebnissen man dabei kommt, zeigt eine gerade veröffentlichte vergleichende Recherche über die Besonderheiten privater Pflegeheimunternehmen - in den USA und in der "New York Times (NYT)" vom 23. September 2007.
Wer meint, amerikanische Zustände wären nicht vergleichbar und private Unternehmen seien in Deutschland sowieso oder a priori anders als in den USA und wer eine repräsentative Studie sucht, braucht nicht weiter zu lesen.
Für den, der sich doch dafür interessiert, folgen die wesentlichen Ergebnisse der von Charles Duhigg durchgeführten Analyse von Trends des Engagements privater Investmentgruppen in diesem Sektor und die Ergebnisse einer Analyse von Versorgungsdaten der "Centers for Medicare and Medicaid Services" des "Department of Health and Human Services".
Die NYT analysierte Daten von 1.200 privaten Pflegeheimen, die zwischen 2000 und 2006 von entsprechenden Unternehmen gekauft und betrieben werden und verglich sie mit mehr als 14.000 anderen bundesweiten Heimen in nichtprivater Trägerschaft. Die Bewertungskriterien waren u.a. die Häufigkeit von Beschwerden, die bei der Aufsichtsbehörde ("regulators") eingingen, Gesundheits- und Sicherheitsprobleme, die den Aufsichtsbeamten auffielen, Strafen, die gegen Heime durch staatliche und bundesstaatliche Behörden verhängt wurden und weitere Performance-Indikatoren aus mehreren Surveys und Datenbasen.
Dabei zeigten sich innerhalb des Untersuchungszeitraums eine Reihe deutlicher und systematischer Unterschiede zwischen privaten und anders getragenen Heimen:
• In privatwirtschaftlichen Heimen teilen sich 20 Bewohner eine registrierte Fach-Pflegekraft, in anderen Heimen waren es bundesweit durchschnittlich 13 BewohnerInnen.
• In jeder privaten Einrichtung traten durchschnittlich 7,7 ernste, von Aufsichtsbeamten entdeckten Gesundheitsprobleme auf, im nationalen Durchschnitt waren es lediglich - aber immerhin immer noch - 6,5.
• Der Anteil von langfristiger Pflege bedürftiger Personen, die Hilfe bei ihren täglichen Aktivitäten brauchten, wuchs zwischen 2000 und 2006 in privaten Heimen um 23 %, in den anderen Heimen um 16 %.
• Der Anteil der so genannten "long-stay residents", deren Fähigkeit sich selbst innerhalb und außerhalb ihres Wohnraumes zu bewegen verschlechterte sich in privaten Heimen um 17 % und in nicht-privaten um 13 %.
• Außerdem nahm der Anteil von BewohnerInnen, die depressiv und ängstlich waren, in privaten Heimen um 16 % und in anders getragenen Heimen um 14 % zu.
• Die in den USA dominanten großen privaten "Pflegeketten" (im Artikel gibt es dazu eine anschauliche interaktive Grafik) verdienten 2005 im Durchschnitt 41 % mehr an der Pflege als die durchschnittliche Einrichtung.
• In 60 % der von privaten Unternehmen frisch übernommenen Heimen wurde die Anzahl der "clinical registered nurses" abgesenkt und manchmal auch bis knapp unter die gesetzlich erlaubte Mindestanzahl. Bei 21 % der privaten Heime stieg ihre Anzahl aber auch, weil sie teilweise zuvor ungesetzlich niedrig lag.
• Obwohl das US-Gesundheitsministerium 2002 betonte, die meisten Pflegebedürftige bräuchten mindestens 1,3 Pflegestunden pro Tag durch eine Pflegefachkraft, lieferten die privaten Heime nur eine Stunde.
• In der Veröffentlichung fehlen allerdings Daten mit denen geprüft werden könnte, ob nicht private Heime möglicherweise von vornherein die schwierigeren Pflegebedürftigen aufgenommen hatten. Sehr unwahrscheinlich, aber möglich.
Der NYT-Artikel deutet bereits in der Überschrift "More profit and less nursing at many homes" die von der Zeitung vermuteten Hintergründe und Zusammenhänge der zitierten Verhältnisse an und illustriert auch anschaulich die Strategien mehrerer großer Investment-Gruppen, die in diesem Bereich aktiv waren und sind. Um die Dimensionen des Pflegemarktes zu verdeutlichen, weist die NYT auf die 75 Milliarden US-$ hin, die allein die staatlichen Versicherungssysteme Medicare und Medicaid 2006 für Heimpflege ausgegeben haben.
Wie profitabel das "Geschäft mit Pflegeheimen" sein kann, zeigt der Artikel am Weiterverkauf einer großen Heimkette mit 186 Heimen, an den Industrie- und Dienstleistungskonzern General Electric (GE). Der hierzulande mit humanem Touch werbenden Konzern waren diese Heime 1,4 Mrd. US-$ wert und die privaten Verkäufer hatten ihr eingesetztes Kapital innerhalb von vier Jahren mit diesen Heimen um mehr als 500 Millionen US-$ vermehrt. Dazu passt der lakonische Schlusssatz des Artikels: "Formation (so der Namen des Verkäufers) declined to comment on that figure."
Nach Lektüre des Artikels sollte man aber nochmals gründlich über die leuchtenden Augen einer Reihe von deutschen Akteure der Gesundheitswirtschaft nachdenken, wenn sie über die Demographie reden.
Kostenfrei heruntergeladen werden kann der im Ausdruck 10 Seiten umfassende Artikel - nach einer Registrierung - von Charles Duhigg "More profit and less nursing at many homes" hier.
Wer auch sonst an den zum Teil exzellent recherchierten und geschriebenen Artikeln der New York Times oder deren Gastkommentaren (darunter traditionell und für die an die Mehrheit der deutschen Ökonomen gewöhnten LeserInnen ausgesprochen lebendig und ideenreich der Ökonom Paul Krugman) interessiert ist, kann kostenlos eine tägliche Auswahl an Artikeln abonnieren und seit neuem auch die Archive der NYT kostenlos benutzen. Die einzige Voraussetzung ist, sich einmal kostenfrei online registrieren zu lassen und sich gelegentlich über die scheinbar unausrottbaren Werbungs-Pop ups zu ärgern.
Bernard Braun, 24.9.2007
MDS Bericht deckt immer noch große Missstände in der Pflege auf - US-Studien zeigen bessere Pflege-Alternativen
 Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) hat jetzt seinen zweiten Bericht zur "Qualität in der ambulanten und stationären Pflege" vorgelegt. Zwar wird betont, dass sich die Qualität der Pflege seit der Veröffentlichung des ersten Berichts im Jahr 2003 verbessert hat. Zugleich werden jedoch immer noch erhebliche Mängel festgestellt: Unzureichende Versorgung mit Essen und Trinken, mangelhafte Vorbeugung gegen Dekubitus, zu häufige Verabreichung von Psychopharmaka.
Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) hat jetzt seinen zweiten Bericht zur "Qualität in der ambulanten und stationären Pflege" vorgelegt. Zwar wird betont, dass sich die Qualität der Pflege seit der Veröffentlichung des ersten Berichts im Jahr 2003 verbessert hat. Zugleich werden jedoch immer noch erhebliche Mängel festgestellt: Unzureichende Versorgung mit Essen und Trinken, mangelhafte Vorbeugung gegen Dekubitus, zu häufige Verabreichung von Psychopharmaka.
Problematisch erscheint dem MDS auch, dass teure Heime nicht unbedingt besser abschneiden als kostengünstige. Auch würden Zertifikate und Gütesiegel der Einrichtungen nichts über die Ergebnisqualität aussagen. Im Durchschnitt seien zertifizierte Heime "kaum messbar besser als nicht-zertifizierte", erklärte Jürgen Brüggemann vom MDS. Einrichtungen mit Zertifikat liefern zwar bei der Dokumentation ihrer Leistungen bessere Ergebnisse ab. Hinsichtlich der Versorgungsqualität schneiden sie teilweise aber sogar schlechter ab.
Der MDS gibt alle drei Jahre einen umfassenden Bericht zur Situation und zur Entwicklung der Pflegequalität bei häuslicher Pflege und in Pflegeheimen ab. Der jetzt vorgestellte Bericht bezieht sich auf die Jahre 2004 bis 2006. Dafür wurden Daten aus 3.736 Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegediensten und aus 4.215 Qualitätsprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen ausgewertet, wobei rund 15.000 ambulant und knapp 25.000 stationär Pflegebedürftige einbezogen waren. Sie wurden zu ihrer Versorgungssituation befragt und ihr Pflegezustand bewertet. Außerdem wurden in den Einrichtungen Pflegekonzepte, Abläufe und die fachliche Arbeit der Pflegekräfte überprüft.
Im Vergleich zum ersten Bericht aus dem Jahr 2004 sind bei wichtigen Versorgungskriterien Verbesserungen eingetreten. Fanden die MDK-Gutachter im Jahre 2003 noch bei rund 37 Prozent der von ambulanten Pflegediensten betreuten Pflegebedürftigen und bei 41 Prozent der Pflegeheimbewohnern Defizite bei der Ernährungs- und Flüssigkeitsversorgung, reduzierten sich diese Werte auf knapp 30 Prozent im ambulanten Bereich und ca. 34 Prozent im stationären. In vielen Fällen wurde etwa der Gewichtsverlauf des Pflegebedürftigen nicht ausreichend kontrolliert oder der individuelle Kalorienbedarf nicht berücksichtigt. Unzureichend war die Ernährung und die Flüssigkeitsversorgung bei etwa 30 Prozent im ambulanten und 34 Prozent im stationären Bereich.
Bei den pflegerischen Maßnahmen zur Vorbeugung von Druckgeschwüren (Dekubiti), bei der Inkontinenzversorgung und bei der Betreuung von Menschen mit Demenz stellt sich die Situation ähnlich dar. Bei zehn Prozent der untersuchten Heimbewohner (2003: 17%) stellten die MDK-Gutachter gesundheitliche Schädigungen und damit einen akut unzureichenden Pflegezustand fest, etwa im Hinblick auf den Haut- und Mundzustand und die Versorgung mit Sonden, Kathetern und Inkontinenzprodukten.
Hier ist der 2. Bericht des MDS nach § 118 Abs. 4 SGB XI - Qualität in der ambulanten und stationären Pflege
Währenddessen gibt es aus den USA Forschungsberichte über Modellvorhaben im Bereich der ambulanten und stationären Pflege, die aufzeigen, dass neue Organisations- und Versorgungsmodelle - bei annähernd gleichen oder sogar geringeren Kosten - zu einer erheblichen Verbesserung des Gesundheitszustands und der Lebensqualität Pflegebedürftiger führen können.
So wurde jetzt in der Zeitschrift "The Milbank Quarterly" eine Evaluation des "PACE"-Projekts veröffentlicht, einem Managed-Care-Programm, das vom betreuten Wohnen über ambulante Pflege bis hin zur stationäre Pflege vielfältige soziale und medizinische Versorgungsleistungen anbietet. Zielsetzungen von PACE-Projekten ist es, Senioren so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben zu lassen und ihnen dazu einen flexiblen und immer wieder neu zusammengestellten Mix an Betreuung und medizinischer Versorgung anzubieten. Dazu zählen alle medizinischen und pflegerischen Leistungen, aber auch Beschäftigungstherapie, Freizeitgestaltung, Sozialarbeit, Ernährungsberatung und anderes mehr. Beteiligt sind an den PACE-Projekten hauptamtliche Mitarbeiter (Ärzte, Pfleger, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten usw.), aber auch ehrenamtliche Helfer, Verwandte und Freunde der Pflegebedürftigen.
In der jetzt veröffentlichten Studie, an der über 3.000 Pflegebedürftige beteiligt waren, wurde jetzt überprüft, welche Elemente des Managed-Care-Programms sich als erfolgreich erwiesen haben und welche nicht. Als Kriterium dafür wurden Selbsteinstufungen des Gesundheitszustands, aber auch Indikatoren zur körperlichen und psychischen Fitness sowie die Mortalitätsrate herangezogen. Einen positiven Einflussfaktoren für Gesundheit und Fitness fand man vor allem dann,
• wenn der medizinische Projektleiter aus der Geriatrie kommt,
• wenn ein Projektteam interdisziplinär besetzt war und möglichst viele Berufe umfasste,
• wenn einem Team auch zusätzlich zu Professionellen möglichst viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Freunde bzw. Verwandte angehörten.
Hier findet man ein kostenloses Abstract der Studie: Dana B. Mukamel u.a.: Program Characteristics and Enrollees' Outcomes in the Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) (The Milbank Quarterly, Volume 85 Issue 3 Page 499-531, September 2007)
Ein weiteres Modellprojekt in den USA sind sogenannte "Green House"-Seniorenheime, in denen versucht wird, in kleineren Häusern mit etwa 10 Pflegebedürftigen durch die Art der Einrichtung und Betreuung eine Atmosphäre zu schaffen, die die Bedürfnisse der Senioren im Hinblick auf private Sphären, Gemütlichkeit und Lebensqualität berücksichtigt. Dazu gehören Einzelzimmer und dazu gehörige Bäder, Gemeinschaftsräume, Haustiere, Zimmerpflanzen und Gärten. Auch die Betreuung und medizinische Versorgung erinnert eher an ein betreutes Wohnen als an ein kommerzielles Pflegeheim. Die Kosten für diese Pflege sind allerdings nicht höher als in anderen Einrichtungen. Dafür ist die Lebensqualität der Betreuten sehr viel höher, wie jetzt eine Studie festgestellt hat.
Im Rahmen eines zweijährigen Modellvorhabens wurden im Vergleich mit anderen Pflegeinrichtungen zahlreiche subjektive Aspekte der empfundenen Lebensqualität, des Wohlbefindens, der physischen und psychischen Fitness ihrer Bewohner und auch objektive Bewertungen der Versorgungsqualität erfasst. Dabei zeigte sich, dass im Vergleich zu den Bewohnern traditioneller Pflegeheime die Green-House-Senioren in nahezu allen Bereichen (Gesundheitszustand, Wohlbefinden und Lebensqualität, Fitness) bessere Werte zeigten.
Hier ist ein Abstract der Studie: Rosalie A. Kane u.a.: Resident Outcomes in Small-House Nursing Homes: A Longitudinal Evaluation of the Initial Green House Program (Journal of the American Geriatrics Society, Volume 55 Issue 6 Page 832-839, June 2007)
Gerd Marstedt, 3.9.2007
Massiver Abbau von Pflegepersonal in Kliniken: Eine Gefahr für die Patientensicherheit?
 Seit 1995 wurden rund 50.000 Pflegestellen in bundesdeutschen Kliniken abgebaut, während gleichzeitig die Zahl der hauptamtlich tätigen Klinikärzte um 20 Prozent gestiegen ist. Heute müssen in den Kliniken pro Jahr etwa eine Million Patienten mehr als 1995 medizinisch versorgt und pflegerisch betreut werden. Die Patienten-Pflegekraft-Quote hat sich damit um 23 Prozent erhöht. Zugleich nimmt die Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit der Patienten zu, was ebenfalls dazu beiträgt, dass die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals weiter ansteigt. Im Jahre 2006 sind so viele Überstunden geleistet worden, dass dafür rund 5.000 Pflegekräfte mehr hätten eingestellt werden müssen.
Seit 1995 wurden rund 50.000 Pflegestellen in bundesdeutschen Kliniken abgebaut, während gleichzeitig die Zahl der hauptamtlich tätigen Klinikärzte um 20 Prozent gestiegen ist. Heute müssen in den Kliniken pro Jahr etwa eine Million Patienten mehr als 1995 medizinisch versorgt und pflegerisch betreut werden. Die Patienten-Pflegekraft-Quote hat sich damit um 23 Prozent erhöht. Zugleich nimmt die Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit der Patienten zu, was ebenfalls dazu beiträgt, dass die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals weiter ansteigt. Im Jahre 2006 sind so viele Überstunden geleistet worden, dass dafür rund 5.000 Pflegekräfte mehr hätten eingestellt werden müssen.
Dies sind Kernaussagen der Studie "Pflege-Thermometer 2007", die auf einer bundesweiten repräsentativen Befragung zur Arbeitssituation des Pflegepersonals sowie zur Patientensicherheit im Krankenhaus basiert. Auftraggeber ist das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung. Angeschrieben wurden insgesamt über 2.100 Kliniken, wobei auch psychiatrische Kliniken und andere Einrichtungen mit aufgenommen wurden. Geantwortet haben 12% der Krankenhäuser, so dass Aussagen aus 250 Kliniken ausgewertet werden konnten.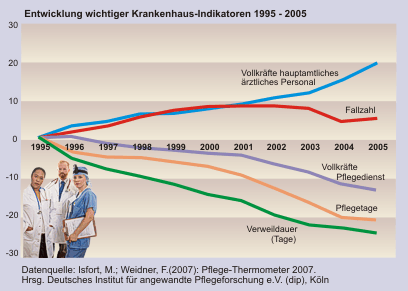
Der massive Abbau von Pflegepersonal kann nach Ansicht der Studienautoren nicht damit begründet werden, dass auch die Verweildauer in Kliniken und die Bettenzahl reduziert wurden: "Die Reduzierung des Pflegepersonals kann dabei nicht mit der Verweildauerverkürzung und dem Bettenabbau alleine erklärt werden. Hinsichtlich der Verweildauerverkürzung werden vor allem die nicht mehr pflege- und therapieintensiven Tage abgebaut. Eine Reduzierung der Bettenzahl steht ebenso wenig kausal im Zusammenhang mit einem Arbeitsaufwand. Einerseits bleibt die Bettenauslastung stabil, andererseits steigt insgesamt die Fallzahl der behandelten Patienten. Der pflegerische und therapeutische Arbeitsaufwand hängt von der Anzahl behandelter Patienten ab, wenn auch nicht von einem linearen Verhältnis ausgegangen werden kann. Die Belastungszahl des Pflegedienstes nach Fällen stieg in zehn Jahren von 48 Patienten pro Pflegekraft auf 59 Patienten."
Nach Einschätzung der befragten Pflegedirektionen wirkt sich die angespannte Personalsituation in der Krankenhauspflege bereits auf die Patientenversorgung und -sicherheit aus. So können Umlagerungen, Mobilisationen, Schmerzmittelverabreichungen und Überwachungen von operierten Patienten nicht mehr in jedem Krankenhaus optimal gewährleistet werden. Die Anzahl der Beschwerden von Patienten und Angehörigen über die Versorgung nimmt in jedem fünften Krankenhaus zu. 40 Prozent der Befragten rechnen zukünftig nicht mit einer Verbesserung der pflegerischen Qualität der Patientenversorgung. Zudem wird ein weiterer Stellenabbau in der Pflege aufgrund des Kostendrucks im Krankenhauswesen erwartet.
Ein weiteres Einzelergebnis der Befragung war die Feststellung, dass in erheblichem Ausmaß Mehrarbeit geleistet werden muss, um den Personalabbau zu kompensieren. So stiegen die Mehrarbeitsstunden in der Studie vom Jahr 2003 mit insgesamt 745.000 am Jahresende auf insgesamt 850.000 am Jahresende 2006, was einem Zuwachs von 13% entspricht. Rechnet man die Überstunden des Jahres 2006 bundesweit hoch, so kommt man auf ca. 5.000 Vollzeitstellen, die dadurch ersetzt wurden. Ein besonderes Problem stellt auch die Altersstruktur des Pflegepersonals in den Kliniken dar. 83% der Befragten gehen davon aus, dass sich der Anteil an älteren Mitarbeitern in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Dies stellt sich als gravierendes Problem dar, weil mehr als drei Viertel der Befragten äußern, dass die beruflichen Belastungen nicht bis zum Rentenalter tragbar sind.
• Die Studie (PDF, 54 Seiten, 3.5 MB) ist hier im Volltext kostenlos verfügbar: Isfort, M.; Weidner, F. (2007): Pflege-Thermometer 2007. Eine bundesweite repräsentative Befragung zur Situation und zum Leistungsspektrum des Pflegepersonals sowie zur Patientensicherheit im Krankenhaus (Herausgegeben von: Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip), Köln)
• Hier ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse
Gerd Marstedt, 26.7.2007
Wenig Pflegepersonal in Kliniken: Hohe Arbeitsbelastungen und hohe Risiken für die Patientensicherheit
 Kliniken, die bei Krankenpflegern an Personal sparen, stellen ein hohes Risiko für die Patientensicherheit dar. Wenn Pflegekräfte eine hohe Zahl von Patienten zu versorgen haben, so erhöht dies ihren Zeit- und Verantwortungsdruck und schlägt sich in einer höheren Zahl medizinischer Komplikationen und sogar einer erhöhten 30-Tage-Sterblichkeit der von ihnen versorgten Patienten nieder. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie von Forschern der Columbia University School of Nursing, New York, die jetzt in der Zeitschrift "Medical Care" veröffentlicht wurde. Ausgewertet wurden Daten von knapp 16.000 Patienten in 51 Intensivstationen von etwa 30 Kliniken der USA. Berücksichtigt wurden außerdem in der Befragung erhobene Urteile von über 1.000 Pflegekräften über das Betriebsklima und andere Arbeitsbedingungen.
Kliniken, die bei Krankenpflegern an Personal sparen, stellen ein hohes Risiko für die Patientensicherheit dar. Wenn Pflegekräfte eine hohe Zahl von Patienten zu versorgen haben, so erhöht dies ihren Zeit- und Verantwortungsdruck und schlägt sich in einer höheren Zahl medizinischer Komplikationen und sogar einer erhöhten 30-Tage-Sterblichkeit der von ihnen versorgten Patienten nieder. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie von Forschern der Columbia University School of Nursing, New York, die jetzt in der Zeitschrift "Medical Care" veröffentlicht wurde. Ausgewertet wurden Daten von knapp 16.000 Patienten in 51 Intensivstationen von etwa 30 Kliniken der USA. Berücksichtigt wurden außerdem in der Befragung erhobene Urteile von über 1.000 Pflegekräften über das Betriebsklima und andere Arbeitsbedingungen.
Erfasst wurden in der Studie einerseits der pflegerische Personalaufwand je Patient, aber auch weitere Arbeitbedingungen wie das Betriebsklima, Personalbestand, geleistete Überstunden, Entlohnung der Pflegekräfte und Angaben zur ökonomischen Lage der Kliniken. Verglichen wurde diese dann mit unterschiedlichen Indikatoren der Patientensicherheit.
Als Ergebnis zeigte sich: Kliniken mit einem höheren Personalbestand in ihren Intensivstationen weisen signifikant niedrigere Raten auf, was Komplikationen und unerwünschte Effekte anbetrifft. Dies wurde etwa deutlich an den Quoten für Infektionen im Blutkreislauf, Lungenentzündungen (durch künstliche Beatmung) und Dekubitus. Gerade solche "Wundliegegeschwüre" gelten in vielen Studien als Indikator einer besseren oder schlechteren Pflegequalität. Und sogar die Sterblichkeits-Quote innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Krankenhaus-Aufnahme zeigte signifikante Unterschiede, je nach dem in den Kliniken verwendeten Zahlenschlüsseln von Patienten zu Pflegekräften.
Für das Ausmaß der von Pflegern geleisteten Überstunden waren die Effekte nicht so eindeutig. Einerseits zeigte sich, dass die Zahl der Infektionen im Urinaltrakt und ebenso das Dekubitus-Vorkommen um so höher lag, je mehr Überstunden geleistet wurden. Andererseits fiel hier die Quote der Infektionen im Blutkreislauf niedriger aus. Für das Betriebsklima und die wirtschaftliche Lage der Klinik ergab sich ein konsistenter Effekt.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Nurse Working Conditions and Patient Safety Outcomes (Medical Care. 45(6):571-578, June 2007)
Die Studie bestätigt erneut eine Reihe schon vorliegender Forschungsbefunde, die einen sehr engen Zusammenhang aufzeigen zwischen den Arbeitsbedingungen und insbesondere auch zeitlichen Belastungen von Pflegekräften, die sich über Erfahrungen von Stress, Zeit- und Verantwortungsdruck dann auch negativ auf die Patientensicherheit auswirken. Eine Literaturübersicht über diese Forschungsbefunde hat unlängst die Canadian Health Services Research Foundation vorgelegt. Dort heißt es in der Zusammenfassung (Übersetzung durch Forum Gesundheitspolitik):
"Zahllose Studien belegen einen Zusammenhang zwischen einem niedrigem Personalbestand bei Pflegekräften und höheren Quoten unerwünschter Effekte bei Patienten, Belegschaft und Klinik. Als erstes und wichtigstes Ergebnis ist hervorzuheben, dass fünf große Studien aufgezeigt haben: Eine niedrige Zahl an Pflegekräften geht mit einer höheren Sterblichkeit von Patienten einher. Ein reduzierter Personalbestand zeigt weiterhin Zusammenhänge zu Effekten wie Dekubitus, Stürze, Verschreibungsfehler sowie Infektionen der Atemwege und im Urinaltrakt. Zum zweiten berichten Pflegekräfte, die für viele Patienten sorgen müssen, häufiger über Burn-Out-Erfahrungen, Arbeitsunzufriedenheit, Krankmeldungen und Tendenzen zum Arbeitsplatz- oder Berufswechsel."
Die Literaturübersicht ist hier zu finden: Canadian Health Services Research Foundation: Evaluation of Patient Safety and Nurse Staffing (PDF, 35 Seiten)
Gerd Marstedt, 3.6.2007
Ende der "Satt-Sauber-Stumm"-Pflege in Sicht? - Erste Ergebnisse eines Pflegebedürftigkeitsprojekts der Pflegekassen
 Seit Einführung der Pflegeversicherung wird immer wieder ihr geltender verrichtungsbezogener Pflegebedürftigkeitsbegriff kritisiert, der im § 14 SGB XI festgeschrieben ist. Nach Ansicht der Kritiker sind Defizite bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen vielfach auf den zu engen Begriff der Pflegebedürftigkeit zurückzuführen, da dieser somatisch ausgerichtet ist. Dadurch würden wesentliche Aspekte (Kommunikation, soziale Teilhabe) ausgeblendet und der Bedarf an allgemeiner Betreuung, Beaufsichtigung und Anleitung, insbesondere bei Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, zu wenig berücksichtigt. Im geltenden Begutachtungsverfahren von Pflegebedürftigkeit des "Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK)" schlägt sich dies u. a. darin nieder, dass der Unterstützungsbedarf ohne systematische und differenzierte Erfassung der Abhängigkeit bei Aktivitäten und in Lebensbereichen ermittelt und damit qualitativ und quantitativ unterschätzt wird.
Seit Einführung der Pflegeversicherung wird immer wieder ihr geltender verrichtungsbezogener Pflegebedürftigkeitsbegriff kritisiert, der im § 14 SGB XI festgeschrieben ist. Nach Ansicht der Kritiker sind Defizite bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen vielfach auf den zu engen Begriff der Pflegebedürftigkeit zurückzuführen, da dieser somatisch ausgerichtet ist. Dadurch würden wesentliche Aspekte (Kommunikation, soziale Teilhabe) ausgeblendet und der Bedarf an allgemeiner Betreuung, Beaufsichtigung und Anleitung, insbesondere bei Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, zu wenig berücksichtigt. Im geltenden Begutachtungsverfahren von Pflegebedürftigkeit des "Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK)" schlägt sich dies u. a. darin nieder, dass der Unterstützungsbedarf ohne systematische und differenzierte Erfassung der Abhängigkeit bei Aktivitäten und in Lebensbereichen ermittelt und damit qualitativ und quantitativ unterschätzt wird.
In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die CDU/CSU-SPD-Bundesregierung eine mittelfristige Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs vorgenommen.
Wie ein anderer Begriff von Pflegebedürftigkeit aussehen könnte, mit welchen Instrumenten und Verfahren sie ermittelt werden kann und welche Auswirkungen diese Neuerungen auf die Anzahl und die Art von Pflegebedürftigen und den für ihre Versorgung notwendigen Aufwand haben, wird seit Herbst 2006 und noch bis Herbst 2008 in einem vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Forschungsprojekt bzw. Modellprojekt der Pflegekassen untersucht.
Das etwas sperrig formulierte Modellprojekt "Maßnahmen zur Schaffung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines Begutachtungsinstrumentes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI" beschäftigt sich in drei Phasen (Vorphase, Hauptphase 1, Hauptphase 2) mit folgenden Themen:
• In der Vorphase erfolgte bis Februar 2007 eine umfassende nationale und internationale wissenschaftliche Recherche, Analyse und Bewertung von Begutachtungsinstrumenten und Pflegebedürftigkeitsbegriffen.
• In der sich anschließenden Hauptphase 1 besteht die Aufgabe der modellhaften Entwicklung eines neuen, praktikablen, standardisierten und allgemein anerkannten, durch den Gesetzgeber noch nicht vorgegebenen, Begutachtungs-Instrumentes unter Berücksichtigung der gleichzeitigen Erarbeitung oder Zugrundelegung eines vom Gesetzgeber ebenfalls noch nicht entschiedenen alternativen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.
• In der darauf folgenden Hauptphase 2 ist das Begutachtungsverfahren von einer unabhängigen Einrichtung wissenschaftlich auf seine Validität und Reliabilität hin zu überprüfen.
Mit den Ergebnissen des Ende März 2007 vorgestellten Gutachtens der Universität Bielefeld von Wingenfeld, Büscher und Schaeffer zum Thema "Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten" lässt sich die Richtung und Bedeutung der möglichen Veränderungen bereits erkennen.
Eine Person gilt im Lichte eines erweiterten Begriffs von Pflegebedürftigkeit als pflegebedürftig, wenn sie "aufgrund fehlender personaler Ressourcen (mit denen körperliche oder psychische Schädigungen, die Beeinträchtigung körperlicher oder kognitiver/psychischer Funktionen, gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen kompensiert oder bewältigt werden könnten) dauerhaft oder vorübergehend nicht in der Lage ist zu selbstständigen Aktivitäten im Lebensalltag, selbstständiger Krankheitsbewältigung oder selbstständiger Gestaltung von Lebensbereichen und sozialer Teilhabe und daher auf personelle Hilfe angewiesen ist".
Das 232 Seiten umfassende vollständige Gutachten der Bielefelder Wissenschaftler findet sich hier: Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten - Überarbeitete Fassung - Bielefeld, 23. März 2007, Verfasser: K. Wingenfeld, A. Büscher, D. Schaeffer.
Wie es nach diesem Startschuss weitergeht, d.h. wie die Entwicklung des neuen Begutachtungsinstruments und der Bewertungssystematik des MDK vorankommen, findet man ebenfalls über die Startseite des Modellprojekts heraus.
Bernard Braun, 24.5.2007
Die Pflege todkranker Angehöriger: Extrem belastend, aber auch bereichernd
 Die häusliche Pflege und Betreuung chronisch erkrankter und behinderter Familienangehöriger bringt für die betroffenen Kinder oder Eheleute extreme hohe Belastungen mit sich. Aber diese Tätigkeit wird von der großen Mehrzahl auch als Bereicherung empfunden und hebt ihr Selbstwertgefühl deutlich. Dies sind Ergebnisse einer Studie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, in der Interviews mit insgesamt 1149 Personen durchgeführt wurden, die ihre schwerkranken (und oft todkranken) Angehörigen am Lebensende zu Hause pflegten. Bei den pflegenden Personen handelte es sich zumeist um Frauen (75%) und um Personen, die selbst schon im vorgerückten Alter sind (Durchschnitt 64 Jahre), allerdings überwiegend bei guter Gesundheit. 42 Prozent der Pflegenden waren Ehepartner, 39 Prozent Kinder und 20 Prozent andere Verwandte oder Freunde.
Die häusliche Pflege und Betreuung chronisch erkrankter und behinderter Familienangehöriger bringt für die betroffenen Kinder oder Eheleute extreme hohe Belastungen mit sich. Aber diese Tätigkeit wird von der großen Mehrzahl auch als Bereicherung empfunden und hebt ihr Selbstwertgefühl deutlich. Dies sind Ergebnisse einer Studie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, in der Interviews mit insgesamt 1149 Personen durchgeführt wurden, die ihre schwerkranken (und oft todkranken) Angehörigen am Lebensende zu Hause pflegten. Bei den pflegenden Personen handelte es sich zumeist um Frauen (75%) und um Personen, die selbst schon im vorgerückten Alter sind (Durchschnitt 64 Jahre), allerdings überwiegend bei guter Gesundheit. 42 Prozent der Pflegenden waren Ehepartner, 39 Prozent Kinder und 20 Prozent andere Verwandte oder Freunde.
Überraschend war die Wissenschaftler der hohe zeitliche Umfang der Pflege und Betreuung: Er lag im Durchschnitt bei 43 Stunden in der Woche, und dies über Zeiträume von ein bis vier Jahren bis zum Tode des Angehörigen. Dieser Wert lag deutlich höher als andere Studien zuvor ermittelt hatten. Häusliche Pflege, so die Forscher, erfordert damit am Lebensende einen Zeitaufwand, der dem vollen Tageseinsatz einer professionellen Pflegekraft entspricht.
Obwohl die Pflege vielen Betroffenen sehr hohe emotionale, körperliche und finanzielle Belastungen abverlangte, empfanden die meisten von ihnen diese Arbeit gleichwohl auch als persönliche Bereicherung. So gaben
• 69% an, die Pflege habe dazu beigetragen, dass sie ihr Leben mehr schätzten,
• 70% sagten, sie hätten dadurch ein besseres Bild von sich selbst und ein besseres Selbstwertgefühl,
• 76% bekamen dadurch das Gefühl, von anderen gebraucht zu werden,
• 65% schätzten den sozialen Kontakte und die Gesellschaft im Rahmen der Betreuung.
Belastungen werden von den Angehörigen auch erwähnt, aber deutlich seltener. Seelischen Stress nannten 29%, körperliche Belastungen 18% und finanzielle Probleme 14%. Hauptsächliche Probleme für die Pflegenden waren Unterbrechung des nächtlichen Schlafs durch Pflegeerfordernisse und der Zwang zur Hilfe auch in Situationen, in denen es ihnen selbst nicht gut ging.
Die Autoren erwähnen selbst eine Einschränkung ihrer Ergebnisse, dadurch dass sie nur ältere und nicht mehr erwerbstätige Angehörige befragt haben. Es könnte daher sein, so stellen sie fest, dass Jüngere aufgrund beruflicher Belastungen und Zwänge die Pflegetätigkeit weniger stark in ihren positiven Effekten wahrnehmen. Sie heben aber auch hervor, dass die Ergebnisse nicht als Vorwand dafür dienen sollten, die Unterstützung von Angehörigen durch soziale Dienste zurückzufahren.
Die Studie steht hier kostenlos im Volltext zur Verfügung:
Jennifer L. Wolff u.a: End-of-Life Care - Findings From a National Survey of Informal Caregivers (Archives of Internal Medicine, Vol. 167 No. 1, January 8, 2007)
Gerd Marstedt, 29.1.2007
Wenig qualifiziertes Pflegepersonal im Krankenhaus: Für Patienten ein tödlicher Risikofaktor
 Viele Todesfälle im Krankenhaus könnten vermieden werden, wenn besser qualifizierte Pflegekräfte tätig wären und routinemäßig Pflegeprotokolle verwendet würden. Dies ist der überraschende Befund einer jetzt veröffentlichten kanadischen Studie. Ein Forschungsteam der Universität von Toronto und des "Institute for Clinical Evaluative Sciences" in Ontario (Kanada) hat die Daten von rund 47.000 Patienten näher analysiert, die seinerzeit wegen bestimmter Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenentzündung, Blutvergiftung) in einer der Kliniken des Distrikts behandelt wurden. Zunächst zeigte sich, dass die Sterbequote dieser Patienten innerhalb eines 30-Tages-Zeitraums erhebliche Unterschiede zwischen den 75 einbezogenen Krankenhäusern aufwies: Sie variierte zwischen 10% und 28%. Als die Forscher auch Informationen über die jeweiligen Pflegekräfte in die Analyse der Daten aufnahmen, zeigte sich, dass fast die Hälfte der Todesfälle in engem Zusammenhang stand mit der Qualifikation der Pfleger/innen sowie der Qualität der Pflegeorganisation.
Viele Todesfälle im Krankenhaus könnten vermieden werden, wenn besser qualifizierte Pflegekräfte tätig wären und routinemäßig Pflegeprotokolle verwendet würden. Dies ist der überraschende Befund einer jetzt veröffentlichten kanadischen Studie. Ein Forschungsteam der Universität von Toronto und des "Institute for Clinical Evaluative Sciences" in Ontario (Kanada) hat die Daten von rund 47.000 Patienten näher analysiert, die seinerzeit wegen bestimmter Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenentzündung, Blutvergiftung) in einer der Kliniken des Distrikts behandelt wurden. Zunächst zeigte sich, dass die Sterbequote dieser Patienten innerhalb eines 30-Tages-Zeitraums erhebliche Unterschiede zwischen den 75 einbezogenen Krankenhäusern aufwies: Sie variierte zwischen 10% und 28%. Als die Forscher auch Informationen über die jeweiligen Pflegekräfte in die Analyse der Daten aufnahmen, zeigte sich, dass fast die Hälfte der Todesfälle in engem Zusammenhang stand mit der Qualifikation der Pfleger/innen sowie der Qualität der Pflegeorganisation.
Die Studie zeigte unter anderem:
&bull, Bei einer um 10% höheren Zahl der Pflegekräfte ergibt sich in der Analyse eine Senkung der Todesfälle um 6 pro 1.000 Patienten. Ähnliche Effekte zeigen sich wenn man den zeitlichen Pflegeaufwand (in Relation zur Zahl der betreuten Patienten) in Rechnung stellt.
&bull, Die Überlebensrate der Patienten liegt um 9 pro 1.000 Patienten höher (innerhalb der betrachteten 30-Tages-Zeitspanne), wenn höher qualifizierte Pflegekräfte im Einsatz sind. (Die Berufsausbildung der Pflegekräfte kann in Kanada wie in den USA im Unterschied zu Deutschland hinsichtlich der Dauer, Qualität und Praxisnähe sehr unterschiedlich ausfallen, man findet in Kliniken relativ unqualifizierte Hilfskräfte ebenso wie Pfleger mit Hochschulabschluss für diese Tätigkeit.).
&bull, Ebenso zeigte sich, dass die Sterbequote in solchen Kliniken deutlich niedriger ausfällt, die eine gute Arbeitsorganisation haben und Pflegeprotokolle routinemäßig bei der Arbeit einsetzen, also auch tatsächlich und nicht nur pro forma zur Kontrolle des Pflegeablaufs und der Patientendaten verwenden.
Insgesamt waren in die Analyse knapp 20 Merkmale einbezogen, die auch als Indikatoren unterschiedlicher Pflegequalität interpretierbar sind: Qualifikation und Berufserfahrung der Pflegekräfte, Ausmaß des Burnout-Gefühls, Anteil Vollzeitstellen innerhalb des Pflegepersonals, Krankenstand bzw. Fehlzeiten, Verhältnis zum ärztlichen Personal, Unterstützung durch Ärzte, aufgewendete Arbeitszeit und andere mehr. 8 dieser 20 Merkmale konnten einen erheblichen Teil (knapp die Hälfte) der unterschiedlichen Sterbequoten in den verschiedenen Krankenhäusern erklären. In die Studie einbezogen waren alle Kliniken in Ontario im Jahre 2002 und 2003 mit Ausnahme kleinerer Häuser mit aktuell weniger als 100 Patienten. Insgesamt wurden Qualifikationsmerkmale und Arbeitsbedingungen von knapp 6.000 Pflegekräften in der Analyse berücksichtigt. Im Durchschnitt hatten 13% der Pfleger/innen eine hochqualifizierte Ausbildung (Hochschule), diese Quote als zentrales Merkmal der Pflegequalität variierte in den Kliniken jedoch zwischen 0 und 62%. In ähnlicher Weise zeigten sich auch für den Einsatz von Pflegeprotokollen massive Differenzen zwischen Kliniken und Abteilungen. In einigen Häusern bzw. Abteilungen lag diese Quote bei 29%, in anderen bei 85%.
In der Studie wurde auch berücksichtigt bzw. geprüft, ob die Ergebnisse möglicherweise dadurch beeinflusst sind, dass die in den einzelnen Kliniken behandelten Patienten auch unterschiedliche Merkmale aufweisen, die ebenfalls maßgeblich sein könnten für die Sterbequote. Dies könnte etwa bewirkt sein durch Differenzen im Lebensalter, Schweregrad der Erkrankung, Zweit-Erkrankungen und anderes mehr. Aufgrund von Patientenbögen konnte dies jedoch kontrolliert und in der Analyse mitberücksichtigt werden, d.h. es sind tatsächlich Merkmale der Pflegequalität und nicht Besonderheiten der Patienten, die fast zur Hälfte ursächlich sind für Überlebenschancen von Patienten.
Die Ergebnisse der Studie haben erhebliche Bedeutung auch für deutsche Verhältnisse. Zwar gibt es in Deutschland keine vergleichbar großen Differenzen in der Qualifikation des Pflegepersonals. Eine Hochschulausbildung im Fach "Pflegewissenschaft" weisen bei uns bislang nur verschwindend geringe Anteile des Personals auf. Gleichwohl sind andere Befunde der Studie durchaus übertragbar. Dies gilt etwa für die zeitliche Belastung der Pfleger/innen bzw. den Pflegeaufwand je Patient und ebenso für die systematische Verwendung von Pflegeprotokollen, wo es markante Differenzen zwischen einzelnen Kliniken gibt. Diese aber auch weitverbreitete Defizite und Unterschiede bei anderen Merkmalen der Struktur- und Prozessqualität der Behandlung im Krankenhaus (z.B. die Orientierung an so genannten "clinical pathways") förderte beispielsweise eine 2003 durchgeführte bundesweite Befragung von Pflegekräften in Akutkrankenhäusern zutage, die durch eine 2004 erfolgte Befragung von hessischen Krankenhausärzten in der Tendenz bestätigt wurden.
Nachdenklich stimmen muss in Anbetracht der Befunde aber auch, dass in Kliniken aufgrund des ökonomischen Drucks weiterhin Personal abgebaut wird und zwar insbesondere im Bereich der Pflege. So meldet das Krankenhaus-Barometer, eine repräsentative Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI), dass von 2002 bis 2004 insgesamt 12,2 Vollkraftstellen pro Krankenhaus gestrichen wurden. In den Jahren 2000 bis 2002 war der Stellenabbau nur etwa halb so hoch. Von der Personalreduzierung waren vor allem der Pflegedienst (-4,2 Prozent) und Mitarbeiter im Medizinisch-technischen Dienst (-1,1 Prozent) betroffen, während der Ärztliche Dienst Zuwächse um +4,2 Prozent vermeldet.
Die Studie wurde im Januar 2007 veröffentlicht im Journal of Advanced Nursing (Heft 57.1)
&bull, Kostenlos zugänglich ist eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Ergebnissen
&bull, und ein Abstract der Studie: "Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients"
Gerd Marstedt, 17.1.2007
"Intensivierte Pflege": Der Mehraufwand schlägt sich bei Patienten wie Pflegekräften positiv nieder
 Studien zur Alten- und Krankenpflege erbringen nicht selten Ergebnisse, die auf Versorgungsmängel hinweisen. (vgl. etwa: Forum Gesundheitspolitik: Kranken- und Altenpflege, Ältere Patienten). Eine Übersichtsarbeit im Rahmen des GMS Health Technology Assessment (HTA) hat sich nun jedoch einmal einigen - prima facie - besonders patienfreundlichen Formen der Pflege gewidmet, der sogenannten "Intensivierten Pflege". Mit dem Begriff werden Pflegetätigkeiten mit verstärktem Patientenkontakt angesprochen, mit stärkerer Berücksichtigung psychischer und sozialer Bedürfnisse der Patienten. Diese Pflegeform ist auch unter dem Begriff "advanced nursing practice" (ANP) bekannt.
Studien zur Alten- und Krankenpflege erbringen nicht selten Ergebnisse, die auf Versorgungsmängel hinweisen. (vgl. etwa: Forum Gesundheitspolitik: Kranken- und Altenpflege, Ältere Patienten). Eine Übersichtsarbeit im Rahmen des GMS Health Technology Assessment (HTA) hat sich nun jedoch einmal einigen - prima facie - besonders patienfreundlichen Formen der Pflege gewidmet, der sogenannten "Intensivierten Pflege". Mit dem Begriff werden Pflegetätigkeiten mit verstärktem Patientenkontakt angesprochen, mit stärkerer Berücksichtigung psychischer und sozialer Bedürfnisse der Patienten. Diese Pflegeform ist auch unter dem Begriff "advanced nursing practice" (ANP) bekannt.
Ausgewertet wurden nur methodisch kontrollierte Studien intensivierter Pflege (die nicht gleichzusetzen ist mit medizinischer Intensivpflege) aus den Bereichen Säuglings- und Kinderkrankenpflege, Gerontologie und Onkologie. In allen Studien wurde unter Hinzuziehung von Kontrollgruppen erforscht, inwieweit zusätzliche Maßnahmen psychischer und sozialer Zuwendung oder auch der Patientenschulung sich auch tatsächlich in einem besseren Gesundheitszustand oder höherer Lebenszufriedenheit der Patienten niederschlagen. Für alle (insgesamt 9) Studien zeigte sich, dass dies tatsächlich der Fall war. Das Fazit der Übersichtsarbeit lautete daher:
"Alle Studien, die statistische Vergleiche der Wirksamkeit intensivierter Pflegemaßnahmen mit den Standardpflegemodellen einschlössen, konnten Erfolge bzw. Verbesserungen in den Versuchsgruppen der intensivierten Pflege feststellen. Dies betraf vor allem psychische Faktoren, wie Ängstlichkeit, Depression, allgemeines Wohlbefinden und Patientenzufriedenheit. Die Einführung intensivierter Pflegemaßnahmen kann aufgrund dieser Studienlage nur befürwortet werden. Der in manchen Fällen notwendige anfängliche Mehraufwand kehrt sich schon in kürzester Zeit um und führt zu höherer Zufriedenheit bei Patienten sowie Pflegekräften. Außerdem sind positive Effekte auf viele psychische und physische Parameter zu erwarten." (S.8)
Ein Beispiel aus dem Bereich der Gerontologie: "An einer Studie, die sich mit den Effekten angeleiteter Bewegung von Pflegepatienten auf die Hautgesundheit der von der Inkontinenz betroffenen Hautteile beschäftigte, nahmen 144 inkontinente Bewohner aus vier verschiedenen Altenpflegeheimen teil. Als pflegerische Maßnahme führte das Forschungspersonal bei der Behandlungsgruppe alle zwei Stunden für fünf Tage in der Woche zwischen 8.00 Uhr und 16.30, für die Dauer von 32 Wochen eine Inkontinenzpflege und Bewegungsübungen durch. Zwischen den vier täglichen Behandlungsabläufen wurden die Teilnehmer zusätzlich motiviert auf die Toilette zu gehen, die Windel wurde immer sofort gewechselt, falls sie nass war. Sämtliche Veränderungen in der Inkontinenzpflege und der körperlichen Handlungsfähigkeit wurden in beiden Gruppen ständig überwacht und dokumentiert. Hingegen erhielt die Kontrollgruppe die übliche Standardpflege vom Pflegepersonal, für den gesamten Studienverlauf von 32 Wochen. (...) Es war ein signifikanter Unterschied der körperlichen Aktivität zwischen der Kontroll- und der Behandlungsgruppe zu beobachten, die Harn- und Stuhlinkontinenz verbesserten sich ebenfalls erheblich in der Behandlungsgruppe. Bei der Kontrollgruppe konnte keine Verbesserung festgestellt werden." (S.6)
Von den Autoren wird auch die ökonomische Frage angesprochen: Inwieweit hat eine "intensivierte Pflege" bei begrenzten finanziellen Ressourcen nicht nur in der Pflegeversicherung überhaupt eine Chance? Tatsächlich hat keine der besprochenen Studien sich diesen ökonomischen Aspekten gewidmet. In dem Bericht wird zumindest aber darauf hingewiesen, dass der höhere Pflegeaufwand sich gleichwohl "rechnen" könne: "Es ist anzunehmen, dass die Kosten durch den vermehrten Einsatz von Mitteln und den Mehraufwand an Zeit in die Höhe getrieben werden. Es können jedoch durch die intensivierte Pflege Einsparungen in Form von vermiedenen Therapien und Krankenhaustagen erreicht werden. Daher kann die intensivierte Pflege als ebenso ökonomisch wie herkömmliche Modelle angesehen werden."
Es gibt eine Kurzfassung des HTA-Berichts
und zum Download die komplette Dokumentation (47 Seiten): Bedeutung der intensivierten Pflege (Autoren: Wilhelm Frank, Brigitte Konta, Nina Prusa, Cornelia Raymann)
Gerd Marstedt, 2.1.2007
Prävention von Stürzen und Knochenbrüchen in Krankenhäusern und Pflegeheimen schwieriger und aufwändiger als gedacht
 Stürze und daraus resultierende Knochenbrüche gehören bei den dann auch meist noch älteren Bewohnern von Krankenhäusern und Pflegeheimen zu den gefürchtesten unerwünschten Ereignissen. Wie sie zu verhindern sind und welche Bedeutung bei diesem Geschehen Demenz und die Einschränkung der Wahrnehmungsfähigkeit älterer Menschen spielt, ist daher eine wichtige praktische Frage.
Stürze und daraus resultierende Knochenbrüche gehören bei den dann auch meist noch älteren Bewohnern von Krankenhäusern und Pflegeheimen zu den gefürchtesten unerwünschten Ereignissen. Wie sie zu verhindern sind und welche Bedeutung bei diesem Geschehen Demenz und die Einschränkung der Wahrnehmungsfähigkeit älterer Menschen spielt, ist daher eine wichtige praktische Frage.
Die in der Ausgabe des "British Medical Journal (BMJ)" vom 8. Dezember 2006 veröffentlichte Studie "Strategies to prevent falls and fractures in hospitals and care homes and effect of cognitive impairment: systematic review and meta-analyses" von Oliver et al. versuchte diese Frage durch einen systematischen Review und eine Meta-Analyse der dazu durchgeführten Primärstudien zu beantworten.
Die wichtigsten Antworten lauten:
• Für den Nutzen von Einzelmaßnahmen wie etwa bauliche Veränderungen, technische Hilfen wie ein Hüftschutz, gezielte Gaben von Vitaminen, die Aufklärung der Patienten oder Bewohner und Übungsprogramme allein findet sich weder in Krankenhäusern noch in Pflegeheimen ausreichende Evidenz. Dies trifft auch für mehrschichtige Interventionen in Pflergeheimen zu.
• In Krankenhäusern haben mehrschichtige Interentionen dagegen einen signifikanten Nutzen bei der Verhinderung von Stürzen aber keine signifikante Wirkung auf die Anzahl der stürzenden Patienten oder der Anzahl von Brüchen.
• In Pflegeheimen gibt es zwar Hinweise auf einen signifikanten präventiven Nutzen von "hip protectors", aber die geringe Anzahl von Untersuchungen lässt keine weiteren Schlussfolgerungen zu.
• Zwischen der Stärke der präventiven Wirkung und dem Auftreten von Demenz oder Wahrnehmungsdefiziten der Patienten gibt es keine signifikante Assoziation.
Hier finden Sie die PDF-Datei des Aufsatzes "Strategies to prevent falls and fractures in hospitals and care homes and effect of cognitive impairment: systematic review and meta-analyses"
Bernard Braun, 14.12.2006
Unterstützung der Pflegepersonen von Demenzkranken wichtig und wirksam
 Eine systematische soziale und mentale Unterstützung von Personen, die mit der Pflege von Demenz- oder Alzheimerkranken befasst sind, z.B. durch Sozialarbeiter, Pflegemanager, Informationsmaterial oder Unterstützungsgespräche (hier handelt es sich um das so genannte REACH-Programm: Resources for Enhancing Alzheimer's Caregiver Health II) reduziert deren Risiko für Depressionen signifikant, verbessert ihre Lebensqualität und steigert ihre Bereitschaft sich an Leitlinien zu orientieren.
Eine systematische soziale und mentale Unterstützung von Personen, die mit der Pflege von Demenz- oder Alzheimerkranken befasst sind, z.B. durch Sozialarbeiter, Pflegemanager, Informationsmaterial oder Unterstützungsgespräche (hier handelt es sich um das so genannte REACH-Programm: Resources for Enhancing Alzheimer's Caregiver Health II) reduziert deren Risiko für Depressionen signifikant, verbessert ihre Lebensqualität und steigert ihre Bereitschaft sich an Leitlinien zu orientieren.
Das ist jedenfalls das Ergebnis zweier randomisierter kontrollierter Studien mit Teilnehmern aus verschiedenen ethnischen Gruppen in den USA, die jetzt in der Zeitschrift "Annals of Internal Medicine" vom 21. November 2006 (Volume 145, Heft 10: 727-738 und 713-726) erschienen sind. Der Effekt der unterstützenden Aktivitäten für Pflegende und Gepflegte wurde für einen Zeitraum von 6 bzw. 12 Monaten nachgewiesen. Was sich zwischen den unterstützten und nichtunterstützten Pflegepersonen nicht unterschied, waren allerdings die Raten der Heimeinweisung der von ihnen gepflegten Personen.
Hier finden Sie ein Abstract des Aufsatzes "Enhancing the Quality of Life of Dementia Caregivers from Different Ethnic or Racial Groups. A Randomized, controlled Trial".
Bernard Braun, 21.11.2006
Pflegekräftemangel: Burn-Out und erhöhte Patientensterblichkeit
 Die gerade über England in der Fachzeitschrift "International Journal of Nursing Studies" publizierten Ergebnisse der in Krankenhäusern in den USA, Schottland, Kanada, England und Deutschland durchgeführten "International Hospital Outcomes Study" zeigen zusätzlich zum bei den hoch belasteten Pflegekräften verbreiteten Burn-Out einen eindeutigen Zusammenhang von zu geringer Anzahl von Pflegekräften und Patientensterblichkeit.
Die gerade über England in der Fachzeitschrift "International Journal of Nursing Studies" publizierten Ergebnisse der in Krankenhäusern in den USA, Schottland, Kanada, England und Deutschland durchgeführten "International Hospital Outcomes Study" zeigen zusätzlich zum bei den hoch belasteten Pflegekräften verbreiteten Burn-Out einen eindeutigen Zusammenhang von zu geringer Anzahl von Pflegekräften und Patientensterblichkeit.
Das "Deutsche Ärzteblatt" vom 24.10. 2006 fasst das folgendermaßen zusammen: "Prof. Anne Marie Rafferty, die Leiterin der Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery in London, hat die Daten von 118.752 Patienten ausgewertet, die an 30 Kliniken in England von fast 4.000 Krankenschwestern betreut wurden. Der Pflegeschlüssel betrug zwischen 6,9 und 14,3 Patienten, den eine Schwester oder ein Pfleger auf Station zu betreuen hatte. Die Analyse ergab eine Korrelation zwischen dem Pflegeschlüssel und der Sterblichkeit der Patienten. Auf den pflegerisch unterbesetzten Stationen war die Sterblichkeit um 26 Prozent erhöht, schreibt die Autorin. Bezogen auf England ergebe dies pro Jahr 246 zusätzliche Todesfälle."
Die aus den Jahren 19998/99 stammenden Daten aus englischen Krankenhäusern bestätigen im übrigen die ebenfalls bereits veröffentlichten Ergebnisse aus Schottland und den USA.
Bernard Braun, 2.11.2006
"Pflege ohne Druck" - Bayerische Studie zum Vorkommen und zur Prophylaxe von Dekubitus veröffentlicht
 Ein Dekubitus ist eine durch länger anhaltenden Druck entstandene Schädigung der Haut und des darunter liegenden Gewebes. Nach vorsichtigen Schätzungen entwickeln in Deutschland jährlich mehr als 400.000 Menschen einen Dekubitus. Vornehmlich sind ältere, pflegebedürftige und vor allem immobile Menschen betroffen. Allein die Therapie von Decubitalulcera Grad III und IV verursacht jährliche Kosten von etwa 1 bis 2,1 Milliarden Euro.
Ein Dekubitus ist eine durch länger anhaltenden Druck entstandene Schädigung der Haut und des darunter liegenden Gewebes. Nach vorsichtigen Schätzungen entwickeln in Deutschland jährlich mehr als 400.000 Menschen einen Dekubitus. Vornehmlich sind ältere, pflegebedürftige und vor allem immobile Menschen betroffen. Allein die Therapie von Decubitalulcera Grad III und IV verursacht jährliche Kosten von etwa 1 bis 2,1 Milliarden Euro.
Aus diesem Grund hat das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen im Rahmen der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Altenpflege dem Thema Dekubitus einen besonderen Stellenwert eingeräumt und das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO mit der Durchführung einer Untersuchung aller stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste zum Thema Dekubitus beauftragt. In der vorliegenden Studie wurden erstmals flächendeckend Daten für das Bundesland Bayern zur Dekubitushäufigkeit, den Risikofaktoren sowie den in der Praxis eingesetzten prophylaktischen Maßnahmen und Therapien erhoben. Die
Erfahrungen der Pflegekräfte aus der Praxis bildeten wichtige Ansatzpunkte zur Identifikation von Verbesserungspotenzialen in der Dekubitusversorgung. Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Studie beinhalten Impulse für eine bessere Versorgung von dekubitusgefährdeten Menschen.
Die Untersuchung liefert sehr detaillierte Daten und Informationen, angereichert durch Tabellen und Grafiken, zu den Themen: Dekubitusrisiko, Dekubitushäufigkeit, Risikofaktoren, Prophylaxe, Expertenstandard, Dekubitustherapie, Dokumentation, Fortbildung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Hilfsmittelverordnung. Basis der Studie sind Fragebogen-Erhebungen bei allen stationären Plegeeinrichtungen und ambulanten Diensten in Bayern.
Der 146seitige Bericht ist jetzt kostenlos beim Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen als PDF-Datei herunterzuladen: Pflege Ohne Druck - Dekubitus: Ursachen der Entstehung, prophylaktische Maßnahmen und Rahmenbedingungen in der häuslichen und stationären Altenhilfe in Bayern
Gerd Marstedt, 28.12.2005
Gesundheitspolitische Reaktionsrituale und Problemverdrängungsmechanismen am Beispiel der Altenpflege
 "Die Würde des Menschen ist unantastbar, falls diese finanzierbar ist." Dies gilt nach Meinung von Claus Fussek und Sven Loerzer, zwei engagierten Beobachtern und Kritikern des herrschenden Pflegesystems, uneingeschränkt für die Pflege älterer Menschen.
"Die Würde des Menschen ist unantastbar, falls diese finanzierbar ist." Dies gilt nach Meinung von Claus Fussek und Sven Loerzer, zwei engagierten Beobachtern und Kritikern des herrschenden Pflegesystems, uneingeschränkt für die Pflege älterer Menschen.
In einem bitterbösen Artikel in der "Frankfurter Rundschau" vom 28.11. 2005 ("Was darf Menschenwürde kosten? Politik und Finanziers von Altenheimen denken nicht daran, den Pflegenotstand wirklich zu beseitigen") skizzieren sie am Beispiel der in letzter Zeit immer wieder bekannt gewordenen "Pflegeskandale" in Pflegeheimen (z.B. unzureichende Verpflegung und so genannte "Fixierungen") ein System organisierter Ent-Verantwortung oder Nichtzuständigkeit.
Dieses System schiebt die Probleme so vielfältig und vielfach durch ein Gewirr von "fein abgestuften Reaktionsrituale" wie Anfragen, Arbeitsgruppen, Eckpunktepapiere, freiwillige Selbstverpflichtungen, Studien, Modellprojekte und Evaluationen hin und her, bis sie kein relevantes Thema mehr sind.
Egal welche anderen Problemzonen der gesundheitlichen Versorgung man kennt: Man bekommt bei diesen Schilderungen und den zitierten Schlagworten und Methoden das Gefühl nicht los, dies alles auch schon dort als Problembearbeitungs-Bausteine kennengelernt zu haben.
Nimmt man die tiefe konkrete Verärgerung und den praktischen Zynismus aus der Skizzierung dieser Strategien durch die beiden Autoren heraus, hat man ein durchaus ertragreiches Modell zur Analyse und Kritik der Form realer gesundheitspolitischer Veränderungen.
Dies gilt leider auch für die von den beiden Pflegekritikern skizzierten abwehrenden Reaktionen professioneller Pflegenden und ihrer Verbände auf eine "Charta der Rechte der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen", die von einer Arbeitsgruppe des von der Bundesregierung eingesetzten "Runden Tisches Pflege" erarbeitet wurde.
Bernard Braun, 29.11.2005
Vergleich der Gesundheits- und Pflegeversorgung älterer Menschen in 19 OECD-Ländern
 Wer für die in Deutschland bevorstehende Debatte über die Zukunft der Pflegeversicherung oder die Möglichkeiten der Gesundheits- und Pflegeversorgung für ältere Menschen nach einer seriösen Quelle für systematische und empirische Argumente aus anderen Ländern sucht, dem sei ein im Juli erschienener OECD-Bericht empfohlen. Auf 138 Seiten werden beispielsweise die Nachfrage nach Pflegeangeboten, die Lösungsversuche, die Finanzierung, die Modelle integrierter Versorgung und die damit gemachten Erfahrungen sowie die Qualitätssicherung von Pflege in 19 OECD-Ländern (darunter z.B. Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, USA und auch Deutschland) dargestellt. Zu den gut dokumentierten Fragen gehört z.B. die für die betroffenen Personen wie die Öffentlichkeit wichtige Frage, was getan wird, damit möglichst viele Menschen im Alter zu Hause leben können.
Wer für die in Deutschland bevorstehende Debatte über die Zukunft der Pflegeversicherung oder die Möglichkeiten der Gesundheits- und Pflegeversorgung für ältere Menschen nach einer seriösen Quelle für systematische und empirische Argumente aus anderen Ländern sucht, dem sei ein im Juli erschienener OECD-Bericht empfohlen. Auf 138 Seiten werden beispielsweise die Nachfrage nach Pflegeangeboten, die Lösungsversuche, die Finanzierung, die Modelle integrierter Versorgung und die damit gemachten Erfahrungen sowie die Qualitätssicherung von Pflege in 19 OECD-Ländern (darunter z.B. Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, USA und auch Deutschland) dargestellt. Zu den gut dokumentierten Fragen gehört z.B. die für die betroffenen Personen wie die Öffentlichkeit wichtige Frage, was getan wird, damit möglichst viele Menschen im Alter zu Hause leben können.
Hier finden Sie den kostenpflichtigen OECD-Bericht "Long-term Care for older people" Link
Website Long-Term Care for Older People: OECD study (2001-2004) Link
Bernard Braun, 19.9.2005
Risiko der Pflegebedürftigkeit in Deutschland sinkt
 Mit Daten des "Sozioökonomischen Panels (SOEP)" untersuchten zwei Wissenschaftlerinnen des Rostocker "Max Planck-Instituts für Demografische Forschung" die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit zwischen 1991 und 2003.
Mit Daten des "Sozioökonomischen Panels (SOEP)" untersuchten zwei Wissenschaftlerinnen des Rostocker "Max Planck-Instituts für Demografische Forschung" die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit zwischen 1991 und 2003.
In einem 2005 im viermal jährlich gedruckt und als PDF-Datei erhältlichen und stets lesenswerten "Information Letter Demografische Forschung aus erster Hand" veröffentlichten Beitrag kommen sie zu dem Schluss, "dass die Alterung der Bevölkerung nicht von einem parallelen Anstieg der Zahl der pflegebedürftigen Personen begleitet sein muss." Zur weiteren Zukunft prognostizieren sie: "Kommende Generationen werden zunehmend an der sich seit den 60er- Jahren ausbreitenden Bildungsexpansion partizipiert haben, wodurch sich das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung erhöht. Diese Faktoren sprechen dafür, dass das Pflegerisiko weiter sinken wird."
Hier finden Sie die Infoletter-Ausgabe mit den Ergebnissen der SOEP-Analyse
Bernard Braun, 7.8.2005
Unterernährung und mangelnde Dekubitusversorgung in der Altenpflege
 Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) führt im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen und mit Ankündigung nichtrepräsentative Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtungen durch. Im jüngsten, im November 2004 veröffentlichten, Ergebnisbericht der Qualitätsprüfungen nach § 118 SGB XI finden sich u.a. folgende Belege für erhebliche Defizite der Prozessqualität:
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) führt im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen und mit Ankündigung nichtrepräsentative Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtungen durch. Im jüngsten, im November 2004 veröffentlichten, Ergebnisbericht der Qualitätsprüfungen nach § 118 SGB XI finden sich u.a. folgende Belege für erhebliche Defizite der Prozessqualität:
• 41 Prozent der untersuchten Personen im vollstationären Bereich wurden bei der Ernährungs- und Flüssigkeitsaufnahme unterversorgt. Wichtige Anforderungen wie z.B. die Kontrolle des Gewichtsverlaufs, die Risikoerkennung oder die Planung sachgerechter Maßnahmen waren nicht erfüllt. Etwas besser sah es im ambulanten Bereich aus, wo "nur" 37 Prozent der Pflegebedürftige mangelhaft ernährt wurden.
• 43 Prozent aller Versicherten, die bezüglich dieser Fragestellung im vollstationären Bereich in Augenschein genommen wurden, wurden bei vorliegendem Dekubitusrisiko oder einem entstandenen Dekubitus (Druckgeschwür) nicht angemessen versorgt.
Der Umfang der Ernährungsdefizite ist umso problematischer, weil sie bereits früher vermutet wurden und eine Veröffentlichung des MDK aus dem Jahre 2003 (Grundsatzstellungnahme Ernährung und Flüssigkeitsversorgung älterer Menschen, Juli 2003), sehr differenzierte und praktische Vorschläge machte, wie die Situation zu verbessern ist. Die 5000 verbreiteten Exemplare scheinen allerdings ein Jahr später noch nicht bei allen Adressaten angekommen zu sein.
Bernard Braun, 4.8.2005