



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Rehabilitation, Kuren |
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Alle Artikel aus:
Patienten
Rehabilitation, Kuren
Rehabilitation und Vorsorge für Mütter, Väter, Kinder und pflegende Angehörige - Bedarf, Wirkungen, Reformbedarf
 Die Datenbasis für diese Studie lieferten vor Beginn der Covid-19-Pandemie eine repräsentative bundesweite Befragung von 1.330 Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen und eine Befragung aller 960 Beratungsstellen (Rücklauf: 346 Stellen). Unter den Bedingungen der Pandemie wurden außerdem 73 Einrichtungen aus dem Verbund des Müttergenesungswerks (Rücklauf n=48), 1.050 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Rücklauf n=139), 1.650 ehemalige Patient*innen aus 55 MGW-Einrichtungen (Rücklauf n=671) und15 Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Beschäftigten in Einrichtungen befragt bzw. interviewt. Da das Projekt nicht verschoben werden konnte (unklar war aber auch, wann das "Ende der Pandemie" zu erwarten war und ob dies dann die Rückkehr zur vorherigen Normalität bedeuten würde), beeinflussen die Erfahrungen mit der Pandemie mit Sicherheit viele Antworten der befragten Väter und Mütter - ohne dass dieser Einfluss quantifiziert werden kann. Projektbegleitend tagte ein Begleitkreis aus Vertreter*innen der Trägerorganisationen (z.B. Caritas) der MGW-Einrichtungen und Angehörigen der Fachabteilung des BMFSFJ und war u.a. an der Erstellung von Fragebögen beteiligt.
Die Datenbasis für diese Studie lieferten vor Beginn der Covid-19-Pandemie eine repräsentative bundesweite Befragung von 1.330 Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen und eine Befragung aller 960 Beratungsstellen (Rücklauf: 346 Stellen). Unter den Bedingungen der Pandemie wurden außerdem 73 Einrichtungen aus dem Verbund des Müttergenesungswerks (Rücklauf n=48), 1.050 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Rücklauf n=139), 1.650 ehemalige Patient*innen aus 55 MGW-Einrichtungen (Rücklauf n=671) und15 Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Beschäftigten in Einrichtungen befragt bzw. interviewt. Da das Projekt nicht verschoben werden konnte (unklar war aber auch, wann das "Ende der Pandemie" zu erwarten war und ob dies dann die Rückkehr zur vorherigen Normalität bedeuten würde), beeinflussen die Erfahrungen mit der Pandemie mit Sicherheit viele Antworten der befragten Väter und Mütter - ohne dass dieser Einfluss quantifiziert werden kann. Projektbegleitend tagte ein Begleitkreis aus Vertreter*innen der Trägerorganisationen (z.B. Caritas) der MGW-Einrichtungen und Angehörigen der Fachabteilung des BMFSFJ und war u.a. an der Erstellung von Fragebögen beteiligt.
Mit einer Vielzahl von Fragen, die bereits 2007 in einer ersten Studie zur Ermittlung des Bedarfs an Mutter-, Vater-Kind-Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen nach §§ 24 und 41 SGB V gestellt, und für die aktuelle Studie nur noch z.B. um Fragen zu psychischen Beschwerden ergänzt wurden, wurde der Gesundheitszustand und die Belastungssituation von 1.330 Angehörigen dieser Zielgruppen als objektiver Bedarf für stationäre Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahmen erhoben.
Der Anteil der Personen mit Bedarf sah differenziert nach Untergruppen so aus:
• 18,9 % aller Mütter, Väter und pflegenden Angehörigen,
• 23,9 % der Frauen und 13,8 % der Männer,
• 33 % der Mütter und Väter, die Angehörige pflegen und
• 75 % der Eltern von Kindern mit einer Behinderung
hätten aufgrund ihrer gesundheitlichen und Belastungssituation eine Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahme benötigt.
Trotzdem überlegten sich nur 21,9 % dieser Personen, eine stationäre Maßnahme jedweder Art zu beantragen.
Zu den Gründen zählt weniger die Unkenntnis des Angebots (62,5 % gaben an, es zu kennen), sondern z.B. die im Vergleich mit "richtig Kranken" Unterschätzung des eigenen Bedarfs, Nachteile am Arbeitsplatz, die Scheu Pflegebedürftige während der Inanspruchnahme einer eigenen Maßnahme nicht in "fremde Hände" zu übergeben oder nicht den/die, Partner(in) allein zu lassen.
Weitere wichtige Ergebnisse der Studie lauten:
• 51 % der ehemaligen Patient*innen nutzten vor einer Maßnahme eine Beratungsstelle und 92 % von ihnen bewerteten deren Beratungsleistung mit gut/sehr gut
• rund 20 % der für eine Vorsorgemaßnahme zugewiesenen Patient*innen erwiesen sich nach der Eingangsuntersuchung in der Einrichtung als eine Person mit Rehabilitationsbedarf.
• Zu dem für die Nachhaltigkeit der Maßnahmewirkungen wichtigen Erhalt von Hinweisen über Nachsorgeangebote (schon seit längerem mit dem Begriff der "therapeutischen Kette" thematisiert) und ihrer Nutzung im Alltag nach der Maßnahme, gibt es u.v.a. folgende Ergebnisse: In ihrer Wahrnehmung erhielt die Mehrheit der zum Maßnahmezeitpunkt mehrheitlich schwer kranken und vielfach belasteten Patient*innen keine systematischen und breiten Hinweise auf gesundheits- und belastungsbezogene Nachsorgeangebote. Bei Gesundheitsangebote (z.B. Ernährung, Bewegung) sah dies etwas besser, bei Angeboten zur Bewältigung von erneuten Belastungen (z.B. Kindererziehung, Geschlechterrollen) etwas schlechter aus. Sofern solche Angebote überhaupt bekannt waren, wurden sie bis zum Zeitpunkt der Befragung nur gering bis sehr gering genutzt. Ein Teil der Befragten wollten sie aber später nutzen. Auch wenn es schon zahlreiche Hinweise auf Gründe der Nicht- oder Nochnichtnutzung gibt (z.B. Zeitmangel, keine Kinderbetreuungsmöglichkeit und die Nichtexistenz von Angeboten vor Ort) sollte das gesamte Nachsorgegeschehen noch gründlicher untersucht werden. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, weil die Nutzung diverser Nachsorgeangebote statistisch signifikante positive Effekte auf den Gesundheits- und Belastungszustand der ehemaligen Patient*innen hat.
• Die Wirkungen der Maßnahmen sahen aus Sicht der ehemaligen Patient*innen so aus: Es gibt eine deutliche Verbesserung des Gesundheits- und Belastungszustands am Ende der Maßnahme (vor Maßnahme: Gesundheit mangelhaft/schlecht=71 % und Belastungssituation sehr/eher belastet=95 %; am Ende der Maßnahme: 6 %; 27 %). Zum Befragungszeitpunkt, also rund 6 Monate nach Beendigung der Maßnahme finden sich aber deutliche Reboundeffekte (Gesundheit mangelhaft/schlecht : 18 %; Belastungssituation sehr/eher belastet: 52 %).
• Zu den versorgungspolitischen Schlussfolgerungen der Studie gehören u.a. die angesichts des Bedarfs (evtl. noch verstärkt durch die Langfristauswirkungen der Pandemie) notwendige Ausweitung der Kapazitäten für Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen für Mütter, Väter und pflegende Angehörige, die Organisation und Vergütung von Beratungsleistungen vor und nach der Maßnahme als Leistungsbestandteil, die systematische Vorbereitung aller Beteiligten auf neue Zielgruppen, die Verbesserung der spezifischen Informationen für Angehörige der neuen Zielgruppen (Väter und pflegende Angehörige), die Qualifizierung der Beratungsstellen für neue Zielgruppen, Ausbau der Kooperation in multiprofessionellen Teams, die bessere Berücksichtigung der Spezifika von Mütter/Väter/pflegende Angehörigen-Maßnahmen im QS Reha®-Verfahren, die deutliche Verbesserung der Nachsorgeangebote als Bedingung für Nachhaltigkeit: Nachsorgeberatung Pflichtleistung, Evaluation der Nicht-Inanspruchnahme und Modellversuche und der verstärkte Auf- und Ausbau interministerieller Verantwortung und Kooperation zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Der Endbericht der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellten Studie zur Untersuchung der Bedarfe von Müttern/Vätern und pflegenden Frauen und Männern (mit und ohne Kinder im Haushalt) in Vorsorge- und Reha-Maßnahmen in Einrichtungen des Müttergenesungswerkes verfasst von Jörn Sommer, Bernard Braun und Stefan Meyer, ist komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.7.21
Ist die medizinische Rehabilitation chronischer Rückenschmerzen wirksamer als Urlaub? Mangels Studien ist dies im Moment offen!
 "Die Frage nach der Wirksamkeit der medizinischen Rehabilitation im Indikationsgebiet "chronische Rückenschmerzen" im Vergleich zu einer Nicht-Intervention, einem Urlaub, einer Selbstbehandlung bzw. einer ambulanten Behandlung durch Praxisärzte bleibt somit weiter offen."
"Die Frage nach der Wirksamkeit der medizinischen Rehabilitation im Indikationsgebiet "chronische Rückenschmerzen" im Vergleich zu einer Nicht-Intervention, einem Urlaub, einer Selbstbehandlung bzw. einer ambulanten Behandlung durch Praxisärzte bleibt somit weiter offen."
Mit dieser Feststellung fassen die Lübecker Sozialmediziner Heiner Raspe und Angelika Hüppe ihren Bericht an den "Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen" zum Thema "Evidenzbasierung in der medizinischen Rehabilitation: eine systematische Literaturübersicht am Beispiel der Indikation chronischer Rückenschmerz" zusammen.
Sie untersuchten und bewerteten u.a. die methodische Qualität von 28 aus einer mehrere Hundert umfassenden Anzahl von interventionellen und vergleichenden Primärstudien, die in einem "wissenschaftlichen Fachjournal im Zeitraum 2000 bis 10/2013 in deutscher oder englischer Sprache publiziert wurden und die Aussagen zu differentiellen Effekten, Wirksamkeit, (Netto)Nutzen oder Effizienz von Rehabilitationskonzepten oder -modulen treffen".
Die Bedeutung dieser Untersuchung rührt u.a. aus der Tatsache, dass sich der "größte Teil der von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) gewährten regelmäßig multidisziplinären und multimodalen Leistungen … auf Versicherte mit muskuloskelettalen Erkrankungen (31 %) und hier vor allem auf unspezifische Rückenschmerzen (ICD M50-54: 54 %, d.h. 17 % vom Gesamt)" bezieht. Diese Leistungen werden im Moment in bundesweit mehr als 500 Fach-Rehakliniken erbracht.
Als wesentliche Defzite der Erkenntnislage zur Rehabilitation der Volkskrankheit unspezifische chronische Rückschmerzen nennen die Autoren u.a. folgende:
• Das Fehlen von Untersuchungen zur "absoluten" Wirksamkeit der medizinisch-beruflichen Rehabilitation
• "Eine wissenschaftliche Aktivierung und Selbstständigkeit einer größeren Zahl von Rehabilitationskliniker bzw. -kliniken hat sich durch die annähernd zehnjährige Förderung der Rehaforschungsverbünde offensichtlich nicht erreichen lassen."
• Die aus den Studien zu gewinnende Evidenzbasis der Rehabilitation chroinischer Rückenschmerzen wird "nur als 'befriedigend'" eingestuft. "Die Studienlage zur absoluten Wirksamkeit ist 'ungenügend'."
• "In kaum einem Fall scheinen" die Studien "zu einer Umgestaltung der Verwaltungs- und Organisationsroutinen der Rehabilitationsträger geführt zu haben, wenn man von der zunehmenden Betonung der ambulanten Rehabilitationsformen in unserem Indikationsbereich absieht. Dies wäre z.B. bei den Ergebnissen der beiden Untersuchungen zu Zuweisungsmodalitäten sowie der einen zum Nachsorgeprogramm zu erwarten gewesen."
• "Studien zur Kosteneffizienz … sind insgesamt selten; die auffindbaren sind deskriptiv und berücksichtigen nur die Kostenträgerperspektive. Interventionelle Studien zu Erhöhung der Effizienz fehlen."
• Fast sämtliche Studien konzentrierten sich auf Reha-Leistungen der DRV und damit überwiegend auf die Leistungen für noch erwerbstätige Personen. Für nicht mehr erwerbstätige, ältere Personen, für deren Reha nach dem SGB IX die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der verantwortliche Träger ist, fehlen also die wissenschaftlichen Belege für den Nutzen dieser Leistungen in hohem Maße.
• Die eingangs des Gutachtens formulierte These, "nach allem, was wir über die Wirksamkeit und den Nutzen der medizinischen Rehabilitation bei chronischen Rückenschmerzen wissen", sei "bisher nur mit durchschnittlich schwachen bis moderaten Effekten zu rechnen" wird durch ihre Ergebnisse bestätigt.
Das Gutachten kritisiert nicht nur die Methodik oder den Approach der Studien, sondern skizziert auch noch sehr detailreich ein optimiertes methodisches Design für zukünftige Evaluationen.
Den 40-seitigen
Bericht gibt es kostenlos auf der Website des Sachverständigenrat.
Bernard Braun, 17.9.14
"Bloß keine richtig Alten oder Sprechbehinderten": Altersdiskriminierung und Selektion Schwerstkranker in Stroke-Reha-Studien
 Ein Teil der Schreckensszenarien über die gesundheitliche Last der demografischen Entwicklung kreist daher um die oftmals dauerhaften körperlichen und mentalen Einschränkungen bei den meist älteren PatientInnen. Im Mittelpunkt von Versorgungsforschungsstudien zur akuten und rehabilitativen Behandlung dieser Patienten müssten daher gerade auch ältere Personen stehen - eigentlich!!
Ein Teil der Schreckensszenarien über die gesundheitliche Last der demografischen Entwicklung kreist daher um die oftmals dauerhaften körperlichen und mentalen Einschränkungen bei den meist älteren PatientInnen. Im Mittelpunkt von Versorgungsforschungsstudien zur akuten und rehabilitativen Behandlung dieser Patienten müssten daher gerade auch ältere Personen stehen - eigentlich!!
Ein am 18. März 2014 veröffentlichter Review von 182 randomisierten kontrollierten Studien über die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten zeigt aber, dass dies nicht der Fall ist.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Während das Durchschnittsalter der in akut-ärztlicher Behandlung befindlicher Schlaganfallpatienten bei 75 Jahren liegt, sind die Teilnehmer der untersuchten RCTs durchschnittlich 64,3 Jahre alt. In einigen Ländern beträgt diese Alterslücke sogar 11-12 Jahre.
• In 46% der RCTs wurden Patienten mit kognitiven Einschränkungen ausgeschlossen.
• Das Gleiche gilt in 23% der Studien für Schlaganfallpatienten mit Sprachausdrucks- oder Sprachkoordinationsstörung - also einer nicht kleinen und irrelevanten, ja sogar typischen Betroffenengruppe.
• In 13% der RCTs wurden schließlich auch noch Patienten ausgeschlossen, die bereits mehrere Schlaganfälle hatten.
Dies bedeutet alles in allem, dass die am schwersten Erkrankten und Rehabilitationsbedürftigen nicht in Studien vertreten waren, die eigentlich repräsentativ für alle Schlaganfallpatienten die Wirkung unterschiedlicher rehabilitativer Interventionen untersuchen und ecidenzbasierte Behandlungshinweise liefern sollten. Zu den wesentlichen Gründen zählen die AutorInnen des Reviews den notwendig höheren und phantasievolleren Aufwand, der betrieben werden muss, wenn diese Patientengruppe in RCTs aufgenommen werden. Wenn aber noch nicht einmal unter den besonderen Bedingungen von Studien alle Typen oder nur eine hochselektierte Gruppe von Patienten vertreten sind, wäre es nicht verwunderlich, wenn unter den Alltagsbedingungen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten mit denselben Argumenten ältere und aufwändigere Patienten auch diskriminiert würden.
Dazu äußern sich die irischen AutorInnen des Reviews zwar nicht, fassen aber die weitreichenden Auswirkungen ihrer Untersuchungsergebnisse folgendermaßen zusammen: "However, it is important that this more vulnerable cohort of patients is represented adequately in trials, not only because they reflect an appreciable proportion of patients suffering from stroke internationally but also to ensure that the development of evidence-based rehabilitation methods is both appropriate and applicable to this age group."
Der dreiseitige Report Ageism in stroke rehabilitation studies von Eva Joan Gaynor, Sheena Elizabeth Geoghegan und Desmond O'Neill ist in der Fachzeitschrift "Age and Ageing" erschienen und online vorab am 18. März veröffentlicht worden. Der Bericht ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.3.14
Es müssen nicht immer teure High-Tech-Interventionen sein! Ein Beispiel aus der Schlaganfall-Rehabilitation.
 Zu den wichtigsten Bestandteilen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, die noch eine gewisse Restbeweglichkeit behalten oder schon wieder erreicht haben, gehören systematische Bewegungsübungen. Die Nutzung eines kostspieligen mechanischen Heimtrainers oder Laufgeräts ("tread mill") samt einer aufwändigen und wartungsintensiven Einrichtung, welche von seinem Körpergewicht abhängig und mittels eines Sicherheitsgürtels für die Standsicherheit des Rehabilitanden beim Training sorgt (so genanntes Locomotor-System), ist normalen abwechslungsreichen Bewegungsübungen unter Anleitung eines Physiotherapeuten nicht überlegen. Und zwar auch in allen möglichen Untergruppen.
Zu den wichtigsten Bestandteilen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, die noch eine gewisse Restbeweglichkeit behalten oder schon wieder erreicht haben, gehören systematische Bewegungsübungen. Die Nutzung eines kostspieligen mechanischen Heimtrainers oder Laufgeräts ("tread mill") samt einer aufwändigen und wartungsintensiven Einrichtung, welche von seinem Körpergewicht abhängig und mittels eines Sicherheitsgürtels für die Standsicherheit des Rehabilitanden beim Training sorgt (so genanntes Locomotor-System), ist normalen abwechslungsreichen Bewegungsübungen unter Anleitung eines Physiotherapeuten nicht überlegen. Und zwar auch in allen möglichen Untergruppen.
Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA, in der 408 Personen, die zwei Monate vor dem Start der Rehabilitation einen Schlaganfall erlitten hatten, einer von drei Rehabilitationsgruppen zugewiesen wurden. Einer so genannten Locomotor-Gruppe, die bereits 2 Monate nach dem Schlaganfall mit dem Training begann, einer Gruppe, die erst 6 Monate nach dem Ereignis mit dieser Art der Rehabilitation begann und einer dritten Gruppe, die 2 Monate nach dem Schlaganfall mit einem traditionellen Heimübungsprogramm unter Begleitung eines Physiotherapeuten startete. Jede Intervention schloss 36 Sitzungen à 90 Minuten im Verlaufe von 12 bis 16 Wochen ein. Der primäre Endpunkt der Studie war eine Verbesserung der Fähigkeit funktional zu gehen spätestens ein Jahr nach dem Schlaganfall.
Diesen Zustand erreichten 52% aller TeilnehmerInnen. Weder zwischen der früh gestarteten noch der spät gestarteten Locomotor-Gruppe und der Heimübungsgruppe gab es statistisch signifikante Unterschiede z.B. bei der Gehgeschwindigkeit, dem Balanciervermögen und der Lebensqualität. Weder Verzögerungen beim späteren Beginn des Heimtrainer- bzw. "Tretmühlen"trainings noch die Ernsthaftigkeit der initialen Behinderung oder Schädigungen wirkten sich signifikant auf das Beweglichkeitsergebnis nach einem Jahr aus.
Insgesamt kam es während der Rehabilitationsmaßnahmen lediglich zu zehn ernsthaften unerwünschten Wirkungen. Im Vergleich mit der Heimübungsgruppe hatten beide Heimtrainer-Gruppen eine signifikant größere (p=0.008) Häufigkeit von Schwindelgefühlen und Ohnmachten. Mehrfachstürze waren unter den Patienten mit ernsten Gehbehinderungen in der Heimtrainer-Gruppe, die schon 2 Monate nach dem Schlaganfall mit der Rehabilitation begannen, mehr verbreitet als in beiden Vergleichsgruppen.
Von der im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (364 (21): 2026-36) am 26. Mai 2011 erschienenen randomisierten und kontrollierten Studie "Body-weight-supported treadmill rehabilitation after stroke" von Duncan PW et al. ist lediglich das Abstract kostenlos erhältlich.
Mit dieser Studie wird aktuell die Gesamtbewertung des Cochrane Reviews "Treadmill training and body weight support for walking after stroke" von Moseley et al. aus den Jahren 2003 und 2005 bestätigt und untermauert. Dessen Conclusio lautete: "Overall no statistically significant effect of treadmill training with or without body weight support was detected. Although individual studies suggested that treadmill training with body weight support may be more effective than treadmill training alone and that treadmill training plus task-oriented exercise may be more effective than sham exercises, further trials are required to confirm these findings."
Bernard Braun, 11.7.11
Befragung von Nutzerinnen einer Mutter-Kind-Kur: Hoher Bedarf, großer und nachhaltiger Nutzen und wie dieser erhöht werden kann!
 "Versicherte haben … Anspruch auf aus medizinischen Gründen erforderliche Rehabilitationsleistungen in einer Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung; die Leistung kann in Form einer Mutter-Kind-Maßnahme erbracht werden" (§ 41 SGB V)
"Versicherte haben … Anspruch auf aus medizinischen Gründen erforderliche Rehabilitationsleistungen in einer Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung; die Leistung kann in Form einer Mutter-Kind-Maßnahme erbracht werden" (§ 41 SGB V)
Den Bedarf für solche Maßnahmen hat das Bundesfamilienministerium beziffert. Etwa 2,1 Millionen Mütter sollen demnach kurbedürftig sein. Trotzdem sinken die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Mütter-Kind- oder auch Vater-Kuren. Von 2009 auf 2010 sanken sie nach aktuellen Angaben des Müttergenesungswerks (MGW) um fast zehn Prozent von 316,7 Millionen auf 287,6 Millionen Euro. Dafür sorgt nach Meinung des MGW die in den letzten Jahren noch leicht angestiegene Erstablehnungsquote von durchschnittlich 34% im Jahr 2009. Dass diese Ablehnungen nicht nur aus berechtigten Gründen erfolgen, zeigt sich darin, dass in den rund 14.800 Widerspruchsverfahren mehr als die Hälfte der Ablehnungen unbegründet gewesen sind.
Nachdem sich nun auch noch der Bundesrechnungshof in die Überprüfung des Ablehnungs- und Bewilligungsgeschehen bei Mutter-Kindkuren (MKK) eingeschaltet hat (seitdem die GKV Steuerzuschüsse erhält, kann der Rechnungshof überprüfen wie in der GKV mit den Einnahmen umgegangen wird), wird die Debatte sicherlich noch eine Weile anhalten.
Wie bei vielen Finanzierungsdebatten verliert die Frage, welchen Nutzen die Versorgungsmaßnahmen haben und was man durch ihre Ablehnung qualitativ bewirkt, an Bedeutung. Sie wird bis auf wenige Ausnahmen kaum mehr gestellt und auch Antworten werden Mangelware.
Eine Ausnahme sind die Ergebnisse einer umfangreichen und tiefschürfenden Befragung von rund 500 versicherten Müttern (die sehr wenigen Väter wurden nicht in die Auswertung aufgenommen) der Handelskrankenkasse (hkk) Bremen, die 2009 eine stationäre MKK bewilligt und in Anspruch genommen hatten.
Zu den wichtigsten Informationen, die aus den 274 beantworteten Fragebögen gewonnen werden konnten, zählen
• der hohe gesundheitliche Bedarf, der die Mütter veranlasste, eine MKK zu beantragen: 47% der Mütter bezeichneten ihren Gesundheitszustand (physisch wie psychisch) vor Antritt der Kur als "mangelhaft" und weitere 14% als "schlecht". Die beste Schulnote für ihre Gesundheit war ein "befriedigend". Der gelegentlich geäußerte Verdacht, die MKK würde von eigentlich gar nicht bedürftigen Personen als eine Art Kurlaub in Anspruch genommen entbehrt also jeglicher Substanz.
• die proportionale Inanspruchnahme der MKK durch Mütter und Kinder aus unteren sozialen Schichten, d.h. der Bevölkerungsgruppe, die auch hier einen sehr hohen Bedarf hat.
• die hohe subjektiv wahrgenommene Wirksamkeit der MKK. Alles in Allem äußerten sich 75% der Teilnehmerinnen sehr zufrieden oder zufrieden. Unmittelbar nach der Heimkehr gaben 90% eine Verbesserung ihres vorherigen gesundheitlichen Zustands an. Und auch noch ein Jahr nach Ende der MKK bewerteten 30% der Teilnehmerinnen ihren Gesundheitszustand noch um eine Note besser als vor Beginn der MKK. Die Noote lag bei 43% um 2 Stufen über der vor Maßnahmebeginn.
• auch die Verbesserung bei objektiven Indikatoren des Gesundheitszustandes wie der Anzahl von Arztkontakten, ärztlichen Therapien und des Körperzustands. Weniger Veränderungen zeigten sich dagegen beim Gesundheitsverhalten der Mütter und im Bereich der eher psychischen Beeinträchtungen und
• positive gesundheitliche Effekte bei Kindern, sofern auch für sie altersgerechte Kurpläne erstellt werden.
Die Befragung förderte auch eine Reihe von meist einfach zu vermeidenden Schwachstellen und Defiziten der MKK zu Tage. Die Teilnehmerinnen nannten dabei vor allem folgende Details:
• Die Informationen über die Ziele und den angestrebten und gesicherten Nutzen sollten in verständlicher Form vor Antritt der MKK vorliegen. Dies gilt auch für Informationen über den Tagesablauf.
• Insgesamt plädieren die Mütter für die Vorlage eines Therapieplans. Ein Therapieplan erscheint den Müttern auch für ihre Kinder als vorteilhaft.
• Eines der größten Defizite sehen die Mütter in zu wenig Informationen oder Angeboten eines Nachsorgeprogramms. Dies wurde nur 17% angeboten und damit auch nur von sehr wenig Müttern in Anspruch genommen.
Der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Marstedt fasst den Nutzen der von ihm mit der Befragung evaluierten MKK so zusammen: "Die positiven gesundheitlichen und versorgungsökonomischen Effekte … der MKK (sind) sowohl in der Höhe als auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit so hoch wie bei vielen anderen weit häufiger in Anspruch genommenen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung."
Dass MKK zu Unrecht und wesentlich häufiger als viele andere GKV-Leistungen nicht bewilligt werden, sollten sich diejenigen Kassenverantwortliche, die glauben damit nutzlose Leistungen zu verweigern und wirtschaftlich zu handeln, nach der Lektüre der hkk-Mütterbefragung noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen.
Die Ergebnisse der Mütter, die eine MKK in Anspruch genommen haben, sind als 17 Seiten umfassender und materialreicher Teil 2 Mutter/Vater-Kind-Kuren: Erfahrungen der hkk-Versicherten des hkk-Reports "Aspekte der Versorgungsforschung 2011" veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.6.11
Gute Kommunikation zwischen Arzt und Patient verbessert auch in der Rehabilitation den Therapieerfolg
 Eine große Zahl von Studien hat bereits aufgezeigt, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient mitentscheidenden Einfluss auf den weiteren Therapieverlauf hat. Eine vertrauensvoller und intensive Kommunikation erhöht die Adhärenz (Befolgung der Medikamentenverordnung), stärkt die Selbstwirksamkeits- oder Kontrollerwartung für eine Rekonvaleszenz, verbessert Kenntnisse über die Krankheit und ihre Ursache. Dass diese Zusammenhänge nicht nur für den Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung, sondern auch für stationär durchgeführte Rehabilitationsmaßnahmen gelten, hat jetzt eine deutsche Studie gezeigt, die in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurde.
Eine große Zahl von Studien hat bereits aufgezeigt, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient mitentscheidenden Einfluss auf den weiteren Therapieverlauf hat. Eine vertrauensvoller und intensive Kommunikation erhöht die Adhärenz (Befolgung der Medikamentenverordnung), stärkt die Selbstwirksamkeits- oder Kontrollerwartung für eine Rekonvaleszenz, verbessert Kenntnisse über die Krankheit und ihre Ursache. Dass diese Zusammenhänge nicht nur für den Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung, sondern auch für stationär durchgeführte Rehabilitationsmaßnahmen gelten, hat jetzt eine deutsche Studie gezeigt, die in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurde.
Im Zentrum der Studie standen Befragungen von anfänglich 470 Patienten aus sieben nordwestdeutschen Rehabilitationskliniken, die zu Beginn ihrer Rehabilitation, im weiteren Verlauf und schließlich noch einmal 6 Monate nach der Entlassung Auskunft gaben über die erlebte Qualität der Kommunikation mit dem für sie hauptsächlich zuständigen Arzt. Vollständige Datensätze standen nach einem halben Jahr noch für 295 Patienten zur Verfügung. Die Stichprobe war nach Aussage der Wissenschaftler recht typisch für eine Reha-Klinik: 66% waren männlich, 63% waren Arbeiter, ebenso viele hatten höchstens einen Hauptschulabschluss, das Durchschnittsalter lag bei 50 Jahren.
Zur Bewertung der Arzt-Patient-Kommunikation wurde ein spezieller Fragebogen verwendet (der "P.A.INT-Fragebogen", Abkürzung für Patient-Arzt-Interaktion) der verschiedene Aspekte der Interaktion erfasst, und zwar unter anderem die emotionale Qualität des Kontakts, die instrumentelle Qualität (auf der Basis von Information und Feedback) sowie auch die Partizipation des Patienten und sein Einbezug in den Prozess des Shared Decision Making. Darüber hinaus wurden in den späteren Befragungen nach der Entlassung auch verschiedene Indikatoren zum Gesundheitszustand erhoben. 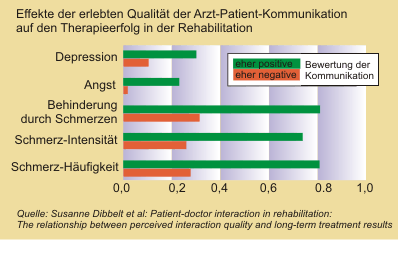
Auf der Basis der Fragebogen-Antworten zu Beginn der Studie wurden die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt, solche mit einer eher positiven und solche mit einer eher negativen Bewertung der Kommunikation mit ihrem Reha-Arzt. Im Vergleich dieser beiden Gruppen zeigten sich dann sechs Monate nach der Entlassung ganz erhebliche Unterschiede, was den Gesundheitszustand und damit Therapieerfolg anbetrifft. Besonders deutlich zeigte sich dies bei den Merkmalen: Häufigkeit von Schmerzen, Intensität von Schmerzen, Behinderungen im Alltag durch Beschwerden, Ängste, Depressivität. (vgl. Abbildung)
Hier ist ein Abstract der Studie: Susanne Dibbelt et al: Patient-doctor interaction in rehabilitation: The relationship between perceived interaction quality and long-term treatment results (Patient Education and Counseling. Volume 76, Issue 3, 2009, Pages 328-335, doi:10.1016/j.pec.2009.07.031)
Gerd Marstedt, 27.1.10
Von der Langsamkeit der Implementation und des Wirksamwerdens evidenter Behandlungs-Leitlinien. Ein Beispiel aus "down under".
 Trotz ausreichender wissenschaftlicher Evidenz für wirksame Behandlungsweisen selbst häufiger Krankheiten und entsprechenden Behandlungsleitlinien medizinischer Fachgesellschaften, erhalten diese gerade die Zielpersonen mit dem größten Bedarf am seltensten oder gar nicht.
Trotz ausreichender wissenschaftlicher Evidenz für wirksame Behandlungsweisen selbst häufiger Krankheiten und entsprechenden Behandlungsleitlinien medizinischer Fachgesellschaften, erhalten diese gerade die Zielpersonen mit dem größten Bedarf am seltensten oder gar nicht.
Dass dies so ist und offensichtlich auch ein weltweites Problem darstellt, zeigt ein am 30. Dezember 2009 in der Fachzeitschrift "Australia and New Zealand Health Policy" veröffentlichter Aufsatz über die Versorgung der australischen Aborigines und einer weiteren ethnischen Ureinwohnergruppe (der "Torres Strait Islander people") mit rehabilitativen und sekundärpräventiven Maßnahmen für Herzkranke. Kardiovaskuläre Erkrankungen stellen die Hauptursache der frühzeitigen Sterblichkeit dieser indigen Bevölkerungsgruppen Australiens dar. Anders als in der weißen Bevölkerung Australien nimmt die Inzidenz koronarer Herzkrankheiten bei der indigenen Bevölkerung nicht ab, sondern bis in die Gegenwart hinein sogar zu. Zugleich gibt es ausreichende Evidenz für die Wirksamkeit und den Nutzen kardiologischer Rehabilitation und sekundärpräventiver Interventionen für die Erkrankungsverläufe und die Sterblichkeit an diesen Krankheiten.
Deshalb publizierte das "National Health and Medical Research Council (NHMRC)" 2005 die Leitlinie "Strengenthing Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples". Sie sollte in übersichtlicher Listenform vor allem Angehörigen der für Rehabilitation und Sekundärprävention zuständigen Gesundheitsdienste Anleitung für gezielte, spezielle rehabilitative Angebote für herzkranke Aborigines an die Hand geben.
Um zu erfahren wie die Leitlinie im Versorgungsalltag angekommen ist, befragten Gesundheitswissenschaftler zwischen Ende 2007 und Mitte 2008 in halbstrukturierten mündlichen Interviews 24 Gesundheitsprofessionals aus 10 ländlichen und 7 städtischen Gesundheitsdiensten in Westaustralien nach ihrer Wahrnehmung der Leitlinie in ihrem beruflichen Alltag und den möglichen Barrieren oder Förderfaktoren für eine leitliniengerechte Behandlung der an Herzerkrankungen leidenden Ureinwohner.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• Nur 25 Prozent der befragten Spezialisten für diese Versorgungsangebote berichteten, die Leitlinien erhalten zu haben. Von diesen Befragten konnten sich dann aber nur wenige an spezifische Elemente oder Empfehlungen erinnern oder angeben, wie sie versucht hatten, die Ansätze in ihrer beruflichen Umgebung zu implementieren.
• Durchweg nur Minderheiten der Befragten (maximal 30 Prozent) hatten spezielle Kontakte und gemeinsame Aktivitäten mit dem "Aboriginal Medical Service (AMS)" oder waren an Überweisungen von Erkrankten in die Rehabilitation beteiligt. Knapp 9 Prozent gaben an, beim Design und der Art und Weise der Gewährung von kardiologischer Rehabilitation Inputs von Aborigines-Gemeinden berücksichtigt zu haben.
• Von den Rehabilitationsexperten, die überhaupt indigene PatientInnen während eines Krankenhausaufenthalts aufsuchten, sprachen 29 Prozent mit den PatientInnen über die Wichtigkeit von Rehabilitation. Die Mehrheit der für Rehabilitation und Sekundärprävention verantwortlichen Befragten hatte keinen Einblick in die stationäre Krankheits- und Behandlungsgeschichte dieser PatientInnen und hatte keinen Zugang zu spezifischen Erziehungsprogrammen der indigenen Personen. Nur eine kleine Minderheit verfügte daher auch über Programme und Versorgungskonzepte welche die spezifische Kultur der Aborigines berücksichtigten.
• Aber auch andere Leistungserbringer wie beispielsweise Ärzte aus "tertiary hospitals" welche PatientInnen weiter betreuten, die nach einem kardiologischen Krankheitserlebnis in ihre Wohnumgebung zurückkehrten, nahmen Kontakt zu den Rehabilitationsexperten auf. Nur 8 Prozent von ihnen berichteten von solchen Kontaktaufnahmen. Nur einer der Interviewten berichtete von einem speziellen nachstationären Mentorenprogramm, das u.a. mit Bildungsmaterialien arbeitete, die auf die speziellen subjektiven und objektiven Bedingungen der indigenen PatientInnen eingingen.
• 54 Prozent der Befragten hatten Zugang zu verantwortlichen Vertretern der beiden Ureinwohnergruppen, was ein Haupthindernis darstellt, diese Bevölkerungsgruppen in die Versorgung einzubeziehen.
• Zu den Barrieren, welche den Zugang der indigenen PatientInnen zu den hier betrachteten Leistungen verhinderten, zählten die befragten Leistungserbringer deren familiäre Verpflichtungen und Restriktionen, den Mangel an Bewusstsein über erhältliche Leistungen, Mangel an Transportmöglichkeiten oder finanzielle Hindernisse. Viele der Leistungserbringer bieten ihre Leistungen auch nur zeitlich begrenzt an und verschlimmern damit die Zugangsschwierigkeiten durch lange Anreisewege.
• Alles in Allem fanden die ForscherInnen in Westaustralien keinerlei Hinweise auf systematische Implementationsstrategien oder Strategien zur Bewertung des Versorgungsergebnisses.
• Last not least spielen natürlich die extrem schlechten sozialen und gesundheitlichen Bedingungen der indigenen Minderheiten in Australien eine Rolle. Sie sind wesentlich durch die jahrhundertelangen politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Interventionen der weißen Mehrheit in Australien geprägt.
Zu den auch hierzulande relevanten Schlussfolgerungen der australischen WissenschaftlerInnen für eine erfolgreichere Implementation, Verbreitung und Nutzung von evidenten Behandlungs-Leitlinien im Gesundheitswesen gehört die Erkenntnis, dass dies komplexe Prozesse mit vielen Facetten sind und gleichzeitig subjektive (z.B. Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit zwischen Akteuren unterschiedlicher Versorgungssektoren) und objektive (z.B. Umgang mit Stadt-Land-Gefälle) Bedingungen des Gesundheitssystems, der Patienten und der Leistungserbringer beachtet werden müssen. Klar ist auch: "No one single strategy is adequate."
Dass selbst solche Hinweise noch lange keine Handlungen auslösen müssen, zeigen die AutorInnen indirekt. Iht Hinweis, man könne durch eine Beteiligung von Patienten und Leistungserbringern an der Entwicklung der technischen Umsetzung von Leitlinien und durch materielle oder immaterielle Anreize eine erfolgreiche Implementation erreichen, stützt sich nämlich auf die Ergebnisse von Studien aus den 1990er Jahren, die offensichtlich noch nicht in das Repertoire der Selbstverständlichkeiten gesundheitspolitischer Interventionen eingegangen sind.
Auch wenn diese Studie eine Reihe methodischer, quantitativer und Repräsentations-Grenzen aufweist, demonstriert sie das Risiko allein auf Selbstläufer, "magic buletts" oder "Patentrezepten" zu vertrauen und die Notwendigkeit wie den potenziellen Nutzen identischer oder auch aufwändigerer Studien über die Umsetzung und Wirkung von Leitlinien auch in Deutschland.
Der 16 Seitenaufsatz "Are the processes recommended by the NHMRC for improving Cardiac Rehabilitation (CR) for Aboriginal and Torres Strait Islander people being implemented?: an assessment of CR Services across Western Australia von Thompson SC, DiGiacomo ML, Smith JS, Taylor KP, Dimer L, Ali M, Wood MM, Leahy TG und Davidson PM ist am 30. Dezember 2009 in der Fachzeitschrift "Australia and New Zealand Health Policy" (2009, 6:29) und in einer provisorischen PDF-Fassung komplett erhältlich.
Bernard Braun, 3.1.10
Folgen schwerer Unfälle langwieriger, schwerer und vielfältiger als erwartet. Reha und ambulante Betreuung verzahnen!
 In einer weltweit einmaligen Längsschnittstudie untersuchten Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zusammen mit einem Personen-Rückversicherungsunternehmen seit 2000 die Krankheits- und Lebensverläufe von 1.148 so genannten Polytrauma-Patienten (Patienten, die mehrere schwere Verletzungen verschiedener Körperregionen oder Organe haben, die einzeln oder in Kombination lebensbedrohlich sind) an der MHH.
In einer weltweit einmaligen Längsschnittstudie untersuchten Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zusammen mit einem Personen-Rückversicherungsunternehmen seit 2000 die Krankheits- und Lebensverläufe von 1.148 so genannten Polytrauma-Patienten (Patienten, die mehrere schwere Verletzungen verschiedener Körperregionen oder Organe haben, die einzeln oder in Kombination lebensbedrohlich sind) an der MHH.
Die so genannte "Hannover Polytrauma Langzeitstudie (HPLS)" beleuchtete neben den medizinischen Aspekten auch das soziale Umfeld, den Beruf, die Rentensituation, Sport und Hobbys der Patienten, die finanzielle Situation, Rehabilitationsmaßnahmen und Versicherungsbelange.
In einer ersten Zwischenbilanz im Jahr 2003 wurden bereits die folgenden - aktuell bestätigten - Ergebnisse veröffentlicht, die sich auf die Daten von 637 überlebenden PatientInnen stützen konnten:
• Besonders auffällig waren soziale Probleme. Fast die Hälfte der Patienten hatte nach dem Unfall weniger Freunde als zuvor, bei mehr als 60 % schränkten die Unfallverletzungen die Freizeitaktivitäten ein. Nahezu 40 % beklagten, dass ihre Partnerschaft oder das Familienleben unter den Folgen des Unfalls gelitten haben. Eine gleich hohe Zahl steht nach der Schwerstverletzung finanziell schlechter da als vor dem Unfall.
• Die Verletzungen wirkten sich auch gravierend auf das Berufsleben aus. 16,6 Prozent der Patienten mussten umgeschult werden, und etwa 20 Prozent waren als Folge des Unfalls erwerbsunfähig und mussten in Rente gehen. Für die Berufsunfähigkeit waren meist Verletzungen des Beckens oder der unteren Extremitäten verantwortlich. 30 Prozent der Patienten waren in Folge des Unfalls arbeitslos geworden. Wenn es den Betroffenen gelungen war, in das Berufsleben zurückzukehren, dauerte die Rehabilitation länger als zwei Jahre. Trotz der negativen Einflüsse bewerteten die Teilnehmer ihre derzeitige Situation als gut oder befriedigend. Gleichwohl berichteten 56 Prozent der Patienten über Probleme mit ihrer Lebenssituation nach dem Unfall.
Die Studie gab eindeutige Hinweise, dass die bis dahin landläufige Schätzung, nach einer solchen schweren Verletzung sei eine Rehabilitationszeit von maximal zwei Jahren notwendig, unrealistisch ist. Außerdem wurde klar, dass auch die beste Medizin nur einen Teil der Folgeprobleme beheben kann.
Die Forscher hoben in ihren jüngsten Äußerungen, die in einem Artikel der "Ärzte Zeitung" vom 6.2.2007 enthalten sind, folgende Aspekte besonders hervor:
• "Die Unfallfolgen sind auch noch nach zehn oder 15 Jahren viel gravierender als wir bislang geglaubt haben."
• Laut der Studie stieg die Arbeitslosigkeit bei den Männern nach dem Unfall von 6,9 Prozent auf 30 Prozent, die der Frauen von 5,5 Prozent auf 27,6 Prozent.
• Zu den langfristigen finanziellen und beruflichen Folgen der Unfälle trug nach Erkenntnissen der Forscher auch eine fehlende Verzahnung zwischen medizinischer Rehabilitation und anschließender ambulanter Betreuung bei.
• Von den 511 nach ihrer Entlassung aus der Akutbehandlung in der MHH gestorbenen PatientInnen starben 24 % an Herzerkrankungen, 22 % an erneuten Traumata sowie 10 % an Suiziden.
Bernard Braun, 9.2.2007
2004: Jeder zehnte Bundesbürger behindert - und auch gut versorgt?
 Zum "Internationalen Tag der behinderten Menschen" am 3. Dezember veröffentlichte das "Statistische Bundesamt" die Mikrozensus-Daten über Behinderte im Jahr 2005. Danach gab es in Deutschland 2005 8,6 Millionen Personen mit einer amtlich anerkannten Behinderung, d.h. rund ein Zehntel der Einwohner Deutschlands waren in irgendeiner Weise behindert. Dieser Anteil steigt in den letzten Jahren: Seit 1999 um 6 %. Entgegen manchen Annahmen war der größte Teil der Behinderten, nämlich 6,7 Millionen, schwer behindert. Dies sind Personen, deren Grad der Behinderung mindestens 50 % beträgt. Behinderte unterscheiden sich beim Familienstand, beim Grad der Erwerbstätigkeit und Ort der Erwerbstätigkeit und bei vielen anderen Merkmalen von Nichtbehinderten gleichen Alters.
Zum "Internationalen Tag der behinderten Menschen" am 3. Dezember veröffentlichte das "Statistische Bundesamt" die Mikrozensus-Daten über Behinderte im Jahr 2005. Danach gab es in Deutschland 2005 8,6 Millionen Personen mit einer amtlich anerkannten Behinderung, d.h. rund ein Zehntel der Einwohner Deutschlands waren in irgendeiner Weise behindert. Dieser Anteil steigt in den letzten Jahren: Seit 1999 um 6 %. Entgegen manchen Annahmen war der größte Teil der Behinderten, nämlich 6,7 Millionen, schwer behindert. Dies sind Personen, deren Grad der Behinderung mindestens 50 % beträgt. Behinderte unterscheiden sich beim Familienstand, beim Grad der Erwerbstätigkeit und Ort der Erwerbstätigkeit und bei vielen anderen Merkmalen von Nichtbehinderten gleichen Alters.
Für die Art und den Umfang sozialstaatlicher Leistungen und Strukturen, die der "Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft" (§ 1 SGB IX) dienen, existiert seit 2001 das Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) mit dem programmatischen Titel "Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen".
Wie es mit der Umsetzung dieses innovativen und auch für Nichtjuristen lesenswerten und für sozialpolitische Debatten über Koordination und Kooperation sowie dem Primat der Bedarfsgerechtigkeit nutzbaren Gesetzes aussieht, kann u.a. auf der Homepage des "Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der behinderten Menschen" jeweils aktuell verfolgt werden.
Anlässlich der Veröffentlichung des letzten der regelmäßigen "Behindertenberichte" der Bundesregierung, dem Bericht der Bundesregierung zur Lage behinderter Menschen und der Entwicklung ihrer Teilhabe 2004, gab es erhebliche Divergenzen zwischen gesetzlichen Vorgaben und der Wirklichkeit:
• Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Karl Hermann Haack, stellte in einer Presseerklärung anlässlich einer Bundestagsdebatte am 12. Mai 2005 fest, "dass es bei der Umsetzung gerade des SGB IX durch die Rehabilitationsträger und die Bundesländer noch entscheidende Defizite gibt. Beispielhaft sind hier die Bereiche Frühförderung, Servicestellen und Eingliederung behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt zu nennen, in denen Kostenschiebereien und Kompetenzgerangel von den Verantwortlichen in Ländern und Kommunen und durch die staatsferne Sozialverwaltung gesetzeswidrig auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden."
• In der Bundestagsdebatte selber stellte er noch kritischer fest: "Die meisten Rehabilitationsträger benehmen sich hingegen als sei gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung behinderter Menschen eine obrigkeitsrechtliche ge- oder verwehrte Gnade. Es ist die Aufgabe von uns allen, die wir politisch verantwortlich sind, noch klarer als bisher zu machen, dass wir hier über gesetzlich verbriefte Ansprüche und Rechte sprechen, ja mehr noch, meine Damen und Herren: Teilhabe, Selbstbestimmung und Gleichstellung sind Bürger- und Grundrechte!"
Bernard Braun, 2.12.2006